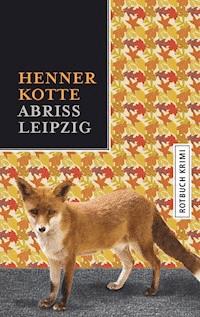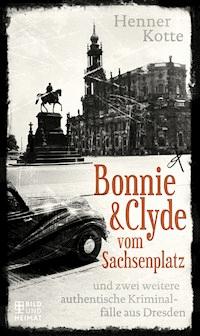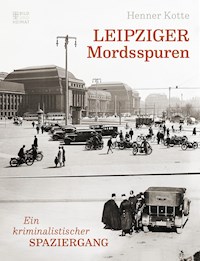Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Nach dem tödlichen Ende eines Geiseldramas in Leipzig ist der Druck auf die Polizei groß und Kommissar Miersch wird vorsorglich aus der Schusslinie gezogen. Ruhe und Erholung glaubt der Bayer in der sächsischen Provinz zu finden. Daraus wird nichts, als er sich sein Zimmer ausgerechnet in dem Gasthof nimmt, wo vor über zwanzig Jahren ein bestialischer Sexualmord verübt wurde. Bis heute gibt das Verbrechen Rätsel auf: Warum hat der Täter dem Mädchen die Augen ausgestochen? Und warum mussten auch der Gastwirt und sein einziger Sohn sterben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henner Kotte
Augen für den Fuchs
Kriminalroman
Rotbuch Verlag
eISBN 978-3-86789-609-2
1. Auflage
© 2010 by Rotbuch Verlag, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Umschlagabbildung: Fotolia, PiusK
Rotbuch Verlag GmbH
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
www.rotbuch.de
Ich rieche meinen Schweiß. Er läuft mir den Rücken hinunter, er kitzelt die Achseln. Mein Atem ist hörbar, er rauscht mir in den Ohren. Das Herz klopft. Ich sehe sie vor mir, die Zarten, die Eleganten, die Unvergleichlichen. Grazil. Makellos. Weiß. Genauso sehen die Traumfrauen im Fernsehen aus. Das schönste Gesicht des Sozialismus! Emöke und Susan. Die Girls vom Fernsehballett. Vom Friedrichstadtpalast. Und die Kati, die Witt. Sie tanzt so bezaubernd. Kati war die liebende Maria der West Side Story. Sie hat uns alle bezaubert. Mich ganz besonders. Sie hat gesiegt, unser Goldmädel!, und hat es allen gezeigt. Maria! Maria! Maria! Reporterlegende Heinz Florian Oertel kriegte sich kaum ein vor Stolz auf diese Frau: Unsere Goldmaria!
Genau wie Kati sieht sie aus, die da oben im Zimmer. Genauso sieht sie aus, dieses Mädchen. Die Hure. Maria! Ich kann tun, was ich will, sie bleibt in meinen Gedanken. Sie verschwindet nicht, geht nicht raus.Sie bleibt mir im Kopf, ist da, bleibt da. Ah! Ich habe sie immer in mir. Immer. Sie tanzt. Sie lächelt. Sie zieht sich aus. Sie stöhnt. Ah! Ja, ich höre sie stöhnen. Überlaut. Sie schreit, in meinem Kopf schreit sie wieder und wieder. Oh! Maria! Maria! Maria!
Ich steige Stufe um Stufe, die Treppe ist steil. Das Knarren verschluckt der Teppich. Neu gekauft, kein Jahr alt. Ornamente wie beim Kalifen. Und oben dieses Weib, sie ruft, sie brüllt nach mir. Maria! Ich komme, ich komme, schreie ich ihr lautlos entgegen. Keine Angst, wir werden unseren Spaß haben. Jetzt! Sofort! Sie lächelt nicht mehr. Sie ahnt wohl das Ende. The most beautiful sound I ever heard … Die Nadel hängt. Maria! Maria! Maria! Endlos. All the beautiful sounds of the world in a single word … Als wäre in meinem Kopf dieser Sprung. Maria! Maria! Maria! Ich halte dagegen. Ich gehe nicht unter. Keiner kriegt mich klein. Sie erst recht nicht. Ich habe meinen Auftritt noch einmal geprobt. I never stop saying … Sie soll ihren Spaß haben. Sie soll nicht leiden. Maria! Aber sie hat es so gewollt. Ich kann nichts dafür. Ihr Huren! Ihr Fotzen! Warum tut ihr mir das an? Mir! Oh! Maria! Maria! Maria!
Ich werde meiner Erregung nicht Herr. Mein Schritt reibt. Ich muss mir in den Hosenschlitz fassen. Kolbendick pulsiert dieser Knorpel, mein Fleisch. Ich stelle sie mir vor. Schlafend. Frisch gewaschen. Duftend. Florena! Ich weiß, dass es schnell gehen wird. Viel zu schnell wird es vorbei sein. Viel zu schnell kommt der point of no return. Stunden müsste er dauern. Tage. Nie aufhören dürfte er. Nie. Aber auch jetzt, hier drinnen bei ihr, wird alles wie nie gewesen sein. Ich könnte weinen. Dieses Weib ist dann tot. Ah! Maria! Maria! Maria! Sie darf nicht schreien. Sie darf mich nicht erkennen. Sie muss tot sein und schweigen. Für immer tot, oh, Maria, ganz tot. Ich kann es nicht ändern. Sie hat es so gewollt. Genau so. Sie hat gesungen, sie hat getanzt, und sie hat gelacht wie die Kati. Maria! Immer wieder hat sie nach mir geschrien. Warum hat sie sich in meine Gedanken gestohlen? Warum muss sie hier bei mir schlafen, wo ich ihr nicht aus dem Weg gehen kann? Warum? I’ve just met a girl named Maria …Doch warum sonst ist sie hierhergekommen? Meinetwegen! Sie will zu mir! Nur deshalb ist sie hier. Sie will, und ich will. Ein bisschen wird ihr Tod auch mein Tod sein. The most beautiful sound I ever heard … So schön wird es nie wieder. Es ist das Ende. Der Anfang.
Meine Hände sind feucht. Ich muss mich konzentrieren. Ich rieche den Angstschweiß durch ihre Tür. Ich schmecke ihre Haut. Sie duftet. Florena und Spee vom Bezug. Friedlich sieht sie aus, wie sie daliegt. Ich muss es tun. Es gibt keinen anderen Ausweg. Sie tut mir wirklich sehr leid. Doch das wird sie mir nicht glauben.
Das Blut färbt das Laken, läuft in den Teppich, versickert. Aber wozu ist sie mir hier erschienen? Warum sonst schläft sie hier in unserem Haus? Maria! Maria! Maria! Meine Erregung lässt mir keine Wahl. Der Atem sticht durch meine Lunge. Meine Hose pocht, platzt. Ich schließe die Augen, ich öffne die Tür. Sie knarrt nicht mehr. Ich habe sie gestern geölt.
Das Messer reibt an meinem Schenkel. Es gibt mir Sicherheit. Mein Puls rast. Schweiß brennt mir in den Augen. Töpfeklappern und Lachen – Geräusche dringen aus Küche und Gastraum. Drei Pils! Wodka Cola! Jeden Moment kann mich einer vor ihrer Tür entdecken. Ah! Maria! Maria! Maria! Jeden Moment kann jemand die Treppe heraufkommen. Ihr Zimmer ist dunkel. Ich drücke den Schalter. Das Licht taucht alles in Weiß. So muss das Jenseits aussehen. Weißer als weiß, heller als die Sonne.
Ihr Bett steht im Eck. Am Fenster bewegt der Wind sacht die Gardine. Sie schläft. Sie vertraut mir. Sie will nicht schreien. Sie muss es nicht. Die Klinge blitzt, als sie in den Hals schneidet. Blut läuft mir über die Finger. Rot, röter, braun, schwarz. Das Mädchen öffnet die Augen. Maria! Die Kati in Todesangst.Das schönste Gesicht des Sozialismus! Sie reißt den Mund auf. Greift mir in den Arm. Auf ihren Lippen zerplatzen Blasen. Sie gurgelt. Ein Laut, als wäre ein Hirsch in der Brunft. Scheiße! Verdammte Scheiße! Meine Traumfrau entschwindet mir, schreit, stürzt zur Tür. Maria! Maria! Maria! Sie will mich verraten! Warum nur? Dieses Biest! Diese Hexe! Sie hat mich doch selbst eingeladen. Sie wollte es. Ich will es. Jetzt!
Meine Hand liegt auf ihrem Mund. Sie beißt, fuchtelt mit den Armen. Es ist kein Spiel mehr. Sie hat alles verdorben. Schlampe! Das Messer liegt irgendwo. Ich reiße ihr das schöne Köpfchen nach hinten. Es knackt. Und das Blut läuft und läuft. Meine Hände sind nass, glitschig. Maria! Du, meine Kati! Sie rutscht in sich zusammen. Ein Gliederpüppchen, das ich zum Bett schleifen muss. Sie liegt da, als würde sie schlafen. Aber die Augen. Ihre Augen! Sie gaffen. Sie haben alles gesehen. Sie sehen mich. Sie erkennen mich wieder. Irgendwann werden sie mich auch verraten.
Ich hebe das Messer neben dem Bett auf. Kati röchelt. Marias Blut spritzt auf das Laken, die Steppdecke, die schöne Tapete. Ich drücke meine Hand auf die Wunde. Kati soll nicht auslaufen, wenn ich mit ihr schlafe. Ich will die ganze Frau, keinen Hautsack. Warum tut sie mir das an? Liebe ist rein. Kati macht alles dreckig. Ich schiebe ihr das Nachthemd über den Kopf. Sie lässt es geschehen. Sie schreit nicht. Kein Laut. Nichts. Es ist so weit. Lass es doch niemals vorbei sein!
Aber ihre Augen. Sie sehen alles. Wir sind nicht allein. Maria! Maria! Maria!
Ich greife zur Klinge und fahre dem Gliederpüppchen unter das Lid. Als würde man den Griebsch aus einem halben Apfel entfernen. Spitz zu und dann drehen. Ganz einfach. Ganz leicht. Ich werfe ihre Augen aus dem Fenster in den Garten. Die Hunde werden sie fressen. Oder der Fuchs. Jetzt ist Kati blind. Dunkle Höhlen. Ein Schlund.
Jetzt wartet die Kati. Endlich. Ich habe ihre Liebe verdient. Sie öffnet die Beine, Katharina. Ich bin daheim, in ihr drin, sie wehrt sich nicht mehr. Oh! Maria! Maria! Maria! Ich liebe dich!
Mörder! Monster! Menschenschlächter! Er hörte die Sprechchöre und blickte in die vorwurfsvollen Gesichter. Er hörte sich stammeln. Er sagte kein verständliches Wort. Zum Abschuss freigegeben! Sie waren kaum zwanzig! Es waren noch Kinder! Die Zeitungen hatten ihr Urteil gesprochen. Die Meute hatte sich auf ihn eingeschossen. Er war das gefundene Fressen. Kriminaldirektor Konstantin Miersch stand am Pranger und konnte der öffentlichen Wut nichts entgegenhalten. Die Fakten lagen klar: Er trug die Verantwortung für den Einsatz. Es war sein Job. Er gab die Befehle. Jetzt hatte es Tote gegeben, Verletzte.
Zwei junge Männer, Philip Thede und Robert Zehmisch, hatten die Gäste eines Restaurants gekidnappt und waren mit Geiseln und erpresstem Lösegeld über die Grenze geflohen. Ja, es stimmte: Er, Konstantin Miersch, hatte den tödlichen Fangschuss befohlen. Zumindest hatte er ihm als letztes Mittel, Gefahr abzuwenden und Leben zu retten, zugestimmt. In den Bergen Serbiens waren die Flüchtenden mit Gewalt gestoppt worden. Das Auto hatte gebrannt. Alle Insassen konnten lebend geborgen werden. Die letzte Geisel überlebte schwer verletzt. Robert Zehmisch verstarb im Armeekrankenhaus Prizren. Philip Thede vegetierte im Wachkoma. Miersch konnte das Leid und die Wut der Familien der Geiselnehmer verstehen. Die Hetzjagd auf ihn, den Kriminaldirektor, verstand er nicht.
Mörder Miersch! Täter vor Gericht! Die Mutter des hirntoten Philip Thede hatte zum Krieg gerüstet. Journalisten berichteten gierig vom Kampf der Frau um die Rehabilitation ihres Kindes. Den komatösen Sohn hatte sie publikumswirksam ins Pflegeheim einweisen lassen. Die Mutter barmte öffentlich: Allein ist’s nicht zu schaffen! Robert Zehmisch war unter großer medialer Anteilnahme bestattet worden. Mutti Thede weinte wie ums eigene Kind. Woher nimmt diese Frau ihre Kraft?, fragte Kriminalreporter Joseph Hönig auf Seite eins. Fast in Vergessenheit geriet die Schuld dieser Jungen. Dabei waren sie Mörder.
Konstantin Miersch stellte sich den Fragen der Journalisten. Er leugnete seine Verantwortung nicht. Ja, er hatte die Leitung der Aktion innegehabt. Doch Miersch saß in Leipzig, war nicht vor Ort gewesen. Bei einer Verfolgung über die Landesgrenzen hinaus konnte die hiesige Kriminalpolizei die Entscheidungen nur in die Hände der dortigen Kräfte legen. Das hatte Miersch getan. Die Kollegen vor Ort hatten gehandelt. In Prag, Budapest, Belgrad. Europaweite Zusammenarbeit. Nach Mierschs Eindruck hatten alle besonnen und befehlsgetreu reagiert. Dann hatte das Fluchtauto in den serbischen Bergen einen auf der Straße befindlichen Traktor gerammt, war ins Schleudern geraten, explodiert und ausgebrannt. Unter Lebensgefahr waren die Insassen gerettet worden. Die Verantwortlichen beteuerten, dass sie das Hindernis den Flüchtenden nicht absichtlich in den Weg geschoben hätten. Ein tragischer Unfall. Miersch zweifelte nicht an dieser Wahrheit. Aber die Presse hatte jeden seiner Befehle bis ins kleinste Detail recherchiert. Als letztes Einsatzmittel ist von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Ja, er hatte diesen Befehl gegeben. Die Schusswaffe als letztes Mittel! Von ihr war nicht Gebrauch gemacht worden. Der tragische Ausgang war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Aber damit wäre es keine Schlagzeile für Joseph Hönig und Seite eins gewesen.
Mörder! Monster! Menschenschlächter! Seit Wochen verfolgten Miersch diese Rufe. Er schlief unruhig. Alpträume quälten ihn. Er lag schweißgebadet im Bett. Am Morgen war das Laken verrutscht und feucht wie ein Handtuch nach der Dusche. Er gestand sich ein, dass er fertig war, am Ende, Burn-out. Mehrmals hatte er ans Aufgeben gedacht, alles hinschmeißen wollen. Er wäre längst weg, wenn ihm Abhauen nicht als Schwäche ausgelegt worden wäre, als Flucht vor der Verantwortung.
Sonntagmorgen. Die Uhr zeigte 7.30 Uhr. Miersch hatte bis zehn schlafen wollen. Die Woche war anstrengend und nervenaufreibend gewesen. Und Margo tat ein Übriges. Er glaubte, sie bereits in der Küche zu hören. Miersch schloss die Augen wieder. Es machte nichts besser. Regentropfen knallten ans Fenster.
Joseph Hönig war bei seiner Suche nach Sensationen auf Simona Thede gestoßen. Der Journalist witterte sofort die Chance auf eine gute Story. Tagelang hatte Simona auf den Zeitungsseiten gestanden. Glaube, Liebe, Hoffnung – Kampf einer Mutter um Gerechtigkeit. Hönigs Artikel hatte weitere nach sich gezogen. Neben Simona beherrschte Miersch nun die Schlagzeilen. Auch überregional und im TV. Kein Mitleid. Keine Regung. Der Mann ist eiskalt. Dass die Täter mehrere Tote auf ihrem Weg hinterlassen hatten, war weniger spektakulär als ein toter junger Mann, ein Verbrecher im Koma und eine Mutter, die kämpfte, um was auch immer. Miersch fühlte sich zum Freiwild erklärt. Er hatte nach den Gesetzen gehandelt. Robert Zehmisch und Philip Thede waren Mörder, und doch genossen sie momentan Heldenstatus und Sympathie. Es war zum Kotzen. Miersch stand allein. Die Unterstützung in Präsidium und Stadtparlament hielt sich in Grenzen. Eindeutig wollten sich weder Dezernent noch OBM zur Sache äußern. Bitte verstehen Sie, dass wir zu laufenden Untersuchungen gar nichts sagen. Und die ihm unterstellten Kollegen lernte er jetzt erst richtig kennen. Hengstmann und Schmitt, Bröer und Kohlund – Mierschsah, wie sie sich auf den Gängen das Lachen verbissen. Sie hatten ihn als Westimport in Leipzig niemals gewollt, jetzt sahen sie die Chance, ihn endlich loszuwerden. Selbst seiner Sekretärin misstraute Miersch.
7.40 Uhr. Er hatte es immer als Luxus empfunden, früh im Bett zu lesen. Es erinnerte ihn an die Ferienwochen im Dorf bei der Oma. Kühe auf Feldern. Hühnerkacke am Hacken. Der Wind rauschte in Bäumen. Kein Straßenlärm. Nichts. In der Bibliothek seines Großvaters hatte er Hans Dominik, Felix Dahn und Hans Fallada entdeckt. Morgens, wenn Oma frische Bäckersemmeln holte, las er. Manchmal bis Mittag. Doch heute lag neben seinem Bett kein Roman. Miersch konnte sich nicht erinnern, ob er in der Leipziger Wohnung jemals einfach nur zur Entspannung zu einem Buch gegriffen hatte. Fremde Welten, absurde Geschichten, er hätte schon lesen wollen … Aber die Arbeit. Der Stress. Gründe fanden sich immer. Auf dem Nachtschrank lagen die Zeitung von gestern und zwei Bücher, Kriminalistik und Die Geschichte der Deutschen Volkspolizei. Ein Gelegenheitskauf im Antiquariat und vielleicht ein Weg, die Kollegen besser kennenzulernen. Aber trotz der Lektüre waren ihm weder die DDR noch ihre altgedienten Mitarbeiter nähergekommen. Sosehr er sich mühte, er würde sie nie verstehen. Miersch blätterte.
Die Geschichte der Deutschen Volkspolizei versteht sich als Teil der Geschichte des Entstehens und der Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik, des zuverlässigen Schutzes der revolutionären Errungenschaften des werktätigen Volkes und des Kampfes zur Sicherung des Friedens.
Es war eine Fremdsprache, die sich schwerer las als die Direktiven der Polizeidirektion.
Mit den vorliegenden Bänden werden all jene gewürdigt, die mit ganzer Leidenschaft und Hingabe erstmalig in der deutschen Geschichte eine wahrhafte Polizei des Volkes geschaffen haben. Damit wird zugleich allen Volkspolizisten ein Denkmal gesetzt, die in Erfüllung ihres Klassenauftrages ihr Leben für den Schutz der Arbeiter-und-Bauern-Macht, für die Sicherheit der Bürger der DDR gaben.
Miersch zwang sich zur Aufarbeitung ostdeutscher Geschichte.
Es klopfte. Die Tür gab eigenartige Laute, dumpf, wie erstickt. Holz oder Kunststoff klangen anders. Presspappe, wahrscheinlich. Klopfte Margo? Sie hatte ihm sicher nicht den Frühstückstisch gedeckt.
»Es ist Sonntag!«, rief er.
»Eben.« Auch Margo schien schon am Morgen gereizt, und wahrscheinlich lag es an ihm. »Für dich! Telefon!«
»Komme!« Ihre Schritte entfernten sich. Schwerfällig quälte sich Miersch aus seinem Bett. Er hatte es neu gekauft, denn Margo nutzte das Schlafzimmer und beide Ehebetten. Manchmal begegnete er in der Wohnung ihren Liebhabern und fragte sich, ob sie von ihm einen Gruß erwarteten. Miersch drehte den Schlüssel im Zimmerschloss. Einer von Margos Besuchern hatte einmal die Türen verwechselt und war zu ihm unter die Decke gekrochen. Er hatte gebrüllt. Margo hatte gelacht und den Jungen mit in ihr Zimmer genommen.
Der Telefonhörer lag auf dem Bord unter der Garderobe. Fremde Mäntel am Haken entdeckte Miersch nicht. Die Klospülung rauschte.
In diesem Moment kam Margo aus der Küche. »Kaffee?« Sie lächelte und nippte an einer Tasse. Im Flur klappte die Badtür. Miersch sah einen Schatten verschwinden. Offensichtlich lag dem Gast nichts an Konversation. Überhaupt wunderte Miersch sich, dass sie die Nacht so früh beendet hatten. In den Ehejahren war er wochenends stets zuerst aus den Federn gewesen. Vielleicht wollte Margo ihm ihren neuen Lover vorstellen. Er hatte nach ihrer Trennung einige ihm völlig neue Seiten an ihr entdeckt.
Miersch griff zum Hörer. »Ja, bitte!« Er benutzte diese Floskel absichtlich. Seine Sekretärin hatte einmal erklärt, dass sich die Stasi mit diesen Worten am Telefon gemeldet habe. Andrea Dressel mochte den Spruch nicht mehr hören. Miersch hatte Ja, bitte! kultiviert.
Die Bereitschaft informierte den Kriminaldirektor. Unnatürlicher Todesfall. Neurophysiologisches Rehabilitationszentrum Leipzig, Bennewitz. Sein Kommen sei nicht erforderlich.
»Danke«, sagte Miersch. Hinter ihm stand Margo in der Tür und hielt ihm eine dampfende Tasse Kaffee entgegen. Er fühlte sich bedrängt. »In einer halben Stunde bin ich da.«
Margo zuckte die Schultern, raffte ihren Bademantel über dem Dekolleté. In der Wohnung schlug eine Tür. Beide nahmen keine Notiz davon.
Miersch ging in sein Zimmer. Sie hatten die Zimmer im Einvernehmen geteilt. Er schlief im Zimmer für Gäste mit separatem Klo und Bad. Der Kleiderschrank war geräumig. Miersch wühlte, er suchte nach der passenden Krawatte. Er wählte blau mit einem abstrakten Muster. Irgendjemand drehte an der Lautstärke einer Wunschsendung im Radio. Die Wohnung hallte wider von Und nun grüßen wir herzlich Opa Albrecht aus …
Miersch war auf der Flucht. Er wollte den Sonntagmorgen weder mit Margo noch ihrem Gast verbringen. Ohne den Anruf hätte er sich den Vormittag lang im Zimmer vergraben und sich über Die Geschichte der Deutschen Volkspolizei informiert. Jetzt fuhr er nach Bennewitz. Er kannte den Ort nicht, aber zum Regierungsbezirk musste er gehören. Neurophysiologisches Rehabilitationszentrum Leipzig klang nach Peripherie der Großstadt. Er hatte nicht gefragt, was diesen Tod unnatürlich erscheinen ließ. Dass man im Krankenhaus starb, war ja nicht ungewöhnlich. Neurophysiologisches Rehabilitationszentrum … Selbstmord? Wahn-sinn? Unfalltod?
Als Miersch die Wohnung verließ, saß Margo allein am Tisch in der Küche und rauchte. Vielleicht hatte der Durchzug mit den Türen geschlagen.
»Viel Erfolg«, sagte sie leise.
Miersch nickte und ging wortlos aus dem Haus.
»Kohlund. Kriminalpolizei.«
»Ich habe Sie verständigt. Sehen Sie diese Spuren?« Ein junger Herr Doktor, das Stethoskop um den Hals, in der Brusttasche Kuli und Spatel, wies mit dem Finger auf den Kopf einer Leiche. Dr. Barthelmes las der Kommissar am Revers des offenen Kittels. »Ich habe dafür keine Erklärung.«
Kohlund nickte. Krankenhaus, typisch. Die Atmosphäre war aseptisch, kaum menschlich. Ärzte und Schwestern wirkten ge-stresst. Dr. Barthelmes sprach wie vom Tonband. Kohlund roch Kampfer. Die Wände waren weiß gekachelt, auf einzelnen Kacheln Abziehbilder mit Fischen. Auf dem rollbaren Esstischchen vorm Bett des Toten befanden sich abgezählte Tabletten in Plasteschalen und eine Kaffeetasse mit braunem Rand. Auf der Platte stand ein Foto mit einem lachenden Kind. Fingerabdrücke waren darauf zu erkennen, vielleicht auch Lippen vom Kuss. Daneben hing regungslos der Beutel am Tropf. Er schlug keine Blasen und heilte nichts mehr. Sein Schlauch aber führte noch immer in eine knorpelige Vene, fingerdick, blau. Der Patient lag friedlich im klinischen Bett unterm weißen Bezug. Abgezehrt, eingefallene Wangen, Leichenblässe. Die Haut Pergament, leicht zerreißbar. Nur der tiefrote Kreis um den Hals, der sich ins Violette zu verfärben begann, ließ auf einen unnatürlichen Tod schließen.
»Die Morgenschwester hat es entdeckt. Natürlich sind diese Symptome nicht.« Der Doktor atmete hektisch. Mit der Hand fuhr er sich durch die Haare.
»Wenn Sie es sagen.«
Jetzt drehte sich Dr. Barthelmes dem Kommissar zu, schluckte und suchte offensichtlich nach Worten für seine Empörung. Dann fuhr er sich resigniert nochmals durch die Haare.
Kohlund heftete seinen Blick auf die Augen des Toten. »Woran litt der Kranke?«
»Krebs. Endstadium. Das kann Tage, aber auch Monate dauern.«
Eine korpulente Schwester schob sich mit ihrem Gesäß ins Gespräch. Ihr Lächeln war professionell, wie gemeißelt. Die Augen blickten mitleidlos, kalt. Sie fragte den Kommissar: »Kann ich die Pietät jetzt bestellen, oder hat die Polizei eigene Wagen?«
»Zur Gerichtsmedizin.«
Die Schwester nickte und verschwand mit einem Handy am Ohr.
Dr. Barthelmes sagte leise: »Monique. Eine unserer Besten.«
Kohlund erschien Schwester Monique wie ein Automat, der emotionslos funktionierte. Sie hämmerte auf die Tasten eines Handys ein. Dann war Stille, und nur ihr Atem war zu hören.
Der Doktor blickte zum Toten. Dann schloss er die Augen. »Ich kann es mir nicht erklären. Stranguliert, aber kein Strick.«
Schwester Monique sprach leise und bestellte einen Krankenträger. Kohlund überlegte, ob der Diensthabende am Notruftelefon der Polizei die Gerichtsmedizin auch in ein Krankenhaus bestellte. Ein Leichenwagen war kaum nötig. Das Institut für Gerichtsmedizin lag keine hundert Meter entfernt. Und der behandelnde Arzt hegte dem Anschein nach dieselben Zweifel wie Kohlund. »Haben Sie eine Erklärung für diese Symptome?«
»Nein. Keine.« Dr. Barthelmes hustete leicht und öffnete die Augen wieder. »Zumindest deuten sie auf keine natürliche Todesursache.«
Schwester Monique gesellte sich wieder zu ihnen und hob bedauernd ihre Schultern. »Ich habe nur den Anrufbeantworter erreicht. Es ist Sonntagmorgen.«
»Ja«, sagte der Arzt abwesend.
Der Schwester schien die Situation peinlich. »Eigentlich sind Bestatter Tag und Nacht dienstbereit.«
»Die nicht. Wir schon.« Kohlund und seine Kollegen von der Mord zwo arbeiteten am Sonntag. Es war immer Sonntag, wenn Kommissare zum Tatort gerufen wurden. Jedenfalls kam es Lars Kohlund so vor. Er hatte Bereitschaft. Das Telefon hatte ihn nicht aus dem Schlaf, sondern aus trauter Gemeinsamkeit mit Alexia gerissen. Endlich ein Wochenende ohne Stress und ohne Kinder. Die hatten ihr eigenes Leben und am Sonntag was anderes vor, als mit Mutti und Vati am Frühstückstisch zu hocken. Gisbert paukte fürs Abitur und radelte sich schon am Morgen den Kopf frei. Charlotte war im Konzert gewesen und hatte bei einer Freundin übernachtet, die wahrscheinlich ein Freund war, vermutete der Vater.
Kohlund und Alexia wollten ihre freien Stunden genießen. Alexia war in seinen Augen noch immer schön und begehrenswert. Besonders in den Morgenstunden. Für ihn selbst war das unerklärlich, aber vielleicht erschien sie ihm nur im milden Licht des Morgens so attraktiv. Kohlund spürte noch immer Alexias Ohrläppchen auf seiner Zunge. Sie hatte wie eine Katze geschnurrt. Das Telefon hatte ihn aus allen Fantasien gerissen und Alexia endgültig geweckt. Scheiße! Er hatte seinen Hintergrunddienst völlig vergessen. Sonntag. Natürlich!
»Dass keiner abnimmt …« Schwester Monique schüttelte den Kopf. Der Anrufbeantworter brachte sie aus ihrer Routine. »Ich probiere eine andere Nummer.«
Wahrscheinlich hatte das Krankenhaus einen Exklusivvertrag mit dem Bestattungsinstitut, und die Stationsschwester rechnete mit einer Strafe, weil sie einen anderen Bestatter bestellte. Die Zunge zwischen den Zähnen, hämmerte sie verbissen eine neue Melodie ins Handy. Kohlund sah aus dem Fenster. Tropfen schlierten die Scheibe hinunter. Sauwetter. Und Sonntag.
Das Neurophysiologische Rehabilitationszentrum lag trutzig auf einer Wiese neben dem Wald. Obwohl er auf der angegebenen Strecke gefahren war, hatte Kohlund diese Einrichtung zuerst verfehlt. Er hatte ungewollte Umwege durch geputzte Wohnanlagen und Einfamiliensiedlungen genommen. Niemals würde er seine Platte gegen einen solchen Besitz tauschen. Hier saß man ja dem Nachbarn fast auf dem Tisch, da war daheim der Weg von der Couch bis zum Bierkasten weiter. Und dann grüßten vielleicht noch Kriminaldirektor Miersch oder Kollegin Schabowski hinter dem Zaun. Schreckliche Vorstellung. Der Lagevorteil solcher Buden war auf den ersten Blick Ruhe, Natur und raus aus der City. Aber auch Grünau mit seinen Neubauten lag außerhalb des Zentrums an Badesee und Wald. Nein, er und seine Familie würden nicht umziehen, egal wie oft ihnen die Schwiegereltern, gute Freunde oder Kollegen die Nachteile der Banlieue aufzählten. Die Kohlunds blieben aus Prinzip und dem schlechten Ruf zum Trotz im Beton wohnen. Viele der angeblichen Katastrophen und Horrorszenarien in den Betonburgen waren sowieso nur Gerede. Kohlund konnte sich beim besten Willen nicht erinnern, jemals bei einem Mord in Grünau ermittelt zu haben.
Jetzt stand er in einem Haus aus Glas und Beton vor einem Toten, der die letzten Monate seinem Ende entgegengelitten hatte. Noch nach seinem Tod schien der Patient zu leiden. Die Augen waren fast in ihren Höhlen verschwunden. Sie blickten starr an die Decke, bisher hatte sie keiner geschlossen. Graugrün. Das Neonlicht spiegelte sich darin. Es war seltsam, einen so nah vor dem Tod gewaltsam aus dem Leben zu holen.
»Wie alt?«, fragte Kohlund.
»Keine vierzig.«
Er war dankbar, dass er bereits jetzt länger gelebt hatte als der Tote. Kohlund suchte am Bett nach einem Namen. Wahrscheinlich hing das Schild vor der Tür.
»Er war Kulturwissenschaftler. Promoviert.« Dr. Barthelmes klang bedauernd. Akademische Qualifikationen waren kein Garant für ein längeres Leben. Niemand konnte einem das garantieren, auch wenn Lebensmittel- und Sportindustrie oder der Gesundheitsminister es ständig versprachen. Rauchen schadet Ihrer Gesundheit und kann zu einem schnelleren Tod führen. Wahrscheinlich hatte dieser Tote nicht mal geraucht. Frühstückszerealien oder Vitaminbomben hätten ihm nicht mehr geholfen. Geräte hatten sein Leben verlängert. Jetzt waren sie abgestellt. Aus. Auch in den Monitoren spiegelte sich das kalte Neonlicht.
»Gerettet hat ihn Ihre Maschinerie nicht.«
»Aber auch nicht getötet. Er hat länger gelebt.«
»Länger gelitten.« Kohlund beugte sich über das Opfer. Die Spuren äußerer Gewaltanwendung waren eindeutig. Der Tote war nicht mit der Hand gewürgt worden. Aber für einen Strick waren die Drosslungsmerkmale zu schmal. Sie ließen auf Draht oder ein Plasteseil schließen. Wäscheleine oder Elektrokabel.
»Wie heißt der Verstorbene?«
»Frank Stuchlik. Sieben Monate lag er hier auf der Onkologie.«
Der Arzt wischte sich über die Augen und schien noch im Nachhinein mit dem Patienten zu leiden. Er bemerkte Kohlunds Blick, straffte sich und fiel in die berufliche Abgebrühtheit der Mediziner. »Wir konnten nichts mehr für ihn tun.«
Kohlund fragte sich, warum der schwer krebskranke Frank Stuchlik dann auf einer Intensivstation lag. Intensiv bedeutete, hier wurden Leben gerettet. Doch Stuchlik hatten die Ärzte, selbst Dr. Barthelmes, längst aufgegeben. Es hätte keinen vom Personal gewundert, wenn Frank Stuchlik bald seinem Leiden erlegen wäre. Kohlund sah sie vor sich, die Krankensäle und Palliativstationen. Er hätte Gottfried Benn rezitieren können, Gisbert hatte das Gedicht für den Unterricht tagelang geübt und die Familie in Depressionen getrieben. Hier diese Reihe sind zerfallene Schöße / und diese Reihe ist zerfallene Brust. / Bett stinkt bei Bett. Die Schwestern wechseln stündlich. Alexia spendete dem Förderverein für die Hospizbewegung. Kohlund fand keine Erklärung, warum jemand einen Sterbenden tötete. Und Mord war es. Eindeutig. Die Gerichtsmedizin würde den Fakt nur bestätigen. So war Stuchliks Tod doch noch eine Überraschung.
»Verwandte?«, fragte Kohlund.
»Sie haben regelmäßig an seinem Bett gestanden. Viele Freunde. Kein Tag ist vergangen, ohne dass ihn jemand besucht hätte.«
Dr. Barthelmes sprach routiniert, als ob er eine Diagnose diktierte. Jetzt sah und hörte Kohlund dem Arzt keine Emotion mehr an, falls er die Geste vorhin überhaupt richtig gedeutet hatte. Er wandte seinen Blick ab, niemals würde er sich an den Anblick von Leichen gewöhnen. Doch Dr. Barthelmes arbeitete, wo gestorben wurde und Rettung kaum möglich war. Auf einer solchen Station könnte Kohlund nicht den Dienst versehen, zu groß erschienen ihm die Belastung und der Stress. Und sein Mitleid konnte er nicht verstecken. Selbst jetzt nicht. Er überwand sich und schloss dem Toten die Augen. Es ging weniger leicht, als er es sich vorgestellt hatte. In Filmen fuhren die Hinterbliebenen den Toten immer nur leicht über die Lider. Kohlund musste die Prozedur mehrmals wiederholen, bis die Augen geschlossen blieben.
»Wir haben hier nichts verändert.« Schwester Monique rechtfertigte sich, ohne dass Kohlund ihr einen Vorwurf gemacht hätte. Augenscheinlich hatte sie ihr Gespräch mit dem zweiten Bestatter beendet und den Abtransport der Leiche geregelt. »Soll doch alles so bleiben, wie’s war, sagen sie immer, die Polizisten.«
Die Polizisten aus dem Film, dachte Kohlund, die sagen das immer. Vielleicht war der schnippische Tonfall Moniques Ausdruck ihrer Anteilnahme. Kohlund war selbst unsicher, aber er gönnte Frank Stuchlik seine letzte Ruhe. Jetzt sah er aus, als ob er schliefe. Entspannt. Ruhig. Die Falten geglättet, von Schmerzen befreit. Sie würden eine Erklärung für seinen Tod finden. Kohlund musste es dem Toten nicht versprechen.
»Hatte er auch gestern Besuch?«, fragte er.
»Sicher.« Schwester Monique wich seinem Blick aus. »Frank Stuchlik ist nicht unser einziger Patient. Wenn auch ein sehr netter … Aber wir haben nicht drauf geachtet.« Sie schien sich aufzublasen, die Hände in die Hüften gebohrt, suchte sie jetzt Kohlunds Blick. Er schaute zu Dr. Barthelmes.
Der nickte. »Vor lauter Arbeit sehen wir nicht alles.«
Die Vorstellung, in einer solch klinischen Atmosphäre sterben zu müssen, empfand Kohlund als immer größer werdenden Horror. Für sich wollte er den Tod möglichst ganz schnell, möglichst bei bester Gesundheit, möglichst geistig aktiv und ohne Leiden. Aber das wünschte sich jeder. Sicherlich hatte auch Frank Stuchlik sich diesen Tod nicht ersehnt. Aber Kohlunds sämtliche Klienten starben auf unnatürliche Weise. Gewaltsam ums Leben kommen, das wollte keiner … Mein Gott, für diese Gedanken hatte er einfach den falschen Beruf.
»Seine Frau und die Kinder sind fast täglich gekommen. Sie waren auch gestern bei ihm. Sicher noch andere. Als hätten sie es geahnt …« Schwester Monique überlegte. »Aber beim besten Willen … Sie müssen die Spätschicht fragen.«
»Glauben Sie, dass seine Verwandten …« Dr. Barthelmes führte sich die Hand um den Hals und blickte Kohlund offen ins Gesicht, sprach den Satz aber nicht zu Ende.
Dieser Gedanke war Kohlund bislang noch gar nicht gekommen. Aber der Arzt wollte eine Antwort, so wie er Kohlund jetzt ansah.
»Ausschließen kann ich nichts.« Eine Floskel, die jeder Kommissar gern von sich gab.
»Ein paar Dinge können Sie schon ausschließen.« Dr. Barthelmes referierte wie Miersch über die Statistik der Straftaten. »Herr Stuchlik ist erst in den Morgenstunden gestorben. Frühestens Mitternacht. Da konnte ohne Anmeldung kein Besuch an seinem Bett wachen. Wir kontrollieren und schließen dann ab.« Er sprach sicher und autoritär. »Körpertemperatur und vegetative Funktionen habe ich sofort gemessen. Keinesfalls vor Mitternacht, eher später.«
»Das haben Sie ja schon gesagt.« Kohlund klang aggressiver, als er wollte. Wenn er das Personal gegen sich aufbrachte, würden die Ermittlungen nur schwieriger. Er versuchte zu lächeln. »Aber jemand muss im Zimmer gewesen sein. Vielleicht …«
Die beiden begriffen sofort. Schwester Monique wollte mit aufgeblasenen Wangen zur Argumentation ausholen. Dr. Barthelmes stellte sich vor sie.
»Sie sprechen von … Sterbehilfe?« Er überdehnte die Pause. Das Wort hallte im Raum nach. »Das ist eine Straftat.«
Kohlund wies dezent auf die Leiche. Frank Stuchlik lag da wie ein Vorwurf.
»Ausgeschlossen.« Dr. Barthelmes wurde lauter. »In unserer Einrichtung ist so etwas noch nie vorgekommen. Auf dieser Station sind nur Mitarbeiter beschäftigt, die ich seit langem kenne. Wir wechseln das Personal nicht wie Kittel. Für alle lege ich meine Hand ins Feuer.«
Verbrennen Sie sich nicht die Finger, war Kohlund versucht zu sagen. Die Schwestern Mord waren nicht selten. Oder auch mordende Krankenpfleger. Todesspritzen und Kopfkissen hatten serienweise Patienten ins Jenseits befördert. Diese Todesengel mordeten immer aus Mitleid. Sie mochten das Elend nicht mehr sehen, sie erlösten die Sterbenden. Das sagten sie alle vorm Staatsanwalt aus. Die Kriminalgeschichte kannte solche Fälle en masse. Immer wieder machten sie Schlagzeilen. In Berlin. In Wien. In Dresden-Neustadt.
Kohlund sprach bedächtig, voller Verständnis. »Einer muss es getan haben. Ich unterstelle Ihnen nichts, aber in Betracht ziehen müssen wir auch diese These und das Personal des Zentrums.«
»Dann stellen Sie Ihre Fragen.« Schwester Monique schob Dr. Barthelmes beiseite und baute sich vor Kohlund auf. Kurz sah es so aus, als wollte sie ihm eine Ohrfeige geben. Dann stemmte sie die Arme in ihre kräftigen Hüften. »Täglich stehe ich hier an den Betten und kann diesen Kranken nicht helfen. Trotzdem pflege ich sie mit meinem ganzen Herzen. Ich kann nicht anders. Auch Sie könnten es nicht!« Ihre Augen hielten ihn fest und schienen abgrundtief wie ein Gebirgssee. Eisig und blau.
Kohlund hatte den Eindruck, dass er in ihr Innerstes blicken konnte, aber nichts genau erkannte. In ihrer Tiefe schien diese Frau empfindsam und sehr verletzlich. Am Grunde des Sees spiegelte sich wärmende Sonne. Ihn durchfuhr so etwas wie ein elektrischer Schlag. Als hätte er Schwester Monique bei etwas Intimem ertappt und nun schämte er sich, dass er es gesehen hatte. Sein Lächeln missglückte. Regentropfen prasselten gegen die Scheibe.
»Guten Morgen!«
Wie ein Messer zerschnitt der Gruß das Gespräch. Franziska Beetz stand in der Tür und strahlte fröhlich.
»’tschuldigung Chef, aber haben Sie Bennewitz hinter Machern vermutet? Ich habe mich dreimal verfahren, und hätte ich nicht gefragt, würde ich immer noch rumkurven.«
Obwohl die Kollegin fast eine Stunde nach ihm ankam, blieb Kohlund gelassen. Auch der Beetz hatte man den Sonntag zerstört. Doch sie schien diese Störung weitaus leichter zu nehmen als er. »Ich hab’s auch nicht sofort gefunden«, sagte er.
»So ein Klotz auf der Wiese und nichts ausgeschildert.«
»Seien Sie froh, dass Sie nicht öfter hierher müssen«, sagte Dr. Barthelmes. »Das Leiden unserer Patienten ist meist irreparabel. Wenn sie einmal hierhergefunden haben, dann kommen sie für Monate, wenn nicht Jahre, jede Woche. Immer wieder.«
Die Kommissare schwiegen betreten. Die Beetz wischte mit ihrem Fuß unsichtbare Spuren auf das Linoleum.
»Frank Stuchlik, schwer krebskrank, augenscheinlich erwürgt«, erklärte Kohlund und versuchte, die peinliche Stille zu überspielen. Franziska Beetz hängte ihre Handtasche über einen Stuhl und betrachtete den Toten.
»Eigentlich kein Alter, um zu sterben«, sagte sie.
»Gibt es eines, das passt?« Schwester Monique bildete mit dem Arzt eine Einheit, sie ließen sich ihre Arbeit nicht leicht reden. Nicht nur Krankenhauspersonal war täglich mit Elend und Leid konfrontiert. Sozialarbeiter, Bestatter, Friedhofsgärtner … Auch er oder die Beetz standen machtlos neben dem Schicksal. Sie kamen immer erst, wenn es zu spät war. Dr. Barthelmes und Schwester Monique konnten wenigstens manchmal noch Hoffnung auf Heilung haben. Die Mordkommission hatte keine Hoffnung. Wenn sie gerufen wurden, war das Schlimmste schon passiert. Kohlund fragte sich, was der tote Frank Stuchlik zu ihren Gesprächen vor seinem Bett sagen würde.
»Wie lange hätte er noch zu leben gehabt?« Die Beetz blickte zur Schwester.
Die zwang sich zu einem Lächeln. »Lange hätt’s nicht mehr gedauert. Wir haben täglich mit seinem Ableben gerechnet.«
»Eigenartig, vorm Tod zu sterben.«
Der Satz der Beetz klang wie eine Zeile aus Benns Gedicht oder einer aus Joseph Hönigs Skandalreportagen. Wahrscheinlich war dies das Resultat ihrer Beziehung zu dem Boulevardjournalisten. Kohlund betrachtete diese Liaison skeptisch. Aber er konnte nur zusehen und hoffen, dass die Kollegin keine dienstlichen Belange ausplauderte.
»Wo darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«, fragte die Beetz, und Schwester Monique wies ihr den Weg aus dem Zimmer. Es war als würden zwei Freundinnen sich zum Kaffee treffen.
»Ich würde gerne kurz mit Ihnen sprechen«, sagte Kohlund.
Dr. Barthelmes verließ wortlos das Krankenzimmer. Kohlund sollte wohl folgen. Auf dem Flur trafen sie Berger von der Technik und seine Mannschaft. Kohlund erklärte kurz die Fakten. Die Kriminaltechniker verschwanden mit Koffern und allem möglichen Gerät im Zimmer des Toten. Der Kommissar war im Zweifel, ob sie überhaupt etwas entdeckten, das die Ermittlungen voranbrachte. Dann klingelte Kohlunds Handy. Es war noch mal die Bereitschaft.
»Ich bin allhier.« Er versuchte einen Scherz. »Wahrscheinlich Mord. Lasst die Maschinerie anlaufen. Wie immer.« Dann verging ihm der bemühte Humor. Die Kollegen teilten ihm mit, dass sich Kriminaldirektor Miersch höchstpersönlich für diesen Fall interessierte und auf dem Weg ins Neurophysiologische Zentrum war. »Scheiße!«
Das war eine eindeutige Warnung. Der Chef mischte sich gern in ihre Arbeit ein, um öffentliches Lob abzufassen. Bei weniger spektakulären Fällen hielt sich Miersch zurück. Und der Tod von Frank Stuchlik war bestimmt kein Fall, der Schlagzeilen machen würde. Miersch konnte nur nerven, einen wirksamen Beitrag hatte er noch bei keiner Ermittlung geleistet. Kohlund kannte niemanden, der den Kriminaldirektor aus Bayern sympathisch fand. Die Schabowski war vielleicht anderer Meinung, aber auch sie kam aus dem Westen. Andrea Dressel vielleicht, die saß beim Direktor im Vorzimmer. Aber der Böer? Hengstmann? Schmitt sowieso. Da waren sie fast alle einer Meinung: Arschloch! Jetzt hatte er den Direktor am Hacken. Prost Mahlzeit! Und das zum Sonntag.
»Verdammte Scheiße!«
»Kann ich helfen?«
Kohlund wandte sich dem Arzt zu. »Entschuldigung. Nein.«
Dr. Barthelmes nahm es ohne Regung zur Kenntnis und setzte seinen Weg fort, sein Kittel wehte ihm hinterher. Kohlund hatte Mühe zu folgen.
»Verdammte Scheiße!«, schrie er noch einmal, um seinen Frust abzureagieren.
Dr. Barthelmes drehte sich zu ihm um. »Scheiße ist der Tod nur für uns, die wir leben. Den anderen ist er egal.«
Die Scheibenwischer rotierten. Es regnete stärker. Miersch kann-te die Ortsnamen nicht. Wöllmen. Gostemitz. Groitzsch. Keine Ahnung, wo er sich befand. Das Navigationssystem hatte er seiner Tochter Bernadette überlassen, die es sich vor einem halben Jahr geliehen hatten, um zum Studium nach Eichstätt zu finden. Bernadette hatte ihn sehr lieb darum gebeten, er hatte nicht widerstehen können. Seitdem hatte Miersch keinen automatischen Wegweiser mehr im Auto. Die Karte verzeichnete Bennewitz nahe Wurzen. Passanten nach dem Weg zu fragen, wäre Miersch als Eingeständnis seiner Unfähigkeit erschienen. Außerdem waren am frühen Sonntagmorgen hier im Regen keine Menschen unterwegs. Nur einen Radfahrer in hautengem Dress und mit nackten und kräftigen Waden hatte er überholt. Doch der sah aus, als würde er unter Wasser trainieren: schwarz vermummt und gesichtslos.
Mörder! Monster! Menschenschlächter! Konstantin Miersch hatte sich nicht vorstellen können, dass solche Schlagzeilen möglich waren. Er fühlte sich einsam und alleingelassen, ungeliebt sowieso und jetzt zum Abschuss freigegeben. Die Kollegen schnitten ihn. Die Dressel kochte zu dünnen Kaffee und vergaß, den Zucker auf die Untertasse zu legen. Die Reporter grinsten hämisch, wenn er ihnen Rede und Antwort stand. Und genau das bezweckte Joseph Hönig wohl auch. Die Beetz hatte sicher ihren Anteil an seiner Kampagne, und der Böer und der Kohlund, die alten Seilschaften eben. Miersch fühlte sich ihren Intrigen und dem darauf folgenden Parteiengezänk im Stadtrat ausgeliefert, ohne dass er genau hätte sagen können, aus welcher Richtung man ihn beschoss. Hönig war der einzig sichtbare Gegner, alle anderen kämpften im Verborgenen. Seine Suspendierung war nur eine Frage der Zeit. Denn dass Leute seinen Rauswurf betrieben, dessen war sich Miersch sicher. Sie wollten ihn los sein. Zu viele waren begierig auf seine Stelle. Kein Problem, er würde den Posten auch freiwillig aufgeben, angenehm und reputationsträchtig war der nämlich keinesfalls. Aber er würde seinen Sessel nicht unehrenhaft, gezwungenermaßen räumen. So nicht!
Machern. Jetzt war er in Machern! Nicht Wurzen und nicht Bennewitz. Machern! Aber noch immer diesseits der Mulde. Das durfte er keinem erzählen, dass er seit über einem Jahrzehnt in Leipzig Dienst tat und wohnte, aber die Umgegend nicht kannte. Margo war mit ihren Freundinnen sämtliche Strecken mit Fahrrad oder Auto abgefahren von Tagebausee bis Dahlener Heide, von Heuersdorf bis Petersberg/Halle, von Altenburg bis hin nach Wittenberg. Die Damen besuchten Sonderausstellungen in Dresden, Wörlitz und Oberwiesenthal und erschienen bei jedem Volksfest im Rudel. Miersch hatte sich diesen Aktivitäten immer verweigert. Jetzt musste es ihn nicht wundern, dass er sich im Umkreis von zwanzig Kilometern von Leipzig verfuhr. Machern.
Eine von diesen gesellschaftsrelevanten Freundinnen seiner Gattin hatte vornehm und luxuriös in Machern geheiratet. Margo hatte sich ein Kleid schneidern lassen, dem Anlass gemäß und dem Ambiente. Miersch glaubte sich zu erinnern, in Reiseführern gelesen zu haben, ein Fürst habe ums Schloss einen Park anlegen lassen, der für die Landschaftsgärtnerei bedeutsam wurde. Nun also Machern. Er versuchte, die Hauptstraße zu finden.
Vor einer Ampel stand ein Schild. Die Schrift war im Regen und aus der Ferne kaum zu entziffern: Neurophysiologisches Rehabilitationszentrum Leipzig. Von wegen Leipzig! Machern, und es sollte in Bennewitz liegen. Miersch fuhr geradeaus. Nächstes Schild links. Einfamilienhäuser säumten die Straße. Margo wäre gern in solch eine Siedlung auf dem Lande gezogen. Die Großstadt blieb ihr immer verhasst. Er hätte Leipzig lieben können, selbst den Dialekt. Aber zu viele hatten etwas dagegen. Menschenschlächter! Monster! Mörder!
Der Glas-Beton-Bau, zweiflüglig mit großen Fenstern, hätte ebenso eine Konzernzentrale, ein Bürohaus oder ein Einkaufszentrum sein können. Das Zentrum war auf die Wiese gerotzt. Angesicht der Masse an Autostellplätzen hätte man meinen können, das Gebäude sei ein Besuchermagnet. Ein paar kleine Wege erweckten die Illusion eines Krankenhausparks. Die wenigen Besucher liefen mit gesenkten Gesichtern zum Einlass. Hinter den Scheiben sah Miersch Menschen warten. Er hatte eine solche Zauberberg-Atmosphäre nie gemocht. Sie machte selbst Gesunde zu Patienten. Aber Nächstenliebe und Familienpflicht verboten Wegsehen und Fernbleiben, die Leugnung von Sterben und Tod. Und so fuhren die Freunde und Angehörigen hinaus zu den Kranken, um denen ein bisschen von der Welt zu erzählen, an der sie nicht mehr teilhaben konnten. Der Kriminaldirektor dachte mit Schaudern an seine Eltern und Tante Gertrud.
Miersch erkannte auf dem Parkplatz den Kleinbus der Kriminaltechnik, die anderen Einsatzwagen standen wahrscheinlich daneben. Hier war er richtig. Er stellte sein Auto in die letzte Bucht, weit von den Kollegen entfernt, als ob er nicht dazugehören wollte.
Aus der Nähe wirkte das Gebäude des Rehabilitationszentrums fremdartig wie ein gelandetes Ufo. Wolken spiegelten sich in der Glasfront. Makellose Wege und Straßen betonten die Fremdartigkeit, es wirkte losgelöst von Landschaft und Bevölkerung. Der Wald hinter der Straße schien abweisend wie eine schwarze Wand. Kein Patient würde sich dahin zu Specht oder Eichkatz, geschweige denn Kobolden und Hexen verirren. Es wirkte wie der Knast in Wachau. Nur die Mauer fehlte. Der Regen machte das Gebäude noch lebloser und einsamer. Es erschien kalt. Noch im Foyer war die Kälte zu spüren.
Miersch wusste nicht, warum, aber dieses Krankenhaus enttäuschte alle seine Erwartungen. Nur konnte er auch nicht erklären, was er erwartet hätte. Sterilität und Sauberkeit waren Voraussetzungen einer Genesung. Durch die großen Fenster konnte man zumindest ein bisschen Natur und Himmel sehen. Stühle gaben den Blick auch im Sitzen frei. Ein junger Mann schob dem Kriminaldirektor eine Oma im Rollstuhl entgegen. Die lächelte freundlich. Miersch bemühte sich zurückzulächeln.
»So ein Wetter! Da fällt es nicht schwer, hier drinnen zu sitzen«, sagte die alte Frau und schien ihm die Hand reichen zu wollen.
»Ja. Ja.« Miersch ignorierte den Gruß und wusste nicht, was er noch sagen sollte. Betreten ging er weiter.
»Noch zwei Wochen, haben die Ärzte gesagt«, rief ihm die Alte hinterher. »Nur noch zwei Wochen!«
Wahrscheinlich meinte sie ihren eigenen Tod.
Die Rezeption war eloquent besetzt und dienstleistungsbereit wie im Interhotel. Der Wachhabende hinter der Theke telefonierte und bat ihn stumm um Geduld. Bin gleich so weit! Miersch nickte und stützte den Ellenbogen auf das Paneel. Zeitschriften im Ständer verkündeten kostenlos beste Gesundheit von Fitness bis Tabletten und Blutspritzen. Nicht nur Demente fielen auf diese Angebote herein. Miersch hatte es bei seiner Mutter erlebt. Mein Arzt ist so was von nett und verzichtet gar auf die Praxisgebühr, aber die Medikamente, mein Junge, die Medikamente, die er verschreibt, sind sehr teuer. Ausgenommen hatte der Mediziner die alte Frau wie eine Gans zur Weihnacht. Miersch war sich sicher, der nette Arzt teilte sich den Profit mit dem Apotheker. Da fielen die zehn Euro Praxisgebühr nicht ins Gewicht. Nur hatte Miersch keine Beweise für dieses unlautere Geschäft. Und seine Mutter war schon lange tot.
»’tschuldigung. Sie wünschen?« Der Mann vom Empfang stand ihm jetzt mit ganzer Person zur Verfügung. Miersch suchte nach Worten. Doch noch bevor er seine Frage stellen konnte, schrie es durch die Halle.
»Station IIIb, Zimmer 12!«
Eine robuste Frau kutschierte ihren Reinigungswagen direkt neben ihn und blickte ihn feindselig an. Lippen zu dick geschminkt, ihr Mund sah aus wie ein Kussmaul. Grobporige Haut erinnerte an die Krater des Mondes. Die Haare waren strähnig und lange nicht gefärbt. Drei Zentimeter, mindestens drei Zentimeter des grauen Ansatzes waren zu sehen. Die Frau war in Rage, sog die Luft ein, gleich würde sie brüllen.
»Ich glaub’s ja wohl nicht! Schlägt Ihnen endlich das Herz?«
Miersch hatte den Eindruck, dass von der Lautstärke die Scheiben klirrten. Selbst der Rezeptionist schaute erschrocken.
»Bitte?«
»Sie sind doch der Miersch? Kriminaldirektor Konstantin Miersch?«
»Ja.«
»Sie kommen zu spät! Viel zu spät!«
Miersch blickte zum Mann hinter der Theke, aber der drückte auf Tasten. Der Computer schien plötzlich seine gesamte Aufmerksamkeit zu fordern. So schrill war Miersch in seiner langjährigen Ermittlungsarbeit noch nie an einem Tatort begrüßt worden. Sie kommen zu spät! Die Kriminalpolizei kam immer zu spät. Das war ihr Job. Und angesichts des Todes sprach man leise, gedämpft. »Verzeihen Sie, kennen wir uns?«, fragte Miersch in verhaltenem Ton.
»Ich kenne Sie! Das genügt!«
Miersch fand keine Worte, die passten, fühlte sich überfordert und fehl am Platz. Der Rezeptionist tippte jetzt Nummern, jedenfalls sah es so aus. Die Reinigungskraft griff zum Lappen. Miersch war bewusst, dass er sich in einem Neurophysiologischen Rehabilitationszentrum befand. Vielleicht war dies eine Patientin und handelte nicht nachvollziehbar. Er hob seine Hand, um sie zu beruhigen. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Mir?! Sie sind noch bescheuerter, als es in der Zeitung steht. Und so was wie Sie leitet die Kriminalpolizei! Einfach unglaublich! Monster! Sie Mörder!«
Das war Volkes Zorn, der ihm hier entgegenschlug. Die Journaille hatte wahrhaft Bestes geleistet. Die Frau schob ihm ihren Wagen fast über den Fuß. Ihr Busen bebte. Das Wischwasser schwappte. Aus dem Besen schwebten Staubflusen auf seine Schuhe.
Die Reinigungskraft wickelte den feuchten Lappen um ihre Hand, hob ihren Arm und gestikulierte wie ein Politiker ohne Wahlvolk. »Drei Monate liegt der Junge schon hier. Drei Monate, und nicht ein Mal haben Sie den Mut gehabt, sich Ihrer Verantwortung zu stellen. Seine Mutter kommt täglich. Aber der Schuldige lässt sich nicht blicken! Monster!«
»Von wem sprechen Sie bitte?«
»Sie wissen genau, von wem ich spreche! Er liegt im Koma. Der wacht nicht mehr auf!«
Miersch dämmerte es. »Philip Thede?«
»Was glauben denn Sie, von wem ich rede?! Sie haben sein Leben auf dem Gewissen!«
»Ich bin eigentlich auf dem Wege zu …«
Doch in dieser Situation musste jedes seiner Worte falsch sein. Die Reinigungskraft streckte ihm ihre Hand wie ein Boxer entgegen, mit der anderen griff sie drohend zum Besen. Der Rezeptionist telefonierte noch immer und tippte hektisch auf der Tastatur seines Computers.
»Wo sagten Sie, finde ich Philip Thede?«, fragte Miersch.
»Station IIIb, Zimmer 12!«
»Danke.«
Er widerstand dem Impuls, ihr Besen und Lappen abzunehmen.
»Kaffee?«
»Wenn Sie fragen, ja.«
»Steht bei uns immer auf der Platte. Ohne Kaffee, wissen Sie …«
Schwester Monique versuchte zu lächeln und ließ Franziska Beetz den Vortritt. Nach dem Weiß der Flure herrschte im kleinen Raum eine fast heimelige Atmosphäre. An den Wänden hingen keine normierten Kunstdrucke, sondern Kinderzeichnungen. Eine Pinnwand steckte voller Ansichtskarten. Costa del Sol. Jerusalem. Sveti Stefan. Beetz las die Namen der Urlaubsorte, scheute sich aber, auf einem der Stühle Platz zu nehmen. Auf dem Tisch standen die Teller geordnet, in der Mitte ein Blumenstrauß und Kuchen wie zum Geburtstag. Die Maschine brodelte, Kaffeeduft füllte den Raum.
»Wissen Sie, sonntags machen wir’s uns gemütlicher. Wenigstens das Gefühl von Wochenende. Verbringen ja fast jedes zweite hier in der Klinik.«
Beetz tat es nicht ungern, hatte sie doch wochentags frei und Zeit zum Shoppen, auch waren Fitnessstudios und Hallenbäder weniger frequentiert. Sie hatte nichts gegen Sonntagsarbeit. Selbst der Chef und gläubige Katholik Konstantin Miersch war bereit, seinen Gottesdienst und den freien Tag für Ermittlungen und bei großen Fällen sogar für Pressekonferenzen zu opfern. Beetz wunderte sich, dass der Chef noch nicht da war. Die Bereitschaft hatte ihn angekündigt, aber eingetroffen war er auf Station noch nicht. Vielleicht war ja auch alles eine Finte, um sie zu effizienterer Arbeit zu bewegen. Miersch verstand sich auf solche Spielchen. Dabei tat sie ihren Job jeden Tag mit gleichem Engagement und hatte nicht den Eindruck, dass Schabowski oder Kohlund oder der Schmitt nur Dienst nach Vorschrift taten. Das war als Kriminalpolizist auch kaum möglich.
»Wenn Sie sich setzen wollen …«
Die professionelle Abgeklärtheit war der Schwester im Dienstzimmer abhanden gekommen. Auch charakterlich schien sie gewandelt, sie gab sich nicht mehr selbstbewusst, eher devot. Hatte Schwester Monique neben dem Toten noch widersprochen, schob sie ihr jetzt den Stuhl unter den Hintern. Beetz räusperte sich und suchte nach den passenden Worten, um ein Gespräch zu beginnen. Die Zeugin sollte erzählen, nicht nur kurze Antworten geben. Monique nahm auf der vordersten Kante des Stuhles neben ihr Platz und knetete ihre Hände auf dem Tisch. Am Fenster zeichneten die Tropfen das Kanalnetz des Leipziger Neuseenlandes.
»War es wirklich Mord?«, fragte Monique.
Die Krankenschwester war naiv oder eine sehr gute Schauspielerin. Sie hatte den Toten entdeckt, die Spuren der Gewalt gesehen, den Arzt und später die Polizei gerufen.
»Ja«, sagte Beetz.
»Kann ich kaum glauben.«
»Wie lange lag denn Frank Stuchlik auf Ihrer Station?«
Monique sprang abrupt auf, als hätte sie etwas vergessen. Den umkippenden Stuhl fing sie, bevor er auf den Boden knallte. Dann setzte sie sich nachdenklich wieder. »Kann ich Ihnen genau sagen.« Sie strich nicht vorhandene Falten aus ihrem Schwesternkittel.
Beetz war sich nicht sicher, wie sie die heftige Reaktion Moniques deuten sollte und schaute sich hilfesuchend nach der Kaffeemaschine um. Die lief mit gurgelndem Geräusch.
»Ich hole sein Krankenblatt.« Damit war die Schwester verschwunden.
Beetz lehnte sich im Stuhl zurück und kippelte. Auf dem Gang schlich ein spindeldürrer Mann im Bademantel vorbei. Er sah interessiert zu ihr hin. Sie fühlte sich ertappt wie in der Grundschule. Wir kippeln nicht! Die Stühle gehen kaputt. Volkseigentum! Als sie freundlich grüßte, schlich der Mann ohne eine Regung weiter. In der linken unteren Ecke des Fensters fluteten Regentropfen den Zwenkauer See, den größten im Tagebaugebiet des Leipziger Südraums.
Monique stürmte wieder herein und schwenkte die Akte wie eine Trophäe. Sie blätterte eifrig und fuhr mit dem Finger über die betreffende Zeile. »Hier, sehen Sie, Stuchlik, Februar, der Neunzehnte. Sein Hausarzt hat ihn überwiesen. Krankenwagen. Wir dachten, er stirbt.«
»Diagnose?«
»Magenkrebs. Metastasen im ganzen Körper. Da gibt’s keine Hoffnung.«
»Wusste Frank Stuchlik, wie’s um ihn stand?«
Monique atmete tief. Der See an der Scheibe wurde größer. »Ich denke, dass es ihm die Ärzte gesagt haben.«
»Sie haben es nicht getan?«
Monique straffte ihren Rücken. »Wir sind Pflegepersonal und übermitteln weder Diagnosen noch Todesurteile.« Ein wenig ihres vorherigen Selbstbewusstseins war wieder erkennbar. »Aber ich denke, er hat es gewusst. Glauben Sie mir, jeder ahnt, wenn es zu Ende geht. Fast zwanzig Jahre tue ich Dienst hier. Ich habe oft Sterbenden die Hand gehalten. Jeder weiß, wenn es kein Zurück mehr gibt.«
Diese Erkenntnis blieb keinem erspart. Beetz musste schlucken. Bislang verdrängte sie solche Gedanken. Als Opa gestorben war, hatte sie es hingenommen, er war eben alt gewesen. Werft eine Blume von mir mit ins Grab!,hatte sie ihren Eltern hinterher-gerufen, als die zum Begräbnis gefahren waren. Ansonsten besuchte Beetz oft dienstlich Trauerfeiern und Urnenbeisetzungen. Das gehörte zum Job. Aber mit den Toten verband die Kommissarin nichts außer der Arbeit. Unnatürliche Todesursache