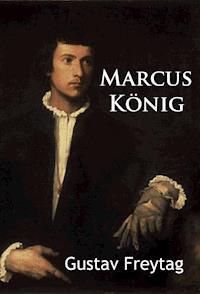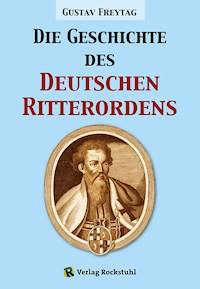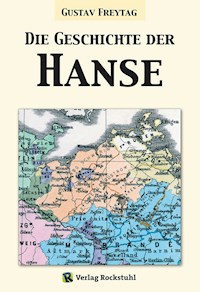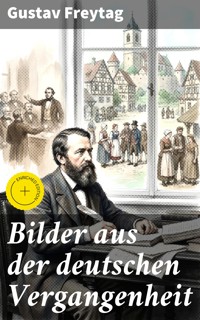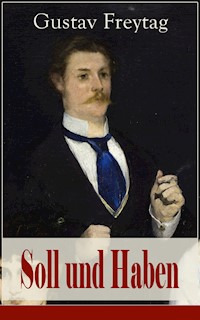Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gustav Freytags Werk 'Aus dem Staat Friedrichs des Großen' bietet einen faszinierenden Einblick in das Preußen unter der Herrschaft Friedrichs II. Das Buch ist ein Meisterwerk des historischen Romans und präsentiert die Zeit des 18. Jahrhunderts auf eine lebendige und authentische Weise. Freytag's präzise Darstellung der politischen und gesellschaftlichen Strukturen dieser Ära lassen den Leser tief in die Geschichte eintauchen, während sein eleganter Schreibstil den Lesefluss angenehm gestaltet. Der Autor schafft es, historische Fakten mit fesselnder Fiktion zu verweben, was dem Werk eine einzigartige und ansprechende Note verleiht. Gustav Freytags Werk zählt zu den bedeutendsten historischen Romanen seiner Zeit und wird oft als Meilenstein in der deutschen Literaturgeschichte betrachtet. Als Schriftsteller und Historiker war Freytag stark von der Zeitgeschichte und dem politischen Umfeld geprägt. Seine intensive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und die Genauigkeit seiner Recherchen haben ihm dabei geholfen, ein Werk von bleibendem Wert zu schaffen. 'Aus dem Staat Friedrichs des Großen' ist daher nicht nur ein historischer Roman, sondern auch ein bedeutendes Zeitdokument, das den Leser zum Nachdenken und Weiterforschen anregt. Dieses Buch ist ein absolutes Muss für Geschichtsinteressierte, die eine spannende und fundierte Darstellung des Preußen unter Friedrich II. erleben möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus dem Staat Friedrichs des Großen
Books
Inhaltsverzeichnis
Zur Einführung
Der Herr Verleger hat die Absicht, die ihm gewiß alle Lehrer des Deutschen wie der Geschichte danken werden, von Freytags »Bildern aus der deutschen Vergangenheit« eine Auswahl in billigen Einzeldrucken dem Schulgebrauch zugänglich zu machen. Was zunächst hier als Probe geboten wird, sind zwei Stücke des letzten Bandes, innerlich dadurch verbunden, daß sie zwei große Perioden der preußischen und also der deutschen Geschichte anschaulich machen, die Zeit Friedrichs des Großen und die der Freiheitskriege. Gern komme ich der Aufforderung nach, dem Abdruck dieser beiden Aufsätze einen kurzen Überblick über Freytags Leben und Werke vorauszuschicken.
*
Seinen Entwicklungsgang hat er selbst beschrieben, als Siebzigjähriger, in dem köstlichen Buche: »Erinnerungen aus meinem Leben« (zuerst 1886). Besonders ausführlich ist darin die Jugendzeit behandelt, eingehend auch die Jahre des Studiums und der beginnenden Berufsarbeit; später drängt sich die Darstellung mehr zusammen. Der Verfasser selbst meint: wer die Menschen aufzähle, deren Freundschaft ihm heilsam gewesen sei, rühme dadurch gewissermaßen sich selbst; »denn wenn einem so viele tüchtige Menschen zugetan waren, so muß man doch auch darnach gewesen sein«. Die Art seines Buches hat Freytag damit ganz treffend bezeichnet: das Interesse, das es gewährt, beruht zum guten Teil auf der Fülle bedeutender Menschen, an deren Leben und Wirken er, empfangend oder gebend, Anteil genommen hat; was aber zurückbleibt, ist doch der Eindruck der eigenen vielseitigen und dabei in sich gefestigten Persönlichkeit des Erzählenden. Zugleich wird der Leser hier durch Freytag selbst mit der Geschichte seiner Werke bekannt, wie sie im Zusammenhang seiner Erlebnisse angeregt, entworfen, vollendet wurden – alle geworden, nicht gemacht.
Gustav Freytag wurde am 13. Juli 1816 zu Kreuzberg in Oberschlesien geboren, wo sein Vater früher Arzt, damals Bürgermeister war; nahe Verwandte des Hauses saßen auf dem Schulzenhofe eines benachbarten Dorfes. So lernte der Knabe außer dem kleinstädtischen Treiben auch das ländliche Leben und Wirtschaften in seiner Heimat kennen. Und das war eine Gegend, die, in den vorangegangenen Kriegsläuften schwer heimgesucht, noch das frischeste Andenken an die erlebte Not und Erhebung bewahrte, der es durch die Nähe der polnischen Grenze auch in der Folgezeit an Anlaß zu politischer Erregung, die das deutsche Selbstbewußtsein steigerte, nicht gefehlt hat. Den Abschluß seiner Schulbildung fand Freytag in Oels; von 1835 an studierte er erst an der Landesuniversität, später in Berlin. In Breslau wurde der Westfale Friedrich Weber, der Dichter von »Dreizehnlinden«, sein Freund; unter den Professoren gewann Hoffmann von Fallersleben den meisten Einfluß auf ihn. Von diesem wurde er beim Übergang nach Berlin an Karl Lachmann, den großen Philologen, empfohlen; aus dessen Vorlesungen über Werke der römischen und altdeutschen Poesie hat er dann, seinem eigenen Bekenntnis nach, die mächtigste Anregung und die eigentliche Grundlage seines gelehrten Wissens empfangen.
Schon 1839 ließ sich der junge Doktor in Breslau als Privatdozent nieder und hielt Vorlesungen über mittelhochdeutsche und neuere deutsche Literatur. Als ihm die Fakultät nicht gestatten wollte, auch über deutsche Kulturgeschichte ein Kolleg zu lesen, gab er seine akademische Stellung auf, blieb aber zunächst in Breslau, mehr und mehr mit dichterischen Plänen und Arbeiten beschäftigt. Seine ersten dramatischen Werke sind in dieser Zeit entstanden. Um einem guten Theater nahe zu sein, ging Freytag 1846 nach Leipzig, im folgenden Jahre nach Dresden. Hier verlebte er noch die erste Hälfte des Revolutionsjahres, das den patriotischen Mann zu eigner Tätigkeit antrieb. Er wurde Gründer und Leiter eines Vereins, in dem Arbeiter und Handwerksgesellen zusammenkamen, um sich durch Musik, durch populäre Vorträge anregen zu lassen und gemeinsame Beschwerden und Wünsche der arbeitenden Klasse verständig zu erörtern. Aber so nützlich dieser Verein wirkte, so zog es Freytag doch zu energischerer Teilnahme am politischen Leben fort. Gelegenheit dazu fand sich in Leipzig in der Redaktion der seit kurzem bestehenden Wochenschrift »Die Grenzboten«. Freytag erwarb mit dem Ostpreußen Julian Schmidt zusammen das Eigentumsrecht an dem Blatte; beide Männer sahen ihre Aufgabe darin, für die Trennung Österreichs vom Deutschen Bunde, die Einigung der deutschen Staaten unter Preußens Führung einzutreten.
*
Seit dem Sommer 1848 wurde Leipzig Freytags eigentliche Heimat; nur während der letzten Jahre seines Lebens verbrachte er die Winter in Wiesbaden. Zu regelmäßigem Sommeraufenthalt erwarb er im Jahre 1852 ein Landhaus in Siebleben bei Gotha. In den ersten bewegten Jahren der Leipziger Zeit gehörte mit andern hervorragenden Gelehrten Theodor Mommsen zu dem Kreis, in dem Freytag verkehrte; unter denen, die ihm später nahestanden, nennt er selbst mit besonderer Verehrung seinen Freund und Verleger Dr. Salomon Hirzel, den Goethe-Kenner, und den Physiologen Karl Ludwig. Auch mit Männern, die in praktischen Berufen tätig waren, pflegte er gern Umgang, weil es dem Politiker wie dem Dichter gleich wichtig war, von dem wirklichen Leben ein volles Bild sich zu erhalten. So durchlebte Freytag die Jahre der stillen Sammlung deutscher Kraft, nachher die Zeit der großen Kriege. Als er 1870 von den »Grenzboten« zurücktrat, durfte er sich sagen, daß das Programm, für das auch er gekämpft hatte, erfüllt war. Den französischen Feldzug bis zur Schlacht bei Sedan machte er im Hauptquartier des Kronprinzen von Preußen mit; und die Erinnerung daran gab ihm später noch einmal die Feder des Journalisten in die Hand, als es galt, nach dem Tode Kaiser Friedrichs für die Würdigung des teuren Verstorbenen Zeugnis abzulegen. Damals schrieb Freytag: »Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone« (1889), eine kleine Schrift, die während weniger Wochen in Tausenden von Exemplaren verbreitet wurde. – Um 30. April 1895 ist er selbst in Wiesbaden gestorben.
Von Freytags Dramen sind die bekanntesten »Die Journalisten« (1852) und das Trauerspiel »Die Fabier« (1859). Dieses ist durch die Freundschaft mit Mommsen und das Studium von dessen »Römischer Geschichte« angeregt; es spielt in der Zeit des römischen Ständekampfes und zeigt in erschütternder, nach dem eignen späteren Urteil des Verfassers allzu herber Tragik einen Familienkonflikt, der durch diese Kämpfe hervorgerufen wird. Der Inhalt der »Journalisten« ist dem eignen Lebenskreise des Dichters entnommen, der die Vorbilder zu seinen Gestalten wie den Stoff zu Sorgen und Freuden, von denen sie bewegt werden, in seiner täglichen Umgebung in Fülle vorfand. Dieses Lustspiel ist, wie Freytag selbst erzählt, in drei Sommermonaten niedergeschrieben worden; und die flotte Art der Entstehung mag zu dem schnellen und sicheren Erfolg das Ihre beigetragen haben. Nicht mit Unrecht hat man das Stück neben Lessings »Minna von Barnhelm« gestellt. – Auch darin folgte Freytag dem Verfasser der »Hamburgischen Dramaturgie« nach, daß er es unternahm, die Erfahrungen und Einsichten, die er als Dichter und als Kritiker gewonnen hatte, theoretisch zu entwickeln. So entstand im Jahre 1863 »Die Technik des Dramas«, ein Buch, das noch heute für eine eingehende Betrachtung dramatischer Werke den besten Anhalt bietet.
Aus der Wirklichkeit und recht aus dem Vollen geschöpft sind die beiden großen Romane: »Soll und Haben« (1855) und »Die verlorene Handschrift« (1864). In dem einen ist es das kaufmännische Treiben, wie es dem Dichter in dem Breslauer Hause Molinari bekannt geworden war, in dem andern die Professorenwelt und im Gegensatz dazu das Leben auf einem Gutshofe, das den Untergrund für die Handlung abgibt. »Soll und Haben« erwarb dem Verfasser mit einem Schlage den Namen eines großen Romandichters; mit der »verlorenen Handschrift« hat er ihn behauptet.
Zur Zeit, wo dies Werk geschaffen wurde, war Freytag noch damit beschäftigt, seine »Bilder aus der deutschen Vergangenheit« abzuschließen (1866) und auf den Umfang von 5 Bänden, in dem sie nun vorliegen, abzurunden. Schon 1859 hatte er einzelne Skizzen, die in den »Grenzboten« erschienen waren – aus den Jahrhunderten der Reformation und des Dreißigjährigen Krieges – als Buch zusammengefaßt; die vorausgehenden und nachfolgenden Bände sind dann allmählich dazugewachsen. In der glücklichsten Weise sind hier Mitteilungen aus alten Quellenschriften (Chroniken, Biographien, Briefen) mit eigenen Schilderungen des Bearbeiters vereinigt. Sein Ziel war, wie er selbst sagt: »das Leben des Volkes, welches unter seiner politischen Geschichte in dunkler, unablässiger Strömung dahinflutet, die Zustände, Leiden und Freuden der Millionen kleiner Leute« anschaulich zu machen. Nach diesem Plane ist wirklich ein »Hausbuch gebildeter Familien« geschaffen worden, das zugleich einen ernsten wissenschaftlichen Charakter trägt; eben der Wissenschaft gehört es an, die öffentlich zu vertreten einst die Breslauer Fakultät dem jungen Dozenten verwehrt hatte.
In innerem Zusammenhange mit den »Bildern« steht die Reihe von acht Romanen, die Freytag unter dem Titel »Die Ahnen« 1872 begonnen und 1880 vollendet hat. Es sind 6 Bände von mäßigem Umfang, in denen ein und dasselbe Geschlecht von den Zeiten der Römerherrschaft bis ins neunzehnte Jahrhundert herab verfolgt wird. Die Absicht war, und es ist ohne Zweifel gelungen, in allem Wechsel der Zeiten, die geschildert werden, doch gewisse gemeinsame Charakterzüge der Familie und eine dadurch bedingte Gleichförmigkeit der Schicksale hervortreten zu lassen.
Man hat wohl daran gedacht, Freytag mit seinen Zeitgenossen Fritz Reuter, Theodor Storm, Gottfried Keller zu einer Gruppe zu vereinigen; zum Vergleich mit dem 10 Jahre jüngeren Scheffel fordert die Gemeinsamkeit mancher von ihnen behandelten Stoffe von selbst auf. Was Freytag von allen den Genannten trennt, ist einmal, daß er weniger als sie in dem Boden einer bestimmten Landschaft wurzelt; und dann, daß er nicht ausschließlich Dichter ist, sondern ebensosehr Gelehrter und Politiker. Aber eben diese Verschmelzung getrennter Interessen bedeutet einer überall zunehmenden Berufs- und Arbeitsteilung gegenüber keinen geringen Gewinn; und wenn dem Wirken des Mannes vielleicht dadurch etwas von Wärme entzogen wurde, daß er das eigentliche Feld seiner Tätigkeit außerhalb der Heimatprovinz und außerhalb des Staats fand, dem er von Geburt angehörte, so liegt doch darin wieder ein Zug zum Universellen, wie er dem lange zersplitterten Vaterlande gerade besonders not tat. Und so wird Freytag mit seinen Werken und mit seiner Persönlichkeit auf lange hinaus zu den Männern gehören, die zur Erziehung des deutschen Volkes und zumal der deutschen Jugend berufen sind.
Flensburg, Januar 1898. Paul Cauer.
Aus dem Staat Friedrichs des Großen.
Was war es doch, das seit dem Dreißigjährigen Kriege die Augen der Politiker auf den kleinen Staat heftete, der sich an der östlichen Nordgrenze Deutschlands gegen Schweden und Polen, gegen Habsburger und Bourbonen heraufrang? Das Erbe der Hohenzollern war kein reichgesegnetes Land, in dem der Bauer behaglich auf wohlbebauter Hufe saß, welchem reiche Kaufherren in schweren Galeonen die Seide Italiens, die Gewürze und Barren der neuen Welt zuführten. Ein armes, verwüstetes Sandland war's, die Städte ausgebrannt, die Hütten der Landleute niedergerissen, unbebaute Äcker, viele Quadratmeilen entblößt von Menschen und Nutzvieh, den Launen der Urnatur zurückgegeben. Als Friedrich Wilhelm 1640 unter den Kurhut trat, fand er nichts als bestrittene Ansprüche auf zerstreute Territorien von etwa 1450 Quadratmeilen, in allen festen Orten seines Stammlandes saßen übermächtige Eroberer. Auf einer unsichern Öde richtete der kluge, doppelzüngige Fürst seinen Staat ein, mit einer Schlauheit und Rücksichtslosigkeit gegen seine Nachbarn, welche sogar in jener gewissenlosen Zeit Aufsehen erregte, aber zugleich mit Heldenkraft und großem Sinn, der mehr als einmal die deutsche Ehre höher faßte, als der Kaiser oder ein anderer Fürst des Reiches. Und als der große Politiker 1688 starb, war, was er hinterließ, doch nur ein geringes Volk, gar nicht zu rechnen unter den Mächten Europas. Denn seine Herrschaft umfaßte zwar 2034 Quadratmeilen, aber höchstens 1 300 000 Menschen. Auch als Friedrich II. hundert Jahr nach seinem Ahnherrn die Regierung antrat, erbte er nicht mehr als 2 240 000 Seelen, weniger als jetzt die eine Provinz Schlesien umfaßt.
Der nächste Absatz und die folgenden Tabelle werden aus technischen Gründen nicht wie im Original als Fußnote wiedergegeben. Re.
Kurfürst Friedlich Wilhelm erbte 1451 Quadratmeilen mit vielleicht 700 000 Einwohnern, diese zum größten Teil im Ordensland Preußen, welches durch die Verwüstungen des Krieges nicht so sehr verödet war.
und Kriegswunden würden dort schneller geheilt, als wo anders, Wohlstand und Intelligenz nehme dort in größeren Verhältnissen zu, als in einem anderen Teile von Deutschland!
Was war es also, das sogleich nach den Schlachten des Dreißigjährigen Krieges die Eifersucht aller Regierungen, zumal des Kaiserhauses, erregte, das seither dem brandenburgischen Wesen so warme Freunde, so erbitterte Gegner zugeführt hat? Durch zwei Jahrhunderte wurden Deutsche und Fremde nicht müde, auf diesen neuen Staat zu hoffen, ebensolange haben Deutsche und Fremde nicht aufgehört, ihn zuerst mit Spott, dann mit Haß einen künstlichen Bau zu nennen, der starke Stürme nicht auszuhalten vermöge, der ohne Berechtigung sich unter die Mächte Europas eingedrängt habe. Und wie kam es endlich, daß schon nach dem Tode Friedrichs des Großen unbefangene Beurteiler ermahnten, man möge doch aufhören, dem vielgehaßten den Untergang zu prophezeien? Nach jeder Niederlage sei er um so kräftiger in die Höhe geschnellt, alle Schäden
Allerdings war es ein eigentümliches Wesen, eine neue Schattierung des deutschen Charakters, was auf dem eroberten Slawengrunde, in den Hohenzollern und ihrem Volke zutage kam. Mit herausfordernder Schärfe erzwang sich dies Neue Geltung. Es schien, daß die Charaktere dort größere Gegensätze umschlossen; denn Tugenden und Fehler seiner Regenten, Größe und Schwäche seiner Politik kamen in schneidenden Kontrasten zutage, die Beschränktheiten erschienen auffälliger, das Widerwärtige massenhafter, das Bewunderungswerte erstaunlicher; es schien, daß dieser Staat das Seltsamste und Ungewöhnlichste erzeugen, und nur die ruhige Mittelmäßigkeit, die sonst so erträglich und förderlich sein mag, nicht ohne Schaden vertragen könne.
Viel tat die Lage des Landes. Es war ein Grenzland zugleich gegen Schweden, Slawen, Franzosen und Holländer. Kaum eine Frage der europäischen Politik gab es, die nicht auf Wohl und Wehe des Staats einwirkte, kaum eine Verwicklung, welche tätigen Fürsten nicht Gelegenheit gab, Ansprüche geltend zu machen. Die sinkende Macht Schwedens, der beginnende Auflösungsprozeß in Polen erregten weitläufige Aussichten, die Übergewalt Frankreichs, die mißtrauische Freundschaft Hollands zwangen zu schlagfertiger Vorsicht. Seit dem ersten Jahre, in welchem Kurfürst Friedrich Wilhelm seine eigenen Festungen durch List und Gewalt in Besitz nehmen mußte, wurde offenbar, daß dort an der Ecke des deutschen Bodens ein kräftiges, umsichtiges, waffentüchtiges Regiment zur Rettung Deutschlands nicht entbehrt werden könne. Seit dem Beginn des französischen Krieges von 1674 erkannte Europa, daß die schlaue Politik, welche von dieser kleinen Ecke ausging, auch das staunenswerte Wagnis unternahm, die Westgrenze Deutschlands gegen den übermächtigen König von Frankreich heldenhaft zu verteidigen.
Es lag vielleicht auch etwas Auffallendes in dem Stammcharakter des brandenburgischen Volkes, an dem Fürsten und Untertanen gleichen Teil hatten. Die preußischen Landschaften hatten den Deutschen bis auf Friedrich den Großen verhältnismäßig wenig von Gelehrten, Dichtern und Künstlern abgegeben. Selbst der leidenschaftliche Eifer der Reformationszeit schien dort abgedämpft. Die Leute, welche in dem Grenzlande saßen, meist von niedersächsischem Stamme, mit geringer Beimischung von Slawenblut, waren ein hartes, knorriges Geschlecht, nicht vorzugsweise anmutig in den Formen ihres Lebens, aber von einem ungewöhnlich scharfen Verstande, nüchtern im Urteil; in der Hauptstadt schon seit alter Zeit spottlustig und von beweglicher Zunge, in allen Landschaften großer Anstrengungen fähig, arbeitsam, zäh, von dauerhafter Kraft.
Aber mehr als Lage und Stammcharakter des Volkes schuf dort der Charakter der Fürsten. In anderer Weise, als irgendwo seit den Tagen Karls des Großen geschah, haben sie ihren Staat gebildet. Manches Fürstengeschlecht zählt eine Reihe glücklicher Vergrößerer des Staats, auch die Bourbonen haben weites Gebiet zu einem großen Staatskörper zusammengezogen; manches Fürstengeschlecht hat einige Generationen tapferer Krieger erzeugt, keines war tapferer als die Wasa und die protestantischen Wittelsbacher in Schweden. Aber Erzieher des Volkes ist keins gewesen wie die alten Hohenzollern. Als große Gutsherren auf verwüstetem Lande haben sie die Menschen geworben, die Kultur geleitet, durch fast hundertfünfzig Jahre als strenge Hauswirte gearbeitet, gedacht, geduldet, gewagt und unrecht getan, um ein Volk für ihren Staat zu schaffen, wie sie selbst: hart, sparsam, gescheit, keck, das Höchste für sich begehrend.
In solchem Sinne hat man recht, den providentiellen Charakter des preußischen Staats zu bewundern. Von den vier Fürsten, welche ihn seit dem deutschen Kriege bis zu dem Tage regierten, wo der greise Abt im Kloster Sanssouci die müden Augen schloß, hat jeder mit seinen Tugenden und Fehlern wie eine notwendige Ergänzung seines Vorgängers gelebt. Kurfürst Friedrich Wilhelm, der größte Staatsmann aus der Schule des deutschen Krieges, der prachtliebende erste König Friedrich, der sparsame Despot Friedrich Wilhelm I., zuletzt er, in welchem sich die Anlagen und großen Eigenschaften fast aller seiner Vorfahren zusammen fanden, im 18. Jahrhundert die Blüte des Geschlechts.
Es war eine freudeleeres Leben im Königsschloß zu Berlin, als Friedrich heranwuchs, so arm an Liebe und Sonnenschein, wie in wenig Bürgerhäusern jener rauhen Zeit. Man darf zweifeln, ob der König, sein Vater, oder die Königin größere Schuld an der Zerrüttung des Familienlebens hatten, beide nur durch Fehler ihres Naturells, welche in den unaufhörlichen Reibungen des Hauses immer größer wurden. Der König, ein wunderlicher Tyrann, mit weichem Herzen, aber einer rohen Heftigkeit, die mit dem Stocke Liebe und Vertrauen erzwingen wollte, von scharfem Menschenverstand, aber so unwissend, daß er immer in Gefahr kam, Opfer eines Schurken zu werden, und in dem dunklen Gefühl seiner Schwäche wieder mißtrauisch und von jäher Gewaltsamkeit; die Königin dagegen, keine bedeutende Frau, von kälterem Herzen, mit einem starken Gefühl ihrer fürstlichen Würde, dabei mit vieler Neigung zur Intrige, ohne Vorsicht und Schweigsamkeit. Beide hatten den besten Willen und gaben sich ehrlich Mühe, ihre Kinder zu tüchtigen und guten Menschen zu machen, aber beide störten unverständig das gesunde Aufleben der Kinderseele. Die Mutter hatte die Taktlosigkeit, die Kinder schon im zarten Alter zu Vertrauten ihres Ärgers und ihrer Intrigen zu machen; denn über die unholde Sparsamkeit des Königs, über die Schläge, die er so reichlich in seinen Zimmern austeilte, und über die einförmige Tagesordnung, die er ihr aufzwang, nahm in ihren Gemächern Klage, Groll, Spott kein Ende. Der Kronprinz Friedrich wuchs im Spiel mit seiner älteren Schwester heran, ein zartes Kind mit leuchtenden Augen und wunderschönem blonden Haar. Pünktlich wurde ihm gerade so viel gelehrt, als der König wollte, und das war wenig genug: Französisch, etwas Geschichte und was einem Soldaten damals für nötig galt, dazu kaum etwas lateinische Deklination, und zwar gegen den Willen des Vaters, – der große König ist nie über die Schwierigkeiten des Genitivs und Dativs herausgekommen. Die Frauen brachten dem Knaben, der sich gern gehen ließ und in Gegenwart des Königs scheu und trotzig aus den Kinderaugen sah, das erste Interesse an französischer Literatur bei; er selbst hat später seine Schwester darum gerühmt, aber auch seine Gouvernante war eine kluge Französin. Daß dem König das fremde Wesen verhaßt war, trug sicher dazu bei, es dem Sohne wert zu machen, denn fast systematisch wurde in den Appartements der Königin das gelobt, was dem strengen Hausherrn mißfiel. Und wenn der König in der Familie eine seiner polternden frommen Reden hielt, dann sahen die Prinzeß Wilhelmine und der junge Friedrich einander so lange bedeutsam an, bis das herausfordernde Gesicht, das eines der Kinder machte, die kindische Lachlust erregte und den Grimm des Königs zum Ausbruch brachte. Dadurch wurde der Sohn schon in frühen Jahren dem Vater ein Gegenstand des Ärgers. Einen effeminierten Kerl schalt er ihn, der sich malproper halte und eine unmännliche Freude an Putz und Spielereien habe.
Aber aus dem Bericht seiner Schwester, deren schonungslosem Urteil der Tadel leichter wird als das Lob, ist auch zu sehen, wie die Liebenswürdigkeit des reichbegabten Knaben auf seine Umgebung wirkte. Wenn er mit der Schwester heimlich eine französische Geschichte las und den ganzen Hof in die komischen Charaktere des Romans umdeutete, wenn sie mit Flöte und Laute verpönte Musik machten, wenn er die Schwester verkleidet besuchte und sie die Rollen einer französischen Komödie gegeneinander rezitierten. Aber selbst bei diesen harmlosen Freuden wurde der Prinz fortwährend in Lüge, Täuschung, Verstellung gedrängt. Er war stolz, hochgesinnt, großmütig, von rücksichtsloser Wahrheitsliebe. Daß ihm die Verstellung innerlichst widerstand, daß er sich, wo sie verlangt wurde, nicht dazu herablassen wollte, und wo er es einmal tat, ungeschickt heuchelte, das machte seine Stellung zum Vater immer schwieriger, größer wurde das Mißtrauen des Königs, immer wieder brach dem Sohn das verletzte Selbstgefühl als Trotz hervor.