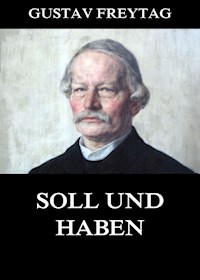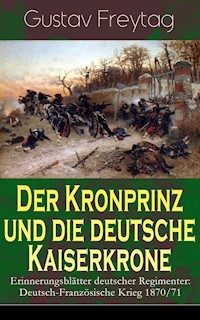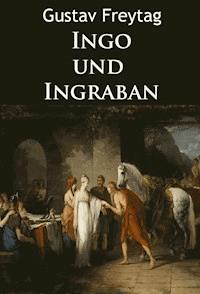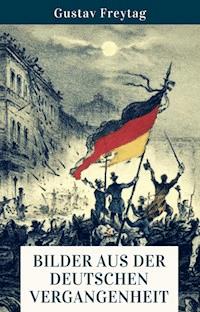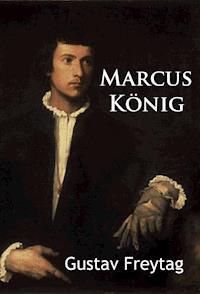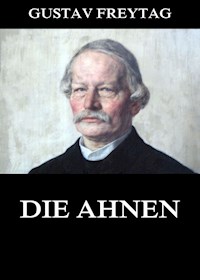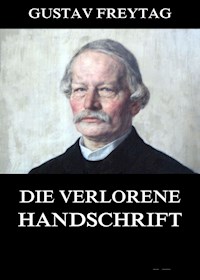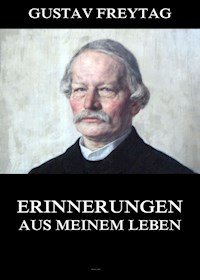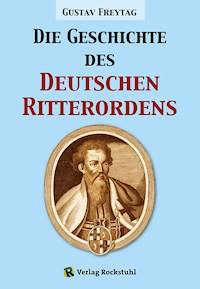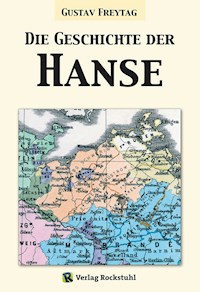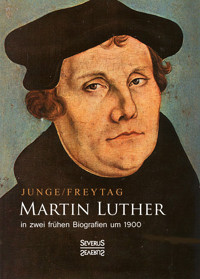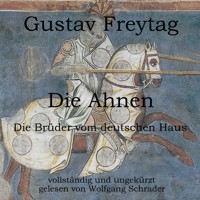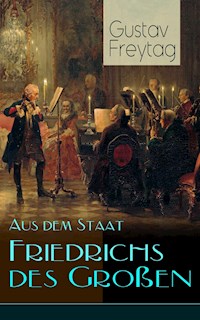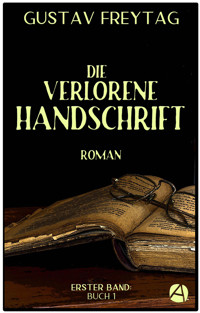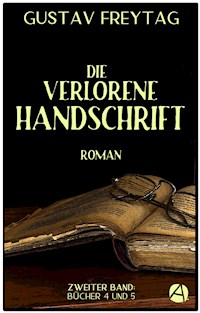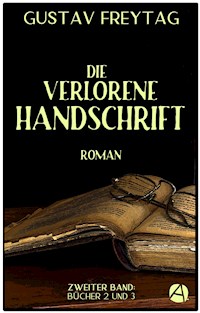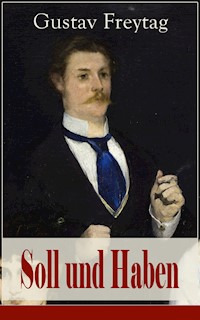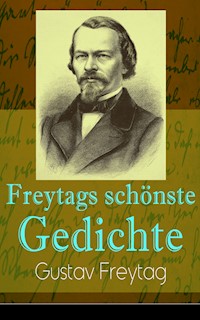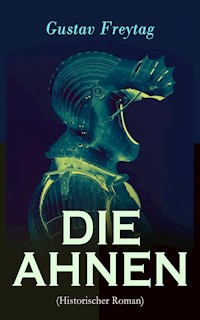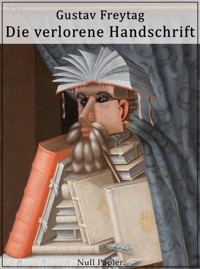
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
"Indiana Jones" trifft "Der Name der Rose": eine Schatzsuche im Universitäts-Milieu des 19. Jahrhunderts. Doktor Fritz Hahn und Professor Felix Werner suchen die verlorene Handschrift des Tacitus. Einen ersten Hinweis auf den Fundort macht der Professor in einem Bibliotheksverzeichnis. Das gesuchte Objekt soll sich in einem Kloster befinden. Dort macht der Professor Bekanntschaft mit der lieblichen und nicht weniger patenten Ilse, während sich Doktor Hahn mit der Tochter eines alten Erbfeindes auseinandersetzen muss. Für Spannung ist gesorgt in diesem unterhaltsamen Professorenroman des Erfolgsschriftstellers Gustav Freytag. "Das ist mein Lieblingsbuch. Seit meiner Jugend bis heute." B. Gregor (gustav-freytag.info) Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1283
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gustav Freytag
Die verlorene Handschrift
Historischer Roman in fünf Büchern
Gustav Freytag
Die verlorene Handschrift
Historischer Roman in fünf Büchern
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954187-64-5
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Editorische Anmerkungen
Erstes Buch
Erstes Kapitel -- Eine gelehrte Entdeckung
Zweites Kapitel -- Die feindlichen Nachbarn
Drittes Kapitel -- Die Reise ins Blaue
Viertes Kapitel -- Das alte Haus
Fünftes Kapitel -- Zwischen Herden und Garben
Sechstes Kapitel -- Eine gelehrte Frau vom Lande
Siebentes Kapitel -- Neue Feindseligkeit
Achtes Kapitel -- Noch einmal Tacitus
Neuntes Kapitel -- Ilse
Zehntes Kapitel -- Die Werbung
Elftes Kapitel -- Speihahn
Zwölftes Kapitel -- Der Abschied vom Gute
Zweites Buch
Erstes Kapitel -- Die ersten Grüße aus der Stadt
Zweites Kapitel -- Ein Tag der Besuche
Drittes Kapitel -- Unter den Gelehrten
Viertes Kapitel -- Der Professorenball
Fünftes Kapitel -- Herr Hummel als Falsarius
Sechstes Kapitel -- Kleine Gegensätze
Siebentes Kapitel -- Die Erkrankung
Achtes Kapitel -- Eine Frage der Residenz
Drittes Buch
Erstes Kapitel -- Die Buttermaschine
Zweites Kapitel -- Aus drei Kabinetten
Drittes Kapitel -- Vielliebchen
Viertes Kapitel -- Unter den Studenten
Fünftes Kapitel -- Alles gestört
Sechstes Kapitel -- Vor dem Drama
Viertes Buch
Erstes Kapitel -- Der Fürst
Zweites Kapitel -- Im Pavillon
Drittes Kapitel -- Zwei neue Gäste
Viertes Kapitel -- Neckereien
Fünftes Kapitel -- Hummels Triumph
Sechstes Kapitel -- Ein Kapitel aus der verlorenen Handschrift
Siebentes Kapitel -- Der Hummeln Zäsarenwahnsinn
Achtes Kapitel -- Alte Bekannte
Neuntes Kapitel -- Im Turm der Prinzessin
Zehntes Kapitel -- Ilses Flucht
Elftes Kapitel -- Der Obersthofmeister
Fünftes Buch
Erstes Kapitel -- Des Magisters Ausgang
Zweites Kapitel -- Vor der Entscheidung
Drittes Kapitel -- Auf dem Weg zum Steine
Viertes Kapitel -- In der Höhle
Fünftes Kapitel -- Tobias Bachhuber
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Editorische Anmerkungen
Ich habe den Text behutsam in die aktuelle Deutsche Rechtschreibung übertragen, davon unberührt blieben natürlich alle Passagen in Mundart.
Erstes Buch
Erstes Kapitel -- Eine gelehrte Entdeckung
Es ist später Abend in unserm Stadtwald, leise wispert das Laub in der lauen Sommerluft und aus der Ferne tönt das Geschwirr der Feldgrillen bis unter die Bäume.
Durch die Gipfel fällt bleiches Licht auf den Waldweg und das undeutliche Geäst des Unterholzes. Der Mond besprengt den Pfad mit schimmernden Flecken, er zündet im Gewirr der Blätter und Zweige verlorene Lichter auf, hier läuft es vom Baumstamme bläulich herab wie brennender Spiritus, dort im Grunde leuchten aus tiefer Dunkelheit die Wedel eines Farnkrautes in grünlichen Golde, und über dem Weg ragt der dürre Ast als ungeheures weißes Geweih. Dazwischen aber und darunter schwarze, greifbare Finsternis. Runder Mond am Himmel, deine Versuche den Wald zu erleuchten sind unordentlich, bleichsüchtig und launenhaft. Bitte, beschränke deine Lichter auf den Damm, der zur Stadt führt, wirf deinen falben Schein nicht allzu schräge über den Weg hinaus, denn linker Hand geht es abschüssig in Sumpf und Wasser.
Pfui, du Lügner! Da ist der Sumpf, und der Schuh blieb darin stecken. Aber dir ist das gerade recht, Täuschen und Betrügen ist deine liebste Arbeit, du Phantast unter den Sternen. Man wundert sich allgemein, dass die Menschen der Vorzeit dich als Gott verehrten. Einst hat das griechische Mädchen dich Selene gerufen und sie hat dir die Schale mit purpurnem Mohn bekränzt, um durch deinen Zauber den treulosen Geliebten zu ihrer Türschwelle zu locken. Damit ist es für immer vorbei. Wir haben die Wissenschaft und Fotogen, und du bist herabgekommen zu einem armen alten Gaukler, der fern von Menschen im Walde umherflackert. Zu einem Gaukler! Man erweist dir noch allzu viel Ehre, wenn man dich überhaupt als lebendes Wesen behandelt. Was bist du denn eigentlich? Eine Kugel ausgebrannter blasiger Schlacke, luftlos, farbenlos, wasserlos. Bah! Eine Kugel? Unsere Gelehrten wissen, dass du nicht einmal rund bist, auch darin lügst du. Wir von der Erde haben dich nach unserer Seite in die Länge gezogen. Du bist gewissermaßen zugespitzt, und deine Gestalt ist erbärmlich und unregelmäßig. Du bist nichts als eine Art großer Erdrübe, welche sich in ewiger Sklaverei um uns herumwälzt.
Der Wald lichtet sich, zwischen der Stadt und dem Wanderer liegt noch eine weite Rasenfläche mit ihrem Weiher. Sei gegrüßt, du grüner Talgrund; wohlgepflegte Kieswege ziehen sich über die Waldwiese, hier und da erhebt sich lustiges Gebüsch und eine Gartenbank. Auf der Bank rastet bei Tage der wohlhäbige Bürger; die Hände auf das spanische Rohr gestützt, sieht er stolz nach den Türmen seiner guten Stadt hinüber. Ist heut auch die Flur verwandelt? Vor dem Wanderer breitet sich’s wie eine wogende Wasserfläche, und es wallt, brodelt und ballt sich um die Füße, in endlosen Nebelmassen soweit das Auge reicht. Welches Geisterheer wäscht hier seine grauen Gewänder? Sie flattern von den Bäumen, sie ziehen durch die Luft, mattscheinend, zerfließend, sich wieder verwebend. Und höher erheben sich die dämmrigen Gebilde. Sie schweben dem Wanderer über das Haupt, die düstern Massen der Bäume verschwinden, auch den Himmel verbirgt die Dämmerung, jeder Umriss löst sich auf in ein Chaos von bleichem Licht und wogender Unform. Noch dauert die feste Erde unter den Füßen des Schreitenden, und doch wandelt er geschieden von allen wirklichen Gestalten der Erde unter leuchtenden körperlosen Schatten. Hier sammelt sich’s und dort wieder zu schwebendem Scheine. Langsam schweifen die Luftgebilde an dem Flor, der den Wanderer umhüllt. Hier dringt eine gebeugte Gestalt heran, einem knienden Weibe vergleichbar, das vor Schmerz zusammenbricht, dort ein Zug in langen wallenden Gewändern wie römische Senatoren, an ihrer Spitze ein Kaiser mit der Strahlenkrone, aber die Krone und das Haupt zerfließen, kopflos und gespenstig gleitet der große Schatten vorüber. -- Dunst der feuchten Wiese, wer hat dich so verwandelt, Wetter! Das tat wieder der Alte dort oben, der gaukelnde Mond.
Weicht hinterwärts, täuschende Bilder der Dämmerung. Das Tal ist durchschritten, vor dem Wanderer schimmern erleuchtete Fenster, hier ragen die nächsten Häuser der Stadt, zwei stattliche Häuser und zwei Hausbesitzer! Hier wohnen Menschen, Steuerzahler, rührig Schaffende; sie hüllen sich zur Nacht in warme Decken und nicht in deine wässerigen Gespinste, o Mond, welche als rollende Tropfen von Haar und Bart träufeln; sie haben ihre Launen und ihre Biederkeit und schätzen deinen Wert, Mond, genau nach den Summen, die du der Stadtkasse an Gaslicht ersparst.
In dem Hause zur linken Hand glänzt aus der obern Fensterreihe eine Lampe nahe den Scheiben. Vergeblich mühst du dich, bleiches Wolkenlicht, deine trügenden Strahlen auch dort hineinzuwerfen. Denn ihn, der dort wohnt, sollst du mit deinen Possen nicht kränken, er ist ein Kind der Sonne und ein Held dieser Geschichte. Es ist der Professor Felix Werner, ein gelehrter Philolog, noch ein junger Herr, aber von wohlverdientem Ruf. Da sitzt er an seinem Arbeitstisch und blickt auf verblichene alte Schrift; ein ansehnlicher Mann; wenn er aufsteht, von guter Mittelgröße, dunkles gelocktes Haar umgibt ihm ein großes Antlitz von kräftiger Bildung, nichts Kleines darin, helle treue Augen unter dunkeln Brauen, die Nase leicht gebogen, die Muskeln des Mundes stark entwickelt, wie bei einem beliebten Lehrer der studierenden Jugend natürlich ist. Jetzt gerade fährt ein feines Lächeln darüber und die Wangen sind ihm von der Arbeit oder geheimer Aufregung gerötet. Verschwinde hinter einer Wolke, Mond, die Gesellschaft meines Professors ist mir lieber.
Der Professor sprang von seinem Arbeitstisch auf und durchschritt einige Male eifrig das Zimmer, dann trat er an ein Fenster, welches auf das Nachbarhaus hinaussah, stellte zwei große Bücher auf das Fensterbrett, legte ein kleineres darüber und brachte dadurch eine Figur hervor, welche einem griechischen P ähnlich sah und durch den Lichtschein dahinter für die Augen im Nachbarhause sichtbar wurde. Nachdem er dies telegrafische Zeichen gezimmert hatte, eilte er wieder an den Tisch und beugte sich von neuem über sein Buch.
Der Diener trat leise ein, das Abendessen wegzuräumen, welches auf einem Seitentisch zurechtgestellt war. Da er die Speisen unberührt fand, blickte er missbilligend auf den Professor und blieb lange hinter dem leeren Stuhl stehen. Endlich rückte er sich in militärische Haltung: »Der Herr Professor haben das Abendbrot vergessen.«
»Räumen Sie ab, Gabriel«, befahl der Professor.
Gabriel bewies keinen guten Willen. »Der Herr Professor sollten wenigstens ein Stück kalten Braten zu sich nehmen. Aus nichts wird nichts«, fügte er wohlwollend hinzu.
»Es ist nicht in der Ordnung, dass Sie hereinkommen, mich zu stören.«
Gabriel nahm einen Teller und trug ihn zum Professor. »Nehmen der Herr Professor wenigstens ein paar Bissen.«
»So geben Sie«, sagte der Professor und aß.
Gabriel benutzte die Pause, in welcher sein Herr widerstandslos bei verständlicher Tätigkeit verweilte, zu einer respektvollen Anmahnung: »Mein seliger Hauptmann hielt sehr auf ein gutes Abendessens...«
»Jetzt aber sind Sie ins Zivile übersetzt,« versetzte der Professor lächelnd.
»Es ist aber auch nicht in der Ordnung,« fuhr Gabriel hartnäckig fort, »wenn ich allein den Braten esse, den ich für Sie hole.«
»Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden,« versetzte der Professor und schob ihm den Teller zurück.
Gabriel zuckte die Achseln. »Es ist zum wenigsten guter Wille. Der Herr Doktor war nicht zu Hause.«
»Ich sehe. Sorgen Sie dafür, dass die Haustür geöffnet bleibt.«
Gabriel machte kehrt und entfernte sich mit den Tellern.
Wieder war der Gelehrte allein, das goldene Licht der Lampe fiel auf sein Antlitz und die Bücher, welche um ihn lagen, schneller rauschten die weißen Blätter unter der Hand des Nachfragenden und in starker Spannung arbeiteten seine Züge.
Da pochte es an die Tür, der erwartete Besuch trat ein.
»Guten Abend, Fritz,« rief der Professor dem Eintretenden entgegen, »setze dich auf meinen Platz und sieh hierher.«
Der Gast, eine zarte Gestalt, mit feinen Zügen und einer Brille vor den Augen, rückte sich gehorsam zurecht und ergriff ein kleines Buch, welches Mittelpunkt eines Kreises von aufgeschlagenen Werken in jedem Alter und Format war. Mit Kennerblicken musterte er zuerst den Deckel: geschwärztes Pergament mit alten Noten und darunter geschriebenem Kirchentext, er warf einen spähenden Blick auf das Innere des Einbandes und suchte nach den Pergamentstreifen, durch welche der übelerhaltene Rücken des Buches mit dem Deckel verbunden war. Dann erst sah er auf das erste Blatt des Inhalts, auf die vergilbten Buchstaben des geschriebenen Textes. »Das Leben der heiligen Hildegard -- die Hand des Schreibers aus dem fünfzehnten Jahrhundert,« -- sprach er, und sah den Freund fragend an.
»Nicht deshalb zeige ich dir das alte Buch. Sieh weiter. Der Lebensgeschichte folgen Gebete, eine Anzahl Rezepte und Wirtschaftsregeln von verschiedenen Händen bis über die Zeit Luthers hinaus. Ich hatte diese Blätter für dich gekauft, du konntest darin vielleicht etwas für deine Sagen oder Volksaberglauben finden. Bei der Durchsicht aber traf ich auf einer der letzten Seiten diese Stelle, und ich muss dir jetzt das Buch noch vorenthalten. Es scheint, dass mehrere Generationen eines Mönchsklosters das Buch benutzt haben, um Bemerkungen einzuzeichnen, denn auf diesem Blatt ist ein Verzeichnis von Kirchenschätzen des Klosters Rossau. Es war ein dürftiges Kloster, das Verzeichnis ist nicht groß oder nicht vollständig. Es wurde von einem unwissenden Mönch, soweit man aus seiner Schrift schließen kann, etwa um 1500 gemacht. Sieh, hier Kirchengerät und wenige geistliche Gewänder, und hier einige theologische Handschriften des Klosters, für uns gleichgültig, darunter aber zuletzt folgender Titel: ›Das alt ungehür puoch von ußfart des swigers.‹«
Der Doktor prüfte neugierig die Worte. »Das klingt wie Überschrift eines Rittergedichts. Und was bedeuten die Worte selbst: Ist der Ausfahrende ein Schwieger oder ein Schweigender?«
»Versuchen wir das Rätsel zu lösen,« fuhr der Professor mit glänzenden Augen fort, und wies mit dem Finger auf dasselbe Blatt. »Eine spätere Hand hat in lateinischer Sprache dazugeschrieben: ›Dies Buch ist latein, fast unlesbar, fängt an mit den Worten: lacrimas et signa und endet mit den Worten: Hier schließt der Geschichten -- actorum -- dreißigstes Buch.‹ Jetzt rate.«
Der Doktor sah in das erregte Gesicht des Freundes: »Lass mich nicht warten. Die Anfangsworte klingen vielversprechend, aber ein Titel sind sie nicht, es mögen im Anfange Blätter gefehlt haben.«
»So ist es,« versetzte der Professor vergnügt. »Nehmen wir an: ein, zwei Blätter haben gefehlt. Im fünften Kapitel der Annalen des Tacitus stehen die Worte lacrimas et signa hintereinander.«
Der Doktor sprang auf, auch ihm flog ein freudiges Rot über das Antlitz.
»Setze dich,« fuhr der Professor fort, den Freund niederdrückend. »Der alte Titel von den Annalen des Tacitus lautete wörtlich übersetzt: ›Tacitus vom Ausgange des göttlichen Augustus‹, besser Deutsch: ›Vom Hinscheiden des Augustus ab.‹ Wohlan, ein unwissender Mönch entzifferte auf irgendeinem Blatte die ersten lateinischen Worte der Überschrift: ›Taciti ab excessu‹ und versuchte sie ins Deutsche zu übersetzen. Er war froh zu wissen, dass tacitus schweigsam bedeutet, hatte aber nie etwas von dem römischen Geschichtsschreiber gehört, und übertrug also wörtlich: Vom Ausgange des Schweigenden.«
»Vortrefflich,« rief der Doktor. »Und der Mönch schrieb seine gelungene Übersetzung des Titels auf die Handschrift. Triumph! Die Handschrift war ein Tacitus.«
»Höre noch weiter,« ermahnte der Professor. »Im dritten und vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung bestanden die beiden großen Werke des Tacitus, die Annalen und Historien, in einer Sammlung vereint unter dem Titel: Dreißig Bücher Geschichten. Wir haben dafür mehrere alte Zeugnisse, sieh her.«
Der Professor schlug bekannte Stellen auf und legte sie vor den Freund. »Und wieder am Ende der verzeichneten Handschrift stand: ›Hier schließt das dreißigste Buch der Geschichten.‹ Dadurch schwindet, wie mir scheint, jeder Zweifel, dass diese Handschrift ein Tacitus war. Und um das Ganze zusammenzufassen, war das Sachverhältnis folgendes: Zur Zeit der Reformation befand sich eine Handschrift des Tacitus im Kloster Rossau, der Anfang fehlte. Es war eine alte Handschrift, sie war durch die Zeit und ihre Schicksale für Mönchsaugen fast unlesbar geworden.«
»Es muss aber an dem Buch noch etwas Besonderes gehangen haben,« unterbrach der Doktor, »denn der Mönch bezeichnet es mit dem Ausdruck: ungeheuer, welches etwa unserm Wort unheimlich entspricht.«
»So ist es,« bestätigte der Professor. »Man darf mutmaßen, dass entweder eine Klostersage, die sich drangeheftet hatte, oder ein altes Verbot, das Buch zu lesen, oder wahrscheinlicher eine ungewöhnliche Beschaffenheit des Deckels oder Formats diese Bezeichnung verursacht hat. Die Handschrift enthielt beide Geschichtswerke des Tacitus, welche durch fortlaufende Bücherzahl verbunden waren. Und wir,« fuhr er fort und warf in der Aufregung das Buch, welches er in der Hand hielt, auf den Tisch, »wir besitzen diese Handschrift nicht mehr. Keines von den beiden Geschichtswerken des großen Römers ist uns vollständig erhalten; uns fehlt, wenn wir die Lücken zusammenrechnen, wohl mehr als die Hälfte.«
Der Freund durchschritt hastig das Zimmer. »Das ist eine von den Entdeckungen, die das Blut schneller in die Adern treibt. Dahin und verloren! Aber es überläuft einen heiß, wenn man deutlich empfindet, dass so wenig fehlte, einen kostbaren Schatz des Altertums für uns zu retten. Er hat Völkermord, Brand und Zerstörung von anderthalb Jahrtausenden überdauert, er liegt noch zu der Zeit, wo das Morgenrot der neuen Bildung bei uns hereinbricht, glücklich verborgen und unbeachtet in einem deutschen Kloster, wenige Wegstunden von der großen Völkerstraße, auf welcher die Humanisten hin und her wandern, die Bilder römischer Herrlichkeit im Haupte, begierig nach jeder Überlieferung aus der Römerzeit suchend. Und kaum eine Tagreise entfernt erblühen Universitäten, auf denen die Jugend sich begeistert in lateinischen Versen und Prosa übt. Es lag so nahe, dass irgendein Mönch aus Rossau einem Ordensbruder davon erzählte, der die Kunde nach Mainz oder Köln trug. Es scheint unbegreiflich, dass nicht einer von den lateinischen Schullehrern, die sich damals über das ganze Land verbreiteten, Nachricht von dem Buche erhielt und den Brüdern etwas von dem Wert eines solchen Denkmals sagte. Und wie natürlich war, dass der geistliche Herr, welcher die Oberaufsicht über das Kloster übte, von dem geheimnisvollen Bande erfuhr und neugierig die verblichenen Blätter umschlug. Selbst dann wäre doch eine Kunde in die Welt gedrungen und die Handschrift uns wahrscheinlich irgendwo erhalten. Aber nichts von alledem. Und im besten Fall hat ein Zeitgenosse von Erasmus und Melanchthon, ein armer hungernder Mönch, die Handschrift an den Buchbinder verkauft, und abgeschnittene Streifen kleben noch irgendwo an alten Einbänden. Sogar dafür ist diese Nachricht wichtig. Das war eine schmerzliche Freude, die dir das kleine Buch bereitet hat.«
Der Professor fasste die Hand des Freundes, die beiden Männer sahen einer dem andern in das treue Gesicht. »Nehmen wir an, der alte Erbfeind erhaltener Schätze, das Feuer, habe auch diese Handschrift verzehrt«, schloss der Doktor traurig. »Wir sind Kinder, dass wir den Verlust empfinden, als hätten wir ihn heut erlitten.«
»Wer sagt uns, dass die Handschrift unwiederbringlich verloren ist?«, entgegnete der Professor in unterdrückter Bewegung. »Noch einmal setze dich vor das Buch, es weiß uns auch von den Schicksalen der Handschrift zu erzählen.«
Der Doktor sprang an den Tisch und ergriff das Büchlein von der heiligen Hildegard.
»Hier hinter dem Verzeichnis,« sprach der Professor und wies auf die letzte Seite des Buches, »steht noch mehr.«
Der Doktor starrte auf das Blatt, lateinische Buchstaben ohne Sinn und Wortabsatz waren in sieben Zeilen zusammengeschrieben, darunter stand ein Name: F. Tobias Bachhuber.
»Vergleiche diese Buchstaben mit jener lateinischen Bemerkung neben dem Titel der unheimlichen Handschrift. Es ist unzweifelhaft dieselbe Hand, feste Züge des siebzehnten Jahrhunderts, hier das s, r, das f.«
»Es ist dieselbe Hand,« rief der Doktor vergnügt.
»Die Buchstaben ohne Sinn sind kindliche Geheimschrift, wie man sie im siebzehnten Jahrhundert übte. Diese hier ist leicht zu lösen, jeder Buchstabe ist mit seinem folgenden vertauscht. Auf einen Zettel habe ich die lateinischen Worte des Textes zusammengestellt. Die Worte lauten auf deutsch: Beim Herannahen des wütenden Schweden habe ich, um den verzeichneten Schatz unseres Klosters den Nachstellungen des brüllenden Teufels zu entziehen, dies alles an einer trocknen und hohlen Stelle des Hauses Bielstein niedergelegt. Am Tage Quasimodogeniti 37. Also am 19. April 1637. -- Was sagst du nun, Fritz? Es scheint doch, die Handschrift war bis in den Dreißigjährigen Krieg nicht verbrannt, denn Frater Tobias Bachhuber -- sein Andenken sei gesegnet -- hat sie in dieser Zeit noch einer Betrachtung gewürdigt, und da er ihr in dem Verzeichnis eine besondere Anmerkung gönnt, wird er sie zuverlässig bei der Flucht nicht zurückgelassen haben. Die geheimnisvolle Handschrift war also bis zum Jahre 1637 im Kloster Rossau, und der Frater hat sie im April dieses Jahres mit anderer Habe in der hohlen und trockenen Stelle des Schlosses Bielstein vor Baners Schweden verborgen.«
»Jetzt wird die Sache ernst,« rief der Doktor.
»Ja, es ist Ernst, mein Freund; nicht unmöglich, dass die Handschrift noch irgendwo verborgen dauert.«
»Und Schloss Bielstein?«
»Es liegt nahe bei dem Städtchen Rossau. Das Kloster hat unter dem Schutze des geistlichen Schirmherrn bis zum Dreißigjährigen Kriege in dürftigen Verhältnissen fortbestanden; im Jahre 1637 wurde Stadt und Kloster durch die Schweden verwüstet. Die letzten Mönche verloren sich, das Kloster wurde nicht wieder eingerichtet. Das ist alles, was ich zur Zeit erfahren konnte. Für das Weitere erbitte ich deine Hilfe.«
»Die nächste Frage ist, ob das Schloss den Krieg überdauert hat,« versetzte der Doktor, »und was bis jetzt daraus geworden. Schwerer wird zu ermitteln sein, wo Bruder Tobias Bachhuber geendet hat, und am schwersten, durch welche Hände sein kleines Buch auf uns gekommen ist.«
»Das Buch fand ich heut bei einem hiesigen Antiquar, es war neuer Erwerb und noch nicht in sein Verzeichnis aufgenommen. Die weitere Auskunft, welche der Verkäufer etwa geben kann, werde ich morgen holen. Es lohnt doch, nachzufragen,« fuhr er kühler fort, bemüht, einen Strom verständiger Erwägung über die aufbrennende Glut seiner Hoffnungen zu leiten. »Seit jener geheimen Notiz des Fraters sind mehr als zweihundert Jahre verflossen, die zerstörenden Kräfte waren in dieser Zeit nicht weniger tätig als früher, vor andern Krieg und Raub der Jahre, in denen das Kloster zugrunde ging. So sind wir zuletzt nicht weiter, als wenn die Handschrift einige hundert Jahre früher verloren wäre.«
»Und doch steigt mit jedem Jahrhundert die Wahrscheinlichkeit, dass die Handschrift bis zur Gegenwart erhalten ist,« warf der Doktor ein, »selbst wenn man für jedes Jahrhundert eine gleiche Zahl von Angriffen auf das Bestehende annimmt. Aber die Zahl der Menschen, welche das Merkwürdige eines solchen Fundes ahnen, ist seit jenem Kriege so groß geworden, dass wenigstens eine Zerstörung durch rohe Unwissenheit fast undenkbar wird.«
»Wir dürfen darin auch dem Wissen der Gegenwart nicht zu viel vertrauen,« warf der Professor ein. »Wenn es aber wäre,« fuhr er auf, und seine Augen strahlten, »wenn uns die Kaisergeschichte des ersten Jahrhunderts, wie sie Tacitus geschrieben, durch ein günstiges Geschick zurückgegeben würde, es wäre ein Geschenk, so groß, dass der Gedanke an die Möglichkeit einen ehrlichen Mann wohl berauschen darf, wie römischer Wein.«
»Unschätzbar,« bestätigte der Doktor, »für unsre Kenntnis der Sprache, für hundert Einzelheiten römischer Geschichte.«
»Für die älteste Geschichte deiner Germanen,« rief der Professor.
Beide maßen wieder mit schnellen Schritten die Stube, schüttelten einander die Hände und sahen einer den andern fröhlich an.
»Und wenn ein günstiger Zufall auf dieser Spur zu der Handschrift leitete,« begann Fritz, »wenn sie durch dich dem Tageslicht zurückgegeben würde, du, mein Freund, du bist auch der beste Mann, sie herauszugeben. Der Gedanke, dass deinem Leben eine solche Freude und so ruhmvolle Arbeit werden könnte, macht mich glücklicher als ich sagen kann.«
»Finden wir die Handschrift,« versetzte der Professor, »so kann sie nur von uns beiden zusammen herausgegeben werden.«
»Von uns?«, fragte Fritz verwundert.
»Von dir mit mir,« entschied der Professor, »das soll deine Tüchtigkeit in weiteren Kreisen bekanntmachen.«
Fritz trat zurück. »Wie kannst du glauben, dass ich so etwas annehmen würde?«
»Widersprich mir nicht,« rief der Professor, »du bist vollkommen dafür geeignet.«
»Das bin ich nicht,« versetzte Fritz fest, »und ich bin zu stolz, etwas zu unternehmen, wobei ich deiner Güte mehr verdankte als meiner Kraft.«
»Das ist ungeschickte Bescheidenheit,« rief der Professor wieder.
»Ich werde es nie tun,« entgegnete Fritz. »Du verleugnest dein Zartgefühl, wenn du nur einen Augenblick daran denkst, dass ich mich vor dem Publikum mit fremden Federn schmücken könnte.«
»Ich weiß besser als du,« rief unwillig der Professor, »was du vermagst und was dir frommt.«
»Jedenfalls frommt mir nicht, dir, der du bei der Arbeit selbst den Löwenanteil haben würdest, den Lohn dafür heimlich abzunagen. Nicht meine Bescheidenheit, sondern meine Selbstschätzung verbietet das. Und dies Gefühl sollst du ehren,« schloss Fritz mit großer Energie.
»Nun,« lenkte der Professor ein, die auflodernde Empfindung bändigend, »vorläufig gebärden wir uns wie der Mann, welcher Haus und Acker vom Erlös eines Kalbes kaufte, das ihm noch nicht geboren war. Sei ruhig, Fritz, nicht du, nicht ich werden die Handschrift herausgeben.«
»Und niemals werden wir erfahren, was römische Kaiser an Thusnelda und Thumelicus gefrevelt haben,« sagte Fritz und trat wieder teilnehmend zu dem Freunde.
»Aber es sind doch nicht Einzelheiten, welche uns den größten Gewinn brächten,« begann der Professor ruhiger, »und nicht, dass wir diese missen, macht uns den Verlust der Handschrift empfindlich. Denn für die Hauptsachen versagen andere Quellen nicht. Das wichtigste wäre immer, dass Tacitus der erste und in mancher Hinsicht der einzige Geschichtsschreiber ist, der höchst auffallende, unheimliche Seiten der menschlichen Natur dargestellt hat. Seine Werke sind uns zwei geschichtliche Tragödien, Szenen des Julischen und des Flavischen Kaiserhauses, markerschütternde Bilder der ungeheuren Umwandlung, welche durch ein Jahrhundert der größte Staat des Altertums, die Seelen der Gehorchenden, die Charaktere der Herrscher erfahren; die Geschichte einer Tyrannenherrschaft, welche die edeln Geschlechter vertilgt, eine hohe und reiche Bildung heraustreibt und verdirbt, vor allem die Herrschenden selbst mit wenigen Ausnahmen entmenschlicht. Wir haben bis zur Gegenwart kaum ein anderes Werk, dessen Verfasser so spähend in die Seelen einer ganzen Reihe von Fürsten blickt, so scharf und genau die Verwüstungen schildert, welche die dämonische Krankheit der Könige in den verschiedensten Naturen hervorgebracht hat.«
»Mich hat immer geärgert,« sagte der Doktor, »wenn man ihm vorwarf, dass er zumeist Kaiser- und Hofgeschichte geschrieben. Wer darf Trauben von einer Zypresse verlangen und behagliche Freude an dem großartigen Staatsleben von einem Manne, der durch einen großen Teil seines Mannesalters täglich Messer und Giftbecher eines wahnsinnigen Despoten vor seinen Augen sah.«
»Ja,« fuhr der Professor beistimmend fort, »er gehörte zu den Aristokraten, deren Häupter hoch über die Menge herausragen, eine Körperschaft, unfähig zum Regieren, unwillig im Gehorsam. In dem Gefühl einer bevorzugten Stellung waren sie die unentbehrlichsten Diener, die stillen Feinde und Rivalen der Fürsten, in ihnen bildeten sich die Tugenden und Laster einer gewaltigen Zeit zu ungeheuern Erscheinungen. Wer sollte die Geschichte römischer Fürsten schreiben als ein Mann aus diesem Kreise? Durch Palastintrigen und stillen Einfluss dunkler Nebengestalten entwickeln sich die Tatsachen, die schwärzeste Missetat verbirgt sich hinter den steinernen Wänden des Palastes, das Gerücht, das leise Gemurmel des Vorzimmers, der lauernde Blick versteckten Hasses sind oft die einzigen Quellen des Geschichtsschreibers. Uns bleibt vor solcher Zeit nichts übrig, als bescheiden das Urteil des Mannes zu schätzen, der uns von diesen fremdartigen Zuständen Kunde überliefert hat. Wer die erhaltenen Bruchstücke des Tacitus ehrlich und gescheit betrachtet, der wird seinen sichern Blick in die tiefsten Falten eines römischen Gemütes bewundernd ehren. Es ist ein erfahrener Staatsmann, ein kräftiger und wahrhafter Geist, der uns die geheime Geschichte seiner Zeit so erzählt, dass wir die Menschen und all ihr Tun verstehen, als ob wir selbst Gelegenheit hätten, ihnen in das Herz zu sehen. Wer das vermag für spätere Jahrtausende, der ist nicht nur ein großer Geschichtsschreiber, er ist auch ein bedeutender Mensch. Und vor solcher Gestalt habe ich immer eine tiefherzliche Ehrfurcht empfunden, und ich halte für eine Pflicht ernster Kritik, das Mäkeln der Kleinen von solchem Bilde fernzuhalten.«
»Schwerlich hat einer seiner Zeitgenossen,« bestätigte der Doktor, »so tief die Schwächen der eigenen Zeitbildung gefühlt als er. Immer hat mich gerührt, wie er das Schwerflüssige seiner Sprache, das Vieldeutige des Ausdrucks mit der Scheu und Vorsicht entschuldigt, welche unter der Herrschaft des Scheusals Domitian auch in die Seelen der Besten geschlagen wurden.«
»Ja,« schloss der Professor, »er ist ein Mann, soweit das in seiner Zeit noch möglich war, und das ist zuletzt die Hauptsache. Denn was uns am meisten fördert, ist doch nicht die Summe des Wissens, die wir einem großen Manne verdanken, sondern seine eigene Persönlichkeit, die durch das, was er für uns geschaffen, ein Teil unseres eigenen Wesens wird. Der Geist des Aristoteles ist für uns noch etwas anderes als die Summe seiner Lehren, welche wir aus den erhaltenen Büchern zusammensuchen. Und Sophokles bedeutet uns etwas ganz anderes als sieben erhaltene Tragödien. Die Art, wie er dachte, fühlte, das Schöne empfand, das Gute wollte, die soll ein Stück von unserem Leben werden. Dadurch vor allem wirkt das Wissen aus vergangener Zeit befruchtend auf unser Sein und Wollen. In diesem Sinne ist auch die schwermütige, trauervolle Seele des Tacitus für mich weit mehr als selbst seine Schilderungen des Kaiserwahnsinns. -- Sieh, Fritz, und deshalb sind mir dein Sanskrit und deine Inder nicht recht, ihnen fehlen die Männer.«
»Sie sind wenigstens für uns schwer erkennbar,« erwiderte der Freund. »Aber wer, wie du, die Homerischen Gesänge den Studenten erklärt, der darf nicht verkennen, welcher Reiz darin liegt, in die geheimnisvollsten Tiefen des menschlichen Schaffens hinabzusteigen, in die Periode der Menschheit, wo noch die junge Volkskraft den einzelnen, welcher in ihr arbeitet, unserm Blicke verdeckt, und das Volk selbst in Poesie, Sage, Recht, wie im Einzelwesen Lebendiges gestaltend, vor uns tritt.«
»Wer sich nur damit beschäftigt,« versetzte der Professor eifrig, »der wird leicht phantastisch und weich. Das Studium solcher Urzeiten wirkt wie orientalischer Mohnsaft. Die Arbeit unter diesen schillernden, undeutlichen Gebilden, welche im Dunkel aufleuchten und wieder verschwinden, verführt zu ungeregeltem Kombinieren; wer sein Lebtag darüber verweilt, wird auch in den Gesichtspunkten, durch die er sein eigenes Leben bestimmt, schwerlich Willkür fernhalten.«
Fritz stand auf. »Das ist unser alter Streit. Ich weiß, du willst mir nichts Hartes sagen, aber ich empfinde, dass du dabei an mich denkst.«
»Und habe ich unrecht?«, fuhr der Professor fort, »wahrlich ich habe Respekt vor jeder geistigen Arbeit, aber meinem Freund möchte ich die gönnen, welche für ihn am segensreichsten ist. Dein Suchen im indischen Götterglauben und deutscher Mythologie lockt dich von einem Rätsel zu dem andern; in dem endlosen Gebiet von unklaren Anschauungen und Bildern unter wesenlosen Schatten soll eine junge Kraft nicht immer weilen. Zwinge dich zu einem Abschluss. Auch aus äußern Gründen. Es taugt dir nicht, Privatgelehrter zu sein, das Leben ist zu bequem, der äußere Zwang, ein bestimmtes Gebiet von Pflichten fehlen dir. Du hast mehrere von den besten Eigenschaften eines Lehrers. Sitze nicht im Hause der Eltern, du musst Universitätslehrer werden.«
Dem Freunde stieg eine dunkle Röte langsam über die Wangen. »Es ist genug,« rief er gekränkt, »wenn ich zu wenig an meine Zukunft gedacht habe, du sollst mir darüber keine Vorwürfe machen. Es war mir vielleicht zu große Freude, an deiner Seite zu leben und der stille Vertraute deiner kräftigen Arbeit zu sein. Etwas von dem Segen, den das Leben eines Mannes allen mitteilt, die an seinem geistigen Schaffen teilnehmen, habe ich in deiner Nähe doch auch empfunden. Gute Nacht.«
Der Professor ging auf ihn zu und fasste seine beiden Hände. »Bleibe,« rief er, »bist du mir böse?«
»Nein,« erwiderte Fritz, »aber ich gehe.« Er schloss leise die Tür.
Der Professor ging mit starken Schritten auf und ab, machte sich Vorwürfe über seine Heftigkeit und sorgte um die Stimmung des Freundes. Endlich warf er die Bücher, welche Telegrafendienste verrichtet hatten, heftig auf die Bretter zurück und trat wieder an den Arbeitstisch.
Gabriel leuchtete dem Doktor die Treppe hinab, öffnete die Haustür und schüttelte den Kopf, als sein Nachtgruß bei dem Herrn nur kurze Erwiderung fand. Er löschte das Licht und horchte nach dem Zimmer seines Herrn. Als er die Schritte des Professors hörte, entschloss er sich, noch einige Züge lauer Abendluft zu schöpfen und stieg in den kleinen Hausgarten. Dort stieß er auf den Hausbesitzer Herrn Hummel, welcher wahrscheinlich in derselben Absicht unter den Fenstern des Professors spazierte. Herr Hummel war ein breitschultriger Mann mit einem großen Kopfe und eigensinnigem Gesicht, wohlhäbig und gut erhalten, von ehrbarem und altfränkischem Anstrich. Er rauchte aus seiner langen Pfeife mit einer sehr dicken Spitze, an welcher eine Reihe kleiner Kirchturmsknöpfe hintereinander stand.
»Ein schöner Abend, Gabriel,« begann Herr Hummel, »ein gutes Jahr, das wird eine Ernte!« Er stieß den Diener vertraulich an: »Da oben hat’s heut etwas gegeben, das Fenster stand offen. Nicht dass ich horchen wollte, aber ich musste so manches vernehmen, Gabriel!«, schloss er bedeutsam und bewegte missbilligend seinen Hausbesitzerkopf.
»Er hat wieder das Fenster aufgemacht,« versetzte Gabriel ausweichend. »Die Fledermaus und die Motte werden bei der freien Aussicht zudringlich, und wenn er mit dem Doktor diskutiert, sind beide manchmal so laut, dass die Leute auf der Straße stehen bleiben und zuhören.«
»Verschluss ist immer gut,« bestätigte Herr Hummel. »Was hat’s denn eigentlich gegeben? Der Doktor ist der Sohn von da drüben, und Sie kennen meine Meinung, Gabriel, ich traue nicht. Ich will niemandem zu nahe treten, aber was von jenem Hause kommt, darüber habe ich so meine Ansichten.«
»Worüber es ging?«, antwortete Gabriel, »ich hab’s nicht gehört, aber das kann ich Ihnen genau sagen, es ging über die alten Römer. Sehen Sie, Herr Hummel, wenn wir die alten Römer hätten, so wäre vieles bei uns anders. Das waren Eisenbeißer, die verstanden zu furagieren. Sie führten Krieg, sie eroberten hier und dort.«
»Sie sprechen ja wie ein Mordbrenner,« sagte Herr Hummel missbilligend.
»Ja, sie taten es nicht anders,« erwiderte Gabriel selbstzufrieden, »sie waren ein eigennütziges Volk und hatten Haare auf den Zähnen wie die Igel. Und was am wunderbarsten ist, wie viel Bücher diese Römer bei alledem geschrieben haben. Kleine und große, viele auch in Folio. Wenn ich die Bibliothek abstäube, nimmt es mit den Römern kein Ende, jede Art von Kaliber, und manche sind dicker als die Bibel. Nur sind alle schwer zu lesen, wer aber die Sprache versteht, erfährt vieles.«
»Die Römer sind ein abgestorbenes Volk,« versetzte Herr Hummel, »als es mit ihnen zu Ende ging, kamen die Deutschen. Der Römer würde es bei uns niemals tun. Das einzige, was uns helfen kann, ist die Hansa. Das ist die Einrichtung. Mächtig zur See, Gabriel,« rief er und schüttelte den Rock desselben an einem Knopfe, »die Städte müssen es unternehmen, Bündnisse, Kapitalaufnahme, denn Handel ist da, Kredit ist da, an Menschen fehlt’s nicht. Schiffe bauen, Flaggen aufhissen.«
»Und wollen Sie mit Ihrem Kahne auf das große Meer?«, fragte Gabriel und wies mit der Hand auf einen kleinen Kahn, der an der hintern Seite des Gartens umgestülpt auf zwei Hölzern lag. »Soll ich mit meinem Professor auf die See gehen?«
»Davon ist nicht die Rede,« versetzte Herr Hummel, »aber die jungen Leute, welche zuvörderst unnütz sind. Mancher könnte etwas Besseres tun, als bei seinen Eltern zu Hause sitzen. Warum soll Ihr Doktor von drüben nicht als Matrose fürs Vaterland mitgehen?«
»Ich bitte Sie, Herr Hummel,« rief Gabriel erschrocken, »der junge Herr? Er hat ja ein kurzes Gesicht.«
»Tut nichts,« brummte Hummel, »dafür gibt’s auf der See Fernröhre, und er kann’s ja meinetwegen bis zum Kapitän bringen. Ich bin nicht der Mann, der seinem Nächsten etwas Böses wünscht.«
»Er ist ein Gelehrter,« entgegnete Gabriel, »und dieser Stand ist auch nötig. Ich versichere Sie, Herr Hummel, ich habe über das gelehrte Wesen nachgedacht, ich kenne meinen Professor genau und zuweilen den Doktor, und ich muss sagen, es ist etwas an der Sache, es ist viel daran. Manchmal bin ich zweifelhaft. Wenn der Schneider den neuen Rock bringt, merkt so einer nicht, was jedermann weiß, ob ihm der Rock sitzt oder ob auf dem Rücken Falten sind. Wenn er auf den Einfall kommt, von einem Bauer eine Fuhre Holz zu kaufen, die vielleicht doch nur gestohlen ist, so bezahlt er hinter meinem Rücken das Holz viel teurer als jeder Mensch. Und wenn er unversehens ärgerlich wird und sich streitet über Dinge, die wir beide ruhig miteinander besprechen, so wird mir die Sache zweifelhaft. Wenn ich aber dann sehe, wie er sonst ist, barmherzig und freundlich sogar gegen die Fliegen, die um seine Nase tanzen -- denn er holt sie mit dem Löffel aus dem Kaffee und setzt sie draußen aufs Fensterbrett -- und wie er aller Welt das Beste gönnen möchte, und wie er sich selber gar nichts gönnt und noch tief in der Nacht liest und schreibt, so wird mir seine ganze Geschichte gewaltig. Und ich sage Ihnen, ich lasse nichts auf die Gelehrten kommen. Sie sind anders als wir, sie verstehen nicht, was unsereiner versteht. Aber wir verstehen nicht, was sie verstehen.«
»Nun, man hat auch seine Bildung,« versetzte Herr Hummel. »Was Sie sagen, Gabriel, haben Sie als ein achtbarer Mensch gesprochen, aber das eine will ich Ihnen anvertrauen, man kann eine große Wissenschaft haben und ein recht hartherziges Subjekt vorstellen, das sein Geld auf Wucherzinsen gibt und seinen guten Freunden die Ehre abschneidet. Und deswegen meine ich: die Hauptsache ist Ordnung und Grenze und seinen Nachkommen etwas hinterlassen. Ordnung hier,« er wies auf seine Brust, »und Grenze dort,« er wies auf seinen Zaun, »dass man sicher weiß, was einem selbst gebührt und was den andern gehört. Und für die Kinder ein festes Eigentum, auf dem sie sitzen; dann mögen diese wieder für ihre Kinder sorgen. Das ist, was ich unter Menschenleben verstehe.«
Der Hausherr verschloss die Tür des Zaunes und die Tür des Hauses, auch Gabriel suchte sein Lager, aber noch lange brannte die Lampe in der Arbeitsstube des Professors, und ihre Strahlen kreuzten sich an der Fensterbrüstung mit dem bleichen Schein des Mondes. Endlich verlosch die Leuchte des Gelehrten, das Zimmer stand leer; draußen am Himmel fuhren kleine Wolken an der Mondscheibe vorüber, und dämmrige Lichter tanzten jetzt als Beherrscher der Stube über den Schreibtisch, über die Werke der alten Römer und über das Büchlein des seligen Frater Tobias.
Zweites Kapitel -- Die feindlichen Nachbarn
In künftigen Zeiten wird, wie man hört, auf dem Erdball eitel Freude und Liebe sein. Die Menschheit wird in wassergrünem und himmelblauem Gewande einhergehen, Sandalen an den Füßen und Palmzweige in der Hand, um den letzten Hass und der letzten Bosheit Salz auf den Schwanz zu streuen und diese Nachtvögel für das große Museum der Zukunft auszustopfen. Bei solcher Jagd wird man finden, dass das letzte Nest der Unholde zwischen den Wänden zweier Nachbarhäuser hängt. Denn zwischen Nachbar und Nachbar nisten sie, seit der Regen vom Dach des einen Hauses in den Hof des andern rieselt, seit der Sonnenstrahl durch eine Hausmauer der andern vorenthalten wird, seit Kinder die Hände durch den Zaun stecken, um Beeren zu naschen, seit der Hausherr nicht abgeneigt ist, sich selbst für besser zu halten als seine Mitmenschen. Und es gab zu unsern Tagen wenig Gebäude im Lande, zwischen denen Widerwille und feindliche Kritik so arg wirtschafteten als zwischen den beiden Häusern am großen Stadtpark.
Viele erinnern sich der Zeit, wo die Häuser der Stadt noch gar nicht bis an den waldigen Talgrund reichten. Damals hatte die Talgasse nur wenige kleine Menschenwohnungen, dahinter lag ein wüster Raum, Frau Knips, die Wäscherin, trocknete dort Bürgerhemden und ihre beiden unartigen Jungen warfen einander mit Holzklammern. Da hatte Herr Hummel einen Trockenplatz am letzten Ende der Straße gekauft und hatte darauf sein schönes Haus gebaut in zwei Stockwerken mit steinernen Stufen und eisernem Gitter, und dahinter ein einfaches Arbeitshaus für sein Geschäft, denn er war Hutfabrikant und trieb die Sache sehr ins Große. Und wenn er aus seinem Hause trat und die Vorsprünge des Daches und die Gipsarabesken unter den Fenstern musternd überschaute, so sah er von allen Seiten Licht und Luft und freie Natur und empfand sich als den vordersten Pfeiler der Zivilisation gegen den Urwald.
Da begegnete ihm, was manchem Pionier der Wildnis die Ruhe stört: sein Beispiel fand Nachahmung. An einem finstern Morgen des März kam ein Wagen mit alten Brettern an den Wäscheplatz gefahren, der ihm gegenüber lag, schnell wurde ein Plankenzaun zusammengeschlagen, Tagelöhner mit Haue und Handkarren begannen Grund zu graben. Das war ein harter Schlag für Herrn Hummel. Aber sein Leid wurde größer. Als er zornig über die Straße schritt und den Maurermeister nach dem Namen des Mannes fragte, der gegen Licht und Ruhm seines Hauses feindlich arbeiten ließ, da erfuhr er, dass sein künftiger Nachbar der Fabrikant Hahn sein sollte. Von allen Menschen auf der Welt war dieser der größte Tort, den ihm das Schicksal antun konnte. Nicht eigentlich als Bürger betrachtet, er war nicht unreputierlich, es ließ sich gegen die Familie nichts Schweres einwenden, aber er war Hummels natürlicher Gegner, denn das Geschäft des neuen Ansiedlers bewegte sich auch um Hüte, und zwar um Strohhüte. Diesen leichten Plunder zu verfertigen ist nie für eine ernste Männerarbeit gehalten worden, es war nie ein zünftiges Handwerk, es hat nie das Recht gehabt, Lehrlinge freizusprechen, es ist sonst nur von italienischen Bauern betrieben worden, es hat sich als eine Neuerung mit andern schlechten Sitten erst spät in der Welt verbreitet, es ist im Grunde gar kein Geschäft, man kauft Strohbänder und lässt sie durch zusammengelaufene Mädchen im Wochenlohn aneinandernähen. Und es besteht eine alte Feindschaft zwischen Filzhut und Strohhut. Der Filzhut ist eine historische Macht, durch Jahrtausende geheiligt, nur die Mütze duldete er neben sich, als gemeine Einrichtung für Werkeltage. Da erhob der Strohhut seine Anmaßungen gegen verbrieftes Recht und beanspruchte frech die Hälfte des Jahres. Seit der Zeit schwanken die Waagschalen des irdischen Beifalls zwischen diesen beiden Attributen des Menschengeschlechts. Wenn der unstete Sinn der Sterblichen nach dem Stroh zuschwankt, bleibt der schönste Filz, Felbel, Seide und Pappe unbeachtet stehn, von der Luft ausgezogen, von Motten zerbissen. Hinwiederum wenn die Neigungen der Menschen nach dem Filz hinfluten, trägt alles Geborne, Frauen, Kinder und Kindermädchen, kleine Männerhüte, dann liegt das Stroh kläglich, kein Herz schlägt dafür und die Hausmaus nistet in dem schönsten Geflecht.
Das war für Herrn Hummel ein starker Grund zum Zorn. Aber es wurde noch ärger. Er sah täglich, wie das feindliche Haus aus dem Boden wuchs, er beobachtete die Gerüste, die aufsteigenden Mauern, die Zieraten der Gesimse, die Fensterreihen, -- es war zwei Fenster länger als sein Haus. Das Erdgeschoss hob sich in die Höhe, ein zweiter Stock, zuletzt gar ein dritter -- alle Fabrikräume des Strohmanns wurden dem Wohnhaus einverleibt. Das Haus des Herrn Hummel war zu einem unbedeutenden Dinge herabgedrückt. Da schritt er zu seinem Advokaten und forderte Rache wegen entzogenem Licht und verschlechterter Aussicht. Natürlich zuckte dieser die Achseln. Das Recht Häuser zu bauen gehörte zu den Grundrechten der Menschheit, es war auch gemeines deutsches Herkommen in Häusern zu leben, und es war voraussichtlich hoffnungslos zu beantragen, dass Hahn auf seinem Grundstück nur ein. Leinwandzelt errichten dürfe. So war durchaus nichts zu tun als sich mit Geduld zu fügen, und Herr Hummel hätte sich das selbst sagen sollen.
Seitdem waren Jahre vergangen. Zu derselben Stunde vergoldete das Sonnenlicht die Parkseite der beiden Häuser, stattlich und bewohnt standen sie da, beide gefüllt mit Menschen, welche täglich aneinander vorbeigingen. Zu derselben Stunde trat der Briefträger über beide Türschwellen, die Tauben flogen von dem einen Dach auf das andere, die Sperlinge an den beiden Hausrinnen traten in die gemütlichsten Beziehungen; um das eine Haus roch es zuweilen ein wenig nach Schwefel, um das andere nach versengten Haaren, aber derselbe Sommerwind trieb vom Walde den Harzgeruch und den Duft der Lindenblüten durch beide Haustüren. Und doch, die tiefe Abneigung der beiden Häuser hatte sich nicht verringert. Das Haus Hahn empfand einen Widerwillen gegen versengte Haare, und die Familie Hummel hustete in ihrem Garten zornig, sooft eine Spur von Schwefel in dem Sauerstoff der Luft geargwöhnt wurde.
Zwar wurde das anständige Verhalten zu der Nachbarschaft nicht ganz mit Füßen getreten, wenn auch der Filz eine Neigung zu bärbeißigem Verhalten hatte, das Stroh war biegsamer und bewies in mehreren Fällen seine Nachgiebigkeit. Beide Hausherren hatten eine bekannte Familie, in welcher sie zuweilen zusammentrafen, ja beide hatten einmal vor demselben Täufling gestanden und darauf geachtet, dass einer nicht weniger Patengeld gab als der andere. Deshalb entstand ein unvermeidliches Grüßen, so oft man ihm nicht aus dem Wege gehen konnte. Aber dabei blieb es. Zwischen dem Markthelfer, welcher die Strohhüte schwefelte, und den Arbeitern, welche über den Hasenhaaren walteten, bestand glühender Hass. Und die kleinen Leute, welche in den nächsten Häusern der Straße wohnten, wussten das und taten redlich das Ihre, um das bestehende Verhältnis aufrecht zu erhalten. Auch konnte in der Tat das Wesen der beiden Hausherren schwerlich zusammenstimmen. Der Dialekt war verschieden, die Bildung hatte einen andern Strich, was der eine an Leibgerichten und andern Einrichtungen des Lebens lobte, missfiel dem andern; Hummel war aus einem Baumstamm des nördlichen Deutschland an das Licht geflogen, Hahn aus einer kleinen Stadt in der Nähe herzugeflattert.
Wenn Herr Hummel von seinem Nachbar Hahn sprach, so nannte er ihn das Strohfeuer und den Phantasten. Herr Hahn war ein sinniger Mann, still und fleißig über seinem Geschäft, in den Freistunden aber ergab er sich ausfallenden Liebhabereien. Unleugbar waren diese darauf berechnet, dem wandelnden Publikum, welches zwischen den beiden Häusern nach der Waldwiese und den grünen Bäumen hinauszog, einen guten Eindruck zu machen. In dem kleinen Garten hatte er nacheinander die meisten Erfindungen gehäuft, durch welche moderne Gartenkunst die Erde verschönert. Zwischen den drei Fliederbüschen erhob sich ein Felsen aus Tuffstein gemauert mit schmalem und steilem Pfade zur Höhe, dass nur feste Bergsteiger ohne Alpenstock die Expedition nach dem Gipfel wagen konnten, auch sie in Gefahr, mit der Nase in den zackigen Tuffstein zu fallen. Im nächsten Jahre wurden, nahe am Gitterzaun, in kurzen Entfernungen Stangen errichtet, an denen Schlinggewächse hinaufliefen; zwischen je zwei Stangen hing eine bunte Glaslampe. Wenn die Lampenreihe an festlichen Abenden angezündet war, warf sie einen magischen Glanz auf die Strohhüte, welche unter dem Fliederbusch zusammensaßen und die Urteile der Vorübergehenden einsammelten. Den Glaskugeln folgte das Jahr der Papierlaternen. Wieder im nächsten Jahre erhielt der Garten ein antikes Aussehen, denn eine weiße Muse glänzte, von Efeu und blühendem Lack umgeben, bis weit in den Wald hinein.
Gegenüber solcher Neuerungssucht hielt Herr Hummel fest an seiner Vorliebe fürs Wasser. An der Hinterseite seines Hauses zog sich eine schmale Wasserader nach der Stadt. Alljährlich wurde sein Kahn mit derselben grünen Ölfarbe angestrichen, er setzte sich in seinen Freistunden am liebsten allein in den Kahn und ruderte sich ein wenig auf den Häusern in den Park, nahm seine Angel zur Hand und ergab sich dem Vergnügen, Weißfische und anderes kleines Wasservolk zu fangen.
Ohne Zweifel war das Haus Hummel legitimer, das heißt eigensinniger, wunderlicher, schwerer zu behandeln. Von allen Hausfrauen der Straße erhob Frau Hummel die größten Ansprüche, durch seidene Kleider, durch eine goldene Uhr an goldener Kette. Sie war eine kleine Dame mit blonden Locken, immer noch recht hübsch, sie war im Theater abonniert, gebildet und zartfühlend und konnte sehr böse werden. Sie sah aus, als wenn sie sich aus nichts etwas mache, aber sie wusste alles, was auf der Straße vorging. Nur den eigenen Gatten vermochte ihre Regierungskraft nicht immer zu bewältigen. Doch bewies Herr Hummel, tyrannisch gegen alle Welt, seiner Frau große Rücksicht. Wenn sie ihm im Hause zu stark wurde, ging er stillschweigend in den Garten, und wenn sie ihm auch dahin folgte, verschanzte er sich in der Fabrik hinter einem Bollwerk von Haaren.
Aber auch Frau Hummel war einer höheren Gewalt unterworfen, und diese Macht übte ihr Töchterchen Laura. Von mehreren Kindern war ihr nur dies eine geblieben, alle Zärtlichkeit und weiche Empfindung der Mutter war ihm zuteil geworden. Und es war ein prächtiger kleiner Balg, die ganze Stadtgegend kannte sie, seit sie die ersten roten Schuhe trug, schon auf dem Arm der Wärterin war sie oft angehalten und beschenkt worden. Lustig wuchs es auf, ein dralles Mädchen mit zwei großen blauen Augen und roten Bäckchen, mit dunkelm Kraushaar und einem schlauen Gesicht. Wenn die kleine Hummel die Straße entlang spazierte, ihre Händchen in den Taschen der Schürze, war sie die Freude der ganzen Nachbarschaft. Keck und kurzab wusste sie sich in alle zu schicken und blieb mit dem kleinen Mäulchen niemand etwas schuldig. Sie gab dem Holzhacker vor der Tür ihre Buttersemmel und trank mit ihm aus seiner Schale den dünnen Kaffee, sie begleitete den Postboten die ganze Straße entlang, und ihr größtes Vergnügen war, mit ihm die Treppen hinaufzulaufen, zu klingeln und seine Briefe zu übergeben; ja sie hatte sich einst am späten Abend aus der Stube geschlichen, saß neben dem Nachtwächter auf einem Ecksteine und hielt sein großes Horn in ungeduldiger Erwartung des Stundenschlages, zu welchem das Horn ertönen würde. Frau Hummel schwebte in einer unaufhörlichen Angst, dass ihre Tochter einmal gestohlen werden müsse, denn mehr als einmal war sie auf viele Stunden verschwunden, dann war sie mit fremden Kindern in ihre Wohnung gegangen und hatte mit ihnen gespielt; sie war die Vertraute vieler kleiner Straßenjungen, wusste sich bei ihnen in Respekt zu setzen, gab ihnen Pfennige und empfing als Zeichen der Achtung Brummteufel und kleine Schornsteinfeger, die aus gebackenen Pflaumen und Holzstäbchen zusammengesetzt waren. Sie war ein gutherziges Kind, das lieber lachte als weinte, und ihr lustiges Gesicht machte das Haus des Herrn Hummel wohnlicher als die Efeulaube der Hausfrau und das mächtige Brustbild des Herrn Hummel selbst, welches recht eigensinnig auf Lauras Puppenstube heruntersah.
»Das Kind wird unerträglich,« rief Frau Hummel zornig und trat, die betrübte Laura an der Hand, in das Wohnzimmer. »Sie quirlt den ganzen Tag auf der Straße umher. Jetzt, als ich vom Markte kam, saß sie neben der Brücke auf dem Stuhl der Obstfrau und verkaufte ihr die Zwiebeln. Jedermann blieb stehen und ich musste mein Kind aus dem Gedränge herausholen.«
»Das Wurm wird gut,« versetzte Herr Hummel lachend, »warum willst du ihr die Jugend nicht gönnen?«
»Sie muss aus dem ordinären Verkehr heraus. Es fehlt ihr aller Sinn für das Feinere, sie kennt noch kaum die Buchstaben und sie hat einen Abscheu vor dem Lesen. Auch ist Zeit, dass mit den französischen Vokabeln ein Anfang gemacht wird. Die Betty der Regierungsrätin ist nicht älter und sie weiß ihre Mutter schon so zierlich chère mère zu nennen.«
»Die Mutter Schere und Möhre und den Vater Kohlrabi,« versetzte Herr Hummel. »Die Franzosen sind ein artiges Volk. Wenn du so besorgt bist, deine Tochter für den Markt abzurichten, dann ist das Türkische immer noch besser als das Französische. Der Türke bezahlt dir Geld, wenn du ihm das Kind verhandelst, die andern wollen alle noch etwas dazu haben.«
»Sprich nicht so ruchlos, Heinrich!«, rief die Gattin.
»Und du bleib mir mit deinen verdammten Vokabeln vom Leibe, sonst verspreche ich dir, ich lehre das Kind alle französischen Redensarten, die ich kenne, es sind ihrer nicht viele, aber sie sind kräftig. Baisez moi, Madame Ümmel.« Damit ging er trotzig aus dem Zimmer.
Das Ergebnis dieser Beratung war aber doch, dass Laura in die Schule ging. Es wurde ihr sehr schwer, zu schweigen und zu hören, und längere Zeit waren die Fortschritte wenig befriedigend. Endlich kam auch in die kleine Seele der Ehrgeiz, sie klomm die untere Staffeln der Bildung bei Fräulein Johanne heran, dann wurde sie in das berühmte Institut von Fräulein Jannette befördert, wo die Töchter anspruchsvoller Familien das höhere Wissen erhielten. Dort lernte sie die Nebenflüsse des Amazonenstromes, viel ägyptische Geschichte, tippte auf den Deckel eines Elektrophors, sprach Französisch über das Wetter, las Englisch in einer kunstvollen Weise, welche sogar dem gebornen Briten die Anerkennung abnötigte, dass in dem Institut eine neue Sprache erfunden werde, und wurde endlich in allen Feinheiten eines deutschen Aufsatzes gebildet. Sie schrieb kleine Abhandlungen über den Unterschied zwischen Wachen und Schlafen, über die Gefühle der berühmten Cornelia, Mutter der Gracchen, über die Schrecken eines Schiffsbruchs und die wüste Insel, auf welche sie sich gerettet hatte. Zuletzt erwarb sie Kenntnisse in der Abfassung von Strophen und Sonetten. Bald stellte sich heraus, dass Lauras Hauptstärke nicht in der französischen, sondern in der deutschen Sprache lag, ihr Stil wurde die Freude der Anstalt, ja sie begann ihre Lehrerinnen und die liebsten Mädchen in Gedichten anzusingen, welche den schwierigen Versbau des großen Schiller vom Kranze aus goldenen Ähren bis zur Form aus Lehm gebrannt sehr glücklich nachahmten. Jetzt war sie mit achtzehn Jahren ein hübsches rosiges Fräulein, immer noch rund und lustig, immer noch die Gebieterin des Hauses, und bei allen Leuten auf der Straße beliebt.
Die Mutter, stolz auf die Bildung der Tochter, hatte ihr nach der Konfirmation ein Oberstübchen geräumt, das auf die Bäume des Parkes hinaussah, und Laura richtete sich ihr kleines Heimwesen zu einem Feenschloss ein, mit Efeu, mit einem kleinen Blumentisch, mit einem allerliebsten Schreibzeug aus Porzellan, auf welchem Schäfer und Schäferin nebeneinander saßen. Dort oben verlebte sie ihre schönsten Stunden bei Feder und Löschblatt, denn sie schrieb vor jedermann verborgen ihre Memoiren.
Aber auch sie teilte die Abneigung ihrer Familie gegen das Nachbarhaus. Schon als kleines Ding war sie bei dieser Haustür schmollend vorübergegangen, noch nie hatte ihr Fuß den Hausflur betreten, und wenn die gute Frau Hahn einmal einen Handschlag von ihr forderte, so dauerte es lange, bevor sie die kleine Hand aus der Schürze zog. Von den Bewohnern des Nachbarhauses war ihr aber der junge Fritz Hahn am peinlichsten. Sie traf selten mit ihm zusammen, und dann wollte das Unglück, dass sie immer in einer Verlegenheit war und Fritz Hahn ihren Gönner spielen konnte. Als sie noch gar nicht in die Schule ging, hatte der älteste Sohn der Frau Knips, schon ein erwachsener Schlingel, welcher hübsche Bilder und Geburtstagswünsche malte und an die Leute in der Nachbarschaft verkaufte, sie einmal zwingen wollen, das Geld, das sie in der Hand hielt, für einen Teufelskopf auszugeben, den er gemalt hatte und den niemand auf der Straße haben wollte. Recht widerwärtig und boshaft behandelte er sie und sie geriet gegen ihre Gewohnheit in Angst, gab ihre Groschen hin und hielt weinend das gräuliche Bild zwischen den Fingern. Da kam Fritz Hahn seines Weges, fragte nach dem Handel, und als sie ihm die Gewalttat des Knips klagte, entbrannte er von einem so heftigen Zorn, dass sie wieder über den Fritz erschrak. Er fuhr auf den Burschen los, der sein Mitschüler war und schon eine Klasse höher saß, und begann auf der Stelle eine Prügelei, welcher der jüngere Knips, die Hände in der Tasche, lachend zusah. Und Fritz drängte den garstigen Buben an die Wand und zwang ihn, das kleine Geldstück herauszugeben und seinen Teufel wieder zu nehmen. Aber diese Begegnung half gar nicht dazu, ihr den Fritz lieb zu machen. Sie konnte nicht leiden, dass er schon als Primaner eine Brille trug und dass er immer so ernst vor sich hinsah. Wenn sie aus der Schule kam und er mit seiner Mappe in die Vorlesung ging, suchte sie ihm jedesmal aus dem Wege zu gehen.
Noch später einmal stieß sie mit ihm zusammen -- sie saß unter den ersten Mädchen im Institut, der älteste Knips war bereits Magister und der jüngere Lehrling im Geschäft ihres Vaters und Fritz Hahn sollte gerade Doktor werden --, da hatte sie sich auf dem Kahn zwischen die Bäume des Parkes gerudert, bis der Kahn an eine Wurzel stieß und ihr Ruder in das Wasser fiel. Und als sie sich danach bückte, gingen Hut und Sonnenschirm denselben Weg, und Laura sah verlegen um Hilfe nach dem Ufer. Da kam wieder Fritz Hahn in tiefen Gedanken daher, er hörte den leisen Schrei, welchen Laura bei dem Unfall ausstieß, sprang sofort in das schlammige Wasser, fischte Hut und Sonnenschirm und zog den Kahn an das Ufer. Hier bot er Laura die Hand und half ihr auf festen Grund. Laura war ihm wohl Dank schuldig, auch hatte er sie mit Achtung behandelt und Fräulein genannt. Aber er sah doch sehr lächerlich aus, die hagere Gestalt verbeugte sich ungeschickt und die Gläser waren starr auf sie gerichtet. Und als sie darauf erfuhr, dass er von dem Sprung in den Sumpf einen schrecklichen Katarrh davongetragen hatte, da wurde sie heißzornig auf sich selbst und auf ihn, weil sie geschrien hatte, wo gar keine Gefahr war, und weil er zu so unnötigem Ritterdienst gestürmt war; sie würde sich schon allein geholfen haben, und jetzt dächten die Hahns, sie sei ihnen wer weiß welchen Dank schuldig.
Darüber hätte sie ruhig sein können, denn Fritz hatte sich still umgezogen und die Kleider in seiner Stube getrocknet.
Freilich, dass die beiden feindlichen Kinder einander mieden, war natürlich, denn Fritz war eine ganz andere Natur. Auch er war das einzige Kind und auch er war von einem gutherzigen Vater und einer übersorglichen Mutter weich erzogen. Von klein auf ein stiller, in sich gekehrter Knabe, anspruchslos, fleißig in den Büchern, hatte er sich neben dem Haushalt der Eltern seine eigene Welt in der Wissenschaft ausgebaut, welche von der großen Heerstraße seitab lag. Während um ihn das Leben lustig summte, saß er über die Grundstriche und Haken des Sanskrit gebeugt und untersuchte die Familienverwandtschaft zwischen dem wilden Geisterheer, das über der Teutoburger Schlacht dahinfuhr, und zwischen den Göttern der Weda, welche über Palmenwälder und Bambusrohr in das heiße Gangestal hinabschwebten. Auch er war Freude und Stolz seines Hauses, die Mutter ließ sich nicht nehmen, jeden Morgen selbst den Kaffee hinaufzutragen, dann setzte sie sich mit ihrem Schlüsselbund ihm gegenüber und sah schweigend zu, während er sein Frühstück verzehrte, schalt leise über sein Nachtarbeiten am letzten Abend und sagte ihm, dass sie nicht ruhig einschlafe, bis sie über sich den Stuhl rücken höre und die Stiefel klappern, die er zum Reinigen vor die Tür stellte. Nach dem Frühstück bot Fritz dem Vater guten Morgen, und er wusste, dass es dem Vater Freude war, wenn er einige Minuten mit ihm durch den Garten schritt, das Wachstum der Lieblingsblumen betrachtete und vor allem, wenn er dem Vater zu einer Verschönerung seine Zustimmung geben konnte. Das war der einzige Punkt, wo Herr Hahn mit seinem Sohne zuweilen in Gegensatz geriet. Und da er den Gründen des Sohnes nicht zu widerstehen vermochte und den eigenen starken Verschönerungstrieb auch nicht bändigen konnte, so schlug er gern den Weg ein, der selbst von größeren Politikern für nützlich erachtet wird, er bereitete seine Pläne heimlich vor und überraschte durch Tatsachen.
Bei solchem Stillleben war dem jungen Gelehrten der Verkehr mit dem Professor das beste Vergnügen des Tages, seine Erhebung, sein Stolz. Er hatte noch als Student die ersten Vorlesungen gehört, welche Felix Werner an der Universität hielt. Allmählich war eine Freundschaft entstanden, wie sie vielleicht nur unter hochgebildeten und wackern Gelehrten möglich ist. Er wurde der hingebende Vertraute für die umfangreiche Tätigkeit seines Freundes. Jede Untersuchung des Professors und ihre Erfolge wurden bis auf Einzelheiten besprochen, jede Freude, die ein neuer Fund machte, teilten die Nachbarn. Täglich sahen sie einander, viele Abende vergingen ihnen in der schönen Art der Unterhaltung, welche den Deutschen eigentümlich ist, in einem Gespräch, das zwischen Erörterung und Geplauder schwebt, wo zwei Geister, welche beide die Wahrheit suchen, sich im Austausch ihrer Ansichten gegenseitig fördern. Dann rührte in jedem, angeregt durch das feine Verständnis und die Einwürfe des andern, eine schöpferische Kraft kräftig die Schwingen, und blitzschnell und ungeahnt öffneten sich dem Sprechenden und dem Hörer neue Gesichtspunkte, ein tieferes Verständnis. Mit dem besten Teil ihres Lebens wuchsen beide zusammen. Freilich war Fritz als der Jüngere auch der, welcher sich am meisten der feurigen Natur des Freundes bequemte, er war mehr Empfänger als Gebender. Aber gerade deshalb wurde das Verhältnis so fest und innig. Nicht ohne kleine Störungen, wie das bei Gelehrten natürlich ist, denn beide waren von schnellem Urteil, beide hochgespannt in den Forderungen, die sie an sich selbst und an die Menschen machten, beide von seiner, leicht erregter Empfindung. Aber solche Gegensätze wurden bald überwunden, sie trugen nur dazu bei, die liebevolle Rücksicht, mit welcher die Freunde einander behandelten, zu vergrößern.
Durch diese Freundschaft wurde das schwierige Verhältnis der beiden Häuser ein wenig gemildert. Auch Herr Hummel konnte nicht umhin, dem Doktor eine kleine Rücksicht zu gönnen, da sein hochverehrter Mieter den Sohn der Feinde auffallend auszeichnete. Denn auf seinen Mieter ließ Herr Hummel nichts kommen. Durch dunkles Gerücht war ihm verkündet, dass der Professor in seiner Art ein berühmter Mann sei, und er war geneigt, irdischen Ruhm besonders hochzuachten, wenn dieser bei ihm zur Miete wohnte. Auch war der Professor ein vortrefflicher Mieter, er protestierte nie gegen eine Maßregel, welche Herr Hummel als oberste Polizeibehörde des Hauses verfügte; er hatte Herrn Hummel einst wegen Anlage eines Kapitals um Rat gefragt, er hielt nicht Hund nicht Katze, gab keine Tanzgesellschaften, sang nicht zum Fenster hinaus und spielte auf keinem Flügel Bravourstücke. Und was die Hauptsache war, er bewies gegen Frau Hummel und Laura, wenn er ihnen einmal begegnete, eine ritterliche Artigkeit, welche dem gelehrten Herrn sehr wohl stand. Frau Hummel war von ihrem Mieter begeistert, und Hummel hatte gut befunden, die letzte notwendige Erhöhung der Miete nicht vorher im Familienkreise zu besprechen, weil er einen Widerspruch seiner gesamten weiblichen Bevölkerung voraussah.
Jetzt hatte der Kobold, welcher zwischen beiden Häusern hin und her lief, Steine in den Weg werfend und den Menschen Eselsohren bohrend, auch die beiden freien Seelen seines Reviers gegeneinander aufgeregt. Aber sein Versuch blieb kümmerlich: die wackern Männer waren nicht fügsam, nach seiner misstönenden Pfeife zu tanzen.
Früh am nächsten Morgen trug Gabriel einen Brief seines Herrn zum Doktor hinüber. Als er in den feindlichen Hausflur trat, kam ihm eilig Dorchen, das Dienstmädchen der Familie Hahn, entgegen, einen Brief ihres jungen Herrn an den Professor in der Hand. Die Boten tauschten die Briefe und zu gleicher Zeit lasen die Freunde ihre Zuschriften.
Der Professor schrieb: »Mein lieber Freund, zürne mir nicht, dass ich wieder einmal heftig wurde, die Veranlassung war so abgeschmackt als möglich. Was mich verstimmte, war, ehrlich gesagt, dass Du so unbedingt verweigertest, einen Lateiner mit mir herauszugeben. Denn die Möglichkeit, Verlorenes zu finden, welche wir im gefälligen Traume durch einige Augenblicke annahmen, war mir doch auch darum so lockend, weil sie uns beiden eine gemeinsame Tätigkeit in Aussicht stellte. Wenn ich versuche, Dich in den engern Kreis meiner Wissenschaft zu ziehen, so wirst Du voraussetzen, dass ich dabei nicht nur durch persönliche Empfindungen, sondern weit mehr durch den naheliegenden Wunsch bestimmt werde, für die Wissenschaft, auf welche ich mich beschränken muss, Deine Kraft zu gewinnen.«