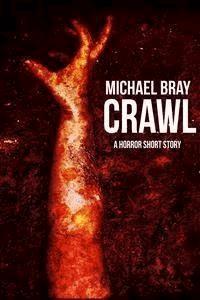Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Etwas ist erwacht. Aufgeweckt von einem Seebeben in der Antarktis ist eine riesige Kreatur aus den Tiefen aufgestiegen. Dieses monströse Wunder der Evolution, das selbst Blauwale winzig erscheinen lässt, übernimmt die Herrschaft über den Ozean und setzt damit eine katastrophale Kettenreaktion in Gang … Henry Rainwater ist ein Krabbenfischer, der versucht, den Fluch seines Familiennamens loszuwerden und sein Leben zu bestreiten. Nachdem er nur knapp einer Begegnung mit diesem Monstrum entkommen konnte, der allerdings sein Vater und der Rest der Schiffscrew zum Opfer fielen, lebt Rainwater zurückgezogen und voller Angst vor jener Kreatur, die das Meer unsicher macht. Der einzige Mann, der Rainwater Glauben schenkt, ist Andrews, ein ambitionierter Wissenschaftler, der von der Regierung beauftragt wurde, der Existenz dieses Ungeheuers nachzugehen. Doch schnell muss Rainwater feststellen, dass Andrews eigentlich andere Motive antreiben, die Kreatur aufzuspüren. Getrieben von seinem Wunsch nach Rache muss Henry seine Angst überwinden und wieder auf See hinausfahren, um das Monster zu finden, es zu töten und Andrews daran zu hindern, einen Plan umzusetzen, der schreckliche Folgen für die gesamte Menschheit haben könnte … ★★★★★ »AUS DER TIEFE ist eine adrenalingeladene Achterbahnfahrt, die einen von der ersten Seite an gefangen nimmt.« - Amazon.com
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus der Tiefe
Michael Bray
This Translation is published by arrangement with SEVERED PRESS, www.severedpress.com Title: FROM THE DEEP. All rights reserved. First Published by Severed Press, 2014. Severed Press Logo are trademarks or registered trademarks of Severed Press. All rights reserved.
Diese Geschichte ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Impressum
Deutsche Erstausgabe Originaltitel: FROM THE DEEP Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Andreas Schiffmann
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-841-6
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
Inhaltsverzeichnis
Für diejenigen unter euch, die an Monster glauben.
»Obwohl es dem akustischen Fingerabdruck eines Lebewesens entspricht, ist uns kein Tier bekannt, das solche Laute erzeugt. Würde es sich um ein Tier handeln, wäre es riesig – laut Forschern, die das Phänomen untersucht haben, sogar viel größer als ein Blauwal.«
Unbekannte Quelle der Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten
»Natürlich ist es vertuscht worden. Dahinter steckte mehr als nur ein Eisbeben, und hätten wir die Öffentlichkeit in unsere Vorahnung eingeweiht, wäre eine Massenpanik ausgebrochen, also haben wir die Lüge von dem Eisbeben verbreitet und gehofft, das Ding würde da unten bleiben. Ist es aber nicht.«
Anonym, 2012
Prolog
Ross-Schelfeis, Antarktis
Mit mindestens 487.000 km² war das Ross-Schelfeis das weltweit großflächigste seiner Art. Obwohl es an seinem höchsten Punkt beeindruckende 160 Fuß weit aus dem Wasser ragte, lag ein Großteil seiner Masse unter der Oberfläche. Ein tiefes Rumpeln durchdrang die Stille der klirrend kalten antarktischen Luft, als ein gewaltiges Stück des Schelfs abbrach und in den Ozean sackte. Eine Schule Killerwale nahm Reißaus vor der Erschütterung, als über 300 Tonnen Eis aufs Wasser schlagen.
Die Kreatur rührte sich.
Nachdem der Lärm sie aus ihrem Tiefschlaf geweckt hatte, öffnete sie die Augen und machte sich auf den Weg, um seine Quelle zu finden, wobei jeder Schwenk seiner Flossen, während sie sich ins offene Meer bewegte, eine Druckwelle verursachte. Tausende Gallonen Wasser strömten beim Schwimmen durch den Körper des Wesens und ermöglichten ihm, die geringsten Schwingungen zu »schmecken«, die von potenzieller Beute im Umkreis von bis zu 100 Meilen ausgingen. Dadurch, dass es seinen Kopf dabei schwenkte, entdeckte es die fliehenden Wale, ja konnte die Positionen aller sieben haargenau ausmachen.
Die Säuger spürten, wie sich der Riese näherte, und gingen in Defensivformation, wobei sie ihre Kälber in der Mitte der Gruppe schwimmen ließen. Die Kreatur jedoch trachtete nach einer besser sättigenden Mahlzeit; sie beschleunigte und steuerte auf das größte Tier der Schule zu, ein 20 Fuß langes Männchen. Der Wal war außerstande, sich zu verteidigen, bevor sich die nach innen gerichteten, gezackten Zähne des Ungeheuers in ihr vergruben, und mühelos Knochen wie Speck durchtrennten. Der außer Gefecht gesetzte Orca heulte gequält auf, während seine ängstlichen Wegbegleiter weiter flüchteten. Verzweifelt bemühten sie sich, den Abstand zu dieser fürchterlichen neuen Bedrohung zu vergrößern. Der Geschmack des Blutes versetzte die riesige Bestie in einen Rausch. Indem sie noch einmal zubiss, löste sie die Schwanzflosse des verwundeten Wals endgültig vom Rest seines Rumpfs, und heißes Blut quoll in die eisigen Wasser. Die Schreie des sterbenden Opfers echoten durch die See, während sich der Meeresgigant daran gütlich tat.
Kapitel 1
Forschungsschiff Neptune, Beringsee, 62 Meilen vor der Küste Alaskas
Unerbittlicher Wind und Regen peitschten aufs Schiff ein, während die Crew damit haderte, auf Kurs zu bleiben. Andrews behielt das Sonar im Auge und versuchte dabei, das Übelkeit erregende Schaukeln der beharrlich weiterfahrenden Neptune zu ignorieren.
»Wir hätten bis zum Ende dieses Sturms warten sollen«, brummelte ihr Kapitän, ein stämmiger Mann mit breiter Brust, schwarzem Vollbart und stahlgrauen Augen.
»Überlassen Sie das Bedauern deswegen mir, Captain Smeet; konzentrieren Sie sich lieber darauf, nicht vom Kurs abzukommen.«
»Leichter gesagt als getan. Wir bekommen eine volle Breitseite Wind ab, und der Rumpf ist schon dick vereist.«
»Vereist?«, wiederholte Andrews und machte seinen Blick endlich von dem Messgerät los.
»Die Temperatur beträgt minus sieben Grad«, knurrte Smeet, gerade als er in eine hohe Welle steuerte. »Das ganze Wasser, das der Sturm in die Höhe spritzen lässt, wird zu Eis und bleibt an der Struktur des Schiffs haften. Die Männer sind draußen, um es zu entfernen, doch sollte es zu viel werden, sind wir geliefert.«
»Aber Sie haben die Lage unter Kontrolle, richtig?«
So gerne er es gewollt hätte: Smeet ging nicht auf Andrews beziehungsweise dessen Arroganz ein. Der Mann ließ das Dreifache des geltenden Lohns dafür springen, dass er dieses schwimmende Irrenhaus befehligte, und das Geld war dem Captain wichtiger als die Genugtuung, ihn in seine Schranken zu verweisen, so verlockend der Gedanke auch sein mochte. Wie er den Kerl nun betrachtete, versuchte er, schlau aus ihm zu werden. Andrews war arg dürr und hätte Smeets Meinung nach mit seinen blauen Augen, dem glänzend schwarzen Haar und teuren Poloshirt eher auf den Golfplatz eines Country Club gepasst als aufs Meer.
»Captain Smeet«, hob er nun erneut an, gleichzeitig da er seine Brille abnahm und sich dazu hinreißen ließ, dass ein leises Lächeln seine Lippen umspielte. »Die Männer werden doch damit fertig, oder?«
»Selbstverständlich, aber es ist nicht so, dass sie begeistert davon wären. Sie hätten sich meinen Rat zu Herzen nehmen und erst morgen auslaufen sollen; ich begreife nicht, was Sie so sehr drängt, dass es heute sein musste.«
»Der Grund dafür ist: Ich habe 15 Jahre darauf gewartet, wieder auf diesen Unterwasserschall zu stoßen, und werde mich wegen eines kleinen Unwetters kein bisschen länger aufhalten lassen.«
»Ich würde bei 20 Fuß hohen Wellen und einer Windgeschwindigkeit von 80 Meilen die Stunde von mehr als einem ‘kleinen Unwetter’ sprechen.«
»Bezahlen wir Sie nicht aus dem Grund so gut, da Sie der Beste sind? Oder möchten Sie andeuten, wir sollten jemanden einstellen, der fähiger ist als Sie?«
»Nein«, antwortete Smeet und schüttelte den Kopf. »Dazu besteht kein Anlass. Nehmen Sie lediglich die Gefahr zur Kenntnis.«
Falls der Schall, den wir empfangen, auf das zurückgeht, was ich vermute, Mr. Smeet, wird die Witterung hier draußen das geringste unserer Probleme sein.
Das wollte Andrews sagen, und sei es nur, um das Gemecker dieses bornierten Kapitäns zu unterbinden, doch das wäre der Situation nicht zuträglich gewesen. Stattdessen lächelte er.
»Zur Kenntnis genommen. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen? Ich muss mich wieder meiner Arbeit widmen. Behalten Sie unseren Kurs bei, bis ich etwas anderes anordne.«
Smeet belegte ihn noch mit einem finsteren Blick, bevor er sich Andrews’ Befehl fügte, während dieser seine Aufmerksamkeit wieder auf die Anzeige lenkte. Er überprüfte seine Kartenbilder, um sich noch einmal über die Position ihres Schiffs zu vergewissern. Nachdem er mit Zufriedenheit festgestellt hatte, dass sie weiterhin auf dem richtigen Weg waren, nahm er den Ausdruck zur Hand, den er einige Tage zuvor vom Ausschlag des Sonars gemacht hatte. Bei oberflächlicher Betrachtung schien es nichts weiter zu sein als eine zittrige Linie in Schwarzweiß; für ihn sprach diese jedoch Bände. Mit einem roten Stift hatte er den Bereich hervorgehoben, der ihn interessierte, und daneben vermerkt: Was bist du?
Während sich das Schiff über einer weiteren Welle aufbäumte, hoffte er inständig, dass sie lange genug am Leben blieben, um das herauszufinden.
Kapitel 2
23 Meilen von der Neptune entfernt behauptete sich die Besatzung des Krabbenkutters Red Gold gegen denselben Sturm. Im Ruderhaus kämpfte Captain Sam Harris darum, das Steuer in seiner Gewalt zu behalten, während die Nussschale inmitten der immensen Wogen herumgeworfen wurde. Am schwappenden Horizont tat sich eine besonders hoch auf, sodass der Himmel hinter ihr verschwand. Der erfahrene Kapitän steuerte in sie hinein, doch sein Magen drehte sich um, als die Welle unter dem Schiff hindurchströmte und dabei gegen den Rumpf klatschte.
Sams Bruder Joey betrat das Ruderhaus. Er war es gewohnt, sich auf See an Deck zu bewegen, weshalb er sich nichts aus dem Schwanken des Schiffs machte.
»Das ist die reinste Hölle da draußen«, bemerkte er und hockte sich auf die Bank hinter dem Captain. »Einer der Neuen hat sich schon verabschiedet.«
»Herrgott nochmal, mit diesen Grünschnäbeln hat man keine Minute Ruhe, was?«, beschwerte sich Sam, während er mit den Elementen rang.
»So ist das eben. Jedenfalls müssen wir diese Körbe herausziehen und in den Hafen zurück, ehe es uns in Stücke reißt. Wann erreichen wir den ersten Korb?«
»Müsste jeden Moment passieren. Du machst dich also besser bereit.«
Joey schmunzelte und steckte sich eine Zigarette an. »Ich bin allzeit bereit.« Er ließ den Qualm in zwei blauen Wölkchen aus seiner Nase wabern.
»Das weiß ich, aber tu mir einfach einen Gefallen: Sei vorsichtig, okay?«
Sams Tonfall verhehlte seine Angespanntheit nicht, was dazu führte, dass sich Joeys Magen ein wenig zusammenzog.
»Ich mache die Crew mobil«, erwiderte er, indem er seine eigene zunehmende Unruhe verdrängte. »Dann können wir diesen Krempel an Bord ziehen und uns schleunigst von hier verpfeifen.«
»Hey Joey.«
»Ja?«
»Denk daran, was ich gesagt habe: Sei vorsichtig.«
Da klopfte Joey seinem Bruder auf den Rücken und kehrte nach unten zurück, um die Männer zusammenzutrommeln.
Kapitel 3
Die vier Mann standen an der Luke und warteten auf die Erlaubnis, nach draußen zu gehen. Unter den Fischern, die auf der Beringsee arbeiteten, herrschte brüderliche Kameradschaft, obwohl Schlafmangel und ständig drohende Gefahren die Gemüter oft erhitzten. Mit einer Sterberate von 25 Prozent unter denjenigen, die mutig oder verrückt genug waren, ihren Lebensunterhalt auf dem Meer bestreiten zu wollen, stand jeder Neuling innerhalb der Mannschaft vor einer schwierigen Aufgabe. Man verdiente sich einzig dadurch Anerkennung, dass man an der Knochenarbeit teilnahm und sowohl dem Kapitän als auch den Kameraden in der Crew gegenüber körperliche wie geistige Stärke bewies.
»Hey, Rainwater, was hältst du von deinem ersten Eindruck der Beringsee?«, höhnte Mackay, als er sich seinen gelben Regenmantel überstreifte.
»Ich fische nicht zum ersten Mal, weißt du? Nur hier draußen war ich noch nicht.«
»Erfahrung hin oder her, auf einen solchen Höllenritt kann man sich nicht gefasst machen. Frag nur Grimshaw, der hat sich schon ausgeklinkt, obwohl wir noch gar nicht losgelegt haben.«
»Ich bin kein Drückeberger.«
»Das sagen sie alle. Ich gehe davon aus, dass Grimshaw jetzt ganz anders daherreden würde – wenn er den Kopf lange genug aus seinem Arsch ziehen könnte, um es zu tun.«
Rainwater stellte seine Nervosität hintan, um dem Schotten den Stinkefinger zu zeigen, und schaffte es sogar, breit zu grinsen.
»Wenn du alter Sack das noch hinkriegst, kann ich es auch.«
»Was du bisher gesehen hast, war harmlos, Junge. Warte, bis das Wasser gefriert oder einige der hohen Wellen über uns hereinbrechen. Vielleicht kannst du dich dann gemeinsam mit Grimshaw verkriechen.«
»Hohe Wellen?«, hakte Rainwater nach, weil er sich fragte, um wie vieles höher jene noch schlagen mochten, von denen das Schiff momentan schon bedrängt wurde.
»Ich hab hier draußen schon welche von 40, 50 Fuß erlebt.«
»Unfug«, behauptete Rainwater, erkannte dann aber mit Entsetzen, dass Morales nicht scherzte.
»Vor ein paar Jahren, als wir in der Gegend um Kiska auf Fischfang waren, brachte uns eine von 40 Fuß zum Kentern. Wir bemerkten überhaupt nichts davon, bis wir uns im Wasser wiederfanden. Sie traf uns von der Seite und rollte über uns hinweg, als ob wir nicht dort gewesen wären. Wir konnten von Glück reden, dass wir es überlebten.«
»Und dann geht dieser Trottel hin und beschließt, wieder in See zu stechen«, warf Mackay ein.
»Was soll ich sagen? Ich liebe es hier draußen. Vielleicht sind wir alle ein bisschen bescheuert, hm? Was ist mit dir, Frischling, bist du dem Leben auf dem Beringmeer gewachsen, was meinst du?«
»Als könnte er es sich aussuchen«, versetzte Mackay. »Schließlich gehört das Schiff seinem Daddy. War von vornherein klar, dass es einmal so kommt, nicht wahr, Junge?«
Rainwater hätte gern gewusst, weshalb ihn der Kommentar so verärgerte. Ihm war klar: Dass sie ihn aus der Reserve locken und ihm als Neuling – Grünschnabel eben, wie man seinesgleichen nannte – das Leben schwermachen wollten, gehörte zur Einführung in den Alltag an Bord eines Krabbenkutters. Egal, wo der Grund lag, er wollte sich nicht unterstellen lassen, eine Sonderbehandlung zu bekommen.
»Ich erwarte nicht, dass es hier draußen eine Extrawurst für mich gibt.«
»Hast du deinen Nachnamen deswegen zu Rainwater geändert – weil du nicht als Harris’ Spross abgekanzelt werden wolltest?«, fragte Mackay und wartete auf eine Reaktion.
»Ich habe meine Gründe, ja. Man sollte mich anhand meiner Leistungen beurteilen, nicht aufgrund meiner Herkunft.«
»Ach, mach dir darum keine Gedanken«, erwiderte Mackay. »Du wirst schneller an die Köderbox kommen, als dir lieb ist, und knietief im Matsch und Fischgekröse stehen.«
»Kann’s kaum erwarten«, murmelte Rainwater, was seine beiden Gefährten anscheinend lustig fanden.
»Keine Sorge, Junge«, sprach Morales. »Denk einfach an die Kohle, die bei dieser Fahrt herumkommt. Diese Arbeit gilt nicht umsonst als härteste auf der Welt. Dann hoffen wir mal, dass uns Daddy nicht untergehen lässt, was?«
Joey kam zu ihnen, woraufhin sie sich aufmachten, um durch die Luke zu gehen.
»Jetzt wird’s ernst, Männer, lasst uns ein paar Krabben hochholen«, sagte er, indem er sie öffnete und hinaus aufs Deck trat, woraufhin eine Bö einen Schwall Regen hereinwehte.
»Komm, Frischling, packen wir’s«, fuhr er fort und zog den Kopf ein, ging los und beugte sich gegen den Wind nach vorne.
Rainwater zog sich die Kapuze seines Mantels über den Kopf und folgten den beiden hinaus.
Drinnen war ihm schon flau im Magen gewesen, doch das ließ sich nicht annähernd mit den fürchterlichen Bedingungen an Deck vergleichen. Der Regen prasselte so heftig, dass es wehtat, und der Sturm brüllte fast so laut wie die aufgewühlte See, welche den Kutter schaukelte, als hätte sie ihre helle Freude daran.
Normalerweise holte man Krabben an Bord der Red Gold zu fünft ein, doch da sich Grimshaw schon aus der Affäre gezogen hatte und die restliche Zeit dieses Abstechers unter Deck absitzen würde, oblag es ihnen allein, die Körbe aus dem Wasser zu hieven und nachzuschauen, ob ihnen etwas in die Falle gegangen war. Dem nicht nachzukommen bedeutete, dass niemand entlohnt wurde und das ganze Unterfangen fehlschlagen konnte. Umgekehrt standen ihnen, so die Kästen voll waren, über 30.000 Dollar pro Kopf für ihre Bemühungen zu. Wie immer bediente Joey als Vorarbeiter an Deck den Hebekran mit Seilzug, den man brauchte, um die je 90 Pfund schweren Krabbenkörbe aus dem Ozean zu ziehen. Mackay hielt den Haken fest, den er auf die an der Oberfläche treibenden Baken der Körbe werfen würde, um sie einzuholen. Wenn die (hoffentlich gefüllten) Behälter aus Stahlstreben und Draht aus dem Wasser kamen, sollten er und Morales sie freischwebend hinüber zum Sortiertisch schwenken. Darüber leerte man sie dann, damit die Crew den Fang sichten konnte, wobei sie alle Jungtiere oder Weibchen zurück ins Meer werfen musste, um die Nachhaltigkeit dieses Gebiets auch in Zukunft zu gewährleisten, und die kostbare Ausbeute in die Sammeltanks unter Deck bringen lassen sollte.
Die Aufgabe an sich war schon anstrengend genug, doch weil das Boot in den Wirren des Unwetters schlingerte und schwankte, stieg die Gefahr ernsthafter oder gar tödlicher Verletzungen in bedenklichem Maße. Wie üblich für Anfänger war Rainwater am Ködertisch zugeteilt. Seine Pflicht bestand darin, den eingefrorenen Fisch zu schneiden und abzupacken, damit man die Krabbenkörbe damit bestücken konnte. Da er schon eine erhebliche Menge Kabeljau so präpariert hatte, spürte er seine Hände nicht mehr. Es handelte sich um eine Art Ritual zur Einweisung, und er machte ohne Murren weiter. Jedermann begann seine Laufbahn als Fischer genau dort, wo er jetzt stand – beim Herrichten von Ködern, bevor er über kurz oder lang in der Hierarchie aufsteigen würde.
»Erster Korb kommt hoch«, rief Joey, der seine Augen gegen Wind und Graupel zusammenkneifen musste.
Mackay setzte seine Füße hinter die vier Fuß hohe Reling und ignorierte den sicheren Tod, der im schäumenden Ozean unterhalb harrte, während das wankende Schiff durch die Wellen pflügte. Er warf den Haken aus.
Die Leine trudelte im hohen Bogen und dank seiner Erfahrung zielgenau durch die Luft, denn sie landete trotz des turbulenten Seegangs und Sturms exakt dort, wo der bewanderte Fischer sie haben wollte. Der Haken zog an den Tauen der Baken, die an dem in der Tiefe des Meeres stehenden Krabbenkorb befestigt waren.
Mackay holte die Leine ein, während Morales hinter ihm stand und sie aufwickelte, um sicherzugehen, dass sie sich nicht um die Beine seines Kameraden wickelte.
Als Mackay die Bake an der Bordwand hochgezogen hatte, nahm Morales sie. Sobald er sie an der Seilwinde einhakte, begann Joey mit der Bergung des Korbes. Rainwater kam nicht umhin, die gute Koordination der drei zu bewundern. Sie bewegten sich wie eine einzelne, bestens eingearbeitete Maschine, weil sie ihre jeweiligen Handgriffe beängstigend effizient erledigten, obwohl sie mit einem Mann weniger arbeiten mussten, obendrein bei einem furchteinflößend schweren Unwetter, wie es der 23-Jährige selten erlebt hatte.
Im Lauf der nächsten zwei Stunden hievte die Besatzung ihre Körbe an Deck und stapelte sie, so wie man sie um die wertvollen Königskrabben erleichterte. Ihr Ertrag war stattlich, wenn nicht gar spektakulär. Obwohl er schon seit über einer Stunde taube Hände hatte, bereitete Rainwater weiter Köder vor und unterbrach sich dabei nur, wenn der Sortiertisch voller Krabben lag, um beim Herauspicken derer zu helfen, die nicht verkauft werden konnten, und sie ins Meer zurückzuwerfen.
Der Sturm war stärker geworden, und jetzt klatschten imposante Wellen von der Seite gegen das Schiff, nicht ohne das Deck zu fluten.
»Wie viele müssen wir noch hochholen?«, rief Mackay gegen das Brausen an.
»Drei«, antwortete Joey hinterm Seilzug.
Mackay suchte Rainwaters Blick.
»Was ist, Frischling: Bock drauf, den Haken auf die nächste Bake zu werfen?«
Der junge Mann schaute seinen Onkel an, den Zwillingsbruder seines Vaters.
»Steht dir frei«, schrie Joey lauter als der Wind. »Bau nur keinen Mist, sonst müssen wir ‘ne Ehrenrunde drehen.«
Als Rainwater an die Reling trat, beugte er seine Hände, um sie ein wenig zu wärmen beziehungsweise überhaupt wieder zu spüren. Er bemerkte, dass die Bordwand nur bis knapp über seine Knie reichte, also mochte er, wenn er nur kurz sein Gleichgewicht verlor oder ein Ruck durchs Schiff ging, in die Tiefe stürzen, was er unmöglich überlebt hätte. Mackay grinste, als ob er seine Gedanken gelesen hätte, und überließ ihm den Haken; die Anstrengungen der letzten Stunden hatten ihm nichts von seinem Übermut genommen.
»Fall bloß nicht da rein, Frischling. Bis wir mit dieser Bleiente gewendet hätten, um dich zu retten, wärst du schon tot.«
Rainwater hob den Haken an, um Gefühl für sein Gewicht zu bekommen. Er hatte federleicht ausgesehen, bevor er von Mackay geworfen worden war, doch Rainwater kam er verblüffend schwer und unhandlich vor.
»Du musst ein paar Dinge beachten«, begann der Ältere. »Erstens: Bleib fest mit beiden Füßen am Boden stehen. Du willst dich nicht in der Leine verheddern und über Bord gezogen wurden. Zweitens: Wirf sie nicht direkt auf die Bake. Hoher Wellengang, kräftige Strömung, also zielst du lieber ein Stück weiter voraus. Der Haken wird sich automatisch festziehen, während du sie einholst.«
Rainwater nickte, und Mackay trat beiseite.
»Und noch eine Sache«, fügte er grinsend hinzu.
»Was?«
»Wenn ein Grünschnabel beim ersten Wurf nicht trifft, bedeutet das Unglück, also sieh zu, dass es dir gelingt.«
Rainwater blinzelte hinaus in die Finsternis, um die gelben Baken im unruhigen Ozean zu erkennen.
»Da ist sie, Junge, wirf den Haken«, rief Mackay.
Rainwater tat es. Das Metall segelte hoch durch die Luft davon. Er war sich sicher, zu wenig Schwung genommen zu haben, doch der Wind ließ den Haken über den Schwimmer hinausfliegen. Er begann, die Leine einzuholen, und lächelte verschmitzt, als sie sich am Tau einhakte.
»Guter Wurf«, lobte Mackay und schlug ihm auf den Rücken, ehe er beim Ziehen half. Morales hängte die Leine in den Seilzug, den Joey dann einschaltete, um den Stahlbehälter nach oben zu ziehen, von dem sie alle hofften, er sei übervoll mit Krabben.
»Vielleicht wird tatsächlich ein Fischer aus dir, Rainwater«, frotzelte Morales, während sie darauf warteten, dass der Korb ans Licht kam.
Der Junge grinste mit dem Gefühl, vielleicht gerade Anklang zu finden. Als das Geflecht an die Oberfläche trat, jubelten die drei, denn es platzte buchstäblich vor Königskrabben.
»Rotes Gold voraus, Männer!«, freute sich Morales, während sie sich darauf gefasst machten, die Ladung an Deck und zum Sortiertisch zu schwingen.
Rainwater grinste und blickte hinaus aufs Meer, eine Landschaft rollender, auf und nieder gehender Wogen, die gegen die Bordwand stoben. Die 70 Fuß hohe Monsterwelle, die von der Seite her gegen den Wind auf sie zukam, fiel ihm sofort auf, doch ihr schierer Umfang wollte ihn glauben machen, sie sei Einbildung. Sein Magen verkrampfte, da er wusste, dass sie das Schiff erfassen würde.
»Achtung!«, brüllte er.
Morales schaute auf, und obwohl der ergraute Fischer schon viele erlebt hatte, gab das Entsetzen in seinen Augen zu erkennen, dass er mit so etwas nie und nimmer gerechnet hätte.
»Heilige Scheiße – runter, duckt euch!«, schrie Mackay und warf sich hinter der Reling auf die Knie.
Rainwater war wie gelähmt und beobachtete mit offenem Mund, wie der Sog näherkam. Dies war auch das treffende Wort, denn so unmöglich es auch erschien: Ihm war klar, dass es keine herkömmliche Welle sein konnte. Morales und er sahen, wie er hervorbrach – ein gekrümmter, blaugrauer Buckel durch die Meeresoberfläche. Rainwater blieb nur ein Augenblick, um sich durch den Kopf gehenzulassen, wie riesig diese Kreatur sein musste. Da ihm keine vergleichbare einfiel, konnte er lediglich starren.
»Morales …« war alles, was er noch sagen konnte, bevor das Wesen mit dem Rücken gegen die Unterseite des Kutters knallte und ihn im Weiterschwimmen vollständig aus dem Wasser wuchtete.
Der Krabbenkorb, der noch an der Seilwinde baumelte, traf Morales, auf dessen Körper ungefähr die gleiche Kraft einwirkte wie bei einem Zusammenstoß mit einem Güterzug. Er wurde durch die Luft geschleudert wie eine Stoffpuppe, bevor ihn die schwarze, schwappende Beringsee verschlang.
Rainwater wurde gegen den Sortiertisch geworfen, wobei er sich den Kopf so fest stieß, dass grelles Licht vor seinen Augen aufblitzte.
Das Schiff landete wieder im Wasser, und die Kreatur nahm es kaum zur Kenntnis, während sie ihre Bahn fortsetzte. Sobald es aufschlug, neigte es sich zur Backbordseite hin und drohte umzukippen.
»Wir gehen unter!«, rief Joey, während er sich aufraffte.
»Wo ist Morales?«, fragte Mackay mit erhobener Stimme, damit man ihn gegen den Wind hörte.
Rainwater konnte nicht sprechen und hatte zu viel Angst, um abgesehen davon, dass er sich bemühte, das Erlebte zu verarbeiten, irgendetwas zu unternehmen.
Da rüttelte Mackay an seiner Schulter. »Ich habe gefragt: Wo ist Morales?«
»Über Bord gegangen …« Mehr brachte der junge Mann nicht heraus.
Die Backbordreling befand sich nur nach knapp über Wasser. Das Schiff hatte eine Schlagseite von erschreckenden 30 Grad, während der Captain versuchte, es vorm Kentern zu bewahren.
»Komm schon, wir müssen uns anziehen«, drängte Mackay, der nun wieder auf die Beine kam und Rainwater dann mit zurück zur Luke nach drinnen schleifte, wo Joey schon die Rettungswesten bereitmachte.
»Zieht die an«, bellte er. »Ich muss zum Ruderhaus; ihr zwei macht das Boot fertig. Zehn Minuten, dann ist dieser Kahn untergegangen.«
Damit war Rainwaters Onkel verschwunden und lief tiefer ins Innere des vernichtend getroffenen Schiffs. Mackay und der Junge begannen, sich die leuchtend roten Rettungswesten überzustreifen, während der Rumpf knarrte und sich seinem nassen Grab weiter zuneigte.
***
Im Ruderhaus herrschte Chaos. Die Scheiben waren beim Aufprall zersprungen, sodass der Wind durch den kleinen Raum pfiff. Sam saß im Kapitänssessel – sein bärtiges Gesicht der Inbegriff von Entschlossenheit – und tat sein Möglichstes, um das Schiff weiterzusteuern.
»Sam, schnell, wir müssen von Bord gehen, bevor es sinkt.«
»Ich kann uns über Wasser halten.«
»Kannst du nicht, es leckt; das Schiff ist verloren, also beeil dich. Lass uns abhauen.«
»Vielleicht können wir …«
»Es ist aus. Wir müssen von Deck – sofort.«
»Was ist passiert?«
»Etwas hat uns gerammt; etwas Großes.«
»Ein anderes Schiff?«
»Nein, glaube ich nicht. Gib es auf und komm mit, damit wir ganz schnell hier runterkommen.«
»Verfluchter Mist«, schimpfte Sam und sandte noch das Notsignal aus, bevor er seinem Bruder unter Deck folgte.
Mackay und Rainwater hatten ihre Westen nun angezogen und das selbstaufblasende Schlauchboot ausgebreitet. Wie Joey und Sam auf die beiden zueilten, mussten sie sich gegen die Schräglage des Schiffs lehnen, um nicht zu fallen.
»Jetzt aber los«, meinte Ersterer, da drehte sich sein Bruder um.
»Wo ist Grimshaw?«
Die Männer sahen einander entgeistert an. »Schafft das Boot ins Wasser«, befahl Sam und drehte sich zur Luke um.
»Du kannst nicht runtergehen.« Joey musste wieder gegen das Getöse anbrüllen. »Der Rumpf dürfte mittlerweile vollgelaufen sein. Es ist zu gefährlich.«
»Hier wird niemand im Stich gelassen«, stellte Sam klar und stürzte auf die Tür zu. Schon war er auf dem Weg unter Deck.
Die drei anderen blieben stehen, schauten sich gegenseitig an und dann auf Joey, der jetzt als Vorarbeiter das Sagen hatte.
»Tut, was er verlangt hat«, bestätigte er und zog seine Weste aus, um seinem Bruder zu folgen.
Rainwater wollte sich anschließen, doch Mackay hielt ihn an einer Schulter fest.
»Nicht auch noch du. Komm, wir müssen dieses Ding zum Schwimmen bringen. Allein schaff ich das nicht.«
»Wie lange warten wir?«, rief Rainwater, während er versuchte, nicht darauf zu achten, wie wenig fehlte, bis das Wasser aufs Deck strömen würde.
»Geben wir ihnen ein paar Minuten, dann …«
Plötzlich erschütterte eine gewaltige Explosion von unten das Schiff, und das Heck sauste in die Höhe, während Teile der Beplankung in die Luft flogen.
»Wir müssen sofort mit dem Boot ins Wasser!« Mackay wurde panisch, nun da Flutwellen über die Reling schwappten und das Schiff endgültig sank.
Rauch quoll aus dem Treppenschacht, der unters Deck führte, und zwischen den Bohlen zu ihren Füßen züngelten Flammen, die der Wind zusätzlich anfachte.
»Mein Dad …«, sprach Rainwater leise, während Mackay den Ring zog, um das runde Schlauchboot – zehn Fuß im Durchmesser – aufzublasen.
»Er ist tot«, rief Mackay, als er es schließlich zu Wasser ließ. Das Schiff ging immer weiter unter – sein Heck verschwand zusehends, während sich der Bug aufrichtete.
»Ich kann ihn retten, ich …«
Da packte Mackay Rainwater an den Schulterteilen seiner Weste und schüttelte ihn.
»Sie sind alle drei tot, also steig in das verdammte Boot!«
Der Junge zögerte und schaute mit großen Augen in den schwarzen, wabernden Qualm.
»Jetzt komm schon, Mann! Wenn etwas untergeht, geschieht es schnell.«
Rainwater sprang ins Boot. Mackay folgte ihm, woraufhin sich beide festhielten, da sie ins Meer rutschten. Schweigend beobachteten sie, wie die Red Gold unter der Oberfläche verschwand und drei ihrer Besatzungsmitglieder mit in die Tiefe nahm.
***
An Bord der Neptune hastete Andrews durch die engen Korridore zur Brücke. Smeet hörte den Funk ab, während er sein Bestes gab, das riesige Schiff durch den Sturm zu manövrieren.
»Wieso haben wir unseren Kurs geändert?«
Smeet warf einen kurzen Blick auf Andrews, mit dem er sein Missfallen kaum verbergen konnte.
»Wir haben den Notruf eines Krabbenkutters an einer Position wenige Meilen von hier erhalten. Die brauchen unsere Hilfe.«
»Dieses Schiff wurde privat gechartert; jemand anders soll sich darum kümmern.«
»Dort treiben möglicherweise Menschen im Wasser, und wir sind das nächste Schiff im Umkreis von 50 Meilen.«
»Wenn irgendein Depp so schlau war, seinen Kahn untergehen zu lassen, sehe ich nicht ein, weshalb meine Zeit und Gelder dazu verwendet werden sollen, sie aus dem Meer zu bergen.«
»Sie könnten an Unterkühlung sterben, wenn sie ins Wasser gefallen sind. Das will ich meinem Gewissen nicht zumuten.«
»Mir ist egal, was Sie wollen. Ich will, dass Sie sich an den Kurs halten, den ich vorgegeben habe.«
Smeet schaute Andrews böse an, woraufhin dieser vorsichtshalber einen Schritt zurücktrat. »Na gut, wenn das so ist, sage ich Ihnen jetzt, wie es laufen wird: Wir fahren diese Leute aufgabeln, die unsere Hilfe benötigen, dann lasse ich dieses – mein Schiff umdrehen, zurück in den Hafen fahren und Sie von Bord gehen.«
»Sie wurden vollständig ausbezahlt, und im Voraus, wie ich vielleicht bemerken dürfte«, entgegnete Andrews hämisch grinsend.
»Oh, Sie bekommen Ihr Geld zurück – jeden elenden Cent. Von jetzt an begreifen Sie sich als ungebetenen Gast an Bord meines Schiffs.«
»Wissen Sie, wer ich bin?«, fragte Andrews mit bedrohlicher Miene, während seine Wangen rot wurden. »Diese Mission ist zu wichtig, um von ihr abzurücken.«
»Vielleicht für Sie«, gab Smeet mit angewidertem Lächeln zurück, »aber nicht für mich.«
»Das können Sie nicht machen, ich werde mit meinen Vorgesetzten sprechen, die …«
»Hergehört, Sie Arschloch: Mag sein, dass Sie irgendein ganz wichtiger Handlanger der Regierung sind, aber offengestanden ist mir das egal. Dieses Schiff gehört mir. Ich bin der Captain und ich sage, dass wir diesen Leuten zu Hilfe eilen werden. Falls Ihnen das nicht passt, können Sie entweder schon einmal die Schwimmhose auspacken oder sich für den Rest der Reise in Ihre Koje zurückziehen. Es liegt an Ihnen.«
Andrews hielt dem Blick des Kapitäns stand. Seine Wange zuckte, während er die Information sacken ließ.
»Also gut, Captain, ich schätze, Sie und Ihre Seefahrerkollegen sind zum Zusammenhalten gezwungen; ich werde Ihnen nicht im Weg stehen.«
»Freut mich, zu hören.«
»Allerdings frage ich mich, ob es sonderlich klug ist, sich in Gewässer zu begeben, wo bereits jemand Schiffbruch erlitten hat.«
Smeet schüttelte den Kopf. »Vorhin haben Sie sich anscheinend nicht allzu viele Sorgen um heikle Wetterverhältnisse gemacht. Außerdem hörte es sich so an, als ob sie mit einem anderen Schiff zusammengestoßen wären.«
»Woher wissen Sie das?«
»Aus der Funknachricht ging hervor, dass sie mit etwas kollidiert sind.«
Nun schenkte Andrews dem Kapitän seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit.
»Wo ist das passiert?«
»Ein paar Meilen östlich von hier. Der Küstenwache sind wegen der Witterung die Hände gebunden, also sind wir wohl ihre letzte Hoffnung.«
Andrews nickte, während sich seine Gedanken schon vor lauter möglichen Gründen überschlugen.
»Die Nachricht war eindeutig, und es kann keiner dieser Kawenzmänner gewesen sein, von denen Sie kürzlich die Rede hatten?«
Smeet wackelte wieder mit dem Kopf. »Nein, die haben sich klar ausgedrückt. Es hieß, etwas Großes sei von der Seite gegen sie gestoßen. Ich tippe auf ein anderes Schiff, das zu dicht herankam, obschon ich erwartet hätte, dass auch von ihm ein Notrufsignal ausgesandt worden wäre.«
»Was glauben Sie, hat es damit auf sich?«
»Würden Sie die Klappe halten und mich zu den Überlebenden weiterfahren lassen, könnten Sie sie selbst fragen.«
***
Im Schlauchboot vergingen zwei nicht enden wollende Stunden. Rainwater schaute Mackay an, dessen Kopf mit dem Kinn am Brustbein nach vorne hing. Er hatte eine Zeitlang nichts gesagt, und das Blut aus der Wunde in seinem Gesicht war zu einer klebrigen Kruste getrocknet. Rainwater wollte seine Augen schließen, und sei es nur einen Moment lang, um die Schmerzen ein wenig zu lindern, die seinen Körper in Beschlag genommen hatten. Er fühlte sich wie betäubt. Seine Lippen bebten, während die Wellen das Boot willkürlich vor sich hertrieben. Er hatten den Peilsender an seiner Rettungsweste eingeschaltet, der jedem Schiff, das ihnen nahe genug kam, ihre Position preisgab. Im Moment hätte er am liebsten geschlafen, die Augen geschlossen und sich eine kleine Weile ausgeruht.
Stattdessen zwang er sich, einen klaren Blick zu fassen, wozu er sich auf einen Punkt konzentrierte und starrte – seinen rechten Fuß. Dabei bemühte er sich, sich nicht von der schwindlig machenden Bewegung des Boots ablenken zu lassen. Sein Verstand setzte sich leidlich gut gegen den Stumpfsinn durch, der in seinem Gehirn Fuß gefasst hatte. Vor seinem geistigen Auge sah er den immensen Sog und den blaugrauen Rücken des unbekannten Etwas, das ihr Schiff verheert hatte. Ihm war etwas untergekommen, das jedermanns Glauben auf die Probe stellte, und wusste jetzt, dass der Mensch nicht auf die Weltmeere gehörte. Wenige Augenblicke, nachdem er ohnmächtig geworden war, erfassten die Suchscheinwerfer der Neptune das Schlauchboot.
Kapitel 4
Namenloses Regierungsgebäude, Washington D.C.
Andrews ging über die Flure des weitläufigen Bauwerks, das offiziell nicht existierte. Es hatte keine Adresse, keinen erfassten Besitzer und keinen eingetragenen Titel. Obgleich man nur ein bescheidenes Erd- und Obergeschoss sah, wenn man davorstand, verfügte es über mehrere Ebenen, die tief in den Boden reichten, und fungierte im Notfall als eines von mehreren Geheimverstecken für den Präsidenten sowie sein Kabinett. Wie sich Andrews dem nicht gekennzeichneten Fahrstuhl näherte, streifte er mit einem flüchtigen Blick die zahllosen Sicherheitskameras, welche ihm auf Schritt und Tritt nachspürten. Nachdem er sich seinen Stapel Ordner auf einen Arm geladen hatte, zog er seinen Dienstausweis durch den Kartenleser neben der Tür und legte seine freie Hand flach gegen das unauffällige Paneel darunter. Das System las den Abdruck der Innenfläche, woraufhin sich der Aufzug öffnete und ihn hineinließ. Er wartete, bis die Tür zuging, und fuhr dann acht Ebenen weit hinunter zu seinem Ziel.
Von dieser Besprechung hing alles ab. Er war sich sicher, über hinreichend unterstützendes Beweismaterial zu verfügen, um seine Vorgesetzten zu überzeugen. Ungeachtet der öffentlichen Meinung über eine Verschwörung Außerirdischer und Kenntnisse zu extraterrestrischer Intelligenz belief sich die wesentliche und um ein Vielfaches weniger spannende Tatsache darauf, dass die Regierung nicht an dergleichen glaubte und ein verstockter, schwer zu vereinnahmender Haufen war, dem es nur um Politik, Kriege und Geld ging.
Nachdem die Tür zischend aufgegangen war, wurde Andrews an einem Sicherheitsposten zurückgehalten, wo man ihn nach allem durchsuchte, was sich als gefährliche Waffe einsetzen ließ. Dann wurde er für sauber befunden, bekam seine Ordner zurück und durfte weitergehen. Er nahm sich einen Moment, um seine Gedanken zu sammeln, holte tief Luft und betrat den Besprechungsraum. Nachdem er zweckgerichtet nach vorne gegangen war, legte er den Papierkram in seinen beiden Armen auf dem Pult ab und hielt dann inne, um die vier Männer anzusehen, die ihn mit kalter Gleichgültigkeit beobachteten.
»Meine Herren, ich bin Dr. Martin Andrews und heute hier, um mich mit Ihnen über die Situation zu unterhalten, von der Sie – zumindest in vorbereitender Weise – in Kenntnis gesetzt wurden.«
Die Blicke der Männer blieben teilnahmslos.
Zähes Pack, dachte Andrews bei sich, während er fortfuhr:
»1997 erhielt die nationale Wetter- und Ozeanografiebehörde ein Unterwassersignal, das keinem der bis dato aufgezeichneten ähnelte. Es wurde von einem Feld akustischer Tiefseemessgeräte eingefangen, die vornehmlich zur Überwachung seismischer Aktivitäten gedacht waren. Wir nannten es Bloop.«
»Was genau war daran so ungewöhnlich?«, fragte ein weißhaariger, grauäugiger General, der abweisend wirkte und sich nicht einschätzen ließ.
»Unsere Analyse, die sich mit den Nachforschungen der Behörde deckte, endete mit dem Ergebnis, dass es ein Geräusch organischen Ursprungs war.«
»Das ist zweifellos nicht ungewöhnlich. Der Ozean steckt voller Leben«, entgegnete der Verteidigungsminister, dessen Tonfall darauf hindeutete, dass er dies als Zeitverschwendung ansah.
»Das stimmt, Sir«, räumte Andrews ein. »Allerdings entsprach nichts an diesem Signal der Norm.«
Er machte eine Pause, um die Aussage wirken zu lassen, doch falls sein Publikum gebannt war, konnte es dies sehr gut überspielen. Er fuhr fort: »Dieses … Bloop wurde gründlich untersucht und erwies sich nicht nur als organisch, sondern ging unseren Ergebnissen zufolge von einem Lebewesen aus, das größer war als jedes andere bislang bekannte.«
»Wie groß exakt?«, hakte der weißhaarige Befehlshaber nach, in dessen Augen sich nun ein leiser Anflug von Interesse erkennen ließ.
»Nun ja, Sir, wenn man sich vor Augen hält, dass das größte bekannte Lebewesen, das die Meere bevölkert – der Blauwal –, zwischen 85 und 90 Fuß lang wird, hätte diese Kreatur anhand des Signals, das wir aufschnappten, mindestens das Dreifache messen müssen.«
»Möchten Sie unterstellen, es handle sich um einen verdammten Dinosaurier welcher Art auch immer?«, fragte ein dünner, sehniger Mann mit übergroßer Brille.
»Nein, kein Dinosaurier, sondern eine unbekannte Spezies.«
»Dr. Andrews«, sagte der Verteidigungsminister. »Falls es so groß war, wie Sie behaupten: Warum hat es dann noch nie jemand gesehen? Warum hat sich seine Existenz noch nicht bemerkbar gemacht? Damit meine ich, wie kann jener Vorfall aus dem Jahr ‘97 Sie zu einem so spekulativen Schluss führen?«
»Also, Sir, bis vor einigen Wochen waren wir drauf und dran, Bloop als Anomalie ad acta zu legen – vielleicht als Eisbeben beliebigen Ursprungs oder Austritt von Gas, entwichen aus einem Riss im Meeresboden. In jüngster Zeit haben sich jedoch Ereignisse zugetragen, die ein neues Licht auf die Umstände werfen, und aus diesem Grund bin ich nun zu Ihnen gekommen.«
»Fahren Sie fort«, bat der General, der sich nun von nichts anderem mehr ablenken ließ.
»Im September stürzte ein sehr großer Teil des Ross-Schelfeises in der Antarktis ins Meer. Wir gehen davon aus, dass die Wucht des Aufpralls beim Absacken des Eises ins Wasser und die damit einhergehenden Vibrationen das Wesen aus einer Art Langzeitwinterschlaf geweckt haben.«
»Verzeihung, Doktor«, warf der Verteidigungsminister mit einem selbstgefälligen Grinsen ein. »Mir erschließt sich nicht, wie es sich hierbei um etwas anderes als Rätselraten und Fantasterei handeln kann. Wenn Sie mich überzeugen wollen, benötigen wir Fakten.«
»Darauf wollte ich noch zu sprechen kommen, Sir.«
Andrews atmete wieder tief durch und redete weiter.
»Wie ich bereits sagte: Wir glauben, die Kreatur wurde von dem abgebrochenen Stück Schelfeis aus einer Art Winterschlaf geweckt. Infolge der Erschütterung haben wir ein weiteres Geräusch in diesem Gebiet aufgezeichnet, dessen Frequenz jener des Bloop entsprach. Später wurden in der Nähe des Ursprungs des Signals partielle Überreste eines Killerwals entdeckt.«
»Der Ozean ist unermesslich weit, also können Sie unmöglich unterstellen, diese Kreatur habe den Wal gerissen«, sagte der dünne Brillenträger, indem er dem Verteidigungsminister einen empörten Blick zuwarf.
»Verzeihen Sie, Sir, wenn ich Ihnen plump widersprechen muss«, beharrte Andrews, »aber wir wissen es genau. Wir haben den Kadaver geborgen. Sein gesamter Hinterleib fehlte; kein Hai wäre dazu in der Lage. Ferner wurde der Radius einiger Bisswunden des Wals gemessen, und unabhängig von einer gewissen Verwesung sowie Spuren kleinerer Aasfresser, die es zu berücksichtigen galt, haben wir Erstaunliches herausgefunden.«
»Und zwar?«, fragte der General und faltete seine Hände auf dem Tisch.
»Und zwar, Sir, dass das Gebiss dieses Wesens einen Umfang von 18 bis 20 Fuß haben muss.«
»Ausgeschlossen«, sprach der General, während er den Ehering an seiner Hand drehte. »Das ist schwer zu glauben, Dr. Andrews.«
»Sie haben recht, aber bitte lassen Sie mich aussprechen. Unmittelbar nach dem Eisbeben änderten zahllose Wal- und Fischarten ihre Zug- und Fressverhalten. Als wir diesen Abweichungen auf den Grund gingen, wurde offenbar, dass alle Spezies – angefangen beim kleinsten Fisch bis hin zu größten Meeressäugern – irgendetwas meiden wollten. Vor ein paar Wochen war ich an Bord des Forschungsschiffs Neptune im Beringmeer und versuchte, der Ursache der Störung nachzuspüren, als wir den Hilferuf eines in Not geratenen Fischkutters erhielten, der angab, von etwas gerammt worden zu sein. Wir unterbrachen unsere Suche natürlich und machten uns auf den Weg zu ihm. Zu dem Zeitpunkt, als wir eintrafen, war das Schiff gesunken, doch wir konnten ein Rettungsboot bergen, das mit zwei Überlebenden in der Nähe trieb. Beide Männer litten an Unterkühlung und entkamen dem Tod nur knapp; einer indes sprach in wirren Worten über ein Ungeheuer, das gegen den Kutter gestoßen sei.«
»Sind die zwei noch am Leben?«, fragte der General.
»Ja, sie wurden in ein Krankenhaus in Anchorage gebracht und behandelt; mittlerweile hat man sie entlassen. Der Rest der Besatzung ertrank an Bord.«
»Dr. Andrews«, hob der Verteidigungsminister an, indem er den Wissenschaftler mit einem finsteren Blick bedachte. »Das beweist immer noch nichts. Gerede über Wahrscheinlichkeiten und verwegene Mutmaßungen zählen nicht zu den Grundlagen, mit denen wir etwas anfangen können. Was genau erwarten Sie nun von uns?«
»Ich brauche finanzielle Mittel, um ein Team zusammenzustellen, und ein Schiff, um mich auf die Suche nach dieser Kreatur zu begeben – um sie zu erforschen.«
»Halten Sie es für lohnenswert, Regierungsgelder für diese Bemühungen einzusetzen?«
»Also, eigentlich schon, Sir – lohnenswerter als die Kriege, die unser Land weiter fördert.«
Er bedauerte sofort, dies gesagt zu haben, und wusste, dass er seine Chance vertan hatte. Der Minister wurde rot im Gesicht und starrte ihn bedrohlich an, während er mit zusammengebissenen Zähnen weitersprach:
»Tja, zum Glück für Sie, Mr. Andrews, wird die Entscheidung, wohin diese Gelder fließen, an Stellen weit über Ihrer Gehaltsklasse gefällt. Nur damit Sie es wissen: Ich glaube, Sie haben den einen oder anderen Horrorfilm zu viel gesehen.«
»Sollten Sie davon absehen, es zu tun, begehen Sie einen schweren Fehler. Wir könnten unheimlich viel darüber erfahren«, hielt Andrews dagegen.
»Ich weiß Ihre Warnung zu schätzen, aber Sie irren sich.«
»Nein, tut er nicht.«
Alle wandten sich daraufhin dem einzigen Mann am Tisch zu, der bislang geschwiegen hatte. Er war schlank, hatte schwarzes Haar und ein schmales Gesicht. Seine Augen waren dunkel, und er trotzte den Blicken der Beisitzenden spürbar selbstbewusst.
»Wer sind Sie denn bitteschön?«, fragte der Verteidigungsminister, während der Mann aufstand und vor die Gesprächsrunde trat, wobei er die Hände auf seinem Rücken verschränkte.
»Mein Name lautet Russo, und ich bin hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Dr. Andrews in allem recht hat, was er sagt.«
»Darf ich fragen, woher Sie das wissen?«, blaffte der Minister, dem es eindeutig nicht schmeckte, so zurechtgewiesen zu werden.
»Ich fürchte, dass ich Ihnen gegenüber keine Rechenschaft ablegen muss.«
»Das ist lächerlich, ich genieße höchste Befugnis.«
Das bewog Russo zum Achselzucken; er schaute den älteren Mann ungerührt an.
»Das verstehe ich, Mr. Secretary, also versuchen Sie bitte, genauso zu verstehen, dass jeder irgendjemandem gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet ist. Fürs Erste würde ich es zu schätzen wissen, wenn Sie Ruhe gäben und mich erklären ließen.«
Russo nahm wieder Platz und griff zu einem Stoß Mappen mit dem Wappen des Präsidenten darauf. Nachdem er allen Anwesenden eine gegeben hatte, blieb eine für Andrews übrig.
»Nun, Gentlemen, seien Sie so gut und schlagen Sie diese Dokumente auf. Ich werde alles über Projekt Blue erläutern und wie es mit der finanziellen Förderung zusammenhängt, um die Dr. Andrews bittet.«
Kapitel 5
Rainbow Bay Beach Gold Coast, Australien
Die Sonne brannte heiß auf den jungen Pottwal, der ungefähr fünf Stunden zuvor gestrandet war. Die 26-jährige Meeresbiologin Clara Thompson und ihr Team aus Freiwilligen hatte sich eine Zeitlang darum bemüht, das verirrte Tier zu retten, und standen nun kurz davor, ihn zurück ins Wasser heben zu können.
»Dexter«, rief sie ihrem Assistenten zu, während sie die nassen Handtücher einsammelte, die man auf den Buckel des Wals gelegt hatte. »Spritz sie noch einmal ab, ihre Haut muss feucht bleiben.«
Dexter schaute zu seiner Vorgesetzten hinüber und nickte. Er brachte es nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass die Überlebenschancen des Tiers gering waren. Clara hatte schon erlebt, dass Wale stranden, aber während der letzten Wochen eine besorgniserregende Häufung des Phänomens festgestellt. Meistens gab es eine plausible Erklärung dafür; Verwirrung aufseiten der Tiere, oder sie waren wendigeren Delfinen ins seichte Wasser gefolgt – dies waren Gründe für ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit gewesen. Man wusste auch, dass sogar die Geräusche der Echolote von U-Booten gewisse Spezies desorientieren konnten, sodass sie irrtümlich strandeten, aber dennoch bereitete Clara etwas an dieser jüngsten Serie Kopfzerbrechen. Es geschah zu oft, und zu viele unterschiedliche Arten waren zur selben Zeit betroffen. Es genügte nicht, um in die Massenmedien zu gelangen, nicht wenn man über Zank unter Prominenten berichten oder Kriege in fernen Ländern schönreden konnte. In der eng miteinander verschweißten Gemeinschaft der Meeresbiologen allerdings hatten die Strandungen zweifelsohne für einige hochgezogene Augenbrauen gesorgt, und jetzt war eine vor Claras Tür geschehen.
Sie hatte einen schlanken, sportlich gebauten Körper und im Zuge ihres vorwiegend draußen bestrittenen Berufsalltags sommersprossige Haut. Ihre Augen waren grün, und ihre Haare bemerkenswert rot, was in der gleißenden australischen Sonne immer noch auffiel, obwohl sie sie zusammengebunden und ihre grüne Baseballmütze aufgesetzt hatte.
»Wie lange braucht dieser verdammte Kran denn noch«, fluchte sie.
»Er ist unterwegs. Schätze, es wird keine Stunde mehr dauern«, antwortete Dexter mit Blick auf die heranrollende Flut, deren Wellen den Unterbauch des Wals umspülten.
Er hob den Schlauch auf, während sich Clara anschickte, die Erde rings um das Tier auszuheben, um ihn nachher leichter ins Meer hieven zu können. Eine Schar Schaulustiger war zusammengekommen und verfolgte das Treiben gespannt mit.
»Wir können nicht mehr viel länger warten«, klagte sie, während sie das geschwächte Tier besah. »Lass es uns von Hand versuchen.«
»Ich dachte, du hättest gesagt, das würden wir nur tun, wenn es nicht mehr anders geht.«
»Es geht jetzt nicht mehr anders. Bring diese Gaffer dazu, uns zur Hand zu gehen.«
30 Minuten später war es der Gruppe gelungen, den Wal zurück ins Nass zu schleifen. Sie johlten und grölten, während sie dabei zuschauten, wie das Tier davonschwamm. Clara richtete sich auf, stemmte ihre Hände in die Hüften und schnaufte beschwerlich infolge der Anstrengung.
»Glaubst du, sie wird es überleben?«, fragte Dexter, als er sich neben sie stellte.
»Ich hoffe es. Sie sieht recht fit aus.«
Die beiden machten sich gerade auf den Rückweg den Strand hinauf, als sie Unruhe hinter sich bemerkten.
Der Wal, den sie gerettet hatten, war wieder gestrandet, diesmal jedoch nicht allein. Clara und Dexter beobachteten, wie sich Dutzende weitere und auch Delfine, ja sogar Haie in den Sand warfen. Sie schlugen um sich, während sie versuchten, sich so weit wie möglich vom Wasser zu entfernen.
»Um Gottes willen …«, raunte Dexter, während eine Reihe Meeresbewohner nach der anderen ins Trockene rutschte.
Clara erwiderte nichts. Sie blickte lediglich über den Strand voller gestrandeter Wasserlebewesen hinweg nach draußen auf den ruhigen, blauen Ozean.
»Was zum Teufel macht euch allen solche Angst?«, flüsterte sie leise für sich.
Kapitel 6
Kodiak, Kodiak Island, Alaska
Kodiak Island an der Südküste von Alaska ist die zweitgrößte Insel der Vereinigten Staaten. Die nördlichen und östlichen Regionen werden von dicht bewaldete, Gebirge geprägt, während im Süden nur vereinzelt Bäume wachsen. An der Küste gibt es zahlreiche natürliche Buchten, in welchen die ansässigen Fischer ihre Schiffe vertäuen, wenn wie so oft in der umliegenden Beringsee ein erbitterter Sturm aufkommt. Zudem zeichnet sich das Land durch ein üppiges Wildschutzgebiet aus und wird von Menschen bewohnt, die nahezu ausschließlich in der florierenden Fischereiindustrie arbeiten.
Aufgrund ihrer geografischen Lage innerhalb der subpolaren Meeresklimazone sind die 6.000 Einheimischen langen, kalten Wintern unterworfen, die selbst die unentwegtesten Fischer – sie machen einen Großteil der Lokalbevölkerung aus – auf die Probe stellen.
Valerie Harris schaute aus dem Fenster ihres Hauses in die Bucht und hielt das Foto ihres verstorbenen Ehemanns noch ein wenig fester. Obwohl es an sich keine Überraschung darstellte, dass jemand sein Leben auf dem Meer ließ, hatten sich die Zeitungen dem Unglück besonders aufmerksam gewidmet, weil die Familie Harris einschlägig bekannt war – schon seit Generationen – und das lokale Interesse den Aufwand rechtfertigte. Valerie beobachtete ihre Kinder beim Frühstücken. Tyler, drei Jahre alt, und Tess, die gerade fünf geworden war, würden ihren Vater nie kennenlernen – nie erfahren, was für ein wunderbar einfühlsamer, freundlicher Mensch er gewesen war, und das machte die Witwe wütend. Sie schloss ihre Augen und lehnte ihre Stirn gegen die kühle Fensterscheibe, wobei sie ein schlechtes Gewissen bekam, da sie wieder auf diese negativen Gedanken gekommen war.
Sie hatte eine Flasche Wodka und eine große Menge Tabletten gekauft. Zweimal schon war sie so weit gegangen, die Dosen zu öffnen, aber nicht die Kraft gefunden, es durchzuziehen, in erster Linie aus Liebe für ihre Kinder. Die innere Stimme, deretwegen sie überhaupt darauf gekommen war, sich umzubringen, hielt ihr zunehmend stichhaltigere Argumente dafür vor, dass die beiden in letzter Zeit ohne ihre Mutter besser beraten seien. Wie sie nun so dastand, stellte sie erneut jene Fragen, die sie nie würde beantworten können:
Was ist, wenn uns das Geld ausgeht?
Was, wenn das Haus veräußert wird, weil ich die Hypothekenraten nicht bezahlen kann?
Was, wenn die bedingungslose Liebe meiner Kinder, während sie älter werden, in Verachtung und Hass umschlägt?
Sie machte ihre Augen wieder zu und ballte die Fäuste vor Entschlossenheit, den beiden solche Qualen zu ersparen. Nichtsdestoweniger fragte sie sich, wie lange es dauern würde, bis sie sich, um Hilfe zu erhalten, an die Stimme in ihrem Kopf wenden würde, und diese Vorstellung ängstigte sie. Ihr blieb nichts anderes übrig, als das Leben so zu nehmen, wie es sich von einem Tag auf den nächsten ergab, und zu hoffen, dass sie es durchstand.
Und falls der Tag kommt, an dem ich es nicht mehr schaffe?
Sie schaute erneut zu ihren Kindern hinüber und schluckte weitere Tränen hinunter. Sie musste es schaffen; das war ihre einzige Möglichkeit.
Kapitel 7
Sunset Cliffs Kalifornien
»Mach schon, Tommy, sei kein solcher Angsthase«, stichelte Alex, während er auf der Stelle schwamm und hinauf zur Spitze der Klippe blinzelte.
Tommy ignorierte seinen Bruder und schaute ins Meer, das ungefähr 50 Fuß unter ihm lag. Es hatte als Mutprobe begonnen, um sich gegenseitig zu immer extremere Tätigkeiten anzustacheln, und zwar in der Hoffnung, der jeweils andere werde kneifen. Zuerst hatten sie einander aufgefordert, in einem Geschäft in ihrer Nähe eine Zeitschrift zu stehlen, dann zum Überqueren der Straße, ohne sich umzuschauen oder eine andere Richtung einzuschlagen, um herauszufinden, ob der Verkehr ihnen ausweichen würde. Soweit war jeder den Aufgaben des anderen nachgekommen, doch jetzt, als der 14-jährige Tommy vom Rand der Klippen aus hinunter zu seinem Bruder blickte, traute er sich nicht zu, sein Soll zu erfüllen.
»Tooommmyyy«, lockte Alex, ehe er sich im Wasser auf den Rücken fallenließ und in die Luft spuckte.
Tommy ließ den Blick hinaus auf den schönen, hellblauen Pazifik schweifen und verlagerte sein Gewicht, weil seine Füße auf dem heißen Fels allmählich brannten. Er wusste, beim Sprung würde ihm nichts passieren. Das Wasser war an dieser Stelle tief, also lief er keine Gefahr, auf Steine oder sonst etwas zu schlagen, das ihn töten oder einen Rollstuhl fesseln mochte. Trotzdem waren ihm Höhen nicht geheuer, und wie er so zu seinem Bruder hinunterschaute, drehte sich sein Magen um.
Alex gackerte wie ein Huhn, während er das Wasser unterhalb mit Armen und Beinen aufwühlte.
»Also gut, hör auf damit«, rief Tommy. Der Zorn in seiner Stimme übertünchte seine Furcht nur knapp.
Er holte tief Luft und sammelte sich, um zu springen. Dass er den Schwanz einzog, kam nicht infrage. Damit wollte er auf keinen Fall leben, besonders weil er fast ein ganzes Jahr älter als Alex war. Nun trat er mehrere Schritte zurück, atmete aus und berechnete seinen Anlauf.
Drei Schritte laufen, dann abspringen.
Ist doch leicht.
Er erfuhr einen kräftigen Adrenalinschub, als er losstürzte, und spielte halb mit dem Gedanken, mitten in der Luft einen Salto zu vollziehen, um Alex zum Schweigen zu bringen und zu beweisen, dass er keinen Schiss hatte.
Just als er sich abstoßen wollte, sah er die Umrisse am Rande seines Gesichtskreises, konnte aber nicht mehr rechtzeitig innehalten, obwohl er wollte. Sie waren gewaltig – ein sehr dunkler Schatten unter Wasser, der auf Alex zukam. Tommy sprang, fiel aber eher ins Wasser, wobei die Spöttelei seines Bruders zweitrangig wurde angesichts des Dings, das sich näherte. Er redete sich ein, es sei ein Wal, wusste aber, dass es dafür zu groß war. Unfassbar groß. Der Aufprall im Wasser unterbrach seinen Gedankengang, da er sich rollte und drehte, nachdem er eingetaucht war.
Rasch schwamm er an die Oberfläche und schnappte Luft, während der Jüngere grinsend zu ihm geschwommen kam.
»Was sollte das denn werden? Du hast vermasselt, was auch immer du tun …«
»Wir müssen hier weg!«, platzte Tommy heraus und kraulte los Richtung Strand.
»Was ist denn los?«
Tommy tauchte mit dem Kopf unter und trat fest aus. Er bekam nur vage mit, dass Alex folgte, und sah den Strand nicht weit voraus, der ihm dennoch ungeheuer weit entfernt vorkam. Als er sich zu einem kurzen Blick zurück hinreißen ließ, schüttete sein Körper noch mehr Adrenalin aus.
Der Sog näherte sich den beiden. Er war unbeschreiblich breit, unbeschreiblich lang. Tommy meinte, die geisterhafte Form eines gesprenkelt grauen Körpers unter der Oberfläche zu erkennen – der des unbekannten Etwas, das nach ihnen trachtete.
Dann wandte er sich wieder dem Strand zu, hielt seinen Kopf unten und strengte seine Beine nach Kräften an. Alex hatte zu ihm aufgeschlossen, und nun schwammen beide Jungen synchron nebeneinander her.
Tommy spürte den sandigen Meeresboden, als sie ins Seichte gelangten, ein tröstliches Gefühl. Hustend und spuckend hastete er den Strand hinauf, sein Bruder dicht hinter ihm. Er drehte sich um und schaute aufs Wasser, wo sich der riesige Leib, der ihnen gefolgt war, zurückzog und wieder untertauchte. Das dabei verdrängte Wasser rollte auf sie zu und ergoss sich in einer haushohen Flutwelle über den Strand, wo sich Sonnenanbeter und Kinder aufgeregt auf höheres Gelände flüchteten. Alex stützte sich mit den Händen auf die Oberschenkel und keuchte, um wieder zu Atem zu kommen.
»Was zur Hölle hast du dir dabei gedacht?«, fragte er beim Hecheln.
Tommy antwortete nicht. Er konnte seinen Blick nicht vom Meer losmachen und nur versuchen, eine vernünftige Erklärung für das zu finden, was er gesehen hatte. »Hey«, rief Alex. »Was sollte das?«
Sein Bruder schüttelte den Kopf, bevor er sich laut stöhnend in die Brandung erbrach.
Kapitel 8
Freeport, Kodiak Island, Alaska
Mit ihrer Länge von 120 Fuß war die Victorious weit größer als die meisten anderen kommerziellen Fischkutter im Hafen. Es handelte sich um einen drastisch modifizierten Walfänger, umgerüstet für die Operation, zu der Andrews und Russo antreten wollten. Sein unauffällig grauer Rumpf beherbergte nun eine Kommandozentrale auf dem neusten Stand der Technik, dazu Quartiere für eine Besatzung von bis zu 20 Personen. Diese Reise sollten sie jedoch nur zu zwölft begehen. Andrews wartete, bis das Schiff sicher vor Anker lag, strich seine Jacke glatt und betrat dann über die Landungsbrücke das Dock. Dort verschaffte er sich einen Überblick der Stadt, ohne seine Sonnenbrille abzunehmen, und ließ den Blick an den Häusern entlang schweifen, die verstreut am Hang standen. Der Wind war kalt und roch salzig, während ihm das Gekrächze der Möwen schon jetzt langsam Kopfschmerzen bereitete.
Am Ende des Hafendamms war ein wettergegerbter, grauhaariger Fischer mit Krabbenkörben zugange. Andrews ging auf ihn zu und setzte sein freundlichstes Lächeln auf.
»Verzeihung, Sir«, begann er ruhig. »Können Sie mir zufällig helfen? Ich suche jemanden.«
»Aye, ansonsten wären Sie nicht hier«, erwiderte der alte Mann, ohne von seiner Arbeit aufzuschauen.
»Wissen Sie vielleicht, wo ich Henry Rainwater finde?«
Da hielt der Fischer inne und schaute Andrews an, wobei er sich der Sonne wegen eine Hand über die Augen hielt.
»Sie meinen den jungen Harris?«
Andrews nickte. »Ich bin davon ausgegangen, er heiße jetzt Rainwater.«
»Sagt er selbst, aber hier in der Gegend wird er immer Harris bleiben. Sie haben von den Umständen gehört, unter denen sein Vater und Onkel gestorben sind?«
»Dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen. Sie sollten nur verstehen, dass ich unbedingt mit ihm reden muss.«
Der Alte stand auf und wischte sich die verschmierten Hände an seinem Hemd ab.
»Nun ja, ich weiß auch nicht mehr, weil er mit niemandem sonderlich viel gesprochen hat, seitdem er aus dem Krankenhaus zurück ist. Er hat ja nicht einmal das Haus verlassen; zumindest will keiner ihn gesehen haben.«
»Wo genau wohnt er denn?«, fragte Andrew, indem er einen Notizblock aus seiner Tasche nahm.
»Von mir erfahren Sie nichts – nicht bevor ich weiß, was Sie wollen.«
»Dass ich mit ihm spreche, ist absolut unerlässlich.«