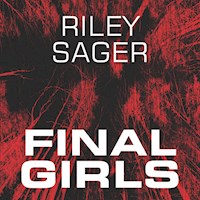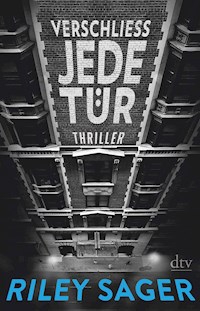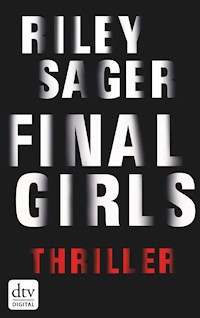Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im See lauert das Grauen Schauspielerin Casey Fletcher hat einen schweren Verlust erlitten, außerdem ist ihre Karriere am Nullpunkt. Um wieder auf die Füße zu kommen, zieht sie sich in ihr Haus am Lake Greene in Vermont zurück. Hier gibt es nichts als Natur, Ruhe und Stille. Das ist nicht leicht auszuhalten, deshalb greift sie immer häufiger zum Bourbon – und zu einem Fernglas. Damit beobachtet sie nicht etwa Vögel, sondern das Paar auf der gegenüberliegenden Seeseite. Katherine und Tom scheinen eine perfekte Ehe zu führen, doch schon bald bemerkt Casey, dass die Fassade bröckelt. Als Katherine kurz darauf spurlos verschwindet, ist Casey höchst alarmiert und bald überzeugt, dass Tom seiner Frau etwas angetan hat …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Am Ufer der dunklen Wasser des Lake Greene stehen fünf Häuser unterschiedlichsten Baustils: von urig-gemütlich bis schreiend modern. Im Sommer, wenn Vermont seine ganze Pracht entfaltet, strahlen sie nachts wie Leuchttürme. Doch ab Mitte Oktober scheint es, als wäre die Finsternis des Sees über die Ufer getreten und in die Häuser eingedrungen.
Ganz besonders gilt das für das Haus genau gegenüber. Was drinnen vor sich geht, ist nicht zu sehen. Genau wie beim See. Egal wie sehr man die Augen anstrengt, dicht unter der Oberfläche liegen Dinge, die man niemals zu Gesicht bekommen wird.
Wer wüsste das besser als ich?
Von Riley Sager sind bei dtv außerdem erschienen:
Final Girls
Schwarzer See
Verschließ jede Tür
HOME – Haus der bösen Schatten
NIGHT – Nacht der Angst
Hope’s End – Du kannst niemandem trauen
Riley Sager
Lake
Das Haus am dunklen Ufer
Deutsch von Christine Blum
Der See ist dunkler als ein Sarg mit zugeklapptem Deckel.
Das sagte Marnie immer, damals, als wir Kinder waren und sie ständig versuchte, mir Angst einzujagen. Natürlich ist das übertrieben. Aber nicht sehr. Das Wasser von Lake Greene ist dunkel, selbst wenn Sonnenlicht hineinscheint.
Ein Sarg, dessen Deckel einen Spalt offen steht.
Von oben kann man etwa eine Unterarmlänge weit hineinsehen, dann wird es trüb. Dann nachtschwarz. Und dann finster wie ein Grab. Noch schlimmer ist es, wenn man untertaucht – gegen den Lichtschein aus der Höhe wirkt das Schwarz der Tiefe noch schwärzer.
Wenn wir als Kinder mitten im See schwammen, forderte Marnie mich oft heraus, so weit hinunterzutauchen, bis ich nichts mehr sah und den Grund berührte. Ich versuchte es wieder und wieder, schaffte es aber nie. In der Dunkelheit verlor ich die Orientierung, drehte mich und schwamm aus Versehen wieder aufwärts statt abwärts. Atemlos und leicht verwirrt wegen des Kontrasts zwischen Wasser und Himmel kam ich dann an die Oberfläche.
Dort war es helllichter Tag.
Gleich darunter lauerte Nacht.
Am Ufer der dunklen Wasser von Lake Greene stehen fünf Häuser unterschiedlichsten Baustils, von urig-gemütlich bis auffallend modern. Im Sommer, wenn Vermont seine ganze Pracht entfaltet und die Häuser voller Freunde, Verwandter und Feriengäste sind, strahlen sie nachts wie Leuchttürme, die den Weg zum sicheren Hafen weisen. Durch die Fenster sieht man in hell erleuchtete Zimmer, in denen Menschen essen und trinken, lachen und diskutieren und Spiele spielen.
Außerhalb der Saison ändert sich das: Die Häuser werden still, zuerst während der Woche, dann auch an den Wochenenden. Nicht, dass sie leer stünden – weit gefehlt. Im Herbst zieht der Green Mountain State genauso viele Besucher an wie im Sommer. Aber die Stimmung ändert sich. Wird gedämpfter. Ernster. Mitte Oktober scheint es fast, als wäre die Finsternis des Sees über die Ufer getreten und in die Häuser eingedrungen, sodass sie weniger stark leuchten.
Ganz besonders gilt das für das Haus auf der gegenüberliegenden Seite des Sees.
Die Fassade aus Glas, Edelstahl und Stein spiegelt das eisige Wasser und den grauen Herbsthimmel wider. Was im Innern vor sich geht, ist nicht zu sehen. Wenn Licht im Haus brennt, kann man hineinschauen, aber nur ein Stück weit. Genau wie beim See. Egal wie sehr man die Augen anstrengt, dicht unter der Oberfläche liegen Dinge, die man niemals zu Gesicht bekommen wird.
Wer wüsste das besser als ich?
Denn ich habe es beobachtet.
JETZT
Über meine nicht angerührte Kaffeetasse hinweg starre ich die Polizistin an, die mir gegenübersitzt. Der aufsteigende Dampf verleiht ihr eine unscharfe, mysteriöse Aura. Nicht, dass Wilma Anson da viel Nachhilfe bräuchte. Sie strahlt fast immer eine undurchschaubare Ruhe aus. Selbst zu dieser späten Stunde und vom Unwetter durchweicht wirkt sie unerschütterlich.
»Haben Sie heute den Abend über das Haus der Royces beobachtet?«
»Ja.« Zu lügen wäre sinnlos.
»Und haben Sie etwas Ungewöhnliches gesehen?«
»Ungewöhnlicher als alles, was ich schon gesehen habe?«
Sie nickt. »Ja, genau das meine ich.«
»Nein.« Hier ist nun doch eine Lüge nötig. Ich habe an diesem Abend eine Menge gesehen. Mehr, als ich je sehen wollte. »Warum?«
Wieder einmal peitscht ein Windstoß den Regen gegen die Glastür zur Veranda. Wir halten beide einen Moment inne und schauen zu, wie die Tropfen gegen die Scheibe prasseln. Der Sturm ist bereits schlimmer als im Fernsehen vorhergesagt – und schon das klang bedenklich. Die Ausläufer eines Hurrikans der Stufe 4, der sich, während er wie ein Bumerang aus dem Landesinneren an die Nordatlantikküste zurückschwenkte, zum tropischen Sturm abgeschwächt hat.
Etwas, was Mitte Oktober kaum jemals vorkommt.
Erst recht nicht in Ostvermont.
»Weil Tom Royce möglicherweise verschwunden ist«, sagt Wilma.
Ich reiße den Blick von der regengepeitschten Terrassentür los und schaue sie überrascht an. Sie blickt zurück, unerschütterlich wie immer.
»Sind Sie sicher?«, frage ich.
»Ich war gerade dort. Das Haus ist nicht abgeschlossen. Der Nobelschlitten steht wie gehabt in der Einfahrt. Drinnen scheint nichts zu fehlen. Außer ihm selbst.«
Ich richte den Blick wieder auf die Terrassentür, als könnte ich durch sie hindurch das Haus der Royces am anderen Ufer sehen. Doch alles, was man sieht und hört, sind Finsternis, das Heulen des Sturms und im Licht der Blitze immer wieder flüchtig das aufgepeitschte, schäumende Wasser.
»Glauben Sie, er hat sich abgesetzt?«
»Sein Geldbeutel und die Autoschlüssel liegen auf der Küchentheke«, sagt Wilma. »Ohne Geld und Auto kann man sich schlecht absetzen. Schon gar nicht bei dem Wetter. Also bezweifle ich es.«
Ihre Wortwahl entgeht mir nicht. Bezweifle.
»Vielleicht hat ihm jemand geholfen?«, schlage ich vor.
»Oder jemand hat ihn verschwinden lassen. Wissen Sie vielleicht etwas?«
Mir klappt vor Staunen die Kinnlade herunter. »Glauben Sie etwa, ich hätte was damit zu tun?«
»Sie sind immerhin in das Haus eingebrochen.«
»Ich habe mich hineingeschlichen«, korrigiere ich in der Hoffnung, dass der sprachliche Unterschied mein Vergehen in Wilmas Augen weniger schwer macht. »Das heißt doch nicht, dass ich weiß, wo Tom Royce jetzt ist!«
Wilma schweigt, weil sie wohl hofft, ich würde noch mehr sagen. Mich vielleicht verdächtig machen. Sekunden vergehen. Ziemlich viele. Jede einzelne akzentuiert durch das Ticken der alten Standuhr im Wohnzimmer, das dem Gesang des Sturms einen steten Rhythmus unterlegt. Scheinbar ungerührt hört Wilma zu. Sie ist wirklich ein Wunder an Gelassenheit. Ich habe den Verdacht, dass sie das maßgeblich ihrem Namen verdanken könnte. Wenn man sich das ganze Leben lang Familie-Feuerstein-Witze anhören muss, ist Engelsgeduld wohl eines der Dinge, die man unweigerlich lernt.
»Hören Sie zu«, sagt Wilma nach gefühlten drei Minuten. »Ich weiß, Sie machen sich Sorgen um Katherine Royce. Ich weiß, Sie würden sie gern finden. Ich auch. Aber ich habe Ihnen schon gesagt, es bringt nichts, wenn Sie die Sache selbst in die Hand nehmen. Lassen Sie mich meine Arbeit machen, Casey. Dann haben wir die besten Chancen, Katherine lebend wiederzubekommen. Wenn Sie also eine Ahnung haben, wo ihr Mann sein könnte, dann sagen Sie mir das bitte.«
»Ich habe keinen blassen Schimmer, wo Tom Royce sein könnte.« Ich beuge mich vor, die Handflächen flach auf dem Tisch, und versuche die gleiche Undurchschaubarkeit auszustrahlen wie sie. »Wenn Sie mir nicht glauben, dürfen Sie gern mein Haus durchsuchen.«
Wilma denkt über das Angebot nach. Zum ersten Mal, seit wir uns an den Tisch gesetzt haben, ist zu spüren, dass ihr Gehirn ebenso stetig tickt wie die alte Standuhr.
»Ich glaube Ihnen«, sagt sie schließlich. »Fürs Erste. Aber das kann sich jeden Moment ändern.«
Als sie geht, bleibe ich bewusst in der Haustür stehen und blicke ihr nach, während der schräg fallende Regen auf die vordere Veranda und mich einprasselt. Sie hastet die Einfahrt entlang zu ihrer zivilen Limousine und rutscht hinters Steuer. Ich winke ihr, während sie den Wagen rückwärts auf die Straße lenkt, dabei durch eine Pfütze spritzt, die eine Stunde zuvor noch nicht da war, und davonbraust.
Dann schließe ich die Haustür, schüttle die Regentropfen ab, gehe in die Küche und schenke mir einen XXL-Bourbon ein. Nach dieser neuen Wendung brauche ich einen Kick, den mir kein Kaffee geben kann.
Wieder rüttelt eine Sturmbö am Haus. Die Dachvorsprünge knirschen, das Licht flackert.
Der Sturm scheint stärker zu werden.
Ausläufer, dass ich nicht lache.
Mit dem Bourbonglas in der Hand steige ich die Treppe hinauf und betrete das erste Zimmer rechts.
Er ist noch genau da, wo ich ihn zurückgelassen habe.
Ausgestreckt auf einem der beiden Einzelbetten.
Die Hand- und Fußgelenke an die Bettpfosten gefesselt.
Ein Handtuch als provisorischer Knebel über dem Mund.
Ich knote das Handtuch los, setze mich auf das identische Bett gegenüber und nehme gemächlich einen großen Schluck Bourbon.
»Uns läuft die Zeit davon«, sage ich. »Also, sag mir endlich, was du mit Katherine gemacht hast.«
DAVOR
Ich sehe es aus den Augenwinkeln.
Eine Unregelmäßigkeit auf der Wasseroberfläche.
Kräusel.
Lichtreflexe.
Etwas, was kurz auftaucht, dann wieder untergeht.
Bisher habe ich geistig unbeteiligt aufs Wasser gestarrt, wie man es gelegentlich tut, wenn man etwas schon tausendmal gesehen hat. Man schaut hin und doch wieder nicht. Hat alles im Blick, ohne etwas wirklich wahrzunehmen.
Vielleicht hat es auch mit dem Bourbon zu tun.
Ich bin beim dritten.
Oder vierten.
Meine Drinks zähle ich auch ohne geistige Beteiligung.
Aber die Bewegung im Wasser hat jetzt meine volle Aufmerksamkeit. Schwankend stehe ich aus dem Schaukelstuhl auf und schaue zu, wie auf der spiegelglatten Wasseroberfläche wieder sonnenfunkelnde Ringe entstehen. Kneife die Augen zusammen, versuche den Bourbonnebel zu durchdringen. Keine Chance; die Bewegung findet genau in der Mitte des Sees statt, zu weit weg für Details.
Ich drehe mich um, verlasse die Veranda und tappe durchs Haus nach vorn in die vollgestellte Eingangsdiele. Die Garderobe ist unter Anoraks und Regenjacken begraben. Dazwischen hängt, schon über ein Jahr lang unangetastet, ein Fernglas im Lederetui mit abgewetztem Riemen.
Ich nehme es, trete wieder auf die hintere Veranda hinaus und stelle mich ans Geländer. Durch das Fernglas suche ich den See ab. Erneut kräuselt sich die Oberfläche. Im Epizentrum taucht kurz eine Hand aus dem Wasser.
Ich lasse das Fernglas fallen.
Denke: Da ertrinkt jemand.
Denke: Ich muss ihn retten.
Denke: Len.
Der letzte Gedanke – an meinen Mann, wie er in genau diesen Tiefen ertrank – scheucht mich auf. Ich stoße mich vom Geländer ab, was die Eiswürfel im Bourbonglas auf dem Boden neben dem Schaukelstuhl klimpern lässt, aber ich eile schon die Verandatreppe hinunter und sprinte über die wenigen Meter bemooster Erde zum Ufer und auf den hölzernen Steg. Er schwingt unter meinen Schritten, während ich zu dem Motorboot haste, das an seinem Ende vertäut ist. Ich löse das Tau, steige schwankend ein, nehme eines der Ruder und stoße mich vom Steg ab.
Einen Moment lang dreht sich das Boot in einer nicht sehr eleganten Pirouette; dann stabilisiere ich es mit dem Ruder. Als der Bug auf die Seemitte zeigt, starte ich den Motor mit einem so kräftigen Zug an der Anlasserschnur, dass mir der Arm schmerzt. Fünf Sekunden später schnurrt das Boot übers Wasser auf die Stelle zu, wo die Oberfläche sich zuletzt gekräuselt hat. Doch es ist nichts mehr zu sehen.
Ich beginne zu hoffen, dass das, was ich sah, nur ein springender Fisch war. Oder ein Eistaucher im Sturzflug. Oder dass mir das Sonnenlicht, der sich im Wasser spiegelnde Himmel und die zahlreichen Bourbons etwas vorgegaukelt haben, was gar nicht da war.
Tja, Wunschdenken.
Denn als das Boot der Seemitte näher kommt, entdecke ich etwas im Wasser.
Einen menschlichen Körper.
Knapp unter der Oberfläche.
Leblos.
Ich schalte den Motor aus und krabble in den Bug, um besser zu sehen. Ich kann nicht feststellen, ob das Gesicht der Person nach oben oder unten gewandt ist, ob sie lebt oder tot ist. Alles, was ich erkenne, sind schemenhafte ausgestreckte Gliedmaßen und wirres, wie Seetang treibendes Haar. Vor meine Augen schiebt sich eine Vision, wie Len genau so trieb, und ich brülle in Richtung Ufer: »Hilfe! Da ertrinkt jemand!«
Die Worte hallen von den feuerrot leuchtenden Bäumen zu beiden Seiten des Sees wider. Vermutlich hat sie niemand gehört. Es ist Mitte Oktober. Lake Greene, ohnehin nicht der überfüllteste Ferienort, ist so gut wie verlassen. Der einzige dauerhafte Anwohner ist Eli, und er wird erst am Abend zurückkommen. Falls sonst jemand in der Nähe ist, macht er sich nicht bemerkbar.
Ich bin auf mich gestellt.
Ich nehme wieder das Ruder und paddle auf die Person im Wasser zu. Eine Frau, erkenne ich jetzt. Mit langem Haar. Im Badeanzug; man sieht den braun gebrannten Rücken, lange Beine und kräftige Arme. Sanft schaukelt sie im Kielwasser des Boots wie ein Stück Treibholz.
Wieder mit Lens Bild vor Augen taste ich nach dem Anker, der an einer der Klampen außen an der Reling festgebunden ist. Er ist nicht schwer, nur zehn Kilo, aber das reicht aus, um das Boot am Wegtreiben zu hindern. Ich lasse ihn ins Wasser fallen. Zischend schabt das Seil an der Bordwand, als er auf den Grund sinkt.
Dann ziehe ich unter einem Sitz eine Schwimmweste hervor, taumele zur Reling und springe dem Anker nach ins Wasser. Kein eleganter Sprung, eher ein seitlicher Platscher. Aber die Kälte des Wassers bewirkt, dass ich auf einen Schlag nüchtern werde. Mit geschärften Sinnen, am ganzen Leib prickelnd vor Kälte, klemme ich mir die Weste unter den linken Arm und paddle mit rechts an die Frau heran.
Selbst halb betrunken bin ich eine gute Schwimmerin. Ich bin am Lake Greene aufgewachsen und habe viele Sommer mehr im als außerhalb des Wassers verbracht. Und auch wenn es vierzehn Monate her ist, dass ich zum letzten Mal hier geschwommen bin, ist mir das Wasser so vertraut wie mein eigenes Bett. Auch an heißesten Tagen erfrischend kühl – und kristallklar während der kurzen Spanne, bis es finster wird.
Ich habe die Frau im Blick und forsche nach Lebenszeichen.
Nichts.
Kein Zucken eines Arms oder Fußes oder langsames Wenden des Kopfs.
Als ich sie erreiche, ist in mir nur ein Gedanke. Ein flehentliches halbes Gebet.
Bitte sei nicht tot. Bitte, bitte lebe noch.
Doch als ich ihr die Rettungsweste um den Nacken gelegt habe und sie umdrehe, sieht sie nicht lebendig aus. Das Gesicht dem Himmel zugekehrt, wirkt sie wie eine Leiche. Die Augen geschlossen. Die Lippen blau. Die Haut eiskalt. Ich verbinde die Gurte der Weste mit dem Schnappverschluss, zurre die Riemen fest und klatsche ihr eine Hand auf die Brust.
Kein Anzeichen eines Herzschlags.
Scheiße.
Noch einmal will ich um Hilfe rufen, aber mir fehlt die Luft. Selbst gute Schwimmer haben ihre Grenzen, und meine sind erreicht. Die Erschöpfung hat mich im Griff wie der Sog der Tide, und mir ist klar: Wenn ich noch länger mit dieser wahrscheinlich toten Frau auf der Stelle schwimme, ende ich bald genauso wie sie.
Ich lege ihr den Arm um die Taille und schwimme einarmig zum Boot zurück. Ohne recht zu wissen, was ich machen soll, wenn ich dort ankomme. Mich am Bootsrand festklammern, überlege ich, ihn gepackt halten. Mit der anderen Hand weiter die Frau festhalten und hoffen, dass ich genügend zu Atem komme, um erneut um Hilfe zu rufen.
Und dass mich diesmal jemand hört.
Doch zunächst muss ich das Boot überhaupt erreichen. Ich habe nicht daran gedacht, auch mir eine Schwimmweste anzulegen. Meine Züge werden langsamer, mein Herz hämmert, ich spüre meine Beine nicht mehr, auch wenn ich glaube, ich bewege sie noch. Das Wasser ist so kalt, und ich bin so müde. So beängstigend, unerträglich müde, dass ich überlege, ob ich die Schwimmweste nicht besser mir anlegen und die Frau versinken lassen soll.
Reiner Selbsterhaltungstrieb.
Schließlich muss ich zuerst mich selbst retten, um sie retten zu können, und dazu ist es vielleicht sowieso zu spät. Aber wieder kommt mir Len in den Sinn, der jetzt schon über ein Jahr lang tot ist. Dessen verkrümmte Leiche am Ufer dieses Sees gefunden wurde. Ich kann nicht zulassen, dass das auch mit dieser Frau passiert.
Also paddle ich mit dem freien Arm weiter, schlage mit den tauben Beinen und ziehe meine Last mit, von der ich überzeugt bin, dass sie nicht mehr lebt. Bis das Boot nur noch drei Meter entfernt ist.
Zwei Meter fünfzig.
Zwei Meter.
Aus heiterem Himmel verkrampft sich der Körper der Frau. Ich bekomme einen Heidenschreck. Jetzt lasse ich doch los, entgeistert ziehe ich den Arm zurück.
Die Frau reißt die Augen auf.
Sie hustet, lange, heftig, rasselnd. Aus ihrem Mund schießt ein Schwall Wasser und läuft ihr übers Kinn; aus ihrem linken Nasenloch rinnt ein Streifen Rotz über die Wange. Sie wischt alles ab und starrt mich keuchend an. »Was ist passiert?«
Ich denke an ihre blauen Lippen, die eiskalte Haut, ihre vollkommene Reglosigkeit. »Nicht aufregen«, sage ich. »Aber ich glaube, Sie wären gerade fast ertrunken.«
KEINE VON UNS sagte noch etwas. Dazu war keine Zeit, während ich mich strampelnd und klammernd abmühte, über die Bordwand zu klettern. Endlich gelang es mir, über die Reling zu flutschen wie ein soeben gefangener Fisch. Noch schwerer war es, die Frau an Bord zu hieven – die Nahtoderfahrung hatte sie jeder Energie beraubt. Ich musste so sehr an ihr zerren und ziehen, dass ich, als sie sicher im Boot war, vor Erschöpfung kein Glied mehr rühren, geschweige denn sprechen konnte.
Doch jetzt, nachdem wir zu Atem gekommen sind, haben wir es geschafft, uns auf die Sitze zu mühen. Wir sitzen einander gegenüber, noch völlig verstört und einfach froh, uns ein bisschen ausruhen und sammeln zu können.
»Sie haben gesagt, ich wäre fast ertrunken«, sagt die Frau schließlich.
Sie ist in eine Decke gehüllt, die ich unter einem der Sitze gefunden habe, was ihr Ähnlichkeit mit einem Kätzchen verleiht, das aus einem Gully gerettet wurde. Zerschlagen und verletzlich und dankbar.
»Ja.« Ich wringe mein Flanellhemd aus. Da es an Bord nur die eine Decke gibt, bin ich weiter klatschnass und friere. Aber das macht mir nichts aus. Ich war ja nicht diejenige, die in akuter Lebensgefahr schwebte.
»Definieren Sie fast.«
»Ganz ehrlich? Ich dachte, Sie wären tot.«
Unter der Decke erschauert die Frau. »Mein Gott.«
»Aber da hatte ich mich offensichtlich geirrt«, versuche ich sie zu beruhigen. »Sie sind von ganz allein wieder aufgewacht. Ich musste gar nichts tun.«
Die Frau setzt sich aufrecht hin; dabei blitzt in den Tiefen der Decke ihr Badeanzug auf. Petrolgrün. Total tropisch. Und für den Herbst in Vermont so unpassend, dass ich mich frage, wie sie eigentlich in diesen See kam. Würde sie mir erzählen, Aliens hätten sie von einem weißen Sandstrand auf den Seychellen hierhergebeamt, ich wäre drauf und dran, es zu glauben.
»Aber wenn Sie mich nicht gesehen hätten, wäre ich gestorben, so viel ist klar«, sagt sie. »Also, vielen Dank, dass Sie mich gerettet haben. Das hätte ich schon längst sagen sollen. Eigentlich sofort.«
Ich antworte mit einem bescheidenen Achselzucken. »Ich nehm’s Ihnen nicht übel.«
Die Frau lacht auf – was ihr solches Leben verleiht, dass keine Spur mehr von der Person bleibt, die dort im Wasser trieb. In ihr Gesicht kehrt Farbe zurück, eine zarte Röte, die ihre hohen Wangenknochen, vollen Lippen und gestochen scharfen Augenbrauen betont. Ihre graugrünen Augen sind groß und ausdrucksvoll und ihre Nase leicht schief, ein Makel, der inmitten all dieser Perfektion umso charmanter wirkt. Selbst in die Decke gewickelt und tropfend von Seewasser ist sie bildhübsch.
Sie bemerkt meinen Blick und sagt: »Ich bin übrigens Katherine.«
Erst da wird mir klar, dass ich diese Frau kenne. Nicht persönlich – getroffen haben wir uns meines Wissens noch nie. Aber ich erkenne sie trotzdem.
Katherine Royce.
Ehemals Supermodel, heute Schirmherrin irgendwelcher wohltätiger Organisationen.
Und gemeinsam mit ihrem Mann Eigentümerin des Hauses direkt gegenüber am anderen Seeufer. Bei meinem letzten Aufenthalt hier stand es leer und zum Verkauf, für über fünf Millionen Dollar. Als sie es im Winter erwarben, ging das ziemlich durch die Presse – nicht nur wegen der Käufer, sondern auch wegen des Ortes, an dem es steht.
Lake Greene.
Der Vermonter Rückzugsort der umjubelten Musical-Ikone Lolly Fletcher.
Und der Ort, wo der Mann der »labilen« Schauspielerin Casey Fletcher tragisch zu Tode kam.
Das sind die typischen Adjektive, mit denen meine Mutter und ich charakterisiert werden. Sie könnten genauso gut unsere Vornamen sein. Umjubelte Lolly Fletcher und Labile Casey Fletcher. Ein Mutter-Tochter-Duo, das man so schnell nicht vergessen wird.
»Ich bin Casey«, sage ich.
»Oh, ich weiß«, sagt Katherine. »Tom – mein Mann – und ich hätten fast noch bei Ihnen vorbeigeschaut, als wir gestern Abend ankamen. Wir sind beide große Fans von Ihnen.«
»Woher wussten Sie, dass ich da bin?«
Katherine zeigt auf das alte Ferienhaus meiner Familie. »Na, das Licht brannte.«
Unser Haus ist nicht das größte hier am See – diese Ehre geht an Katherines neues Domizil –, aber das älteste. Es wurde 1878 vom meinem Ururgroßvater erbaut und seither ungefähr alle fünfzig Jahre renoviert und ausgebaut. Vom See aus betrachtet sieht es zauberhaft aus. Dicht an den Hang am Ufer geschmiegt und hoch aufragend hinter einer Mauer aus Gebirgssteinen, wirkt es fast wie eine Karikatur neuenglischer Gemütlichkeit: ein strahlend weißes zweistöckiges Gebilde mit Giebeln, vorgelagerten Ziergittern und Zuckerbäckerschnitzereien an der Dachkante. Eine Hälfte des Hauses liegt so dicht am Ufer, dass die umlaufende Veranda praktisch über dem Wasser schwebt.
Wo ich saß, als ich Katherine vorhin um ihr Leben kämpfen sah.
Und wo ich gestern Abend saß, zu betrunken, um die Ankunft des Promipaars zu bemerken, dem jetzt das Haus direkt gegenüber gehört.
Die andere Hälfte unseres Hauses ist etwa zehn Meter weit zurückgesetzt; im Winkel zwischen den beiden Bauteilen befindet sich ein kleiner geschützter Hof. Hoch darüber, im obersten Stock, liegt das Masterschlafzimmer, von wo aus man eine atemberaubende Aussicht hat. Jetzt, am Nachmittag, liegen die Fenster im Schatten der hohen Kiefern. Aber nachts strahlt der Lichtschein aus dem Schlafzimmer vermutlich wie ein Leuchtfeuer.
»Den ganzen Sommer war bei Ihnen dunkel«, spricht Katherine weiter. »Als wir gestern Abend das Licht sahen, nahmen wir an, das müssten Sie sein.« Taktvoll lässt sie unerwähnt, warum ihr Mann und sie annahmen, es sei ich und nicht zum Beispiel meine Mutter.
Mir ist klar, dass sie meine Geschichte kennen.
Die kennt jeder.
Katherines einzige Anspielung auf meine jüngsten Probleme ist ein freundliches, behutsames »Wie geht es Ihnen übrigens? Es muss so schwer für Sie sein, mit all dem, was Sie gerade durchmachen«. Sie beugt sich vor und legt mir die Hand aufs Knie. Eine überraschend intime Geste für jemanden, der mich gerade erst kennengelernt hat, auch wenn ich ihr höchstwahrscheinlich das Leben gerettet habe.
»Oh, mir geht’s wunderbar«, sage ich. Die Wahrheit zusagen, würde signalisieren, dass ich über all das reden wollte, um es mit Katherines Worten zu formulieren.
Und dazu bin ich noch nicht bereit, auch wenn es über ein Jahr her ist. Manchmal denke ich, dass ich es nie sein werde.
»Das freut mich.« Katherine lächelt, leuchtend wie ein Sonnenstrahl. »Ich habe ein so schlechtes Gewissen, dass ich Ihnen beinahe einen weiteren Schlag versetzt hätte, also wenn ich ertrunken wäre.«
»Wenn Sie das tröstet, Sie haben einen unvergesslichen ersten Eindruck hinterlassen.«
Sie lacht. Gott sei Dank. Mein Sinn für Humor wurde schon als trocken, von manchen auch als grausam bezeichnet. Eine Geschmackssache, finde ich, so wie die Olive im Martiniglas. Entweder man mag’s oder nicht.
Katherine scheint meinen Humor zu mögen, jedenfalls lächelt sie weiter. »Die Sache ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das passieren konnte. Ich kann hervorragend schwimmen. Vielleicht hat es im Moment nicht den Anschein, aber ich versichere Ihnen, es stimmt. Ich denke, das Wasser war wohl kälter als vermutet, und ich habe einen Krampf bekommen.«
»Es ist Mitte Oktober. Da ist das Wasser eisig.«
»Oh, ich schwimme sehr gern in kaltem Wasser. An Neujahr mache ich immer beim Polar Plunge mit.«
Ich nicke. Natürlich macht sie das.
»Für einen guten Zweck«, fügt sie hinzu.
Ich nicke wieder. Natürlich für so was.
Mein Gesicht muss mich verraten haben, denn Katherine sagt: »Tut mir leid. Das klang angeberisch, oder?«
»Ein bisschen.«
»Puh. Das wollte ich nicht. Manchmal kommt das leider vor. Das Gegenteil von falscher Bescheidenheit. Ich weiß nicht, ob es ein Wort dafür gibt, wenn man sich aus Versehen toller darstellt, als man ist.«
»Falsche Unbescheidenheit?«, schlage ich vor.
»Hihi, das gefällt mir«, kichert Katherine. »Genau das ist mein Problem, Casey. Ich verfalle so oft in falsche Unbescheidenheit.«
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Katherine Royce mir eigentlich unsympathisch sein sollte. Sie ist eine dieser Frauen, die anscheinend nur existieren, damit wir anderen uns minderwertig fühlen. Und doch finde ich sie bezaubernd. Vielleicht liegt es an der absurden Situation – als Gerettete und Retterin auf einem Boot an einem herrlichen Herbstnachmittag. Es hat etwas Surreales, in Richtung Die kleine Meerjungfrau. Als wäre ich ein Prinz, der sich Hals über Kopf in die Sirene verliebt, die er soeben aus dem Meer gefischt hat.
An Katherine wirkt nichts künstlich. Ja, sicher, sie ist wunderschön, aber auf bodenständige Art. Keine Sexbombe, sondern eher das hübsche Mädchen von nebenan. Eine Kombination aus Betty undVeronica aus den Archie-Comics, auf den Lippen ein selbstironisches Lächeln. In ihrer Zeit als Supermodel leistete ihr das gute Dienste – sie war die große Ausnahme in einer Welt notorischer Zickenvisagen.
Erstmals hörte ich vor sieben Jahren von ihr, als ich an einem Theater an der 46th Street in einem Broadway-Stück mitwirkte. Gleich um die Ecke, mitten auf dem Times Square, stand eine riesige Werbetafel, die Katherine in einem Hochzeitskleid zeigte. Ungeachtet ihrer Garderobe, der Blumen und der geschmeidigen Bräune ihrer Haut war sie nicht als sittsame Braut in Szene gesetzt. Nein, sie war auf der Flucht. Hatte die Pumps von sich geschleudert und rannte durch smaragdgrünes Gras, während der sitzengelassene Bräutigam und die Hochzeitsgesellschaft hilflos mit offenen Mündern aus dem Hintergrund zusahen.
Ich weiß nicht, ob es Werbung für Parfüm oder Brautkleider oder Wodka war. Es war mir auch egal. Was meinen Blick jedes Mal anzog, wenn ich die Werbetafel sah, war der Gesichtsausdruck der Frau. Ein strahlendes Lächeln, das auch in ihren Augen leuchtete. Sie wirkte erleichtert, befreit, fast verklärt. Eine Frau, für die es das höchste Glück bedeutete, mit einem Schlag ihre gesamte Existenz wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen zu lassen.
Ein Gesichtsausdruck, der mich tief im Innern ansprach.
Und es noch immer tut.
Erst später, das Stück war längst abgesetzt, aber die Werbung immer noch da, verband ich das Bild mit einem Namen.
Katherine Daniels.
Oder Katie, wie es in den Zeitschriften hieß. Und die Designer, die Mode für sie entwarfen, nannten sie Kat. Sie schritt für Yves Saint Laurent über den Laufsteg, tollte für Calvin Klein am Strand herum und wälzte sich für Victoria’s Secret auf seidenen Laken.
Dann heiratete sie Thomas Royce, den Gründer und Geschäftsführer eines Social-Media-Unternehmens, und hörte auf zu modeln. Ich erinnere mich noch an das Hochzeitsfoto in der People und dass es mich überraschte. Ich hatte erwartet, dass sie aussehen würde wie auf jener Werbetafel. Die personifizierte Freiheit. Stattdessen umklammerte sie, in ein Vera-Wang-Kleid gezwängt, den Arm ihres Mannes und lächelte so verkrampft, dass ich sie kaum erkannte.
Und jetzt sitzt sie hier in meinem Boot und grinst breit, und ich verspüre eine seltsame Erleichterung, dass die Frau von der Werbetafel nicht ganz verschwunden ist.
»Darf ich Ihnen eine sehr persönliche, sehr neugierige Frage stellen?«, frage ich.
»Sie haben mir gerade das Leben gerettet«, sagt Katherine. »Es wäre schäbig, jetzt Nein zu sagen, oder?«
»Es geht um Ihre Zeit als Model.«
Katherine hebt die Hand. »Sie wollen wissen, warum ich aufgehört habe.«
»Mehr oder weniger.« Ich hebe verlegen die Schultern. Wie unbedacht von mir. Ich hätte sie tausend andere Dinge fragen können. Stattdessen stelle ich genau die Frage, die sie sicher am häufigsten zu hören bekommt.
»Die ausführliche Version ist, dass das Modeln viel weniger glamourös ist, als es aussieht. Die Arbeitszeiten waren endlos lang, und die Diät war eine Qual! Stellen Sie sich mal vor, Sie dürften ein ganzes Jahr lang nicht eine einzige Scheibe Brot essen.«
»Kann ich nicht. Ehrlich«, sage ich.
»Das war schon Grund genug aufzuhören. Und manchmal, wenn mir die Frage gestellt wird, sage ich genau das. Ich schaue den Leuten in die Augen und sage: ›Ich hab aufgehört, weil ich Pizza essen wollte.‹ Aber um ehrlich zu sein, das Schlimmste war, dass alles sich nur auf mein Äußeres konzentrierte. Dieses ständige Gestyltwerden, dieses Verdinglichtwerden. Keiner kümmerte sich darum, was ich sagte. Oder dachte. Oder fühlte. Der Glanz des Modelns war bald verblasst. Also, nicht falsch verstehen: Die viele Kohle war genial, einfach Wahnsinn. Und die Kleider waren atemberaubend. So unglaublich schön. Jedes einzelne Outfit ein Kunstwerk. Aber es kam mir falsch vor. Anderswo leiden Menschen. Kinder hungern. Frauen werden unterdrückt. Und ich spaziere auf Laufstegen hin und her, in Klamotten, die mehr kosten, als die meisten Leute im Jahr verdienen. Einfach makaber.«
»Klingt ganz ähnlich wie das Schauspielern«, sage ich. »Oder als wäre man ein Showpony.«
Katherine lacht prustend auf, und da beschließe ich endgültig, dass ich sie mag. Wir sind uns in vielerlei Hinsicht ähnlich. Berühmt aus Gründen, mit denen wir nicht so recht glücklich sind. Irrsinnig privilegiert, aber selbstkritisch genug, um uns dessen bewusst zu sein. Und wir wünschen uns beide, die Welt sähe in uns mehr als das, was die Menschen in uns hineinprojizieren.
»Also, das war die lange Version«, schließt sie. »Die ich nur Leuten erzähle, die mich vor dem Ertrinken retten.«
»Und die Kurzversion?«
Katherine wendet den Blick dem anderen Ufer zu, das von ihrem Haus beherrscht wird. »Tom wollte, dass ich aufhöre.«
Über ihr Gesicht geht etwas Düsteres. Nur ganz kurz, so, wie der Schatten einer Wolke übers Wasser zieht. Ich erwarte, dass sie noch mehr zu ihrem Mann sagt und warum er das von ihr verlangt hat. Doch stattdessen fängt sie an zu husten.
Heftig.
Viel heftiger als vorher.
Tiefe, krampfartige Hustenstöße, so laut, dass sie von der Wasseroberfläche widerhallen. Die Decke gleitet von ihr ab, und sie schlingt sich die Arme um den Leib, bis der Anfall vorüber ist. Danach wirkt sie verängstigt. Noch einmal geht ein Wolkenschatten über ihr Gesicht, und für einen kurzen Moment kommt es mir vor, als frage sie sich, was gerade passiert ist. Doch dann hebt sich die Wolke, und sie schenkt mir ein beruhigendes Lächeln. »O Mann, das war aber nicht ladylike.«
»Geht’s Ihnen gut?«
»Ich glaube schon. Und du, bitte.« Mit zitternder Hand zieht sich Katherine die Decke wieder um die von Gänsehaut überzogenen Schultern. »Aber jetzt sollte ich wahrscheinlich nach Hause.«
»Natürlich. Du bist sicher am Erfrieren.«
Ich jedenfalls bin es. Nach meiner Heldentat hat der Adrenalinschub nachgelassen, und Kälte kriecht mir in die Knochen. Ich zittere am ganzen Leib, als ich den Anker hochziehe – ganze fünfzehn Meter klatschnasses Seil. Als ich ihn endlich ordentlich befestigt habe, sind meine Arme so lahm, dass ich mehrmals an der Anlasserschnur ziehen muss, um den Motor zu starten.
Ich steuere Katherines Haus an. Es unterscheidet sich von allen anderen dadurch, dass es nicht aus den Siebzigerjahren stammt, sondern jünger ist. Früher stand dort ein absolut brauchbarer Bungalow aus den Dreißigern, umgeben von hohen Kiefern. Vor zwanzig Jahren wurden der Bungalow abgerissen und die Kiefern gefällt. Jetzt steht dort eine scharfkantige Monstrosität, die aus dem Boden ragt wie ein Felsblock. Die Seeseite besteht fast nur aus Glas, vom großzügigen, weitläufigen Erdgeschoss bis zum spitzgiebeligen Dach.
Tagsüber wirkt die Fassade imposant, wenn auch etwas langweilig. Ein Haus wie ein Schaufenster mit nichts darin. Doch nachts, wenn alle Zimmer erleuchtet sind, gleicht es einem Puppenhaus. Auf den ersten Blick erscheint alles sichtbar. Die blitzblanke Küche. Das funkelnagelneue Esszimmer. Das riesige Wohnzimmer, vor dem sich die mit Steinplatten belegte Terrasse bis ans Seeufer erstreckt.
Drinnen war ich erst einmal, als Len und ich von den Vorbesitzern zum Abendessen eingeladen wurden. Es fühlte sich komisch an, so auf dem Präsentierteller zu sitzen. Wie ein Präparat in einer Petrischale.
Wobei es nicht gerade von Beobachtern wimmelt. Der Lake Greene ist einsam in einem dichten Wald in Ostvermont gelegen und nicht sonderlich groß, anderthalb Kilometer lang und an den schmalsten Stellen nur vierhundert Meter breit. Er bildete sich gegen Ende der Eiszeit, als ein gemächlich durchs Land wandernder Gletscher beschloss, hier etwas von sich zurückzulassen. Beim Schmelzen grub das Eis eine Mulde in den Boden, in der sich das Gletscherwasser schließlich sammelte. Also ist er im Grunde eine Pfütze. Eine sehr große und tiefe und sehr hübsch anzusehende, aber nichtsdestoweniger eine Pfütze.
Der größte Reiz an ihm ist, dass er nicht öffentlich zugänglich ist. Ans Wasser kommt man nur über die Stege der Häuser, und davon gibt es nicht viele: Ganze fünf sind es dank der riesigen Grundstücke und der wenigen Stellen am Ufer, die sich überhaupt zum Bauen eignen. Das Nordende des Sees ist Naturschutzgebiet. Das Südende hat ein felsiges Steilufer. Die Häuser stehen im mittleren Bereich, zwei auf der einen und drei auf der anderen Seite.
Das Anwesen von Katherine ragt stolz und neureich zwischen den viel älteren, bescheideneren Gebäuden auf und hat zwei Nachbarn. Links, etwa hundert Meter entfernt, steht das niedliche Cottage der Fitzgeralds. Er ist Banker, sie handelt hobbymäßig mit Antiquitäten. Sie kommen jedes Jahr Ende Mai am Memorial-Day-Wochenende und bleiben bis zum Labor Day Anfang September. Für den Rest des Jahres steht das Haus leer.
Rechts der Royces steht das etwas altersschwache Domizil von Eli Williams, einem gefragten Romancier der Achtziger, nach dem heute kein Hahn mehr kräht. Sein Haus ähnelt einem Schweizer Chalet, drei Stockwerke grob bearbeitetes Holz mit winzigen Balkonen und roten Fensterläden. Früher verbrachten die Williams’ genau wie meine Familie den Sommer hier. Als seine Frau starb, verkaufte Eli das Haus in New Jersey und zog ganz hierher. Als einziger ständiger Anwohner hat er jetzt ein Auge auf die anderen Häuser, wenn diese verlassen sind.
In Katherines Haus brennt kein Licht; in den Glasscheiben spiegelt sich der See. Ich erhasche einen Blick auf das verzerrte Abbild von uns beiden im Boot. Unsere Umrisse zittern, als bestünden auch wir aus Wasser.
Als ich das Boot am Steg festgemacht habe, beugt Katherine sich vor und nimmt meine Hände in ihre. »Nochmals vielen Dank. Du hast mir wirklich das Leben gerettet.«
»Das war doch selbstverständlich. Außerdem, wer wäre ich denn, wenn ich ein Supermodel in Not ignorieren würde.«
»Ex-Supermodel.« Sie hustet wieder. Ein einzelner rauer Stoß.
»Kommst du klar?«, frage ich. »Willst du zum Arzt oder so?«
»Nein, das wird schon wieder. Tom kommt auch bald nach Hause. Bis dahin werde ich erst mal heiß duschen und mich dann hinlegen.« Sie klettert auf den Steg und bemerkt dann, dass meine Decke ihr noch um die Schultern hängt. »Ach je, die hab ich ganz vergessen.«
»Behalt sie noch«, sage ich. »Du brauchst sie mehr als ich.«
Katherine nickt zum Dank und geht auf das Haus zu. Ich glaube nicht, dass es Absicht ist, aber sie geht wie auf dem Laufsteg. Lange, weiche, elegante Schritte. Mag sie die Welt des Modelns, mit gutem Grund, noch so leid sein – sie hat eine bewundernswerte Gabe, sich zu bewegen. Leicht und anmutig wie ein Geist.
Als sie am Haus angelangt ist, dreht sie sich noch einmal um und winkt mir mit der linken Hand zu.
Erst da fällt mir etwas auf.
Katherine hat ihren Mann einige Male erwähnt, aber einen Ehering trägt sie – zumindest im Moment – nicht.
ALS ICH wieder an meinem Haus anlange, klingelt gerade mein Telefon; schon auf der Treppe zur Veranda höre ich das verärgerte Vogelgezwitscher. Nass, erschöpft und halb erfroren, wie ich bin, will ich es eigentlich ignorieren, aber dann sehe ich, wer es ist.
Marnie.
Die wunderbare, ätzende, mit weit überproportionaler Geduld gesegnete Marnie.
Der einzige Mensch, der nicht total genervt ist angesichts dessen, was ich mir alles leiste, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie meine Cousine ist. Und meine beste Freundin. Und meine Managerin.
Aber heute ruft sie ausschließlich als Freundin an. »Nichts Geschäftliches«, verkündet sie sofort, als ich abnehme.
»Dachte ich mir.« Ich weiß ja, dass es momentan nichts Geschäftliches gibt, weswegen man sich besprechen müsste. Dass es vielleicht nie wieder etwas geben wird.
»Wollte bloß hören, was der alte Sumpf da draußen macht.«
»Der See oder ich?«
»Beide.« Marnie behauptet, sie empfinde Hassliebe für den Lake Greene, aber ich weiß, in Wahrheit liebt sie ihn über alles. Als Kinder verbrachten wir hier jeden Sommer, schwammen und paddelten und blieben in unserem gemeinsamen Zimmer jede Nacht bis in die frühen Morgenstunden auf, weil Marnie Gruselgeschichten erzählte.
»Du weißt, dass es am See spukt, ja?« So begann sie jedes Mal, nachdem sie es sich am Fußende ihres Betts gemütlich gemacht hatte, die gebräunten Beine nach oben gestreckt, die Fußsohlen flach gegen die schräge Decke gestemmt.
Ich lasse mich in den Schaukelstuhl sinken. »Ist ein komisches Gefühl, wieder hier zu sein. Traurig.«
»Natürlich.«
»Und einsam.« Dieses Haus ist einfach zu groß für eine Person allein. Ganz zu Anfang war es klein – nur eine Jagdhütte an einem einsamen See. Doch mit den Jahren und Anbauten verwandelte es sich in etwas, worin eine ganze Sippe Platz fand. Jetzt, mit nur mir darin, kommt es mir unendlich leer vor. In der vergangenen Nacht, als ich um zwei aufwachte und nicht wieder einschlafen konnte, ging ich von Zimmer zu Zimmer, fassungslos über den vielen ungenutzten Raum.
Das Dachgeschoss mit den Schlafzimmern. Fünf insgesamt, vom großen Schlafzimmer mit eigenem Badezimmer bis zu dem kleinen Zweibettzimmer mit der Dachschräge, wo Marnie und ich als Kinder schliefen.
Der erste Stock mit den eigentlichen Wohnräumen. Ein Labyrinth gemütlicher, ineinander übergehender Zimmer. Das Wohnzimmer mit dem großen Natursteinkamin und der mit Kissen bestückten Leseecke unter der Treppe. Das Spielzimmer, verunstaltet durch einen Elchkopf oben an der Wand, vor dem ich als Kind Angst hatte und den ich als Erwachsene immer noch gruselig finde. Hier steht der einzige Fernseher im Haus, was der Grund ist, weshalb ich nie viel fernsehe, wenn ich hier bin. Es kommt mir immer vor, als beobachte der Elch jede meiner Bewegungen.
Neben dem Spielzimmer die Bibliothek, ein niedliches Zimmer, das kaum beachtet wird, weil seine Fenster auf den Wald hinausgehen, ohne Blick auf den See. An sie schließt eine Reihe von Wirtschaftsräumen an – Waschküche, Gästetoilette, Küche, Esszimmer.
Und rundherum zieht sich wie ein Geschenkband die Veranda. Mit Korbstühlen neben der Haustür und hölzernen Schaukelstühlen nach hinten hinaus zum See.
Dann das Erdgeschoss. Oder besser, der teils ebenerdige Keller. Jener Teil des Hauses, den ich mich weigere zu betreten.
Weil er mich mehr als alles Übrige an Len erinnert.
»Es ist nur natürlich, wenn du dich einsam fühlst«, sagt Marnie. »Aber daran wirst du dich gewöhnen. Ist denn außer Eli noch jemand da?«
»Tatsächlich ja. Katherine Royce.«
»Das Model?«
»Ex-Model.« Ich denke an das, was Katherine beim Aussteigen aus dem Boot sagte. »Sie und ihr Mann haben das Haus gegenüber gekauft.«
»Machen Sie Urlaub in Promiland, an Lake Greene, Vermont!«, sagt Marnie mit bester Fernsehwerbungsstimme. »Und, hast du sie kennengelernt? Ist sie zickig?«
»Nein, im Gegenteil supernett. Aber das kann auch daran liegen, dass ich sie vor dem Ertrinken gerettet habe.«
»Was – im Ernst?«
»Im Ernst.«
»Wenn da die Paparazzi dabei gewesen wären, hätten sich deine Karriereaussichten gerade entscheidend geändert.«
»Ich dachte, das hier wäre kein Geschäftsanruf.«
»Ist es auch nicht«, beharrt sie. »Es ist ein Bitte-pass-auf-dich-auf-Anruf. Ums Geschäftliche kümmern wir uns, wenn du wieder wegdarfst.«
Ich seufze. »Und darüber entscheidet Mom. Also wahrscheinlich nie. Ich sag dir, ich bin zu ›lebenslänglich‹ verknackt.«
»Ich rede mit Tante Lolly, dass sie dich begnadigt. Aber du mach dir erst mal eine schöne Zeit mit deiner neuen Modelfreundin. Hast du ihren Mann auch getroffen?«
»Nein, das Vergnügen hatte ich noch nicht.«
»Ich hab gehört, er wäre komisch.«
»Komisch? Inwiefern?«
Marnie hält inne, sucht nach dem passenden Wort. »Intensiv.«
»Tom Cruise, wie er auf dem Sofa auf und ab hüpft? Oder Tom Cruise, wie er vom Flugzeug baumelt?«
»Sofa«, sagt Marnie. »Nein, Flugzeug. Was ist der Unterschied?«
»Hm. Eigentlich keiner.«
»Tom Royce ist wohl eher so einer, der beim CrossFit-Training ein Meeting abhält und nie aufhört zu arbeiten. Du hast seine App nicht, oder?«
»Nein.« Ich meide jede Form von sozialen Medien – das sind meiner Meinung nach alles Sondermülldeponien mit unterschiedlichem Verseuchungsgrad. Ich habe schon genug Probleme, ohne dass mir irgendwelche Wildfremden auf Twitter erzählen, wie sehr sie mich hassen. Außerdem weiß ich nicht, ob ich mich zurückhalten kann. Ich will gar nicht darüber nachdenken, welchen Mist ich nach sechs Drinks schreiben würde. Besser, ich lasse die Finger davon.
Tom Royces Produkt ist im Prinzip eine Mischung aus LinkedIn und Facebook. Mixer heißt es. Dazu da, um Geschäftsleute miteinander in Kontakt zu bringen, indem sie sich über ihre Lieblingsrestaurants, Bars, Golfplätze und Ferienorte austauschen. Der Slogan lautet: »So klappt der Mix aus Job und Spaß«.
In meinem Job klappt er allerdings nicht. Der Himmel weiß, ich hab’s versucht.
»Gut«, sagt Marnie. »Auf der Plattform wärst du ein bisschen fehl am Platze.«
»Wieso? Ich verkörpere doch genau das Motto.«
Marnies Stimme wird eine Oktave tiefer. Der besorgte Ton, den ich das letzte Jahr über immer wieder zu hören bekommen habe. »Keine Scherze, bitte, Casey. Nicht darüber. Ich mache mir Sorgen um dich. Nicht als deine Managerin. Als Freundin und Verwandte. Natürlich kann ich das, was du durchmachst, nicht annähernd nachfühlen, aber du musst da nicht allein durch.«
»Ich bemühe mich, Marnie.« Ich beäuge das Glas Bourbon, das ich wegen Katherines Rettung habe stehen lassen. Mich packt der Drang, einen Schluck zu nehmen, aber ich weiß, das würde sie hören. »Ich brauche nur Zeit.«
»Dann nimm sie dir. Finanziell bist du abgesichert. Und dieser Wahnsinn wird auch irgendwann abebben. Konzentrier dich die nächsten Wochen einfach auf dich.«
»Mache ich.«
»Gut. Und ruf mich an, wenn du was brauchst. Egal was.«
»Mache ich«, wiederhole ich.
Wie schon beim ersten Mal meine ich es nicht so. Marnie kann nichts tun, um etwas an der Situation zu ändern. Die Einzige, die mich aus dem Schlamassel herausziehen kann, den ich mir eingebrockt habe, bin ich selbst.
Und momentan habe ich keine Lust dazu.
Zwei Minuten nachdem Marnie und ich uns verabschiedet haben, bekomme ich den nächsten Anruf. Die tägliche Sechzehn-Uhr-Kontrolle meiner Mutter.
Statt auf dem Handy ruft sie immer auf dem uralten Telefon mit Wählscheibe im Spielzimmer an, weil sie weiß, dass ich wegen des nervenzermürbenden Klingelns eher abnehmen werde. Da hat sie recht. In den drei Tagen seit meiner Rückkehr hierher habe ich versucht, das unerträgliche Schrillen zu ignorieren, aber jedes Mal schon vor dem fünften Mal aufgegeben.
Heute schaffe ich es bis sieben, ehe ich reingehe und abnehme. Tue ich das nicht, dann wird sie es so lange probieren, bis sie mich endlich an die Strippe kriegt.
»Wollte mich nur erkundigen, ob du dich schon ein bisschen eingelebt hast«, sagt sie – genau das, was sie auch gestern gesagt hat.
Und vorgestern.
»Alles gut«, sage ich – genau wie gestern.
Und vorgestern.
»Und das Haus?«
»Auch alles gut. Deshalb sagte ich ja: alles.«
Sie ignoriert meine Spitze. Wenn es einen Menschen gibt, der sich von meinem Sarkasmus nicht beeindrucken lässt, dann Lolly Fletcher. Sie hat sechsunddreißig Jahre Übung darin.
»Und hast du getrunken?«, fragt sie – der wahre Grund ihres täglichen Anrufs.
»Natürlich nicht.« Ich schiele zu dem Elchkopf, der mit glasigem Blick auf mich herunterstarrt. Obwohl er schon fast hundert Jahre lang tot ist, kann ich mich nicht des Gefühls erwehren, dass er wegen der Lüge tadelnd schaut.
»Ich hoffe aufrichtig, dass das stimmt«, sagt meine Mutter. »Wenn ja, hoffe ich, dass es so bleibt. Wenn nicht, nun, dann sehe ich bald keinen anderen Ausweg, als dich an einen Ort zu schicken, wo die Sache effektiver angegangen wird.«
Im Klartext: auf Entzug.
Dass sie mich in irgendeine Klinik in Malibu verfrachtet, in deren Namen das Wort Hoffnung oder Leben oder Weiter vorkommt. In solchen war ich schon und fand es jedes Mal scheußlich. Genau darum spielt meine Mutter immer darauf an, wenn sie mich dazu bringen will, brav zu sein. Die verborgene Drohung, die sie nie ganz ausformuliert.
»Du weißt, dass ich das ungern täte«, spricht sie weiter. »Weil das den nächsten Schwung schlechter Presse bedeuten würde. Und ich ertrage den Gedanken nicht, dass diese schrecklichen Klatschreporter dich noch mehr malträtieren als sowieso schon.«
Das ist eines der wenigen Dinge, in denen meine Mutter und ich uns einig sind. Klatschreporter sind definitiv ekelhaft. Und auch wenn es übertrieben ist, von malträtieren zu sprechen, lästig sind sie auf jeden Fall. Sie hat mich deshalb nach Lake Greene weggesperrt statt in meine Wohnung in der Upper West Side, damit ich den neugierigen Blicken der Paparazzi entkomme. Die waren gnadenlos. Warteten vor meiner Haustür. Folgten mir in den Central Park. Ließen mich auf Schritt und Tritt nicht aus den Augen, weil sie mich mit einem Drink in der Hand erwischen wollten.
Schließlich wurde ich die Überwachung so leid, dass ich in die nächste Bar marschierte, mich mit einem doppelten Old Fashioned nach draußen setzte und ihn unter dem Klicken von einem Dutzend Kameras hinunterstürzte. Am nächsten Morgen prangte ein Foto des Moments auf der Titelseite der New York Post.
»Caseys Schnapsexzess«, lautete die Schlagzeile.
An jenem Nachmittag stand meine Mutter mit ihrem Fahrer Ricardo im Schlepptau vor meiner Tür. »Ich finde, du könntest für vier Wochen an den See fahren, was meinst du?«
Sie formulierte es als Frage, aber eine Wahl hatte ich nicht. Ihr Ton brachte klar zum Ausdruck, dass ich gehen und Ricardo mich fahren würde und ich nicht einmal daran denken sollte, auf dem Weg an einem Spirituosengeschäft anzuhalten.
Und hier bin ich nun in meiner Einzelhaft. Meine Mutter beteuert, es sei zu meinem Besten, aber ich weiß genau, dass es eine Strafe ist. Denn obwohl nicht alles, was passiert ist, meine Schuld war, habe ich es mir doch zur Hälfte selbst eingebrockt.
Vor ein paar Wochen schlug mir eine Bekannte, die die Memoiren von Prominenten herausgibt, vor, ich könnte doch meine eignen schreiben. »Die meisten Stars finden das sehr kathartisch.«
Gern, gab ich zurück, aber nur, wenn sie unter der Überschrift In sieben einfachen Schritten zum gefundenen Fressen für die Boulevardpresse erscheinen. Sie hielt das für einen Witz, und das war es vielleicht auch, aber ich stehe trotzdem zu dem Titel. Vielleicht würden mich die Leute besser verstehen, wenn ich mein Leben Schritt für Schritt erklären würde, wie eine IKEA-Aufbauanleitung.
Schritt eins ist natürlich, das einzige Kind der umjubelten Broadway-Ikone Lolly Fletcher und von Gareth Greene, einem eher konturlosen Produzenten, zu sein.
Meine Mutter debütierte mit neunzehn am Broadway und ist seither dort tätig. Meistens auf der Bühne, aber auch in Film und Fernsehen. YouTube ist proppenvoll von ihren Auftritten bei der Lawrence Welk Show, der Mike Douglas Show, bei Match Game und einigen Dutzend Filmpreisverleihungen. Sie ist klein und zierlich, selbst mit Absätzen kaum eins fünfzig groß. Sie lächelt nicht – sie funkelt. Ihr ganzer Körper scheint zu leuchten, angefangen bei den Lippen mit dem Amorbogen und den haselbraunen Augen. Dieses Leuchten strahlt auf das Publikum ab, hüllt es ein in den hypnotischen Glanz ihres Talents.
Und ja, meine Mutter ist talentiert, ohne Frage. Sie war – und ist noch immer – ein Star der alten Schule. In ihrer Jugend war sie in puncto Tanz, Schauspiel und Schlagfertigkeit kaum zu toppen. Und ihre Singstimme war das reinste Kraftwerk, fast schon unheimlich für eine so zarte Person.
Aber hier ist das kleine Geheimnis meiner Mutter: Hinter dem Funkeln, in diesem zierlichen kleinen Körper, verbirgt sich ein Rückgrat aus Stahl. Aus armen Verhältnissen in einem Kohlerevier in Pennsylvania stammend, beschloss sie schon früh, dass sie berühmt werden wollte. Und zwar mit ihrer Stimme. Sie arbeitete hart, putzte Tanzstudios, um an Tanzunterricht zu kommen, hatte drei Schülerjobs, um sich Gesangsstunden zu finanzieren, und übte pausenlos. In Interviews behauptet meine Mutter, noch nie im Leben geraucht oder Alkohol getrunken zu haben, und das glaube ich ihr. Nichts sollte ihrem Erfolg im Weg stehen.
Und als sie tatsächlich groß herauskam, arbeitete sie wie besessen, um dort oben zu bleiben. Eine Lolly Fletcher ließ keine Vorstellung ausfallen. Das inoffizielle Motto unseres Haushalts lautete: »Wenn man nicht bereit ist, alles zu geben, braucht man sich erst gar nicht zu bemühen.«
Meine Mutter gibt immer noch alles, und zwar jeden verdammten Tag.
Ihre ersten beiden Produktionen wurden von den Greene-Brüdern inszeniert, einem der gefragtesten Produzentenduos der damaligen Zeit. Stuart Greene war das stets präsente, öffentliche Gesicht der beiden. Gareth Greene war der blasse, unbeirrbare Erbsenzähler. Beide verliebten sich Hals über Kopf in die junge Lolly, und sofort glaubte die Öffentlichkeit, sie würde den Marketing-Strahlemann nehmen. Doch sie entschied sich für den Buchhaltertyp, der überdies zwanzig Jahre älter war als sie.
Erst viele Jahre später heiratete Stuart eine Chorsängerin und bekam Marnie.
Drei Jahre darauf bekamen meine Eltern mich.
Ich war ein spätes Kind, meine Mutter war einundvierzig. Ich hatte immer den Verdacht, dass sie mich bekam, um sich abzulenken und zu beschäftigen. In ihrer Karriere herrschte vorübergehend etwas Flaute, weil sie zu alt war, um Eliza Doolittle oder Maria von Trapp zu spielen, aber noch zu jung für Mrs Lovett und Mama Rose.
Aber dann fand sie das Muttersein doch nicht so spannend. Schon nach sechs Monaten nahm sie wieder eine Rolle in einer Reprise von Der König und ich an, und ich wurde buchstäblich zum Broadway-Baby. Mein Bettchen stand in ihrer Garderobe, und meine ersten Schritte machte ich auf der Bühne, gebadet im Glanz des mittig platzierten Ghost Light.
Also ging meine Mutter davon aus, dass ich in ihre Fußstapfen treten würde. Nein, verlangte es faktisch von mir. Ich gab mein Bühnendebüt mit der Cosette in einer Inszenierung von Les Misérables, in der sie ein halbes Jahr lang in London spielte. Die Rolle bekam ich nicht deshalb, weil ich singen oder tanzen konnte oder auch nur annähernd talentiert war, sondern weil es in Lolly Fletchers Vertrag stand. Nach zwei Wochen wurde ich ersetzt, weil ich permanent sagte, mir wäre übel, ich könnte nicht spielen. Meine Mutter war fuchsteufelswild.
Dies führte zu Schritt zwei: Rebellion.
Nach dem Fiasko mit den Misérables stellte mein besonnener Vater sich zwischen mich und die Starletambitionen meiner Mutter. Dann, als ich vierzehn war, starb er, und ich begann zu rebellieren. Für ein reiches Kind in Manhattan bedeutete das: Drogen. Und in Clubs gehen, wo man sie bekam. Und zu Absackerpartys, wo man noch mehr nahm.
Ich rauchte.
Ich schnupfte.
Ich legte mir bonbonfarbene Pillen auf die Zunge und ließ sie zergehen, bis ich meine Mundhöhle nicht mehr spürte.
Und es wirkte. Ein paar glückselige Stunden lang war ich in der Lage, zu vergessen, dass mein Vater tot war, meiner Mutter ihre Karriere mehr bedeutete als ich, all die Leute um mich herum nur da waren, weil ich die Drogen finanzierte, und ich keine wirklichen Freunde besaß außer Marnie. Aber irgendwann wurde ich mit einem Ruck in die Wirklichkeit zurückgerissen und fand mich in der Wohnung eines Fremden wieder, ohne mich zu erinnern, sie betreten zu haben. Oder auf dem Rücksitz eines Taxis im fahlen Morgenlicht, das zwischen den Gebäuden am East River hindurchschimmerte. Oder in einem U-Bahn-Waggon, einem schlafenden Obdachlosen gegenüber, mit Erbrochenem auf meinem zu kurzen Rock.
Meine Mutter tat ihr Bestes, um mich wieder hinzukriegen. Das muss ich ihr zugestehen. Leider bestand ihr Bestes darin, einen Haufen Geld in die Sache zu stecken. Sie tat all das, was reiche Eltern gestörter Mädchen so tun. Schickte mich ins Internat und auf Entzug und zum Psychologen, wo ich mir die Nagelhaut abkaute, statt über meine Gefühle zu reden.
Dann geschah ein Wunder.
Ich besserte mich.
Um genau zu sein: Ich begann mich zu langweilen, und das führte zur Besserung. Mit neunzehn hatte ich mein Leben schon so lange verbockt, dass ich es leid war. Ich wollte etwas Neues ausprobieren, wollte keine wandelnde Katastrophe mehr sein. Ich hörte auf mit den Drogen, den Clubs und den »Freunden«, die ich dabei gefunden hatte. Ich ging sogar ein Semester lang auf die NYU.
Und dort geschah – Schritt drei – ein weiteres Wunder.
Ich fand zur Schauspielerei.
Es war nie meine Absicht gewesen, meiner Mutter nachzueifern. Nach meiner Kindheit im Showbusiness wollte ich nichts damit zu tun haben. Aber die Sache ist: Es war die einzige Welt, die ich kannte. Als mich also eine Freundin von der Uni mit ihrem Vater, einem Filmregisseur, bekannt machte und der mich fragte, ob ich nicht bei seinem nächsten Projekt eine kleine Rolle übernehmen wolle, sagte ich: »Warum nicht?«
Der Film war gut. Er brachte eine Menge Geld ein, und ich machte mir einen Namen. Nicht Casey Greene, wie ich in Wirklichkeit heiße. Ich bestand darauf, als Casey Fletcher aufgeführt zu werden, denn, mal ehrlich, wenn man schon über ein solches Erbe verfügt, wäre man schön blöd, es nicht auszuschlachten.
Ich bekam noch eine Rolle in einem anderen Film. Und weitere folgten. Zum großen Entzücken meiner Mutter und zu meiner eigenen Überraschung wurde ich das, wovor ich mich am meisten gefürchtet hatte: Berufsschauspielerin.
Sogar eine ziemlich gute.
Sicherlich nicht legendär wie meine Mutter, die wirklich eine der Großen in ihrem Geschäft ist. Aber ich kann Regieanweisungen gut umsetzen, habe eine ordentliche Bühnenpräsenz und kann den abgedroschensten Dialogen eine frische Wendung verleihen. Da ich keine klassische Schönheit bin, übernehme ich anstatt von Hauptrollen oft die der fürsorglichen besten Freundin, der vernünftigen Schwester oder der mitfühlenden Arbeitskollegin. Ich werde nie ein solcher Star werden wie meine Mutter, aber das will ich auch gar nicht. Immerhin, ich habe einen Namen. Man kennt mich. Die Regisseure mögen mich. Die Castingagenten geben mir große Rollen in kleinen Filmen und kleine Rollen in großen Filmen, und ich hatte die Hauptrolle in einer Sitcom, von der nur dreizehn Folgen gedreht wurden.
Mir ist egal, wie groß eine Rolle ist. Wichtig ist mir die Figur an sich. Ich will komplexe, interessante Rollen, in denen ich verschwinden kann.
Wenn ich spiele, will ich zu jemand ganz anderem werden.
Deshalb ist meine große Liebe das Theater. Ich vermute, es hat doch auf mich abgefärbt, dort auf den Seitenbühnen aufzuwachsen. Außerdem sind die Rollen dort spannender. Die letzte Filmrolle, die ich angeboten bekam, war für eine Transformers-Neuauflage. Ich sollte die Mutter eines Protagonisten spielen, der von einem sechs Jahre jüngeren Schauspieler verkörpert wurde. Mit vierzehn Zeilen Text. Die letzte Theaterrolle war die Hauptrolle in einem Broadway-Thriller, mit Dialogen auf jeder einzelnen Seite.
Den Film lehnte ich ab, das Drama nahm ich an. Ich liebe es einfach, wenn dieser Funke zwischen Aufführenden und Publikum überspringt. Das gibt es nur im Theater. Ich spüre ihn jedes Mal, wenn ich auf die Bühne trete. Wir befinden uns im selben Raum, atmen dieselbe Luft, durchleben dieselbe emotionale Reise. Und dann ist es vorbei. Das ganze Erlebnis so flüchtig wie Rauch.
Ein bisschen wie meine Karriere, die so gut wie vorbei ist, egal was Marnie sagt.
Und wo wir schon bei flüchtigen Dingen sind, willkommen bei Schritt vier: einen Drehbuchautor heiraten, der auch einen Namen hat, aber keinen so großen, dass er den eigenen überschattet hätte.
Um konkret zu sein, Len. In der Filmwelt bekannt als Leonard Bradley, Co-Autor von ein paar Filmen, die Sie ziemlich sicher kennen, und einer Menge anderen, von denen Sie nie gehört haben. Wir trafen uns zum ersten Mal auf einer Party, dann am Set eines Films, bei dem er das Skript ein bisschen glättete, ohne später in den Credits aufgeführt zu werden. Beide Male fand ich ihn süß und witzig und dachte mir, dass er unter seinem grauen Hoodie und der NY-Knicks-Baseballkappe insgeheim vielleicht sogar sexy sein könnte. Erst bei unserem dritten Zusammentreffen, als wir zufällig denselben Flieger zurück nach New York nahmen, fing ich an, ihn unter der Überschrift »Möglicher Freund« zu betrachten.
»Wir dürfen uns nicht mehr ständig so über den Weg laufen«, sagte er.
»Genau«, gab ich zurück. »Man weiß ja, wie in dieser Stadt geklatscht wird.«
Wir bogen es so hin, dass wir Sitze nebeneinander bekamen, und verbrachten den ganzen Flug ins Gespräch vertieft. Bei der Landung auf dem JFK hatten wir schon beschlossen, mal zusammen essen zu gehen. An der Gepäckausgabe hatten wir beide gerötete Wangen vom Flirten und konnten uns nicht so recht trennen.
Ich sagte: »Ich sollte gehen. Mein Wagen wartet draußen.«
»Natürlich.« Plötzlich wirkte Len verlegen. »Könnte ich davor noch einen Kuss kriegen?«
Den gewährte ich ihm, und mir drehte sich der Kopf wie ein Gepäckband voller Samsonite-Koffer.
Ein halbes Jahr später heirateten wir standesamtlich, mit Marnie und meiner Mutter als Trauzeuginnen. Len besaß keine Angehörigen, jedenfalls keine, die er zu seiner Spontanhochzeit hätte einladen wollen. Seine Mutter war achtzehn und schwanger gewesen, als sie seinen dreißig Jahre älteren Vater geheiratet hatte, und dreiundzwanzig, als sie davonlief. Lens Vater ließ die Wut darüber an Len aus. Schon bald nachdem wir zusammengekommen waren, hatte Len mir erzählt, dass er ihm als Sechsjährigem den Arm gebrochen hatte. Die nächsten zwölf Jahre verbrachte Len in Pflegefamilien. Den letzten Kontakt zu seinem inzwischen längst verstorbenen Vater hatte er gehabt, kurz bevor er mit einem Vollstipendium an die University of California in Los Angeles ging.
Im Bewusstsein seiner Vergangenheit wollte Len auf keinen Fall den gleichen Fehler machen wie seine Eltern. Er wurde nie wütend und war kaum jemals traurig. Wenn er lachte, dann lachte sein ganzer Körper mit, als wäre in ihm so viel Fröhlichkeit, dass sie nicht zu halten war. Er konnte hervorragend kochen und noch besser zuhören, und er liebte lange, heiße Bäder, vorzugsweise mit mir gemeinsam in der Wanne. Unsere Ehe bestand sowohl aus großen Gesten – wie jener Geburtstag von mir, an dem er ein ganzes Kino mietete, um mir eine Privatvorstellung von Das Fenster zum Hof