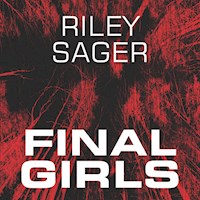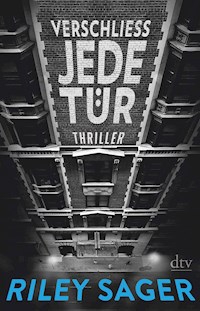Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie haben die Hölle überlebt. Aber das war erst der Anfang ... Drei junge Frauen haben jeweils ein grausiges Massaker überlebt. Jetzt, viele Jahre später, hat es erneut ein Mörder auf sie abgesehen … ein hochspannender Thriller mit spektakulärem Ende! »Sensationell!« Karin Slaughter Als Einzige hat die Studentin Quincy ein Massaker auf einer Party überlebt. Sie hat jede Erinnerung an damals aus ihrem Gedächtnis gelöscht und sich mühsam ein normales Leben aufgebaut. Zwei andere Frauen, Lisa und Samantha, haben ähnlich Grauenvolles durchgemacht – ein Fest für die Medien, in denen die drei als »Final Girls« bekannt werden. Doch der Horror ist noch lange nicht zu Ende: Lisa wird tot aufgefunden. Ermordet? Der Schlüssel zu allem scheint in dem Massaker in Pine Cottage zu liegen, das nur Quincy überlebte. Angestachelt von Samantha, versucht sie verzweifelt sich zu erinnern, was dort geschah … »Der erste große Thriller des Jahres: ›Final Girls‹ von Riley Sager.« Stephen King Eine hochspannende, raffiniert aufgebaute Story – mit spektakulärem Ende! Von Riley Sager sind bei dtv außerdem folgende spannende Thriller erschienen: »Schwarzer See« »Verschließ jede Tür« »HOME – Haus der bösen Schatten« »NIGHT – Nacht der Angst« »Hope's End«
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Riley Sager
Final Girls
Thriller
Deutsch von Christine Blum
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Mike
PINE COTTAGE 1:00 Uhr
Der Wald hatte Zähne und Klauen.
Steine, Äste und Dornen schnappten nach Quincy, als sie schreiend durchs Unterholz rannte. Aber nichts konnte sie aufhalten. Nicht die Steine, die sich in ihre nackten Fußsohlen bohrten. Nicht der peitschendünne Zweig, der ihr ins Gesicht schlug und einen blutigen Striemen auf ihrer Wange hinterließ.
Stehen zu bleiben kam nicht infrage. Stehen zu bleiben wäre ihr Tod. Also rannte sie weiter, auch als sich eine Dornranke um ihren Knöchel wickelte und ihr tief in die Haut schnitt. Die Ranke spannte sich zitternd, dann gab sie Quincy frei. Falls es wehtat, spürte Quincy es nicht. Ihr Körper ertrug bereits Schmerzen, die jenseits alles Aushaltbaren waren.
Nur ihr Instinkt trieb sie voran. Eine unbewusste Klarheit, dass sie um jeden Preis weiterrennen musste. Warum, hatte sie vergessen. Da war keine Erinnerung mehr an das, was vor fünf, zehn, fünfzehn Minuten gewesen war. Hätte ihr Leben von dem Wissen, warum sie auf der Flucht durch den Wald war, abgehangen, sie wäre auf der Stelle tot zusammengebrochen.
Sie rannte. Sie schrie. Sie versuchte, nicht an den Tod zu denken.
In der Ferne, zwischen dem wirren Geäst der Bäume, tauchte ein weißer Schimmer auf. Scheinwerfer.
War eine Straße in der Nähe? Sie hoffte es. Genau wie ihre Erinnerung hatte sie jegliche Orientierung verloren.
Sie rannte schneller, schrie lauter, flog dem Licht entgegen.
Wieder schlug ihr ein Zweig ins Gesicht. Er war dicker als der erste, wie ein Nudelholz. Nach dem Aufprall war sie einen Moment lang betäubt und blind. Schmerz pochte in ihrem Kopf und ihr Blick verschwamm hinter blauen Blitzen. Als sie nachließen, erkannte sie im Gleißen des Scheinwerferlichts eine Silhouette.
Ein Mann.
Er.
Nein. Nicht Er.
Jemand anders.
Rettung.
Quincy rannte noch schneller. Streckte ihre blutüberströmten Arme aus, als könnte sie den Fremden so an sich heranziehen. Dabei flammte der Schmerz in ihrer Schulter auf. Und mit dem Schmerz kam – nein, keine Erinnerung, aber eine grausame Gewissheit.
Nur Quincy war noch am Leben.
Alle anderen waren tot.
Sie war die Einzige, die überlebt hatte.
1
Als Jeff anruft, sind meine Hände mit einer dicken Fettschicht überzogen. Trotz aller Bemühungen ist die Buttercreme zwischen meine Finger gekrochen, hat sich bis zu den Fingerknöcheln hochgeschoben und klebt da jetzt zäh wie Leim. Nur ein kleiner Finger ist verschont geblieben; mit ihm aktiviere ich die Lautsprechfunktion des Telefons.
»Privatdetektei Carpenter und Richards«, sage ich mit dem rauchigen Timbre einer Film-noir-Sekretärin. »Womit kann ich dienen?«
Jeff spielt mit. In rauem Ton, irgendwo zwischen Robert Mitchum und Dana Andrews, knurrt er: »Holen Sie Miss Carpenter an den Apparat, aber pronto. Ich muss mit ihr reden.«
»Miss Carpenter ist mit einem dringenden Fall beschäftigt. Kann ich ihr etwas ausrichten?«
»Ja. Sagen Sie ihr, mein Flug von Chi-Town hat Verspätung.«
Sofort gebe ich das Spiel auf. »Oh Jeff, wirklich?«
»Tut mir leid, Süße. So ist das eben in der Windy City.«
»Wie lange wird es dauern?«
»Ist noch alles drin – vielleicht zwei Stunden, vielleicht erst nächste Woche? Ich hoffe, es hat wenigstens den Vorteil, dass mir der Beginn des Großen Backwahns erspart bleibt.«
»Keine Chance, Freundchen.«
»Wie läuft’s bisher?«
Ich betrachte meine Hände. »Wie geschmiert.«
Großer Backwahn ist Jeffs Bezeichnung für die anstrengende Saison von Anfang Oktober bis Ende Dezember, in der sich ein heillos überzuckerter Feiertag an den anderen reiht. Er spricht das Wort gern mit unheilschwangerer Stimme aus, wobei er die Hände hebt und die Finger krümmt wie Spinnenbeine.
Ironischerweise ist eine Spinne daran schuld, dass meine eigenen Hände gerade mit extradunkler Schoko-Buttercreme überzogen sind. Ihr Leib hängt schwarzglänzend am Rand eines Cupcake, die schwarzen Beine ziehen sich über seine Oberfläche und Seiten. Sobald ich fertig bin, werden die Cupcakes appetitlich arrangiert, fotografiert und in der Halloween-Backideen-Rubrik meiner Website publiziert. Das diesjährige Motto lautet Die Rache des Süßen.
»Wie ist es am Flughafen?«, frage ich.
»Voll. Aber in der Bar werde ich’s überleben.«
»Ruf mich an, wenn es sehr viel später wird. Ich erwarte dich heiß und fettig.«
»Leg dich ins Zuckerzeug«, sagt Jeff.
Nach dem Anruf wende ich mich wieder der Buttercremespinne und dem dunklen Cupcake darunter zu. Wenn alles nach Plan gelaufen ist, sollte die rote Kirschfüllung schon beim ersten Bissen herausquellen. Dieser Test kommt später. Im Moment geht es mir vor allem ums Äußere.
Cupcakes zu verzieren ist schwerer, als man glauben sollte. Vor allem, wenn Tausende von Lesern das Ergebnis im Internet sehen können. Da darf nichts verschmiert oder verwischt sein – in der hochauflösenden digitalen Welt sticht jeder Fehler überdeutlich heraus.
Jedes Detail zählt. Das ist eines der zehn Gebote auf meiner Website, gleich nach Der Messbecher ist dein bester Freund und Keine Angst vor Misserfolgen.
Ich vollende den ersten Cupcake und arbeite am zweiten, da klingelt das Telefon erneut. Diesmal habe ich nicht mal mehr einen sauberen kleinen Finger, deshalb muss ich es klingeln lassen. Das Telefon summt und summt und tanzt dabei über die Tischplatte. Schließlich verstummt es, um nach einer Sekunde ein vielsagendes Piep von sich zu geben.
Eine SMS.
Verwundert lege ich die Spritztülle beiseite, wische mir die Hände ab und schaue aufs Display. Die Nachricht ist von Coop.
Wir müssen reden. Live.
Meine Finger schweben wie erstarrt über dem Bildschirm. Coop braucht drei Stunden hierher nach Manhattan, aber diese Fahrt hat er schon oft bereitwillig in Kauf genommen. Wenn es wichtig war.
Wann?, schreibe ich zurück.
Seine Antwort kommt nur Sekunden später. Jetzt. Üblicher Ort.
In meinem Kreuz entsteht ein kleiner Druck. Er ist schon da. Das kann nur eines bedeuten: Irgendwas stimmt nicht.
Hastig treffe ich die üblichen Vorbereitungen für eine Verabredung mit Coop. Zähne putzen. Lipgloss auftragen. Eine Xanax einwerfen und mit einem Schluck Traubensaftschorle direkt aus der Flasche hinunterspülen.
Im Aufzug fällt mir auf, dass ich mich hätte umziehen sollen. Ich bin in Backmontur: schwarze Jeans, ein altes Hemd von Jeff, rote Ballerinas. Alles mehlbestäubt und voller verwaschener Flecken von Lebensmittelfarbe. Auf meinem Handrücken ist noch ein angetrockneter Glasurspritzer – blauschwarz, darunter scheint helle Haut durch. Er sieht aus wie ein blauer Fleck. Ich lecke ihn ab.
Draußen auf der Eighty-Second Street biege ich nach rechts in die Columbus Avenue ein, wo eine Menge Fußgänger unterwegs sind. Beim Anblick der vielen Menschen spannt sich alles in mir an. Ich stoppe und taste mit steifen Fingern in meiner Handtasche nach dem Pfefferspray, das ich dort immer aufbewahre. In der Masse ist man zwar geschützt, aber irgendwie auch schutzlos. Erst nachdem ich das Spray gefunden habe, gehe ich weiter, mein Gesicht zu einer finsteren Lass-mich-bloß-in-Ruhe-Grimasse verzogen.
Obwohl die Sonne scheint, liegt ein Hauch von Frost in der Luft. Typisch für Anfang Oktober in New York, wenn das Wetter wie nach Lust und Laune zwischen heiß und kalt wechselt. Aber der Herbst naht mit großen Schritten. Die Blätter im Theodore-Roosevelt-Park leuchten bereits im Übergang von Grün zu Gold.
Durch die Baumkronen schimmert die Rückseite des American Museum of Natural History, das zu dieser Tageszeit von Schulkindern überlaufen ist. Ihre Stimmen schwirren wie Vögel durch die Zweige. Als eines von ihnen aufkreischt, verstummen die anderen für eine Sekunde. Ich erstarre, nicht wegen des Kreischens, sondern wegen der darauffolgenden Stille. Dann nehmen die Kinder ihr Geschrei wieder auf. Ich entspanne mich und gehe weiter zu dem Café zwei Blocks südlich des Museums.
Unser üblicher Treffpunkt.
Coop erwartet mich an einem Tisch am Fenster. Er sieht aus wie immer. Das scharf geschnittene, zerfurchte Gesicht, das im entspannten Zustand nachdenklich wirkt, so wie jetzt. Die große, kräftige Statur. Große Hände, an der einen ein rubinroter Absolventenring anstelle eines Eherings. Nur seine kurz geschorenen Haare deuten auf Veränderung hin; sie sind bei jedem Treffen ein bisschen grauer als zuvor.
Seine Anwesenheit entgeht keinem der anderen Gäste im Café, alles Kindermädchen und koffeinierte Hipster. Ein Polizist in Uniform sorgt immer für Verunsicherung. Wobei Coop auch ohne Dienstkleidung eine beeindruckende Figur abgäbe, groß und muskulös, wie er ist. Das gestärkte blaue Hemd und die schwarze Hose mit den messerscharfen Bügelfalten unterstreichen seine imposante Erscheinung. Als ich eintrete, hebt er den Kopf. Ich bemerke die Erschöpfung in seinem Blick. Er muss gleich nach der Nachtschicht hierhergefahren sein.
Auf dem Tisch stehen schon zwei Tassen. Für mich Earl Grey mit Milch und extra Zucker. Für Coop Kaffee. Schwarz. Ungesüßt.
»Quincy.« Er nickt mir zu.
So läuft es immer ab. Coops Nicken ist seine Art, mir die Hand zu geben. Wir umarmen uns nie zur Begrüßung. Nicht seit jener Nacht, als ich ihn zum ersten Mal traf und verzweifelt in seinen Armen lag. Egal wie oft wir uns sehen, dieser Moment bleibt immer lebendig und läuft in Endlosschleife vor meinem inneren Auge ab, bis ich ihn mit Gewalt wegschiebe.
Sie sind tot, hatte ich mit erstickter Stimme gekeucht, während ich mich an ihm festklammerte, kaum fähig, die Worte aus meiner Kehle zu würgen. Sie sind alle tot. Und Er ist noch irgendwo da hinten.
Zehn Sekunden später hatte er mir das Leben gerettet.
»Das ist aber eine Überraschung«, sage ich und setze mich. In meiner Stimme ist ein Beben, das ich zu unterdrücken versuche. Warum auch immer Coop mich angerufen hat, wenn es schlechte Neuigkeiten sind, will ich ruhig sein, wenn ich sie höre.
Coop mustert mich besorgt, ein Blick, der mir wohlvertraut ist. »Du siehst gut aus. Aber du hast abgenommen.« Auch in seiner Stimme schwingt die Sorge um mich. Er denkt an die sechs Monate nach Pine Cottage, als mein Appetit mich so vollständig verlassen hatte, dass ich ins Krankenhaus eingeliefert und zwangsernährt werden musste. Ich weiß noch, wie ich aufwachte und Coop neben dem Bett stand und den Plastikschlauch anstarrte, der in meinem Nasenloch verschwand.
Enttäusche mich nicht, Quincy, hatte er damals gesagt. Du hast diese Nacht nicht überlebt, um jetzt einfach so zu sterben.
»Keine Sorge«, sage ich. »Ich hab endlich begriffen, dass ich nicht alles essen muss, was ich backe.«
»Und wie läuft das? Diese Backgeschichte?«
»Gut. Super. Im letzten Vierteljahr hab ich fünftausend Follower und einen Anzeigenkunden dazugewonnen.«
»Großartig«, sagt Coop. »Freut mich, dass alles so gut klappt. Irgendwann musst du mir auch mal was backen.«
Wie das Nicken gehört auch dieser Satz zum Ritual.
»Was macht Jefferson?«, fragt er.
»Dem geht’s auch gut. Er wurde gerade zum Hauptverteidiger in einem großen Fall bestellt.« Ich erwähne nicht, dass sein Mandant beschuldigt wird, bei einer misslungenen Razzia einen Drogenermittler getötet zu haben. Coop hat für Jeffs Job ohnehin nichts übrig. Besser, ich gieße nicht noch mehr Öl in dieses Feuer.
»Schön für ihn«, sagt er.
»Er ist seit zwei Tagen verreist, in Chicago, weil er da Aussagen von Familienangehörigen aufnehmen will. Er meint, die helfen meistens, um die Jury wohlwollender zu stimmen.«
Coop hört gar nicht richtig zu. »Mhm. Einen Antrag hat er dir also noch nicht gemacht?«
Ich schüttle den Kopf. Ich hatte Coop erzählt, Jeff habe sich das vermutlich für unseren Urlaub auf den Outer Banks im August vorgenommen, aber nichts dergleichen war geschehen. Das ist im Übrigen der wahre Grund, warum ich abgenommen habe: Ich habe angefangen zu joggen, um in ein hypothetisches Hochzeitskleid zu passen. »Ich warte noch.«
»Das kommt schon.«
»Und du?«, frage ich nur halb im Scherz. »Endlich ’ne Freundin gefunden?«
»Nö.«
Ich hebe eine Augenbraue. »Einen Freund?«
Er grinst nicht einmal. »Ich bin deinetwegen hier, Quincy.«
»Natürlich. Frag nur. Ich antworte.«
So ist es immer, wenn wir uns treffen – ein-, zwei-, manchmal dreimal pro Jahr. Oft sind seine Besuche wie Therapiesitzungen. Ich habe kaum je die Chance, ihm meinerseits Fragen zu stellen. Über sein Leben weiß ich nur in groben Zügen Bescheid. Er ist einundvierzig, war eine Weile bei den Marines, bevor er Polizist wurde, und stand ziemlich am Anfang seiner beruflichen Laufbahn, als ich ihm schreiend im Wald entgegenlief. Ich weiß, dass er noch immer in dem Ort Streife fährt, wo die grausigen Ereignisse stattfanden, aber ich habe keine Ahnung, ob er zufrieden ist. Oder glücklich. Oder einsam. Zu Feiertagen höre ich nie von ihm. Er schreibt keine Weihnachtskarten. Vor neun Jahren, bei der Beerdigung meines Vaters, saß er in der letzten Reihe und verließ die Kirche, ehe ich ihm auch nur danken konnte, dass er gekommen war. Nur zu meinem Geburtstag zeigt er mir so was wie Zuneigung. Jedes Jahr schickt er mir denselben Spruch: Noch ein Jahr, das du beinahe nicht erlebt hättest. Nutze es.
»Er wird es tun, ganz sicher«, meint Coop und steuert die Unterhaltung wieder nach seinem Willen. »Ich wette, an Weihnachten. Das Datum ist bei den Männern beliebt.«
Er nimmt einen Schluck Kaffee. Ich nippe an meinem Tee und nutze ein Blinzeln, um die Augen ein klein wenig länger zu schließen. Im Dunkeln hoffe ich zu spüren, wie das Xanax allmählich zu wirken beginnt. Aber ich spüre nur, dass ich immer nervöser werde.
Als ich die Augen öffne, kommt gerade eine gut gekleidete junge Frau mit einem ebenso gut gekleideten pausbäckigen Kleinkind ins Café. Wahrscheinlich ein Au-pair-Mädchen, wie die meisten Frauen unter dreißig in diesem Viertel. An warmen, sonnigen Tagen sind die Gehwege voll von ihnen – eine Parade austauschbarer Mädchen frisch vom College, bewaffnet mit Abschlüssen in Literaturwissenschaft und Studienkrediten. Die hier fällt mir nur auf, weil sie mir ähnlich sieht. Mädchenhaftes, rosiges Gesicht. Blondes Haar, zu einem Pferdeschwanz gebändigt. Weder zu dünn noch zu dick. Der kräftige, gesunde Menschenschlag des Mittleren Westens.
Das hätte ich sein können – in einem anderen Leben. Einem Leben ohne Pine Cottage, ohne das Blut und das Kleid, das die Farbe änderte wie in einem schrecklichen Albtraum.
Noch etwas, woran ich jedes Mal denke, wenn Coop und ich uns treffen – dass er glaubte, mein Kleid wäre rot. So hatte er es durchgegeben, als er über Funk um Verstärkung bat. So ist es im Polizeiprotokoll verewigt, das ich mehrmals gelesen habe, ebenso im Mitschnitt der Polizeimeldung, den ich nur einmal Gelegenheit hatte zu hören.
Jemand rennt durch den Wald. Weiblich, weiß. Jung. Sie trägt ein rotes Kleid. Sie schreit.
Ja, ich bin durch den Wald gerannt oder besser: wie verrückt gerast, sodass das Laub aufspritzte, taub gegen die Schmerzen, die meinen Körper durchpulsten. Und ja, ich habe geschrien, obwohl alles, was ich hören konnte, der Herzschlag in meinen Ohren war. Das Einzige, worin Coop sich geirrt hatte, war die Farbe meines Kleides.
Noch eine Stunde zuvor war es weiß gewesen.
Ein Teil des Blutes stammte von mir. Das meiste von den anderen. Hauptsächlich von Janelle, die ich im Arm gehalten hatte, bevor ich selbst verletzt wurde.
Nie werde ich Coops Gesichtsausdruck vergessen, als er seinen Irrtum erkannte. Wie sich seine Pupillen weiteten. Wie sich sein Mund zu einem Rechteck verzog beim Versuch, seine Kinnlade am Herunterfallen zu hindern. Das entgeisterte Schnauben, das er von sich gab. Zwei Drittel Entsetzen, ein Drittel Mitgefühl.
Das gehört zu den wenigen Dingen, an die ich mich tatsächlich erinnere.
Was in Pine Cottage geschah, zerfällt für mich in zwei Hälften, die nichts miteinander zu tun haben. Da ist der Anfang voller Angst und Entsetzen, als Janelle aus dem Wald getaumelt kam, noch nicht tot, aber schon nicht mehr wirklich am Leben. Und dann das Ende, als Coop mich in meinem roten und doch nicht roten Kleid fand.
Zwischen diesen beiden Polen herrscht Leere. Ungefähr eine Stunde, die in meinem Gedächtnis wie ausgelöscht ist.
Die offizielle Diagnose lautet »Dissoziative Amnesie«, auch bekannt als Gedächtnisstörung, ausgelöst durch Trauma oder Stress. Im Prinzip heißt das: Was ich erlebt habe, war zu schrecklich für meine zerbrechliche Seele, also habe ich es unbewusst ausgeklammert. Selbst induzierte Lobotomie.
Nicht dass das andere davon abgehalten hätte, mich zu drängen, ich solle mich erinnern. Wohlmeinende Verwandte. Fehlgeleitete Freunde. Psychiater, denen bereits die publizierte Fallstudie vorschwebte. Denk nach, sagten sie alle. Denk ganz genau darüber nach, was passiert ist. Als ob das etwas geändert hätte. Als ob mein Vermögen, mich an jedes blutige Detail zu erinnern, meine Freunde wieder zum Leben erweckt hätte.
Trotzdem bemühte ich mich. Therapie. Hypnose. Sogar ein albernes Spiel zur Gedächtnisstimulation durch Sinneseindrücke. Dabei hielt mir ein kraushaariger Spezialist bei verbundenen Augen aromatisierte Papierstreifen vor die Nase und fragte mich, was für Emotionen die einzelnen Düfte in mir wachriefen. Nichts von alldem zeigte auch nur die geringste Wirkung. Diese eine Stunde in meinem Leben ist wie eine blank geputzte Tafel. Schwarz mit einem Hauch Kreidestaub.
Ich verstehe das Bedürfnis nach mehr Informationen und Details durchaus. Aber was Pine Cottage angeht, brauche ich das nicht. Ich weiß, was dort passiert ist. Ich muss mich nicht genau erinnern, wie. Denn die Sache mit den Details ist: Sie können auch ablenken. Zu viele davon verschleiern die nackte, brutale Wirklichkeit. Wie die bunte Halskette, unter der sich die Tracheotomienarbe versteckt.
Ich verstecke meine Narben nicht. Ich verleugne sie nur.
Auch im Café verleugne ich fleißig. Bloß krampfhaft so tun, als wäre Coop nicht drauf und dran, mit der schlechten Nachricht herauszuplatzen – als ob ich das verhindern könnte.
»Bist du beruflich in der Stadt?«, frage ich. »Wenn du länger bleibst, würden Jeff und ich uns freuen, wenn du mit uns zu Abend isst. Der Italiener, wo wir letztes Jahr waren, hat uns doch allen gefallen.«
Coop sieht mich über den Tisch hinweg an. Ich kenne niemanden, dessen Augen so hellblau sind wie seine. Heller noch als das Blau der Xanax-Pille, die sich gerade in meinem zentralen Nervensystem breitmacht. Kein ruhiges Blau. Coops Blick hat eine Intensität, der ich stets ausweichen muss. Dabei würde ich am liebsten ganz genau hinschauen, in der Hoffnung, seine Gedanken lesen zu können. Ein wildes Blau. Augen, wie man sie sich von einem Beschützer wünscht.
»Ich glaube, du weißt, warum ich hier bin«, sagt er.
»Keine Ahnung, ehrlich.«
»Es gibt schlechte Neuigkeiten. Noch sind sie nicht in den Medien, aber das kommt noch. Sehr bald.«
Er.
Das ist mein erster Gedanke. Dass es etwas mit Ihm zu tun hat. Auch wenn ich mit eigenen Augen gesehen habe, wie Er starb, ist irgendetwas in mir davon überzeugt, dass Er Coops Kugeln überlebt hat, dass Er geflohen ist, sich jahrelang versteckt hielt und nun wieder auftaucht in der Absicht, mich zu finden und sein halb fertiges Werk zu beenden.
Er ist am Leben.
In meinem Magen klumpt sich die Angst, schwer und unförmig, wie ein basketballgroßer Tumor. Ich muss auf der Stelle aufs Klo.
Coop weiß sofort, was ich denke. »Nein, nicht das. Er ist tot, Quincy. Das wissen wir beide.«
Nett zu hören, aber das löst meine Anspannung nicht. Meine Hände sind zu Fäusten geballt, die Fingerknöchel auf den Tisch gepresst. »Sag mir einfach, was los ist.«
»Es geht um Lisa Milner.«
»Was ist mit ihr?«
»Sie ist tot, Quincy.«
Das raubt mir den Atem. Ich glaube, ich ringe nach Luft. Aber sicher bin ich mir nicht, weil mich die Erinnerung an das verschwommene Echo ihrer Stimme gefangen hält.
Ich will dir helfen, Quincy. Ich will dir beibringen, ein Final Girl zu sein.
Ich hatte eingewilligt. Wenigstens für eine Weile. Ich hatte gedacht, sie wüsste es am besten.
Jetzt ist sie tot.
Jetzt gibt es nur noch zwei von uns.
2
Lisa Milners Pine Cottage war ein Studentinnenverbindungsheim in Indiana. Eines lange vergangenen Abends im Februar klopfte dort ein Mann namens Stephen Leibman an die Tür. Er war Studienabbrecher, wohnte bei seinem Vater. Beleibt, sein Gesicht so wabblig und gelb wie Hühnerschmalz.
Die Verbindungsstudentin, die ihm aufmachte, begrüßte er gleich auf der Türschwelle mit einem Jagdmesser. Eine Minute später war sie tot. Leibman zerrte die Leiche nach drinnen, verschloss alle Türen und kappte die Strom- und Telefonkabel. Was dann folgte, war ein einstündiges Massaker, dem neun junge Frauen zum Opfer fielen.
Lisa Milner wäre beinahe die zehnte geworden.
Während des Gemetzels hatte sie sich in das Zimmer einer Mitstudentin geflüchtet und in einen Schrank gekauert, sich unter Kleidern vergraben, die nicht ihre waren, und gebetet, dass der Wahnsinnige sie nicht fand.
Aber er fand sie doch.
Lisa erblickte ihn, als er die Schranktür aufriss. Zuerst sah sie das Messer, dann sein Gesicht. Beides triefte vor Blut. Nachdem er ihr einen Stich in die Schulter versetzt hatte, gelang es ihr, ihm das Knie in den Schritt zu rammen. Sie war schon im Erdgeschoss und fast an der Tür, da holte er sie ein. Sie trug vier Stichwunden in Brust und Bauch davon, außerdem einen zwölf Zentimeter langen Schnitt im Arm, den sie zum Schutz erhoben hatte. Hätte er noch einmal zugestochen, wäre sie gestorben. Aber irgendwie gelang es ihr, schreiend und schwindelig vom Blutverlust, ihn am Knöchel zu packen. Er stürzte. Ließ das Messer los. Lisa bekam es zu fassen und rammte es ihm bis zum Griff in den Bauch. Stephen Leibman verblutete neben ihr auf dem Fußboden.
Details. Wie reichlich sie fließen, wenn sie andere betreffen.
Als es passierte, war ich sieben. Es war das erste Mal, dass ich bewusst Nachrichten sah. Ich konnte gar nicht anders als hinschauen, denn meine Mutter, die neben mir vor dem Fernseher stand, hielt sich die Hand vor den Mund und wiederholte unablässig zwei Worte. Mein Gott. Mein Gott.
Was ich damals im Fernsehen sah, war verwirrend und beängstigend. Die Schaulustigen, die weinten. Das gelb-schwarze Polizeiband vor der Eingangstür. Die lange Reihe der verhüllten Tragen. Die leuchtenden Blutflecken im Schnee. Es war der Moment, in dem ich begriff, dass das Böse auf dieser Welt existierte.
Als ich zu weinen begann, hob mein Vater mich hoch und trug mich in die Küche. Während meine Tränen zu Salz trockneten, stellte er eine Reihe Schüsseln auf die Arbeitsfläche und füllte sie mit Mehl, Zucker, Butter und Eiern. Er gab mir einen Löffel und wies mich an, alles zusammenzurühren. Meine erste Backlektion.
Man kann Gebäck auch zu süß machen, Quincy, hatte er gesagt. Das wissen alle guten Bäcker. Es muss einen Kontrast zur Süße geben. Etwas Herbes. Oder Bitteres. Oder Saures. Ungesüßter Kakao. Kardamom und Zimt. Zitrone und Limette. Die mildern die Süße so weit ab, dass man sie umso mehr genießt.
Momentan habe ich nur einen sauren, bitteren Geschmack im Mund. Ich schütte mehr Zucker in meinen Tee und leere ihn in einem Zug. Es hilft nichts. Der Zuckerschub bekämpft lediglich die Wirkung des Xanax, das seinen Zauber endlich entfaltet. Der Zusammenstoß der beiden tief in mir drin macht mich kribbelig.
»Wann ist es passiert?«, frage ich, nachdem sich der Schock in Unglauben verwandelt hat. »Und wie?«
»Heute Nacht. Etwa um Mitternacht hat die Polizei in Muncie sie gefunden. Sie hat Selbstmord begangen.«
»Mein Gott.« Ich spreche so laut, dass mein Au-pair-Double am Nebentisch mit schief gelegtem Kopf wie ein Cockerspaniel von ihrem iPhone aufschaut. »Selbstmord?« Das Wort schmeckt bitter. »Ich dachte, sie wäre glücklich. Also, sie wirkte glücklich.«
Noch immer höre ich Lisas Stimme in meinem Kopf. Du kannst das, was geschehen ist, nicht ändern. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist, wie du damit umgehst.
»Es wird noch untersucht, ob sie betrunken war oder Drogen genommen hat.«
»Also könnte es auch ein Unfall gewesen sein?«
»Nein. Sie hat sich die Pulsadern aufgeschlitzt.«
Mein Herzschlag setzt einen Moment lang aus. Ich bin mir der rhythmischen Pause, die dadurch entsteht, sehr bewusst. In sie hinein strömt Trauer, so schnell, dass mir schwindelig wird.
»Ich will alles darüber wissen«, sage ich.
»Willst du nicht. Es wird nichts ändern.«
»Aber Informationen zu haben ist besser als nichts.«
Coop starrt in seinen Kaffee, wie um das trübe Spiegelbild seiner hellen Augen zu untersuchen. Endlich sagt er: »Was ich weiß, ist: Um Viertel vor zwölf hat Lisa einen Notruf abgesetzt.«
»Was hat sie gesagt?«
»Nichts. Sie hat sofort wieder aufgelegt. Die Zentrale hat den Anruf rückverfolgt und eine Streife zu ihr geschickt. Die Haustür war nicht verschlossen, also sind Polizisten reingegangen. Und fanden sie. In der Badewanne. Ihr Handy lag neben ihr im Wasser. Ist ihr wahrscheinlich aus der Hand gerutscht.« Er wendet den Blick zum Fenster. Er ist sichtlich müde. Und zweifellos besorgt, dass ich eines Tages etwas Ähnliches tun könnte. Aber der Gedanke ist mir nie gekommen, nicht einmal, als ich mit dem Schlauch in der Nase im Krankenhaus lag. Ich greife über den Tisch hinweg nach seinen Händen. Er zieht sie weg, bevor ich sie berühre.
»Wann hast du es erfahren?«, frage ich.
»Vor ein paar Stunden. Eine Bekannte bei der Indiana State Police rief mich an. Wir haben immer mal wieder Kontakt.«
Ich brauche nicht zu fragen, woher Coop eine Polizistin in Indiana kennt. Überlebende Opfer von Straftaten sind nicht die Einzigen, die seelischen Rückhalt brauchen.
»Sie meinte, es wäre gut, dich vorzuwarnen«, sagt er. »Bevor die Nachricht an die Öffentlichkeit geht.«
Natürlich, die Presse. Journalisten kommen mir oft vor wie ausgehungerte Geier mit blutigen Innereien im Schnabel.
»Ich rede mit keinem von denen.«
Wieder wird das Au-pair aufmerksam. Sie schaut mit zusammengekniffenen Augen auf. Ich starre sie an, bis sie das iPhone auf den Tisch legt und so tut, als würde sie sich mit dem Kleinkind beschäftigen.
»Musst du auch nicht«, sagt Coop. »Aber überleg dir, ob du wenigstens eine Beileidsbekundung veröffentlichst. Die Klatschreporter werden hinter dir her sein wie die Hyänen. Wirf ihnen lieber gleich einen Knochen hin.«
»Warum muss ich unbedingt was sagen?«
»Du weißt warum.«
»Warum nicht Samantha?«
»Weil sie von der Bildfläche verschwunden ist. Ich bezweifle, dass sie nach all den Jahren jetzt plötzlich wieder auftauchen wird.«
»Die Glückliche.«
»Also bleibst nur du. Deshalb wollte ich dir die Nachricht persönlich überbringen. Ich weiß, ich kann dich zu nichts zwingen, aber vielleicht wäre es ganz vorteilhaft, dich mit der Presse gutzustellen. Da Lisa und Samantha ausfallen, bist du alles, was sie haben.«
Ich ziehe mein Handy aus der Tasche. Es war die ganze Zeit still. Keine neuen Anrufe. Keine Textnachrichten. Nur ein paar Dutzend Mails meine Website betreffend. Ich schalte das Gerät aus. Ein Aufschub. Die Presse wird mir trotzdem auf die Spur kommen. Da hat Coop recht. Die Journalisten werden alles versuchen, um das letzte greifbare Final Girl zu einem Kommentar zu überreden.
Schließlich haben sie uns erschaffen.
Final Girl, so nennt man im Filmjargon die Mädchen, die in Horrorfilmen am Ende noch leben. So habe ich es zumindest gehört. Schon vor Pine Cottage waren Horrorfilme nicht mein Ding, mit all dem Kunstblut, den Gummimessern und Protagonisten, die sich so dumm anstellten, dass ich immer fand, wenn auch mit schlechtem Gewissen, sie hätten ihr Schicksal verdient.
Nur war das, was mit uns passiert war, kein Film. Es war Realität. Bittere Realität. Das Blut war echt. Die Messer waren aus Stahl und albtraumhaft scharf. Und die, die gestorben waren, hatten es ganz bestimmt nicht verdient.
Wir drei aber hatten irgendwie lauter geschrien, waren schneller gerannt, hatten härter gekämpft. Wir hatten überlebt.
Ich weiß nicht, wer Lisa Milner den Spitznamen als Erstes verpasste. Wahrscheinlich eine Zeitung im Mittleren Westen, dort, wo sie lebte. Ein Journalist, der mal besonders kreativ über die Studentinnenmorde schreiben wollte. Und das kam dann dabei heraus. Der Name war flapsig-morbide genug für das Internet, das sich sofort daraufstürzte – all diese neuen Nachrichtenseiten, die um Aufmerksamkeit buhlten. Die Printmedien sprangen natürlich auf den Zug auf. Zuerst die Boulevardblätter, dann die seriösen Tageszeitungen, schließlich die Zeitschriften.
Binnen Tagen war die Transformation vollzogen. Lisa Milner war nicht mehr einfach nur Überlebende eines Massakers. Sie war ein Final Girl, quasi direkt einem Horrorfilm entsprungen.
Das Gleiche passierte vier Jahre später mit Samantha Boyd und dann, nochmals acht Jahre später, mit mir. Sicher gab es dazwischen andere Blutbäder, aber keines davon erregte die Gemüter so sehr wie in unserem Fall. Weil wir drei aus unerfindlichen Gründen als Einzige überlebt hatten. Drei hübsche junge Mädchen in Angst und Blut. Jede von uns wurde zu etwas Einzigartigem, Exotischem stilisiert. Wie ein prächtiger Vogel, der nur alle paar Jahre sein Gefieder spreizt. Oder wie diese Blume, die nach vergammeltem Fleisch stinkt, wenn sie erblüht.
Die Art der Aufmerksamkeit, die mir in den Monaten nach Pine Cottage zuteilwurde, war warmherzig bis bizarr. Manchmal auch beides zugleich, wie im Fall des Briefes, den ich von einem älteren kinderlosen Paar erhielt. Sie boten mir an, meine Studiengebühren zu bezahlen. Ich lehnte freundlich dankend ab. Danach hörte ich nie wieder etwas von ihnen.
Andere Briefe waren verstörender. Unzählige Male wurde ich von einsamen Gruftis oder Häftlingen angeschrieben, die sich mit mir treffen, mich heiraten oder mich in ihren tätowierten Armen halten wollten. Ein Automechaniker aus Nevada bot an, mich in seinem Keller einzuschließen, um mich vor weiterem Unheil zu bewahren. Seine unschuldige Naivität war verblüffend, als glaubte er wirklich, mich gefangen zu halten sei die wohltätigste Sache der Welt.
Und dann war da der Brief, in dem es hieß, auch ich müsse sterben. Es sei meine Bestimmung, abgeschlachtet zu werden. Der war anonym. Ich gab ihn Coop – nur für alle Fälle.
Ich werde zunehmend kribbelig. Das liegt am Zucker und dem Xanax, die wie die neueste Clubdroge wirken. Coop spürt die Veränderung und sagt: »Ich weiß, das ist ziemlich viel auf einmal.«
Ich nicke.
»Willst du raus hier?«
Ich nicke noch einmal.
»Dann lass uns gehen.«
Während ich aufstehe, beschäftigt sich das Au-pair wieder betont mit dem Kleinkind und schaut krampfhaft nicht in meine Richtung. Vielleicht erkennt sie mich und fühlt sich deshalb unbehaglich. Es wäre nicht das erste Mal, dass so was passiert.
Als ich zwei Schritte hinter Coop an ihr vorbeigehe, schnappe ich mir unbemerkt ihr iPhone vom Tisch.
Noch ehe ich aus der Tür bin, steckt es tief in meiner Tasche.
Coop begleitet mich nach Hause. Er läuft schräg vor mir, wie ein Agent des Secret Service. Wir halten beide Ausschau nach Journalisten. Noch ist keiner zu sehen.
Vor dem rotbraunen Vordach meines Hauses bleibt Coop stehen. Es ist ein Wohnkomplex aus der Vorkriegszeit, elegant und geräumig. Meine Nachbarn sind blauhaarige Damen und gepflegte schwule ältere Herren. Coop fragt sich mit Sicherheit jedes Mal, wenn er hier ist, wie sich eine Backbloggerin und ein Pflichtverteidiger die Miete für eine Wohnung in der Upper West Side leisten können.
Tatsache ist, wir können es nicht. Nicht von Jeffs lächerlichem Gehalt und ganz sicher nicht von dem Geld, das meine Website einbringt.
Die Wohnung ist auf mich eingetragen. Sie gehört mir. Das Kapital dafür entstammt einer ganzen Reihe von Klagen, die nach Pine Cottage eingereicht wurden. Angeführt von Janelles Stiefvater verklagten die Eltern der Opfer so ziemlich alle und jeden. Die psychiatrische Klinik, aus der Er ausbrechen konnte. Seine Ärzte. Die Hersteller der vielen Antidepressiva und Antipsychotika, die in Seinem Gehirn kollidiert waren. Sogar die Firma, von der die Tür mit dem defekten Schloss stammte, durch die Er entkommen war.
Alle Fälle wurden außergerichtlich geklärt. Die Beklagten wussten nur zu gut, dass ein paar Millionen Dollar nichts waren gegen die schlechte Publicity, die ihnen ein Prozess gegen trauernde Familien einbringen würde. Aber trotz des Vergleichs konnten sich nicht alle retten. Eines der Antipsychotika wurde in der Folge vom Markt genommen. Und die psychiatrische Klinik, Blackthorn Psychiatrics, schloss ihre defekten Türen ein Jahr danach für immer.
Die Einzigen, bei denen nichts zu holen war, waren Seine Eltern, die für Seine Behandlungskosten aufgekommen und pleite waren. Ich hatte damit kein Problem. Meinetwegen musste das völlig verstörte Ehepaar nicht auch noch für Seine Sünden bezahlen. Außerdem war mein Anteil an den Schadensersatzgeldern hoch genug. Ein Freund meines Vaters aus der Finanzbranche half mir, einen Großteil des Geldes zu investieren, als die Aktien noch günstig waren. Die Wohnung kaufte ich mir direkt nach dem Studium, als gerade die große Immobilienblase geplatzt war. Zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche mit Frühstücksecke, wo ich inzwischen meinen improvisierten Arbeitsplatz eingerichtet habe. Und das alles für einen Appel und ein Ei.
»Willst du mit raufkommen?«, frage ich. »Du hast die Wohnung noch nie gesehen.«
»Vielleicht ein andermal.«
Noch ein Spruch, der zu unserem Ritual gehört.
»Du willst gehen, nehme ich an?«
»Die Fahrt ist lang. Du kommst klar?«
»Ja«, sage ich. »Sobald der Schock sich gelegt hat.«
»Ruf mich an oder schreib, falls was ist.«
Das nun meint er wirklich so. Seit dem Morgen nach Pine Cottage war Coop stets bereit, alles stehen und liegen zu lassen, wenn ich ihn brauchte. Seit jenem Morgen, an dem ich in tiefsten körperlichen und seelischen Qualen gewimmert hatte: Wo ist der Polizist? Bitte, der Polizist soll kommen! Eine halbe Stunde später war er da.
Zehn Jahre danach ist er immer noch da. Nickt mir zum Abschied zu. Nachdem ich das Nicken erwidert habe, verbirgt Coop seine hellblauen Augen hinter einer Ray-Ban-Brille und geht. Bald hat die Menge der Fußgänger ihn verschluckt.
In meiner Wohnung angelangt, marschiere ich sofort in die Küche und nehme noch ein Xanax. Die Traubenschorle, die darauf folgt, ist so süß, dass mir die Zähne wehtun. Trotzdem trinke ich noch ein paar kleine Schlucke. Dabei ziehe ich das gestohlene iPhone aus der Tasche. Nach einer kurzen Überprüfung weiß ich, dass die vorige Besitzerin Kim heißt und ihr Eigentum in keiner Weise gesichert hat. Ich kann jedes Telefonat, den Suchverlauf im Internet und jede Textnachricht sehen, einschließlich derjenigen, die eben erst von einem markigen Kerl namens Zach kam.
Lust auf bisschen Spaß heute Nacht?
Ich mache mir den Scherz und schreibe zurück: Immer doch.
Das Handy vibriert. Zachs Antwort. Es ist ein Foto seines besten Stücks.
Wie charmant.
Ich schalte das Handy aus. Eine Vorsichtsmaßnahme. Kim mag mir ähnlich sehen, aber unsere Klingeltöne sind völlig verschieden. Dann drehe ich es um, betrachte die silberne, von Fingerabdrücken verschmierte Rückseite. Ich poliere sie, bis ich mein Gesicht darin erkennen kann, schief wie in einem Zerrspiegel auf dem Jahrmarkt.
Genau das, was ich gebraucht habe.
Ich taste nach der Goldkette, die ich um den Hals trage. Daran hängt der kleine Schlüssel zu der einzigen Küchenschublade, die ich immer verschlossen halte. Jeff glaubt, darin befände sich wichtiger Papierkram für die Website. Ich lasse ihn in dem Glauben.
Die Schublade ist voll klimpernder, glänzender metallener Gegenstände. Eine blitzende Lippenstifthülle, ein dickes Goldarmband. Mehrere Löffel. Eine silberne Puderdose, die ich aus dem Schwesternzimmer mitgehen ließ, als ich nach Pine Cottage aus der Klinik entlassen wurde. Während der langen Heimfahrt starrte ich immer wieder mein Spiegelbild darin an, um sicherzugehen, dass ich noch da war. Auch jetzt betrachte ich all meine verzerrten Spiegelbilder und verspüre dieselbe Bestätigung.
Ja, es gibt mich noch.
Ich lege das iPhone zu den anderen Sachen, verschließe die Schublade und lege mir die Kette wieder um.
Mein Geheimnis, warm an mein Brustbein geschmiegt.
3
Den Nachmittag verbringe ich damit, die unfertigen Cupcakes zu ignorieren. Es ist, als starrten sie die ganze Zeit zu mir herüber und flehten mich an, sie ebenso gut zu behandeln wie die beiden, die bereits verziert sind und eine Armlänge entfernt stehen, überheblich in ihrer Vollkommenheit. Ich weiß, ich sollte mein Backwerk vollenden, und sei es nur aus therapeutischen Gründen. Das ist schließlich mein erstes Gebot – Backen ist besser als Therapie.
Normalerweise glaube ich daran. Backen ergibt einen Sinn. Was Lisa Milner tat, ergibt keinen Sinn.
Aber meine Stimmung ist so düster, dass ich weiß: Nicht einmal Backen wird dagegen helfen. Stattdessen gehe ich ins Wohnzimmer, lasse meine Finger über ungelesene Ausgaben des New Yorker und der heutigen Times gleiten und tue so, als wüsste ich nicht ganz genau, wo das enden wird. Und genau da endet es auch. Am Bücherregal neben dem Fenster, wo ich auf einen Stuhl steige und ein Buch aus dem obersten Fach ziehe.
Lisas Buch.
Sie schrieb es ein Jahr nach ihrer Begegnung mit Stephen Leibman. Der Titel – bitterer Hohn im Nachhinein – lautet: Der Wille zum Leben: Mein persönlicher Weg vom Schmerz zur Heilung. Es wurde ein kleinerer Bestseller. Der Sender Lifetime verfilmte ihn sogar.
Gleich nach Pine Cottage schickte Lisa mir ein signiertes Exemplar mit der Widmung: Für Quincy, meine strahlende Überlebensschwester. Wenn du reden willst, ich bin für dich da. Darunter ihre Telefonnummer in sauberen, eckigen Ziffern.
Ich hatte nicht vor, sie anzurufen. Ich sagte mir, dass ich ihre Hilfe nicht brauchte. Wozu auch, wenn ich mich doch an nichts erinnern konnte?
Aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass jede Zeitung und jeder Fernsehsender im Land ausführlich über das Pine-Cottage-Massaker berichten würden. So wurde es getauft: Pine-Cottage-Massaker. Auch wenn das »Cottage« eher eine Waldhütte gewesen war. Es war eine gute Schlagzeile. Außerdem war Pine Cottage der offizielle Name der Hütte, eingebrannt in ein Brett über der Tür wie bei einem Pfadfinderlager.
Außer zu den Beerdigungen ging ich in der Zeit nicht unter Menschen. Das Haus verließ ich nur zu Arztterminen oder Therapiesitzungen. Weil der Rasen vor dem Haus zu einer Art Reporter-Flüchtlingscamp geworden war, musste meine Mutter mich zur Hintertür hinaus und durch den Nachbargarten zum Auto lotsen, das einen Block entfernt geparkt war. Dadurch konnten wir allerdings nicht verhindern, dass mein Highschool-Abschlussfoto auf der Titelseite der People landete, die Worte »einzige Überlebende« gleich unter meinem von Akne gezeichneten Kinn.
Alle wollten ein Exklusivinterview. Ich bekam Anrufe, Mails, Textnachrichten. Eine bekannte Reporterin – der Ekel verbietet mir, ihren Namen auszusprechen – hämmerte gegen die Wohnungstür, während ich drinnen saß, den Rücken gegen das vibrierende Holz gepresst. Bevor sie ging, schob sie einen handgeschriebenen Zettel unter der Tür hindurch, der mir hunderttausend für ein persönliches Interview versprach. Das Papier roch nach Chanel Nr. 5. Ich warf es in den Mülleimer.
Obwohl ich seelisch gebrochen und meine Wunden noch frisch waren, war mir klar, was passieren würde. Die Presse war entschlossen, mich zu einem Final Girl zu machen.
Vielleicht wäre ich damals besser damit klargekommen, wenn meine familiäre Situation auch nur annähernd stabil gewesen wäre. Aber das war sie nicht.
Bei meinem Vater war der Krebs mit aller Macht wieder ausgebrochen, und infolge der Chemo war er zu angeschlagen, um mir wirklich Trost zu spenden. Trotzdem versuchte er es. Nachdem er mich schon einmal beinahe verloren hatte, erklärte er mein Wohlergehen zum obersten Gebot. Er vergewisserte sich, dass ich aß, schlief, mich nicht in meiner Trauer vergrub. Er wollte einfach, dass es mir gut ging, obwohl das auf ihn selbst ganz offensichtlich nicht zutraf. Gegen Ende schien es mir beinahe, als hätte ich Pine Cottage nur deshalb überlebt, weil mein Vater einen Pakt mit Gott geschlossen hatte: sein Leben gegen das meine.
Ich nehme an, meine Mutter empfand ähnlich wie er, aber meine Angst und meine Schuldgefühle waren zu groß, als dass ich zu fragen gewagt hätte. Nicht dass sie mir viel Gelegenheit dazu gegeben hätte. Sie war in den Verzweifelte-Hausfrau-Modus verfallen, entschlossen, um jeden Preis den Schein zu wahren. Sie hatte sich eingeredet, dass die Küche dringend renoviert werden musste, als könnte neues Linoleum den Doppelschlag von Krebs und Pine Cottage abschwächen. Wenn sie nicht grimmig meinen Vater oder mich zu unseren diversen Terminen fuhr, verglich sie Arbeitsplatten und Wandfarben. Ganz zu schweigen von ihrem straffen Vorstadtprogramm bestehend aus Spinning-Gruppen und Lesezirkeln. Schon eine einzige dieser sozialen Verpflichtungen auszulassen wäre für meine Mutter einer Niederlage gleichgekommen.
Da meine patchouliduftende Therapeutin meinte, ich bräuchte jemanden, der mich auffangen könnte, suchte ich mir diesen in Coop. Er tat, was er konnte – mehr als einmal ertrug er einen spätnächtlichen Anruf von mir. Aber ich hatte zunehmend das Bedürfnis, mich mit jemandem auszutauschen, der Ähnliches durchgemacht hatte wie ich. Lisa schien die ideale Ansprechpartnerin zu sein.
Statt sich vom Ort ihres Traumas zu flüchten, war Lisa in Indiana geblieben. Nach sechs Monaten Genesungszeit war sie an ihr altes College zurückgekehrt und hatte ihr Kinderpsychologie-Studium abgeschlossen. Bei der Diplomfeier erhielt sie stehenden Applaus vom Publikum. Eine Kompanie Medienvertreter, die sich hinten im Hörsaal aufgebaut hatte, hielt den Moment in einem Blitzlichtgewitter fest.
Ich las also ihr Buch. Fand ihre Telefonnummer. Und rief an.
Ich will dir helfen, Quincy, sagte sie zu mir. Ich will dir beibringen, ein Final Girl zu sein.
Und wenn ich kein Final Girl sein will?
Du hast gar keine Wahl. Du bist eines, ob du willst oder nicht. Du kannst das, was geschehen ist, nicht ändern. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist, wie du damit umgehst.
Für Lisa bedeutete das, sich der Sache zu stellen. Sie schlug mir vor, ein paar ausgewählten Journalisten Interviews zu geben, zu meinen Bedingungen. Sie meinte, öffentlich darüber zu sprechen könne mir dabei helfen, die Geschehnisse zu verarbeiten.
Ich folgte ihrem Rat und gab drei Interviews: der New York Times, der Newsweek und Miss Chanel Nr. 5, die mir tatsächlich die hunderttausend zahlte, obwohl ich gar nicht darum bat. Das Geld half mir sehr beim Wohnungskauf. Aber wer glaubt, ich hätte kein schlechtes Gewissen dabei gehabt, sollte noch mal gründlich nachdenken.
Die Interviews waren eine Qual. Es fühlte sich falsch an, über meine toten Freunde zu sprechen, die selbst nichts mehr dazu sagen konnten, vor allem, da ich mich nicht erinnern konnte, was eigentlich mit ihnen geschehen war. Ich war eine ebenso ahnungslose Zuschauerin wie die Leute, die meine Interviews so gierig verschlangen wie Konfekt.
Nach jedem der drei Gespräche fühlte ich mich so hohl und leer, dass nichts Essbares mich erfüllen konnte. Irgendwann versuchte ich es gar nicht mehr und landete ein halbes Jahr, nachdem ich es verlassen hatte, wieder im Krankenhaus. Das war, als mein Vater den Kampf gegen den Krebs bereits verloren hatte und nur noch auf den Tod wartete. Trotzdem war er Tag für Tag an meiner Seite. Zittrig, im Rollstuhl, löffelte er Eiscreme in mich hinein, um die bitteren Antidepressiva hinunterzuspülen, die man mich zwang zu nehmen.
Ein Löffelchen voll Zucker, Quinn, sagte er. Das Lied weiß, wovon es spricht.
Als mein Appetit zurück war und ich entlassen wurde, wurde ich aus heiterem Himmel von der Oprah-Winfrey-Show angerufen. Der Produzent am Telefon sagte, Oprah wolle uns alle drei in der Show haben – Lisa, mich und sogar Samantha Boyd. Die drei Final Girls, endlich vereint. Lisa sagte natürlich zu. Samantha, die sich bereits rar zu machen begann, völlig überraschend auch. Anders als Lisa hatte sie nie versucht, mich zu kontaktieren. Sie war so nichtexistent wie meine Erinnerungen.
Ich willigte ebenfalls ein, obwohl ich bei dem Gedanken daran, wie all die Hausfrauen im Publikum vor Mitleid mit mir zerfließen würden, fast wieder ins Kaninchenloch der Anorexie fiel. Aber ich wollte meine Leidensgenossinnen persönlich treffen. Vor allem Samantha. Ich wollte wissen, wie die Alternative zu Lisas ermüdender Offenheit aussah.
Es wurde nichts daraus.
An dem Morgen, an dem meine Mutter und ich nach Chicago fliegen sollten, kam ich in ihrer frisch renovierten Küche zu mir. Sie war völlig verwüstet – der Boden übersät mit zerbrochenen Tellern, aus dem offen stehenden Kühlschrank tropfte Orangensaft, die Arbeitsflächen waren ein Trümmerfeld aus Eierschalen, Mehlklumpen und Ölpfützen in Vanilleextrakt. Auf dem Boden inmitten des Chaos saß meine Mutter und weinte um die Tochter, die neben ihr stand und doch unwiederbringlich verloren war.
Warum, Quincy?, stöhnte sie. Warum hast du das getan?
Denn natürlich war ich es gewesen, die die Küche von unten nach oben gekehrt hatte wie ein achtloser Einbrecher. Das wusste ich, kaum dass ich das Chaos sah. Die Zerstörung hatte System. Das war so hundertprozentig ich. Aber ich erinnerte mich nicht daran, es getan zu haben. Die Minuten, in denen ich hier gewütet hatte, waren ebenso ausgelöscht wie die Stunde in Pine Cottage.
Das wollte ich nicht, versicherte ich. Ich weiß nicht, was mit mir los war, ehrlich.
Meine Mutter tat, als glaubte sie mir. Sie stand auf, wischte sich die Wangen ab, brachte vorsichtig ihr Haar in Ordnung. Aber ein dunkles Zucken in ihren Augen verriet ihre wahren Gefühle. Ich erkannte: Sie hatte Angst vor mir.
Während ich die Küche putzte, rief meine Mutter bei der Show an und sagte ab. Und da die Prämisse gewesen war: wir alle oder keine, war das Ganze damit gestorben. Es würde kein Treffen der drei Final Girls im Fernsehen geben.
Später an jenem Tag verfrachtete meine Mutter mich zu einem Arzt, der mir im Prinzip lebenslang Xanax verschrieb. Sie war so scharf darauf, mich bedröhnt zu wissen, dass sie mich zwang, gleich auf dem Parkplatz vor der Apotheke eine Pille zu schlucken. Ich spülte sie mit der einzigen im Auto befindlichen Flüssigkeit herunter – einer Flasche lauwarmer Traubenschorle.
Es reicht, sagte sie. Keine Blackouts und keine Tobsuchtsanfälle mehr. Und kein Opfergetue. Du nimmst jetzt diese Pillen und bist normal, Quincy. So, wie es sein muss.
Ich willigte ein. Ich wollte nicht, dass bei meiner Collegeabschlussfeier ein Bataillon Reporter anwesend war. Ich wollte kein Buch schreiben, kein Interview mehr geben oder öffentlich gestehen, dass meine Narben noch immer kribbelten, wenn ein Gewitter aufzog. Ich wollte keines dieser Mädchen sein, das für immer mit seiner Tragödie verbunden blieb, für immer mit dem schrecklichsten Moment seines Lebens assoziiert wurde.
Noch flatterig von meinem ersten Xanax rief ich Lisa an und erklärte ihr, ich würde von nun an nicht mehr an die Öffentlichkeit treten. Ich würde kein ewiges Opfer sein.
Ich bin kein Final Girl, sagte ich zu ihr.
Lisa antwortete mit Engelsgeduld, was mich zur Weißglut brachte: Was bist du sonst, Quincy?
Normal.
Für Mädchen wie dich und mich und Samantha gibt es kein normal, sagte sie. Aber ich kann verstehen, warum du es probieren willst.
Sie wünschte mir alles Gute und betonte, sie sei für mich da, wenn ich sie je bräuchte. Wir sprachen nie wieder miteinander.
Jetzt starre ich das Gesicht an, das mir vom Titel ihres Buchs entgegenblickt. Das Foto ist gut. Natürlich ein bisschen bearbeitet, aber nicht kitschig. Freundliche Augen. Kleine Nase. Das Kinn vielleicht etwas zu breit und die Stirn einen Tick zu hoch. Keine klassische Schönheit, aber hübsch.
Sie lächelt nicht. Es ist nicht die Art von Buch, das dem Leser ein Lächeln gewährt. Ihre Lippen liegen genau richtig aufeinander. Nicht zu fröhlich. Nicht zu streng. Perfekt ausbalanciert zwischen Ernst und Selbstzufriedenheit. Ich stelle mir vor, wie Lisa diesen Gesichtsausdruck vor einem Spiegel geübt hat.
Der Gedanke macht mich traurig.
Dann sehe ich sie in der Badewanne vor mir, mit dem Messer in der Hand. Eine noch schlimmere Vorstellung.
Das Messer.
Das ist es, was ich nicht verstehe. Noch weniger als den Selbstmord an sich. Shit happens. Das Leben kann beschissen sein. Manchmal kommt jemand damit nicht klar und zieht den Schlussstrich. So traurig es ist, das passiert ständig. Sogar Menschen wie Lisa.
Aber dass sie ein Messer gewählt hat. Nicht etwa eine Dose Pillen mit einer Flasche Wodka dazu (meine erste Wahl, wenn es jemals dazu käme). Nicht das weiche, tödliche Versinken in Kohlenmonoxid (Option Nummer zwei). Lisa beschloss, ihr Leben auf genau die Art zu beenden, wie es Jahrzehnte zuvor schon einmal fast geendet hätte. Sie zog sich die Klinge absichtlich über die Handgelenke, nur ja tief genug, um das Werk zu beenden, das Stephen Leibman begonnen hatte.
Ich frage mich, was gewesen wäre, wenn sie und ich in Kontakt geblieben wären. Vielleicht hätten wir uns doch einmal persönlich getroffen. Vielleicht hätten wir uns angefreundet.
Vielleicht hätte ich sie retten können.
Ich gehe zurück in die Küche und klappe den Laptop auf, den ich hauptsächlich für Blogangelegenheiten verwende. Eine kurze Google-Suche nach Lisa Milner zeigt mir, dass die Nachricht von ihrem Tod noch nicht im Internet angekommen ist. Das wird sie aber. Die große Unbekannte ist, wie sehr sich das auf mein eigenes Leben auswirken wird.
Ein paar Klicks später bin ich auf Facebook, dem zähen Sumpf aus Likes, Links und horrender Grammatik. Ich persönlich benutze die sozialen Medien nicht. Kein Twitter, kein Instagram. Vor Jahren hatte ich einmal eine private Facebook-Seite, habe sie aber gelöscht, nachdem ich zu viele Mitleids-Follower und Freundschaftsanfragen von Typen bekam, die auf Final Girls standen. Für meine Website unterhalte ich noch eine – ein notwendiges Übel. Darüber komme ich problemlos auf Lisas Seite: Sie war schließlich Followerin von Quincy’s Sweets.
Lisas Seite ist bereits zu einem virtuellen Kondolenzbord geworden, voller Beileidsbekundungen, die sie nie lesen wird. Ich scrolle mich durch Dutzende davon, die meisten einfallslos, aber von Herzen.
Du wirst uns fehlen, Lisa Pisa! XOXO
Ich werde dein wunderhübsches Lächeln und deine herzensgute Art nie vergessen.
Ruhe in Frieden, Lisa.
Die anrührendste kommt von einem rehäugigen braunhaarigen Mädchen namens Jade.
Dass du es geschafft hast, den schlimmsten Moment deines Lebens zu überwinden, hat mich ermutigt, auch meinen zu überwinden. Du wirst mich auf ewig inspirieren, Lisa. Nun, da du oben im Himmel bei den Engeln bist, wach bitte über uns hier unten.
Unter den vielen, vielen Fotos, die Lisa über die Jahre auf ihrer Pinnwand gepostet hat, finde ich auch eins von Jade. Es wurde vor drei Monaten aufgenommen. Die beiden posieren Wange an Wange, offenbar in einem Freizeitpark, mit dem Zickzackgerüst einer hölzernen Achterbahn im Hintergrund. Im Arm hält Lisa einen riesigen Teddybären.
Keine Frage, das Lächeln der beiden ist echt. Einen so fröhlichen Ausdruck kann man nicht vortäuschen. Ich weiß, wovon ich spreche, ich hab’s versucht. Aber beide umgibt eine Aura des Verlusts. Das sehe ich ihren Augen an. Auch in Fotos von mir schleicht sich immer diese unfassbare Traurigkeit. Letztes Weihnachten, als Jeff und ich meine Mutter in Pennsylvania besuchten, machten wir ein Gruppenfoto vor dem Weihnachtsbaum, wie eine echte, funktionierende Familie. Später, als wir die Bilder am Computer anschauten, hielt meine Mutter mein verkrampftes Grinsen für eine Grimasse und fragte: Hätte es dich denn umgebracht, mal zu lächeln, Quincy?
Ich stöbere eine halbe Stunde lang in Lisas Fotos herum. Sie geben Einblick in ein Leben, das sich völlig von meinem unterscheidet. Lisa hat zwar nie geheiratet und eine Familie gegründet, aber sie schien ein erfülltes Leben zu führen, umgeben von vielen Menschen – Verwandte, Freunde, Mädchen wie Jade, die einfach jemanden brauchten, der nett zu ihnen war. Hätte ich es zugelassen, hätte ich eine davon sein können.
Stattdessen hatte ich das Gegenteil getan. Die Leute stets auf sicheren Abstand gehalten. Sie wenn nötig weggestoßen. Nähe war ein Luxus, den zu verlieren ich mir nicht noch einmal leisten konnte.
Beim Betrachten versetze ich mich in jedes von Lisas Fotos hinein. Hier stehe ich mit ihr vor dem Grand Canyon. Hier wischen wir uns vor den Niagarafällen den Sprühnebel von den Gesichtern. Da sind wir mitten in einer Gruppe von Frauen, die in einer Bowlingbahn cancanmäßig die Beine in die Luft werfen. Coole Bowling-Bande!, lautet die Unterschrift.
Ein Foto betrachte ich länger. Lisa hat es erst vor drei Wochen veröffentlicht. Ein Selfie, aufgenommen mit gestrecktem Arm schräg von oben. Lisa hält eine Weinflasche hoch, der Raum, in dem sie sich befindet, könnte ein holzgetäfeltes Wohnzimmer sein. Darunter hat sie geschrieben: Jetzt ein Schluck Wein! LOL!
Hinter ihr ist ein Mädchen zu erkennen, oder besser: ein Ausschnitt von ihr. Er erinnert mich an diese angeblichen Fotos von Bigfoot, die manchmal in kitschigen Sendungen über paranormale Phänomene gezeigt werden. Ein unscharfer schwarzer Haarschopf, von der Kamera abgewandt.
Auch ohne ihr Gesicht zu sehen, fühle ich mich diesem namenlosen Mädchen verbunden. Genauso habe ich mich von Lisa abgewandt, mich allein in den Hintergrund zurückgezogen.
Als verwischter Fleck. Als dunkler Schatten ohne Konturen.
PINE COTTAGE 15:37 Uhr
Als Quincy den Namen der Waldhütte zum ersten Mal hörte, musste sie sofort an Märchen denken.
Er klang so niedlich. Pine Cottage, Kiefernhäuschen. Da wurden Bilder von Zwergen und Prinzessinnen wach und von Waldwichteln, die eifrig im Haushalt halfen. Aber als Craigs SUV über den Schotterweg holperte und die Hütte in Sicht kam, erkannte Quincy, dass die Fantasie mit ihr durchgegangen war. Die Wirklichkeit war viel prosaischer.
Von außen wirkte die Hütte plump, robust und nüchtern. Nicht viel kunstvoller als das, was Kinder aus Bauklötzen bauen. Sie kauerte inmitten eines kleinen Kiefernhains, dessen Kronen das Dach überschatteten und sie kleiner aussehen ließen, als sie war. Dicht an dicht, die Zweige ineinander verschränkt, umringten die Bäume das Gebäude wie eine Mauer, dahinter weitere Bäume, verschmolzen zu stummer Schwärze.
Ein finsterer Wald. Da war es, Quincys Märchen, wenn auch mehr Brüder Grimm als Disney. Als sie ausstieg und in das verfilzte Dickicht spähte, lief ihr ein ungebetener Schauder über den Rücken. »So sieht’s also mitten im Nirgendwo aus. Schon ein bisschen gruselig.«
»Hasenfuß«, sagte Janelle, die sich mit ihrem Gepäck zu Quincy gesellte – sie schleppte nicht nur einen, sondern gleich zwei schwere Koffer.
»Packesel«, spöttelte Quincy.
Janelle streckte ihr die Zunge heraus und verharrte so, bis Quincy kapierte, dass das eine Aufforderung an sie war, die Kamera zu nehmen und das Bild für die Nachwelt festzuhalten. Pflichtbewusst befreite sie ihre neue Nikon aus ihrer Tasche und schoss ein paar Fotos. Auch dann noch, als Janelle die Pose aufgab und sich abmühte, mit ihren dünnen Armen die beiden Koffer anzuheben.
»Quin-ciiie«, sagte sie in diesem Singsangton, den Quincy nur zu gut kannte. »Hilfst du mir mit denen? Bitte?«
Quincy hängte sich die Kamera um den Hals. »Nö. Du hast all das Zeug eingepackt. Wahrscheinlich brauchst du nicht mal die Hälfte davon.«
»Ich bin auf alles vorbereitet. Heißt das nicht bei den Pfadfindern so?«
»Allzeit bereit«, gab Craig zurück, der mit einer Kühlbox auf den breiten Schultern an ihnen vorbeiging. »Und ich hoffe, du hast neben all dem Kram auch den Schlüssel zu der Hütte eingepackt.«
Janelle ließ ihre Koffer stehen und tastete in ihren Jeanstaschen nach dem Schlüssel. Dann lief sie zur Eingangstür und gab dem Zedernholzschild mit dem Namen der Hütte einen Klaps. »Gruppenfoto?«, schlug sie vor.
Quincy aktivierte den Selbstauslöser der Kamera und positionierte sie auf der Motorhaube des SUV. Dann eilte sie zu den anderen vor die Hütte. Grinsend verharrten sie alle sechs, bis es klickte. Die East Hall Crew, wie Janelle sie in der Studienorientierungswoche getauft hatte. Und auch jetzt noch, zwei Monate nach Beginn des zweiten Studienjahrs, hielten sie zusammen wie Pech und Schwefel.
Nach der Fotosession schloss Janelle feierlich die Tür auf. »Und, was meint ihr? Gemütlich, was?«, fragte sie, kaum dass sich die Tür knarrend geöffnet und die anderen auch nur eine Sekunde Zeit gehabt hatten, das Hausinnere zu mustern.
Quincy stimmte ihr zu, auch wenn Bärenfelle an der Wand und ein abgewetzter Läufer auf dem Boden eigentlich nicht ihrer Vorstellung von Gemütlichkeit entsprachen. Sie hätte das Ambiente als »rustikal« beschrieben – oder auch »rostikal«, denn nicht nur das Spülbecken war voller Rostflecken, auch die Wasserhähne im einzigen Badezimmer spuckten erst einmal braun gefärbtes Wasser aus.
Aber eines musste man ihr lassen: Für eine Waldhütte war sie erstaunlich geräumig. Vier Schlafzimmer. Nach hinten heraus eine Terrasse mit Holzboden, die beim Betreten nur ganz leicht schwankte. Ein riesiger Wohnbereich mit einem Kamin aus Naturstein, schon dieser etwa so groß wie das Wohnheimzimmer, das Janelle und Quincy sich teilten, daneben sauber aufgestapeltes Feuerholz.
Die Hütte – beziehungsweise das gesamte Wochenende – war Janelles Geburtstagsgeschenk von ihrer Mom und ihrem Stiefvater. Die beiden gaben sich Mühe, coole Eltern zu sein, die ihre Kinder wie Freunde behandelten. Die sich sagten, dass ihre Tochter während der Collegezeit sowieso trinken und Drogen nehmen würde, also konnten sie ihr auch eine Hütte in den Pocono Mountains mieten, wo sie all das in relativer Sicherheit tun konnte. Achtundvierzig Stunden ohne Studentenbetreuer, Mensaessen und Studienausweise, die an jeder Tür und jedem Aufzug durch den Schlitz gezogen werden mussten.
Aber bevor es losgehen konnte, sammelte Janelle alle Handys in einer kleinen Holzkiste ein. »Keine Anrufe, kein Herumgedaddel und erst recht keine Fotos oder Videos«, sagte sie und schob die Kiste ins Handschuhfach des SUV.
»Und meine Kamera?«, fragte Quincy.
»Die ist erlaubt. Aber von mir darfst du nur schmeichelhafte Bilder machen.«
»Klar doch.«
»Ich mein’s ernst. Wenn ich was Peinliches von diesem Wochenende auf Facebook sehe, wirst du von mir entfreundet! Virtuell und real.«
Und dann stürzten sich auf ihr Kommando hin alle auf die Schlafzimmer, um möglichst das schönste zu ergattern. Amy und Rodney sicherten sich den Raum mit dem Wasserbett, das wild wabbelte, als sie sich zu zweit daraufwarfen. Betz, die keinen Freund hatte, den sie hätte mitbringen können, nahm pflichtschuldig das Zimmer mit dem Etagenbett und knallte sich gleich mit ihrem lexikondicken Harry Potter und die Heiligtümer des Todes in die untere Koje. Quincy zog Janelle in das Zimmer mit den beiden Einzelbetten links und rechts an der Wand, genau wie in ihrem Wohnheimzimmer.
»Ganz wie zu Hause«, sagte sie. »Oder zumindest fast.«
»Nett«, sagte Janelle. In Quincys Ohren klang es unecht. »Aber ich weiß nicht.«
»Wir können auch ein anderes nehmen. Es ist dein Geburtstag. Du hast die erste Wahl.«
»Stimmt. Und ich beschließe«, sie packte Quincy an den Schultern und zerrte sie von der unebenen Matratze herunter, »dass ich allein schlafen will.«
Sie steuerte Quincy in den Flur und auf das Zimmer an dessen Ende zu. Es war das größte und besaß einen Erker mit herrlichem Panoramablick auf den Wald. An den Wänden hingen einige Patchworkdecken, ein fröhliches, heimeliges Kaleidoskop aus Farben. Und da, auf dem Rand des großen Doppelbetts, saß Craig. Mit gesenktem Kopf starrte er den Boden zwischen seinen Converse-beschuhten Füßen an, die Hände im Schoß gefaltet, die Daumen rieben rastlos aneinander. Als Quincy eintrat, sah er auf, und in sein scheues Lächeln trat etwas Hoffnungsvolles.
»Das sieht doch viel gemütlicher aus«, sagte Janelle augenzwinkernd. »Viel Spaß euch beiden.« Mit einem kleinen Hüftstoß beförderte sie Quincy weiter ins Zimmer hinein. Dann schlüpfte sie hinaus und schloss die Tür hinter sich. Im Flur entfernte sich ihr Kichern.
»Das war ihre Idee«, sagte Craig.
»Hab ich schon vermutet.«
»Wir müssen nicht …« Er verstummte. Quincy musste sich den Rest denken. Das Zimmer teilen? Miteinander schlafen, wie Janelle es so ausdrücklich geplant hatte?
»Ist schon okay«, sagte sie.
»Quinn, wirklich. Wenn du noch nicht bereit bist.«
Quincy setzte sich neben ihn und legte die Hand auf sein bebendes Knie. Craig Anderson, der angehende Basketballstar. Braunhaarig, grünäugig, lässig, sexy. Von all den Mädchen auf dem Campus hatte er sie ausgesucht.
»Ist schon okay«, sagte sie noch einmal und meinte es so ernst, wie man es als Neunzehnjährige vor ihrem ersten Mal nur meinen konnte. »Ich find’s schön.«
4
Jeff findet mich auf dem Sofa vor, Lisas Buch auf dem Schoß und mit geröteten Augen. Ich habe den ganzen Nachmittag geweint. Als er seinen Koffer fallen lässt und mich in die Arme zieht, schmiege ich den Kopf an seine Brust und weine noch ein bisschen mehr. Nach zwei Jahren des Zusammenlebens und zwei Jahren fester Beziehung davor weiß er, dass er nicht sofort fragen sollte, was los ist. Er lässt mich einfach weinen.
Erst als sein Kragen von Tränen durchweicht ist, sage ich: »Lisa Milner hat Selbstmord begangen.«
Jeffs Umarmung wird noch fester. »Die Lisa Milner?«
»Genau die.«
Mehr muss ich nicht sagen. Den Rest begreift er auch so.
»Oh Quinn. Liebes. Es tut mir so leid. Wann? Was ist passiert?«
Wir setzen uns wieder aufs Sofa, und ich erzähle Jeff, was ich weiß. Er hört sehr aufmerksam zu – eine Begleiterscheinung seines Jobs, in dem er als Erstes sämtliche Informationen aufnehmen muss, um sie dann zu strukturieren.
»Wie geht es dir jetzt?«, fragt er, als ich fertig bin.
»Gut«, sage ich. »Ich bin nur geschockt. Und ich trauere. Ist wahrscheinlich dämlich.«
»Nein. Du hast jedes Recht zu trauern.«
»Ja? Lisa und ich haben uns niemals getroffen.«
»Das ist egal. Ihr habt euch ausgetauscht. Sie hat dir geholfen. Ihr wart verwandte Seelen.«
»Wir waren beide Gewaltopfer«, sage ich. »Das ist das Einzige, was uns verbunden hat.«
»Du musst es nicht herunterspielen, Quinn. Nicht vor mir.«
Da spricht der Pflichtverteidiger. Jeff verfällt immer dann in Anwaltssprache, wenn er nicht meiner Meinung ist, was nicht oft vorkommt. Normalerweise ist er einfach Jeff, der Freund, der kein Problem damit hat, zu kuscheln. Der viel besser kocht als ich und der in den Anzügen, die er bei Gericht trägt, einen absolut umwerfenden Hintern hat.
»Weder ich noch sonst jemand kann auch nur annähernd nachvollziehen, was du damals durchgemacht hast«, sagt er. »Das können nur Lisa und diese andere.«
»Samantha.«
»Samantha«, wiederholt Jeff zerstreut, als hätte er den Namen die ganze Zeit gewusst. »Ich bin sicher, ihr geht es genauso wie dir.«