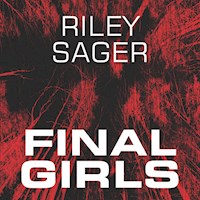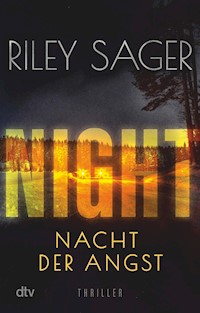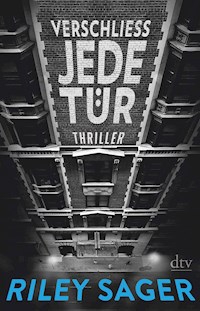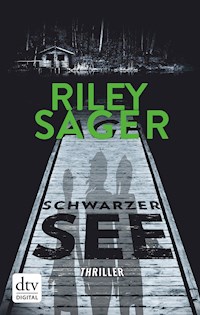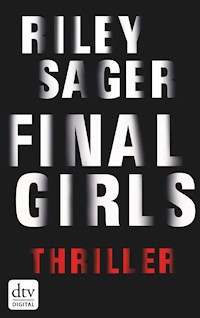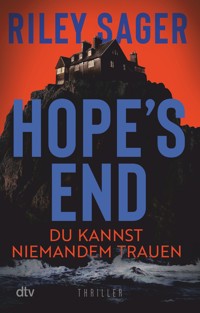
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine grausame Familientragödie, ein blutiges Geheimnis Der neue packende Psychothriller von Riley Sager 1929 erschüttert eine schreckliche Bluttat ganz Maine. Die 17-jährige Lenora Hope wird verdächtigt, ihre Eltern und ihre Schwester grausam ermordet zu haben. Sie streitet die Tat jedoch vehement ab. Erst als fast fünfzig Jahre später die junge Pflegerin Kit nach Hope's End, den Familiensitz und Schauplatz der Tragödie, kommt, scheint sich das Geheimnis um die grausamen Morde zu lüften. Denn Lenora Hope, die nach einem Schlaganfall nur noch mithilfe einer Schreibmaschine kommunizieren kann, will Kit die ganze Geschichte erzählen. Doch Kit begreift schnell, dass sie niemandem trauen kann. Und schon bald weiß sie, dass sie in tödlicher Gefahr ist … - Ein altes Herrenhaus, ein ungeklärtes Verbrechen, eine tödliche Gefahr: Riley Sager at his best - Die blutige Geschichte des alten Famlienanwesens Hope's End droht sich fünfzig Jahre später zu wiederholen: bester Psychothrill - Ein Lesevergnügen voller unerwarteter Twists - atmosphärisch, düster, packend Ebenfalls von Riley Sager bei dtv erschienen sind die Thriller ›NIGHT – Nacht der Angst‹, ›HOME – Haus der bösen Schatten‹, ›Verschließ jede Tür‹, ›Schwarzer See‹ und ›Final Girls‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
ich will ihnen alles erzählen
dinge die ich noch nie jemandem erzählt habe
ja über diese nacht
weil ich ihnen vertraue
Schreckliche Geschichten ranken sich um die betagte Lenora Hope, die zurückgezogen in ihrem einsamen Herrenhaus lebt. Sie soll vor vielen Jahren ihre gesamte Familie grausam ermordet haben und niemand weiß, was in jener Nacht wirklich geschehen ist. Aber nun will Lenora ihrer jungen Pflegerin Kit alles erzählen. Doch die Enthüllung des dunklen Geheimnisses scheint neue Schrecken heraufzubeschwören und auch Kit gerät in tödliche Gefahr …
Von Riley Sager sind bei dtv außerdem erschienen:
Final Girls
Schwarzer See
Verschließ jede Tür
HOME – Haus der bösen Schatten
NIGHT – Nacht der Angst
Riley Sager
Hope’s End
Du kannst niemandem trauen
THRILLER
Deutsch von Christine Blum
Meiner Familie
Wir sind wieder an der Schreibmaschine, Lenora im Rollstuhl, ich stehe daneben und lege ihre linke Hand auf die Tastatur. Eine neue Seite ist eingespannt. Die beschriebene von gestern Abend liegt offen auf dem Tisch, gewissermaßen die Teildokumentation unserer letzten Unterhaltung.
ich will ihnen alles erzählen
dinge die ich noch nie jemandem erzählt habe
ja über diese nacht
weil ich ihnen vertraue
Ich hingegen vertraue Lenora nicht.
Nicht ganz.
Sie ist kaum in der Lage, eigenständig zu handeln, und wird doch so vieler Dinge beschuldigt. Ich bin hin- und hergerissen, möchte sie beschützen, und gleichzeitig verdächtige ich sie.
Aber wenn sie mir alles erzählen will, bin ich bereit zuzuhören.
Obwohl es vermutlich Lügen sein werden.
Oder – noch schlimmer – die ganze entsetzliche Wahrheit.
Die Finger ihrer linken Hand trommeln auf die Tasten, sie will endlich anfangen. Ich hole tief Luft, nicke und helfe ihr, den ersten Satz zu tippen.
Woran ich mich am lebhaftesten erinnere
Am lebhaftesten erinnere ich mich daran, als es fast vorüber war. Ich habe heute noch Albträume davon.
Ich erinnere mich, wie es stürmte, als ich auf die Terrasse hinaustrat. Heulend fegte der Wind vom Meer her über die Klippen und warf sich gegen mich. Ich taumelte rückwärts; es war, als stieße mich eine unsichtbare Menschenmenge zurück zum Haus.
Dem letzten Ort, wo ich jetzt sein wollte.
Keuchend gewann ich wieder festen Stand und begann mich über die regennasse glitschige Terrasse zu kämpfen. Es goss in Strömen, die Tropfen waren eisig und fühlten sich wie Nadelstiche an. Rasch wich die Betäubung von mir, in der ich mich befunden hatte, und auf einmal wurden mir Dinge bewusst.
Dass mein Nachthemd blutbefleckt war.
Dass meine Hände warm und klebrig von Blut waren.
Dass ich noch immer das Messer umklammerte.
Auch daran war Blut gewesen, doch der kalte Regen wusch es bereits ab.
Ich kämpfte weiter gegen den Wind an, schnappte jedes Mal nach Luft, wenn scharfe Tropfen auf mich einprasselten. Vor mir lag der sturmgepeitschte Ozean, warf sich gischtend gegen die Felswand zwanzig Meter tiefer. Nur die niedrige Marmorbrüstung der Terrasse trennte mich von dem finsteren Abgrund.
Als ich sie erreicht hatte und mich dagegenlehnte, entfuhr mir ein wilder, erstickter Laut. Halb Lachen, halb Schluchzen.
Das Leben, das ich bis vor wenigen Stunden gelebt hatte, war unwiederbringlich verloren.
Meine Eltern. Auch unwiederbringlich verloren.
Trotzdem empfand ich Erleichterung.
Ich wusste, bald würde ich von allem frei sein.
Ich drehte mich zum Haus um. Die Fenster waren hell erleuchtet, das Gebäude strahlte wie die Kerzen, die acht Monate zuvor meine mehrstöckige Geburtstagstorte geziert hatten. Hübsch sah es aus. Elegant. All der Reichtum, der hinter den makellos geputzten Fensterscheiben glänzte.
Doch ich wusste, wie sehr der Schein trügen kann.
Und dass mit der richtigen Beleuchtung selbst ein Gefängnis hübsch aussehen kann.
Drinnen hörte ich meine Schwester schreien. Voller Entsetzen und Qual, anschwellend und wieder verebbend wie eine Sirene. Schreie, wie sie zu hören sind, wenn etwas absolut Grauenhaftes geschehen ist.
Und so war es auch.
Ich sah auf das Messer in meiner Hand hinab, das nun blitzblank war. Ich wusste, ich könnte damit zustechen. Ein letztes Mal.
Ich brachte es nicht über mich. Stattdessen warf ich es über die Brüstung und sah zu, wie es in der tosenden Brandung weit unten versank.
Unter den anhaltenden Schreien meiner Schwester verließ ich die Terrasse und ging zu den Garagen, um ein Seil zu suchen.
So weit meine Erinnerungen – und wovon ich geträumt hatte, als ich Sie weckte. Ich war so verängstigt, weil es sich anfühlte, als geschähe all das noch einmal.
Aber das ist nicht, was Sie eigentlich wissen wollen, oder?
Sie wollen wissen, ob ich der Unmensch bin, für den man mich hält.
Die Antwort ist nein.
Und ja.
Eins
Die Geschäftsstelle liegt an der Hauptstraße, zwischen einem Schönheitssalon und einem Schaufenster, das mir im Nachhinein geradezu prophetisch erscheint. Als ich zu meinem Vorstellungsgespräch hier war, gehörte es zu einem Reisebüro und war mit Plakaten dekoriert, die Sommer, Sonne, Weite und Freiheit versprachen. Bei meinem letzten Besuch, als man mir mitteilte, dass ich vom Dienst suspendiert war, war es leer und dunkel. Jetzt, sechs Monate später, ist dahinter ein Aerobic-Studio. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat.
Mr. Gurlain erwartet mich an seinem Schreibtisch. Er steht ganz hinten im Raum, der unverkennbar für den Einzelhandel ausgelegt ist. Ohne Regale, Waren und Kasse wirkt er als Büro für eine Person viel zu groß und kahl. Das Geräusch, mit dem die Tür hinter mir ins Schloss fällt, hallt unnatürlich laut durch die Leere.
»Hallo, Kit«, sagt Mr. Gurlain in viel freundlicherem Ton als bei meinem letzten Besuch. »Schön, Sie wiederzusehen.«
»Gleichfalls.« Eine geheuchelte Floskel. Ich habe mich in Mr. Gurlains Gegenwart nie richtig wohlgefühlt. Lang, dünn und ein wenig raubvogelhaft, könnte er auch Chef eines Bestattungsunternehmens sein. Nicht ganz unpassend – üblicherweise ist das für die Klienten seiner Agentur ja der nächste Schritt.
Gurlain’s Home Health Aides ist auf langfristige häusliche Vierundzwanzig-Stunden-Pflege spezialisiert – einer der wenigen Pflegedienste in Maine, der so etwas anbietet. An den Wänden der Geschäftsstelle hängen Poster von lächelnden Krankenschwestern, auch wenn die meisten der Angestellten – wie ich auch – rechtlich gesehen gar keine sind.
»Sie werden ab jetzt in der häuslichen Betreuung eingesetzt«, hatte mir Mr. Gurlain bei jenem schicksalhaften Vorstellungsgespräch gesagt. »Sie sind also nicht nur Pflegekraft.Sie betreuen eine Person in allen Belangen.«
An einer Tafel hinter Mr. Gurlains Schreibtisch stehen die Namen aller in der Agentur beschäftigten Pflegekräfte, danach sortiert, wer gerade beim Patienten und wer verfügbar ist. Früher stand da auch mein Name, immer in der Spalte »im Einsatz«. Darauf war ich stolz. Wenn ich gefragt wurde, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiente, imitierte ich Mr. Gurlain, so gut ich konnte, und antwortete: »Ich bin in der häuslichen Pflege tätig.« Das klang ehrenwert. Bewundernswert. Man betrachtete mich daraufhin mit mehr Respekt, und ich hatte das Gefühl, endlich einen Sinn im Leben gefunden zu haben.
Als eigentlich intelligente, aber alles andere als strebsame Schülerin hatte ich die Highschool mehr schlecht als recht hinter mich gebracht und nach meinem Abschluss keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen sollte.
»Du kannst doch gut mit Menschen«, sagte meine Mutter, nachdem ich die Stelle in einem Schreibbüro verloren hatte. »Versuch’s doch mal in einem Pflegeberuf.«
Aber um qualifizierte Kranken- oder Altenpflegerin zu werden, hätte ich eine lange Ausbildung machen müssen.
Also machte ich das Nächstbeste.
Bis ich etwas falsch machte.
Und jetzt sitze ich hier, bang, aufgeregt und müde. So müde.
»Wie geht’s, Kit?«, fragt Mr. Gurlain. »Ich hoffe, Sie haben Ihre kleine Auszeit genossen und sind frisch und erholt – es gibt ja nichts Besseres, um den Kopf frei zu bekommen.«
Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Fühle ich mich nach sechs Monaten unbezahlten Zwangsurlaubs erholt? Macht es den Kopf frei, wenn man wieder in seinem alten Kinderzimmer schlafen und auf Zehenspitzen um seinen schweigenden, grollenden Vater herumschleichen muss, dessen Enttäuschung über die Tochter jedes Zusammensein überschattet? Habe ich all die Befragungen genossen – von der Agentur, der Gesundheitsbehörde, der Polizei? Die Antwort auf alles ist: Nein.
Das gebe ich Mr. Gurlain gegenüber natürlich nicht zu. »Ja«, sage ich nur.
»Wundervoll«, erwidert er. »Nun, jetzt liegt diese dumme Sache hinter uns. Zeit für einen Neuanfang!«
Ich bin verärgert. Dumme Sache. Als wäre alles nur ein kleines Missverständnis gewesen. Tatsächlich bin ich seit zwölf Jahren bei der Agentur. War immer stolz auf meine Arbeit. Und gut darin. Ich habe gewissenhaft für meine Klienten gesorgt. Doch kaum lief etwas schief, wurde ich wie eine Verbrecherin behandelt. Zwar wurde ich letztlich von jeder Schuld freigesprochen und darf wieder arbeiten, aber die ganze Tortur hat mich wütend und bitter gemacht. Vor allem Mr. Gurlain gegenüber.
Eigentlich wollte ich gar nicht wieder zu der Agentur zurück. Aber meine Suche nach einem anderen Job entpuppte sich als kompletter Reinfall. Ich habe Dutzende Bewerbungsunterlagen eingereicht für Jobs, die ich eigentlich gar nicht wollte. Trotzdem war ich jedes Mal am Boden zerstört, wenn es nicht einmal zum Vorstellungsgespräch kam. Regale auffüllen im Supermarkt. Kassiererin in einer Drogerie. An der Theke im neuen McDonald’s mit dem Spielplatz draußen am Highway. Momentan ist Gurlain’s Home Health Aides meine einzige Option. Und sosehr mir Mr. Gurlain zuwider ist, arbeitslos zu sein ist noch schlimmer.
Ich versuche, es so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. »Sie haben einen Einsatz für mich?«
»So ist es. Die Klientin hatte vor Jahren eine Reihe von Schlaganfällen und benötigt in jeder Hinsicht Unterstützung. Bislang hatte sie eine Pflegerin auf privater Basis, aber die hat plötzlich gekündigt.«
»Hilfe in jeder Hinsicht heißt …«
»Ja, Sie würden mit im Haus wohnen.«
Ich nicke, um mein Erstaunen zu verbergen. Ich hatte erwartet, dass mich Mr. Gurlain zunächst an der kurzen Leine halten und mir so eine Acht-Stunden-Sache zuteilen würde, bei der man tagsüber jemandem Gesellschaft leistet. Das hingegen klingt wie eine reguläre Pflegestelle.
»Kost und Logis sind natürlich enthalten«, fährt Mr. Gurlain fort. »Aber Sie müssen vierundzwanzig Stunden am Tag zur Verfügung stehen und jede Abwesenheit mit der Dame absprechen. Sind Sie interessiert?«
Natürlich bin ich interessiert. Aber hundert verschiedene Fragen halten mich davon ab, sofort Ja zu sagen. Ich fange mit einer einfachen, aber wichtigen an. »Wann würde ich anfangen?«
»Sofort. Und wie lange Sie dort sein werden, nun, wenn alles zufriedenstellend läuft, sehe ich keinen Grund, warum Sie nicht bleiben könnten, bis Sie nicht mehr gebraucht werden.«
In anderen Worten, bis die Klientin stirbt. Das ist die grausame Wahrheit an diesem Job: Er ist immer auf Zeit.
»Und wo ist der Einsatzort?« Ich hoffe, es ist irgendwo weit draußen im Hinterland von Maine. Je weiter weg, desto besser.
Mr. Gurlain macht meine Hoffnung sogleich zunichte. »Am Stadtrand.« Und lässt sie wieder aufleben, als er hinzufügt: »Auf der Steilküste.«
Die Steilküste. Wo sich aberwitzig reiche Leute in prächtigen Bastionen auf zerklüfteten Felsklippen hoch über dem Meer verschanzen. Meine Hände verkrampfen sich, die Fingernägel bohren sich in die Handflächen. Das hätte ich nicht erwartet. Eine Chance, augenblicklich aus dem schäbigen Ranchhaus meiner Kindheit in eine Villa auf der Steilküste zu ziehen? Klingt zu gut, um wahr zu sein. Es muss einen Haken geben. So einen Job gibt doch niemand auf, es sei denn, er hat ein massives Problem.
»Warum hat die bisherige Pflegekraft gekündigt?«
»Das weiß ich nicht«, sagt Mr. Gurlain. »Mir wurde nur gesagt, dass es nicht einfach ist, einen passenden Ersatz zu finden.«
»Ist die Klientin …« Ich verstumme. Schwierig, hätte ich gern gefragt. Aber das kann ich nicht sagen. »… gibt es besondere Ansprüche an die Betreuung?«
»Ich glaube, das Problem ist nicht die Betreuung an sich, auch wenn diese sicherlich anspruchsvoll ist. Offen gesagt ist es eher der Ruf der Klientin.«
Ich setze mich zurecht. »Wer ist es denn?«
»Lenora Hope.«
Diesen Namen habe ich zuletzt vor zehn, eher zwanzig Jahren gehört. Ich bin baff, ein Gefühl, das mir völlig fremd ist. Doch da ist es – eine Art erschrockenes Beben in meinem Brustkorb, wie das Flattern eines gefangenen Vogels. »Die Lenora Hope?«
»Ja«, sagt Mr. Gurlain mit einem kleinen Naserümpfen, als wäre er gekränkt, auch nur im Ansatz missverstanden worden zu sein.
»Ich hatte keine Ahnung, dass sie noch lebt.« Als ich klein war, wusste ich nicht einmal, dass es sie wirklich gab. Ich dachte, Lenora Hope sei eine Art mythischer Kinderschreck. In mein Gedächtnis schleicht sich der längst vergessene Reim aus Grundschulzeiten.
Lenora Hope nahm einen Strick,
Zog ihn der Schwester ums Genick.
Wenn man alles verdunkelte, sich vor einen Spiegel stellte und ihn aufsagte, erschien manchmal Lenora darin. Das jedenfalls behaupteten einige der älteren Mädchen. Dann musste man sich vorsehen, denn das hieß, dass die eigenen Eltern und Geschwister als Nächste dran waren. Das kaufte ich den Mitschülerinnen nicht ab – der Reim war doch nur so was Ähnliches wie die Legende von »Bloody Mary«, das heißt komplett erfunden. Also gab es auch Lenora Hope nicht.
Erst in der Highschool erfuhr ich, dass ich mich irrte. Lenora Hope war nicht nur eine reale Person, sie hatte auch hier gelebt, ein reiches Mädchen aus einer feinen Villa ein Stück außerhalb der Stadt.
Bis sie mit siebzehn eines Nachts durchdrehte.
Stach mit dem Messer blutig rot
Die Mommy und den Daddy tot.
»Sie ist sehr wohl noch am Leben«, sagt Mr. Gurlain.
»Meine Güte, dann muss sie ja uralt sein.«
»Sie ist einundsiebzig.«
Kaum zu glauben. Ich hatte immer gedacht, die Morde wären im vorigen Jahrhundert passiert, zur Zeit der Krinolinen, Gaslampen und Pferdekutschen. Aber wenn Mr. Gurlains Worte stimmen, heißt das, dass das Familienmassaker an den Hopes im Prinzip noch gar nicht lange her ist.
Im Kopf rechne ich nach: vierundfünfzig Jahre. Im Jahr 1929. Mit der Jahreszahl kehrt auch der letzte Teil des Reims zurück.
»Das war ich nicht«, rief sie nachher.
Doch außer ihr lebt keiner mehr.
Und anscheinend ist das noch immer der Fall – Lenora Hope lebt. Nur etwas leidend und pflegebedürftig. Und ich soll sie pflegen und betreuen. Falls ich die Stelle haben will.
Will ich nicht. »Gäbe es nicht noch was anderes für mich? Keine anderen neuen Klienten?«
»Ich fürchte nein.«
»Und sonst ist niemand von der Agentur frei?«
»Nein, alle ausgebucht.« Mr. Gurlain legt die Fingerspitzen aneinander. »Passt Ihnen etwas an dem Einsatz nicht?«
Ganz entschieden nicht. Und zwar so einiges. Angefangen damit, dass Mr. Gurlain mich offensichtlich immer noch für schuldig hält, aber aus Mangel an Beweisen nicht einfach rausschmeißen kann. Nachdem er mich durch die Suspendierung nicht losgeworden ist, versucht er es nun damit, mir die Betreuung der hiesigen Lizzie Borden zuzuschustern. »Na ja, es ist mir nicht –« Ich suche nach Worten. »Ich wäre nicht ganz glücklich damit, jemanden zu betreuen, der so etwas getan hat.«
»Es wurde nie bewiesen, dass Lenora Hope diese Taten begangen hat«, sagt Mr. Gurlain. »Und da sie nicht für schuldig befunden wurde, muss man annehmen, dass sie unschuldig ist. Ich dachte, gerade Sie würden das sehr wohl verstehen.«
Hinter der Wand zum Aerobic-Studio setzt Musik ein. »Physical« von Olivia Newton-John. Nicht dass das Physische im Song mit Aerobics zu tun hätte, aber ich nehme an, den Hausfrauen, die dazu in ausgeleierten Sweatshirts und Stulpen um die Waden herumhüpfen, ist das egal. Denen geht es nur darum, gegen viel Geld ihren Hüft- und Bauchspeck loszuwerden. Ein Luxus, den ich mir nicht leisten könnte.
»Kit, Sie wissen doch, wie es bei uns läuft. Ich vergebe die Aufträge, und Sie als Betreuerin nehmen sie an. Wenn Ihnen das nicht recht ist, denke ich, dass sich unsere Wege hier und jetzt für immer trennen sollten.«
Das wäre mir auch am allerliebsten. Aber ich brauche dringend eine Arbeit. Egal was für eine. Ich muss anfangen, mir wieder Ersparnisse aufzubauen. Die sind zu fast nichts geschrumpft.
Und vor allen Dingen muss ich von meinem Vater wegkommen, der während der sechs Monate kaum ein Wort mit mir gesprochen hat. Der letzte vollständige Satz, den er an mich richtete, klingt mir heute noch im Ohr. Es war morgens, er saß am Küchentisch und las die Zeitung. Sein Frühstück stand unangetastet vor ihm. Dann knallte er die Zeitung auf den Tisch und zeigte auf die Schlagzeile auf der ersten Seite.
Als ich sie sah, wurde mir unwirklich zumute. Als geschähe das nicht mir, sondern einer fiktiven Version von mir in einem schlechten Film. Im Artikel war mein Schulabschlussfoto abgedruckt. Nicht das beste Bild, wie ich so bemüht lächle vor dem blauen Paravent, der in der Turnhalle aufgestellt worden war und im Schwarzweißdruck der Zeitung schmutzig grau wirkte. Und mein Haar war heute noch so fedrig dünn wie auf dem Foto. Mein erster Gedanke war, dass ich dringend eine neue Frisur brauchte.
»Das ist nicht wahr, was die schreiben, Kit-Kat«, sagte mein Vater.
Es klang wie ein Versuch, mich aufzumuntern. Aber sein bestürzter Gesichtsausdruck stand im Widerspruch dazu. Er sagte das nicht um meinetwillen, sondern um seinetwillen. Um sich selbst davon zu überzeugen, dass es nicht wahr war.
Ohne ein weiteres Wort warf mein Vater die Zeitung in den Mülleimer und verließ die Küche. Seither hat er kaum ein Wort zu mir gesagt. Jetzt denke ich an dieses angespannte, erstickende Schweigen und sage: »Ich mach’s. Ich nehme die Stelle an.«
Ich rede mir ein, dass es schon nicht so schlimm sein wird. Dass es nur vorübergehend ist. Ein paar Monate, allerhöchstens. Nur bis ich genug Geld angespart habe, um anderswohin zu ziehen. Irgendwohin, wo es besser ist. Weit weg von hier.
»Hervorragend«, sagt Mr. Gurlain ohne den geringsten Hauch von Begeisterung. »Dann sollten Sie sich dort so schnell wie möglich vorstellen.«
Er beschreibt mir den Weg zu Lenora Hopes Haus, gibt mir eine Telefonnummer, unter der ich anrufen soll, falls ich es nicht gleich finde, und bedeutet mir mit einem Nicken, dass das alles ist. Beim Gehen werfe ich einen Blick auf die Tafel hinter seinem Schreibtisch. In der Spalte der Pflegekräfte, die gerade frei sind, stehen drei Namen. Also hätte auch jemand anders zur Verfügung gestanden.
Ich weiß genau, warum Mr. Gurlain mich angelogen hat. Ich werde immer noch bestraft dafür, dass ich die Regeln gebrochen und den lupenreinen Ruf der Agentur geschädigt habe.
Doch als ich die Tür aufstoße und in die eisige Oktoberluft Maines hinaustrete, kommt mir ein anderer Grund in den Sinn, warum mir diese Stelle zugewiesen wurde. Einer, bei dem mir noch viel kälter wird.
Mr. Gurlain hat mich gewählt, weil es niemanden – nicht einmal die Polizei – sonderlich stören würde, wenn ich Lenora Hope umbrächte.
Zwei
Ich brauche keine Stunde, um meine Sachen zu packen. Ich weiß nur zu gut, dass man als Pflegekraft nicht viel braucht. Eine Arzttasche, einen Koffer, einen Karton. Mehr nicht.
In der Tasche befinden sich meine Hilfsmittel zur Patientenversorgung. Thermometer, Blutdruckmanschette, Stethoskop. Die schwarze Ledertasche haben mir meine Eltern geschenkt, als ich bei Mr. Gurlain meinen ersten Einsatz übernahm. Nach zwölf Jahren habe ich sie noch immer in Gebrauch, auch wenn der Reißverschluss klemmt und das Leder an den Kanten rissig geworden ist.
Im Koffer sind mein Kulturbeutel und meine Kleidung. Nüchterne, langweilige Hosen und Strickwesten, die vor zehn Jahren in Mode waren. Ich bin schon lange darüber hinweg, mich modisch zu kleiden. Bequem und günstig ist wichtiger.
Im Karton sind Bücher. Hauptsächlich Taschenbücher. Sie gehörten einst meiner Mutter, man sieht ihnen an, dass sie geliebt und viel gelesen wurden.
»Mit einem Buch ist man nie einsam«, sagte sie immer. »Niemals.«
Der Gedanke ist schön, aber ich weiß, dass er nicht stimmt. Ich war jetzt sechs Monate lang von Büchern umgeben und habe mich nie einsamer gefühlt.
Als alles gepackt ist, spähe ich in den Flur, um mich zu vergewissern, dass der Weg zur Hintertür frei ist. Mein Vater ist über Mittag nach Hause gekommen; das tut er manchmal, wenn er in der Nähe arbeitet. Er hat es sich mit einem Sandwich in seinem Lehnsessel im Wohnzimmer vor dem Fernseher bequem gemacht.
Im vergangenen halben Jahr haben wir unsere Vermeidungsstrategien perfektioniert. Manchmal vergingen Wochen, ohne dass wir einander zu Gesicht bekamen. Ich verbrachte die meiste Zeit in meinem Zimmer und wagte mich nur in die Küche, wenn ich mir sicher war, dass er bei der Arbeit war, schlief oder seine Freundin besuchte, von der ich eigentlich nichts wissen soll. Jedenfalls hat er sie mir nicht vorgestellt. Ich weiß nur, dass sie existiert, weil ich letzte Woche hörte, wie er sich mit einer fremden Frau im Wohnzimmer unterhielt. Am nächsten Abend stahl sich mein Vater fort wie ein Schuljunge. Entweder weil er mir gegenüber verbergen wollte, dass er sich wieder mit jemandem traf, oder weil ihm die Vorstellung, ich könnte mit der neuen Dame seines Herzens zusammentreffen, peinlich war.
Jetzt stehle ich mich auf Zehenspitzen fort. Zweimal muss ich zum Auto gehen, einmal mit der Arzttasche und dem Koffer, dann mit dem Bücherkarton. Als ich zum zweiten Mal zu meinem Ford Escort komme, lehnt Kenny am Wagen. Er hat mich wohl mit dem Koffer gesehen und ist herübergekommen, um zu fragen, was los ist. Sein Blick liegt auf dem Karton in meinen Händen. »Ziehst du aus?«
»Ja. Vorübergehend. Vielleicht auch für immer. Ich hab wieder einen Einsatz.«
»Ich dachte, du wärst gefeuert.«
»Suspendiert. Ist gerade vorbei.«
»Oh.« Kenny runzelt die Stirn. Das passiert nicht oft. Meistens schaut er einfach nur notgeil drein. »Schnelle Nummer vor der Abreise?«
Ja, das ist der Kenny, wie ich ihn kenne, seit wir im Mai etwas miteinander angefangen haben. Er ist, so wie ich bis heute, momentan arbeitslos und wohnt bei seinen Eltern. Anders als ich ist er erst zwanzig. Er ist mein kleines schmutziges Geheimnis. Oder vielleicht eher ich seines.
Es begann an einem Nachmittag, als wir beide in unserem jeweiligen Garten in der Sonne lagen, ich mit einem Sidney-Sheldon-Band, er mit einem Joint. Ein paarmal trafen sich unsere Blicke über den Rasen hinweg, dann fragte er: »Hast du heute frei?«
»Nö«, gab ich zurück. »Und du?«
»Nö.«
Dann fragte ich aus Einsamkeit und Langeweile: »Lust auf ’n Bier?«
»Klar«, sagte Kenny. Also holte ich uns ein Bier. Dabei unterhielten wir uns natürlich. Und das führte irgendwie dazu, dass wir auf dem Wohnzimmersofa herumknutschten.
»Lust auf Sex oder so?«, fragte Kenny irgendwann.
Damals war ich seit vier Wochen suspendiert und voller Selbstmitleid. Ich musterte ihn von oben bis unten. Alles in allem nicht schlecht, trotz des Schnurrbärtchens, das ihm wie eine tote Raupe unter der Nase hing. Der Rest war deutlich besser. Vor allem seine Arme, sehnig, stark und gebräunt. Es hätte schlimmer sein können, wie ich aus Erfahrung wusste.
Ich zuckte mit den Schultern. »Klar, warum nicht.«
Danach schwor ich mir, das nie wieder zu tun. Himmel noch mal, als Kenny geboren wurde, war ich elf. Ich weiß noch, wie seine Eltern mit ihm aus der Klinik kamen, meine Mutter sich begeistert über ihn beugte und mein Dad seinem Dad einen Umschlag mit einer kleinen Aufmerksamkeit in die verschwitzte Hand drückte. Aber als Kenny zwei Tage nach unserem ersten Mal an der Hintertür stand wie ein streunender Hund auf der Suche nach Essensresten, ließ ich ihn rein und nahm ihn mit in mein Zimmer.
So lief es seither ein- bis zweimal pro Woche, manchmal auch dreimal. Wir wissen beide, was Sache ist: Mit Liebe hat das nichts zu tun. Oft reden wir nicht mal miteinander. Zwar habe ich Gewissensbisse, aber ich brauchte neben dem Lesen einfach noch etwas anderes, um die langen einsamen Tage herumzubringen.
»Mein Dad ist zu Hause«, sage ich zu Kenny. »Und meine neue Patientin wartet.«
Wer sie ist, erwähne ich nicht. Ich habe Angst, was er dann von mir denken könnte.
Kenny bemüht sich nicht, seine Enttäuschung zu verbergen. »Okay, verstehe. Dann sieht man sich wohl.«
Ich schaue ihm nach, wie er zu seinem Haus zurücktrottet. Als er hineingeht, ohne sich noch einmal nach mir umzudrehen, gibt mir das einen kleinen Stich. Nicht unbedingt Trauer, aber nahe daran. Es war vielleicht nur Sex, und es war nur Kenny, aber immerhin war es etwas, und er war jemand.
Jetzt ist da nichts und niemand mehr.
Ich verstaue den Karton im Kofferraum und gehe ein letztes Mal ins Haus. Mein Vater sitzt immer noch im Wohnzimmer und schaut die Mittagsnachrichten, weil das meine Mutter immer tat. Eine alte Gewohnheit, und bei Pat McDeere sitzen Gewohnheiten tief. Auf dem Bildschirm ist Präsident Reagan zu sehen, der eine Rede zur wirtschaftlichen Lage hält, hinter ihm züchtig und aufrecht »Just Say No«-Nancy. Mein Vater, der Politiker egal welcher Couleur nicht leiden kann, schnaubt verächtlich. »Red keinen Scheiß, Ronnie«, brummt er, den Mund voller Sandwich. »Mach endlich mal was, was für Leute wie mich gut ist.«
Ich bin in der Tür stehen geblieben und räuspere mich jetzt. »Dad? Ich wollte mich verabschieden.«
»Oh.« Er klingt nicht überrascht. Wenn überhaupt, klingt er erleichtert.
»Ich hab wieder einen Einsatz«, füge ich hinzu, als von ihm keine Frage kommt. »Schlaganfallpatientin. Wohnt auf der Steilküste.« Das sage ich in der Hoffnung, dass es ihn vielleicht beeindruckt oder wenigstens aufhorchen lässt. Immerhin gibt es reiche Leute, die mir so weit vertrauen, dass sie eine pflegebedürftige Person in meine Obhut geben.
Falls dem so ist, lässt er es sich nicht anmerken. »Aha«, sagt er nur.
Ich weiß, dass ich den Namen meiner neuen Patientin verraten müsste, um die Aufmerksamkeit meines Vaters zu bekommen. Wie bei Kenny liegt mir der Gedanke fern. Wenn er wüsste, dass ich Lenora Hope betreuen werde, würde er noch weniger von mir halten. Falls das überhaupt möglich ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich jetzt schon erbärmlich findet.
»Brauchst du noch was, bevor ich gehe?«, frage ich stattdessen.
Mein Vater nimmt noch einen Bissen von dem Sandwich und schüttelt den Kopf. Ich verspüre wieder diesen Stich, jetzt stärker. So stark, dass ich das Gefühl habe, von meinem Herz bräche etwas ab und stürzte in die Magengrube.
»Ich versuche, so alle zwei Wochen mal bei dir vorbeizuschauen.«
»Brauchst du nicht«, sagt mein Vater.
Und das ist alles.
Ich bleibe noch einen Moment auf der Türschwelle stehen – warte, hoffe, flehe ihn stumm an, noch etwas zu sagen. Irgendwas. Tschüs. Auf Nimmerwiedersehen. Hau ab. Nur nicht dieses feindselige Schweigen, bei dem ich mich fühle wie ein Nichts. Nein, schlimmer.
Unsichtbar.
So fühle ich mich.
Dann gehe ich, ohne mir die Mühe zu machen, Adieu zu sagen.
Ich will nicht, dass darauf wieder nur Schweigen folgt.
Drei
Zu den dröhnenden Klängen von Duran Duran aus meinem lausigen Autoradio fahre ich an der Felsküste entlang, immer weiter bergauf, bis der Escort aus dem letzten Loch pfeift. Die raue See unter mir erscheint mittlerweile nur noch als verschwommener weißer Schleier, der sich auf den Sandstreifen in der Tiefe legt. Im Rückspiegel macht sich die Wohngegend breit, die als »die Steilküste« bekannt ist. Sie erstrahlt förmlich im Glanz vererbten Reichtums: protzige Villen, die sich wie die Vogelnester an die zerklüfteten Felsen klammern, halb verborgen hinter Backsteinmauern und wucherndem Efeu.
Wie die andere Hälfte lebt.
So hätte meine Mutter diese Felsenburgen mit ihren Türmchen, Aussichtsplattformen und Erkern hoch über dem Atlantik kommentiert.
Da muss ich widersprechen. Selbst von den oberen Zehntausend können es sich nur die wenigsten leisten, auf der Steilküste zu wohnen. Die Gegend hier war schon immer sehr exklusiv und wird es wohl immer bleiben. Hier wohnt die Crème de la Crème, hoch über allen und allem anderen, als hätte Gott persönlich ihr diesen Platz zugewiesen.
»Und jetzt kommst du dorthin, Kit-Kat«, hätte meine Mutter gesagt. »In einem solchen Haus wirst du arbeiten.«
Wieder müsste ich widersprechen. Vor mir liegt alles andere als ein Traumziel.
Hope’s End.
Ein wahrhaft apokalyptischer Name für ein Anwesen. Vor allem wenn man bedenkt, was dort geschehen ist.
Drei Familienmitglieder in einer Oktobernacht brutal ermordet, das vierte der Taten angeklagt. Bei dem es sich wohlgemerkt um ein siebzehnjähriges Mädchen handelte. Kein Wunder, dass ich den morbiden Reim, den ich auf dem schmuddeligen Spielplatz hinter der Grundschule kennenlernte, für frei erfunden hielt. Die Geschichte klang zu gruselig, um wahr zu sein.
Aber es ist tatsächlich passiert.
Und wurde zur Stadtlegende.
Zu etwas, worüber Kinder bei Übernachtungsbesuchen flüsternd reden und Erwachsene am liebsten gar nicht. Es gab so viele Thesen und Spekulationen, dass die Fakten über die Jahre unscharf geworden sind. Abgesehen von dem Kinderreim weiß ich kaum etwas über die Sache. Nur dass Winston Hope mit Überseehandel ein Vermögen gemacht und sich nicht in Bar Harbor oder Newport, sondern hier an der Felsküste im Norden von Maine niedergelassen hatte, wo das Land seinerzeit noch weitgehend unbesiedelt war und er sich den schönsten Seeblick aussuchen konnte. Ich weiß auch, dass er mit seiner Frau Evangeline zwei Töchter hatte, Lenora und Virginia. Und dass in jener lang zurückliegenden Nacht drei der Familienmitglieder ermordet wurden.
Lenora, die einzige Überlebende, behauptete, es nicht gewesen zu sein. Den Ermittlern erklärte sie, sie habe geschlafen. Erst nach dem Aufwachen, als sie nach unten kam und ihre toten Eltern und Schwester sah, habe sie begriffen, was geschehen war.
Keine Erklärung hatte sie dafür, wer es sonst getan haben mochte.
Oder wie.
Oder warum.
Ebenso wenig konnte sie erklären, warum sie verschont geblieben war. So richtete sich der Verdacht gegen sie; Beweise fand man allerdings nicht. Weitere Zeugen gab es auch nicht, da die Dienerschaft passenderweise ihren freien Abend hatte. In Ermangelung greifbarer Beweise wurde Lenora nie verurteilt. Doch der Kinderreim sagt alles über die öffentliche Meinung aus. Schon die erste Zeile – Lenora Hope nahm einen Strick – weist ihr eindeutig die Schuld zu.
Das wundert mich nicht. So etwas wie mutmaßliche Unschuld gibt es nicht.
Das weiß ich aus Erfahrung.
Nachdem die Stadt ihr Urteil über Lenora Hope gesprochen hatte, verkroch diese sich auf dem Anwesen ihrer Familie und ließ sich nicht mehr blicken. Dadurch schwand das Interesse an ihr jedoch keineswegs. Zu meiner Highschool-Zeit war es üblich, dass die Jungs sich gegenseitig anstachelten, sich auf das Grundstück zu schleichen und durch die Fenster zu spähen, um einen Blick auf sie zu erhaschen. Soweit ich weiß, gelang das keinem. Weshalb ich Lenora Hope widerwillig einen gewissen Respekt zollen muss. Ich wäre auch gern in der Lage, mich unsichtbar zu machen.
Vor mir werden die Klippen noch höher, die Straße steigt immer steiler an. Wieder röhrt der Escort auf. Ein Stück entfernt entdecke ich eine sonnengefleckte Mauer. So hoch, dass unmöglich zu sehen ist, was dahinter liegt, und so alt, dass die Straße ehrerbietig einen Bogen darum macht.
Langsam folge ich der Biegung. Da erblicke ich eine aufgesprühte Schrift auf der Mauer, neonblau gegen den herrschaftlichen roten Backstein. Das Graffiti bestätigt mir, dass ich richtig bin.
VERRECKDADRINLENORAHOPE
Ich starre die Worte an. Frage mich, ob ich weiterfahren oder lieber schnellstens die Flucht ergreifen soll. Die Antwort ist klar. Das Zweite kann ich mir nicht leisten.
Also fahre ich weiter, im Schritttempo auf das verschnörkelte Tor in der beschmierten Mauer zu. Dahinter durchschneidet die Zufahrt in gerader Linie eine smaragdgrüne Rasenfläche, an deren Ende das Haus der Hopes liegt.
Jetzt, da ich seiner ansichtig werde, frage ich mich, warum es je als »Haus« bezeichnet wurde.
Das ist kein Haus.
Das ist ein kleines Schloss.
Etwas, das ich zuletzt gesehen habe, als ich im Alter von vierzehn Jahren mit meinen Eltern einen Ausflug nach Bar Harbor machte. Ich weiß noch, wie mein Vater den ganzen Tag lang über die Geldscheißer murrte, die sich da ihre Paläste hingestellt hatten. Weiß der Teufel, was er zu Hope’s End sagen würde, das selbst die stattlichen Villen jener Schickimickistadt in den Schatten stellt. Es ist noch größer. Prächtiger. Es würde nahtlos in Dallas oder Dynasty oder eine andere dieser albernen Primetime-Serien passen, die meine Mutter immer schaute.
Von der Breite her erinnert es an ein Kreuzfahrtschiff, und die drei Stockwerke sind eine wahre Phantasmagorie an Verschwendung des prosperierenden späten 19. Jahrhunderts. Die Eingangstür und alle Fenster der beiden unteren aus rotem Backstein gemauerten Etagen haben Ziereinfassungen aus Marmor, die zu nichts nütze sind, außer zu zeigen, wie viel Geld die Hopes damals hatten. Es müssen Tonnen von dem Zeug sein, so überladen ist alles. Auch die Fenster im obersten Stock sind mit Marmor umrahmt, ragen aber als Gauben aus dem Dach hervor, auf dem ein Dutzend Schornsteine thront wie Kerzen auf einer reich verzierten Geburtstagstorte.
Am Tor befindet sich eine kleine Sprechanlage. Ich kurble das Fenster herunter, strecke den Arm aus und klingele. Erst nach einer Weile erwacht der Lautsprecher mit statischem Knistern zum Leben, gefolgt von einer Frauenstimme. »Ja.«
Es ist keine Frage. Vielmehr steckt in dem kleinen Wort so viel Ungeduld wie nur irgend möglich.
»Hallo. Ich bin Kit McDeere.« Ich verstumme, um der Stimme am anderen Ende die Möglichkeit zu geben, sich ebenfalls vorzustellen. Sie tut es nicht, woraufhin ich mich gezwungen fühle, hinzuzufügen: »Ich komme von Gurlain’s Home Health Aides. Ich bin die neue …«
»Kommen Sie zum Haus«, unterbricht mich die Stimme knapp. Dann herrscht wieder Stille.
Das Tor beginnt sich zu öffnen. Dabei erzittert es kurz, als fände es meine Anwesenheit unheimlich. Quietschend schwingt es weiter auf, was mich zu der Frage bringt, wie oft auf Hope’s End wohl Besuch empfangen wird. Nicht oft, beschließe ich, als das Tor auf halber Strecke rasselnd zum Stehen kommt. Vorsichtig rolle ich an und versuche abzuschätzen, wie viel Platz links und rechts des Autos bleibt. Er reicht nicht. Jedenfalls nicht, wenn ich meine Seitenspiegel behalten will, was mir doch sehr lieb wäre. In meinem derzeitigen Budget sind Autoreparaturen nicht drin.
Ich will gerade aussteigen und das Tor per Hand weiter aufschieben, da höre ich von weiter vorn eine Männerstimme: »Klemmt’s wieder?«
Mit einer Schubkarre voller Laub kommt die dazugehörige Person auf mich zu. Das Erste, was mir auffällt: Der Mann sieht gut aus. Anfang, höchstens Mitte dreißig. Sehr gut in Form, soweit ich es unter seinem Flanellhemd und den erdfleckigen Jeans erkennen kann. Vollbart und Haar, das sich im Nacken zu locken beginnt. Unter anderen Umständen wäre mein Interesse geweckt. Unter sehr anderen Umständen. Existenziell anderen. Ebenso wenig wie Autoreparaturen kann ich mir in meinem Leben romantische Verwicklungen leisten – und nein, Kenny zählt nicht.
»Ich weiß nicht, wann es schon mal geklemmt hat«, sage ich durchs offene Fenster, »aber jetzt klemmt es auf jeden Fall.«
»Nicht wann – wie oft«, erwidert der Mann mit einem reizvoll verschmitzten Lächeln. »Schon mindestens zum zehnten Mal. Es gibt hier so viel zu tun, dass ich ständig vergesse, mich darum zu kümmern. Sie sind die neue Pflegerin?«
»Betreuerin«, berichtige ich. Das ist meine Aufgabe. Pflegerin darf man sich nur mit der entsprechenden Ausbildung nennen. Betreuerin oder Pflegekraft ist man schon nach einem Grundkurs – in Maine sind hundertachtzig Stunden vorgeschrieben –, in dem die wichtigsten Kenntnisse vermittelt werden. Wie man Puls, Blutdruck, Temperatur misst, Medikamente verabreicht, einfache physiotherapeutische Übungen macht. Aber all das einem Fremden zu erklären würde unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nehmen.
»Dann machen wir das Ding doch mal so weit auf, dass Sie anfangen können.« Aus der hinteren Hosentasche zieht der Mann ein Paar Arbeitshandschuhe und streift sie sich demonstrativ über. »Sicher ist sicher. Das hab ich auf die harte Tour gelernt. Der Ort hier kann bissig sein.« Er zerrt am Tor. Es gibt ein schrilles Kreischen von sich, das ich bei einem Patienten als »gepeinigt« beschrieben hätte.
»Arbeiten Sie in Vollzeit hier?«, frage ich mit lauter Stimme, um den Lärm zu übertönen.
»Ja. Einer der wenigen, die noch da sind. Früher wimmelte es hier von Leuten, die sich um alles kümmerten. Zum Beispiel gab es einen Parkverwalter, einen Gärtner und einen Hausmeister, dazu ein paar Hilfskräfte in Teilzeit. Heute bin ich das alles in einem.«
»Und, gefällt es Ihnen?«
Der Mann ruckt ein letztes Mal am Tor. Die Einfahrt ist frei. Er dreht sich zu mir um. »Sie meinen, ob ich Angst habe.«
Ja, das meine ich. Ich hielt die Frage für ganz unschuldig, eigentlich selbstverständlich in Anbetracht dessen, was hier einst geschehen ist. Jetzt wird mir klar, dass man sie auch für unhöflich halten könnte. »Ich wollte nur –«
»Schon gut«, sagt der Mann. »Sie sind neugierig. Ich weiß, was draußen über den Ort hier geredet wird.«
»Ich nehme an, das heißt nein.«
»So ist es.« Der Mann zieht einen Handschuh ab und reicht mir die Hand. »Ich bin übrigens Carter.«
Ich schüttle seine Hand. »Kit McDeere.«
»Schön, Sie kennenzulernen, Kit. Wir sehen uns sicher gelegentlich.«
Ich fahre noch nicht los. »Danke, dass Sie mir mit dem Tor geholfen haben. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn Sie nicht zufällig vorbeigekommen wären.«
»Ach, das hätten Sie irgendwie hingekriegt.« Carter mustert mich neugierig mit zur Seite geneigtem Kopf. »Sie wirken, als würde Ihnen immer was einfallen.«
Das war einmal so. Heute nicht mehr. Einfallsreiche Leute werden nicht vom Job suspendiert, und falls doch, finden sie schnell einen neuen. Und sie wohnen mit einunddreißig nicht mehr bei den Eltern. Dennoch nehme ich das Kompliment mit einem Nicken an.
»Noch was«, sagt Carter, tritt zu mir ans Fenster und beugt sich herunter, bis wir auf Augenhöhe sind. »Vergessen Sie alles, was über Lenora Hope und die Sache hier gesagt wird. Die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Miss Hope ist völlig harmlos.«
Carter wollte mich offenbar beruhigen, aber seine Worte unterstreichen nur das Surreale an der Situation. Sicher, als ich die Geschäftsstelle verließ, wusste ich, worauf ich mich einließ. Aber es war ein abstraktes Wissen, das über dem Kofferpacken, dem unzugänglichen Verhalten meines Vaters und der Suche nach dieser Adresse in den Hintergrund getreten ist. Jetzt, da ich hier bin, trifft es mich mit voller Wucht.
Ich werde gleich eine Frau kennenlernen, die ihre ganze Familie umgebracht hat.
Angeblich umgebracht hat, rufe ich mir ins Gedächtnis. Das Verbrechen wurde Lenora nie nachgewiesen, wie Mr. Gurlain so dezent betonte. Aber wer soll es sonst gewesen sein? Außer Lenora war damals niemand im Haus, es gab keine weiteren Verdächtigen oder Überlebenden. Mir kommt die letzte Zeile des Kinderreims in den Sinn.
Doch außer ihr lebt keiner mehr.
Ein Schauder läuft mir über den Rücken. Ich fahre los, weg von Carter, auf das spektakuläre Wohnhaus zu. Doch je näher ich komme, desto mehr schwindet sein luxuriöser Glanz und die Verwahrlosung dahinter wird sichtbar.
Hope’s End eine Bruchbude.
Im ersten Stock fehlt eine Fensterscheibe; die klaffende Öffnung ist mit aufgenageltem Sperrholz verdeckt. Aus den Marmoreinfassungen um Fenster und Türen sind ganze Stücke herausgebrochen. Auf dem Dach fehlt die Hälfte der Schieferplatten, wodurch das Dach zernarbt und verbeult wirkt. Ich bin beinahe erleichtert. Was ich sehe, ist so desolat, wie ich mich fühle.
Die Zufahrt endet in einer Schleife vor dem Haus, von der wiederum eine Abzweigung zu dem geduckten Garagengebäude ein Stück neben dem Haupthaus führt. Ich zähle die Garagentore.
Es sind fünf.
Wie die oberen Zehntausend nun mal leben.
Vor dem Haus stelle ich den Motor ab, steige aus und eile die drei Stufen hinauf zur mächtigen Eingangstür. Noch bevor ich klopfen kann, werden die beiden schweren Türflügel aufgestoßen, und vor mir steht eine Frau. Ich erschrecke fast, sie so plötzlich vor mir zu sehen. Vielleicht liegt es auch nur daran, wie eintönig sie aussieht. Weißes Haar bis knapp auf die Schultern. Ein schwarzes Kleid, das eng an ihrem gertenschlanken Körper anliegt. Ein Spitzenkragen, ähnlich den Zierdeckchen, die meine Großmutter immer häkelte. Blasse Haut. Blaue Augen. Und dazu ein kühner, kirschroter Lippenstift. Ihre Erscheinung wirkt so dramatisch streng, dass ich das Alter der Frau nicht recht einschätzen kann. Müsste ich eine Zahl nennen, würde ich fünfundsiebzig sagen, aber ich kann mich in beide Richtungen um zehn Jahre irren.
An einer Kette um ihren Hals hängt eine Schmetterlingsbrille. Sie hebt sie an die Augen und mustert mich eine Sekunde lang – eine erste rasche Einschätzung. »Miss McDeere«, sagt sie. »Herzlich willkommen.«
»Vielen Dank«, sage ich, auch wenn an ihrer Aussage nicht das Geringste herzlich ist. Ihr desinteressierter Ton gehört unverkennbar zu jener Person, die über die Sprechanlage mit mir gesprochen hat.
»Ich bin Mrs. Baker, die Haushälterin.« Die Frau verstummt und betrachtet meine Kleidung genauer. Meine Jacke scheint ihr zu missfallen. Sie ist aus blauer Wolle und voller Knötchen. Ich besitze sie schon so lange, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, wann und wo ich sie gekauft habe. Aber vielleicht gilt Mrs. Bakers angewiderter Blick auch dem, was ich darunter trage. Weiße Bluse. Grauer Rock. Schwarze Ballerinaschuhe, die ich zuletzt beim Begräbnis meiner Mutter getragen habe. Wenn ja, kann ich nichts machen. Das sind die hübschesten Kleider, die ich besitze.
Nach einem Augenblick sichtlichen Zögerns fügt sie hinzu: »Kommen Sie doch rein.«
Auch ich zögere, ehe ich eintrete. Das liegt an der Tür selbst. Fast so breit wie hoch und von diesen allgegenwärtigen Marmorschnörkeln eingefasst erinnert sie irgendwie an ein offenes Maul. Ihr Anblick lässt mich an etwas denken, was Carter sagte.
Der Ort hier kann bissig sein.
Plötzlich sehne ich mich nach Zuhause. Was mich völlig überrascht, da es sich dort überhaupt nicht mehr nach Zuhause anfühlte, seit meine Mutter gestorben war. Aber früher war es einmal ein glücklicher Ort, an den ich ebenso glückliche Erinnerungen habe. Weiße Weihnachten und Geburtstagskuchen und meine Mutter, wie sie sonntagmorgens in ihrer lächerlichen geblümten Schürze French Toast macht. Gibt es auf Hope’s End so etwas wie glückliche Erinnerungen? Oder sind sie alle in jener Schreckensnacht verpufft? Ist jetzt nur noch Trübsal geblieben?
Mrs. Baker räuspert sich ungeduldig. »Kommen Sie, meine Liebe?«
Ein Teil von mir sträubt sich. Dieser Ort – so riesig, so protzig und vor allem so verschrien – weckt in mir den Drang, mich umzudrehen und schnurstracks zurück nach Hause zu fahren.
Dann aber denke ich an meinen Vater, mein Kinderzimmer, den kläglichen Rest Geld auf meinem Konto. Daran wird sich nichts ändern, wenn ich nichts dagegen tue. Wenn ich jetzt gehe – was ich liebend gern täte –, sitze ich wieder in der Sackgasse fest, in der ich schon ein halbes Jahr lang stecke. Hier zu arbeiten, und sei es nur für ein paar Wochen, könnte die entscheidende Veränderung bringen.
Mit diesem Gedanken hole ich tief Luft, trete durch die Tür und lasse zu, dass Hope’s End mich gänzlich verschluckt.
Vier
Innen ist Hope’s End hübscher als außen, wenn auch nur geringfügig. Die Eingangstür führt in ein prächtiges Foyer mit Marmorboden, Samtvorhängen und Wandteppichen. Palmen in großen Töpfen stehen hier, dazu kunstvoll geschnitzte Holzsessel mit staubigen Polstern und brokatbezogenen Zierkissen. Darüber, im Deckengewölbe, schwebt ein ölgemalter Himmel voller dicker rosa Wolken. Alles wirkt zugleich schwülstig und schäbig und aus der Zeit gefallen. Wie die Lobby eines vor Jahrzehnten überstürzt aufgegebenen Viersternehotels.
Links von mir erstreckt sich ein langer Flur mit hohen Fenstern. Er führt an einer offen stehenden Tür vorbei und knickt weiter hinten vor einer geschlossenen Doppeltür nach rechts ab. Zu meiner Rechten führt ein ebensolcher Flur geradewegs in ein sonnendurchflutetes Zimmer. Doch meine Aufmerksamkeit gilt dem Anblick vor mir. Dort führt eine imposante, mit rotem Teppich belegte Treppe hinauf in den ersten Stock. Auf einem Absatz in halber Höhe teilt sie sich in zwei symmetrisch geschwungene Aufgänge. In der Decke darüber ist ein Buntglasfenster, durch das Sonnenstrahlen in allen Farben des Regenbogens schräg auf den Teppich fallen.
»Die Haupttreppe«, sagt Mrs. Baker. »1913 mit dem Haus zusammen gebaut. Seit damals wurde an dem Haus kaum etwas verändert. Mr. Hope hat damals mit Bedacht ein zeitloses Design gewählt.«
Während sie spricht, geht sie weiter, ihre Absätze klicken wie Metronomschläge über den Marmor. Ich folge ihr, aber der Boden bringt mich etwas aus dem Takt. Er ist stellenweise uneben, als schlüge er Wellen wie der Ozean draußen.
»Ihre Sachen können Sie später hereinholen«, sagt Mrs. Baker. »Ich dachte, es wäre nett, sich erst einmal im Wintergarten zu unterhalten, da ist es heiter und gemütlich.«
Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Bisher kann ich an Hope’s End nichts Heiteres finden, nicht einmal an dem Wenigen, das tatsächlich hübsch ist. In allen Ecken scheint sich Düsternis und Verderben zu ballen und wie Spinnweben festgesetzt zu haben. Und etwas Frostiges liegt in der Luft, ein nach Salz schmeckendes ungreifbares Etwas, das mich erschauern lässt.
Ich weiß, das ist nur Einbildung. Hier sind drei Menschen gestorben – auf grausamste Art und Weise, wenn man der Legende glauben kann. Vor diesem Hintergrund kann einem der Geist durchaus Streiche spielen.
Wie um diese Erkenntnis zu untermauern, kommen wir an vier gerahmten Ölgemälden vorbei, alle genau gleich groß. Über alle ist schwarzer Stoff gespannt, nur über eines nicht. Darauf ist ein junges Mädchen im rosa Satinkleid zu sehen.
»Miss Hope«, sagt Mrs. Baker im Vorbeigehen, ohne auch nur einen Blick darauf zu werfen. »Von ihrem Vater zu ihrem Geburtstag in Auftrag gegeben.«
Anders als Mrs. Baker muss ich einfach stehen bleiben. Die Lenora auf dem Gemälde sitzt auf einem weißen Diwan, hinter ihr eine rosa gestreifte Tapete, über ihrer Schulter ist ein Stück eines Spiegels mit Goldrahmen zu sehen. Es wirkt etwas gekünstelt, wie das Mädchen sich an die Armlehne schmiegt. Ihre Hände ruhen mit ineinander gekrallten Fingern im Schoß, verraten ihre Anspannung. Der Maler hatte sich offenbar Mühe gegeben, diesen Eindruck durch eine allzu zwanglose Pose auszugleichen.
Die Blässe und zarten Gesichtszüge der Dargestellten erinnern mich an eine Knospe, die dabei ist, sich zu öffnen. Die junge Lenora hatte eine Stupsnase, volle Lippen und grüne Augen, fast so leuchtend wie das Buntglas über der Haupttreppe. Sie blickt den Maler direkt an, im Blick ein spitzbübisches Funkeln, fast als wüsste sie, was viele Jahrzehnte später über sie gemunkelt würde.
Mrs. Baker hält inne, dreht sich um und schenkt mir einen ungeduldigen Blick. »Der Wintergarten ist da vorn, Miss McDeere.«
Ich setze mich wieder in Bewegung, wobei ich noch einen letzten Blick auf Lenoras Porträt und die daneben hängenden Gemälde werfe. Der schwarze Kreppstoff, der sie bedeckt, wurde nicht etwa nur darüber gehängt, sondern straff gespannt und mit Nägeln direkt am Rahmen befestigt. Doch bei aller Mühe kann er die Bilder nicht ganz verbergen. Ganz schwach sind sie hinter dem dünnen Material zu erahnen, schemenhaft, konturlos. Wie Geister.
Winston, Evangeline und Virginia Hope.
Nur Lenora ist unverhüllt, weil sie als Einzige noch da ist.
Ich schließe zu Mrs. Baker auf und folge ihr schnellen Schrittes weiter den Flur entlang, vorbei an geschlossenen Türen, die vermuten lassen, dass dahinter verbotene Räume liegen. Bei jeder Tür erschaudere ich kurz. Nur Zugluft, sage ich mir. In so großen alten Häusern gibt es das oft.
Der Wintergarten ist zumindest heller als alles, was ich bis jetzt vom Haus gesehen habe; heiter würde ich ihn allerdings nicht nennen. Auch hier stehen wie überall muffige antike Möbel. Alles voller Samt und Stickereien und Fransen. Fluchtpunkt des Raums ist ein großer Flügel in der hinteren Ecke, mit heruntergeklapptem Deckel wie ein Sarg.
Die Muffigkeit wird etwas gelockert durch die beiden raumhohen Fensterfronten. Die eine gibt den Blick frei auf den Rasen, wo ich in der Ferne Carter beim Laubrechen erkenne. Durch die andere sieht man eine kahle Terrasse, eingefasst von einer kaum taillenhohen Brüstung. Dahinter ist nichts weiter zu sehen als blauer Himmel. Als schwebte die Villa frei in der Luft.
Mrs. Baker gewährt mir noch ein paar Sekunden des staunenden Umschauens, dann deutet sie auf ein kleines, mit rotem Samt bezogenes Sofa. »Bitte setzen Sie sich doch.«
Vorsichtig lasse ich mich auf eine Ecke des Sofas nieder, als könnte es unter mir zusammenbrechen. Das befürchte ich in der Tat. Alles auf Hope’s End wirkt so alt und wertvoll, dass ich nicht glaube, dass man es ersetzen könnte. Mrs. Baker indessen lässt sich ohne Zögern auf das Sofa mir gegenüber fallen. Dabei steigt aus dem Polster eine kleine Staubwolke auf wie ein Atompilz.
»Nun, Miss McDeere«, sagt sie. »Erzählen Sie doch ein wenig von sich.«
Ehe ich ein Wort sagen kann, platzt polternd und klappernd jemand ins Zimmer. Eine junge Frau, in der einen Hand einen Metalleimer, mit der anderen zieht sie einen Staubsauger hinter sich her. Als sie uns erblickt, erstarrt sie, was uns Gelegenheit gibt, ihren Anblick ausgiebig zu bestaunen. Sie ist höchstens zwanzig und trägt eine formelle Dienstmädchenuniform wie aus einem Schwarzweißfilm. Schwarzes knielanges Kleid. Gestärkter weißer Kragen mit nadelspitzen Ecken. Weiße Schürze, darauf ein schmutziger Streifen, wo sie sich wahrscheinlich die Hände abgewischt hat.
Der Rest hingegen ist Technicolor pur. Grellrot gefärbtes Haar mit zwei neonblauen Strähnen, die rechts und links des Gesichts baumeln wie die Tentakel eines Tintenfischs. Ebenso knallblau der bis zu den Schläfen gezogene Lidstrich. Die Lippen sind kaugummirosa, ein etwas dunkleres Rouge überzieht ihre Wangen.
»Ups, sorry!«, ruft sie und guckt mich mit großen Augen an, sichtlich überrascht, eine Fremde auf Hope’s End zu sehen. Ich nehme an, das passiert nicht oft. »Ich dachte, das Zimmer wäre leer.«
Sie macht kehrt, um zu verschwinden, wobei es wieder klappert – jetzt sehe ich, dass um ihre beiden Handgelenke haufenweise kunterbunte Plastikreifen hängen.
»Schon gut, Jessica«, sagt Mrs. Baker. »Ich hätte Ihnen Bescheid sagen sollen, dass ich das Zimmer heute Nachmittag brauche. Das ist Miss McDeere, die neue Betreuerin.«
Ich winke dem Mädchen kurz zu. »Hi.«
Sie winkt mit klappernden Armreifen zurück. »Hey, willkommen an Bord.«
»Ich wollte mich gerade etwas näher mit ihr bekannt machen«, sagt Mrs. Baker. »Vielleicht könnten Sie im Foyer weiterarbeiten. Es sieht ein wenig vernachlässigt aus.«
»Da hab ich aber gestern sauber gemacht.«
»Wollen Sie vielleicht andeuten, dass meine Augen mich getrogen haben?« Mrs. Bakers Lächeln ist so starr, dass es einem Zähnefletschen ähnelt.
Das Mädchen schüttelt den Kopf, sodass ihre großen Ohrringe schwingen. »Nein, Mrs. Baker.«
Sie macht einen Knicks, sichtlich sarkastisch, aber Mrs. Baker scheint ihn für aufrichtig zu halten. Mit einem letzten neugierigen Blick auf mich verschwindet Jessica samt Eimer, Staubsauger und klapperndem Schmuck wieder in den Flur.
»Verzeihen Sie, bitte«, sagt Mrs. Baker zu mir. »Dieser Tage ist es schwer, gute Angestellte zu finden.«
»Oh«, ist alles, was ich als Antwort zustande bringe. Bin ich nicht auch eine Angestellte? Oder sie selbst?
Sie setzt ihre Brille auf und rückt sie auf der Nasenspitze zurecht. Dann betrachtet sie mich durch die dicken Gläser. »Nun, Miss McDeere –«
»Sie können mich Kit nennen.«
»Kit.« Sie speit den Namen förmlich aus wie einen schlechten Geschmack. »Ich nehme an, das ist eine Abkürzung.«
»Ja. Von Kittredge.«
»Das ist aber ein recht ausgefallener Vorname.«
Ich verstehe, was sie meint. Ausgefallen für jemanden wie mich. »Es war der Mädchenname meiner Großmutter mütterlicherseits.«
Mrs. Baker gibt ein Geräusch von sich. Nicht ganz ein Hmmm, aber nahe daran. »Und woher kommt Ihre Familie?«
»Von hier«, sage ich.
»Können Sie das präzisieren?«
Wieder verstehe ich. Hier kann Verschiedenes bedeuten. Einmal die Villen hier oben auf den Klippen, wo das große Geld wohnt, angeführt von den Hopes. Dann alle anderen.
»Aus dem Ort.«
Mrs. Baker nickt. »Dachte ich mir.«
»Mein Vater ist Handwerker, und meine Mutter war Bibliothekarin«, füge ich hinzu in der Hoffnung, Mrs. Baker zu verdeutlichen, dass meine Eltern nicht weniger Respekt verdienen als Leute vom Schlag der Hopes.
»Interessant«, sagt Mrs. Baker in einem Ton, dem anzuhören ist, dass sie es alles andere als das findet. »Haben Sie viel Erfahrung als Pflegekraft?«
Ich spanne mich innerlich an, unsicher, wie viel sie schon weiß. »Ja. Was hat Mr. Gurlain Ihnen denn gesagt?«
»Sehr wenig. Ich wünschte, man hätte Sie mir heiß empfohlen, aber leider ist dem nicht so. Mir wurden so gut wie keine Auskünfte über Sie erteilt.«
Ich hole tief Luft. Das könnte von Vorteil sein. Vielleicht aber auch nicht. Denn es bedeutet, dass ich alles selbst erklären muss, wenn sie mich danach fragt.
Bitte nicht fragen, bete ich stumm.
»Ich arbeite seit zwölf Jahren bei Gurlain’s Home Health Aides.«
Mrs. Baker erwidert meinen Blick mit unlesbarer Miene. »Das ist ja ziemlich lange. In dieser Zeit haben Sie sicher viel gelernt.«
»Ja, natürlich.« Ich beginne aufzuzählen, worin ich mich auskenne, von simplen Aufgaben – Schonkost zubereiten, Hilfe beim Waschen, Laken wechseln, ohne dass die Person das Bett verlassen muss – bis hin zu professionellen Tätigkeiten. Vollständige Wäsche des Körpers im Bett. Katheter legen. Blut abnehmen, Insulin spritzen, Schulterblätter und Pobacken auf Dekubitus prüfen.
»Nun, da sind Sie ja praktisch eine Krankenschwester«, unterbricht Mrs. Baker, für deren Geschmack ich offenbar zu lange geredet habe. »Sind Sie mit Schlaganfallpatienten vertraut?«
»Ein bisschen.« Ich denke an Mrs. Plankers, die ich keine zwei Monate lang betreut hatte, bis ihrem armen Ehemann das Geld für eine private Kraft ausging, er seine Frau in ein staatlich finanziertes Seniorenheim gab und ich einem anderen Patienten zugeteilt wurde.
»Miss Hopes Zustand könnte Ihnen mehr Aufmerksamkeit abverlangen, als Sie es gewohnt sind«, sagt Mrs. Baker. »Als junge Frau hat sie eine Polioinfektion durchgemacht, seither ist sie nicht mehr in der Lage zu gehen. In den letzten zwanzig Jahren hatte sie zudem mehrere Schlaganfälle. Rechtsseitig ist sie ganz gelähmt, und sie kann nicht sprechen. Kopf und Hals kann sie bewegen, aber nicht immer gut kontrollieren. Tatsächlich gehorcht ihr nur der linke Arm noch weitgehend.«
Ich winkle meinen eigenen linken Arm an. Unmöglich, mir vorzustellen, ich könnte nur noch diesen einen kleinen Teil meines Körpers gebrauchen. Wenigstens weiß ich jetzt, warum sie Hope’s End nie verließ. Sie konnte gar nicht.
»Ist die vorige Pflegerin deshalb gegangen?«
»Mary?« Mrs. Baker scheint leicht irritiert – das erste Mal, dass ich ihr eine Gefühlsregung anmerke. »Nein, sie hat ihre Arbeit sehr gut gemacht und war über ein Jahr lang bei uns. Miss Hope war begeistert von ihr.«
»Warum hat sie dann so plötzlich gekündigt?«
»Ich wünschte, ich wüsste es. Sie hat weder gesagt, warum, noch, wohin sie wollte. Tatsächlich hat sie uns überhaupt nicht benachrichtigt. Sie ist einfach gegangen. Noch dazu mitten in der Nacht. Die arme Miss Hope war bis zum Morgen ganz allein, da hätte alles Mögliche passieren können. Wie Sie ja selbst sehr wohl wissen, wenn man bedenkt, was mit der letzten Person in Ihrer Obhut geschehen ist.«
Mir stockt der Atem.
Sie weiß es.
Natürlich weiß sie es.
Ich schrumpfe förmlich unter ihrem vernichtenden Blick. »Ich kann erklären, was da passiert ist.«
»Dann tun Sie es bitte.«
Beschämt blicke ich beiseite. Ich komme mir bloßgestellt vor. Nackt. Automatisch ziehe ich den Rock weiter über die Knie, versuche, so viel wie möglich von mir zu bedecken. »Ich hatte eine …« Meine Stimme bricht, obwohl ich diese Geschichte schon Dutzende Male anderen, ebenso kritischen Zuhörern erzählt habe. Polizisten. Der Staatsanwaltschaft. Mr. Gurlain. »Ich hatte eine schwer krebskranke Patientin. Magenkrebs. Viel zu spät entdeckt. Er hatte schon gestreut … so ziemlich überallhin. Zu operieren wäre chancenlos gewesen. Und eine Chemo konnte auch nicht viel ausrichten. Es blieb nichts mehr, als es ihr bis zum Ende so erträglich wie möglich zu machen. Aber die Schmerzen waren, also, wahnsinnig heftig.« Ich starre weiter in meinen Schoß, verfolge die Bewegung meiner Hände, die noch immer über meinen Rock streichen. Meine Worte jedoch sind nicht so zurückhaltend. Sie fließen immer schneller, freier, etwas, was in dem grauen Vernehmungsraum der Polizeistation nie passiert ist. Ich schiebe es darauf, dass ich in Hope’s End bin. Der Ort hier ist mit dem Tod vertraut. »Sie bekam Fentanyl verschrieben. Nur bei Bedarf, wenn unbedingt nötig. Eines Abends war es nötig. Ich hatte noch nie erlebt, dass jemand solche Schmerzen hatte. Die gehen nicht weg. Die bleiben und zermürben dich total. Ich sah ihr an, wie schrecklich sie litt. Also gab ich ihr eine Fentanyl und beobachtete die Wirkung. Die Tablette schien zu helfen, also ging ich schlafen.«
Wie jedes Mal an diesem Punkt verstumme ich. Es dauert immer einen Moment, bis ich es schaffe, mein Versagen detailliert zu schildern.
»Am nächsten Morgen wachte ich früher auf als sonst.« Ich sehe wieder den dunkelgrauen Himmel vor dem Fenster, noch durchwirkt von den letzten Spuren der Nacht. Das Zwielicht war mir damals wie ein schlechtes Omen erschienen. Mit einem Blick wusste ich, dass etwas nicht stimmte. »Ich ging sofort zu meiner Patientin und merkte, dass sie nicht ansprechbar war. Da wählte ich den Notruf. Das ist bei uns Vorschrift.« Ich überspringe, dass mir zu jenem Zeitpunkt schon klar war, dass das Zeitverschwendung war. Ich erkenne sehr gut, wenn jemand tot ist. »Während ich auf den Notarzt wartete, fiel mir die Fentanylflasche ins Auge. Bei unserer Agentur müssen wir alle Medikamente in einem verschlossenen Kästchen unter unserem Bett aufbewahren. Damit nur wir Betreuer Zugang dazu haben. Ich weiß nicht, ob ich am Vorabend zu müde gewesen war oder zu erschüttert von den Schmerzen der Frau – jedenfalls hatte ich vergessen, sie mitzunehmen.« Ich kneife die Augen zu. Versuche zu verhindern, dass ich wieder die Flasche vor mir sehe, die umgekippt neben der Nachttischlampe liegt. Es hilft nichts. Ich sehe alles. Die Flasche. Den Verschluss ein paar Zentimeter daneben. Die einsame verbliebene Tablette. Ein winziges hellblaues Scheibchen, von dem ich schon immer gefunden hatte, dass es viel zu hübsch für etwas so Gefährliches aussah. »Über Nacht hatte die Patientin alle genommen«, fahre ich fort. »Sie starb, während ich schlief. Die Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Laut der rechtsmedizinischen Untersuchung starb sie an Herzversagen durch eine Überdosis Fentanyl.«
»Glauben Sie, das war Absicht?«, fragt Mrs. Baker.
Ich öffne die Augen und sehe, dass ihre Miene etwas weniger streng geworden ist. Nicht so weit, dass man von Mitgefühl sprechen könnte. Das ist nicht ihr Stil. Was ich in den Augen der alten Dame sehe, ist komplexer. Eine Art Akzeptanz.
»Ja. Ich glaube, sie wusste genau, was sie tat.«
»Aber es hieß, Sie seien schuld.«
»Ja. Und ja, es war nachlässig von mir, die Flasche neben dem Bett zu vergessen. Da stimme ich voll zu, das habe ich immer gesagt. Aber ich wurde gleich des Schlimmsten verdächtigt und unbezahlt von der Arbeit suspendiert. Es wurde offiziell gegen mich ermittelt, mit Polizei und allem. Ein Riesenwirbel, deshalb kam das Ganze sogar in die Presse.« Ich verstumme wieder. Denke an meinen Vater mit der Zeitung vor sich auf dem Küchentisch. Wie geweitet und wässrig seine Augen waren.
Das ist nicht wahr, was die schreiben, Kit-Kat.
»Aber die Anklage wurde fallen gelassen«, fahre ich fort. »Die Sache wurde als Unfall deklariert. Jetzt ist meine Suspendierung aufgehoben, und ich bin wieder im Job. Trotzdem weiß ich, dass man alles Mögliche von mir denkt. Dass ich die Tabletten absichtlich habe stehen lassen. Oder der Patientin sogar geholfen habe, sie zu nehmen.«
»Und, haben Sie das?«
Ich starre Mrs. Baker an. Verblüfft und gekränkt. »Was ist denn das für eine Frage?«
»Eine ehrliche. Die eine ehrliche Antwort verdient, meinen Sie nicht auch?«
Sie sitzt ganz ruhig da, der Inbegriff von Geduld. Ihre Haltung ist perfekt, das kerzengerade Rückgrat meilenweit von der staubigen Lehne des Sofas entfernt. Meine Haltung ist das genaue Gegenteil: zusammengesunken, mit verschränkten Armen, niedergedrückt vom Gewicht ihrer Frage.
»Würden Sie mir denn glauben, wenn ich Nein sagte?«
»Ja.«
»Die meisten Leute glauben mir nicht.«
»Wir auf Hope’s End sind anders als die meisten Leute.« Mrs. Baker wendet sich der Fensterfront mit der Terrassenbrüstung dahinter zu. Und dem Nichts jenseits davon … diesem Abgrund, bestehend aus dem Himmel und vermutlich der See tief unten. »Hier geht man bei jungen Damen, die schrecklicher Taten beschuldigt werden, davon aus, dass sie unschuldig sind.«
Überrascht richte ich mich auf. So förmlich, wie Mrs. Baker sich gab, ging ich davon aus, dass die tragische Vergangenheit von Hope’s End tabu war.
»Tun wir doch nicht so, als wüssten Sie nicht, was hier vorgefallen ist, meine Liebe«, sagt sie. »Sie wissen es. Genau wie Sie wissen, dass jedermann Miss Hope für die Verantwortliche hält.«
»Ist sie es denn?« Diesmal überrasche ich sogar mich selbst. Normalerweise bin ich nicht so kühn. Wieder schiebe ich das auf die Umgebung. Sie fordert kühne Fragen geradezu heraus.
Mrs. Baker verzieht die Lippen, möglicherweise anerkennend, vielleicht aber auch nicht. »Würden Sie mir glauben, wenn ich Nein sagte?«
Ich schaue mich im Zimmer um, lasse den Blick über das zierliche Mobiliar, die großzügigen Fenster, den Rasen und die Terrasse mit dem unendlichen Himmel dahinter schweifen. »Da ich hier bin, muss ich davon ausgehen, dass sie unschuldig ist.«
Anscheinend ist das die richtige Antwort. Oder zumindest eine akzeptable. Denn Mrs. Baker steht auf und sagt: »Dann zeige ich Ihnen jetzt den Rest des Hauses. Und danach stelle ich Sie Miss Hope vor.«
Damit ist es besiegelt. Ich bin jetzt offiziell die neue Betreuerin von Lenora Hope.
Obwohl ich nicht ehrlich zu Mrs. Baker war.
Nicht nur, was meine damalige Patientin anging.
Sondern auch in Bezug auf Lenora Hope. Da hat sich meine Meinung nicht geändert. Ich glaube immer noch, dass sie es getan hat. Aber ich weiß, das spielt keine Rolle. Sie ist meine Patientin. Meine Aufgabe ist es, sie zu betreuen. Wenn ich die nicht erfülle, werde ich nicht bezahlt. Ganz einfach.
Wir verlassen den Wintergarten und gehen durch den Flur zurück. Als wir an den Gemälden vorbeikommen, schiele ich wieder zu dem einzigen hin, das nicht verhüllt ist.
Lenoras ölgemalte Augen scheinen uns zu folgen.
Fünf
»Aus finanziellen Gründen sind wir gezwungen, einen überschaubaren Haushalt zu führen«, sagt Mrs. Baker, als wir wieder im Foyer angekommen sind. »Die Arbeiten draußen erledigt Carter, den Sie, glaube ich, schon kennengelernt haben.«
Ich versteife mich leicht verunsichert. Woher weiß sie das? »Ja, habe ich.«
Mrs. Baker führt mich an der Haupttreppe vorbei in den Flur zum anderen Seitenflügel. »Drinnen macht Jessica sauber, und Archibald kocht.«
»Und was machen Sie?«