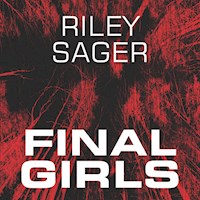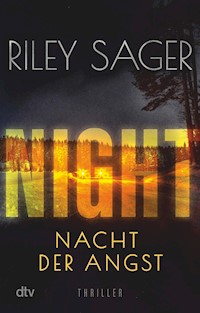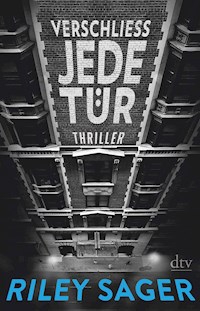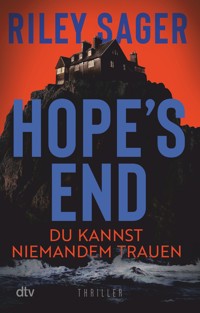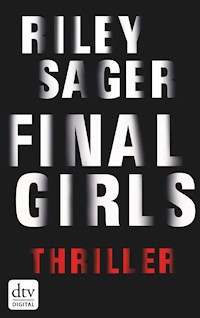Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Scharf wie ein Skalpell, schlicht genial.« A.J. Finn, Autor von ›The Woman in the Window‹ Der Lake Midnight: ein einsamer tiefer See mitten in den Wäldern Nordamerikas. Hier hat sich vor fünfzehn Jahren etwas Schreckliches ereignet, das die junge Künstlerin Emma bis heute verfolgt: Ihre drei Freundinnen verschwanden eines Nachts. Man fand bis heute keine Spur von ihnen. Jetzt kehrt Emma zurück an den Lake Midnight. Und dann scheint sich die Geschichte auf grauenvolle Weise zu wiederholen: Wieder verschwinden drei Mädchen ... »Ein fesselnder Thriller, der Gegenwart und Vergangenheit raffiniert miteinander verwebt.« Publishers Weekly Emma Davis ist 28, Künstlerin und steht am Beginn einer großen Karriere. Vor fünfzehn Jahren hat sie im Sommercamp in den Wäldern am Lake Midnight etwas Schreckliches erlebt, das sie seitdem nicht mehr loslässt: Die drei Mädchen, mit denen sie eine Hütte teilte, verschwanden eines Nachts. Trotz ausgedehnter Suchaktionen wurde keine Spur von ihnen gefunden. Jetzt, viele Jahre später, kehrt Emma an den Lake Midnight zurück, um einen Kunstkurs zu geben. Doch die Atmosphäre ist unheimlich und angespannt. Überall wird Emma mit Erinnerungen an früher konfrontiert. Und dann scheint sich die Geschichte auf schreckliche Weise zu wiederholen: Wieder verschwinden drei Mädchen spurlos. Doch Emma ist entschlossen, diesmal zu handeln. Sie wird versuchen, die drei zu finden, koste es, was es wolle. Und dazu muss sie herausfinden, was damals, vor fünfzehn Jahren, wirklich geschehen ist. Von Riley Sager sind bei dtv außerdem folgende spannende Thriller erschienen: »Final Girls« »Verschließ jede Tür« »HOME – Haus der bösen Schatten« »NIGHT – Nacht der Angst« »Hope's End«
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Emma Davis ist 28, Künstlerin und steht am Beginn einer großen Karriere. Vor fünfzehn Jahren hat sie im Sommercamp in den Wäldern am Lake Midnight etwas Schreckliches erlebt, das sie seitdem nicht mehr loslässt: Die drei Mädchen, mit denen sie eine Hütte teilte, verschwanden eines Nachts. Trotz ausgedehnter Suchaktionen wurde keine Spur von ihnen gefunden. Jetzt, viele Jahre später, kehrt Emma an den Lake Midnight zurück, um einen Kunstkurs zu geben. Doch die Atmosphäre ist unheimlich und angespannt. Überall wird Emma mit Erinnerungen an früher konfrontiert. Und dann scheint sich die Geschichte auf schreckliche Weise zu wiederholen: Wieder verschwinden drei Mädchen spurlos.
Doch Emma ist entschlossen, diesmal zu handeln. Sie wird versuchen, die drei zu finden, koste es, was es wolle. Und dazu muss sie herausfinden, was damals, vor fünfzehn Jahren, wirklich geschehen ist.
Wie immer für Mike
Und so fängt es an.
Du wachst auf, als das Sonnenlicht in den Bäumen vor dem Fenster flüstert. Das Licht ist schwach, kraftlos und grau an den Rändern. Die Dämmerung streift noch die Haut der Nacht ab. Und doch ist es so hell, dass du dich zur Wand drehst, während die Matratze unter dir quietscht. In diesem Umdrehen gibt es einen Augenblick der Orientierungslosigkeit, einen Sekundenbruchteil, in dem du nicht weißt, wo du bist. Das kommt gelegentlich vor, wenn du tief und traumlos geschlafen hast. Vorübergehende Amnesie. Du siehst die feine Körnung der Kiefernwand, riechst den Rauch des Lagerfeuers in deinen Haaren und weißt genau, wo du bist.
Camp Nightingale.
Du schließt die Augen und versuchst, wieder einzuschlafen, bemühst dich, die Naturgeräusche von draußen auszublenden. Sie klingen schrill und disharmonisch – Nachttiere, die mit den Taggeschöpfen kollidieren. Du fängst das Brummen der Insekten auf, das Vogelgezwitscher, einen einsamen Eistaucher, der über den See hinweg einen letzten geisterhaften Ruf ausstößt.
Der Lärm von draußen überlagert vorübergehend die Stille drinnen. Doch dann verklingt das Hämmern eines Spechts zu einem Echo, und in dieser kurzen Pause erkennst du, wie still es ist. Dass du nichts als das stete Auf und Ab deines eigenen schlafschweren Atems hörst.
Du reißt die Augen wieder auf und horchst angestrengt auf andere Geräusche – irgendetwas.
Doch da ist nichts.
Der Specht legt wieder los. Sein rasches Hämmern zieht dich förmlich von der Wand weg, und du drehst dich zum Inneren der Hütte um. Der Raum ist klein. Es gibt gerade genügend Platz für zwei Etagenbetten, einen Nachttisch mit einer Laterne darauf und vier Truhen aus Hickory-Holz neben der Tür, in denen man seine Sachen verstauen kann. Man sieht sofort, ob der Raum leer ist, und genau das ist er. Du schaust zu dem Etagenbett gegenüber. Der obere Schlafplatz ist ordentlich gemacht, das Laken straff gezogen. Der untere das genaue Gegenteil – ein Durcheinander aus Decken, darunter etwas Knubbeliges.
Du siehst im frühen Dämmerlicht auf die Uhr. Kurz nach fünf. Fast eine Stunde bis zum Wecken. Das löst eine unterschwellige Panik in dir aus, die knapp unter deiner Haut summt, juckend und lästig.
Bilder von Notfällen rasen durch deinen Kopf. Eine plötzliche Erkrankung. Ein hektischer Anruf von daheim. Du versuchst sogar, dir einzureden, die Mädchen hätten so schnell weggemusst, dass sie dich nicht wecken konnten. Oder sie haben es versucht, dich aber nicht wach bekommen. Du kniest dich vor die Truhen, in die frühere Campbesucherinnen ihre Namen geschnitzt haben, und öffnest alle außer deiner. Sie sind vollgestopft mit Kleidung, Zeitschriften und Bastelarbeiten. In zweien liegen Handys, ausgeschaltet und seit Tagen nicht benutzt.
Nur eine hat ihr Handy mitgenommen.
Du hast keine Ahnung, was das zu bedeuten hat.
Der erste – und einzige – plausible Ort, an dem die Mädchen sein könnten, ist der Waschraum, ein Rechteck mit Wänden aus Zedernholz, das hinter den Hütten nah am Waldrand steht. Vielleicht musste eine von ihnen auf die Toilette, und die anderen sind mitgegangen. So was kommt vor. Du selbst hast an solchen nächtlichen Ausflügen teilgenommen. Zusammengedrängt seid ihr im Schein einer einzigen Taschenlampe über den Weg gehuscht. Doch das perfekt gemachte Bett zeugt von einer geplanten Abwesenheit. Einer Abwesenheit, die länger dauern sollte. Oder es bedeutet, schlimmer noch, dass letzte Nacht niemand hier geschlafen hat.
Du öffnest die Tür und trittst nervös nach draußen. Es ist ein grauer, kühler Morgen, und du schlingst die Arme um dich, um ein bisschen Wärme zu spüren, während du zum Waschraum gehst. Drinnen schaust du in jede Kabine und jede Dusche. Alle sind leer. Die Wände der Dusche sind trocken. Die Waschbecken auch.
Als du wieder draußen stehst, hältst du auf halbem Weg zwischen Waschraum und Hütten inne, den Kopf geneigt, und horchst im Summen und Zirpen und sanften Klatschen des Wassers ans nahe Seeufer auf Anzeichen der Mädchen.
Es ist nichts zu hören.
Das Camp ist vollkommen still. Das Gefühl, allein zu sein, legt sich wie ein schwerer Mantel um deine Schultern. Du fragst dich einen Moment lang, ob das Camp geräumt wurde und man nur dich zurückgelassen hat. Schreckliche Szenarien drängen in deinen Kopf. Hütten, die in irrer, angstgetriebener Eile verlassen wurden. Und du hast alles verschlafen. Du umkreist leise die Hütten, horchst auf Lebenszeichen. Es sind insgesamt zwanzig, die auf der Lichtung rasterförmig angeordnet sind. Du gehst zwischen ihnen hindurch, spürst, wie lächerlich du aussiehst. Du trägst nur ein Tanktop und Boxershorts, an deinen nackten Füßen kleben trockene Kiefernnadeln und der Mulch vom Weg.
Die Hütten sind nach Bäumen benannt. Deine heißt Dogwood, die nebenan Maple. Du gehst im Kopf alle Namen durch und überlegst, in welcher die Mädchen sein könnten. Du stellst dir eine improvisierte Übernachtungsparty vor. Spähst durch Fenster und stößt unverschlossene Türen auf, musterst die Doppeldeckerreihen schlafender Mädchen und suchst nach überzähligen Besucherinnen. In einer Hütte – Blue Spruce – weckst du versehentlich ein Mädchen im unteren Bett. Sie setzt sich auf, das Keuchen bleibt ihr in der Kehle stecken.
»Entschuldigung«, flüsterst du und schließt die Tür. »Tut mir leid, tut mir leid.«
Du gehst zu den Gemeinschaftsgebäuden des Camps, wo es von Sonnenaufgang bis zur Dämmerung geschäftig zugeht. Noch aber ist der Sonnenaufgang nur ein Versprechen, ein schwaches Rosa, das allmählich über den Horizont kriecht. Dort steht die rustikale Kantine, wo es in etwa einer Stunde nach Kaffee und verbranntem Speck riechen wird. Im Augenblick aber riecht es nicht nach Essen, kein Laut ist zu hören.
Du drückst die Klinke. Die Tür ist abgeschlossen.
Als du dein Gesicht ans Fenster presst, siehst du nur den dunklen Speiseraum, die Stühle stehen noch auf den langen Tischen.
Genau wie in der Kunstwerkstatt nebenan. Auch sie ist abgeschlossen und dunkel.
Du siehst den Halbkreis aus Staffeleien, auf denen die halb fertigen Leinwände von gestern stehen. Ihr habt an einem Stillleben gearbeitet. Eine Vase Wildblumen neben einer Schale mit Orangen. Du kannst dich des Gefühls nicht erwehren, dass die Stunde nie beendet wird, dass die Blumen für immer halb gemalt bleiben und die Schalen ewig auf ihr Obst warten werden.
Du weichst zurück, drehst dich langsam, überlegst dir den nächsten Schritt. Rechts liegt der Schotterweg, der aus dem Camp hinaus und durch den Wald bis zur Hauptstraße führt. Du gehst in die entgegengesetzte Richtung, wo ein gewaltiges Blockhaus am Ende einer gebogenen Auffahrt thront.
Das Landhaus. Es ist ein unförmiges Mischwesen, mehr Herrenhaus als Hütte, das die Campbewohnerinnen daran erinnert, wie bescheiden ihre eigenen Unterkünfte sind. Alles ist still und dunkel. Die Sonne geht hinter dem Gebäude auf und taucht die Vorderseite in Schatten, sodass du die Buntglasfenster, das Fundament aus Feldstein und die rote Tür kaum erkennen kannst.
Du willst zur Tür laufen und dagegenhämmern, bis Franny aufmacht. Sie leitet das Camp und muss erfahren, dass drei Mädchen verschwunden sind. Sie ist für die Mädchen verantwortlich.
Du hältst inne, weil du dich auch irren könntest. Vielleicht hast du ein Versteck übersehen, in dem sich die Mädchen verkrochen haben. Du möchtest Franny nur im äußersten Notfall beunruhigen, denn du hast sie schon einmal enttäuscht.
Du willst gerade in eure verlassene Hütte zurückkehren, als etwas hinter dem Landhaus deine Aufmerksamkeit erregt. Ein Streifen orangefarbenes Licht am Ende des abfallenden Rasens.
Der Himmel, der sich im Lake Midnight spiegelt.
Bitte seid da, denkst du. Bitte seid in Sicherheit. Bitte lasst mich euch finden.
Natürlich sind die Mädchen nicht am See. Es gibt keinen vernünftigen Grund, weshalb sie dort sein sollten. Es kommt dir vor wie ein Albtraum. Die Art von Albtraum, vor der du dich am meisten fürchtest, wenn du abends die Augen zumachst. Nur ist dieser Albtraum wahr geworden.
Vielleicht bleibst du deswegen nicht stehen, als du das Seeufer erreichst. Du gehst weiter, in den See hinein, spürst glitschige Steine unter den Füßen. Bald reicht dir das Wasser bis zu den Knöcheln. Als du zu zittern anfängst, weißt du nicht, ob es vom kalten See oder von der Angst kommt, die dich ergriffen hat, seit du auf die Uhr geschaut hast.
Du drehst dich im Wasser, betrachtest die Umgebung. Hinter dir das Landhaus, die dem See zugekehrte Seite strahlt im Sonnenaufgang, die Fenster sind rosig erleuchtet. Das Seeufer erstreckt sich zu beiden Seiten, eine scheinbar endlose Linie aus Felsen und schiefen Bäumen. Du schaust nach draußen auf die weite Fläche des Sees. Das Wasser ist glatt wie ein Spiegel, in seiner Oberfläche sieht man die langsam aufziehenden Wolken. Der See ist sehr tief, obwohl sich die Wasserlinie durch die anhaltende Trockenheit gesenkt und am Strand einen dreißig Zentimeter breiten Streifen sonnengetrockneter Kiesel hinterlassen hat.
Nun, da der Himmel heller wird, kannst du das gegenüberliegende Ufer als dunklen Streifen im Dunst erkennen. Alles – das Camp, der See, der Wald um dich herum – ist in Privatbesitz. Es gehört Frannys Familie und wurde über Generationen weitervererbt.
So viel Wasser. So viel Land.
So viele Orte, an denen man verschwinden kann. Die Mädchen könnten überall sein. Das wird dir klar, als du im Wasser stehst und immer stärker zitterst. Sie sind da draußen. Irgendwo. Es kann Tage dauern, bis man sie findet. Oder Wochen. Womöglich findet man sie nie.
Der Gedanke ist zu schrecklich, und doch kannst du an nichts anderes denken. Du stellst dir vor, wie sie durch den dichten Wald stolpern, halt- und orientierungslos, und sich fragen, ob das Moos an den Bäumen wirklich nach Norden weist. Du stellst dir vor, dass sie hungrig und verängstigt sind. Du stellst sie dir unter der Wasseroberfläche vor, wie sie in den Schlamm sinken und vergeblich versuchen, sich nach oben zu kämpfen.
Das alles denkst du und fängst an zu schreien.
1. Teil
ZWEI WAHRHEITEN
1
Ich male die Mädchen immer in derselben Reihenfolge.
Zuerst Vivian.
Dann Natalie.
Allison kommt als Letzte, obwohl sie als Erste die Hütte verlassen hat und daher streng genommen zuerst verschwunden ist.
Meine Gemälde sind groß, geradezu gewaltig. Groß wie ein Scheunentor, wie Randall zu sagen pflegt. Doch die Mädchen sind immer klein. Unbedeutende Zeichen auf einer erschreckend großen Leinwand.
Sie kommen stets in der zweiten Phase eines Gemäldes dazu, nachdem ich einen Hintergrund aus Erde und Himmel aufgetragen habe, dessen Farbtöne angemessen düstere Namen tragen. Spinnenschwarz. Schattengrau. Blutrot.
Und Mitternachtsblau natürlich. Auf meinen Gemälden gibt es immer ein bisschen Mitternacht.
Die Mädchen stehen manchmal dicht zusammengedrängt, dann wieder einzeln, verteilt auf die Ecken der Leinwand. Ich male sie in weißen Kleidern, deren Säume sich blähen, als liefen sie vor etwas davon. Meist kehren sie dem Betrachter den Rücken zu, sodass man nur ihre Haare sieht, die auf der Flucht hinter ihnen herflattern. Wenn man einen Blick auf ihr Gesicht erhaschen kann, was selten vorkommt, sieht man nur ein blasses Profil, nicht mehr als einen einzigen geschwungenen Pinselstrich.
Als Letztes male ich den Wald, indem ich die Farbe mit einem Spachtel in breiten, sperrigen Strichen auf die Leinwand schmiere. Dieser Prozess kann Tage oder sogar Wochen dauern, und dabei wird mir ein bisschen schwindlig von den Dämpfen, weil ich immer mehr Farbe auf die Leinwand klatsche, Schicht um Schicht, bis es richtig dick ist.
Ich habe gehört, wie Randall potenziellen Käufern gegenüber damit prahlt, dass meine Oberflächen an van Gogh erinnerten, dass die Farbe in zweieinhalb Zentimeter hohen Wellenkämmen von der Leinwand abstehe. Ich stelle mir lieber vor, dass ich die Natur male, in der echte Glattheit nur ein Mythos ist, vor allem im Wald. Die rauen Rillen der Baumrinde. Moosflecken auf einem Stein. Das Laub mehrerer Herbste, das den Boden bedeckt. Das ist die Natur, die ich mit meinen Kratzern und Höckern und Farbkringeln einzufangen suche.
Also füge ich mehr und mehr Farbe hinzu, jede wandgroße Leinwand versinkt allmählich im Wald meiner Fantasie. Dicht. Abweisend. Voller Gefahren. Die Bäume ragen dunkel und bedrohlich auf. Ranken kriechen nicht, sie umschlingen, verengen sich zu einem Würgegriff. Unterholz überwuchert den Waldboden. Blätter verdecken den Himmel.
Ich male, bis kein Fleckchen Leinwand mehr frei ist und die Mädchen vom Wald verschlungen werden, begraben unter den Bäumen und Ranken und Blättern, unsichtbar. Erst dann weiß ich, dass ein Gemälde fertig ist, und setze mit dem Pinselende meinen Namen in die untere rechte Ecke.
Emma Davis.
Derselbe Name ziert in nahezu unleserlicher Schrift eine Wand der Galerie und begrüßt die Besucher, die durch die gewaltigen Schiebetüren des ehemaligen Lagerhauses im Meatpacking District treten. Alle anderen Wände sind mit Gemälden bedeckt. Meinen Gemälden. Siebenundzwanzig Stück.
Meine erste Ausstellung in einer Galerie.
Randall hat sich für die Vernissage geradezu selbst übertroffen und den Raum in einen Großstadtdschungel verwandelt. Rostfarbene Wände und Birkenstämme, in New Jersey gefällt und geschmackvoll arrangiert. Im Hintergrund wummert ätherische Housemusic. Die Beleuchtung lässt an Oktober denken, obwohl nächste Woche St. Patrick’s Day ist und der Schneematsch sich noch auf den Straßen türmt.
Die Galerie ist proppenvoll, das muss ich Randall lassen. Sammler, Kritiker und Schaulustige drängen sich vor den Bildern, Champagnergläser in der Hand, und greifen beiläufig nach Kroketten mit Ziegenkäse und Champignons, die an ihnen vorbeigetragen werden. Man hat mich schon einem Dutzend Leute vorgestellt, deren Namen ich sofort vergessen habe. Wichtige Leute. So wichtig, dass Randall mir beim Händeschütteln ihre Namen ins Ohr flüstert.
»Von der ›Times‹«, sagt er über eine Frau, die von Kopf bis Fuß in Violett gekleidet ist. Bei einem Mann, der einen makellosen Maßanzug und rote Turnschuhe trägt, flüstert er nur: »Christie’s.«
»Sehr eindrucksvolle Arbeiten«, sagt Mr Christie. »Sie sind so kühn.«
Er klingt überrascht, als wären Frauen unfähig zur Kühnheit. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selbst alles andere als kühn bin. Verglichen mit anderen Größen der Kunstwelt wirke ich geradezu sittsam. Kein violettes Ensemble oder grelles Schuhwerk. Heute Abend habe ich das kleine Schwarze und schwarze Pumps mit Kitten Heels aufgeboten. Meist trage ich Cargohosen und farbfleckige T-Shirts. Mein einziger Schmuck ist das silberne Glücksarmband, das ich immer am linken Handgelenk trage. Daran hängen drei Glücksbringer – winzige Vögel aus gebürstetem Zinn.
Ich habe Randall einmal erzählt, dass ich mich so schlicht kleide, weil meine Gemälde herausstechen sollen, nicht ich. In Wahrheit finde ich es sinnlos, mich kühn zu geben.
Vivian war in jeder Hinsicht kühn.
Und doch ist sie verschwunden.
Während des Meet and Greet lächle ich so breit, wie es von mir erwartet wird, und weiche gewandt den unvermeidlichen Fragen nach meinen Zukunftsplänen aus.
Nachdem der Strom der Fremden versiegt ist, stehe ich mit einem Glas Champagner abseits der Menge und zwinge mich, nicht bei jedem Bild nach dem verräterischen roten Verkauft-Aufkleber zu schielen. Ich sehe mich nach Leuten um, die ich tatsächlich kenne, und es sind gar nicht so wenige. Dafür bin ich dankbar, finde es aber auch seltsam, sie alle im selben Raum zu sehen. Freunde aus der Highschool zusammen mit Leuten aus der Werbeagentur, Malerkollegen neben Verwandten, die mit dem Zug aus Connecticut gekommen sind.
Bis auf eine Cousine sind alle männlich.
Nicht ganz zufällig.
Meine Laune bessert sich, als Marc eintrifft, modisch spät und mit einem stolzen Grinsen im Gesicht. Er behauptet, er verabscheue die Kunstwelt, fügt sich aber perfekt hier ein. Bärtig mit wunderbar zerzaustem Haar. Karierter Sportmantel über abgetragenem Mickymaus-T-Shirt. Rote Sneaker, bei denen Mr Christie vor Neid erblassen würde. Marc geht durch die Menge, schnappt sich ein Glas Champagner und eine Krokette, die er sich in den Mund steckt und nachdenklich zerkaut.
»Der Käse ist die Rettung«, teilt er mir mit. »Aber die wässrigen Pilze sind eine Unverschämtheit.«
»Ich habe noch gar nicht probiert. Bin zu nervös.«
Marc legt mir beruhigend die Hand auf die Schulter. So war es schon, als wir während des Kunststudiums zusammengewohnt haben. Jeder Mensch braucht einen ruhenden Pol und Künstler ganz besonders. Für mich ist das Marc Stewart. Meine Stimme der Vernunft. Mein bester Freund. Vermutlich wäre er sogar mein Ehemann, würden wir nicht beide auf Männer stehen.
Ich fühle mich zu den Unerreichbaren hingezogen. Auch das wohl mit gutem Grund.
»Du darfst es genießen«, sagt er.
»Ich weiß.«
»Du kannst stolz auf dich sein. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Künstler dürfen sich von eigenen Erfahrungen inspirieren lassen. Darum geht es doch bei der Kreativität.«
Marc redet natürlich von den Mädchen. Sie sind in jedem meiner Gemälde begraben. Außer mir weiß nur er von ihrer Existenz.
Aber ich habe ihm nicht erzählt, weshalb ich sie fünfzehn Jahre später immer noch verschwinden lasse.
Es ist besser, wenn er das nicht weiß.
Eigentlich hatte ich nie vor, so zu malen. Zu Beginn meines Studiums waren schlichte Farben und Formen mein Ding. Die Suppendosen von Andy Warhol. Die Flaggen von Jasper Johns. Piet Mondrians kühne Quadrate und strenge schwarze Linien. Dann erhielt ich die Aufgabe, einen Menschen zu malen, den ich kannte und der gestorben war.
Ich entschied mich für die Mädchen.
Als Erste malte ich Vivian, weil sie in meiner Erinnerung am hellsten leuchtet. Blonde Haare wie aus einer Shampoowerbung. Unpassend dunkle Augen, die bei richtiger Beleuchtung schwarz aussahen. Stupsnase voller Sommersprossen. Ich steckte sie in ein weißes Kleid mit einem aufwendigen viktorianischen Kragen, der sich wie ein Fächer um ihren Schwanenhals legte, und verlieh ihr das gleiche rätselhafte Lächeln, mit dem sie die Hütte zuletzt verlassen hatte.
Du bist noch zu jung dafür, Em.
Dann kam Natalie. Hohe Stirn. Eckiges Kinn. Die Haare zu einem straffen Pferdeschwanz gebunden. Ihr weißes Kleid erhielt einen niedlichen Spitzenkragen, der ihren dicken Hals und die breiten Schultern überspielte.
Und dann war da noch Allison, die so gesund aussah. Apfelbäckchen und schmale Nase. Augenbrauen, die zwei Töne dunkler waren als ihr flachsblondes Haar, dünn und perfekt wie mit einem braunen Stift gemalt. Ich versah sie mit einer elisabethanischen Halskrause, aufgeputzt und majestätisch.
Doch mit dem Gemälde stimmte etwas nicht. Ich erkannte es erst in der Nacht, bevor ich das Projekt abgeben musste. Ich wurde um zwei Uhr morgens wach und bemerkte, wie mich die drei durchs Zimmer anstarrten.
Dass man sie sah, war das Problem.
Ich schlich aus dem Bett und trat vor die Leinwand, nahm einen Pinsel, tauchte ihn in braune Farbe und schmierte einen Strich über ihre Augen. Einen Ast, der sie blendete. Weitere Äste folgten. Dann Pflanzen und Ranken und ganze Bäume, die aus meinem Pinsel auf die Leinwand flossen, als würden sie daraus hervorwachsen. Als es dämmerte, war fast die ganze Leinwand von Wald bedeckt. Von Vivian, Natalie und Allison blieben nur Fetzen weißer Kleider, Hautflecken und Haarsträhnen.
Dies war Nr. 1. Das erste Bild meiner Waldserie. Das Einzige, auf dem zumindest Spuren der Mädchen zu sehen sind. Das Bild, das die beste Note in der Klasse bekam, nachdem ich meinem Lehrer erklärt hatte, was es bedeutete, ist hier nicht ausgestellt. Es hängt in meinem Loft und ist unverkäuflich.
Die anderen aber sind hier, großzügig gehängt in der weitläufigen Galerie. Als ich sie alle beieinandersehe, mit ihren knorrigen Ästen und leuchtenden Blättern, wird mir klar, von welcher Besessenheit die Unternehmung zeugt. Es verunsichert mich, dass ich jahrelang dasselbe Motiv gemalt habe.
»Ich bin ja stolz«, sage ich zu Marc und trinke einen Schluck Champagner.
Er kippt sein Glas in einem Zug hinunter und nimmt sich ein neues. »Was ist denn dann mit dir los? Du wirkst so verdrießlich.«
Er näselt mit britischem Akzent, eine treffende Imitation von Vincent Price aus einem grellen Horrorfilm, dessen Titel wir beide vergessen haben. Wir wissen nur noch, dass wir völlig stoned waren, als wir ihn im Fernsehen gesehen und bei diesem Satz vor Lachen gebrüllt haben. Wir sagen es viel zu oft zueinander.
»Es ist so seltsam. All das hier.« Ich deute mit meinem Champagnerglas auf die Gemälde, die die Wände beherrschen, die Leute, die sich davor aufgereiht haben, Randall, der ein elegantes europäisches Paar, das gerade hereingekommen ist, auf beide Wangen küsst. »Ich hatte einfach nicht damit gerechnet.«
Das ist keine falsche Bescheidenheit, sondern die Wahrheit. Hätte ich mit einer Ausstellung gerechnet, hätte ich mir Titel für meine Werke überlegt. Stattdessen habe ich sie einfach durchnummeriert, von Nr. 1 bis Nr. 33.
Randall, die Galerie, die surreale Vernissage – all das ist ein glücklicher Zufall. Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der richtige Ort war Marcs Bistro im West Village. Damals arbeitete ich seit vier Jahren fest als Gestalterin in einer Werbeagentur. Der Job machte mir keinen Spaß und füllte mich nicht aus, doch ich konnte die Miete für ein heruntergekommenes Loft bezahlen, das groß genug für meine Waldgemälde war. Nach einem Rohrbruch brauchte Marc etwas, um den Wasserschaden an der Wand vorübergehend zu verdecken. Ich lieh ihm Nr. 8, weil es am größten war.
Die richtige Zeit kam eine Woche später, als der Besitzer einer kleinen Galerie bei Marc zu Mittag aß. Er sah das Gemälde, war einigermaßen fasziniert und fragte Marc, von wem es sei.
Und so wurde eines meiner Bilder – Nr. 7 – in der Galerie ausgestellt. Eine Woche später war es verkauft. Der Besitzer wollte mehr. Ich gab ihm drei Bilder. Eines davon – die Glückszahl 13 – fiel einer jungen Kunstliebhaberin auf, die es auf Instagram postete und damit die Aufmerksamkeit ihrer Chefin erregte, einer Fernsehschauspielerin, die als Influencerin bekannt war. Sie kaufte das Bild und hängte es in ihr Esszimmer, wo sie es bei einer Dinnerparty einer kleinen Gruppe von Freunden vorführte. Einer dieser Freunde arbeitete als Redakteur bei ›Vogue‹ und erzählte seinem Cousin davon, der eine größere, renommiertere Galerie besaß. Dieser Cousin ist Randall, der gerade durch die Galerie streift und jeden Gast in die Arme schließt.
Allerdings weiß niemand von ihnen – weder Randall noch die Schauspielerin und nicht einmal Marc –, dass ich außer meinen Arbeiten für die Werbeagentur nur diese dreiunddreißig Bilder gemalt habe. Keine neuen Ideen sickern in mein Künstlerhirn, kein Funke der Inspiration springt über. Ich habe natürlich andere Sachen versucht, wenn auch mehr aus Pflichtgefühl als auf eigenen Wunsch. Aber ich bin nie über erste, halbherzige Versuche hinausgekommen. Jedes verdammte Mal lande ich wieder bei den Mädchen.
Ich weiß, ich kann sie nicht ewig malen, sie nicht immer und immer wieder im Wald verschwinden lassen. Darum habe ich mir geschworen, keines mehr zu malen. Es wird keine Nr. 34 oder Nr. 46 oder, Gott behüte, Nr. 112 geben.
Darum antworte ich auch nicht, wenn mich die Leute fragen, was ich als Nächstes machen will. Ich habe keine Antwort für sie. Meine Zukunft ist im wahrsten Sinne des Wortes eine leere Leinwand, die darauf wartet, von mir gefüllt zu werden. In den letzten sechs Monaten habe ich nichts bemalt außer den Wänden meines Ateliers, die ich mit einem Farbroller von Narzissengelb in Blaugrün verwandelt habe.
Falls mich irgendetwas verdrießlich stimmt, ist es das. Ich bin eine Eintagsfliege. Eine kühne Malerin, deren Lebenswerk an diesen Wänden hängt.
Daher fühle ich mich hilflos, als Marc mich stehenlässt und den gut aussehenden Kellner anbaggert, was Randall die perfekte Gelegenheit bietet, mich am Handgelenk zu einer schlanken Frau zu ziehen, die gerade Nr. 30 betrachtet, meine bis dato größte Arbeit. Obwohl ich ihr Gesicht nicht sehen kann, weiß ich, dass sie wichtig ist. Alle anderen Gäste hat man zu mir geführt, bei ihr aber ist es umgekehrt.
»Hier ist sie, Darling«, verkündet Randall. »Die Künstlerin höchstpersönlich.«
Die Frau wirbelt herum, fixiert mich mit einem freundlichen grünäugigen Blick, den ich seit fünfzehn Jahren nicht gesehen habe. Es ist ein Blick, den man nicht vergisst. Die Art Blick, bei der man sich wie der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt fühlt.
»Hallo, Emma.«
Ich erstarre, bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie sie sich verhalten oder was sie sagen wird. Oder warum sie hier ist. Ich hatte angenommen, Francesca Harris-White wolle nichts mehr mit mir zu tun haben.
Doch sie lächelt herzlich und zieht mich an sich, bis sich unsere Wangen berühren. Eine halbe Umarmung, die Randall mit unverkennbarer Eifersucht konstatiert.
»Ihr kennt euch schon?«
»Ja«, sage ich, noch immer verblüfft, sie hier zu treffen.
»Es ist ewig her. Emma war damals nur ein schmächtiges Mädchen. Ich könnte nicht stolzer sein auf die Frau, die aus ihr geworden ist.«
Sie wirft mir noch einen Blick zu. Den Blick. Und obwohl ich überrascht bin, macht es mich sehr glücklich, sie zu sehen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten.
»Vielen Dank, Mrs Harris-White«, sage ich. »Das ist sehr freundlich von Ihnen.«
Sie runzelt scherzhaft die Stirn. »Was soll denn dieser Unsinn von wegen Mrs Harris-White? Ich heiße Franny. Immer Franny.«
Auch daran erinnere ich mich. Wie sie in ihren Khakishorts und dem blauen Polohemd vor uns stand, die Füße in den klobigen Wanderstiefeln grotesk überdimensioniert. Nennt mich Franny, ich bestehe darauf. Hier draußen in der Wildnis sind wir alle gleich.
Doch als die Zeitungen im ganzen Land berichteten, was geschehen war, verwendete man ihren vollständigen Namen. Francesca Harris-White. Die einzige Tochter des Immobilientycoons Theodore Harris. Das einzige Enkelkind des Holzbarons Buchanan Harris. Die Witwe des sehr viel älteren Tabakerben Douglas White. Geschätztes Nettovermögen fast eine Milliarde, das meiste davon altes Geld aus dem goldenen Zeitalter.
Jetzt steht sie vor mir, scheinbar unberührt von der Zeit, obwohl sie Ende siebzig sein muss. Sie ist in Würde gealtert. Ihre gebräunte Haut strahlt. Das ärmellose blaue Kleid betont die schlanke Figur. Ihre Haare, die zwischen Blond und Grau changieren, sind zu einem Chignon aufgesteckt, und um den Hals trägt sie eine einreihige Perlenkette.
Sie dreht sich wieder zu dem Gemälde, mustert es in seiner ganzen gewaltigen Größe. Es ist eine meiner dunkleren Arbeiten – viel Schwarz, Tiefblau und Schlammbraun. Die Leinwand lässt sie winzig erscheinen, als stünde sie tatsächlich in einem Wald, dessen Bäume sie überragen.
»Es ist wirklich wunderbar. Das sind sie alle.«
Sie stockt beim Sprechen. Ihre Stimme bebt, wirkt unsicher, als könnte Franny die Mädchen in ihren weißen Kleidern im gemalten Dickicht erkennen.
»Ich muss gestehen, dass ich mit Hintergedanken hergekommen bin«, sagt sie und starrt weiter auf das Bild, als könnte sie nicht die Augen davon lassen. »Natürlich bin ich wegen der Kunst hier. Aber auch noch aus einem anderen Grund. Ich möchte dir einen interessanten Vorschlag unterbreiten.«
Endlich wendet sie sich ab und richtet die grünen Augen wieder auf mich. »Ich würde gern mit dir darüber sprechen, falls du Zeit hast.«
Ich schaue zu Randall, der in diskreter Entfernung hinter Franny steht. Er haucht das Wort, nach dem sich jeder Künstler sehnt: Auftragsarbeit.
Allein dieser Gedanke lässt mich zustimmen. Sonst hätte ich nämlich abgelehnt.
»Lass uns morgen Mittag zusammen essen. Halb eins? Bei mir? Dann können wir alles nachholen.«
Ich nicke, obwohl ich mir nicht sicher bin, was hier gerade passiert. Frannys unerwartetes Erscheinen. Die noch unerwartetere Einladung zum Mittagessen. Die angsteinflößende und doch verlockende Aussicht, etwas für sie zu malen. Ein weiteres surreales Element eines ohnehin sonderbaren Abends.
»Natürlich«, sage ich noch einmal, weil mir nichts Besseres einfällt.
Franny strahlt. »Wunderbar.«
Sie drückt mir eine Karte in die Hand. Dunkelblaue Schrift auf schwerem weißem Pergament. Schlicht, aber elegant. Darauf stehen ihr Name, eine Telefonnummer und eine Adresse an der Park Avenue. Bevor sie geht, gibt es noch eine halbe Umarmung. Dann dreht sie sich zu Randall und deutet auf Nr. 30.
»Ich nehme es.«
2
Frannys Haus ist leicht zu finden. Es trägt nämlich den Namen ihrer Familie.
Das Harris.
Wie viele seiner Nachbarn gibt sich das Harris betont unauffällig. Hier sieht man keine verspielten Erker und Giebel wie beim Dakota, nur dezente Architektur, die sich hoch über die Park Avenue erhebt. Über dem Eingang ist das Familienwappen der Harris in Marmor gemeißelt. Es stellt zwei hohe, sich überkreuzende Kiefern dar, die von einem Efeukranz umgeben sind. Ziemlich passend, wenn man bedenkt, dass die Familie mit dem Fällen solcher Bäume den Grundstein ihres Vermögens gelegt hat.
Drinnen ist das Harris still und feierlich wie eine Kathedrale. Ich komme mir vor wie eine Sünderin, die auf Zehenspitzen hineinschleicht. Eine Hochstaplerin. Jemand, der nicht hierhergehört. Doch der Portier lächelt und begrüßt mich mit Namen, als würde ich seit Jahren hier wohnen.
Im Aufzug geht der herzliche Empfang weiter, dort erwartet mich ein weiteres vertrautes Gesicht aus Camp Nightingale.
»Lottie?«, frage ich.
Anders als Franny hat sie sich in den letzten fünfzehn Jahren ziemlich verändert. Sie ist natürlich älter geworden. Weltgewandter. Statt der Shorts und des Karohemds, worin ich sie zuletzt gesehen habe, trägt sie einen dunkelgrauen Hosenanzug mit weißer Bluse. Ihre ehemals langen mahagonifarbenen Haare sind jetzt pechschwarz und zu einem geschmeidigen Bob geschnitten, der ihr blasses Gesicht umrahmt. Aber das Lächeln ist dasselbe. Freundlich, warm und ebenso lebendig wie damals in Camp Nightingale.
»Emma«, sagt sie und umarmt mich. »Mein Gott, wie schön, dich wiederzusehen.«
Ich erwidere die Umarmung. »Das finde ich auch, Lottie. Ich hatte mich schon gefragt, ob du noch für Franny arbeitest.«
»Sie wird mich nicht los, selbst wenn sie wollte. Nicht dass sie es je gewollt hätte.«
In der Tat hatte man die eine selten ohne die andere gesehen. Franny leitete das Camp, und Lottie war ihre ergebene Assistentin. Sie regierten nicht mit eiserner Faust, sondern mit Samthandschuhen, und blieben stets wohlwollend geduldig, selbst wenn jemand wie ich zu spät eintraf. Ich weiß noch, wie ich Lottie zum ersten Mal begegnet bin. Wie sie gemächlich aus dem Landhaus trat, nachdem meine Eltern und ich mit stundenlanger Verspätung angekommen waren. Sie lächelte, winkte und begrüßte uns aufrichtig mit den Worten Willkommen in Camp Nightingale.
Jetzt schiebt sie mich in den Aufzug und drückt den obersten Knopf. Während wir nach oben sausen, sagt sie: »Du und Franny esst im Gewächshaus. Warte ab, bis du es siehst.«
Ich nicke und gebe mich gespannt, doch Lottie durchschaut mich sofort. Sie mustert mich von Kopf bis Fuß, registriert meine steife Haltung, meinen Fuß, der auf den Boden klopft, mein aufgesetztes Lächeln, das unkontrolliert zittert.
»Du brauchst nicht nervös zu sein. Franny hat dir schon hundertmal verziehen.«
Ich wünschte, ich könnte das glauben. Obwohl Franny in der Galerie so freundlich zu mir war, bleibt ein hartnäckiger Zweifel. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass dies mehr als ein bloßer Freundschaftsbesuch ist.
Die Aufzugtüren gehen auf, und ich stehe im Vorraum von Frannys Penthouse. Zu meiner Überraschung hängt gegenüber vom Aufzug das Gemälde, das sie erst gestern Abend gekauft hat. Für Francesca Harris-White gibt es keine roten Aufkleber oder wochenlangen Wartezeiten. Randall muss die ganze Nacht aufgeblieben sein, um den Transport zu organisieren.
»Eine wunderbare Arbeit«, sagt Lottie über Nr. 30. »Ich verstehe, was Franny daran so gefallen hat.«
Ich frage mich, ob es Franny auch dann noch gefallen würde, wenn sie wüsste, dass die Mädchen darin versteckt sind und nur darauf warten, gefunden zu werden. Ich frage mich auch, was die Mädchen selbst davon halten würden, in Frannys Penthouse zu wohnen. Allison und Natalie wäre es sicher egal. Aber Vivian? Sie wäre hingerissen.
»Ich habe vor, mir einen Nachmittag freizunehmen und in die Galerie zu gehen. Ich möchte sehen, was du sonst noch gemalt hast. Ich bin so stolz auf dich, Emma. Wie wir alle.«
Sie führt mich nach links durch einen kurzen Flur, vorbei an einem offiziell wirkenden Esszimmer und durch ein tiefer gelegenes Wohnzimmer. »Da wären wir. Das Gewächshaus.«
Das Wort wird dem Raum nicht annähernd gerecht. Es ist ein Gewächshaus in etwa so, wie die Grand Central Station ein Bahnhof ist. Beide sind so schmuckvoll, dass es jeder Beschreibung spottet.
Frannys Gewächshaus ist in Wahrheit ein zweistöckiger Wintergarten, den man auf die ehemalige Dachterrasse gesetzt hat. Schwere Glasscheiben reichen vom Boden bis zur gewölbten Decke, in manchen Ecken liegen noch Dreiecke aus Schnee. Inmitten dieses fantasievollen Gebildes wächst ein kleiner Wald. Es gibt gedrungene Kiefern, blühende Kirschbäume und Rosen mit lodernden roten Blüten. Der Boden ist mit glattem Moos und Efeuranken bedeckt. Es gibt sogar einen plätschernden Bach mit einem steinigen Bett. Inmitten dieses Märchenwaldes findet sich eine Terrasse aus rotem Backstein. Dort entdecke ich Franny, die an einem schmiedeeisernen Tisch sitzt, der fürs Mittagessen gedeckt ist.
»Hier ist sie«, verkündet Lottie. »Vermutlich ausgehungert. Dann trage ich besser mal das Essen auf.«
Franny begrüßt mich erneut mit einer angedeuteten Umarmung. »Wie wunderbar, dich wiederzusehen, Emma. Und du bist so schön angezogen.«
Da ich keine Ahnung hatte, was ich anziehen sollte, hatte ich mein bestes Kleid gewählt – ein bedrucktes Wickelkleid von Diane von Fürstenberg, das mir meine Eltern zu Weihnachten geschenkt haben. Neben Franny, die eine schwarze Hose und ein weißes Hemd trägt, komme ich mir zu steif und förmlich vor. Ich bin schrecklich nervös, weil ich endlich erfahren will, weshalb sie mich herbestellt hat.
»Was hältst du von meinem kleinen Gewächshaus?«
Ich sehe mich noch einmal um und erspähe Details, die mir zuvor entgangen sind. Eine Engelsfigur, zur Hälfte mit Efeu überwuchert. Die Narzissen, die neben dem Bach wachsen. »Es ist herrlich. Zu schön, um es mit Worten zu beschreiben.«
»Meine kleine Oase in der Großstadt. Wenn ich nicht in der Wildnis leben kann, muss ich die Wildnis eben zu mir holen.«
»Deshalb hast du also mein größtes Gemälde gekauft.«
»Genau. Wenn ich es ansehe, komme ich mir vor, als stünde ich vor einem dunklen Wald und müsste mich entscheiden, ob ich mich hineinwage. Die Antwort lautete natürlich ja.«
Das wäre auch meine Antwort. Doch anders als Franny würde ich nur hineingehen, weil ich weiß, dass die Mädchen kurz hinter dem Waldrand auf mich warten.
Das Mittagessen besteht aus Mandelforelle und Rucolasalat, dazu gibt es einen frischen Riesling. Das erste Glas Wein beruhigt meine Nerven. Das zweite nimmt mir die Hemmungen. Als mich Franny beim dritten nach meinem Job, meinem Privatleben und meiner Familie fragt, antworte ich ehrlich – dass ich ihn hasse, noch ledig bin und meine Eltern sich in Boca Raton zur Ruhe gesetzt haben.
»Es war ganz köstlich«, sage ich, nachdem wir Zitronentorte zum Nachtisch gegessen haben, die so gut war, dass ich am liebsten den Teller abgeleckt hätte.
»Das freut mich sehr. Die Forelle war aus dem Lake Midnight, musst du wissen.«
Ich zucke zusammen, als sie den See erwähnt. Franny bemerkt meine Überraschung. »Wir können liebevoll an einen Ort denken, auch wenn dort etwas Schlimmes geschehen ist. Ich jedenfalls kann das. Und tue es auch.«
Ich verstehe, dass Franny trotz allem, was geschehen ist, so empfindet. Immerhin ist es der Besitz ihrer Familie. Viertausend Morgen Wildnis am südlichen Rand der Adirondacks, gerettet durch ihren Großvater, nachdem er sein Leben damit verbracht hatte, eine fünfmal so große Fläche zu roden. Dass Buchanan Harris diese viertausend Morgen im ursprünglichen Zustand beließ, sollte wohl eine Wiedergutmachung sein. Trotzdem griff er auch bei diesem Projekt in die Umwelt ein. Enttäuscht darüber, dass es nirgendwo auf seinem Grund ein angemessen großes Gewässer gab, entschied er, selbst eines anzulegen. Er staute einen nahe gelegenen Fluss, Punkt Mitternacht am verregneten Silvesterabend 1902 schloss er mit einem Knopfdruck die Tore des Damms. Nach wenigen Tagen war aus einem stillen Tal ein See geworden.
Das ist die Geschichte des Lake Midnight, die jeder Neuankömmling im Camp Nightingale zu hören bekam.
»Es hat sich kein bisschen verändert«, fährt Franny fort. »Das Landhaus steht natürlich noch. Mein zweites Zuhause. Ich war letztes Wochenende da, die Forellen habe ich selbst gefangen. Die Jungs finden es schrecklich, dass ich so oft hinfahre. Vor allem, wenn ich mit Lottie ganz allein dort bin. Theo macht sich immer Sorgen, dass uns etwas Schreckliches passieren könnte und niemand Hilfe holt.«
Als Franny ihre Söhne erwähnt, überkommt mich wieder Unbehagen.
Theodore und Chester Harris-White. Was für unerträglich abgehobene Namen. Genau wie ihre Mutter bevorzugten sie die Spitznamen – Theo und Chet. An Chet, den Jüngeren, kann ich mich kaum erinnern. Er kann nicht älter als zehn gewesen sein, als ich im Camp war, das Ergebnis einer überraschenden, späten Adoption. Ich kann mich nicht daran erinnern, je mit ihm gesprochen zu haben, hatte ihn aber gelegentlich gesehen, wenn er barfuß über den abschüssigen Rasen zum See hinunterrannte.
Theo war ebenfalls adoptiert. Jahre vor Chet.
An ihn erinnere ich mich gut. Zu gut vielleicht.
»Wie geht es ihnen?«, erkundige ich mich, obwohl es mich eigentlich nichts angeht. Ich frage nur, weil Franny mich erwartungsvoll ansieht und offenbar mit dieser Frage rechnet.
»Beiden geht es gut. Theo verbringt ein Jahr in Afrika, er arbeitet für Ärzte ohne Grenzen. Chet macht im Frühjahr seinen Master in Yale. Er ist mit einem netten Mädchen verlobt.« Sie hält inne, damit ich die Informationen verdauen kann. Das Schweigen ist vielsagend. Es verrät mir, dass ihre Familie gedeiht, trotz allem, was ich ihnen angetan habe. »Ich dachte, du wüsstest das vielleicht schon. Wie ich hörte, funktioniert der Flurfunk von Camp Nightingale noch immer bestens.«
»Ich habe keinen Kontakt mehr zu den Leuten.«
Nicht dass die Mädchen, die ich im Camp kannte, es nicht versucht hätten. Als Facebook in Mode kam, erhielt ich einige Freundschaftsanfragen. Ich ignorierte sie, weil ich keinen Sinn darin sah, mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Uns verband nichts außer der Tatsache, dass wir zwei Wochen zur selben Zeit am selben Ort verbracht hatten. Dennoch fügte man mich einer Facebook-Gruppe ehemaliger Campmitglieder hinzu. Ich habe die Benachrichtigungen vor Jahren abgestellt.
»Vielleicht können wir das ändern«, sagt Franny.
»Wie stellst du dir das vor?«
»Es wird allmählich Zeit, dir zu sagen, warum ich dich heute hergebeten habe.« Dann fügt sie taktvoll hinzu: »Abgesehen davon natürlich, dass ich deine Gesellschaft sehr genieße.«
»Ich gebe zu, ich bin neugierig.« Die Untertreibung des Jahres.
»Ich werde Camp Nightingale wiedereröffnen.«
»Hältst du das für eine gute Idee?« Die Worte platzen einfach aus mir heraus. Sie klingen ein bisschen verächtlich. Kalt, beinahe grausam.
»Tut mir leid, so war es nicht gemeint.«
Franny greift über den Tisch, drückt meine Hand und sagt: »Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Du bist nicht die Erste, die so reagiert. Und ich gebe zu, es ist nicht gerade die naheliegendste Idee. Aber für mich ist es der richtige Zeitpunkt. Das Camp hat lange genug leer gestanden.«
Fünfzehn Jahre. So viel Zeit ist vergangen. Es kommt mir vor wie ein ganzes Leben. Aber auch wie gestern.
Das Camp schloss früh in jenem Sommer, nur zwei Wochen nach Saisonbeginn, und warf die Pläne vieler Familien über den Haufen. Doch es ließ sich nicht ändern. Nicht nach dem, was geschehen war. Meine Eltern schwankten zwischen Mitgefühl und Ärger, als sie mich einen Tag nach allen anderen abholten. Ich kam als Letzte und ging als Letzte. Ich weiß noch, wie ich in unserem Volvo saß und aus dem Rückfenster schaute, als das Camp hinter uns verschwand. Ich war erst dreizehn, wusste aber, dass es für immer schließen würde.
Ein anderes Camp hätte die Krise vielleicht überstanden. Doch Camp Nightingale war nicht irgendein Sommercamp. Es war das Sommercamp, wenn man in Manhattan lebte und ein bisschen Geld hatte. Der Ort, an dem Generationen junger Frauen aus wohlhabenden Familien den Sommer mit Schwimmen, Segeln und Klatschgeschichten verbrachten. Meine Mutter war dort gewesen. Und meine Tante. Bei mir in der Schule hieß es nur Camp Rich Bitch. Wir sprachen verächtlich darüber, aber nur, weil wir neidisch und enttäuscht waren, dass unsere Eltern sich den Aufenthalt nicht leisten konnten. Ich war eine Ausnahme, und das auch nur für einen Sommer.
Den Sommer, der den Ruf des Camps für immer zerstörte.
Die Beteiligten waren bedeutend genug, um die Medien den ganzen Sommer und bis in den Herbst hinein zu beschäftigen. Natalie, die Tochter eines führenden orthopädischen Chirurgen, Allison, das Kind einer bekannten Broadway-Schauspielerin. Und Vivian, die Senatorentochter, die von den Zeitungen gern als schwierig bezeichnet wurde.
Die Presse ließ mich weitgehend in Ruhe. Anders als die anderen war ich nur die Tochter eines gleichgültigen Investmentbankers und einer gut funktionierenden Alkoholikerin. Eine schlaksige Dreizehnjährige, deren Großmutter kürzlich gestorben war und ihr genügend Geld hinterlassen hatte, um sechs Wochen in einem der exklusivsten Sommercamps des Landes zu verbringen.
Es war Franny, die den Zorn der Medien abbekam. Francesca Harris-White, das reiche Mädchen, das die Klatschspalten immer vor den Kopf gestoßen hatte, weil sie die Spielchen, die ihre Gesellschaftsschicht vorschrieb, nicht mitmachte. Mit einundzwanzig heiratete sie einen Mann, der so alt wie ihr Vater war. Sie begrub ihn, als sie noch keine dreißig war. Mit vierzig adoptierte sie ein Kind, mit fünfzig das zweite.
Die Berichterstattung war brutal. Die Artikel beklagten, Lake Midnight sei kein sicherer Ort für ein Sommercamp, zumal Frannys Ehemann dort ein Jahr, bevor das Camp eröffnet wurde, ertrunken sei. Man behauptete, es gebe zu wenig Personal und Aufsicht. Pseudointellektuelle Artikel warfen Franny vor, dass sie zu ihrem Sohn gestanden habe, als er in Verdacht geraten sei. Einige munkelten sogar von finsteren Machenschaften der Familie.
Vermutlich war ich nicht ganz unschuldig daran.
Streichen wir das. Natürlich war ich schuld daran.
Doch Franny scheint mir nichts übel zu nehmen, als sie so in ihrem falschen Wald sitzt und die Vision eines neuen Camp Nightingale entwirft.
»Es ist natürlich nicht dasselbe. Das geht auch nicht. Fünfzehn Jahre sind eigentlich lange genug, aber was geschehen ist, wird für immer wie ein Schatten über dem Camp liegen. Darum werde ich es diesmal ganz anders machen. Ich habe eine Wohltätigkeitsstiftung gegründet. Niemand muss einen Penny für den Aufenthalt zahlen. Das Camp wird völlig kostenlos sein und Mädchen aus den drei umliegenden Staaten aufnehmen, die sich besondere Verdienste erworben haben.«
»Das ist sehr großzügig.«
»Ich will kein Geld von irgendjemand, das habe ich auch nicht nötig. Ich will nur erleben, dass es dort wieder von Mädchen wimmelt, die die Natur genießen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn du dabei wärst.«
Ich schlucke. Ich soll den Sommer in Camp Nightingale verbringen? Das hat so gar nichts mit der Auftragsarbeit zu tun, auf die ich gehofft hatte. Es ist so befremdlich, dass ich fast glaube, ich hätte mich verhört.
»Die Idee ist gar nicht so seltsam. Ich will, dass das Camp einen Schwerpunkt auf Kunst legt. Klar, die Mädchen werden natürlich schwimmen und wandern und die üblichen Sachen machen. Aber sie sollen auch etwas über Schreiben, Fotografie und Malerei lernen.«
»Ich soll ihnen Malunterricht geben?«
»Selbstverständlich«, sagt Franny. »Aber du wirst auch jede Menge Zeit für dich haben. Es gibt keine bessere Inspiration als die Natur.«
Ich verstehe noch immer nicht, weshalb Franny ausgerechnet mich dort haben will. Eigentlich müsste ich der letzte Mensch sein, den sie um sich haben möchte. Sie merkt natürlich, dass ich zögere. Ich sitze steif auf meinem Stuhl, spiele mit der Serviette auf meinem Schoß, drehe sie zu einem Knoten.
»Ich verstehe, dass du verunsichert bist. Das wäre ich an deiner Stelle auch. Aber ich gebe dir nicht die Schuld an dem, was passiert ist, Emma. Du warst jung und durcheinander, und es war eine schreckliche Situation für uns alle. Ich bin fest davon überzeugt, dass man die Vergangenheit ruhen lassen soll. Und ich wünsche mir wirklich, einige Ehemalige dabeizuhaben. Ich will allen zeigen, dass es wieder ein sicherer, glücklicher Ort ist. Rebecca Schoenfeld hat schon zugesagt.«
Becca Schoenfeld ist eine bekannte Fotojournalistin. Ihr Foto von zwei blutüberströmten syrischen Flüchtlingen, die einander an der Hand halten, war auf den Titelseiten in aller Welt zu sehen. Vor allem aber – und das ist es, was für Franny zählt –, ist Becca ebenfalls eine Veteranin des letzten Camp-Sommers.
Sie gehört nicht zu den Mädchen, die mich auf Facebook kontaktiert haben. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Rebecca war immer ein Mysterium für mich. Nicht gerade überheblich, aber distanziert. Sie war still, blieb oft für sich, war damit zufrieden, die Welt durch die Linse ihrer Kamera zu betrachten, die sie immer um den Hals trug, selbst wenn sie bis zur Taille im See stand.
Ich stelle mir vor, wie sie hier an diesem Tisch sitzt, die Kamera mit dem Leinwandriemen um den Hals, während Franny sie überredet, ins Camp Nightingale zurückzukehren. Dass sie zugestimmt hat, verändert meine Sicht. Frannys Idee erscheint mir jetzt weniger verrückt und eher wie etwas, das tatsächlich passieren könnte.
»Das ist eine sehr große Verpflichtung«, sage ich.
»Du wirst natürlich angemessen entschädigt.«
»Das meine ich nicht.« Ich drehe die Serviette so fest, dass sie wie ein Seil aussieht. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich dorthin zurückkann. Nicht nach allem, was geschehen ist.
»Vielleicht solltest du genau deshalb dorthin zurückkehren«, sagt Franny. »Ich hatte auch Angst, wieder hinzufahren. Ich habe es zwei Jahre vor mir hergeschoben. Ich hatte damit gerechnet, nur Dunkelheit und schlimme Erinnerungen vorzufinden. Aber so war es nicht. Es war genauso schön wie immer. Die Natur hat eine heilende Wirkung, Emma. Daran glaube ich ganz fest.«
Ich sage nichts. Es fällt mir schwer, zu sprechen, solange Frannys grüne Augen auf mich gerichtet sind, eindringlich und mitfühlend und auch ein wenig bittend.
»Sag, dass du wenigstens darüber nachdenkst.«
»Das werde ich. Ich denke darüber nach.«
3
Ich denke nicht darüber nach.
Ich steigere mich hinein.
Frannys Angebot geht mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf. Aber es ist nicht die Art von Nachdenken, die sie sich erhofft. Statt zu sinnieren, wie wunderbar es wäre, nach Camp Nightingale zurückzukehren, suche ich Gründe dagegen. Zermürbende Schuldgefühle, die ich in fünfzehn Jahren nicht losgeworden bin. Die übliche alte Angst. All das geht mir durch den Kopf, als ich mich mit Marc in seinem Bistro zum Abendessen treffe.
»Ich finde, du solltest hinfahren«, sagt er und stellt mir einen Teller Ratatouille hin. Es ist mein Lieblingsgericht, dampfend heiß und mit dem üppigen Duft von Tomaten und Kräutern der Provence. Normalerweise würde ich reinhauen, doch Frannys Angebot hat mir den Appetit verdorben. Marc spürt das wohl und stellt ein großes Weinglas neben meinen Teller, das bis zum Rand mit Pinot Noir gefüllt ist. »Es könnte dir guttun.«
»Das sieht meine Therapeutin sicher anders.«
»Das bezweifle ich. Es ist ein Fall wie aus dem Lehrbuch, du musst einen Abschluss finden.«
Den habe ich weiß Gott nicht gehabt. Über einen Zeitraum von sechs Monaten gab es Gedenkgottesdienste für die Mädchen, je nachdem, wann ihre Familien die Hoffnung aufgegeben hatten. Zuerst kam Allison an die Reihe, mit viel Gesang und Drama. Dann folgte Natalies Gottesdienst, eine stille Feier im engsten Familienkreis. Vivians war der letzte, er fand an einem bitterkalten Januarmorgen statt. Es war der einzige, den ich besuchte. Meine Eltern waren dagegen, aber ich ging trotzdem hin. Ich schwänzte die Schule und schlüpfte in der dicht besetzten Kirche in die letzte Bank, weit weg von Vivians weinenden Eltern. Es waren so viele Senatoren und Kongressabgeordnete zugegen, dass ich mir wie in einer Nachrichtensendung vorkam.
Der Besuch half mir nicht. Und dass ich online Berichte über die Gottesdienste für Allison und Natalie las, auch nicht. Vor allem, weil die, wenngleich winzige, Chance bestand, dass sie noch am Leben waren. Zwar hat der Bundesstaat New York sie drei Jahre nach ihrem Verschwinden für tot erklärt, doch solange man die Leichen nicht findet, gibt es keine Gewissheit.
»Ich bin mir nicht sicher, ob es darum geht, einen Abschluss zu finden.«
»Worum denn dann, Em?«
»An diesem Ort haben sich drei Menschen in Luft aufgelöst. Darum geht es.«
»Kapiert«, sagt Marc. »Aber da ist noch etwas. Etwas, das du mir verschweigst.«
»Na schön.« Ich seufze in meine Ratatouille, dass der Dampf über den Tisch wabert. »Ich habe in den letzten sechs Monaten kein einziges Bild gemalt.«
Marc sieht mich betroffen an. »Im Ernst?«
»Oh ja.«
»Du hast also eine Blockade.«
»Mehr als das.«
Ich gestehe ihm alles. Dass ich nichts anderes als die Mädchen malen kann. Dass ich mich weigere, weiterhin ihre weiß gekleideten Gestalten zwischen Bäumen und Ranken verschwinden zu lassen. Dass ich jeden Tag auf die gigantische Leinwand in meinem Loft starre und versuche, genügend Energie aufzubringen, um etwas Neues zu erschaffen.
»Na schön, du bist also besessen.«
»Bingo.« Ich trinke einen anständigen Schluck Wein.
»Ich will ja nicht unsensibel sein«, sagt Marc. »Und es liegt mir fern, deine Gefühle kleinzureden. Du fühlst, was du fühlst, das verstehe ich. Ich verstehe allerdings nicht, warum dich das, was in dem Camp geschehen ist, nach all den Jahren noch verfolgt. Du kanntest die Mädchen doch kaum.«
Das hat meine Therapeutin auch gesagt. Ich weiß selbst, dass es irgendwie sonderbar ist, wenn einen etwas, das vor fünfzehn Jahren geschehen ist, noch immer so mitnimmt. Wenn man auf Mädchen fixiert ist, die man nur zwei Wochen gekannt hat.
»Sie waren meine Freundinnen. Und ich habe ein schlechtes Gefühl, weil ihnen etwas zugestoßen ist.«
»Ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen?«
»Beides.«
Ich war der letzte Mensch, der sie lebend gesehen hat. Ich hätte ihnen was immer sie vorhatten ausreden können. Zumindest aber Franny oder eine Betreuerin informieren können, gleich nachdem sie gegangen waren. Stattdessen habe ich einfach weitergeschlafen. Im Traum höre ich manchmal Vivians letzte Worte.
Du bist noch zu jung dafür, Em.
»Und du hast Angst, dass du dich noch schlechter fühlst, wenn du wieder hinfährst«, befindet Marc.
Statt zu antworten, greife ich nach dem Glas, sehe mein wackliges Spiegelbild im Wein. Ich starre mich an und bin schockiert, wie fremd ich mir vorkomme. Sehe ich wirklich so traurig aus? Vermutlich schon, denn Marcs Stimme klingt weicher, als er sagt: »Es ist normal, dass du dich fürchtest. Deine Freundinnen sind gestorben.«
»Verschwunden.«
»Aber sie sind tot, Emma. Das weißt du doch, oder? Das Schlimmste, was passieren konnte, ist schon geschehen.«
»Es gibt noch etwas Schlimmeres als den Tod.«
»Und das wäre?«
»Ungewissheit. Darum kann ich auch nur die Mädchen malen. Und so geht es nicht weiter, Marc. Ich muss nach vorn schauen.«
Doch das ist nicht alles. Er kennt zwar die wesentlichen Bestandteile der Geschichte, aber ich habe vieles ausgelassen. Dinge, die in Camp Nightingale geschehen sind. Dinge, die danach geschehen sind. Den wahren Grund, aus dem ich das Glücksarmband trage, dessen Vögel bei jeder Bewegung aneinanderklirren. Das alles laut auszusprechen würde es wahr machen. Und dieser Wahrheit kann ich mich nicht stellen.
Man könnte behaupten, dass ich Marc belüge. Aber ich habe mir nach Camp Nightingale geschworen, nie wieder zu lügen.
Verschweigen ist meine Taktik. Eine völlig andere Art von Sünde.
»Umso mehr Grund, dorthin zu fahren.« Marc greift über den Tisch und umfasst meine Hände. Er hat Schwielen an den Handflächen, seine Finger sind vernarbt. Die Hände eines Mannes, der sein Leben lang gekocht hat. »Vielleicht musst du einfach anfangen, etwas anderes zu malen. Du kennst doch das alte Sprichwort – Augen zu und durch.«
Nach dem Essen kehre ich in mein Loft zurück und stehe vor der weißen Leinwand. Ihre Leere verspottet mich seit Wochen. Ein gewaltiges Nichts, das mich herausfordert, es zu füllen.
Ich schnappe mir eine abgenutzte, regenbogenfarbene Palette, schmiere etwas Farbe darauf, tupfe eine Pinselspitze hinein und zwinge mich, etwas zu malen. Alles außer den Mädchen. Ich berühre die Leinwand mit dem Pinsel, die Borsten gleiten darüber, ziehen Farbe hinter sich her.
Dann trete ich zurück und starre auf den Pinselstrich, betrachte ihn ganz genau. Er ist gelb. Etwas geschwungen. Wie ein zusammengedrücktes S. Mir wird klar, dass ich eine Strähne von Vivians Haar gemalt habe, das ein wenig mitschwingt, als sie sich verkriecht. Es kann nichts anderes sein.
Ich greife nach einem Lappen, der nach Terpentin riecht, und wische damit über die gelbe Farbe, bis nur noch ein schwacher Fleck die Leinwand verunziert. Mir kommen die Tränen, als ich begreife, dass ich nach all den Wochen nur diesen verschwommenen Schmierfleck zustande gebracht habe.
Es ist jämmerlich. Ich bin jämmerlich.
Ich wische mir über die Augen, bemerke etwas am Fenster. Eine Bewegung. Etwas blitzt auf.
Blonde Haare. Blasse Haut.
Vivian.
Ich schreie auf und lasse den Lappen fallen, meine rechte Hand umklammert das Armband. Die Vögel daran schwingen mit, als ich herumwirbele.
Nur sehe ich nicht Vivian.
Ich sehe mich selbst im Fenster. Im nachtdunklen Glas wirke ich verschreckt, schwach und tief erschüttert.
Erschüttert, weil die Mädchen immer in meinen Gedanken und auf meinen Leinwänden sind. Und doch weiß ich nach fünfzehn langen Jahren nicht mehr als an dem Abend, an dem sie die Hütte verlassen haben. In den Tagen nach ihrem Verschwinden habe ich alles nur noch schlimmer gemacht. Für Franny. Für ihre Familie. Für mich selbst.
Daran könnte ich endlich etwas ändern. Es würde mich nicht von meinen Sünden reinwaschen, sie aber vielleicht erträglicher machen.
Ich wende mich vom Fenster ab, nehme mein Handy und wähle die Nummer, die auf der eleganten Visitenkarte steht, die Franny mir gestern Abend gegeben hat. Sofort meldet sich die Mailbox, auf der Lottie mich bittet, eine Nachricht zu hinterlassen.
»Hier spricht Emma Davis. Ich habe über Frannys Angebot, den Sommer in Camp Nightingale zu verbringen, nachgedacht.« Ich halte inne, kann selbst nicht ganz glauben, was ich als Nächstes sage. »Die Antwort lautet ja. Ich komme.«
Ich hänge ein, bevor ich es mir anders überlegen kann. Doch auch so verspüre ich den Drang, noch einmal anzurufen und alles zurückzunehmen. Mein Finger zuckt schon über dem Bildschirm, doch ich rufe stattdessen Marc an.
»Ich fahre nach Camp Nightingale«, verkünde ich, bevor er mich begrüßen kann.
»Da bin ich aber froh, dass meine aufmunternden Worte geholfen haben. Einen Abschluss zu finden ist eine gute Sache, Em.«
»Ich werde nach ihnen suchen.«
Marc schweigt. Ich stelle mir vor, wie er blinzelt und sich mit der Hand durch die Haare fährt – die übliche Reaktion, wenn er etwas nicht begreift. Schließlich sagt er: »Ich weiß, ich habe dich dazu ermutigt, aber das scheint mir keine gute Idee zu sein.«
»Gut oder nicht, darum fahre ich hin.«
»Sei doch mal realistisch. Was erwartest du zu finden?«
»Keine Ahnung. Vermutlich gar nichts.«
Ganz sicher erwarte ich nicht, Vivian, Natalie und Allison dort zu entdecken. Sie sind spurlos verschwunden, was es umso schwerer macht, nach ihnen zu suchen. Camp Nightingale selbst mag klein sein, aber das Anwesen als solches ist riesig, über fünfzehn Quadratkilometer Wald. Wenn mehrere Hundert Leute sie damals nicht gefunden haben, werde ich sie jetzt auch nicht finden.
»Was, wenn eine von ihnen etwas zurückgelassen hat?«, frage ich. »Einen Hinweis darauf, wohin sie wollten oder was sie vorhatten.«
»Und selbst wenn? Das bringt sie nicht zurück.«
»Das ist mir klar.«
»Womit wir zur nächsten Frage kommen: Warum ist dir das so wichtig?«
Ich halte inne und überlege, wie ich das Unerklärliche erklären soll. Es ist nicht leicht, zumal Marc nicht die ganze Geschichte kennt.
Also sage ich: »Hast du jemals etwas Tage, Wochen oder sogar Jahre später bereut?«
»Klar doch«, sagt Marc. »Ich glaube, jeder bereut etwas.«
»Und bei mir ist es das, was im Camp geschehen ist. Ich habe fünfzehn Jahre lang auf einen Hinweis gewartet. Irgendeine Kleinigkeit, die mir verrät, was ihnen zugestoßen ist. Jetzt habe ich die Gelegenheit, dorthin zurückzukehren und selbst danach zu suchen. Es ist vermutlich die letzte Chance, eine Antwort zu finden. Wenn ich die versäume, habe ich noch mehr zu bereuen.«
Marc seufzt, also habe ich ihn überzeugt. »Versprich mir nur, keine Dummheiten zu machen.«
»Als da wären?«
»Dich in Gefahr zu bringen.«
»Es ist ein Sommercamp, kein Undercoverjob bei der Mafia. Ich fahre einfach hin, sehe mich um, stelle ein paar Fragen. Und nach sechs Wochen habe ich vielleicht eine Vorstellung, was aus ihnen geworden ist. Wenn nicht, hilft es mir hoffentlich, etwas anderes zu malen. Du hast selbst gesagt, Augen zu und durch.«
»Na schön«, sagt Marc und seufzt noch einmal. »Du planst jetzt deine Campingtour. Dann kommst du zurück und malst wieder.«
Als wir einander Gute Nacht sagen, fällt mein Blick auf Gemälde Nr. 1, in dem ein Hauch von Vivian, Natalie und Allison steckt. Ich trete näher, suche nach aufblitzenden Haaren oder einem Fitzelchen von einem Kleid.
Obwohl der Ast ihre Augen verdeckt, weiß ich, dass sie mich ansehen. Es ist, als hätten sie schon immer gewusst, dass ich eines Tages ins Camp zurückkehren werde. Nur weiß ich nicht, ob sie mich drängen, dorthin zu fahren, oder mich anflehen, es nicht zu tun.
Vor fünfzehn Jahren
»Wach auf, Sonnenschein.«
Es war erst kurz nach acht, als meine Mutter in mein Zimmer schlich, die Augen schon glasig von der morgendlichen Bloody Mary. Ihre Lippen kräuselten sich zu dem Lächeln, das sie immer aufsetzte, wenn sie etwas Folgenschweres plante. Ich nannte es das Mutter–des–Jahres–Lächeln. Es machte mich unweigerlich nervös, da bei ihr stets ein tiefer Abgrund zwischen Absicht und Ergebnis klaffte. An jenem Morgen rollte ich mich unter der Decke zu einer Kugel zusammen und wappnete mich für stundenlanges erzwungenes Mutter–Tochter–Bonding.
»Bist du bereit?«
»Wofür?«
Meine Mutter starrte mich an und spielte dabei am Kragen ihres Chiffon-Morgenrocks herum. »Fürs Camp, natürlich.«
»Welches Camp?«
»Das Sommercamp«, sagte meine Mutter und betonte das erste Wort, um mir klarzumachen, dass es sich um einen längeren Aufenthalt handelte.
Ich setzte mich hin und warf die Decke beiseite. »Von einem Camp war nie die Rede.«
»Oh doch, Emma. Ich habe dir das schon vor Wochen gesagt. Ich und deine Tante Julie waren auch schon da. Herrgott, sag nicht, du hast es vergessen.«
»Das hätte ich nicht vergessen.«
Ich hätte mich sehr wohl daran erinnert, wenn man mir gesagt hätte, dass man mich für den ganzen Sommer von meinen Freundinnen wegreißen würde. Wahrscheinlicher war, dass meine Mutter es mir hatte sagen wollen, es aber nicht getan hatte. In ihrer Welt reichte es, wenn man über etwas nachdachte, man musste es nicht wirklich tun. Ich wusste das, dennoch kam ich mir überrumpelt vor. Es erinnerte mich an die Extremmaßnahmen, bei denen Eltern ihre drogensüchtigen Kinder aus Rehakliniken entführen lassen.
»Dann sage ich es dir jetzt. Wo ist dein Koffer? In einer Stunde müssen wir los.«
»In einer Stunde?« Mein Magen zog sich zusammen, als ich begriff, dass sich meine Sommerpläne soeben in Luft aufgelöst hatten. Ich würde nicht mit Heather und Marissa abhängen. Es würde keine heimliche, unbewachte Zugfahrt nach Coney Island geben, wie wir es in den Freistunden geplant hatten. Keinen Flirt mit Nolan Cunningham von nebenan, der nicht ganz so süß war wie Justin Timberlake, aber ähnlich arrogant und selbstbewusst auftrat. Außerdem fing er nun, da ich keine Zahnspange mehr trug, endlich an, mich zu bemerken. »Wohin fahren wir?«
»Camp Nightingale.«
Camp Rich Bitch. Das war ja mal eine Überraschung.
Das veränderte alles.
Zwei Jahre lang hatte ich meine Eltern vergeblich angefleht, mich dorthin zu schicken. Und nun, nachdem ich die Hoffnung schon aufgegeben hatte, wurde mein Wunsch plötzlich wahr. Und zwar in einer Stunde. Das erklärte natürlich auch das Mutter-des-Jahres-Lächeln. Ausnahmsweise war es gerechtfertigt.
Dennoch sollte meine Mutter nicht sehen, wie sehr ich mich freute. Damit hätte ich sie nur ermutigt, weitere Versuche zu unternehmen, um verlorene Zeit gutzumachen. Fünf-Uhr-Tee im Plaza. Einkaufstour zu Saks. Nur damit sie sich besser fühlte, nachdem sie in den ersten zwölf Jahren meines Lebens null Interesse an mir gezeigt hatte.
»Ich fahre nicht«, verkündete ich, legte mich wieder hin und zog mir die Decke über den Kopf.