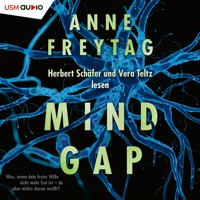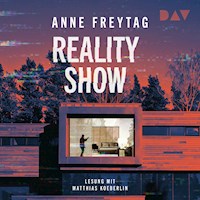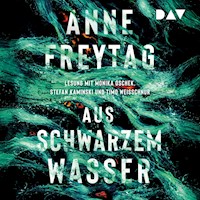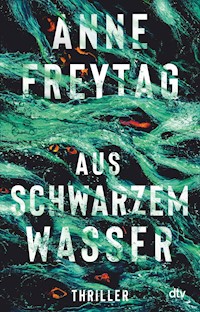
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: dtv bold
- Sprache: Deutsch
Das Meer ist der Ursprung allen Lebens und verbirgt eine tödliche Bedrohung Ohne zu bremsen, rast die Innenministerin Dr. Patricia Kohlbeck mit ihrem Dienstwagen in die Spree. Mit dabei: ihre Tochter Maja. »Du kannst niemandem trauen, sie stecken alle mit drin«, ist das Letzte, was sie zu ihrer Tochter sagt, bevor sie ertrinkt. Auch Maja stirbt – wacht jedoch wenige Stunden später unversehrt in einem Leichensack im Krankhaus wieder auf. Wie ist das möglich? Während Maja versucht, Antworten zu finden, ereignet sich eine verheerende Naturkatastrophe nach der anderen. Und gegen ihren Willen gerät sie in einen Konflikt aus Lügen, Intrigen und Machtkämpfen, dessen Folgen fatale Ausmaße annehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Nach einem schweren Autounfall erwacht Maja Kohlbeck unverletzt in einem Leichensack. Getrieben von der Warnung ihrer Mutter, niemandem zu vertrauen, flieht sie aus der Pathologie des Krankenhauses zu einem Freund. Während die Öffentlichkeit über den Unfall und den Verbleib von Majas Leiche spekuliert, sucht Maja selbst nach Antworten. Niemals hätte ihre Mutter sich das Leben genommen und sie dabei in tödliche Gefahr gebracht - oder hätte sie das? Und welche Rolle spielt Efrail Rosendahl, der Fremde, der sein Leben riskiert hat, um sie aus dem Wagen zu retten. Bevor Maja herausfinden kann, was mit ihrer Mutter passiert ist, ereignet sich plötzlich eine verheerende Naturkatastrophe nach der anderen. Und Maja gerät mitten hinein in einen Strudel aus Lügen, Intrigen und Machtkämpfen, dessen Folgen fatale Ausmaße annehmen.
Für die Menschen, die verstehen, dass nur ein Teil dieser Geschichte Fiktion ist.
(Und auch ein bisschen für Harry Styles.)
AM KUPFERGRABEN, BERLIN, 21:53 UHR
Der Ausdruck verschwindet aus ihren Augen. Dann sind sie nur noch leer und blau, wie Glaskugeln, durch die niemand mehr sieht. Ihre Hand liegt tot in meiner, ihr Blick geht ins Unendliche, an mir vorbei in ein unbestimmtes Nichts. Schmutzpartikel schweben im Wasser. Ihr Haar fließt um ihr Gesicht wie blonde Flammen. Ich will wegsehen, aber ich kann nicht. Mein Brustkorb zieht sich immer weiter zusammen, ein Gefühl, als würden meine Rippen brechen. Es dauert nicht mehr lang, dann gibt es mich nicht mehr.
Das matte Grün ist überall. Eine luftleere Hülle, die mich langsam tötet. Ich stecke fest, Blutwolken wabern um mein Knie, die Wagentür ist eingedrückt, mein Bein klemmt dazwischen.
Ich schaue durch die Windschutzscheibe nach oben in verschwommenes Licht. Helle Flecken in der Dunkelheit, die rund und oval schimmern. Nicht weit weg. Ein paar Meter vielleicht. Meine Muskeln zucken, als würden sie sich ein letztes Mal entladen. Ich höre auf zu frieren. Es ist ein leises Gefühl. Ohne Angst, schon halb auf der anderen Seite. Als würde ich mich mit einer Hand am Leben festhalten und der Rest hat bereits losgelassen. Ich spüre, dass der Bindfaden, der mich noch hier hält, jeden Moment reißen wird.
Der Nebel meiner Gedanken lichtet sich. Ich treibe ganz knapp unter meinem Bewusstsein, zwischen zwei Welten, gerade noch da, halte weiter ihre Hand. In meinem Kopf läuft kein Film, nur ein paar Fetzen aus meinem Leben. Erinnerungen, die Abschied nehmen. Sie kommen und gehen. Ich denke ein letztes Mal an alles und dann an nichts mehr. Mein Kopf leert sich, wie meine Lungen sich geleert haben. Übrig bleiben nur ihre letzten Worte: Du kannst niemandem trauen, sie stecken alle mit drin.
Das schwarze Grün pulsiert. Der Atemreflex wartet direkt an meiner Kehle. Er ist stärker als mein Verstand. Ich lasse das Wasser in meinen Mund fließen. Es schmeckt endgültig, nach Metall und nach Blut, dringt immer tiefer in meinen Rachen. Tu es, sagt die Stimme in meinem Kopf. Tu es jetzt.
Ich schaue ein letztes Mal in das tote Gesicht meiner Mutter, sehe sie an, und sie durch mich hindurch.
Dann atme ich ein.
Und sterbe nicht.
ZWEIEINHALB STUNDEN SPÄTER
Du kannst niemandem trauen, sie stecken alle mit drin.
Ich öffne die Augen und da ist nichts als Schwarz. Mehr Schwarz, als ich je gesehen habe. Ein seltsam raumloses Gefühl, wie ein Universum ohne Sterne. Die Luft ist modrig feucht, sie riecht nach gekipptem Wasser und Gummi. Ich höre mich atmen, rasselnd und flach. Sonst ist da nichts, kein Geräusch, nur eine leere Stille.
Ich liege ausgestreckt auf dem Rücken, meine Schulterblätter bohren sich in harten Untergrund – Stein, vielleicht auch Metall. Ich versuche, mich zu bewegen, aber es geht nicht, taste blind um mich. Alles ist nass und kalt. Die Enge greift auf mich über, mein Mund ist trocken, es ist zu dunkel, zu schwarz, ich will mich aufsetzen und kann nicht. Mein Atem trifft auf etwas direkt vor meinem Gesicht, vor meiner Nase, vor meinem Mund. Ich fasse um mich, berühre das glatte Material, es ist dicht, die Oberfläche gibt kaum nach, ich spüre Wasser, eine Lache, in der ich liege, durchtränkte Kleidung. Meine Finger rutschen ab, wieder und wieder. Ich taste nach einer Öffnung, einem Ausweg, einem Reißverschluss, nach irgendwas. Aber es gibt keine Öffnung, keine Luft, nur Wände, überall Wände, biegsam und dicht, zu allen Seiten geschlossen. Es fühlt sich an wie ersticken, Blut rauscht in meinen Ohren, die Luft ist abgestanden und zu oft geatmet, das Schwarz pulsiert vor meinen Augen, ich bin eingeschlossen in einer undurchdringlichen Haut aus nasser Kälte. Sie frisst sich klamm in mein Fleisch, immer tiefer, bis in die Knochen. Mein Brustkorb ist eng, meine Lungen krampfen, ich winde mich, weiß nicht, ob ich schreie, schlage um mich, kann nicht mehr denken, trete und rutsche ab. Meine Muskeln verspannen sich, sie zucken, als würde jemand Strom durch meinen Körper jagen. Ich versuche ein weiteres Mal, mich aufzusetzen, kann mich nicht aufsetzen, liege wie auf einer Schlachtbank, mit trockenem Mund und trockener Kehle, sehe flirrende Sterne, während eine Kralle in meinem Rachen nach meiner Luftröhre greift und immer fester zudrückt.
Atemnot. Dunkelblaue Fetzen, vage Erinnerungen, schwerelos, schmutziges Wasser, überall Wasser, eine grünlich graue Tiefe, die mich verschluckt, das Gesicht meiner Mutter.
Dann eine Riffelung unter meinen Fingerkuppen.
Ein Reißverschluss.
Ich erstarre, blicke mit offenen Augen ins Nichts, zwinge mich, mich zu konzentrieren, suche fieberhaft die Schließe, bekomme sie nicht zu fassen. Es ist das Innenstück, klein und glatt, nicht dazu gedacht, geöffnet zu werden. Ich atme zu hastig, verschlucke mich, muss würgen, erwische endlich den Verschluss, kralle mich mit den Fingernägeln darunter, einer reißt ein bis ins Nagelbett. Meine Hände sind kalt, aber ich lasse nicht los, schaffe es schließlich, den Reißverschluss ein kleines Stück zu öffnen. Ich denke nicht daran, wo ich bin, denke nicht ans Sterben oder Totsein, bloß an den Reißverschluss, zwinge einen Finger durch das winzige Loch, höre mich keuchen und schreien, alles dreht sich.
Dann ein Lichtstrahl. Wie ein Schlag ins Gesicht. Wie ein Hoffnungsschimmer. Kurz ein ratschendes Geräusch, nur ein paar Zentimeter, Hände, die sich durch die viel zu enge Öffnung kämpfen – meine Hände. Sie umfassen das gummihafte Material, dann reißen sie den Verschluss in einem Ruck auf.
SOFIE, BORACAY, PHILIPPINEN, ZUR SELBEN ZEIT
Der Sand ist nicht sandfarben, sondern weiß. Wie Zucker unter einem großen Himmel. Sofie hat noch nie so klares Meerwasser gesehen. Es ist so klar wie Wasser aus der Leitung. Sie schaut sich um. Die Sonne geht gerade erst auf und der Strand ist fast leer. Er scheint ihnen allein zu gehören, die Weite, die Farben, das Meer. Es umspült die schroffen Felsen mit der Madonna und den Palmen, die wie eine kleine schwarze Insel vor dem Ufer liegen. Dahinter schimmert der Ozean. Es ist ein Blau, das Sofie an Maja erinnert. An ihre Augen. An diese Mischung aus Blau und Türkis.
In der Ferne kräht ein Hahn. Sofie hatte keine Ahnung, dass es auf den Philippinen so viele Hähne gibt. Der Laut passt nicht zum Bild, aber sie hat sich daran gewöhnt. An das Krähen ab vier Uhr morgens, an den Gestank von Benzin und Abwasser, an die Schlaglöcher in den buckeligen Sandstraßen, an die Tricycles und die Mittagshitze. Sie liebt es hier. Das kleine Hotel direkt am Meer, das gute Essen, die Massagen für drei Euro pro Stunde. Sofie will hier nie wieder weg. Sie will Maja anrufen und ihr sagen, dass sie ihre Sachen packen und auf der Stelle herkommen soll. Und dann bleiben sie für immer dort. Maja, Theo und sie. In einer kleinen Hütte irgendwo am Strand. Nur das Krähen der Hähne und das Rauschen der Wellen. Und dann verliebt sich Maja in einen Filipino oder einen Japaner. Und sie sind alle glücklich.
Sofie schaut lächelnd in den Himmel. Er ist so blau, dass er beinahe schwarz wirkt, sie schließt die Augen und bohrt die Füße noch tiefer in den Sand. Das Sonnenlicht dringt rötlich durch ihre Lider, die Strahlen treffen warm auf ihre Haut. Dann beginnt ein Song von Jack Johnson in der Hotelbar hinter ihr. »Seasick Dream«. Das Lied ist leicht wie der Wind, er streicht über die Wellen wie eine große Hand über ein glattes Bettlaken.
»Kommst du mit ins Wasser?«
Sofie öffnet die Augen und blickt in Theos Gesicht. Es ist unglaublich, wie braun er bereits geworden ist. Sie selbst ist fast noch so blass wie bei ihrer Ankunft vor einer Woche. Theo steht auf und streckt ihr die Hand hin. Sofie will sie gerade nehmen, als ihr Handy auf dem kleinen Plastiktisch zwischen ihren Sonnenliegen zu vibrieren beginnt.
Ihr Blick fällt auf das Display.
»Das ist mein Vater«, sagt sie. »Ich komme gleich nach.«
»Richte ihm Grüße aus«, erwidert Theo und küsst sie auf den Mund. Seine Lippen sind kühl und schmecken nach Mango. Wenn sie für immer blieben, würden sie oft nach Mango schmecken. Sofie schaut ihm nach. Er passt gut hierher. In ihr Paradies.
Ja, sie ist glücklich …
Dann geht sie ans Telefon.
MAJA
Weiß gekachelte Wände, gefliester Boden, ein nackter Raum, Neonröhren, kaum Licht. Ich atme gierig ein, zu schnell und zu flach, muss husten, mein Blickfeld pulsiert, mein Atem kommt von allen Seiten, hallt von den Wänden wider. Ich stütze mich mit den Armen auf dem Metalltisch ab, auf dem ich sitze, schaue mich um, sehe verschwommen, ein Tränenschleier, dann heiße Spuren in meinem Gesicht. Mein Herz schlägt schnell und fremd, ein tiefes dumpfes Gefühl, das sich überall in mir ausbreitet, lauter als sonst. Meine Hände sind wässrig blau und aufgedunsen, der Reißverschluss hat Risse in meiner Haut hinterlassen, mein Zeigefinger blutet. Der Nagel steht eingerissen ab.
Ich blicke durch den Raum. Scharfe Linien und Kanten, als wäre die Welt härter geworden. Realer. Es ist kalt, vielleicht ein paar Grad über null, die nasse Kleidung macht es noch kälter. Mein Atem kondensiert, er schwebt milchig und halb durchsichtig in der klammen Luft. Meine Zähne klappern, sonst ist nichts zu hören. Ich schaue mich um. Obduktionstische auf Rollen, Metallschränke, Leichen unter weißen Laken und in Säcken. Ein Kühlschrank für Menschen.
Ein paar Sekunden lang bleibe ich reglos sitzen, zwischen den Toten und der Stille, dann klettere ich umständlich aus dem Leichensack, steif gefroren und zitternd. Ich bleibe hängen, muss mich festhalten, falle fast vom Tisch. Meine Füße sind eiskalt. Keine Schuhe. Ich bin barfuß. Dann berühre ich den Boden. Er ist rau und trocken, meine Füße sind feucht und gräulich blau. Es ist ein Boden, den man abspritzen kann, in der Mitte ein großer Gully.
Ich bemerke den Umschlag nicht gleich, er hat fast denselben Farbton wie die Fliesen. Er muss vom Tisch gefallen sein. Ich bücke mich danach und hebe ihn auf. Umweltpapier, kein Fenster, die Lasche ist nicht zugeklebt.
Ich ziehe eine einzelne Seite heraus.
Ganz oben steht Totenschein. Darunter mein Name, Maja Fria Kohlbeck. Meine Anschrift und mein Geburtsdatum. Letzter behandelnder Arzt: Dr. Volker Hauck. Sterbezeitpunkt heute um 22:47 Uhr. Identifiziert durch: Prof. Robert Stein. Robert hat mich identifiziert? Er war hier? Ich versuche, es mir vorzustellen, aber es gelingt mir nicht. Wie er neben meinem toten Körper steht und nickt. Überstellung an Prof. Dr. Greifland – auf Wunsch von Prof. Stein. Gefolgt von einer Adresse: Kolmarer Straße 4, 10405 Berlin.
Abholung morgen um 7:45 Uhr.
Todesursache:ungeklärt.
MAJA, KURZ DARAUF
Ein Geräusch lässt mich aufschauen. Das Licht im Korridor ist angegangen, eine helle Linie unter der Tür und ein quadratischer Fleck auf dem Boden. Ich bewege mich nicht, stehe neben dem Metalltisch, lauernd wie ein in die Enge getriebenes Tier, das sich bereit macht, jeden Moment anzugreifen. Mein Herz schlägt schneller, verteilt das Adrenalin in meinem Körper, plötzlich bin ich schmerzhaft wach.
Ich gehe lautlos in Richtung Tür und schaue durch das kleine Fenster in den Flur, doch es ist nichts zu sehen. Nur Licht. Ich höre Schritte und Stimmen, die näher kommen. Absätze auf Fliesen. Und das Quietschen von Gummisohlen. Mein Blick fällt auf das an die Wand montierte Telefon. Aber es ist zu spät. Ich habe keine Zeit mehr für diesen Anruf. Abgesehen davon ist die einzige Handynummer, die ich auswendig kenne, die von Sofie – und die ist auf den Philippinen.
»Ja, davon habe ich auch schon gehört«, sagt eine tiefe Männerstimme. »Wann wird sie nach Moabit überstellt?«
Jeden Moment sind sie da. Nur noch ein paar Schritte. Ich kann die beiden riechen, ja, beinahe schmecken.
»Gar nicht. Sie wird woanders hingebracht«, antwortet eine Frau. »Kam von ganz oben. Keine Ahnung, warum.«
Ich höre das Klirren von Schlüsseln, die Suche nach dem richtigen, keine Schritte mehr. Der Mann fragt etwas, ich höre nicht hin, suche nach einem Fluchtweg, entdecke eine zweite Tür am anderen Ende des Raums, mit einem grünen länglichen Aufkleber und der Aufschrift Notausgang.
Ich stopfe meinen Totenschein zurück in den Umschlag und danach beides in die Hosentasche. Dann laufe ich los. Meine Füße treffen auf Fliesen, ein nasses Geräusch, begleitet von der Frage, ob das Öffnen der Tür wohl einen Alarm auslösen wird – egal, spielt keine Rolle. Ich stoße sie auf, kein Alarm, dafür eine Stimme hinter mir: »Halt!«
Scheiße! Die Tür fällt in Schloss, der Boden ist glatt, ich renne, rutsche fast weg, laufe weiter durch leere Gänge, gräulich blaue Fliesen an den Wänden, die am Boden sind gemustert, rechts und links zweigen Türen ab, breit mit Sicherheitsglas, Beschilderungen führen durch ein Labyrinth aus Korridoren. Es ist ein Krankenhaus. Eines, in dem ich noch nie war. Alte Mauern und keine Menschenseele. Nur ich. Und die, die mir folgen.
»Bleiben Sie stehen!«
Auf einer der Türen am Ende des Flurs steht Treppenhaus. Ich stemme mich dagegen, sprinte die Stufen hoch. Ein Stockwerk, dann zwei. Die Schritte kommen näher, sie holen auf.
Ich erreiche das Erdgeschoss, sehe ein Schild mit dem Wort Ausgang, folge ihm. Da sind Betten, die durch Gänge geschoben werden, Schwestern und Ärzte, ich trete zur Seite, renne an ihnen vorbei. Beim Anblick der filigranen Schnörkel auf den Fliesen wird mir schwindlig. Alles beginnt sich zu drehen. Ich strecke die Arme aus, als könnte ich so die Wände davon abhalten, sich zu bewegen, werde langsamer, das Licht schmerzt in meinen Augen, wie Nadeln, die in mein Gehirn gestoßen werden. Vielleicht ist es ein Fehler wegzulaufen, vielleicht sollte ich einfach stehen bleiben und es erklären. Aber ich kann es nicht erklären, nichts davon, weder, was passiert ist, noch, warum ich nicht tot bin. Die Warnung meiner Mutter erwacht in meinem Kopf: Du kannst niemandem trauen, sie stecken alle mit drin. Also renne ich weiter – nur weg, egal wohin.
Eine Frau hinter mir schreit: »Haltet sie!« Aber niemand hält mich. Alles passiert zu schnell, die Welt hört auf, sich zu drehen, wird wieder gestochen scharf, schärfer als je zuvor. Am Ende des Flurs sehe ich den Ausgang, schwere Holztüren, die sich für mich öffnen. Meine Beine brennen, eine bleierne Schwäche breitet sich in mir aus, Seitenstechen, ich bekomme kaum noch Luft, höre, wie der Mann ruft: »Bleiben Sie endlich stehen!« Die Sohlen seiner Sportschuhe quietschen auf dem Boden.
Das Geräusch ist nah.
Gleich haben sie mich.
MAJA, WENIG SPÄTER
Ich werde schneller, renne blind durch die Straßen, versuche, mich an etwas zu orientieren. Es ist dunkel, ich kann die Schilder nicht schnell genug lesen, passiere sie, biege ab, erkenne die Rosenthaler Straße – auch ohne Schild. Ich laufe wie abgerichtet, wie eine Maschine im Autopilot. Keine Spur mehr von Schwäche und Schwindel, nur noch Flucht, Beine, die rennen, und ein Herz, das viel zu ruhig schlägt. Ich war nie konzentrierter, nie wacher. Du kannst niemandem trauen, sie stecken alle mit drin. Meine nackten Füße treffen auf den Asphalt, rau und körnig, voller Kanten. Wovon hat sie gesprochen? Wer steckt wo mit drin? Ich weiche Passanten aus, ihnen und ihren Blicken. Es ist spät, vielleicht schon Nacht. 22:47 Uhr, schließt es mir durch den Kopf. Da bin ich gestorben. Todesursache: ungeklärt. Wie lange ich in dem Leichensack lag, weiß ich nicht. Minuten? Stunden? Länger? Ich sehe mir über die Schulter, der Mann ist noch da, weiter weg, aber trotzdem zu nah. Als ich wieder nach vorne schaue, pralle ich mit einer Frau zusammen. Ich strauchle, fange mich aber. Sie ruft mir irgendwas hinterher, ich höre nicht hin, renne weiter, scanne den Boden vor mir, überall Glasscherben, mal kleine, mal größere. Ich versuche, ihnen auszuweichen, erkenne eine zu spät, weiß, dass ich sie in vollem Lauf treffen werde. Das Glas bohrt sich tief in meine Ferse. Sie pocht und blutet, aber ich spüre den Schmerz nicht, das Adrenalin verschiebt ihn auf später.
Rechts von mir stolpern zwei Männer aus einer Bar, der eine schubst den anderen, sie streiten, schreien sich an, es riecht nach Alkohol. Ich verlasse den Gehweg, laufe ein Stück auf der Straße weiter, ein Taxifahrer hupt mich an. Ich sehe den Rosenthaler Platz näher kommen, die beleuchteten U-Bahn-Schilder, Autos und Ampeln. Der Typ folgt mir noch immer. Ich spüre seine Anwesenheit wie einen Schatten. Es besteht kein Zweifel: Er wird nicht aufgeben.
Ich renne weiter, vorbei am Zugang zur U-Bahn, vorbei am Café Oberholz, der Gehweg ist voll mit Menschen, Nachtschwärmer und Raucher. Ich dränge mich an ihnen vorbei, sie starren gebannt auf einen Fernseher, vielleicht ein Fußballspiel. Die Ampel wechselt auf Rot, ich schaue nach links und rechts, die Tram fährt ein, Endstation Am Kupfergraben. Der Straßenname versetzt mir einen seltsamen Stich. Dann bemerke ich, dass die M1 in Richtung Niederschönhausen, Schillerstraße noch an der Haltestelle steht. Ihre Türen beginnen bereits, sich zu schließen. Ich laufe los, denke nicht, mein Herz schlägt einen festen Rhythmus gegen meine Rippen, dann springe ich ab. Kein Boden mehr unter den Füßen, nur noch Wind im Gesicht. Ich spüre den Jeansstoff, der an meinen Beinen klebt, das feuchte T-Shirt an meinem Bauch. Mein Blick ist auf die Türen gerichtet, der Spalt wird enger, sie streifen meine Schultern. Nicht wieder aufgehen, denke ich. Nicht wieder aufgehen. Meine Füße berühren den Boden, ich rutsche weg, stoße gegen einen Reisekoffer und eine Haltestange, fange mich und drehe mich sofort wieder zu den Türen. Sie sind zu.
Der Typ erreicht die Tram, er steht draußen, ich drinnen. Ich sehe sein Gesicht durch die staubigen Scheiben. Es ist rot, Schweißperlen glänzen auf seiner Stirn. Er starrt mich an, direkt in meine Augen. Es ist ein Blick, als wäre das, was er sieht, nicht möglich.
Dann fährt die Tram los und unser Blickkontakt reißt ab.
SOFIE
»Bist du noch dran?«
Sie ist noch dran. Doch sie kann nicht sprechen. Als hätte dieser eine Satz sie gelähmt. Wie ein Gift, das so verzögert wirkt, dass das Opfer seinen eigenen Tod noch mitbekommt.
»Liebling?«
Die Stimme ihres Vaters ist sanft und weit weg. Alles ist weit weg. Das Meer, Theo, sie selbst.
»Wenn du nach Hause willst, kann ich das organisieren.«
Nach Hause, denkt Sofie und weiß nicht mehr, wo das ist.
»Sag mir, was ich tun kann«, sagt ihr Vater.
Aber er kann nichts tun. Sie hat ihn niemals zuvor machtlos erlebt, noch nie in ihrem ganzen Leben. Doch in diesem Fall ist er es.
»Wann ist die Beerdigung?«, fragt Sofie und ihre Stimme klingt so fremd, dass es auch die einer anderen sein könnte.
Ihr Vater schluckt. Sie hört es. »Das steht noch nicht final fest«, sagt er. »Wir müssen noch die Obduktion abwarten.«
»Die Obduktion?«, fragt sie matt.
»Die Unfallursache ist unklar«, antwortet er. »Das ist das übliche Prozedere.«
»Wird Maja auch obduziert?« Sofies Stimme bricht wie ein dünner Zweig.
»Ja«, sagt ihr Vater. Mehr nicht.
Sie nickt langsam. Die Bilder in ihrem Kopf sind entsetzlich. Sofie will sie nicht sehen, aber sie gehen nicht weg. Die Pathologie einer Klinik, bläuliches Licht, Maja, die nackt auf einem Metalltisch liegt, ein Gerichtsmediziner, der ihren Brustkorb aufsägt.
»Wo seid ihr gerade?«
Sofie ist froh um diese Frage, sie lenkt sie kurz von den Bildern ab.
»Auf Boracay«, sagt sie.
»Soll ich euch dort abholen lassen?«
Sofie kann nicht antworten. Sie weiß es nicht. Sie weiß gar nichts. Ihr Körper fühlt sich an wie betäubtes Zahnfleisch. Sie begreift nicht, was passiert ist. Dass es passiert ist. Sie hat den Satz genau gehört, beide Male, doch er hat sie nicht erreicht.
Maja ist tot.
Aber sie kann nicht tot sein. Sofie hat vorgestern noch mit ihr gesprochen. Worüber, weiß sie nicht mehr. Wie kann sie es nicht mehr wissen? Es war erst vor zwei Tagen.
»Soll ich jemanden schicken, Liebes?«, fragt ihr Vater ruhig.
»Ich muss mit Theo sprechen«, erwidert sie.
»In Ordnung«, sagt er. »Ich fliege morgen am späten Nachmittag nach Israel. Aber Verena kannst du immer erreichen. Tag und Nacht.«
»Okay«, sagt Sofie.
»Ruf an, ja?«
»Okay«, sagt sie noch einmal. Dann legt sie auf.
MAJA
Die Trambahn ruckelt die Straße entlang. Ich sinke auf einen der freien Plätze. Meine Haare sind nass, rotschwarze Spuren übersäen den Boden. Blut und Dreck. Sie führen von den Türen bis zu meiner Ferse. Es tut noch immer nicht weh. Aber das wird nicht mehr lang dauern. Die Streckenanzeige wechselt und kündigt die nächste Station an: Zionskirchplatz. Daneben steht 01:13 Uhr.
Ich schließe kurz die Augen. 01:13 Uhr. Ich will einfach nur nach Hause, aber der Weg dorthin ist weit und ich bin müde. Abgesehen davon habe ich keinen Schlüssel. Und Sofie ist verreist, ich komme also nicht in die Wohnung. Und ich habe kein Geld. Daniel wohnt keine fünf Minuten von hier. Und er verlässt so gut wie nie das Haus. Abgesehen davon hat er unseren Ersatzschlüssel. Ich könnte bei ihm duschen und die Wunde versorgen. Bei ihm übernachten.
Kurz denke ich, dass ich nicht aufstehen kann. Und ich will auch nicht aufstehen. Am liebsten würde ich für immer hier sitzen bleiben. Genau hier. Alle Kraft, die ich eben noch hatte, ist aufgebraucht. Ich bin ein kleiner Rest, der übrig ist, gerade noch in der Lage, zu atmen und zu sitzen.
Trotzdem tue ich es. Ich zwinge mich auf die Füße. Als meine Ferse den Boden berührt, entlädt sich der Schmerz wie ein Stromschlag in mein Bein. Die Trambahn hält und die Türen gehen auf. Ich steige aus, dann stehe ich an der Haltestelle und sehe mich um. Viele Gesichter, aber seins ist nicht dabei. Er ist mir nicht gefolgt.
Ich überquere schwerfällig die Straße, humple den Gehweg hinunter. Und während ich gehe, versuche ich zu rekonstruieren, was in den vergangenen Stunden passiert ist. Die einzelnen Stücke zu einem Ganzen zu formen. Aber es bleiben Lücken. Offene Fragen ohne Antworten. Ich weiß, wer ich bin und wann ich geboren wurde – und das nicht nur, weil es auf meinem Totenschein stand. Ich weiß auch, wo ich heute Nachmittag war – und dass ich nicht das getan habe, was ich ursprünglich vorhatte. Genauso wenig wie die letzten beiden Male.
Ziemlich genau dann kommt der Riss. Was dazwischen geschehen ist, ist weg. Als würde ich durch eine beschlagene Scheibe schauen. Dunkelblaue Fetzen. Umrisse. Todesursache: ungeklärt. Was ist passiert?
Ein paar Meter vor mir blockieren Leute den Gehsteig. Sie stehen da und schauen in einen Fernseher. Und irgendwas an der Situation stimmt nicht. Die seltsame Stille. Die Anspannung. Es ist keine Fußballstimmung. Kein Bier, kein Gegröle, nur steife Körper und stumme Mienen. Ein paar von ihnen wirken betroffen, andere ungläubig. Keiner spricht.
Ich bleibe stehen und stütze mich mit einer Hand an der Hausmauer neben mir ab, um meinen Fuß zu entlasten.
Dann sehe ich, was sie sehen.
Und ein Teil der Erinnerung kommt zurück.
DANIEL, CHORINER STRASSE 57, 10435 PRENZLAUER BERG
Er sitzt vor dem Fernseher, als es klingelt. Daniel ist allein in seiner Wohnung. Wie so oft. Neben ihm auf dem Bett liegt eines von Majas getragenen T-Shirts. Sie hat es neulich nachts angehabt und er hat es nicht gewaschen, weil er nicht wollte, dass es ihren Duft verliert.
Als Sofie ihn angerufen hat, war er gerade dabei, Kaffee zu machen. Das Pulver ist im Filter, das Wasser im Kocher. Daniel ist nicht mehr dazu gekommen, auf Start zu drücken. Jetzt sitzt er da und schaut leer in den Fernseher. Eine Sondersendung. In der rechten Hand hält er noch immer den Kaffeelöffel.
Es klingelt ein zweites Mal, doch Daniel steht nicht auf. Die Leute klingeln oft bei ihm – auch nachts –, weil sie wissen, dass er meistens zu Hause ist. Und lange wach. Normalerweise öffnet er ihnen auch. Aber nicht heute. Heute tut er gar nichts mehr. Nur dort sitzen, auf seinem Bett, und es nicht begreifen. Weil die Wahrheit größer ist als sein Verstand. Die Fassungslosigkeit lähmt ihn. Vor nicht mal ein paar Stunden hat er noch auf diesem Bett mit Maja geschlafen. Auf derselben Matratze, auf der er gerade sitzt. Der Bezug hat ihren Schweiß aufgesaugt. Maja hat auf der Bettdecke gelegen, nackt und mit geschlossenen Augen. Er auf ihr, in ihr. Daniel sieht den Moment, sie unter sich in den Laken, Haut auf Haut. Danach hat er sie festgehalten, ein paar Minuten der Stille, nur ihr schwerer Atem. Daniel will sich in dieser Erinnerung auflösen wie eine Tablette in einem Glas Wasser.
Aber das Klingeln lässt ihn nicht. Es hört einfach nicht auf, wird zu einem Sturm. Daniel fährt unvermittelt hoch, die Wut packt ihn so plötzlich, dass es ihn überrascht. Er schleudert den Kaffeelöffel auf den Boden, durchquert mit schnellen Schritten den Raum, erreicht die Wohnungstür, reißt den Hörer von der Gegensprechanlage und schreit ein »Was?!« hinein.
Für die Dauer eines Augenblicks ist es absolut still, sein Gesicht angespannt, alle Muskeln gleichzeitig. Bis er ihre Stimme hört. Nur drei Wörter und sein Zorn fällt in sich zusammen. Übrig bleibt Ungläubigkeit. Und ein Rauschen in seinen Ohren.
Daniel steht da und starrt auf die Wand, auf ein unsauber gestrichenes Weiß. Dann öffnet er die Wohnungstür und lauscht in den Flur. Seine Hände sind taub. Er hört hallende Schritte, die lauter werden. Es ist ihr Rhythmus – und doch auch wieder nicht. Als würde sie mit einem Fuß fester auftreten als mit dem anderen. Trotzdem erkennt er ihren Gang. Er kennt ihn genau, er hat oft dort oben gestanden und darauf gewartet, dass ihr Gesicht über dem Geländer erscheint.
Ich bin’s. Maja.
Dann endlich sieht er sie. Müde und abgeschlagen, mit Schatten unter den Augen. Eine Schürfwunde am Hals. Sie ist blass und schön.
Daniel hätte nicht gedacht, dass er sie je wiedersieht.
MAJA
Ich weiß nicht, wo er anfängt und ich aufhöre. Oder wer wen zusammenhält. Ich atme langsam ein und aus, spüre ein scharfes Brennen hinter meinen geschlossenen Lidern. Die Wohnung riecht noch nach uns. Nach Daniel und mir. Nach einem Hauch von Schweiß und unseren Körpern. Ein kleiner Rest Sex, den wir im Bettzeug zurückgelassen haben. Das war vor ein paar Stunden. Am späten Nachmittag. Als ich gekommen bin, um es zu beenden, und wieder nur gekommen bin.
Daniel vergräbt sein Gesicht in meiner Halsbeuge, küsst mich auf die Schläfe, auf die Wange, murmelt belegt: »Du lebst.« Er sagt es immer wieder. Seine Arme liegen um mich wie ein Versteck, in dem mich niemand findet.
Wir stehen neben der offenen Wohnungstür, im Hintergrund läuft der Fernseher. Der Ton ist kaum zu hören, nicht mehr als ein dumpfes männliches Flüstern. Als ich die Augen öffne, sehe ich mein Gesicht. Eine Version von mir mit hochgesteckten Haaren und stark geschminkten Augen. Ein Blick in die Vergangenheit. Das Foto zeigt meine Mutter und mich in bodenlangen Roben. Es ist vor zwei Jahren auf einer Benefizveranstaltung entstanden. Vielleicht auch vor zweieinhalb. Ich erinnere mich daran, wie sie damals in ihrem begehbaren Schrank stand, zwei Abendkleider hochhielt und fragte: »Welches davon soll ich anziehen? Das schwarze oder das hellblaue?« Und wie ich antwortete: »Das hellblaue.« Weil es denselben Farbton hatte wie ihre Augen. Dieses beinahe eisige Blau. Sie sah schön aus an jenem Abend. Das tat sie oft.
Ich löse mich aus Daniels Armen und es wird schnell kühl ohne ihn. Er drückt die Wohnungstür ins Schloss, ich schaue stumm in den Fernseher. Unten links im Bild steht Brennpunkt. Der Moderator trägt Schwarz. Ich bücke mich nach der Fernbedienung, die neben dem Bett auf dem Boden liegt, und mache lauter.
»Was die genaue Ursache für den Unfall war, bei dem die Innenministerin Dr. Patricia Kohlbeck und ihre Tochter Maja tödlich verunglückten, ist derzeit noch unklar. Ein Krisenstab wurde zusammengestellt und mit der Aufklärung des Vorfalls beauftragt, ein Sondereinsatzkommando hat die Ermittlungen aufgenommen.
Von der Kanzlerin selbst gibt es bislang noch keine Stellungnahme. Diese wird jedoch direkt nach ihrer Landung in Kopenhagen erwartet, wo sie als eine der Abgesandten der Europäischen Union an der Welt-Klimakonferenz teilnimmt.
›Das Einzige, was wir zum jetzigen Zeitpunkt mit Sicherheit sagen können, ist, dass die Bundesinnenministerin, Dr. Patricia Kohlbeck, in einen schweren Autounfall verwickelt war. Es ist noch zu früh, um genauere Angaben zu den Hintergründen oder dem Unfallhergang zu machen‹, so der Sprecher des Innenministeriums Markus Dornbusch bei einer Sonderpressekonferenz.
Augenzeugen berichten von einem schwarzen Audi A8, der heute Abend gegen 21:45 Uhr Am Kupfergraben ungebremst das Geländer des Spreeufers durchbrach und dann in den Fluss raste. Mehrere Passanten verständigten umgehend den Rettungsdienst. Einer von ihnen, der einunddreißigjährige Efrail R., riskierte sein Leben bei dem Versuch, die Opfer aus dem Wagen zu befreien. Seiner Aussage zufolge kam jede Hilfe für die Innenministerin zu spät. Ihre Tochter hingegen war noch bei Bewusstsein. Efrail R. ist es zu verdanken, dass Maja Kohlbeck noch lebend aus dem Wrack geborgen werden konnte. Sie verstarb dann jedoch nur wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus.«
Daniel nimmt mir die Fernbedienung aus der Hand und schaltet auf stumm.
»Was ist passiert?«, fragt er.
Ich starre auf den Bildschirm, in das Gesicht meiner Mutter. Da sah sie noch aus wie sie. Unter Wasser dann nicht mehr. Als hätte es sie geschluckt, sie festgehalten unter der Oberfläche, dicht wie Quecksilber. Auf dem Foto lächelt sie. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nie wieder lächeln wird. Dass es sie nicht mehr gibt.
Daniel legt seine Hand auf meine Schulter. Ich schaue ihn an. In ernste Augen, seine Stirn ist gerunzelt, eine steile Falte steht zwischen seinen Brauen. Er weiß, dass ich nicht antworten werde. Weil ich nicht kann. Dann nickt er, als hätte er mein Schweigen verstanden. Er drückt sanft meinen Arm, Daniels Blick fällt auf den kleinen See aus Blut, der sich um meine Ferse gebildet hat.
»Soll ich mir das mal anschauen?«, fragt er.
Ich nicke.
Er verschwindet nebenan im Badezimmer und kommt wenig später mit einem Verbandskasten, Desinfektionsmittel und einer mit Wasser gefüllten Plastikwanne zurück.
»Geh zum Bett«, sagt er.
Genau das hat er vor ein paar Stunden schon einmal zu mir gesagt. Nur in einem völlig anderen Zusammenhang. In einem anderen Tonfall. In einem ganz anderen Leben. Daniel sieht mich an. Und da weiß ich, dass wir beide dasselbe denken.
Er weicht meinem Blick aus und ich setze mich auf die Bettkante. Daniel geht vor mir in die Hocke, greift nach meinem Fuß und fängt an, die Wunde zu säubern. Es ist mir unangenehm, aber ich sage nichts. Schmutz und Blut färben das Wasser.
»Tut es sehr weh?«, fragt Daniel.
Ich schüttle den Kopf. »Es geht.«
Er trocknet meine Ferse mit einem sauberen Handtuch ab. Der weiße Stoff saugt sich voll. Daniel untersucht die Verletzung. Es ist der inspizierende Blick eines Medizinstudenten, fokussiert und ernst. Man sieht, dass ihm Blut nichts ausmacht. Er desinfiziert die Wunde. Ich halte still, obwohl es brennt.
»Der Schnitt ist tief«, sagt er. »Das muss genäht werden.«
»Ich gehe nicht ins Krankenhaus«, sage ich.
Daniel nickt langsam, so als hätte er nichts anderes von mir erwartet.
»Ich kann es hier machen.« Kurze Pause. »Aber ich habe nichts zum Betäuben da.« Er mustert mich. Sein Blick sagt: Das wird verdammt wehtun.
Ich sage: »Ist okay.«
Daniel zögert einen Moment, doch dann steht er auf und nimmt einen Stuhl. Er stellt ihn vor das Bett und platziert mein Bein so, dass meine Ferse ein Stück über die Kante der Sitzfläche ragt. Danach setzt er sich auf den Boden und zieht Einweghandschuhe an. Er desinfiziert erst meinen Fuß, dann seine Hände.
»Ich brauche mehr Licht«, sagt er und macht eine Kopfbewegung in Richtung Nachttischlampe. Ich strecke mich danach und verstelle den Schirm.
»So?«, frage ich.
»Ja«, sagt Daniel und reißt zwei Zellophanverpackungen auf. Es sind geübte Handgriffe, ruhig und präzise. Bevor er zu nähen beginnt, schaut er noch einmal hoch, direkt in meine Augen. »Und du bist dir sicher?«, fragt er.
»Ich bin mir sicher«, sage ich.
»Nicht bewegen.«
»Okay.«
Wir sehen einander an, ein, vielleicht zwei Sekunden, dann senkt er den Blick und beinahe im selben Moment schießt der Schmerz heiß durch meinen Fuß.
»Worüber wollte deine Mutter mit dir sprechen?«, fragt Daniel.
Ich kann nicht denken, auch nicht antworten, der Schmerz frisst sich durch meinen Verstand. Ein Brennen und Stechen, das sich ausbreitet.
Daniel stellt die Frage noch einmal. Er will mich ablenken. Und ich lasse mich ablenken. Versuche, mich zu erinnern. Daniel setzt zum zweiten Stich an, ich schließe die Augen und presse die Lippen aufeinander, gebe keinen Laut von mir. Meine Hände krallen sich ins Bettzeug. Und ich halte still.
Es war Viertel nach neun, als mein Handy geklingelt hat. Ihr Anruf kam aus dem Nichts. Als würde sich eine Tote bei einem melden. Eine Tote, denke ich. Ich lag nackt auf Daniel. Auf diesem Bett. Er war noch in mir. Alles an dieser Situation war falsch.
Meine Mutter stand schon vor der Tür. Ich weiß nicht, woher sie wusste, wo ich war, woher sie die Adresse kannte. Ich hätte sie fragen sollen. Vielleicht habe ich das ja und weiß es nur nicht mehr. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen.
Der Schmerz in meiner Ferse wächst und breitet sich langsam aus, er zieht in den Mittelfuß und die Wade hoch. Ich schlucke dagegen an und halte weiter still.
Sie wartete vor Daniels Haustür. Ein Panzer von einem Wagen, in der zweiten Reihe geparkt. Sie ist selbst gefahren, saß nicht wie sonst hinten. Ich tauche ein in den zähen Brei aus Erinnerungen. In die klebrige Masse aus Bildern und Worten, bei der ich nicht weiß, was wahr ist und was nicht. Ich sehe meine Mutter und mich im Auto sitzen. Sie angespannt und fahrig und ich auf einmal wieder das Kind, das ich nicht mehr sein wollte, ein paar Jahre jünger in nur ein paar Minuten. Sie hat immerzu in den Rückspiegel geschaut. Tausend nervöse Blicke. Ich habe keine Ahnung, wohin sie wollte. Sie hat es mir nicht gesagt. Oder ich erinnere mich nicht. Aber ich erinnere mich an ihren letzten Gesichtsausdruck. Daran, wie ich zugesehen habe, wie das Leben aus ihren Augen verschwand. Wie eine Kerze, die man ausbläst. Und an das, was sie kurz davor noch zu mir sagte. Kurz bevor der Wagen volllief und wir nur noch Blicke hatten.
»Fertig«, sagt Daniel.
Ich öffne die Augen. Er verbindet bereits meinen Fuß.
»Danke«, sage ich leise.
Er antwortet nicht, lächelt nur. Mit dem Mund und mit den Augen. Dann sagt er: »Du musst Sofie anrufen.«
»Ich will nicht, dass sie sich Sorgen macht«, erwidere ich. »Ich glaube kaum, dass sie auf den Philippinen irgendwas davon mitbekommen hat.«
»Hat sie«, widerspricht Daniel. »Ihr Vater hat es ihr gesagt.«
Natürlich hat er das, denke ich. Identifiziert von Prof. Robert Stein.
»Du hast mit ihr gesprochen?«
Daniel nickt. »Sie hat mich vorhin angerufen.«
»Wo sind sie gerade?«, frage ich.
»Auf Boracay.«
ST. HEDWIG-KRANKENHAUS, GROSSE HAMBURGER STRASSE 5–11, 10115 BERLIN
»Was soll das heißen, sie ist verschwunden?«, fragt Dr. Hauck mit einem müden bis gereizten Unterton in der Stimme. Den Blick hält er gesenkt, studiert im Gehen eine Krankenakte.
»Genau das«, sagt Dr. Merten betont leise. »Sie ist verschwunden.«
Hauck bleibt stehen und schaut auf.
»Sie kann nicht verschwunden sein«, entgegnet er. »Maja Kohlbeck ist tot. Ichselbst habe ihren Tod festgestellt.«
»Das ist mir klar. Ich war anwesend«, sagt Dr. Merten ruhig. »Aber ich habe sie gesehen. Es war Maja Kohlbeck.«
Dr. Hauck atmet tief ein. Er ist ein viel beschäftigter Mann, hat eine Station zu leiten, Patienten, die ihn brauchen, das braucht er nicht.
»Gibt es denn noch irgendwelche anderen Anhaltspunkte?«, fragt Dr. Hauck. »Ich meine, einmal abgesehen von Ihrer Aussage?«
»Nun ja«, sagt Merten, »da wäre dann noch das Fehlen der Leiche.«
Hauck nickt. Es kommt vor, dass Leichen verschwinden. Das passiert öfter, als man denkt. Meistens tauchen sie nach kurzer Zeit wieder auf. Irgendjemand bringt sie irgendwohin, sie werden verwechselt, etwas wird falsch beschriftet. Das passiert. Wenn es allerdings stimmt und Merten sagt die Wahrheit, wenn Maja Kohlbeck wirklich noch lebt, wäre das ein Skandal. In diesem Fall hätte nämlich er – Hauck – die Tochter der Innenministerin fälschlicherweise für tot erklärt. Und das kann nicht sein.
Sie war tot. Da ist er sich sicher, er geht jeden Schritt gedanklich noch einmal durch und kann keinen Fehler finden. Alles ist genau nach Vorschrift abgelaufen. Ein tragisches Unglück, ja, aber Maja Kohlbeck war tot. Und Merten, dieser schmierige Aasgeier, ist schon eine ganze Weile hinter seinem Posten her. Der lauert doch nur auf eine Chance, ihn abzusägen. Hauck weiß das. Trotzdem fragt er sich, was er übersehen haben könnte. Ob Merten doch recht haben könnte. Sie stehen nebeneinander im Flur, Hauck hält sich an der Krankenakte fest. Schließlich sagt er: »Kümmern Sie sich darum.«
»Ist gut«, sagt Merten.
»Davon darf nichts nach außen dringen. Wir würden ziemlich blöd dastehen.«
»Wir?«, fragt Merten selbstgefällig.
»Ja, wir. Die Klinik, ich … Sie.«
Merten runzelt die Stirn. »Wieso ich?«
»Wie Sie vorhin selbst sagten«, Hauck lächelt abgeklärt, »Sie waren dabei. Sie standen direkt neben mir, als ich Maja Kohlbeck für tot erklärte. Wenn ich damit falschlag, hätten Sie eingreifen müssen. Und das haben Sie nicht. Sie verstehen, was ich sagen will?«
Die beiden Männer sehen einander an. In Mertens Blick flackern Widerworte auf, die er nicht aussprechen wird, das weiß Hauck. Es ist immer dasselbe mit den Ambitionierten. Sie wollen unbedingt aufsteigen, unterschätzen aber, was es für Konsequenzen hat, sich mit den Falschen anzulegen. Und er ist der Falsche. Es gibt einen guten Grund, weshalb die alten Hasen da sind, wo sie sind. Wenn ein Kopf rollt, wird es sicher nicht seiner sein.
»Ich erledigte das«, sagt Merten.
»Guter Mann«, sagt Hauck. »Ich wusste, wir verstehen uns.«
MAJA, EINE STUNDE SPÄTER
»Geh endlich duschen«, sagt Daniel und zeigt auf die Tür zum Badezimmer.
»Ich muss Sofie anrufen«, erwidere ich.
»Das versuchst du jetzt bereits seit über einer Stunde.« Er nimmt mir das Handy weg. »Sie hat kein Netz.«
»Sie denkt, ich bin tot«, fahre ich ihn an.
»Ich weiß«, sagt er und sieht mir direkt in die Augen. »Ich suche die Nummer des Hotels raus und du gehst duschen.« Bevor ich widersprechen kann, reicht er mir eine kleine Plastiktüte und fügt hinzu: »Mach die um den Verband. Die Wunde darf nicht nass werden.«
Ich stehe nackt im Bad und trinke aus dem Wasserhahn. Der Durst ist wie ein Fieber. Ich stütze mich auf dem Waschbecken ab und kann nicht aufhören zu trinken. Irgendwann tue ich es dann doch und betrachte mich im Spiegel. Ein paar Tropfen laufen über mein Kinn und meinen Hals. Ich wische sie mit einem Handtuch weg und lege es zur Seite. Der Durst ist noch da. Ich ignoriere ihn.
Durch das gekippte Fenster dringen die nächtlichen Geräusche der Stadt in den Raum. Autos, Menschen, Stimmen. Sie kommen mir lauter vor als sonst. Ich betrachte mein Gesicht. Meine farblose Haut. Ein blasses Grau, durchsetzt von verzweigten Äderchen. Zusammen mit den dunklen Haaren wirke ich fast schwarz-weiß. Wie eine Kohlezeichnung auf porösem Papier. Nur meine Augen sind in Farbe. Und die Blutergüsse. Lilablau mit grünen Schatten. Es ist ein seltsam vertrauter Anblick, mein Körper mit so vielen Prellungen, Schürfwunden und Kratzern. Ich sah oft so aus. Und wusste nie, warum. Ich weiß es bis heute nicht. Es ist ein Rätsel geblieben, das ich irgendwann hingenommen habe.
Ich war vier oder fünf, als es das erste Mal passierte. Vielleicht war ich auch jünger und kann mich an die Male davor einfach nicht erinnern. Meine Mutter hat mich an jenem Abend ins Bett gebracht. Alles war wie immer. Bis ich aufgewacht bin. In diesem kleinen Waldstück, das an das Anwesen meiner Mutter grenzt. Es war dunkel, aber eine Art der Dunkelheit, in der man sehen kann, ganz kurz bevor es zu dämmern beginnt. Ich lag auf der feuchten Erde, mein Nachthemd nass und schmutzig, mein Haar voller Blätter. Es war im Herbst. Ich habe nicht geweint, ich hatte nicht mal besonders große Angst, ich saß einfach nur da und wartete darauf, dass es hell wird. Dann ging ich nach Hause.
Von da an passierte es oft. Phasenweise fast jede Nacht. Über Monate hinweg. Meine Mutter war ratlos. Sie verschloss jeden Abend alle Türen und Fenster, aber irgendwie kam ich trotzdem raus. Mit der Zeit wurde es unregelmäßiger, geschah nur noch alle paar Wochen. So blieb es eine Weile. Meine Mutter schickte mich zum Kampfsport. Irgendwie musste sie ja die Blutergüsse erklären. Also begann ich mit Krav Maga. Ein halbes Jahr später dann mit Boxen. Beides ist mir leichtgefallen. Wenn mich jemand auf meine Wunden, Abschürfungen und blauen Flecken angesprochen hat, konnte ich es auf das harte Kampftraining schieben. Im Krav Maga sagte ich, es käme vom Boxen, im Boxen, vom Krav Maga.
Als ich dreizehn war, hörte das mit dem Schlafwandeln mit einem Mal auf. Mit dem Kampfsport machte ich weiter. Zwei Jahre lang blieb es ruhig. Bis es wieder anfing. Einfach so, ohne erkennbaren Grund. Ich weiß nicht, was genau es auslöst oder was ich tue, während ich denke, dass ich schlafe. Ich habe nie ein Muster erkennen können. Vielleicht gibt es keins. Vielleicht auch doch.
Sofie und Daniel wissen Bescheid. Daniel nur deswegen, weil es einmal in seinem Beisein passierte. Erzählt hätte ich es ihm nicht. Er wachte auf, als ich gerade im Begriff war, seine Wohnung zu verlassen. Er meinte, ich habe ausgesehen, als wäre ich wach, hätte jedoch auf nichts reagiert – nicht auf ihn, nicht auf seine Stimme. Wie ein ferngesteuerter Soldat.
Ich frage mich, ob meine Mutter je beobachtet hat, was in diesen Nächten geschah. Bestimmt hat sie das. Immerhin reden wir hier von meiner Mutter. Gesagt hat sie es mir nie. Aber sie hat mir vieles nicht gesagt.
Ich schließe die Augen und sehe, wie sie barfuß durchs Haus geht und sich mit dieser ganz bestimmten Handbewegung das Haar aus dem Gesicht streicht. Es war immer dieselbe, immer diagonal. Eine von den Gesten, die einen Menschen ausmachen. Als ich klein war, hat sie mir auch die Haare so aus der Stirn gestrichen. Und wenn ich nicht schlafen konnte, hat sie mich in die Arme genommen und festgehalten. Mein Kopf lag dann auf ihrer Brust und sie hat leise vor sich hin gesummt. Ihr gesamter Körper hat vibriert. Sie hatte die beste Stimme, die man haben kann. Tief und ruhig. Und ich habe die Augen geschlossen und gespürt, wie sie bis in meine Knochen drang. Es war das sicherste Gefühl der Welt. Dieses Vibrieren und ihre Arme. Solange sie da war, hatte ich nie Angst. Jetzt ist sie tot.
Ich hatte vergessen, dass sie auch gute Seiten hatte.
MAJA, WENIG SPÄTER
Sofie hat noch immer kein Netz. Und bei der Nummer, die Daniel rausgesucht hat, geht keiner ran. Es klingelt so lange, bis irgendwann das Besetztzeichen ertönt. Vielleicht ist Sofie schon auf dem Weg nach Hause. Vielleicht sitzt sie bereits in einer Maschine nach Deutschland. Für Robert wäre es kein Problem, so einen Rücktransport zu organisieren. Ein Anruf, und jemand holt sie ab.
Ich lege Daniels Handy zur Seite. Dann fällt mein Blick auf den eingerissenen Zeigefingernagel meiner rechten Hand. Ich nehme die kleine Schere, die auf der Ablage liegt, und schneide das abstehende Stück vorsichtig weg. Das Blut ist getrocknet, mein Fleisch scheint rosa hindurch.
Einen Augenblick stehe ich einfach nur da. Zu müde, um mich zu bewegen. Auf eine Art erschöpft, die ich so nicht kannte. Rein körperlich, die Muskeln, die Knochen. Als wären mein Kopf und mein Körper siamesische Zwillinge, zwei Wesen, die sich arrangieren müssen, aber nicht dasselbe wollen. Der eine schlafen, der andere nicht. Also tue ich, was Daniel gesagt hat: Ich gehe duschen. Den Tag von meinem Körper schrubben. Und mit ihm alles, was passiert ist.
Ich greife nach der Plastiktüte, die neben dem Waschbecken liegt, stülpe sie über meinen bandagierten Fuß und klebe die Öffnung mit Leukoplast zu. Dann gehe ich zur Badewanne, die Tüte knistert auf den Fliesen, ich halte mich fest und steige über den Wannenrand, ziehe den Duschvorhang zu und drehe das Wasser auf. Es prasselt auf mein Gesicht wie Regen. Eine Weile stehe ich so da, vollkommen reglos im Wasser, dann öffne ich den Mund und trinke ein paar Schlucke. Aber das trockene Gefühl im Rachen geht einfach nicht weg. Ich spüre, wie die kühle Flüssigkeit meine Kehle benetzt, doch es ändert nichts, macht es eher noch schlimmer.
Ich höre auf zu trinken und wasche mir die Haare. Dann greife ich blind nach einem Duschgel. Es riecht nach Mann, aber das ist mir egal. Ein herber Duft, den ich gut von Daniels Haut kenne. Ich seife mich damit ein. Es sind automatische Abläufe, als wüsste mein Körper allein, wie duschen geht. Als bräuchte er mich dafür nicht, als wäre ich nur dabei. Ich spüle den Schaum aus meinen Haaren, von meinem Bauch und den Beinen, dann stelle ich das Wasser ab und wickle mich in ein Handtuch.
Ich stehe noch tropfnass in der Badewanne, als ich nach Daniels Handy auf der Ablage greife und ein weiteres Mal bei Sofie anrufe. Keine Verbindung. Dann trockne ich mich ab, schlüpfe in die Jogginghose und das Unterhemd, das ich noch bei Daniel hatte, und schaue in den noch leicht beschlagenen Spiegel. Mein Blick ist ernst. So, wie es der meiner Mutter oft war. Wenn man nicht weiß, dass ich ihre Tochter bin, kann man es nicht sehen. Aber wenn man es weiß, kann man es erkennen. Ich schaue in meine Augen und suche nach ihren, suche sie in mir. Normalerweise klappt das. Aber nicht heute.
Irgendwas ist falsch. Erst weiß ich nicht, was es ist, doch dann sehe ich es. Es ist der Farbton. Das Blau ist zu dunkel, zu fließend, nicht wie Eis, eher wie dunkle Tinte, die in Wasser verläuft. Ich rücke näher an den Spiegel heran, so nah, dass sich mein Atem als Dunst auf die Oberfläche legt, und betrachte meine Iris. Den scharfen Ring, der sie nachtgrau vom Weiß des Augapfels trennt. Er sieht aus wie immer. Ganz im Gegensatz zu meiner Regenbogenhaut mit diesem Kranz aus rötlichem Braun, der das Blau durchbricht. Ein Bernsteinton, der sich wie Feuer um meine Pupille ausbreitet.
Es muss am Licht liegen. Eine optische Täuschung.
Aber es ist dasselbe Licht wie sonst auch.
DANIEL, NEBENAN
»Es handelt sich dabei ja um Panzerglas«, entgegnet einer der Experten im Fernsehen. »Das tritt man nicht so einfach ein.«
Daniel steht auf und geht zum Kühlschrank. Er holt alles heraus, was er braucht, um Sandwiches zu machen, bestreicht die Toastscheiben mit Butter, belegt sie dann mit Cheddar und Tomaten. Mehr hat er ohnehin nicht da.
»Bedeutet das dann nicht eigentlich im Umkehrschluss, dass die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen in Dienstwagen von Politikern letzten Endes zum Sicherheitsrisiko, im Fall der Innenministerin gar zur Todesursache werden können?«
Daniel legt die Sandwiches ins heiße Olivenöl. Der Käse schmilzt und quillt zwischen den Toastscheiben am Rand heraus. Grilled Cheese, so wie Maja es mag.
»Daskannmangenerellsonichtsagen«, erwidert der Experte. »Feststehtallerdings,dassnachderzeitigenKenntnissendas eindringende Wasser zu Kurzschlüssen in der Elektronik geführt hat, was es nahezu unmöglich machte, ohne Hilfe von außen aus dem Wagen zu kommen.« Pause. »Selbst mit Hilfe von außen wäre es kaum zu machen. Der hohe Wasserdruck, die Dicke der Verglasung …«
Maja kommt barfuß in die Küche. Sie wirkt angespannt. Ihre Stirn liegt in Falten. Daniel will nicht fragen, ob es ihr gut geht – denn wie könnte es ihr gut gehen nach so einem Tag? –, aber er will auch nicht nichts sagen, ihre Anspannung einfach ignorieren.
»Bist du okay?«, fragt er vorsichtig.
Sie nickt.
»Ich hab uns was zu essen gemacht. Ich dachte, du hast bestimmt Hunger.«
Sie schaut in die Pfanne.
»Das riecht gut«, sagt sie.
Sie steht neben ihm in Jogginghose und einem weißen Unterhemd, trägt keinen BH, das Haar hat sie lose zusammengebunden, sie ist ungeschminkt. So mag er sie am liebsten. So pur. Es ist eine Art von verletzlicher Nacktheit, die ihn seltsam berührt. Unverstellt und echt. Daniel liebt es, wenn sie so durch seine Wohnung geht. Als wäre sie seine Freundin. Als wäre sie bei ihm zu Hause.
»Hast du Sofie erreicht?«, fragt er, während er die Sandwiches auf zwei Teller legt und in der Mitte durchschneidet.
»Nein«, sagt Maja. »Am Handy konnte keine Verbindung aufgebaut werden und in dem blöden Hotel geht keiner ran.«
Daniel nimmt die Teller und stellt sie auf den Tisch.
»Wir erreichen sie noch«, sagt er. »Versprochen.«
Sie setzen sich, fangen an zu essen. Und mit jedem Bissen scheint Maja etwas mehr Farbe zu bekommen. Es war gut, dass er Sandwiches gemacht hat.
Plötzlich stockt die Moderatorin mitten im Satz, und Maja und Daniel blicken zum Fernseher. »Ich höre soeben aus der Regie, dass wir ein Video erhalten haben, das den Unfallhergang dokumentiert.«
Ein Standbild wird eingeblendet, kurz darauf startet die Aufnahme. Zu sehen ist ein Mann, schätzungsweise Mitte fünfzig, der an ein Metallgeländer gelehnt in der Abendsonne steht. Hinter ihm fließt breit und schwarz die Spree. Es wirkt wie ein Versehen, so als hätte die Person, die filmt, eigentlich nur ein Foto machen wollen. Einen schnellen Schnappschuss. Es ist ein ruhiger, träger Abend, ein Anflug von Sommer, kaum Autos, nur ein paar Fußgänger. Die Ruhe vor dem Sturm, denkt Daniel noch, als wie aus dem Nichts etwas Schwarzes von hinten ins Bild schießt, über den Gehweg rast und im nächsten Moment die Brückenabsperrung durchbricht.
Maja versteift sich neben ihm, sie legt das Sandwich weg, er nimmt ihre Hand. Der Mann im Video springt gerade noch rechtzeitig zur Seite, die Aufnahme wackelt, der Fluss ist aufgewühlt, sieht aus, als würde er kochen. Einen Augenblick lang ist es absolut still, so als hätte der Schock alle Geräusche verschluckt. Dann auf einmal Stimmen, die alle durcheinanderreden, schnelle Schritte, eine Frau, die hysterisch schreit, eine andere, die versucht, sie zu beruhigen. Daneben jemand, der reglos aufs Wasser starrt. Passanten, die angerannt kommen. Der Mann, der eben noch gefilmt wurde, holt sein Handy aus der Tasche und wählt eine Nummer. Eine Frau, nur ein paar Meter von ihm entfernt, tut dasselbe.
Daniel sieht kurz zu Maja hinüber. Er kann nicht glauben, dass sie in diesem Fahrzeug war. Eingesperrt. Dass der Wagen langsam mit Wasser volllief. Er sieht ihr helles Gesicht in der grünen Dunkelheit, die Atemluft wird dünner, die Enge beklemmend. Daniel spürt, dass ihm schlecht wird. Dann plötzlich rennt ein Mann ins Bild, etwas älter als er, vielleicht auch genauso alt. Sein Gesicht ist nicht zu erkennen, sein Haar unordentlich und dunkel, ein Ton, der im schwachen Licht fast schwarz wirkt. Er wirft im Lauf seinen Rucksack auf den Gehweg und springt ohne zu zögern ins Wasser.
Alles in Daniel spannt sich an, er schaut gebannt auf die unruhige Oberfläche des Flusses, hört Leute in dem Video reden, aber nicht, was sie sagen. Der Typ taucht kurz auf, holt tief Luft und verschwindet wieder in der Schwärze.
Nach ein paar Sekunden erfolgt ein Schnitt, dann sind die Rettungskräfte da, Notarztwagen, Feuerwehr, Blaulicht. Daniel erkennt zwei dunkle Gestalten im Wasser, eine davon ist Maja. Die Sanitäter ziehen sie heraus, stützen sie, legen sie auf eine Trage, packen sie in warme Decken. Sie wird nicht beatmet, ist ansprechbar.
Daniel schaut zu ihr rüber. Er wüsste gern, was in ihr vorgeht, während sie das sieht, doch der Ausdruck in ihrem Gesicht verrät nichts. Es ist eine Maske, hinter die sie ihn nie wirklich hat blicken lassen. Er betrachtet sie und in diesem Moment wird ihm schmerzlich bewusst, wie wenig er von ihr weiß. Es ist Maja nie schwergefallen, sich vor ihm auszuziehen, aber nackt kennt er nur ihren Körper. Ein paar Dinge hat er im Laufe der Zeit herausgefunden. Dass sie Grilled-Cheese-Sandwiches mag, worauf sie im Bett steht, welche Art von Filmen sie gern schaut, welche Serien, dass sie sich unter anderem deswegen mit ihrer Mutter zerstritten hat, weil die ihr nicht sagen wollte, wer ihr Vater ist, und dass sie Yoga hasst, aber wünschte, sie würde es mögen. Daniel weiß etwas von ihr, aber er kennt sie nicht. Nicht wirklich.
Maja schaut auf und er sieht weg. Zurück zum Fernseher. Sein Herz schlägt schnell. Er ist angespannt, mustert den jungen Mann, der sie aus dem Wagen gezogen hat, und spürt ein irrationales Prickeln von Eifersucht im Nacken. Es hat nichts mit ihm zu tun. Der Typ spielt keine Rolle. Trotzdem fragt sich Daniel, warum er es getan hat. Alle anderen sind stehen geblieben, sie haben den Notarzt verständigt, waren betroffen, aber keiner von ihnen hat sein Leben riskiert. Nur er. Warum? Weil er so ein guter Mensch ist? Ein Arzt? Eher unwahrscheinlich bei dem Anzug, den er trägt.
Er geht zu den Sanitätern, sie reichen ihm eine Decke. Er ist groß mit breiten Schultern und einem Gesicht voller Schatten. Dann macht er einen Schritt in den Lichtkegel der Straßenlaterne und für den Bruchteil einer Sekunde schaut er direkt in die Kamera.
DANIEL, 3:56 UHR
Um kurz vor vier schaltet er den Fernseher aus und verräumt das benutzte Geschirr. Es ist ihm ein Rätsel, wie Maja in dieser Position schlafen kann. So verrenkt. Andererseits, vielleicht ist es ein Shutdown des Gehirns, so eine Art Schutzfunktion. Daniel streicht ihr sanft das Haar aus der Stirn. Maja schläft weiter. Wie bewusstlos. Ihr Arm liegt ausgestreckt auf der Tischplatte, ihr Gesicht halb auf ihrer Schulter, halb auf dem harten Untergrund.
Er greift unter ihre Kniekehlen und Achseln, dann hebt er sie vorsichtig von dem Stuhl, auf dem sie sitzt. Sie schläft weiter, die Wange an seine Brust gepresst, ihr Körper dicht an seinem.
Er legt sie nebenan ins Bett und deckt sie zu, dann geht er zurück in die Küche, schaltet das Licht aus und kriecht wenig später zu Maja unter die Decke. Es ist nachtgrau im Zimmer, der Vorhang ist nur halb zugezogen, die Straßenlaterne wirft ihr dünnes Licht an die Wand. Bis auf ein paar vorbeifahrende Autos ist nichts zu hören. Ab und zu Majas Atem.
Daniel betrachtet sie im Halbdunkel. Und dieser Anblick erinnert ihn an die Nacht, in der er sie kennengelernt hat. Ein Spieleabend. Theo hat damals ein paar Kommilitonen eingeladen. Einer von denen schrieb Daniel. Er war gerade von einem Date nach Hause gekommen und wollte eigentlich ins Bett gehen. Er weiß bis heute nicht, warum er seine Meinung noch geändert hat. Dafür erinnert er sich genau an den Moment, in dem er Maja zum ersten Mal sah. Ungeschminkt, in verwaschenen Jeans und ohne BH. Wie sie im Schneidersitz auf dem Sofa saß und ferngesehen hat. Eine Packung Chips in der Hand, auf dem Couchtisch vor sich eine Flasche Bier. Das hat gereicht.
Die Frau, mit der er am selben Abend ausgegangen war, war vergessen. Sie und ihr rotes Kleid und ihre getuschten Wimpern und die gemachten Haare. Ebenso wie die Zeit mit ihr, das lange Gespräch, die Drinks danach, der Spaziergang. Alles ausgelöscht in nur ein paar Sekunden.
Maja zuckt neben ihm im Schlaf, sie windet sich, schaut hektisch unter ihren geschlossenen Lidern hin und her, als würde sie schlecht träumen. Auf ihrer Stirn schimmern Schweißperlen, ihr Gesicht ist angespannt, sie atmet flach und unruhig. Sie so zu sehen, erinnert Daniel an das, was passiert ist. Daran, dass sie tot war. Daran, dass ihre Mutter tot ist. Daran, dass Sofie nach wie vor denkt, Maja ist es auch. Er greift nach ihrer Hand und hält sie fest. Und ihr Atem entspannt sich, erst er und dann ihre Muskeln.
Daniel betrachtet sie und da fällt ihm sein Versprechen wieder ein. Wir werden Sofie noch erreichen. Aber sie haben sie nicht erreicht, sie haben nicht mehr angerufen. Maja hat noch ein paar Bissen von ihrem Sandwich gegessen und ist kurz danach eingeschlafen. Und es ist gut, dass sie schläft. Sie muss sich erholen.
Er hingegen ist hellwach. Also rappelt er sich auf, löst vorsichtig seine Hand aus ihrer und geht leise in die Küche zurück – sein Versprechen einlösen.
BORACAY, PHILIPPINEN, 11 UHR VORMITTAGS
Die Algen kamen plötzlich, die Wellen haben sie gebracht. Nicht wirklich ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Sie treiben im Wasser, fließend und weich wie Haarsträhnen. Das Meer liegt da wie ein ausgebreitetes Bettlaken. Ruhig und atmend, nur ein paar Wellen. Der Himmel ist tiefblau, das Wasser klar, der Tag erfüllt von fauler Stille. Sonnenmilch und Trägheit liegen in der Luft, die Sonne brennt aufs Meer, auf Köpfe und Schultern und Rücken. Die Menschen kühlen sich ab, die Algen leuchten grün.
Dann bricht die Hölle los.
Ein Schrei zerschneidet die Stille, spitz und schrill, erst nur einer, dann immer mehr, ein Chor aus Schmerz und blutiger Haut. Alle rennen los wie Tiere, eine Herde in blinder Panik, sie wollen an Land, alle gleichzeitig, bloß weg, zurück ans Ufer, raus aus dem Wasser. Am Strand ist Stillstand, Leute stehen da, hilflos, gaffen, bewegen sich nicht. Blutwolken wabern um offenes Fleisch, sie legen sich rot auf die Wellen. Menschen stolpern und fallen, sie drücken sich gegenseitig unter Wasser, stützen sich aufeinander ab.
Es geht schnell, es dauert nur Minuten, dann ist es vorüber. Die Schreie verstummen, das aufgewühlte Wasser beruhigt sich, die Oberfläche wird wieder glatt. Menschen treiben in einem Meer aus Algen, die Sonne verbrennt ihre Rücken und Arme.
Doch sie spüren es nicht mehr.
Sie sind alle tot.
MAJA
Ich schrecke hoch, schaue mich um, aber da sind keine Leichen, keine im Wasser treibenden Körper, keine verätzte Haut, kein Blut, nur ich in Daniels Bett, allein in seinem Zimmer. Es war nur ein Traum, sage ich mir, nicht echt. Auch wenn es sich so anfühlt. Ich schließe kurz die Augen, zwinge mich dazu, ruhig zu atmen, ein und aus, spüre meinen Puls überall, wie er knapp unter der Haut pocht. Meine Haare sind klatschnass, die Decke, das Unterhemd, die Jogginghose. Ich wische meine feuchten Handflächen am Bettlaken ab, dann die verschwitzten Strähnen aus meinem Gesicht. So viele Tote. Und so schnell. Ich höre noch ihre Schreie, sehe den Horror in ihren Augen. Mütter, die versuchen, ihre Kinder an Land zu bringen, Kinder, die am Strand stehen und nach ihren Eltern schreien. Aber es war nur ein Traum. Es ist nicht wirklich passiert. Nur in meinem Kopf.
Irgendwann beruhigt sich endlich mein Herzschlag und ich befreie mich aus der feuchten Daunendecke, die wie eine Faust um meinen Körper liegt. Als ich aufstehe, zittern meine Knie. Es ist lange her, dass ich mich so schwach gefühlt habe. Ich schäle mich aus den durchgeschwitzten Klamotten und werfe sie auf den Boden. Die Luft im Zimmer ist kühl und ich bekomme Gänsehaut, viele kleine Härchen, die sich gegen die Kälte stemmen. Ich gehe zu Daniels Schrank und nehme eine Trainingshose und ein Unterhemd von ihm heraus, dann ziehe ich beides an. Mir ist flau im Magen, fast übel. Als könnte ich das offene Fleisch riechen, das von der Sonne verbrannt wird.
Nebenan in der Küche läuft Musik. Je näher ich der Tür komme, desto stärker wird der Geruch nach frischem Kaffee. Trotzdem gehe ich erst ins Bad. Die Luft ist abgestanden, als wäre sie dick und zäh. Vielleicht liegt es aber auch gar nicht an der Luft, vielleicht bekomme ich einfach nicht genug.