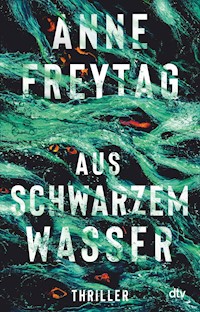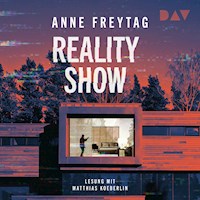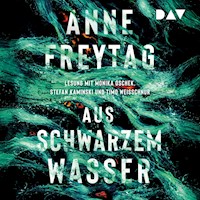11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wenn Sophie es sich aussuchen könnte, wäre ihr Leben simpel. Aber das ist es nicht. Und das war es auch nie. Das fängt damit an, dass ihre Mutter sie direkt nach der Geburt im Stich gelassen hat. Und endet damit, dass Sophies Vater plötzlich beschließt, mit seiner Tochter zu seiner Freundin nach München zu ziehen. Alle sind glücklich. Bis auf Sophie.
Was hat es bloß mit dieser verdammten Liebe auf sich? Sophie selbst war noch nie verliebt. Klar gab es Jungs, einsam ist sie trotzdem. Bis sie in der neuen Stadt auf Alex trifft. Das Nachbarsmädchen mit der kleinen Lücke zwischen den Zähnen, den grünen Augen und dem ansteckenden Lachen. Zum ersten Mal lässt sich Sophie voll und ganz auf einen anderen Menschen ein. Und plötzlich ist das Leben neu und aufregend. Bis ein Kuss alles verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DAS BUCH
Wer bin ich? Das ist die Frage, auf die Sophie einfach keine Antwort findet. Sie ist 17. Sie ist einsam. Und sie sucht nach einer Schublade, in die sie passt. Nach ihrem Platz im Schutz der Menge, aus der sie aber gnadenlos heraussticht. Denn sie ist alles andere als normal. Schön wie eine Märchenprinzessin, neu in der Stadt und ohne Mutter aufgewachsen.
Sophie hat mit Jungs geschlafen – zu früh und mit den falschen –, aber letztlich hinterließen sie mehr Leere als Liebe.
Liebe. Davon versteht Sophie sowieso nicht viel. Wie auch, wenn der eine Mensch, der sie bedingungslos hätte lieben müssen, unmittelbar nach ihrer Geburt abgehauen ist. Und als wäre das noch nicht genug, lässt sie nun auch noch ihr Vater im Stich. Er entscheidet, dass sie kurz vor Sophies Abitur von Hamburg zu seiner neuen Freundin nach München ziehen. Und so findet sich Sophie plötzlich in einem fremden Haus, mit einer »Stiefmutter«, kleinen Brüdern und einem struppigen Hund wieder.
Doch dann taucht Alex auf: das Nachbarsmädchen mit der kleinen Lücke zwischen den Zähnen, den grünen Augen und dem ansteckenden Lachen. Zum ersten Mal hat Sophie das Gefühl, dass auch ihr Leben voller Leichtigkeit sein könnte – wenn sie sich nur traut …
DIE AUTORIN
Anne Freytag, geboren 1982, hat International Management studiert und für eine Werbeagentur gearbeitet, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Die Autorin veröffentlichte mehrere Romane für Erwachsene, unter anderem unter ihrem Pseudonym Ally Taylor. Mit ihrem ersten Jugendbuch, Mein bester letzter Sommer, schrieb sie sich direkt in die Herzen ihrer Leser und wurde von der Presse gefeiert.
Anne Freytag liebt Musik, Serien sowie die Vorstellung, durch ihre Geschichten tausend und mehr Leben führen zu können. In diesem Leben wohnt und arbeitet sie derzeit in München – wenn sie nicht gerade in ferne Länder und Städte reist. Manchmal auch nur in Gedanken.
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Anne Freytag
Copyright © 2017 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Martina Vogl
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik.Design, München, unter Verwendung einer Illustration von © Isabel Klett
Gestaltung Vorsatz, Playlist und Innenillustrationen: Das Illustrat, München
Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-20442-6V006www.heyne.de
Dieser Roman ist für alle mit Ecken und Kanten auf dieser runden Welt
Und vor mir das Nichts
Es schüttet. Wasser fällt in Strömen aus dem Himmel, und die harten Tropfen treffen wie Nadeln auf mein Gesicht. Ich renne. Ich renne, so schnell ich kann. Der Regen läuft über meine Arme und Beine und die Wimperntusche in meine Augen. Vor einer Stunde war es noch eine Nacht mit Sternen und Sichelmond. Ich renne schneller, als ich kann. Mein T-Shirt und die Hotpants kleben an mir wie die Schuld. Dieser Blick. Ich habe Seitenstechen. Kann kaum atmen, ringe nach Luft. Und alles, was ich sehe, sind seegrüne Augen getränkt in Enttäuschung. Ich stolpere, fange mich, werde langsamer. Und jeder Schritt ist eine schmerzhafte Erinnerung an die letzte halbe Stunde meines Lebens. Mein Magen zieht sich abrupt zusammen. Ich stütze mich mit den Händen auf meinen nackten kalten Schenkeln ab, muss würgen, übergebe mich aber nicht. Ein paar Sekunden starre ich auf den durchnässten Stoff meiner weißen Chucks und die unruhige Oberfläche der Pfütze, in der ich stehe. Mein Herz rast. Mir ist schwindlig. Ich richte mich langsam auf, rühre mich aber nicht. Der Donner grollt in den Wolken wie die Wut in meinem Kopf. Ich presse mir die Handballen gegen die Stirn, will schreien, tue es aber nicht. Mein Brustkorb ist eng. Meine Unterlippe zittert, aber ich spüre keine Kälte. Blätter fliegen wild umher, auf der Straße liegen kleine Äste, die der Wind von den Bäumen gerissen hat, und ich stehe ratlos im Regen und halte mir die Seite, als wäre es eine klaffende Wunde. Ich starre ins Nichts und frage mich, was ich jetzt tun soll. Und wie ich das tun konnte. Dieses Mal habe ich nicht einfach nur einen Fehler gemacht.
Ich habe uns kaputt gemacht.
MÄRZ
Stille Nacht, einsame Nacht
Ich sollte schlafen, aber ich kann nicht. Es ist fast vier Uhr morgens, und ich bin hellwach. Der Mond scheint kühl und ziemlich voll durchs Fenster. Das Haus ist komplett still. Papa schläft. Es ist mir ein Rätsel, wie er schlafen kann. Als wäre morgen ein Tag wie jeder andere auch.
Ich gehe barfuß, begleitet vom vertrauten Knarzen des Holzbodens, durchs Treppenhaus und weiter in unser möbelloses Wohnzimmer. Dort setze ich mich auf eine der Umzugskisten und schaue mich um. Dieser Raum war einmal die Seele des Hauses. Jetzt ist er leer. Mit jedem Bild, das wir abgenommen und verpackt haben, haben wir ein Stück von uns ausradiert. Alles, was übrig bleibt, sind nackte Wände mit Linien, die verraten, wo einmal Rahmen hingen und jetzt nichts mehr hängt. Papa hat fast alles verkauft. Sogar das Sofa. Wir nehmen nur ein paar persönliche Gegenstände mit, der Rest wurde verscherbelt, entsorgt oder verschenkt. Es ist wie mit einem Körper, den man beerdigt, wenn man gestorben ist. Man braucht ihn nicht mehr.
Meine Füße sind kalt. Genauso wie das Mondlicht, das durch die Fenster scheint. Und wie die Stimmung in diesem Haus. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre es beleidigt. So, als hätten wir es verraten. Vielleicht komme aber auch nur ich mir verraten vor.
Ich schleiche in mein Zimmer zurück und lege mich in ein Bett, das ich morgen zurücklassen werde, weil Lena genug Betten für uns hat. Ich hätte meins gerne mitgenommen – etwas, das Papa gar nicht verstehen kann: Es ist schließlich nur ein Bett. Für mich ist es viel mehr als das. Ich habe es, so lange ich denken kann. Ich glaube, ich war noch im Kindergarten. In diesem Bett haben Lukas und ich als Fünfjährige zusammen gespielt, wir haben aus Decken Höhlen gebaut, und an den Wochenenden hat er bei mir übernachtet. Vor allem in der Zeit, als seine Eltern so viel gestritten haben. Da waren wir beide zwölf. Sein Kopf lag auf meinem Schoß und sein Leben in Scherben. In diesem Bett haben wir Filme und Serien geschaut und uns dann stundenlang darüber unterhalten. Hier hat Lukas mir von seinem ersten Mal erzählt. Und drei Monate später ich ihm von meinem. Er war nach seinem aufgekratzt, ich nach meinem aufgelöst. Lukas ist Familie. So etwas wie mein Bruder. Und das war perfekt. Bis er sich beim letzten Schüleraustausch in Vianne verliebt und nach ihrer Abreise beschlossen hat, ihretwegen nach Paris zu ziehen und sein Abitur dort zu machen. Das ist knapp sechs Monate her.
Ich drehe mich auf die Seite und betrachte die langen Schatten der Äste an den Wänden. Das Gewirr aus unterschiedlich dicken Linien. Ich bin froh, dass Lukas glücklich ist. Das bin ich wirklich. Er lebt sein eigenes Leben, und das ist gut so. Das ändert aber nichts daran, wie sehr er mir fehlt. Wie ein Körperteil. Seit er weg ist, leide ich still und heimlich an den Phantomschmerzen, die an seine Stelle getreten sind. Seit er weg ist, bin ich allein. Davor war ich einfach nur seltsam.
Ende schlecht, alles schlecht?
Die Osterferien sind vorbei. Und mit ihnen unser Leben in Hamburg. Ich sitze auf dem Beifahrersitz und versuche, nicht daran zu denken, dass das hier das Ende ist. Zumindest ein Ende. Eben war dieses alte Backsteinhaus noch mein Zuhause. Jetzt ist es das nicht mehr. Meine Augen brennen, aber ich werde nicht weinen. Nicht wegen so etwas.
Mein Vater öffnet die Fahrertür und lässt sich neben mir auf den Sitz fallen, dann atmet er tief ein, so als wären wir im Schwimmbad und er würde jeden Augenblick untertauchen. »Also gut, Motte«, sagt er und stößt langsam die Luft aus, »dann wollen wir mal.«
Ich will nicht. Ich will meine drei Kisten wieder auspacken und hierbleiben. Aber es geht nicht um das, was ich will. Wenn man siebzehn ist, tut es das eigentlich nie.
»Hast du alles?«
Ich antworte mit einem langsamen Nicken, weil er sonst in meiner Stimme hören würde, was ich ihm zuliebe für mich behalte. Ich weiß, dass er einen Neuanfang braucht. Für meinen Vater war dieser Schritt lange überfällig. Wütend macht es mich trotzdem.
Papa startet den Motor. Er wirft noch einen letzten, flüchtigen Blick auf das Haus, in dem ich Laufen gelernt habe, dann legt er den Rückwärtsgang ein und manövriert den vollbepackten Kombi aus der Einfahrt. Wir fahren die schmale Allee hinunter. Ihre nackten Linden stehen Spalier wie hölzerne Skelette, die sich regungslos von uns verabschieden. Sie werden uns nicht vermissen. Aber ich werde sie vermissen. Ihren Duft und das Rascheln ihrer Blätter im Wind. Wenn man von den Wintermonaten absieht, bin ich die vergangenen sechzehn Jahre zu diesem Geräusch eingeschlafen.
»Sophie, ist alles okay?«
Ich schaue zu ihm rüber. »Klar«, sage ich, »alles gut.« Meine Stimme verrät, dass nichts gut ist. Papa weicht meinem Blick aus und schweigt. Es ist ein lautes Schweigen. Wir holpern über das Kopfsteinpflaster, vorbei an den viktorianischen Häusern mit ihren bunten Türen und den teuren Autos in den Auffahrten. Das Leben, wie ich es kannte, ist vorbei. Es endet genau jetzt. In diesem Moment. Und jeder Meter, der uns von unserem alten Haus trennt, vertieft den sauberen Schnitt, den mein Vater für uns entschieden hat. Es ist ein Schnitt, der meine Kindheit und Jugend aus meinem Gesamtbild herausschneidet. Ich will schreien, aber ich verziehe keine Miene. Ich schaue nur reglos aus dem Fenster.
Etwas über eine Stunde später halten wir an einer Tankstelle, kaufen ein paar Getränke und belegte Brote, die so aussehen, als wären sie aus dem letzten Jahrhundert. Labbriger Toast und gräuliche Salami. Igitt.
»Geh du ruhig schon mal ins Auto, ich bezahle derweil«, sagt Papa und hält mir den Schlüssel entgegen.
Die elektrische Schiebetür öffnet sich, und ich trete durch einen Schwall abgestandener Klimaluft nach draußen in die nasskalte Realität. Die meisten Menschen sind gleichgültig bis schlecht gelaunt, und es stinkt nach Benzin. Mein Atem schwebt als kleine Wolke vor mir her, als wollte er mir den Weg weisen. Ich schließe den Wagen auf und verkrieche mich in seiner wohligen Wärme, dann werfe ich die Tür zu und schnalle mich an wie ein artiges Kind, das sich auf den Wochenendausflug freut. Ich schaue zum Tankstellenshop hinüber. Papa steht an der Kasse und lächelt die Mitarbeiterin in ihrem hellblauen Hemd freundlich an. Ich ertrage diesen Anblick nicht. Ihn so glücklich zu sehen zeigt mir, dass er es all die Jahre, die wir nur zu zweit waren, eigentlich nicht war.
Ich ziehe die Schuhe aus und die Beine hoch und krame die Kopfhörer aus meiner Handtasche. Als ich die Knoten aus dem Kabel löse, fällt mein Blick auf das Auto an der nächsten Zapfsäule. Eine Frau steigt ein und verstaut etwas auf der Rückbank. Die Fenster sind schmutzig. Im milchigen Licht der Mittagssonne erkenne ich die Abdrücke von Kleinkinderhänden an den verschmierten Scheiben. Irgendwie macht mich dieser Anblick traurig. Vielleicht, weil ich meine Mutter nie persönlich kennengelernt habe – einmal abgesehen von meiner Geburt, da waren wir beide anwesend, aber das zählt irgendwie nicht.
Als plötzlich die Fahrertür neben mir aufgeht, zucke ich kurz zusammen und folge dem Geräusch. Mein Vater steigt ein und streckt mir zwei Packungen TUC-Kekse entgegen. »Hier, für dich, Motte.«
Ich muss lächeln. »Danke.«
»Das war noch nicht alles.« Auf seiner großen Handfläche liegen drei Butterstückchen in goldglänzendem Papier. In der anderen hält er ein weißes Plastikmesser. »Was wäre so eine lange Reise ohne dein Lieblingsessen?« Ich presse kurz die Lippen aufeinander, dann greife ich danach. »So, jetzt müssen wir aber.« Er zwinkert mir zu, dann schnallt er sich an. »Ich habe Lena eben angerufen. Sie freut sich schon sehr auf uns.«
»O ja, ich wette, sie freut sich besonders auf mich.«
»Komm schon, Sophie, gib ihr bitte eine Chance.«
Als ob ich eine andere Wahl hätte.
»Ich liebe Lena.«
»Ich weiß«, sage ich und reiße die erste TUC-Packung auf. Plötzlich fühlt sie sich nicht mehr an wie eine schöne Geste, sondern wie Bestechung.
»Du wirst sie mögen, wenn du sie erst einmal besser kennst.« Ich frage mich kurz, wen er gerade überzeugen will – sich oder mich, sage aber nichts. »Und München ist eine wirklich schöne Stadt. Ganz ähnlich wie Hamburg, nur etwas kleiner.«
»Ja, und in Bayern.«
»Motte, das wird toll, du wirst schon sehen«, übergeht er meinen Kommentar. »Ich kann immer noch nicht glauben, wie super alles hingehauen hat.«
»Was alles?«, frage ich nüchtern.
»Na ja, ich meine, mein neuer Job beginnt erst in zwei Wochen, der Resturlaub hat genau gereicht, um alles zu organisieren und den Umzug über die Bühne zu bringen, und die Schulferien liegen dieses Jahr einfach perfekt!« Er schaut kurz zu mir rüber. »Immerhin musstest du so nur zwei Wochen mit Entrümpeln verschwenden. Und jetzt hast du immer noch deine gesamten Osterferien vor dir.« Er strahlt die Windschutzscheibe an, und ich unterdrücke den Drang, ihm zu sagen, dass das bedeutet, dass ich mich vierzehn Tage langweilen werde. »Wir haben zwei Wochen Zeit, uns alles in Ruhe anzuschauen und uns einzugewöhnen. Wir könnten ins Gebirge fahren oder nach Italien.« Denkt er, dass er mich damit ködern kann? Italien und ein paar Berge? »Was meinst du, Motte?« Er sieht zu mir rüber. »Wäre das nicht toll? Ich meine, Italien! Da wolltest du doch immer hin.« Sein Blick fleht mich an, Ja zu sagen. Ja, das ist toll. Ja, das freut mich. Ja, da wollte ich immer hin. Hauptsache Ja.
Eigentlich will ich antworten, dass mich weder Italien noch die Berge noch seine blöde Freundin auch nur im Geringsten interessieren, aber ich bringe es nicht über mich, ihm so wehzutun. Lena ist die erste, die ihm seit der Frau, die mich geworfen, aber nicht gewollt hat, etwas bedeutet. Und ich weiß, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass diese Patchwork-Nummer funktioniert. Also atme ich tief ein und entscheide mich für Variante drei: »Ja, du hast recht, das wollte ich.« Das ist nicht mal gelogen.
Der erleichterte Ausdruck in seinem Gesicht zeigt, wie unglaublich angespannt er eigentlich ist. Er weiß, dass ich nicht umziehen wollte. Und genauso wenig eine Stieffamilie haben. Oder einen Hund. Ich wollte einfach so weitermachen wie bisher. Mit den falschen Jungs schlafen, irgendwann bald mein Abi machen und weiterhin keine Ahnung haben, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Als Papa mir vor drei Monaten gesagt hat, dass es mit Lena und ihm ernst wird, bin ich zwar hellhörig geworden, aber ich hätte nie gedacht, dass ernst so ernst ist. Als er eine Woche später dann die Karten auf den Tisch gelegt hat, bin ich filmreif ausgerastet. Ich habe mich aufgeführt wie eine Diva im Hormonrausch, weil ich gehofft habe, dass er es sich dann noch einmal anders überlegt. Aber das hat er nicht.
Ich bin wohl eingeschlafen, denn als ich die Augen wieder öffne, ist es bereits dunkel. Zwischen dem Beifahrerfenster und meinem Kopf klemmt mein kleines Kissen. Das muss Papa da hingetan haben. Ich richte mich auf, trinke einen Schluck lauwarmes Mineralwasser, das vor knapp vierhundert Kilometern noch spritzig war, und schaue nach draußen in ein Meer aus Dunkelblau und Schwarz, gesprenkelt mit vielen roten, kleinen Lichtern. Es ist ziemlich dichter Verkehr, aber immerhin hat es aufgehört zu regnen.
»Na, gut geschlafen, Motte?«, fragt Papa über das sanfte Geräusch des Motors hinweg.
Ich brumme ihm ein heiseres Ja entgegen.
»Hast du Hunger?« Er schaut kurz in meine Richtung. »Es gibt noch belegte Brote.«
Ich denke kurz an die gammlige Salami. »Nein, danke. Die sehen irgendwie eklig aus.«
Er wirft einen Blick in den Rückspiegel und setzt den Blinker. »Ist sowieso besser. In einer Stunde sind wir da.« Papa wechselt die Spur. »Und dann gibt es sicher was Leckeres zu essen. Lena wäre nicht Lena, wenn sie nicht irgendwas vorbereitet hätte. Sie kocht richtig gut.«
Das war zu erwarten.Die Frau geht mir jetzt schon auf die Nerven. Wahrscheinlich kommen wir an und es gibt einen riesigen Schweinebraten mit Klößen – ach nein, halt, mit Knödeln – als bayerischen Willkommensgruß. Vor meinem inneren Auge mutiert Lenas sonst so stilsicherer Jil-Sander-Look zu einem geblümten Dirndl mit roter Schürze, und anstatt ihrer blonden, glatten Haare, die immer aussehen, als wären sie gerade frisch geföhnt worden, hat sie in meiner Fantasie eine Timoschenko-Zopf-Frisur. Ich muss unfreiwillig lachen.
»Was ist? Was ist so lustig?«
»Ach nichts«, sage ich und schüttle schnell den Kopf. »Ich musste nur an etwas denken, was Lukas neulich geschrieben hat.«
»Ah, wie geht es ihm denn? Er ist doch noch in Frankreich, oder?«
»Jep.« Leider. Und das wüsstest du auch, wenn du dich für mich interessieren würdest.
Die mechanisch-weibliche Stimme des Navigationssystems weist uns auf ein Autobahnkreuz in einem Kilometer hin, dann schweigt sie wieder.
»Ach ja, Lena und die Jungs haben letztes Wochenende dein Zimmer hergerichtet.«
Die Jungs? Mein Zimmer?
Am liebsten würde ich ihm entgegenschreien, wie beschissen ich es finde, dass sie einfach ohne mich entschieden haben, in welchem Zimmer ich von nun an wohnen soll, zwinge mich aber dazu, es nicht zu tun, weil ich genau weiß, dass ich mir dann einen endlosen Vortrag darüber anhören könnte, wie oft er mich in den vergangenen Monaten gebeten hat, einmal mit ihm nach München zu fahren, damit ich endlich Lena und ihre Söhne kennenlerne. Er hat es eine Annäherung genannt, ein Kennenlernen, einen ersten Schritt. Ich wollte nichts davon wissen. Er hat gesagt, dass er mir das Haus zeigen will, dass ich mir ein Zimmer aussuchen soll, aber ich wollte kein verdammtes Zimmer. Ich wollte mein altes Zimmer und mein altes Leben. Ich habe alles getan, um es so schwer wie möglich für ihn zu machen. Anfangs hat er noch versucht, mit mir darüber zu reden, mich zu überzeugen, aber irgendwann hat er aufgegeben. Ich glaube, das war am schlimmsten. Dass er einfach ohne mich gefahren ist. Manchmal wäre es schön gewesen, wenn er auch mal ein Wochenende zu Hause geblieben wäre.
Papa räuspert sich.
»Du bekommst das größte Zimmer.« Er macht eine Pause und sieht zu mir rüber. »Und es hat einen eigenen Balkon.«
Ich schaue stur aus dem Beifahrerfenster. Es strengt mich richtig an, wie sehr er sich bemüht. Wie sehr er versucht, mir dieses Haus und dieses neue Leben zu verkaufen. Wie ein verdammter Immobilienmakler. Gleich schwärmt er mir noch von der Aussicht vor oder davon, dass der Balkon eine Südwest-Ausrichtung hat. Ich wette, Lenas blödes Haus ist genauso wie sie. Wie eine beschissene Homestory aus dem AD Magazin. Mit Hartholzböden und auserwählten farblichen Akzenten.
»Motte, ich gebe mir hier wirklich Mühe.« Er seufzt. »Ich weiß ja, dass das alles nicht einfach für dich ist.« Untertreibung des Jahrhunderts. »Und ich verstehe auch, dass es seltsam für dich sein muss, dass es nach so vielen Jahren eine Frau in meinem Leben gibt. Aber falls du Angst hast, dass Lena versuchen wird, deine Mutter zu ersetzen …«
»Das hat nichts mit ihr zu tun!«, fahre ich ihn an, und bevor er noch etwas sagen kann, setze ich meine Kopfhörer auf, drücke Play und verschränke die Arme vor der Brust. Es war so klar, dass er mit ihr kommen würde. Weil alles mit ihr zu tun hat. Sie ist seit siebzehn Jahren weg und immer noch ein Thema. Ich versuche, mich auf die Musik zu konzentrieren und meine Gedanken hinter mir zu lassen, aber natürlich schalte ich genau bei der Textstelle ein, wo der Sänger von Seafret davon singt, dass es sich so anfühlt, als würden sie Ozeane voneinander trennen. Genauso fühlt es sich für mich auch an. Ich bin mutterseelenallein. Umgeben von Wasser.
Mein Vater hat sie wirklich geliebt. Meine Mutter, meine ich. Sie war für ihn die Eine. Jetzt gibt es eine andere. Dazwischen gab es nur ihn und mich. Und irgendwo da draußen eine Frau, von der ich nichts weiß und die nichts von mir wissen will, mit der ich verwandt bin. Sie atmet und sie lebt, doch es ist ein Leben, in dem ich nicht vorkomme. Sie hat mich ausgeklammert, aber eine ständige Erinnerung an sich zurückgelassen. Wenn ich mein Gesicht anschaue, sehe ich sie. Ich erinnere mich daran, wie ich früher stundenlang mit einem Foto von ihr vor dem Spiegel stand und die Ähnlichkeit zwischen uns beiden gesucht habe – nur um sie dann zu widerlegen. Weil es beschissen ist, jemandem so ähnlich zu sehen, den man hasst. Oder hassen sollte. Jemandem, den man eigentlich nicht kennt und trotzdem vermisst. Jemandem, der etwas ganz tief in einem drin kaputt gemacht hat und von dem man sich dennoch wünscht, dass er eines Tages zurückkommt und einem sagt, dass er einen lieb hat. Menschen gehen. Manchmal körperlich – Lukas –, manchmal emotional – Papa – und manchmal beides – meine Mutter. Ich träume noch immer diesen naiven Traum, in dem sie mir sagt, dass sie keine andere Wahl hatte. Dass sie gehen musste. Dass sie schwerkrank war. Dass es ihr leidtut. Dass ich ihr jede Stunde eines jeden Tages gefehlt habe. Aber ich weiß, dass dieser Traum sich nie erfüllen wird. Der Traum ist naiv – nicht ich. Wenn mich jemand nach ihr fragt, erzähle ich, dass sie kurz nach meiner Geburt gestorben ist. Papa findet das zwar nicht richtig, aber er sagt nichts deswegen. Ich weiß, dass sie nicht wirklich tot ist, aber für mich ist sie es. Also läuft es aufs Gleiche hinaus. Zumindest tue ich so. Und ich bin gut darin, so zu tun als ob. Andere sehen nur das, was sie sehen wollen. In Wahrheit ist meine Mutter wie ein Albtraum, der immer wieder kommt. Sie fehlt mir. Und das, obwohl ich sie nicht mal kenne. Manchmal male ich mir Gespräche aus, die wir nie geführt haben, und erschaffe Erinnerungen, die es so nie gab. Ich habe sie mir so oft vorgestellt, dass sie in meiner Welt echt sind. Papa sagt, dass er hofft, dass ich ihr eines Tages verzeihen kann, weil es mir dann besser gehen wird. Aber wie soll man jemandem verzeihen, der einen nie um Verzeihung gebeten hat? Wie lässt man jemanden los, den man nie hatte?
Ich betrachte meine Reflexion in der Fensterscheibe. Gott, ich sehe ihr so verdammt ähnlich. Nur die helle Haut und die dunklen Haare habe ich von meinem Vater. Und das Grübchen in meiner rechten Wange, wenn ich lächle. Der Rest ist von ihr. Vor allem die Augen. Die Form und die Farbe. Wie karibisch-blaue Mandeln. Das Haar meiner Mutter ist blond, meines schwarz. Als würde ich Trauer tragen. Ein struppiges Kopftuch um ein blasses Gesicht. Meine Nase ist klein, aber weniger stupsig als die meiner Mutter. Und mit breiterem Rücken. Eigentlich ist ihre Nase viel zu niedlich für das Gesicht einer erwachsenen Frau. Fast schon absurd niedlich. Aber sie ist auch das perfekte Gegengewicht zu ihren Lippen. Sie hat das Näschen eines Kindes und den Mund einer Hure. Ich glaube, das passt ganz gut zu ihr. Und vielleicht auch zu mir.
Vor ungefähr einem Jahr hatte ich eine Phase, in der ich immer roten Lippenstift getragen habe. Als Lukas mich das erste Mal so gesehen hat, meinte er, dass ich mit den roten Lippen wie eine moderne Version von Schneewittchen aussehe. Er meinte, ich hätte ein Puppengesicht mit wütendem Blick und einem Mund, der für eine Märchenprinzessin viel zu obszön wäre. So kam er auf Schneeflittchen. Irgendwann hat er das »Schnee« einfach weggelassen und mich nur noch das Flittchen genannt. Das tut er bis heute. Lukas darf das, weil er Lukas ist. Mein bester Freund. Er darf das, weil er weiß, wie es in mir aussieht und wer ich wirklich bin. Manchmal denke ich, er weiß es sogar besser als ich.
Sie haben Ihr Ziel erreicht
Ich bin müde, aber gleichzeitig total aufgekratzt. Als hätte ich jeden Moment eine mündliche Prüfung, die ich unbedingt bestehen muss. Mein Körper will schlafen, aber mein Kopf denkt nicht daran. Die Navigationsfrau sagt, dass wir unser Ziel in sechs Minuten erreichen werden. Ich will nicht ankommen, aber gleichzeitig bin ich froh, dass wir bald da sind, weil ich langsam nicht mehr sitzen kann. Ich habe jede Position so lange wie möglich ausgehalten, und jetzt habe ich sie alle durch. Meine Beine kribbeln, und ich wippe nervös mit den Füßen, was Papa zu nerven scheint, aber offensichtlich nicht genug, um mich zu bitten, damit aufzuhören. Noch vier Minuten. Ich frage mich kurz, warum Papa das Navi nicht schon längst ausgeschaltet hat – immerhin kennt er den Weg –, aber vielleicht lässt er es meinetwegen an. Damit ich mich seelisch auf unser neues Leben vorbereiten kann.
Er setzt den Blinker und biegt rechts ab, und obwohl es so dunkel ist, sieht man sofort, dass wir uns in einer wohlhabenden Wohngegend befinden. Es gibt echt nichts Schlimmeres als getarnte Bonzen. Die, die sich in abgelegene Straßen verziehen, weil sie schließlich viel zu viel Klasse haben, ihren Reichtum öffentlich zur Schau zu stellen. Alter Baumbestand, riesige Grundstücke, teure Autos. Ich erhasche einen Blick auf eine moderne Festung mit gigantischen Fensterfronten und penibel gestutzten Grünflächen, die aussehen wie ein dichter Teppich aus Grashalmen. Sie stehen kerzengerade nebeneinander wie winzige Soldaten zum Morgenappell. In der Auffahrt ein Audi S3 in Schwarz und ein Q7 in Silber. Ich wette, es ist ein Diesel. Reiche Leute sind nämlich grundsätzlich umweltbewusst. Oder sie reden es sich nur ein. Ich wette, Lena hat einen Mini Cooper S in Beige. Und eine meterdicke Spießerhecke, die wie ein ökologischer, perfekt getrimmter Wall um ihr Protzhaus liegt. Schützende Arme aus Buchs, die sie und ihre Jungs vor neugierigen Blicken schützen. Noch eine Minute.
»Gleich haben wir es geschafft, Motte«, sagt Papa. »Das da vorne ist es.«
Ich recke meinen Hals, aber ich erkenne nichts. Papa wird langsamer, dann biegt er in eine breite Kieseinfahrt. Und da steht er. Ein Mini Cooper S. Er ist dunkelgrün, nicht beige. Das wäre meine zweite Wahl gewesen. Das Haus liegt verborgen hinter einer scheinbar unüberwindbaren Mauer aus Geäst. Kein Buchs, aber ein Meer aus Büschen. Papa parkt und zieht den Schlüssel ab.
»So. Da wären wir.«
Wir steigen aus, und die Steine knirschen unter unseren Schuhsohlen. Der Kiesweg führt zu einem lächerlich großen Haus. Es ist tatsächlich noch größer als in meiner Vorstellung. Weiß mit dunkelgrünen Fensterläden. Auf der rechten Seite wuchert der Efeu bis unters Dach. Der Vorgarten ist gepflegt, aber nicht zu gepflegt. Wildromantisch mit einem großen Fischteich umringt von Büschen, Blumenbeeten und hohen Laubbäumen. Das hier wäre die perfekte Kulisse für einen englischen Kostümfilm. Es fehlt eigentlich nur noch eine Kutsche.
»Toll, oder?«, fragt Papa und legt den Arm um mich. »Und innen ist es tatsächlich noch schöner.«
Er klingt wieder wie ein Makler, aber ich muss ihm recht geben. Es ist wunderschön. Hassen tue ich es trotzdem.
»Komm schon«, sagt er und schiebt mich zum Eingang. »Lass uns reingehen.« Ich will da nicht rein. Ich will einfach ein paar Monate vorspulen. Zu dem Tag, wenn ich ausziehe. Ich will den Teil dazwischen überspringen. Das Sich-vorstellen und Lächeln, dieses So-tun-als-wäre-man-aus-demselben-Holz-geschnitzt. Wir gehen die letzten Meter auf die Haustür zu.
»Hast du einen Schlüssel zu unserem neuen Zuhause oder müssen wir klingeln?«, frage ich trotzig.
»Natürlich habe ich einen, aber ich möchte Lena und die Jungs nicht erschrecken.« Er nickt in Richtung Klingel, und ich strecke widerwillig die Hand aus. Aus dem Haus dringen Stimmen und das Geklapper von Geschirr. Meine Fingerkuppe schwebt über dem Klingelknopf, bleibt aber auf Abstand, so als würden sie sich gegenseitig abstoßen. Als wären sie beide negativ geladen. Ich will nicht hier sein, und die Klingel weiß das.
»Jetzt komm schon, Sophie«, sagt Papa ungeduldig. Als ich mich nicht bewege, drängt er mich ein Stück zur Seite und drückt selbst auf den Klingelknopf. Er kann es kaum erwarten, in dieses blöde Haus zu kommen, und ich kann es kaum erwarten, schlafen zu gehen, weil das einer Bewusstlosigkeit am nächsten kommt.
Die Tür geht auf. Und da steht sie: Lena in all ihrer Perfektion. Papa starrt sie an. Ein bisschen so, als hätte ihr Anblick ihm einen Schlag versetzt. In ihrem Gesicht breitet sich ein Lächeln aus, und ihre Zähne erinnern mich an Zahnpastawerbung. Lena lacht, Papa strahlt. Er leuchtet wie eine Laterne. Das kann ja was werden. Die beiden sind wie zwei verliebte Teenager, die zusammenziehen. Ich warte darauf, dass Lena mich begrüßt, aber sie bemerkt mich nicht. Ihr blondes Haar glänzt im warmen Licht des Flurs goldgelb, und ihre Augen funkeln. Sie sieht glücklich aus. Und Papa sieht glücklich aus. Nur ich sehe nicht glücklich aus. Ich möchte mich für sie freuen. Ich möchte ihnen ihr Glück gönnen. Aber ich schaffe es nicht. Er sieht sie an, als wäre sie das Beste, was ihm je passiert ist, und als hätte er Angst, jeden Moment in seinem alten Leben in Hamburg aufzuwachen. Nur mit mir.
»Können wir dann mal reingehen?«, frage ich gereizt.
Lena und Papa schauen mich an, als wäre ich ein böser Geist, der ohne Erlaubnis ihren Augenblick betritt, doch dann macht Lena einen Schritt auf mich zu. Sie lächelt mich warm an. Irgendwie erinnert sie mich an die weibliche Hauptrolle aus dem Film Wie ein einziger Tag. Rachel Soundso. Sie hat dieselben fröhlichen Augen und ein ebenso fröhliches Lachen. Lena ist vielleicht keine Schauspielerin, aber sie spielt definitiv eine Hauptrolle. Und zwar die im Leben meines Vaters.
»Hallo, Sophie«, sagt sie und legt zaghaft die Arme um mich, als wäre ich ein unberechenbares Tier, das jeden Augenblick nach ihr schnappen könnte. »Schön, dass du da bist.« Ich will ihr nicht glauben, aber es klingt nicht nach einer Lüge. Es klingt tatsächlich aufrichtig. Lena lässt mich los und zeigt ins Innere des Hauses. »Bitte, kommt doch rein. Das Essen ist gleich fertig.«
Zwei Jungs laufen auf uns zu und springen an meinem Vater hoch. »Christian! Christian!«, rufen sie begeistert. Sie könnten Zwillinge sein, wenn da nicht der Größenunterschied wäre. Ich schätze sie auf sechs und zehn. Vielleicht ist der Ältere auch schon elf. Er ist in dem Alter, wo er noch spielt wie ein Kind. Aber bald schon wird ihm alles peinlich sein. Die beiden tragen dunkle Jeans und dunkelblaue Pullover. Ihre Haare sind ordentlich frisiert und ihre Wangen rosig. Sie sehen aus, als kämen sie gerade von einem Fotoshooting für überteuerte Kindermode.
»Jetzt lasst Christian und Sophie doch erst mal richtig ankommen, ihr zwei«, sagt Lena lachend. Aber sie denken gar nicht daran. Sie hängen an Papa wie kleine Äffchen. Ich finde sie jetzt schon anstrengend. Als dann auch noch ein Hund angerannt kommt, schüttle ich nur den Kopf. Stimmt. Da war was. Ich wusste, dass es einen gibt, aber in meiner Vorstellung war es ein Golden Retriever und kein puscheliger Mischlingsköter. Sein Fell hat die Farbe von schwarzen Jeans, die nicht richtig gewaschen wurden, aber sein Gesicht ist überraschend niedlich. Er schnuppert an meinem Knie, setzt sich vor mich hin und schaut mich aus dunklen Augen an. Immerhin einer, der mich wahrnimmt. Wir mustern einander. Wenn ich ein Hund wäre, würde ich aussehen wie er.
»Valentin, Leon«, sagt Papa und setzt die beiden Jungs ab, »darf ich vorstellen, das ist meine Tochter Sophie.« Sie strecken mir artig die Hände entgegen.
»Dann bist du also unsere neue Schwester«, stellt der kleinere fest und strahlt mich an. Als ob es so einfach wäre. Ich will gerade widersprechen und ihm sagen, dass ich niemals seine Schwester sein werde, aber seine großen Kinderaugen und dieser Blick lassen mich schweigen. »Mama, darf ich Sophie mein Zimmer zeigen?«
»Klar darfst du das, aber zeig ihr doch erst einmal, wo sie ihre Jacke aufhängen kann, ja?«
»Okay.« Leon greift nach meiner Hand, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt, dann sagt er »Komm mit« und zieht mich hinter sich her. »Das da ist dein Haken.« Er deutet auf die Garderobe. »Und das ist deine Schublade.«
»Meine Schublade?« Er nickt. »Wofür brauche ich denn eine Schublade?«, frage ich verständnislos.
»Für deine Schals und Mützen«, antwortet er, als wäre das eine total bescheuerte Frage gewesen. Leon hält noch immer meine Hand. Seine ist klein und warm und weich.
»Hast du denn auch eine?«
»Ja«, sagt er und nickt. »Meine ist die ganz unten, weil ich am kleinsten bin.«
»Verstehe.«
Leon zeigt auf die oberste Schublade. »Das war mal die von meinem Papa, aber jetzt gehört sie Christian.« In diesem Moment wird mir klar, dass ich nicht die Einzige bin, für die sich alles ändert. Leon und Valentin haben zwar noch ihr Zuhause und sie sind nicht allein, aber ihre Familie ist genauso kaputt wie meine. Nur eben anders.
Leon zieht mich zu den Stufen. »Komm, ich zeig dir mein Zimmer.« Er lächelt mich von unten an, dann flüstert er: »Ich hab eine Höhle, aber das darfst du keinem sagen, okay, Sophie?«
Mit seinen blauen Augen und der kleinen Nase könnte er echt mein Bruder sein.
»Ich sage kein Wort. Das ist unser Geheimnis.«
Er bleibt stehen und schaut mich an, als wollte er sichergehen, dass ich wirklich die Wahrheit sage. Dann lächelt er zurückhaltend. Und einfach so mag ich ihn. Und das, obwohl er nicht mein Bruder ist.
Ein Haus voller Geschichten
Knapp dreißig Minuten später kenne ich jeden Quadratzentimeter des Hauses. Leon und Valentin – der als älterer Bruder natürlich mitgekommen ist – haben mir sogar die Abstellkammer und den Heizraum gezeigt, weil man sich dort besonders gut verstecken kann. Wir haben die Führung im Keller begonnen und uns nach und nach hochgearbeitet. Jetzt kenne ich jedes Zimmer. Bis auf Lenas und meins. Leon hat gesagt, dass ich mich gedulden muss, weil er sich schließlich auch gedulden musste. Immerhin wollte er mir als erstes sein Zimmer zeigen, aber das hat laut Valentin überhaupt keinen Sinn ergeben. Er hat die Arme verschränkt und in diesem »Ich bin der größere und deswegen habe ich auch recht«-Tonfall gesagt: Wir gehen doch nicht erst hoch, dann wieder runter und dann wieder hoch? Das ist doch Quatsch! Wir fangen unten an. Und genau so haben wir es gemacht. Leon und ich haben uns geduldet, und wir haben unten angefangen. Doch als wir dann endlich in der ersten Etage angekommen sind, gab es kein Halten mehr. Leon hat an meinem Arm gezogen, als wäre er ein übermütiger Welpe und mein Arm die Leine, die ihn davor beschützt, Dummheiten zu machen. Ich habe mir sein Bett ganz genau angesehen und ihm versichert, dass ich gut verstehe, dass es ihm so gut gefällt. Ich dachte, ich hätte lange genug Interesse dafür gezeigt, und wollte schon wieder gehen, aber Leon hat darauf bestanden, dass ich mich reinlege – was ich eigentlich nicht wollte, aber letztlich trotzdem getan habe. Er hat sich neben mich gelegt und mir zugeflüstert, dass das winzige Zimmer, in dem sein Bett steht, eigentlich ein Schrank ist, worauf ich auch ohne seine Hilfe gekommen wäre, aber ich habe nichts gesagt. Leon hat erzählt, dass es seine Zauberhöhle ist und dass er sein Bett erst nicht in den Schrank tun durfte, weil sein Papa gesagt hat, dass ein Schrank nicht zum Schlafen da ist. Und dann hat er noch gesagt, dass man in einer Badewanne ja auch nicht schläft, sondern badet. Leon hat gekichert und mir zugeflüstert, dass er ja gar nicht in der Badewanne schlafen wollte und dass sein Papa das irgendwie falsch verstanden hat. Ich musste lachen. Ich glaube zum ersten Mal heute.
Valentins Zimmer ist das eines älteren Jungen. Weil er ja auch älter ist, hat er gesagt, und ich habe genickt. Er hat eine Nische mit Hochbett und darunter einen Schreibtisch. Und sogar einen Computer. Den alten von seinem Papa. Leon und Valentin teilen sich ein Bad, das erstaunlich sauber ist, weil ihre Mama will, dass sie lernen, Ordnung zu halten. Als ich gesagt habe, dass mir der Boden gefällt, haben sie mir erzählt, dass vor zwei Jahren ein Mann da war, der alle Böden abgeschliffen hat und dass danach überall Staub war. Ü-BER-ALL. Sie haben ihre Ausführungen mit energischem Nicken und großen Augen unterstrichen, so wie bloß Kinder es können. Ich gebe es ja nur sehr ungern zu, aber das Haus ist wirklich schön. Liebevoll und gemütlich. Das Haus einer Mutter. Holzfußböden und riesige Fenster mit langen Vorhängen aus seidig-leichtem Stoff. Leon hat gesagt, dass er sie atmen lassen kann. Als ich nicht verstanden habe, wovon er spricht, hat er die Tür zum Flur einen Spalt weit geöffnet, ein Fenster aufgemacht und den Vorhang zugezogen. Der kalte Wind hat sie aufgebläht, als wären es weiße Lungen. In den Fluren stehen Pflanzen in riesigen Töpfen, und an den Wänden hängen große gerahmte Bilder. Abstrakte Kunstwerke. Kunstgeschmack hat sie auch noch.
»Jungs?«, ruft Lena von unten zu uns hoch.
»Ja?«, rufen sie zurück.
»Habt ihr Sophie schon ihr Zimmer gezeigt?«
»Nein, aber das wollten wir gerade.«
Die alten Treppendielen knarzen, als Papa und Lena die Stufen hinaufsteigen. Dann stehen sie Hand in Hand vor uns.
»Ich hätte dir das Haus gerne selbst gezeigt«, sagt sie und lächelt entschuldigend, »aber ich musste mich noch ums Essen kümmern.«
»Kein Problem«, antworte ich, weil ich ehrlich gesagt ganz froh bin, dass sie bei der großen Führung nicht dabei war. »Valentin und Leon haben mir bis auf dein und mein Zimmer alles gezeigt.«
»Sogar den Keller«, sagt Valentin.
»Und die Abstellkammer«, fügt Leon hinzu und nimmt wieder meine Hand. »Mensch, Valentin! Wir haben den Dachboden vergessen!«, ruft er aufgebracht. »Mama, dürfen wir den Sophie nachher noch zeigen?«
»Wenn es dann noch nicht zu spät ist und Sophie Lust dazu hat, ja, ansonsten irgendwann in den nächsten Tagen.«
»Bitte, bitte, heute, Mama!«
»Mal sehen, Leon. Christian und Sophie haben eine lange Fahrt hinter sich.«
Papa legt den Arm um Lena, und ich schaue schnell weg. »Lena und ich haben schon mal ein paar Kisten reingetragen«, sagt er. »Ich dachte, dass du sicher dein kleines Kissen, das Malzeug und ein paar andere Sachen haben möchtest. Deinen Laptop habe ich ans Ladekabel gehängt, falls du später noch Lukas anrufen willst.«
Leon schaut mich von unten an. »Wer ist Lukas?«
»Sei nicht so neugierig, Leon«, sagt Lena, dann wendet sie sich mir zu. »Nach dem Essen suche ich die Zugangsdaten fürs Internet raus, und wenn du willst, können wir die Kisten dann zusammen hochtragen.«
Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Vermutlich wäre ein Danke angebracht, aber ich nicke nur und sage: »Okay, ist gut.«
»Darf ich Sophie jetzt ihr Zimmer zeigen?«, fragt Leon und springt unruhig auf und ab.
»Ja, das darfst du.«
Mein Zimmer ist riesig. Mindestens vier Mal so groß wie mein altes. Es ist die Art von Raum, in dem Ohrensessel und kleine Holztische mit schweren Kristall-Aschenbechern stehen sollten. Oder Regale mit Unmengen von Büchern. Das bin nicht ich. Vor allem nicht im Moment. Alle starren mich an und warten auf meine Reaktion. Sie warten auf den Freudenschrei. Aber ich schreie nicht. Ich stehe nur da und fühle mich verloren.
»Na, was sagst du?«, fragt Papa. »Ist das Zimmer nicht der Wahnsinn?« Er nimmt mich mit den Händen bei den Schultern und schiebt mich zur Balkontür, dann macht er sie auf. »Schau dir nur mal den Balkon an. Der ist doch großartig!« Ich schaue hinaus und zwinge mich zu einem Lächeln. Ich kann kaum atmen. Das ist nicht mein Zuhause. Papa schüttelt den Kopf und seufzt gereizt. »Kannst du vielleicht mal etwas sagen?« Ich fühle mich, als müsste ich jeden Moment kotzen. Mir bricht der Schweiß aus.
»Gefällt es dir nicht?«, fragt Leon.
»Doch, doch … es … Es ist wirklich wunderschön.«
Ich schaue kurz zu Boden. Als ich wieder aufschaue, treffen sich Lenas und meine Blicke.
»Das sind sehr viele Eindrücke auf einmal für Sophie«, sagt sie und lächelt. »Ich glaube, wir sollten jetzt erst mal etwas essen, und dann sehen wir weiter, okay?«
»Kann Sophie neben mir sitzen?«, fragt Leon.
»Das musst du Sophie selbst fragen. Wenn sie das will, dann gerne.«
Ich bin Lena dankbar, aber genau das will ich nicht sein. Ich will sie nicht mögen.
Ich will nichts mit ihr zu tun haben.
Eine Taube auf dem Dach
Papa hatte recht. Lena kocht hervorragend. Und es war kein Schweinebraten. Es war Lasagne. Mein Lieblingsessen. Wenn das mal kein Zufall ist. Das Essen war sehr gut, die Unterhaltungen wirr und die Stimmung in Ordnung. Ich habe hauptsächlich auf Leons viele Fragen geantwortet und ansonsten geschwiegen. Es war ein bisschen so, als hätte ich einen Gastauftritt in einer Fernsehserie und meinen Text noch nicht bekommen. Alle kannten ihre Rolle und ihren Einsatz. Nur ich nicht.
Wenn man es genau nimmt, habe ich mich in fast allem getäuscht. Kein Dirndl, keine Knödel, kein protziges Haus, keine Timoschenko-Zopf-Frisur. Nicht mal ein Golden Retriever. Stattdessen ein schmutzig-schwarzer Hund, der Carlos heißt und der mich aus irgendeinem Grund sofort ins Herz geschlossen hat. Er folgt mir auf Schritt und Tritt. Sogar aufs Klo. Seltsames Tier. Lena und die Jungs haben – bestimmt dreiundzwanzig Mal – betont, dass Carlos eigentlich niemanden mag. Vielleicht mag er mich deswegen. Ich mag schließlich auch niemanden.
So sieht also mein neues Leben aus. Ich habe einen Hund, der nicht mein Hund ist, ein Zimmer, in dem ich problemlos ein Tennis-Doppel spielen oder drei Viertel des Platzes untervermieten könnte, und zwei kleine Brüder, die sich riesig freuen, dass ich da bin, die aber nun mal nicht meine Brüder sind. Ich habe ein eigenes Bad und viele sehr geschmackvolle Möbel, die ich mir nicht ausgesucht habe. Es ist, als wäre ich gestern in meinem alten Leben ins Bett gegangen und heute in einem völlig neuen aufgewacht. So wie in Freaky Friday. Nur anders.
Ich will gerade die Tür zu meiner Schlafhalle zumachen, als Leon meinen Namen ruft. Nicht schon wieder. Da habe ich gerade den Hund abgeschüttelt, dann kommt er. Das sind viel zu viele Menschen. Und Stimmen. Und Eindrücke. Ich bin ein Einzelkind ohne Haustiere mit einem Chirurgen als Vater. Mein Leben war tendenziell immer leise bis einsam. Und das war mir ganz recht. Meistens zumindest.
»Sophie?«
Einen Moment bin ich versucht, so zu tun, als hätte ich ihn nicht gehört, doch da spitzt er auch schon durch den Türspalt. Leon weiß ganz genau, wie niedlich er ist und wie er seine Kinderwaffen einsetzen muss.
»Was gibt’s denn?«
»Darf ich dir den Dachboden zeigen?«
Auch das noch. Ich glaube, ich habe heute echt genug von diesem Haus gesehen. Außerdem bin ich so voll, dass ich mich kaum noch bewegen kann. Und müde.
»Reicht das nicht morgen?«, frage ich, obwohl ich ihm am liebsten die Tür vor der Nase zumachen will.
»Aber er wird dir gefallen.«
»Kann schon sein«, antworte ich, »aber das wird er morgen auch noch.«
»Bitte, Sophie.« Dieser kleine Mensch mit seinen fiesen großen Augen. »Das dauert auch gar nicht lang. Der Teil vom Speicher, den ich dir zeigen will, ist nämlich nur ganz, ganz klein.«
Ich seufze. »Na gut, zeig mir den Speicher.« Leon strahlt mich an. Als ob er nicht die ganze Zeit gewusst hätte, dass ich ohnehin Ja sagen würde. »Ich hoffe, er ist wirklich klein.«
»Das ist er. Meine Uroma hat gesagt, da hat ganz früher mal ein Diener drin gewohnt.«
»Ach was.«
Ich folge ihm durch den langen Flur, an dessen Ende eine steile Holzleiter steht. Wir bleiben stehen, und Leon zeigt nach oben.
»Siehst du die Klappe da?«
Mein Blick folgt seinem ausgestreckten Zeigefinger.
»Ja, die sehe ich.« Wenn auch nicht gleich, weil sie ebenso wie die Decke und die Wände weiß gestrichen ist.
»Die musst du hochdrücken. Aber du musst vorsichtig sein, die klemmt manchmal und wenn man nicht aufpasst, fällt sie einem auf den Kopf.«
»Aha«, sage ich und mustere ihn prüfend. »Du hast aber nicht rein zufällig vor, mich unauffällig aus dem Weg zu räumen, oder?«
Er schaut mich an. »Was?«
»Vergiss es.«
Ich schaue noch einmal hoch, dann steige ich langsam die alten Sprossen hinauf. Als ich oben angekommen bin, halte ich mich an der obersten fest und stemme mich gegen die quadratische Holztür. Und es passiert gar nichts. Als ich etwas fester drücke, klappt die Luke mit Schwung nach oben und bleibt offen stehen. Der Speicher liegt schwarz wie die Nacht über unseren Köpfen.
»Warte, ich gehe vor!«, ruft Leon, quetscht sich an mir vorbei und schaltet das Licht ein. Ich klettere die letzten Sprossen hoch, dann stehe ich neben ihm in einem Raum der Größe einer geräumigen Abstellkammer. Es ist der gleiche Holzfußboden wie im restlichen Haus, nur dass der hier nicht abgeschliffen wurde. Seine Kerben und Furchen erzählen spannende Geschichten. Alles ist alt. Bis auf das Fenster. Das ist ganz offensichtlich ersetzt worden. Das neue ist ziemlich groß – zu groß für so ein winziges Zimmer. Ich drehe mich um die eigene Achse. Hier ist es klein und gemütlich und so weit oben, dass man in die noch nackten Baumkronen schauen kann. Als wäre man selbst in einem Baum. In luftiger Höhe. Ganz allein und doch geborgen. Wie die Taube auf dem Dach.
»Schön, oder?« Leon setzt sich im Schneidersitz auf den Boden und blickt aus dem Fenster. Ich setze mich neben ihn. Er schaut hoch und grinst mich an. »Das hier magst du lieber als das große Zimmer.«
Ich grinse zurück. »Ja, kann schon sein.«
»Es ist ein bisschen wie meine Höhle.«
»Das ist es.« Die Dunkelheit umhüllt uns wie eine Decke. Eine Weile sitzen wir da und schweigen. Alles ist still. Nur der Wind pfeift ums Dach. Es ist ein heimeliges Geräusch.
»Da hinten«, sagt Leon, steht unvermittelt auf und erwartet offensichtlich, dass ich es auch tue, »da ist das Bad.«
»Im Ernst?« Na ja, eigentlich logisch. Der Diener musste eben auch mal duschen.
»Schau, es ist ganz klein«, sagt Leon in seinem zufriedenen Tonfall. Ich muss lächeln. Das scheint irgendwie die Hauptsache zu sein. Ich stecke meinen Kopf ins Badezimmer, und damit ist es auch schon fast voll. Es besteht aus dem kleinsten Waschbecken, das ich je gesehen habe, einem Klo und einer Dusche für Schlangenmenschen. Es ist einfach perfekt.
Schöne neue Welt
Ich habe geahnt, dass Papa von meiner Idee nicht gerade begeistert sein wird, aber irgendwie dachte ich, er würde mich verstehen. Stattdessen kam nur ein Vortrag, was denn an dem anderen Zimmer nicht passen würde und dass ich endlich einmal genug Platz zum Zeichnen hätte und dass Lena und die Jungs sich so reingehängt haben und dass ich nicht so undankbar sein soll und dass er gar nicht versteht, warum ich mich so anstelle. Das alles hat er mir bei angelehnter Tür in meinem neuen Zimmer wütend entgegengeflüstert. Es sollte schließlich keiner hören, dass wir eine Auseinandersetzung haben, wo wir doch jetzt so eine große glückliche Familie sind.
»Beim Essen vorhin hast du kaum ein Wort gesagt, du bedankst dich nicht für das wunderschöne Zimmer oder dafür, dass alle dir ihre Hilfe anbieten.« Er macht eine Pause. »Warum musst du so sein?«
»Warum ich so sein muss?«, flüstere ich schroff zurück. »Das hier war nicht meine Entscheidung. Es war ganz allein deine. Du hast nicht gefragt, ob ich das will!«
»So ist es, Sophie«, antwortet er gereizt. »Es geht ausnahmsweise mal nicht nur um dich!« Nur um mich? »Das hier ist seit deiner Geburt die erste Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, und dafür werde ich mich ganz sicher nicht entschuldigen. Mein gesamtes Leben hat sich immer und ausschließlich um dich gedreht.«
Ich starre ihn an. So etwas hat er noch nie gesagt. Zum ersten Mal fühle ich mich wie eine Bürde. Wie eine genetische Verpflichtung. Als hätte die Tatsache, dass meine Mutter mir das Leben geschenkt hat, ihm seines weggenommen. Ich will gerade sagen, dass sie mich ja hätten abtreiben lassen können, aber mein Vater ist schneller. »Ich hatte gehofft, du würdest dich einkriegen, aber langsam reicht es!«
»Langsam reicht es?«, frage ich mit bebender Stimme. »Du tust ja gerade so, als wären wir schon mehrere Wochen hier! Aber es sind Stunden. Ein paar Stunden!«
»Nicht so laut«, flüstert Papa wütend.
»Ich musste das Haus verlassen, in dem ich aufgewachsen bin, mein Zimmer und meine Schule und die Stadt, in der ich siebzehn Jahre lang gelebt habe!«
»Ich habe gesagt, nicht so laut!«, sagt Papa nun selbst laut.
»Warum? Ist laut sprechen hier verboten?«
»Hör jetzt auf, Sophie.« Er klingt bedrohlich und fremd.
»Womit denn?«, frage ich fast verzweifelt. »Was habe ich denn getan? Ich habe nur etwas gefragt!«
Die Tür geht auf. »Ist bei euch alles okay?« Lena betritt unaufgefordert das Zimmer. Als Papa sie sieht, lächelt er los wie ein abgerichteter Hund. Gott, wie armselig.
»Ja, alles okay«, lügt er.
»Das klang aber nicht so.«
»Es war nur ein Missverständnis. Sophie und ich haben das schon geklärt.« Er schaut mich eindringlich an. »Nicht wahr, Sophie?«
Der Mann, der mir gerade gegenübersteht, sieht aus wie mein Papa, er hat seine Stimme und trägt seine Kleidung. Aber er ist es nicht. Er ist ein völlig anderer Mensch.
»Worum ging es denn?«, fragt Lena.
»Wie gesagt«, sagt mein Vater scheinbar ruhig, »wir haben das geklärt.«
»Aber es scheint Sophie ziemlich mitgenommen zu haben.«
Mein Blick findet ihren. Ich brauche ihre Hilfe nicht. Und ich will sie auch nicht. »Hat eure Auseinandersetzung etwas mit dem Zimmer im Speicher zu tun?«
»Du hast Lena bereits gefragt?«, platzt es aus meinem Vater heraus. »Bevor du mit mir gesprochen hast?«
»Nein, Christian, das hat sie nicht«, sagt Lena, ehe ich reagieren kann. Ich kann kaum atmen.
»Sondern?«
»Leon hat mir erzählt, dass er mit Sophie auf dem Dachboden war und dass sie sich dort oben sofort wohlgefühlt hat.«
Mein Vater seufzt und schließt einen Moment die Augen, dann macht er einen Schritt auf Lena zu und nimmt ihre Hand. »Es tut mir leid, dass ich dich eben so angeredet habe«, sagt er reumütig. »Ich bin einfach völlig fertig.«
Es tut ihm leid, dass er sie eben so angeredet hat? Meine Augen brennen verräterisch. Nicht jetzt. Keine Tränen. Nicht vor ihr.
»Sophie, wenn du das Zimmer haben willst, ist das überhaupt kein Problem.«
Wenn sie denkt, dass sie mich mit ihrem lahmen Versuch, sich auf meine Seite zu schlagen, beeindrucken kann, hat sie sich getäuscht. Immerhin ist es ihre Schuld. Sie hat alles kaputt gemacht. Und am liebsten würde ich ihr genau das sagen. Dass Papa und ich uns immer gut verstanden haben, dass wir nie Streit hatten. Nie. Dass alles gut war. Bis sie auf der Bildfläche erschienen ist. Vor Lena waren Papa und ich ein Team. Wir haben zusammen Serien geschaut und Doppelkopf gespielt. Manchmal auch Schach.
»Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dir das obere Zimmer zu geben, weil es so unglaublich klein ist. Ich wollte nicht, dass du dich wie Cinderella in ihrem Turmzimmer fühlst.«
Lena lächelt. Ich hasse sie. Aber wenn ich das laut aussprechen würde, würde meine Stimme versagen. Ich würde hysterisch klingen und in Tränen ausbrechen, und Papa würde ausrasten.
»Das Bad ist seit Ewigkeiten nicht geputzt worden, aber das können wir morgen zusammen machen, wenn du willst. Oder besser gesagt, nacheinander – es ist schließlich viel zu klein.« Lena lächelt. »Und dann bringen wir deine Sachen hoch.« Sie macht eine Pause. »Was denkst du?«
Ich will ihr sagen, dass sie sich zum Teufel scheren soll, aber ich will dieses Zimmer. Ich will meinen Turm und meine Ruhe, deswegen räuspere ich mich und antworte: »Das wäre sehr schön. Danke.« Dieser simple Satz kostet mich all die Kraft, die ich in mir habe. Vor allem das letzte Wort.
»Das Bett können wir jetzt gleich hochbringen, dann kannst du schon heute dort schlafen.« Sie lächelt und schaut zu meinem Vater. »Zu dritt haben wir das ganz schnell erledigt. Den Futon-Lattenrost aus dem Gästezimmer kann man zusammenschieben. Der sollte problemlos durch die Luke passen.«
Ich weiß, dass mein Vater dagegen ist. Seine Körperhaltung und seine finstere Miene lassen keinen Zweifel daran. Trotzdem nickt er. Vermutlich will er Lena später noch flachlegen und kann deswegen keinen Streit mit ihr gebrauchen.
»Also gut«, sagt er mit einem kühlen Blick in meine Richtung. »Dann machen wir das eben. Auch wenn ich es vollkommen unnötig finde.«
»Ich finde es kein bisschen unnötig«, erwidert Lena. »Ich möchte, dass Sophie sich hier zu Hause fühlt.« Sie zeigt in Richtung Flur. »Wollen wir?«
Ich will nach Hause. Und ich will weinen. Aber da das nicht geht, nicke ich. Nicht mehr lang und ich kann mit Lukas skypen. Wenn ich sein Gesicht sehe, wird es mir gleich besser gehen. Er ist der Einzige, der mich versteht.
Und Lena natürlich. Verdammte Schleimerin. Sie will, dass ich sie mag. Aber das wird nicht passieren.
Die Verbindung wird gehalten
»Mensch, Flittchen, endlich …«, sagt Lukas, als er meinen Skype-Anruf annimmt. Es tut so gut, sein Gesicht zu sehen, dass ich fast in Tränen ausbreche. Wenigstens etwas Bekanntes in dieser schönen neuen Welt. »Ich dachte schon, du hast mich vergessen.«
»Als ob ich dich vergessen könnte.«
Er grinst. »Wenn das stimmt, wie kann es dann sein, dass ich über eine Stunde lang vor dem Bildschirm herumgesessen bin und auf deinen Anruf gewartet habe?«
Ich seufze. »Wir haben gegessen, und dann hat Lena das blöde WLAN-Passwort nicht gefunden.« Ich mache eine Pause. »Ach ja, und davor mussten wir noch mein japanisches Bett in die Dienerwohnung schleppen.«
Er legt den Kopf schräg. »Dein was in die was?«
Ich muss lachen. »Hier gibt es eine ehemalige Dienstboten-Unterkunft.«
»Aha.« Er zieht die Augenbrauen hoch. »Ist wohl ein großes Haus.«
Ich lehne mich an die Wand. »Das könnte man wohl sagen.«
»Ein schönes Haus?«
»Ja, schon.«
Lukas lächelt.
»Was ist?«, frage ich.
»Ach nichts, ich warte nur darauf, dass du mir erzählst, was dich so beschäftigt.«
»Wie meinst du das?«
»Komm schon, dein leerer Blick hat ja wohl kaum etwas mit dem Passwort oder deinem komischen Bett zu tun.«
Lukas. Mein Lukas.
»Nein, das hat er nicht«, gebe ich zu.
»Also, was ist passiert?«
Ich presse meine Lippen aufeinander. »Papa und ich haben gestritten.«
»Was? Du und dein Vater?«, fragt er erstaunt. »Aber ihr … ihr streitet nie.«
»Jetzt schon.«
Lukas macht sein »Oh-Flittchen-das-tut-mir-so-leid«-Gesicht, und ich muss lächeln. »War es sehr schlimm?«
»Für unsere Verhältnisse schon.«
»Willst du drüber reden?«
»Nicht wirklich, nein.«
»Okay.«
Es entsteht eine Pause, die so laut ist, dass ich sie brechen muss.
»Und bei dir? Ist mit dir und deinem kleinen Croissant alles gut?«
Er grinst. »Ja, alles gut.«
Damit war zu rechnen. Die beiden sind wie ein verdammtes Disney-Märchen.
»Vianne hatte die letzten zwei Wochen wegen dem ganzen Schulstress zwar keine Lust auf Sex, aber seit gestern ist auch das ausgestanden.«
»Das freut mich wirklich sehr für dich, aber ich brauche echt keine Details«, sage ich und rümpfe die Nase.
»Du willst nicht hören, wie ich es ihr gestern nach allen Regeln der Kunst besorgt habe?«
»Halt die Klappe«, sage ich, und er grinst dreckig. »Wir hatten einen Deal, schon vergessen?«
»Natürlich nicht. Fragen über Sex, die Anatomie der Frau und ihre geheimsten Fantasien und Wünsche: Ja. Details zum Akt als solchem: Nein.«
»Gut«, antworte ich lächelnd.
Klar weiß ich, dass Lukas ein Kerl ist, und ich weiß auch, dass er einen Penis hat und dass er den auch benutzt, aber ich habe ihn nie auf diese Art gesehen. Sein Genitalbereich ist wie der von Barbies Ken: nicht vorhanden. Wir kennen uns seit dem Kindergarten. Und auch wenn mir bewusst ist, dass seitdem nicht nur seine Hände und Füße gewachsen sind, will ich an den Rest nicht denken. Lukas ist mein Mensch. Und dafür braucht er keinen Penis. Im Gegenteil. Sein Penis würde unserer Freundschaft nur im Weg stehen.
»Vianne hat die Zusage für die Sorbonne bekommen.«
»Echt?«
»Ja, heute. Schon verrückt, oder? Im Herbst wird sie anfangen, dort zu studieren.«
»Aber sie hat doch noch gar nicht das Abitur.«
»Das nicht, aber sie erfüllt die Kriterien, ganz egal, was sie für Noten im Bac schreibt.«
»Wow«, sage ich und schlucke. »Dann … dann bleibst du also in Paris? Ich meine, nach dem Abitur?«
»Ich …« Er zuckt die Schultern und schüttelt unbestimmt den Kopf. »Keine Ahnung, das ist noch so lange hin.« Das ist eine Lüge. »Jetzt guck nicht so, Flittchen, es steht noch nichts fest.«
»Ja, klar.«
»Ich meine es ernst. Es ist noch nichts entschieden.« Ein paar Sekunden schauen wir einander einfach nur an. So lange, bis ich lächle. »Was ist? Glaubst du mir nicht?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: