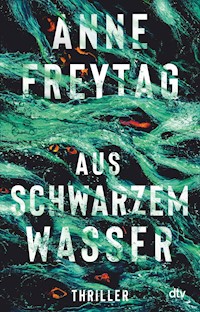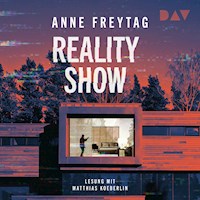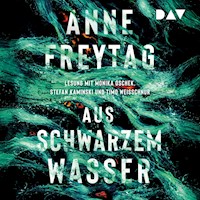Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Kampa VerlagHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Helene hätte ihren Mann verlassen sollen. Für Alex. Aber sie hat es nicht getan. Und jetzt hat ihr Mann sie verlassen – weil er sich in eine andere verliebt hat. »Es ist einfach passiert.« Mit diesem Satz zerreißt Georg das Gefüge, das Helene immer versucht hat zusammenzuhalten. Aber vielleicht ist das Ende gar kein Ende? Vielleicht ist es ein Anfang. Etwas, das Helene gebraucht hat, um sich aus dem gesellschaftlichen Korsett zu befreien, aus ihren ewigen Versuchen, den Bildern einer Frau zu entsprechen: als Ehe- und Karrierefrau, als Mutter und Tochter … Was bedeutet es eigentlich, eine Frau zu sein? Diese Frage begleitet Helene, während sie beginnt, ihren eigenen Weg zu gehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Freytag
Lügen, die wir uns erzählen
Roman
Kampa
Für Ella
»I sat with my anger long enough, until she told me her real name was grief.« unknown
Jetzt. Briefgeheimnis
»Dann bist also jetzt du das Opfer?«, frage ich. »Weil ich dich seinetwegen nicht verlassen habe?«
»Nein«, erwidert Georg und steht auf. »Weil du ihn die ganze Zeit über geliebt hast.«
Er sagt es in einem harten Flüstern, ein gedrosseltes Schreien, das ich gut von ihm kenne – sein Kinder-Tonfall. Anna und Jonas sollten uns nicht hören, nicht beim Streiten, nicht beim Sex. Je älter sie wurden, desto leiser wurden wir. Kein Austausch mehr, weder körperlich noch verbal. Bis Georg und ich irgendwann nicht mehr waren als Atmosphäre, feinstoffliche Stimmungsschwankungen, die sich ab und zu im Flur begegnen. Ein Korsett, das wir uns gegenseitig vor Jahren mit einem Ich will angelegt haben.
Georg deutet auf das Kuvert zwischen uns auf dem Tisch. »Liebst du ihn?«, fragt er.
»Keine Ahnung«, sage ich.
Georg hat auf ein Nein gehofft, ich erkenne es an seinem knappen Nicken, an der senkrechten Falte zwischen seinen Augenbrauen, an der Anspannung in seinem Gesicht, insbesondere um den Mund. Ich hätte nicht gedacht, meinen Mann noch einmal so zu sehen, so eifersüchtig. Früher war er es oft. Als wäre ich ein stetiger Drahtseilakt für ihn gewesen, ein ewiges Erobern. Wenn wir ausgingen und ein Mann mich zu lange ansah, griff Georg demonstrativ nach meiner Hand oder küsste mich – als wäre ich sein Revier und damit markiert. Es hat mir nichts ausgemacht, wenn er so war. Im Gegenteil, ich mochte ihn besitzergreifend. Ich, seine Frau, und er, der es jeden wissen ließ. Doch irgendwann hörte das auf. Als wären wir zu Ende gegangen, gefangen in einem endlosen Abspann, in dem man aus Höflichkeit sitzen bleibt, bis das Licht angeht. Mariam war das Licht. Georg hat es eingeschaltet.
Und jetzt steht er da und sieht mich an, direkter und länger, als ich es von ihm gewohnt bin. Und irgendwie selbstgerecht, obwohl es ihm nicht zusteht. Ich mustere ihn – den Mann, den ich so lange kenne und der mir trotzdem fremd ist. Und dann frage ich mich, wann wir zuletzt miteinander gesprochen haben, wirklich gesprochen, nicht nur mit Worten die Luft bewegt, keine leeren Sätze, keine alltäglichen Fragen oder Absprachen, kein Brauchst du jemanden, der dich zum Flughafen bringt?, sondern ein echtes Gespräch zwischen zwei Menschen, die sich etwas bedeuten – oder wenigstens noch etwas zu sagen haben.
Ich denke an die Situation zurück, als er mir von ihr erzählt hat. An sein Es ist einfach passiert. Gewusst habe ich es schon eine Weile. Seit einem Dienstagabend im März. Georg hatte sich mit einem ehemaligen Studienfreund verabredet, der für ein paar Tage in der Stadt war – jedenfalls hatte er das gesagt. Als er wieder nach Hause kam, roch er frisch geduscht. Sein Haar war feucht, der Duft des Shampoos weiblich. Auf meine Vermutung angesprochen habe ich ihn nicht. Vielleicht weil ich dachte, es würde vorbeigehen, eine holprige Phase in unserer Ehe, wie Schlaglöcher in einer Straße nach einem langen, harten Winter. Gestohlene Nächte, die irgendwann enden würden. Nur dass sie das nicht taten. Aus den Nächten wurden Tage. Und aus den Tagen Wochenenden. Der fremde Shampoo-Duft war irgendwann nicht mehr fremd. Und auf einmal hatte die Frau einen Namen. Nicht nur einen Körper, nicht nur ein Loch, in dem mein Mann verschwinden konnte, wenn es ihn überkam. Mariam.
Georg lässt den Blick sinken, schaut zu Boden. Er war lange nicht so – so anwesend. Als wären der, der gerade hier ist, und der, der mich verlassen hat, nicht derselbe Mensch. Es ist einfach passiert. Ich höre noch, wie er es sagte. Die Tonlage, die Ausrede. Danach breitete sich Schweigen zwischen uns aus, aufgeladen, als würden wir auf einen Funken warten, den es nicht mehr gab. Ich lehnte an der Arbeitsfläche, die Arme verschränkt, der Blick lang wie ein Abschied. Von außen betrachtet war alles wie vorher: eine saubere Küche, fast steril, die Kräutertöpfe am Fenster, Basilikum, Thymian, Salbei, ein paar Meter daneben Georg und ich, eine eingefrorene Realität, gefangen in lauter Stille. Wie in einer Schneekugel, die geschüttelt wurde – ein eisiger Sturm, der um uns tobte, und wir standen mittendrin. Es hat sich angefühlt, als hätte man uns dort abgestellt, zwei Fremde, die verheiratet sind. Und mit jeder Sekunde, in der wir nichts sagten, schien die Küche sich aufzublähen wie Lungen, kurz bevor jemand schreit.
Ich habe Georg auch mal betrogen. Das ist Jahre her. Es war in Lausanne nach einer Lesung, ein flüchtiger One-Night-Stand mit einem Journalisten, den ich danach nie wiedergesehen habe. Georg weiß nichts davon, es war nicht der Rede wert. Ein zweiter Akt irgendwo in der Schweiz, während er woanders war.
Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich an jene Nacht zurückdenke. Nicht oft, aber es kommt vor. Dann ist es wie eine Szene aus einem Film oder einem Roman: eine Frau und ein Mann, beide verschämt und erregt, tausend Entscheidungen, jede einzeln getroffen, irgendwo zwischen Lust und Verstand. Kleider, die zu Boden fallen, Hände, die sich ausstrecken, Augen, die hungrig über Haut gleiten. Es war das reinste Klischee: ein dunkles Hotelzimmer, eine halbe Flasche Rotwein auf dem Nachttisch, die andere Hälfte bereits im Blut. Zwei Körper und ein paar Höhepunkte. Triebe und Hände. Ich habe mich in diesen Stunden beinahe schmerzhaft lebendig gefühlt. Doch es hatte nichts mit uns zu tun. Nichts mit dem Leben, das wir führten, unserem Haus, unseren Kindern – und auch nicht mit ihm, meinem Mann, der mich schon ewig nicht mehr angefasst hat, für den ich eher so etwas war wie ein Stück Einrichtung, etwas, das eben da ist und das man womöglich vermissen würde, wenn es weg wäre. Aber ich war nie weg, ich war immer da – für ihn und die Kinder. Und für alles andere.
Als ich fremdgegangen bin, hatte das nichts mit Liebe zu tun, es ging um das, was der Journalist in mir sah: die Brüste, die Rundungen, die straffen Schenkel, für die ich seit Jahren joggen gehe. Ihm fiel auf, woran mein Mann sich längst sattgesehen hatte.
Eine solche Nacht hätte ich Georg verzeihen können. Sogar ein paar solcher Nächte. Ausrutscher aus unserem gemeinsamen Leben in ein anderes. Aber bei ihm war es nicht nur Sex, nicht nur Triebbefriedigung, keine falsche Entscheidung nach zu viel Wein. Das, was anfangs vielleicht noch eine Ausflucht war, hat sich zu einem zweiten Strang entwickelt, zu einer Geschichte, die sich über Monate neben unserer weitererzählt hat.
Bei dem Gedanken atme ich tief ein, spüre, wie mein Brustkorb sich dehnt, schaue zu Georg, dieser ergrauten Version von ihm, glatt rasiert, dunkle Augen, ungekämmtes Haar. Ich sehe dabei zu, wie er neben dem Tisch auf und ab geht, die Hände in den Hosentaschen zu Fäusten geballt, am Rande eines Wutausbruchs. Weil es eine Sache ist, wenn es bei ihm jemand anders gibt, und eine völlig andere, dass es bei mir auch so sein könnte. Das mit Mariam ist immerhin einfach passiert. Die Sache mit Alex – dessen Brief Georg mir nicht nur vorbeigebracht, sondern offenbar auch gelesen hat – habe ich verschwiegen. Eine bewusste Entscheidung. Ein Verrat, der unsere Ehe zu einer Inszenierung verkommen lässt. Zu einem Übereinkommen, bei dem Georg der Kompromiss war.
In dem Moment, als ich das denke, bleibt er abrupt stehen.
»Es war dieser Typ«, sagt er und sieht mich an, »bei der Lesung, von der ich dich damals spontan abgeholt habe.«
Mein Puls wird schneller, das Blut zieht sich aus meinen Fingern und Füßen zurück.
»Das war er. Der, den du so lang umarmt hast. Von ihm ist der Brief.«
Ich antworte nicht.
»Antworte mir«, sagt Georg.
Während ich mich erhebe, entgegne ich: »Ich schulde dir keine Erklärung. Du bist ausgezogen. Du hast eine Freundin. Weißt du noch?«
Georg sieht mich lange an. Mehrere Sekunden, die alles langsamer machen. Irgendwann schüttelt er den Kopf und sagt: »Du begreifst es nicht, oder?« Ein direkter Blick. »Du warst meine große Liebe. Und er war deine.«
Nach diesem Satz ist es still. Eine Stille wie für Stecknadeln. Georgs Vorwurf füllt den gesamten Raum, er liegt in der Luft wie ein beißender Geruch, der sich zwischen uns ausbreitet. Aber Alex war nicht der Grund für das Scheitern unserer Ehe. Georg und ich sind unserer gegenseitigen Gleichgültigkeit zum Opfer gefallen, der Routine und den sich wiederholenden Abläufen. Sex als Mittel zum Abreagieren, selten und meist von hinten. Keine Küsse, kein Danach, keine Verabredungen. Nie ins Kino, kaum Restaurantbesuche. Zwei Wochen Sardinien im Jahr, immer dasselbe Hotel, immer dieselben Zimmer, immer dieselben Strände. Wir sind zusammengeblieben, weil wir nicht schuld sein wollten an diesem gescheiterten Entwurf, der gar kein Entwurf war, sondern das echte Leben. Als wäre es irgendwann zu spät, umzukehren. Als wäre man bereits zu weit gekommen.
»Ich sollte gehen«, sagt Georg.
Ein Teil von mir will nicken, ein anderer will, dass er bleibt.
Damals in der Küche unseres Hauses konnte er meinem Blick nicht standhalten, hat überallhin gesehen, nur nicht in meine Augen. Jetzt sieht er nur dorthin – in meine Augen. Nicht knapp an mir vorbei, ausweichend, unmännlich. Die Jahre zuvor hat er in meinem Schatten gelebt wie in einem Anbau. Wie jemand, der sich in die Garage zurückzieht, um dort heimlich Pornos anzusehen und zu masturbieren. Mit einem kleinen Kühlschrank voll mit Bier und schlechtem Gewissen. Georg hat meinen Erfolg gehasst, die Anerkennung, den Wind um meine Person. Er hat es nie laut ausgesprochen, nie gesagt, wie sehr es ihn abstößt, dass sein Nachname mit meinem Vornamen in Verbindung gebracht wird. Dass ich ihn groß gemacht habe, während er ihn nur trägt. Der Mann von, die bessere Hälfte, der, der nicht arbeiten muss, der, der das Taschengeld verdient.
Georg steht zwischen mir und der Tür. So wie vor neuneinhalb Wochen, als er mich verlassen hat. Eine andere Tür, andere Menschen und doch dieselben. Ich denke an die Situation zurück. An Georg und mich, jeder auf seiner Seite der Kücheninsel, da, wo wir sonst schweigend Gemüse schnitten, getrennt von Gedanken und der Dunstabzugshaube. Und es war nicht die Wahrheit, die so wehtat, nicht die Erkenntnis, dass er die andere nicht nur fickt, sondern liebt, es war das Bedauern in seinem Blick. Das Ende von zwanzig Jahren, so bedrückend unspektakulär.
Sie heißt Mariam. Ich habe mich in sie verliebt.
Er hat kurz auf- und dann sofort wieder weggeschaut, eine Geste wie ein Schnitt. Als hätte er damit die Verbindung zwischen uns gekappt, das letzte bisschen, das noch da war. Als hätte er das finale Okay gegeben, die Maschinen eines Koma-Patienten abzustellen. Keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr. Kein halbherziger Versuch, von dem wir beide wussten, dass er scheitern würde. Georg ist gegangen. Ein paar letzte Schritte weg von mir. Eine Türklinke, die sich ein letztes Mal hebt. An jenem Tag war sie nicht der Schlusspunkt hinter irgendeinem Streit, sie war der Schlusspunkt hinter unserer Ehe.
Mein Handy klingelt. Der schrille Ton begleitet unsere Blicke.
Als der Anruf endet, ist es unwirklich still. Als gäbe es keine Geräusche mehr. Keinen Laut. Zehn Sekunden lang, elf … dann klingelt es erneut.
Und in dem Moment weiß ich, wer es ist. Ich weiß, was er sagen wird.
Und bei dem Gedanken daran zieht sich alles in mir zusammen.
Neuneinhalb Wochen vorher. Happy End
Mein Mann und die andere gehen Hand in Hand den Bürgersteig entlang und sehen falsch zusammen aus – sie zu wenig wie ich und er zu glücklich. Ich hatte vergessen, wie Georg in glücklich aussieht, wie anders sein Gesicht wirkt. Unbeschwert. Fast jungenhaft. Das war mal mein Anblick, dieses Lächeln. Beim Frühstück, im Bett, Anna zwischen uns, Georgs Hand auf meinem schlaffen Bauch. Ich will nicht daran denken, aber ich sehe jedes Detail. Georg, der mich küsst, der Anna küsst, auf den kleinen Rücken, auf die Wange, Georg, der mir sagt, dass er mich liebt – mich immer lieben wird. Und jetzt stehe ich auf der anderen Straßenseite hinter einem Lieferwagen und verletztem Stolz.
Sie kriegt den reifen Georg. Den wohlsituierten. Den gut gekleideten. Den Mann, der er erst durch mich geworden ist. So viele Jahre habe ich an ihm gefeilt, ihn geformt wie einen nassen Klumpen Ton.
Mariam.
Sie sieht aus, wie ihr Name es hat vermuten lassen. Exotisch, besonders. Schwarze Haut, das Haar zu langen Zöpfen geflochten, Flip-Flops, nackte trainierte Beine, ein Top mit Arm-Ausschnitten, die ihr bis zur Hüfte reichen und einen tiefen Einblick auf ihren BH-losen Oberkörper geben. Sie ist jünger als ich, ein neueres Modell. Als wäre ich die letzte Generation und inzwischen überholt – von ihr, dem Facelift. Eine Stimme in meinem Kopf sagt, dass es daran liegt – dass ich zu alt bin. Als wären meine Falten das Problem, als hätte ich meinen Mann mit einer glatteren Stirn halten können. Ich weiß, dass es nichts damit zu tun hat, aber die Gedanken sind da, frisch gesät auf fruchtbarem Boden – auf Selbsthass und Minderwertigkeitskomplexen. Mariam ist wie ein Hinweisschild auf meine Unzulänglichkeiten.
Während ich neben ihnen hergehe, getrennt von der Straße und geparkten Autos, versuche ich, mir nicht vorzustellen, wie sie miteinander schlafen, wie sie sich anfassen, wie sie sich küssen. Aber alles an ihnen ist Sex, sie scheinen förmlich davon durchdrungen, die Lust noch auszudünsten, die sie kurz zuvor noch stöhnend und seufzend verbunden hat. Als hätte der Hunger sie aus dem Bett getrieben, nachdem sie es getrieben haben, Georg und sein Loch.
Ihn mir beim Sex vorzustellen, ist seltsam. Und das nicht, weil er mit einer anderen schläft, sondern weil Georg und ich uns seit Jahren nicht mehr nackt gesehen haben. Wenn es dann doch mal passiert ist, sind wir fast erschrocken. Ertappte Blicke, die sich treffen und aneinander abprallen wie Billardkugeln. Ich kannte Georg nur noch angezogen. Pyjama, Hausschuhe, Bademantel, Anzug, Krawatte, Hemd, alles von unserer Haushälterin gebügelt und in den Schrank gehängt. Ich habe das Bedürfnis verloren, mit meinem Mann zu schlafen, von ihm berührt zu werden. Es ist vom Alltag erstickt worden wie eine Flamme unter einem Glas.
Georg legt seinen Arm um die andere – derselbe Mann, der mir vor zwanzig Jahren in einer Kirche versprochen hat, mich immer zu lieben und zu ehren. Er hat es vor unseren Familien und Freunden gesagt. Ich werde dich lieben und ehren. Beim Gedanken daran hallt seine Stimme durch meinen Kopf wie damals durch das Steingemäuer – eine Lüge, die von allen Wänden abgeschmettert wurde, zurück zu mir, seiner Frau. Ich habe ihm schon damals nicht geglaubt – woher soll man auch wissen, ob man jemanden immer lieben und ehren wird? –, aber ich habe es mir gewünscht. Dass wir diese Ausnahme sind. Er und ich.
Georg lacht auf. Und er sieht aus wie ein Fremder. Wie jemand, der das Gesicht meines Mannes übergezogen hat und seinen Körper trägt wie eine Schürze. Jemand, den ich kenne, aber nicht erkenne. Ein attraktiver Mann. Ein Mann, der mir auffallen würde.
Wenig später bleiben sie vor einem Lokal stehen. Es ist die Anschrift, die Georg aus alter Gewohnheit in unseren synchronisierten Kalender eingetragen hat – der Grund, warum ich weiß, wo sie hinwollten. Die beiden sehen sich nach einem freien Platz um, setzen sich – nicht einander gegenüber, sondern Schulter an Schulter, wie in einem Pariser Straßencafé. So als würden sie den Gedanken nicht ertragen, voneinander getrennt zu sein – nicht mal von einer Tischplatte.
Ich bleibe im Schatten einer Litfaßsäule stehen und beobachte sie. Jedes Lächeln, die zärtliche Vertrautheit, die Nähe zwischen ihnen, Augen wie Berührungen. Und dann frage ich mich, ob Georg und ich auch mal so waren, so regelrecht betrunken vom anderen, mit Händen, die nach Nähe suchen, und Blicken, die einen Vorgeschmack aufs Später geben.
Ich weiß es nicht mehr. Vermutlich.
Als der Kellner kommt, um ihre Bestellung aufzunehmen, wende ich mich ab und gehe – nach außen hin aufrecht, innerlich am Boden, mit einer Überdosis fremden Glücks und Krämpfen in den Gedärmen, die mich entfernt an Wehen erinnern.
Zwanzig Minuten später bin ich wieder zu Hause. Es ist kühl und leer, genau wie ich. Mauern aus Stein und geschlossene Fenster, ein Gefängnis in bester Lage. Gerahmte Bilder an den Wänden, wie Zertifikate für ein gelungenes Leben. Georg und ich erst ohne, dann mit Kindern. Zu dritt mit Anna, zu viert mit Jonas, ein kleines Mädchen und ein noch kleinerer Junge.
Ich verharre am Fuße der Stufen und betrachte unsere Kinder, neugeborene Menschen mit unfassbar kleinen Händen. Ein paar Stunden alt, ein paar Tage, ein paar Monate. Reine Wesen, die noch niemand versaut hat. In diesem Augenblick wird mir klar, dass ich meinen Kindern damals alles habe geben können, was sie brauchten. Liebe, Muttermilch, frische Windeln, Nähe. Georg und ich haben die beiden jeden Abend gebadet und in den Schlaf gesungen. Georg hat eine schöne Stimme, warm und brummig, ein beruhigender Klang, so als würde alles gut. Ich erinnere mich daran, wie Georg im Flur langsam auf und ab ging, ein Baby auf dem Arm, die Lippen an seiner Schläfe, summend und wippend, ich erinnere mich an speckige Arme und winzige Füße, an zahnlose Münder, zusammengezogen als wären es Rosinen.
Und jetzt ist Georg weg. Und unsere Kinder groß. Anna fast sechzehn, Jonas fünfzehn, zwei Wesen, die Georg und ich gezeugt haben, denen wir nun peinlich sind – so wie ihnen eigentlich alles peinlich ist: ihre unfertigen Körper, ihre fremden Begierden und Gedanken, die Verlorenheit, derer sie sich vermutlich nicht mal bewusst sind. Anna mit ihrem mädchenhaften Gesicht und den Rundungen einer jungen Frau, hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis, ihre Reize zu zeigen, und dem, nicht darauf reduziert zu werden. Ein erster fester Freund, Nachmittage in ihrem Zimmer hinter verschlossenen Türen, laute Musik – verdächtig laut. Und Jonas mit seiner brechenden Stimme, die mich jedes Mal an das Knarzen der Kellertür denken lässt. Mit seiner knabenhaften Gestalt, gefangen irgendwo zwischen Kind und dem Übergang zum Mann, zu weit weg und gleichzeitig elektrisiert davon. Nasse Flecken in der Bettwäsche, die er versucht zu entfernen, deren eingetrocknete Härte ihn dennoch verrät. Zwei Menschen im Werden, während ich nur noch welke.
Ich stehe da, die Finger auf dem Handlauf, die Rillen des Holzes rau unter meiner Haut, brennende Augen und ein Gefühl von Leere in der Brust. Ich habe den Kindern noch nichts gesagt. Stattdessen habe ich behauptet, Georg wäre geschäftlich unterwegs. Eine Lüge, die genauso gut wahr sein könnte. Nur dass ich ihn, wenn es so wäre, nicht vermissen würde. Vermutlich würde ich nicht mal an ihn denken. Er wäre einfach weg. Ein Zustand, der mit den Jahren normal geworden ist. Doch jetzt tue ich es. Jetzt denke ich an ihn. Weil er nicht geschäftlich unterwegs ist, nicht verreist, nicht beim Laufen, nicht auf ein vermeintliches Bier mit Christoph, sondern bei einem späten Mittagessen mit seiner Freundin.
Nun weiß ich es also.
Mein Blick fällt erneut auf die Wand vor mir, die Ausschnitte unseres Lebens. Ein Fotoalbum, das zwischen verklebten Seiten all das Hässliche versteckt. Die Verlogenheit, die Einsamkeit, die Distanz, die aus unserer einstigen Nähe entstanden ist. Das Paar auf diesen Fotos gibt es schon lange nicht mehr, es hat sich auseinandergelebt, jeder in ein anderes Leben, unter einem Dach, in einem Bett, jahrelang.
Während ich mich immer weiter in Fiktion flüchtete, fickte Georg nur ein paar Straßen entfernt eine andere. Er hat sich beim Joggen verliebt. Und ich in meinen Romanen gemordet.
Ich bleibe mit den Augen an einem Hochzeitsfoto hängen. Mein Gesicht spiegelt sich grau im staubigen Glas. Ich mustere die Frau auf dem Bild, an der ich so lange vorbeigegangen bin, ohne sie zu bemerken. Diese junge Version von mir, die in Georgs Armen liegt und lacht, den Kopf in den Nacken geworfen, die Augen geschlossen, ein tiefblauer Himmel, der uns umgibt, mit weißen Wolkenbergen. Und Georg, der mich ansieht, ganz jung und verliebt, das Haar etwas kürzer, noch nicht grau durchsetzt und ungewohnt ordentlich. Er im Smoking, ich in einem schmal geschnittenen weißen Kleid mit Spitzenborte, als wäre ich ein Geschenk für ihn. Wir sahen schön zusammen aus, Georg und ich. Ein Happy End mitten im Leben – das nun zu Ende geht.
Zwei Wochen später. Es war einmal
Georg steht herum wie ein Regenschirm, den jemand ver- gessen hat. Ich frage mich, wieso er hergekommen ist, er hätte auch anrufen können, eine Nachricht schreiben, eine E-Mail. Stattdessen steht er in der Tür zum Esszimmer und sucht nach den richtigen Worten. Die haben Georg meistens gefehlt.
Ich schaue an ihm vorbei auf die Uhr. 11:23 Uhr.
Eigentlich müsste ich schreiben. Georg kennt meine Schreibroutine, er weiß, dass er stört. Aber es ist ihm egal – so wie es ihm immer egal war. Dann schreibst du eben später.
Der Minutenzeiger klickt. 11:24 Uhr.
Wir haben die Uhr in Italien gekauft. Ein spontaner Trip nach Meran, fünf oder sechs Tage, in denen wir nur gegessen und miteinander geschlafen haben. Das war noch vor den Versuchen, ein Kind zu zeugen. Damals, als Sex noch Spaß gemacht hat. Ich habe lange nicht mehr an diese Reise gedacht. Viel Wein, durchwachte Nächte, lange Gespräche, manche so lang, dass wir die Sonnenaufgänge erlebt haben, Frühstück nackt im Bett. Ich erinnere mich, wie Georg in einem Restaurant zu mir gesagt hat: Deine Beine machen mich wahnsinnig. Er sagte es so heiser, dass sein Satz im Rauschen der Unterhaltungen und der Musik beinahe unterging.
Auf dem Rückweg schafften wir es nicht bis zum Hotel. Erst lehnten wir an einer Hauswand, dann hatten wir Sex in einer dunklen Hofeinfahrt. Währenddessen musste Georg mir immer wieder den Mund zuhalten, weil ich so laut war. Ich erinnere mich, dass er in mein Ohr gelacht hat, als ich kam. Ich spürte ihn überall. Seine Hände, das Pulsieren, seinen Atem.
Bei dem Gedanken daran zieht sich mein Unterleib zusammen, und ein Schwall Blut fließt aus mir heraus. Das mit dem Bluten hat etwa eine Stunde, nachdem Georg das Haus verlassen hat, angefangen. Die erste Periode seit Monaten. Meine Frauenärztin meinte, das Ausbleiben könne viele Gründe haben: Menopause, Stress, psychische Belastung, extremer Sport. Jetzt blute ich, als hätte mich jemand abgestochen. Manche Frauen bekommen Blutungen, wenn sie trauern. Sie verarbeiten das Trauma körperlich, weil sie emotional nicht in der Lage dazu sind, heißt es im Internet. Noch etwas, wozu ich nicht in der Lage bin: trauern.
Ich stand im Schlafzimmer, als die Blutung begann – ein halb ausgeräumter begehbarer Schrank, eine ungenutzte Bettseite, ein leerer Waschtisch im Bad. Da waren keine Tränen, nicht mal ein Schleier. Nur das Blut, das in meine Unterhose lief, Eingeweide, die stellvertretend für mich weinten. Ich stand reglos da und habe an alles gedacht. Wie ein Leben, das in Bildern an mir vorbeizieht. Ein Tod, den ich miterlebe. Georg und ich am Anfang unserer Beziehung, erste Verabredungen, lange Telefonate, gefolgt von einer Sehnsucht, die fast schmerzhaft war. Seine Wärme in den Decken und Kissen, sein Geruch auf meiner Haut, das Rührei nach dem Sex, seine gierige Art, mich zu küssen. Unsere erste gemeinsame Wohnung, eineinhalb Zimmer, ein winziger Balkon. Mein Kater Mozart, gegen den Georg allergisch war, Christina, die ihn zu sich nahm. Der erste Umzug, Georg, der in Boxershorts für uns kocht. Der es mir im Kino mit den Fingern macht, ohne dass es jemand bemerkt. Der in einem voll besetzten Lokal vor mir auf die Knie geht, weil er es nicht aushält, noch länger zu warten. Ich weiß noch, wie er mir damals den Ring an den Finger steckte. Dass in dem Moment mein Leben von einem Versuch zu etwas Konkretem zu werden schien. Als hätte Georg mich mit dem achtzehnkarätigen Solitär in die Kategorie Ehefrau und Mutter befördert. Unsere Hochzeit fiel klein aus, ein teures Kleid, die Haare lose hochgesteckt, Diamantohrringe. Henri war mein Trauzeuge, mein Vater hatte keine Zeit und meine Mutter Vorbehalte – hauptsächlich wegen unseres Altersunterschieds. Ihr Blick sagte Vaterkomplex, sie selbst sagte nichts.
Danach habe ich jahrelang Monat für Monat auf Papierstreifen gepinkelt – Ovulations- und Schwangerschaftstests. Immer wieder. Immer wieder negativ. Es war wie ein Teilzeitjob neben meiner Vollzeitstelle.
Ich weiß noch, wie Georg damals versucht hat, das Richtige zu sagen, aber ich wollte es nicht hören. Weder dass es irgendwann klappen wird noch dass wir kein Kind brauchen, um glücklich zu sein. Weil wir uns haben, weil wir uns lieben. Ich wollte nicht aufgemuntert werden. Ich wollte in der Bade- wanne sitzen und dabei zusehen, wie mein Kinderwunsch in roten Schwaden ins heiße Wasser lief. Hellrotes Blut, wabernd und viel, Erinnerungen an Georg und mich im Bett, ich auf dem Rücken, zwei Kissen unter dem Po, Georg auf mir. Ein Kraft-, längst kein Liebesakt mehr, während dem ich stöhnte wie eine Hure, um es meinem Mann leichter zu machen, nur einen Gedanken im Kopf: das Zeitfenster, das, während Georg noch versuchte zu kommen, bereits im Begriff war, sich zu schließen. Wir hatten jeden Tag Sex. Manchmal mehrmals hintereinander. Wochenenden und Feierabende, bestehend aus Höhepunkten, die längst keine mehr waren.
An einem dieser Abende hat Georg mein Gesicht in seine Hände genommen und gefragt: Denkst du nicht, wir könnten uns gegenseitig genügen? Ich habe geschwiegen und Reizwäsche gekauft. Bin dazu übergegangen, ihm einen zu blasen und mich dann, kurz bevor er kam, auf ihn zu setzen und ihm den Rest zu geben. Nichts war zu demütigend, um an sein Sperma zu kommen. Wenn er fertig war, blieb ich fünfzehn Minuten mit hochgelagertem Becken liegen, obwohl ich wusste, dass es keinen Unterschied machte. Dass es Frauen gab, die trotz Kondom schwanger wurden. Trotz Pille. Dass ein Magen-Darm-Infekt ausreichte, einmal Übergeben nach zu viel Alkohol.
Manchmal, wenn ich dort lag, fragte ich mich, ob Georg und ich vielleicht einfach nicht kompatibel waren. Er ein Schlüssel, ich ein Zahlenschloss. Ob ich von einem anderen Mann vielleicht längst schwanger wäre. Ob Georg eine andere Frau längst geschwängert hätte. Es waren Fragen wie Zahnschmerzen.
»Mariams Wohnung ist groß«, sagt Georg unvermittelt. »Anna und Jonas hätten ein eigenes Zimmer, wenn sie zu uns kommen.«
Zu uns. Zu ihm und seinem Loch, in das er sich verliebt hat.
Georg steht verloren da und starrt auf seine Füße, auf die schwarzen Socken, die er immer trägt, zu jeder Jahreszeit, ganz gleich wie warm es ist. »Es ist nicht weit von hier. Nur ein paar Minuten«, sagt er. »Die zwei könnten zu Fuß gehen.« Pause. »Oder ich hole sie ab.«
In dem Moment frage ich mich, wie oft Georg wohl bei ihr war, wenn er gesagt hat, er wäre in Wahrheit woanders. Ob beispielsweise seine plötzliche Leidenschaft fürs Laufen nur ein Vorwand war, um sie zu sehen. Eine billige Ausrede, die er mir auftischte. Oder die Abende, an denen er angeblich Christoph auf ein Bier getroffen hat. Hat er ihn jemals wirklich getroffen? Oder war er da bei ihr, bei Mariam, nur ein paar Straßen entfernt, während ich allein auf dem Sofa saß und die Nachrichten geschaut habe?
»Anna hat mich gestern angerufen«, sagt Georg. »Dreimal.«
Ich antworte nicht.
»Ich will sie sehen.«
»Wen?«, frage ich. »Anna oder beide?«
»Selbstverständlich beide.«
Er lügt. Aber was macht eine Lüge mehr noch für einen Unterschied?
Seit der Sache mit Jonas vor drei Monaten – Georg nennt es nur die Sache – behandelt er ihn wie einen Aussätzigen. Wir haben im Anschluss zusammen in der Küche gesessen, Georg und ich. Er hat sein Gesicht in den Händen vergraben, minutenlang geschwiegen. Dann hat er aufgeschaut und gesagt: Jonas braucht Hilfe. Als wäre er angefahren worden. Oder gestürzt. Seit Georg ausgezogen ist, hat er Jonas’ Therapie mit keinem Wort erwähnt. Davor ging es praktisch um nichts anderes.
»Ich kann die Kinder an den Wochenenden nehmen«, spricht Georg weiter und klingt dabei so versöhnlich, dass ich kotzen möchte. »Oder jedes zweite. Ganz wie du willst.«
Ganz wie ich will. Natürlich.
Ich sehe ihn an und sage nichts. Erinnere mich daran, wie Georg nach der Geburt unserer Kinder beide Male die Nabelschnur durchtrennt hat. Mit wässrigen Augen und ruhigen Händen. Jetzt sind sie die Nabelschnüre zwischen uns. Nur dass man sie nicht einfach so durchtrennen kann, einfach halbieren, damit jeder seinen fairen Anteil bekommt.
»Wir müssen mit ihnen reden, Lene«, seufzt er. »Ich habe sie seit mehr als zwei Wochen nicht gesehen.«
Ich denke an ihn und Mariam in dem Lokal. An das Gefühl, allein auf der anderen Seite zu stehen. Auf eine Art einsam, die ich nicht kannte. Abgelegt wie ein altes Kleidungsstück. Ersetzt. Ich denke an die Bilder im Flur, die eingerahmten Lügen, denen Georg die Bedeutung genommen hat. Der Druck hinter meinen Augen wächst, ein dumpfer Schmerz, aber ich kann nicht weinen. Als wären meine Tränenkanäle verkrustete Dämme, die einfach nicht brechen wollen.
Und dann sage ich: »Nicht wir müssen mit ihnen reden, Georg. Du musst mit ihnen reden.« Ich sehe ihn an. »Ich finde, dieses Privileg hast du dir verdient.«
»Komm schon, Lene …«
Ich schüttle den Kopf. »Sag ihnen einfach, was du mir gesagt hast. Dass es einfach passiert ist. Ich bin mir sicher, das werden sie verstehen.«
Vier Tage später. The ugly truth
Mariam ist Yoga-Lehrerin. Nicht irgendwo angestellt, es ist ihr Studio. Ich habe es über Umwege erfahren, den Rest über Google und Instagram, diese Ausgeburt der Hölle. 1329 Posts, die Yoga-Posen zeigen. Und Super-Food-Smoothies. Und grüne Säfte. Und nachhaltige Übungsmatten. Ich sollte Mariam nicht stalken, aber ich kann nicht anders. Wie bei einem Mückenstich, den man anfängt zu kratzen, und dann ist man im Wahn.
Ich scrolle durch Mariams Profil, dann wähle ich eines der Fotos aus und sehe es in groß an. Die Bildunterschrift lautet Der Kranich. Es sieht ganz einfach aus, so als könnte das jeder. Als könnte ich es einfach nachmachen, wenn ich wollte. Ich lese die Anleitung, dann die Tipps. Fester Bauch, Hände schulterbreit aufstellen, Schultern nicht zu den Ohren ziehen, Ellenbogen leicht anwinkeln, mit den Händen aktiv vom Boden wegdrücken, Füße strecken, innere Oberschenkel anspannen – und dann fliegen. Während ich weiter nach unten scrolle – der sich verneigende Held, der Skorpion –, versuche ich, meine inneren Oberschenkel zu isolieren und bewusst anzuspannen, aber es gelingt mir nicht.
Es folgen noch mehr Verrenkungen, noch mehr Lebensweisheiten, Glückskekssprüche auf esoterischem Hintergrund. Alles in mir will kotzen bei diesem Anblick, bei dieser neuen Art des bewussten Lebens, das so komplett an mir vorbeigegangen ist – oder ich an ihm. Ich jogge. Ich tue es nicht gern und nicht mehr so oft wie früher, gerade so oft wie nötig. Eine Art Instandhaltungsprogramm, wie man ein Auto zum Service bringt. Bei Mariam ist es ein Lebensstil. Die richtige Einstellung, Selfcare. Sie hat ihre innere Mitte und meinen Mann. Ich habe nur Blutungen – und eine schriftliche Bestätigung für Georgs Nachsendeauftrag. Das Schreiben lag vorhin im Briefkasten. Jetzt kenne ich seine neue Anschrift. Und ihren Nachnamen. Brenner.
Seit ich weiß, wie sie heißt, recherchiere ich Georgs Freundin wie einen Romancharakter. Ich lerne sie kennen, lerne sie auswendig. Geboren am 11. Juni in Köln, Sternzeichen Zwilling, Gründerin von Namasté Yoga – äußerst einfallsreicher Name. Ärztlich geprüfte Yogalehrerin, FenKid®-Kursleiterin, Hatha Yoga, Jivamukti Yoga, Bikram Yoga, Yin Yoga. Mehrjährige Auslandsaufenthalte in Indien und auf Bali. Natürlich. Ich kann sie mir bildlich vorstellen in einer ihrer Verrenkungen auf einer Yogamatte am Strand. Ein gemeißelter Körper, geschlossene Augen, ein sorgloses Gesicht. Sie bietet Kurse an, bildet aus.
Mehr war über sie nicht zu finden. Den Rest dichte ich dazu. Hobbys: Zeichnen. Töpfern? Nein, eher nicht. Gärtnern? Schon eher. Sukkulenten, viele kleine Übertöpfe, Küchenkräuter, Pflanzen mit großen Blättern. Kochen. Indisch, asiatisch, Gemüse-Currys, vegetarisch – vielleicht vegan? Kokosmilch, Linsen, Kichererbsen, in die Richtung. Musikgeschmack? Schwierig … Vielleicht etwas wie »Boa Suerte« von Vanessa Da Mata und Ben Harper? Oder »Samba de benção« von Bebel Gilberto? Portugiesisch? Reggae? Klassik? Alles möglich. Lieblingsfilme? Bevorzugt französische und skandinavische Produktionen, ab und zu auch amerikanische und deutsche. Bella Marta, Gran Turino, Die Königin, auf jeden Fall Filme mit Substanz. Etwas zum Nachdenken. Das – und zum Ausgleich Sex and the City. Oder Girls. Zuletzt gelesen hat sie einen Roman von … Sally Rooney? Adeline Dieudonné? Donna Tartt? Oder von mir? Weiß sie, wer ich bin? Liest sie Krimis? Liest sie meine?
Es ist eine Berufskrankheit. Ich dichte Menschen Dinge an, Eigenschaften, Ereignisse aus ihrer Vergangenheit. Georg hat das immer gehasst. Du kannst dir so was nicht einfach ausdenken. Du musst Realität und Fiktion voneinander trennen. Er hat recht. Manchmal geht es so weit, dass ich nicht mehr weiß, was wahr ist und was erfunden. Ich bin wie ein Mädchen, das spielt. Eine Fünfjährige, die einen Kinderwagen mit Babypuppe vor sich herschiebt und in einem Miniatur-Supermarkt Miniatur-Produkte kauft. Leere Kellogg’s-Pappschachteln, die sie dann an der Kasse mit Plastikmünzen bezahlt.
Mein Blick geht zum Fenster, noch ist es hell, aber die Stadt sieht schon blau aus. Ein kühles, schönes Licht auf den Hausfassaden, wie ein Mantel, den sie übergezogen haben, um nicht zu frieren. Ich höre Anna über mir, ihre Schritte, die wie Morsezeichen zu mir ins Erdgeschoss dringen, harte Fersen, die auf harten Boden treffen. Sie hat schon wieder nicht Hallo gesagt, ist direkt in ihr Zimmer gegangen, ohne Begrüßung, ohne ein Wort. Es scheint fast so, als würden meine Tochter und ich Georgs und mein Schweigen fortsetzen wie eine alte Familientradition, die es zu erhalten gilt. Mein Blick fällt von der Zimmerdecke zurück auf Mariams Gesicht auf dem Bildschirm.
Ich sollte aufhören, diesen Blödsinn anzusehen, und anfangen zu kochen. Eine gute Mutter sein, mich kümmern, nicht nur um mich, sondern um meine Kinder. Aber ich bleibe sitzen, scrolle stur weiter – noch mehr Yoga-Posen, noch mehr Smoothies. Unter den Posts stehen Worte wie Lotuspflug, Fisch, Pfeil und Bogen, stehende Schildkröte, Yoga Nidasana. Und dann denke ich, wie unglaublich dehnbar Mariam ist, wie beweglich – wie gut im Bett. Die Wut in meinem Bauch ist ein harter Klumpen, wie ein Tumor, der so schnell wächst, dass er mich sprengen wird. Ich klicke noch mehr Bilder an, eins nach dem anderen, lese die Beschreibungen, scrolle immer weiter – so lange, bis ich einen scharfen Schmerz unter den Rippenbögen spüre wie einen alten Freund, den ich nicht wiedersehen wollte. Mariam ist mein Negativ. Georg würde sagen, mein Positiv. Jung, schwarz, trainiert, entspannt, lächelnd, gepierct, ausgeglichen, tätowiert. Ich möchte ihre Haut berühren. Wissen, ob sie sich so anfühlt, wie sie aussieht, so glatt und makellos. Und dann stelle ich mir vor, wie Georgs Hände über ihren Körper gleiten. Helle Fingerkuppen, die dunkle Konturen nachfahren, straffe Kurven, Fleisch und Haut und Muskeln, die sich unter seiner Berührung zusammenziehen, feste Brüste, ein starker Rücken, ein runder Po. Und in dem Moment verstehe ich, wie es sich anfühlen muss, ein Mann zu sein. Das Bedürfnis zu haben, in einer Frau zu versinken – in sie einzudringen, sich in ihr zu bewegen. Die Gedanken kommen plötzlich, so als hätte ich mich in der Tür geirrt. Unmittelbar danach geht die zum Wohnzimmer auf, und ich klappe den Laptop zu. Peinlich berührt, als hätte man mich bei etwas Verbotenem erwischt.
Ich schaue auf und sehe Anna, wie sie im Lichtkegel des Flurs steht und mich mustert. Georgs Augen und mein Mund. Sie ist uns wirklich gelungen, unsere Tochter. Immerhin das.
Dann sagt sie: »Ich habe Hunger.« Sie sagt es in diesem gelangweilten Teenager-Tonfall, in den sie nur verfällt, wenn sie mit mir spricht. Kurz vor unfreundlich, aber gerade noch freundlich genug, dass man es ihr nicht vorwerfen kann. Anna sieht mich an, und ich erwidere den Blick. Es ist, als wäre da etwas, das uns voneinander trennt. Etwas Unsichtbares, das turmhoch zwischen uns aus dem Boden ragt. Und während ich mir Mühe gebe, die Mauer abzutragen, legt Anna nur immer neue Steine darauf. Wie bei Tetris.
»Hast du Lust auf Pizza?«, frage ich.
Anna zuckt mit den Schultern. Nicht mal dazu sagt sie Ja.
Mit Georg ist sie anders. Das war schon immer so, schon als sie klein war. Anna hatte Blicke, die sie nur ihm schenkte und die mir – wenn ich sie aus dem Augenwinkel wahrnahm – Stiche der Eifersucht versetzten. Als müsste ich die Nummer eins meiner Tochter sein, weil ich ihre Mutter bin, und Anna demzufolge biologisch dazu verpflichtet, mich zu lieben. Und genau so fühlt es sich an. Wie eine biologische Verpflichtung, während sie es bei ihrem Vater freiwillig tut. So als hätte ich sie bereits vor ihrer Geburt enttäuscht. Als wüsste sie, was damals passiert ist. Worüber ich nachgedacht habe. Und diesen Groll trägt Anna seitdem mit sich herum. Eine Abneigung gegen mich, die mehr als ihr ganzes Leben andauert.
Ich mustere sie. Und in dem Moment denke ich, wie fremd sie mir manchmal ist, geradezu unheimlich. Verschlossen und still, doch dann laut, sobald die Tür zu ihrem Zimmer zufällt. Diesem Zimmer, das ein einziges Chaos ist. Kleidung, Schminke und Kram. Mit anderen redet sie, mit mir nicht. Vielleicht gehört das so. Vielleicht reden Teenager nur mit anderen Teenagern und nicht mit, sondern über ihre Eltern.
Eine Dreiviertelstunde später sitzen wir mit Pizzakartons vor dem Fernseher, Jonas, Anna und ich. Würde man die Situation durch eines der Fenster beobachten, könnte man meinen, wir wären eine glückliche Familie. Das Fernsehprogramm lenkt von der unangenehmen Stille ab. Der Tatsache, dass wir uns nichts erzählen. Drei Menschen in drei Welten zusammen auf einer Couch. Ich habe Georgs Familie immer verachtet – jetzt sind wir genauso.
Ich beiße von meinem Pizzastück ab, und dann denke ich, dass keine Pizza, egal wie gut sie ist, die Leere in meinem Inneren jemals füllen kann. Diese Leere, die schon so viel länger da ist, als ich mir eingestehen will. Ein Abgrund, den ich unter meiner heilen Welt begraben habe. Wenn Mariam Kinder hätte, würde sie ihnen garantiert keine Pizza bestellen. Bei ihr gäbe es ein veganes Curry mit Zutaten aus dem Biomarkt und frischen Kräutern von ihrem verdammten Balkon. Dieser Gedanke macht mich so wütend, dass ich anfange zu zittern. Ich lege das angebissene Pizzastück zurück in den Karton und schaue zu Anna und Jonas, die mich beide nicht beachten. So als hätten sie nur ihre Körper zum Essen nach unten geschickt, und ich bin eben auch da.
Zwanzig Minuten später stehen wir in der Küche. Jonas wirft die Pizza- und Tiramisu-Reste in den Müll, Anna stellt die halb leere Colaflasche in den Kühlschrank, ich räume die benutzten Dessert-Teller in den Geschirrspüler. Da fragt Anna plötzlich: »Wann kommt Papa eigentlich wieder?«
Ich schaue auf, einen der Teller noch in der Hand, und mein Magen wird seltsam leicht, so als würde ich fallen. Als hätte jemand den Boden unter mir geöffnet. Ich blicke von Anna zu Jonas und wieder zurück. Und dann höre ich mich sagen: »Gar nicht.« Und nach einer Pause: »Der ist zu seiner Freundin gezogen.«
Bei diesem Satz fällt der Ausdruck aus Annas Gesicht, so als hätte ich sie geohrfeigt. Ihre Augen sind leer, schauen durch mich hindurch, als wäre ich Fensterglas. Nicht mehr lang, und sie werden sich mit Vorwürfen füllen. Mit stummer Verachtung, vielleicht mit Tränen.
Ich bemerke die blassen Sommersprossen auf Annas Wangen und Schultern. Wir stehen uns gegenüber, dann streckt Anna die Hand aus und hält sich an der Arbeitsfläche fest, als wäre ihr schwindelig geworden. Ich greife nach ihrem Arm, will sie halten, doch Anna weicht vor mir zurück, mustert mich mit nassen Augen und einem kindlichen Blick, trotzig, als wäre sie auf einmal wieder klein.
»Ich weiß, dass das überraschend kommt«, sage ich, um einen ruhigen Tonfall bemüht. »Aber euer Vater hat sich verliebt.« Den Zusatz dieses blöde Arschloch schlucke ich hinunter. Stattdessen atme ich ein und füge mit so etwas wie einem Lächeln hinzu: »Solche Dinge passieren. Niemand kann etwas dafür.«
Als Anna den Kopf schüttelt, rollen Tränen über ihre unteren Wimpern.
»Er ist deinetwegen gegangen«, sagt sie tonlos. »Du hast ihn vertrieben mit deiner Emotionslosigkeit.«
Ich antworte nicht. Ich stehe nur da mit dem Dessertteller in der Hand, er ist hart und kalt zwischen meinen Fingern. Und plötzlich überkommt mich eine Erinnerung wie ein starker Kopfschmerz. Ich in unserer alten Wohnung im Lehel, das Telefonat mit meiner Mutter, Georgs strafendes Schweigen danach. Ich spüre dasselbe wie an jenem Abend, als hätten meine Zellen den Moment für später konserviert. Die Wut, die ich damals aus Höflichkeit unterdrückt habe, drängt wie Kohlensäure an meine Oberfläche. Ich hebe den Arm. Ich tue es nicht bewusst, denke nicht nach, führe nur aus – diese verdrängte Handlung, die über Jahre in mir feststeckte wie ein Dorn aus guter Erziehung.
Der Augenblick hat etwas entrückend Fremdes. Als wäre es nicht ich, die dort steht. Als würde ich die Situation von außen beobachten, aus sichererer Entfernung wahrnehmen, wie der Teller mit voller Wucht auf den Boden trifft, wie ein scharfer Laut die Stille zerschneidet, wie Anna zusammenzuckt, wie Porzellansplitter von den Fliesen spritzen, sie scheinen von überall zu kommen.
Dann ist da nichts mehr. Kein Laut. Nur Scherben, durchzogen von Tiramisu-Resten, aufgeweichtem Biskuit, Kaffeespritzern, Mascarpone. Und mittendrin ich, die sich fühlt, als wäre endlich etwas in ihr geplatzt. Etwas, das ich mein halbes Leben lang mit mir herumgetragen habe.
Vergangenheit. Paraderolle
»Ich denke, es wäre am besten, wenn du mit deinem Vater sprichst.«
Es klang wie ein Vorschlag, aber es war eine verkleidete Aufforderung, ein höflicher Befehl und damit die Art der Kommunikation, die meine Mutter perfektioniert hatte.
»Bist du noch dran?«, fragte sie an der Grenze zu gereizt.
»Ja«, erwiderte ich und fragte mich, wieso ich nicht auflegte.
»Ich kann ihn natürlich auch selbst anrufen, aber du weißt ja, was dann passiert.« Bewusst gesetzte Pause. »Willst du das?«
Alles, was ich wollte, war in Ruhe gelassen zu werden. Nicht das Sprachrohr sein. Die ewige Vermittlerin und damit die, die am Ende die Wut von beiden abbekam – von meinem Vater laut, von meiner Mutter schwelend. Gedankt wurde es mir nie. Dass ich mich zwischen die Fronten begab, dieses verminte Gebiet aus stiller Verachtung, das meine Eltern seit Jahren kultivierten. Ich übersetzte, vermittelte, rieb mich auf – und geriet dann ins Kreuzfeuer. Einer der beiden schickte mich vor, der andere knallte mich ab. So lief es jedes Mal.
»Wenn ich mit ihm rede, gibt es nur wieder Streit«, sprach meine Mutter weiter. »Ich versuche, es ihm zu erklären, und er versteht es nicht. Oder er versteht es falsch.«
Sie machte eine Pause, wie um mir die Möglichkeit zu geben, ihr beizupflichten. Ein Ja, ich weiß, Papa kann schwierig sein. Aber ich tat es nicht. Nicht heute. Stattdessen betrachtete ich die gerahmten Bilder, die im Flur an der Wand hingen: Georg und ich im Urlaub, bei unserer Hochzeit, er mit seinen Eltern, ich mit meinem Bruder.
Als die Stille ins Unangenehme zu kippen drohte, sagte meine Mutter: »Dann redest du mit ihm?«
Und ich erwiderte: »Ja.« Eine Antwort wie ein Kniesehnenreflex.
»Lieb von dir«, sagte meine Mutter. Dabei klang ihre Stimme rostig und alt, älter, als sie war. Als hätte sie sie im Laufe ihres Lebens verbraucht, sie aufgerieben an zu vielen Worten und Verletzungen. »Am besten wird sein, du rufst ihn gleich an«, fügte sie hinzu. »Später störst du nur beim Essen.«
Später störst du nur beim Essen.
Aus der Küche drang der Geruch von Bratkartoffeln und Zwiebeln zu mir in den Flur. Ich stand im Halbdunkel mit einem Fick dich im Hals und feuchten Handflächen. Dass meine Mutter uns beim Essen stören könnte, war ihr nicht mal in den Sinn gekommen. Ich hörte Töpfe und Pfannen klappern, der Backofen brummte. Georg würde nichts sagen, wenn ich nach dem Telefonat in die Küche zurückkäme, weder Wir wollten doch zusammen kochen noch Jedes Mal, wenn deine Mutter anruft, springst du. Er würde mich anschweigen. In stiller Wut versinken, während wir uns wortlos gegenübersaßen und jeder für sich zu Abend aß.
»Ich muss los, mein Schatz«, sagte meine Mutter dann. »Helmut hat einen Tisch für uns reserviert. Wir sind spät dran.«
»Ist gut«, sagte ich, »schönen Abend.« Aber da war die Leitung bereits tot.
Ein paar Sekunden blieb ich noch dort stehen, zwischen den Räumen, hin- und hergerissen zwischen dem Auftrag meiner Mutter, meinen Vater gleich anzurufen, und dem Zorn meines Mannes, der nebenan auf mich wartete. Als ich kurz darauf die Küche betrat, schaute Georg nicht mal auf. Als wäre ich weniger als ein Schatten.
»Tut mir leid«, sagte ich leise, aber Georg reagierte nicht. Ich wusste, dass er mich gehört hatte, dass er mich ignorierte, mich mit Nichtachtung strafte. »Meine Mutter«, versuchte ich es zu erklären, doch Georg winkte ab.
»Es interessiert mich nicht«, sagte er und holte das Salatbesteck aus einer der Schubladen.
Ich nahm es ihm nicht mal übel. Und gleichzeitig tat ich es doch. Anstatt etwas zu sagen, schluckte ich die aufsteigenden Widerworte wie Mageninhalt, der unvermittelt hochkommt.
Georg hatte keine Ahnung von meiner Familie. Er sah seine ein-, vielleicht zweimal im Jahr – ein notwendiges Übel, das man ab und zu über sich ergehen ließ. Ich machte ihm das nicht zum Vorwurf, er kannte es nicht anders – kannte weder seine Schwester noch seinen Bruder. Und am wenigsten die Eltern. Das gemeinsame Familienleben hatte einer Wohngemeinschaft geglichen, jeder ein Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche wurden notgedrungen geteilt, der Fernseher brachte sie ab und an zusammen – er und der Hunger. Und dann sind sie, einer nach dem anderen, aus dem Reihenmittelhaus ausgezogen, jeder in sein eigenes Leben. Es gab Nichten und Neffen und Scheidungen und ein paar Familienfeiern, bei denen man erschien, weil man musste. Es gab Anrufe zum Geburtstag und kitschige Postkarten aus spanischen Urlaubsorten, die Georg neben dem Papiermüll stehend überflog und sofort wegwarf. Er war kein Familienmensch, das hatte ich immer gewusst. Im Grunde galt dasselbe für mich – mit dem Unterschied, dass es bei mir war, als wäre ich an meiner psychisch erkrankt.
Georg schaute auf, braune Augen, die kühl zu fragen schienen: Was ist?, dazu ein unfreundlicher Blick, seine Lippen eine schmale, harte Linie. Ich hatte seinen Mund nie besonders gemocht. Alles andere an meinem Mann war markant und einladend. Sein Blick – zumindest meistens –, die gerade Nase, sein Kiefer, die Zahnarztzähne. Er war gut aussehend, einer, dem die Frauen nachschauten.
Georg musterte mich, und ich sah weg, suchte nach einer Möglichkeit, mich nützlich zu machen. Doch der Tisch war bereits gedeckt, der Fisch im Ofen, der Salat längst fertig. So als hätte Georg sich extra beeilt, nur um sagen zu können: Ich habe alles allein gemacht.
Als wir einander wenig später gegenübersaßen, war die Küche noch heiß vom Backfisch und die Stimmung zwischen uns kalt. Ich lächelte über Georgs Wut hinweg, teilte Essen aus, schenkte Wein ein, war freundlich für uns beide – und verachtete mich dafür.
»Wie war dein Tag?«, fragte ich.
Georg antwortete nicht, jedenfalls nicht gleich, er trank erst ein paar Schlucke Weißwein, dann erwiderte er knapp: »Anstrengend.«
»Das kann ich mir vorstellen.« Danach wartete ich auf ein Gespräch, das einfach nicht entstand. Auf ein Ende des Schweigens. Auf eine Kehrtwende zurück zu einem schönen Abend. Doch Georg dachte nicht daran. Stattdessen ließ er mein Friedensangebot ins Leere laufen und schob sich ein Stück Fisch in den Mund, das er unnötig lange kaute.
»Was ist mit dem Bechter-Fall?«, fragte ich nach einer Weile. »Hast du ihn bekommen?«
Georg schaute auf und nickte.
»Herzlichen Glückwunsch.« Ich hob mein Glas. »Du hast es verdient.«
Schleimerin, dachte ich. Aber er hat es verdient, dachte ich auch.
»Danke«, erwiderte Georg.
Danach blieb es still. Mehrere Minuten lang nur Besteck auf Geschirr und das Klingen von Weingläsern, die angehoben und wieder abgestellt wurden.
So war es oft in meiner Kindheit gewesen. Feindseliges Schweigen nach lautstarken Auseinandersetzungen meiner Eltern. Erst wurde das Essen verteilt, danach die Verletzungen, und am Ende leckte jeder seine Wunden.
Und dann dachte ich, dass ich am liebsten aufstehen würde, meinen Teller nehmen und gegen die Wand werfen. Einfach so. Um Georg unmissverständlich klarzumachen, dass mir die Situation nicht passte. Dieses ewige Bestraftwerden. Ich spürte, wie meine Beine kribbelten, als wollten sie mich dazu ermutigen, wenigstens zu gehen, wenn ich schon nicht für mich einstehen konnte. Aber ich bewegte mich nicht, blickte starr zu Georg, während ich unter der Tischplatte unablässig meine Stoffserviette knetete. Mit schwitzigen Händen und einer Wut im Bauch, die schwelend in mir hochkochte.
Ich stellte mir vor, wie ich mich langsam erhob, wie ich die Serviette neben mein Platzset legte. Wie ich nach meinem Teller griff, die Handfläche auf der Unterseite, und ihn dann mit voller Wucht gegen die Wand schleuderte. In meinem Kopf passierte alles in Zeitlupe. Ein stummer, lang gezogener Schrei, das Bersten von Porzellan. Kein Laut. Nur »If I Didn’t Care« von The Ink Spots und Bratkartoffeln, die an der Tapete klebten und langsam daran hinunterrutschten. Erbsen, die über den Boden rollten, in Dressing ertränkte Salatblätter auf den dunklen Dielen. Und dazu Georgs dummes Gesicht.
Es wäre so schön gewesen.
Aber ich warf den Teller nicht. Stattdessen aß ich schweigend auf.
Derselbe Abend. Nicht gut, und dir?
Georg lag auf dem Sofa und schaute das Heute Journal, während ich nach meinem Rucksack griff, das Licht im Flur ausschaltete und die Wohnung verließ. Ich hatte die Küche aufgeräumt, den Herd geputzt und die Flächen – doch die dicke Luft war geblieben. Eine Stimmung, so präsent wie ein eigenständiger Charakter. Georg war nach dem Essen aufgestanden und wortlos im Wohnzimmer verschwunden. Sein schmutziges Geschirr hatte er als stummen Vorwurf auf dem Tisch zurückgelassen.
Ich betrat den Gehweg, ging die Straße hinunter, begleitet von schlechter Laune und meinen Gedanken, passierte Restaurants mit Sonnenterrassen, die bis auf den letzten Stuhl besetzt waren. Gut gekleidete Menschen, die Cocktails tranken. Bier und Wein. Die laut lachten, die glücklich waren, wie gecastete Statisten für einen Film. Ferrero-Küsschen-Freunde, die sich abends noch für einen Drink verabredeten. Auf den Tischen standen Kerzen und Schalen mit Nüssen und Oliven, die Frauen trugen Sommerkleider, wallende Stoffe, kurze Röcke, viel gebräunte Haut. Neben ihnen fühlte ich mich wie ein Schandfleck in meiner ausgeleierten Trainingshose. Wie ein Kaugummi, in den man getreten war. Ich hatte so sehr versucht, in dieses Viertel zu passen, in dieses Stückchen Paris mitten in München. Aber es war mir nie gelungen.
Georg hatte die Wohnung über einen befreundeten Makler bekommen. Ich brauchte einen Neuanfang, und er verdiente genug. Also hatte ich Ja gesagt und meine Sachen gepackt. Ich dachte, wenn Kleider Leute machen, dann könnte ich sein, wer ich wollte. Mich neu erfinden – umziehen, erst die Möbel, dann mich. Als wäre es so einfach.
Ich hatte das hier gewollt, das alles: den Mann, die Wohnung, meinen Job. Eine Kleisterschicht, die man auf die Vergangenheit schmiert und mit einem neuen Leben überklebt. Was darunter verborgen war, ging keinen etwas an. Und es interessierte auch keinen. Nicht wirklich. Weder die zwei Fehlgeburten noch die Leere, die der Tod dieser unfertigen Wesen in mir hinterlassen hatte. Ich spürte das Brennen in meinen Augen, ein altvertrautes Gefühl, das mich wie ein unangenehmer Verwandter immer wieder aufsuchte. Ich schluckte trocken, kämpfte gegen die Tränen. Irgendwann war es auch mal gut, das sagten alle. Und es war ja nicht nur mir passiert, so etwas passierte jeden Tag, andauernd – wie oft, erfuhr man erst, wenn man zum Club gehörte. Es war ein volles Boot, eine Queen Mary II.
Nach der zweiten Fehlgeburt im vergangenen Jahr hatten Georg und ich aufgehört, es zu versuchen, und stattdessen mit unserem alten Leben weitergemacht. Wenn möglich, bitte wenden. Das jedenfalls war der Plan gewesen. Nur dass es aus unserer Situation kein Zurück gab. Ich blieb im Nachher gefangen wie ein Insekt auf einem Gelbsticker. Aber ich konnte nach wie vor lächeln. Und ich konnte arbeiten gehen, auch wenn ich dabei blutete. Man kann so gut wie alles blutend erledigen, das wusste ich nun. Freibekommen hatte ich nicht. Dafür war ich noch nicht weit genug gewesen.
Stattdessen wurde ich ein paar Wochen später zur Programmleitung befördert. Wie ein letzter Beweis dafür, dass ich keine Mutter war, sondern eine Karrierefrau. Bald darauf fing ich mit Pilates an. Ich praktizierte es exzessiv – jeden Tag zwei Stunden, manchmal auch drei. Ich weiß nicht, ob ich mich spüren oder bestrafen wollte. Vermutlich beides. Mein damaliger Dreiklang lautete: trainieren, arbeiten, weinen. Wenn ich nicht allein war, ging ich dafür auf die Toilette – zu Hause, im Verlag, bei Freunden, im Fitnessstudio. Ich kannte jedes Damenklo in der näheren Umgebung und fand heraus, welche zwei Wimperntuschen das Wort wasserfest wirklich verdienten. Ich wollte nicht, dass die wenigen Leute, die Bescheid wussten, sich in meiner Gegenwart unwohl fühlten – peinlich berührt vom Unvermögen meines Körpers, ein Baby herzustellen. Es war kein Thema, das sich bei gemeinsamen Abendessen anbot, eher etwas zum Ausklammern. Kinderlosigkeit, Jobverlust, Suchterkrankungen … Darüber sprach man nicht, man machte es mit sich selbst aus.
Einige der Zimmer in unserer Wohnung blieben leer, wir nutzten sie als Homeoffice oder für Sport. Ab und zu empfingen wir auch Gäste – Studienfreunde von Georg, die sich während des Oktoberfests das Hotel sparen wollten.
Der Alltag ging weiter. Ich stürzte mich in meinen Job und reduzierte meinen Körperfettanteil auf zwölf Prozent, ich hörte auf, mich zu bemitleiden, und fing an, mich mit einem Leben zu arrangieren, für das andere töten würden. Eine weitere Made im Speck, die sich über ihr Maden-Dasein in der Ersten Welt beklagte. Anderswo starben Kinder an Hunger. In mir starben sie, bevor sie geboren wurden.
Manchmal fragte ich mich, ob sie jemals wirklich da gewesen waren, diese Anfänge von zwei Leben, oder ob ich sie nur geträumt hatte: die Ultraschallbilder, die schmerzenden Brüste, das Ziehen der Mutterbänder, die Übelkeit. Und dann erinnerte ich mich, wie sie tot und fremd aus mir herauskamen, geformt wie kleine Menschen, ohne süß zu sein, mit zu großen Köpfen und perfekten Füßen. Kürettage. Kürettage klingt so viel schöner als Ausschabung. So wie der Name eines Künstlers. Ich war Teil seines Frühwerks.
Während ich weiter in Richtung Schwimmbad ging, versuchte ich, nicht an jenen Tag im Krankenhaus zurückzudenken. An die Plazenta, die sich einfach nicht von der Gebärmutterwand hatte lösen wollen, an mich, die sich gegen eine Operation wehrte, an Georg, der überfordert war von der Situation – von meinen Schmerzen, von dem Blut, so viel Blut.
Bei der Erinnerung daran drehte sich plötzlich alles. Ein verschmiertes Bild aus Straße, Gehsteig und Bäumen. Ich streckte die Hand aus, suchte Halt und fand ihn an einem Baumstamm, spürte seine raue Rinde unter meinen Fingern, trocken und schuppig. Ich atmete lange ein und noch länger aus. Irgendwann ließ die Übelkeit nach – so unvermittelt, wie sie gekommen war. Ich schaute hoch, leicht benommen und zittrig. Erst da bemerkte ich das Pub neben mir. Den Geruch von Frittiertem und die Blicke der Gäste, die auf mich gerichtet waren, als wäre ich das Unterhaltungsprogramm.
Ich wandte mich ab, suchte Schutz im Eingang des Nachbarhauses. Dort blieb ich stehen, riss mit zitternden Fingern das Zellophan der Gauloises-Schachtel auf und nahm eine Zigarette heraus. Der Geruch erinnerte mich an Paris. Tabak und Filter. Zu der Zeit hatte ich mehr gelebt als jetzt.
Ich zündete die Zigarette an. Es war ein trotziges Ich bin nicht schwanger, und deswegen darf ich das. Weil es niemanden kümmert, wenn man nur sich umbringt, solange man keinen Fötus mit ins Verderben stürzt.
Ich lehnte an der Fassade und rauchte, spürte die Hauswand porös im Rücken. Mein Brustkorb zog sich zusammen, aber ich weinte nicht, ich stand einfach nur da, ganz dünn in der Dunkelheit. Mit geschlossenen Augen und kalten Füßen.
Dann sagte jemand meinen Namen.
»Helene.«
Seine Stimme war wie aus einem anderen Leben.
Ich schlug die Augen auf, und da stand er: Alex. Er sah mich an mit diesem Blick von früher. Sein Haar war kürzer, ein Bartschatten auf den Wangen, Bluejeans, schwarze Schuhe, hellblaues Hemd. Die Vergangenheit holte mich ein, als wäre ich in vollem Lauf mit ihr zusammengeprallt.
Man sah Alex die Jahre nicht an. Und falls doch, hatten sie ihn nur reifer gemacht. Ihm mehr Charakter verliehen. Er stand mir gegenüber und musterte mich, seine Augen wanderten an mir hinab, von meinen ungewaschenen Haaren über mein fahles Gesicht zu meiner Jogginghose. Nichts, was er nicht schon gesehen hatte. Er kannte die ungeschminkte Wahrheit, er kannte mich nackt und müde. Aber das war damals gewesen. Und jetzt war er wieder da, als hätte ich eine Schublade geöffnet und ihn zufällig darin gefunden.
Das zwischen Alex und mir war von Anfang an kompliziert gewesen. Keine Liebesgeschichte, jedenfalls keine, die sich selbst erzählte, eher eine von denen, die gegen ihren Willen geschah. Wir hatten während des Studiums in Paris zusammengewohnt, Christina, Alex und ich. Anfangs waren es nur Christina und ich gewesen, in einer Dreieinhalbzimmerwohnung im elften Arrondissement, nahe der Metrostation Oberkampf, mit Wohnküche und einem Balkon, auf dem nur ein Bierkasten Platz fand. Christina kam ursprünglich aus einem Kaff in der Nähe von Des Moines in Iowa. Sie kannte Paris aus den Arthouse-Filmen am College und entschied sich nach ihrem Abschluss, an der Sorbonne zu studieren. Christina war angenehm laut, amerikanisch, aufzufallen gehörte zu ihrem Wesen. Wir gingen gemeinsam aus, wir tranken zu viel, wir unterhielten uns über Gott und die Welt. Drei Semester lang gab es nur uns beide – und das halbe Zimmer, das hauptsächlich dem Trocknen von Wäsche diente. Manchmal schliefen auch betrunkene Kommilitonen auf dünnen Matratzen oder Freunde, die übers Wochenende zu Besuch kamen. Irgendwann hatte Christina die Idee, das halbe Zimmer zu vermieten. An einen Typen aus ihrem Seminar, der auf der Suche nach einer WG war und verzweifelt genug, ein Drittel der Miete zu übernehmen.
Ein paar Tage später war Alex eingezogen – mit nichts weiter als einer großen Topfpflanze und einem Koffer. Ein uraltes Ding mit nur drei Rollen. Es war ein Samstag gewesen, später Nachmittag, Hochsommer, das wusste ich noch. Und auch, dass er in derselben Nacht das erste Mädchen mit nach Hause brachte. Alex und ich teilten uns eine Wand, so dünn wie Papier. Ich konnte jeden Laut aus seinem Zimmer hören. Vor Christina tat ich gern so, als würde mich diese Tatsache nerven, doch in Wahrheit mochte ich diesen akustischen Einblick in seine Privatsphäre. Ein Hörspiel mit nur einer Zuhörerin.
Erst sehr viel später hatte Alex mir erzählt, dass er sich an jede Einzelheit unserer ersten Begegnung erinnerte. An mich, ungeschminkt, in meinem weißen ärmellosen T-Shirt ohne BH darunter, meine kurzen dunklen Haare, die aussahen, als hätte jemand darin gewühlt, Bluejeans, barfuß. Er hatte damals gesagt, dass mein Anblick etwas mit ihm gemacht hatte. Diese fast schwarzen Augen, dein kleiner Mund, der Ausdruck in deinem Gesicht. Alex hatte mir gestanden, dass er seit diesem Tag den Drang hatte unterdrücken müssen, mich anzufassen – meine Haut, meine Brüste –, dass er versucht hatte, sich von mir fernzuhalten, was ihm jedoch auf lange Sicht nicht geglückt war. Als wäre ein Gummiband zwischen uns gespannt gewesen, das ihn ab einer gewissen Entfernung unweigerlich zu mir hatte zurückschnellen lassen.