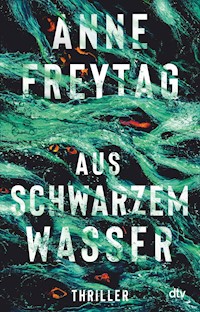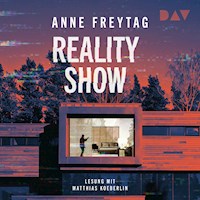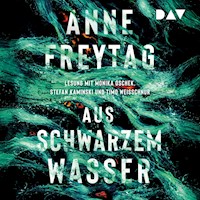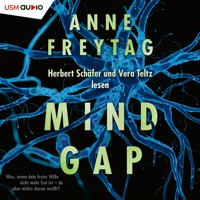
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: USM Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Welt, wie wir sie kennen, hört auf zu existieren »Wir stehen an der Schwelle zu einer technischen Revolution, die unser Denken und Handeln für immer verändern wird.« Das verspricht Erik Grote bei der Vorstellung des NINK. Ursprünglich in der Militärforschung entwickelt, sollte der NINK-Chip ein Auslöschen traumatischer Kampferinnerungen ermöglichen. Die Journalistin Silvie wird Opfer dieser Realitätsveränderungen, als es heißt, ihr Bruder habe zwei Menschen ermordet und sich danach in den Kopf geschossen. Nichts von all dem ergibt einen Sinn. Also beginnt Silvie zu recherchieren und schnell wird klar, dass jeder noch so bahnbrechende Fortschritt in den falschen Händen aufs Schrecklichste pervertiert werden kann …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Freytag
Mind Gap
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für die Menschen, die verstehen, dass (vielleicht immer) nur ein Teil der Geschichte Fiktion ist.
(Und auch ein bisschen für Matt Damon. Und für Heike Makatsch.)
Und noch mehr für Rita, Kira, Adriana & Eva.
»If a thing is free to be good it is also free to be bad. And free will is what has made evil possible. [… F]ree will, though it makes evil possible, is also the only thing that makes possible any love or goodness or joy worth having.«
C.S.Lewis
Jetzt
Sie schlagen die Tür ein. Lang wird es nicht mehr dauern – ein paar Minuten vielleicht.
Ich warte darauf, es zu begreifen. Aber da ist nichts. Nur Angst. Und das Gefühl, dass ich mich jeden Augenblick übergeben muss. Es gab keinen PlanB. Oder anders ausgedrückt: Mein gesamtes Leben war ein PlanB. Eine Reihe von Entscheidungen, von denen ich mir sicher war, sie freiwillig zu treffen. Ich denke an die unzähligen Gefahrensituationen, in die ich mich im Laufe der Jahre gebracht habe. Kriegsgebiete, Extremsport. Doch es war nie echt. Immer nur kalkuliertes Risiko. Ein Muskelspiel, als hätte ich damit sagen wollen: Siehst du, Tod, ich lache dir ins Gesicht. Die Wahrheit ist, dass ich das Adrenalin gebraucht habe, um mich lebendig zu fühlen. Eine Illusion von Kontrolle.
Gestern um diese Zeit, dachte ich, ich hätte nichts zu verlieren. Dass ich bereits alles verloren hatte. Und irgendwie habe ich geglaubt, das wäre Freiheit.
Dann kam sein Anruf.
Von allen Wendungen, die mein Leben hätte nehmen können, hätte ich mit dieser am wenigsten gerechnet. Mit seiner Stimme. Mit der Vertrautheit, die darin lag.
Es war ein Fehler, sich mit ihnen anzulegen, wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Andererseits: Was wäre die Alternative gewesen? Nichts tun? Sich ducken? Darauf hoffen, dass sie uns nicht kriegen?
Die Schläge gegen die Tür werden lauter. Kein Takt, nicht gleichmäßig, nur ein hartes Geräusch, Metall auf Metall. Ich höre, wie es sich verformt, wie es droht nachzugeben. Dann ein kreischender Laut – eine Säge.
Sie werden es in die Wohnung schaffen, daran besteht kein Zweifel. Sie werden reinkommen, und sie werden mich töten. Ich spüre meinen Puls überall. Ihn und die Härchen, die sich wie in Zeitlupe aufrichten. An meinen Armen, im Nacken. Mein Hals wird enger und enger, als würde jemand langsam zudrücken. Eiskalte Hände, verschwitzte Handflächen.
Ich zittere unkontrolliert, während ich auf die schmale Balkonmauer steige. Wind gemischt mit Regen trifft auf mein Gesicht wie der feuchte Sprühnebel im Supermarkt, der das Obst und Gemüse frisch hält. Mein Blick geht in die Tiefe. Ich kann das Kopfsteinpflaster nicht sehen, aber ich weiß, dass es da ist. Genauso wie die quadratischen Bodenplatten des Gehwegs, in deren riesigen Pfützen sich rot der Schriftzug des gegenüberliegenden Lokals spiegelt.
»Wie ein Bungeesprung«, sage ich leise.
Meine Zehenspitzen tasten sich vor, sie ragen ins Nichts, das unter mir wartet. Weiche Gelenke, ein trockener Mund. Ich weiß, wie es sich anfühlt, ins Bodenlose zu stürzen. Ich habe es oft genug getan. Von Brücken. Aus Flugzeugen. Aufmüpfige Mutproben, die nichts mit dem hier gemeinsam haben. Ich strecke die Arme seitlich aus, um die Balance nicht zu verlieren – obwohl es egal wäre. Fallen oder springen, was macht es für einen Unterschied.
Ich dachte, ich hänge nicht am Leben. Nicht nach allem, was es mir genommen hat. Doch in dieser Sekunde auf der nassen Balkonmauer weiß ich, dass ich falschlag.
Das Kreischen der Säge wird lauter, kommt näher.
Ich will nicht sterben, denke ich und blicke in die Tiefe, versuche, es mir vorzustellen. Wie ich springe. Wie ich aufkomme. Kein Seil, kein Fallschirm, keine Karabiner, die mich halten. Nur Panik und die Luft und das Gefühl des Bedauerns, das mir kurz vor Schluss klarmacht, dass ich sehr wohl noch leben wollte. Ein letzter Schrei, der in meiner Lunge steckt, Tränen, die vom Regen verschluckt werden.
In exakt dem Moment bricht die Tür.
Sie kommen.
Knapp 15 Stunden vorher. 19:26 Uhr – Berlin Silvie Mankowitz
Ich sehe ihn an, wie er dasteht in seinem Smoking und der Fliege und versuche, nicht auf ihn hinabzuschauen. So viel Ego in nur einem Mann. Er nickt und lacht, die Traube um ihn herum stimmt ein. Matthieu kann mit Menschen, konnte er immer, sie hängen an seinen Lippen, wenn er spricht. Er ist es gewöhnt, einer der Stars des Abends zu sein. Bester Regisseur, bestes Drehbuch. Einer von den ganz Großen.
Irgendwie ist er alt geworden. Aber bei einem Mann ist das nicht tragisch. Erst recht nicht, wenn er auf eine verbrauchte Art gut aussieht. Unordentliches Haar, Geheimratsecken, Lachfältchen um die Augen, blasse Haut, die obligatorische Zigarette in der Hand. Matthieu hat sich schon immer in der Rolle des Künstlers gefallen. Vielfach ausgezeichnet, für Preise nominiert … Normalerweise trägt er ausgewaschene Anzughosen und dazu T-Shirts mit ausgeleiertem Halsausschnitt. Bei einer Frau ist so etwas ungepflegt, bei einem Mann jung geblieben.
Für Anlässe wie heute macht er sich zurecht. Für seinen Schritt aus dem Schatten ins Rampenlicht. Schwarzer Anzug, Fliege, die Nägel geschnitten, der Bart gestutzt. Matthieu liebt das Bad in der Menge, es können gar nicht genug Komplimente sein, die er scheinbar bescheiden abtut. Alle Augen auf ihn gerichtet – mit mir als Anhängsel in seiner Armbeuge, wie ein drittes Standbein, das ihm Halt gibt. Er sagt dann Dinge wie Hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau – Sätze, die gut klingen und noch besser ankommen. So uneitel, so bodenständig. So gelogen.
Ich stehe auf dem roten Teppich und fühle mich verkleidet. Ein pastellgelbes Accessoire neben einem Mann von Welt, der so tut, als hätte er sich mal eben etwas dem Anlass Angemessenes übergeworfen, während er in Wahrheit den halben Nachmittag lang verzweifelt ein Hemd nach dem anderen aus dem Schrank gerissen und dann wütend aufs Bett geworfen hat. Wie ein trotziger Junge, der nicht bekommt, was er will. Ich war auch diesmal früher fertig als er – und das, obwohl ich mich zusätzlich schminken, mir die Nägel lackieren und die Haare machen musste.
Andererseits bin ich nicht mehr als ein Papierschild auf einem Stuhl in der ersten Reihe. Ein paar Hände, die meinem begnadeten Freund Beifall klatschen. Während die Blicke der anderen mich nur streifen, muss Matthieu ihnen standhalten, ich bin bloß eine Begleiterscheinung.
Um fair zu sein: Er hat meinetwegen lange zurückgesteckt. Vor allem, als bei mir der Hirntumor diagnostiziert wurde. Matthieu ist bei mir geblieben, als ich im Krankenhaus war. Er hat mich und meine Launen stoisch ertragen. Meine Ängste, meine Wutausbrüche. Uralte Erinnerungen, die plötzlich wieder da waren, hochgekocht aus einem Teil in meinem Inneren, der bis dahin fest verschlossen war. Matthieu hätte jederzeit gehen können. Aber das ist er nicht. Er saß neben meinem Bett, als ich im Koma lag, er hat meine Hand gehalten. Jeden Tag, wochenlang. Die Pflegerinnen haben mir im Nachhinein erzählt, dass er mir nicht von der Seite gewichen ist. Dass er mit mir gesprochen hat, mein Gesicht geküsst, meine Hände eingecremt, mein Haar gebürstet. Er hat mich nie allein gelassen. Auch nicht, als ich ein Jahr später erfahren habe, dass mein Bruder bei einem Auslandseinsatz getötet wurde. Matthieu hat sich mit mir um Samuels Beerdigung gekümmert. Mich im Arm gehalten. Für mich gesorgt. Eingekauft, gekocht.
Er hat mich nicht mal verlassen, als ich seinen Heiratsantrag abgelehnt habe. Zwei Mal. Der Juwelier hat den Ring zurückgenommen und wir nie wieder darüber gesprochen.
Matthieu kennt mich – meine Neurosen, den Stellenwert meines Jobs, mein Problem mit Nähe. Und ich kenne ihn – sein beinahe krankhaftes Geltungsbedürfnis, seine Komplexe, seinen Narzissmus, seine Angst, allein zu sterben. Er akzeptiert meine Distanziertheit und ich seinen Trophäenschrank aus Palisander, den er extra für seine Preise hat anfertigen lassen – ein Schrein, mit dem er sich selbst verehrt.
Manchmal, wenn Matthieu denkt, dass ich es nicht mitbekomme, holt er seine Trophäen heraus und sieht sie an, so wie er früher mal mich angesehen hat. Und das ist okay. Ihm geht einer ab beim Anblick seiner Auszeichnungen und mir mit meinem Ultraschall-Vibrator, den Matthieu fälschlicherweise für ein Porenreinigungsgerät hält. Im Grunde sind wir ein ganz normales Paar. Mehr Alltag und weniger Romantik, eine gesunde Portion Realismus in all den zu hohen Erwartungen.
»Wir sollten reingehen, die Veranstaltung fängt bald an«, flüstert Matthieus Agentin und entschärft ihren eindringlichen Tonfall mit einem Lächeln. »Backstage wartet eine Kleinigkeit zu essen auf dich und das extra stille Mineralwasser, das du magst.« Pause. Blick zu mir. »Silvie, ich bringe dich zu deinem Platz.«
Matthieu wendet sich noch einmal großzügig den Fotografen zu, er lächelt, winkt, ich halte mich im Hintergrund, dann dirigiert er mich zum Eingang. Die Traube, die vorhin um ihn stand, folgt uns wie eine kleine Herde, drinnen trennen sich unsere Wege – die Stars gehen hinter die Bühne, das Fußvolk schiebt sich wie ein zäher Brei in Richtung Saal.
Auf dem Platz mit der Nummer zwölf liegt ein Kärtchen, auf dem in goldenen Lettern Silvie Durand steht. Durand, nicht Mankowitz. Manchmal frage ich mich, ob Matthieu es extra falsch angibt, um so den Fragen nach unserem Familienstand zu entgehen. Dem immer wiederkehrenden Mysterium, warum wir nicht verheiratet sind. Von den fehlenden Kindern ganz zu schweigen.
Ich nehme das Platzkärtchen und lasse es unauffällig zwischen die beiden samtbezogenen Sessel fallen, danach schalte ich mein privates Handy auf Flugmodus und setze mich. Der Raum ist vorfreudig aufgeladen, der Stoff meines Kleids elektrisch.
Im nächsten Moment kündigt ein sanfter Gong den Beginn des Filmfests an.
Drei Stunden, dann habe ich es hinter mir – das Lächeln, das Nicken, die Begeisterung, die indiskreten Fragen, die unbequemen Schuhe, die Glückwünsche zu meinem genialen Mann. Was sind schon drei Stunden im Vergleich zu einem Leben.
Das Licht wird gedimmt, die Gespräche versiegen. Stille fällt so plötzlich über den Raum, als hätte man ein Feuer unter einer Decke erstickt. Das Publikum beginnt wie abgerichtet zu klatschen. Frenetischer Applaus. Die Scheinwerfer gehen an, der Fußboden vibriert, die Sitzreihen, die Armlehnen – meine übereinandergeschlagenen Beine.
Ich schaue in meinen Schoß, auf die kleine Handtasche durch deren pastellgelben Stoff ein grelles Display leuchtet.
Es ist das Handy, das ich nie ausschalte.
Die Nummer, die ich nur meinen Quellen gebe.
Kurz spiele ich mit dem Gedanken, den Saal zu verlassen, doch es ist zu spät: Die Moderatoren eröffnen den Abend.
Ich spüre den missbilligenden Blick meiner Sitznachbarin, als ich das Handy aus meiner Tasche hole, dann wende ich mich von ihr ab und beantworte den Anruf.
»Hallo?«
»Silvie?« Pause. »Silvie, bist du das?«
Mir bricht der Schweiß aus, mein Gesicht ist wie eingefroren, das Blut sackt mir in die Beine.
»Kannst du mich hören?«
Unmöglich.
Mein Bruder ist tot.
»Ich bin da in was reingeraten, Silvie«, sagt er in einem harten Flüstern.
Alles in mir verkrampft sich, ich versuche zu atmen, doch ich bekomme kaum Luft. Das Kleid ist auf einmal schrecklich eng, so eng, dass ich aufstehen und es mir vom Leib reißen möchte. Aber ich kann mich nicht bewegen. Ich sitze nur da und starre auf den roten Teppich vor mir.
»Die sind an mir dran«, sagt Samuel atemlos. »Wenn sie mich kriegen, töten sie mich.«
Zur selben Zeit – woanders
»Sie wissen, dass Sie über alles mit mir sprechen können.«
Er nickt.
»Wenn das stimmt, wieso fällt es Ihnen dann so schwer, sich mir zu öffnen?«
Er lacht humorlos auf. »Meine Vorgesetzten halten mich für geisteskrank«, sagt er ruhig, »und schätzungsweise gilt dasselbe für Sie. Da ist man nicht so redselig.«
»Ich bin kein Freund von solchen Begrifflichkeiten«, wendet sie ein. »Und noch weniger von derartigen Klassifizierungen.«
»Dann halten Sie mich nicht für geisteskrank?«
»Nein«, erwidert sie knapp.
»Sie würden es mir wohl kaum sagen, wenn es anders wäre«, antwortet er. »Immerhin soll ich Ihnen vertrauen. Richtig?«
»Sie haben viel durchgemacht«, weicht sie seiner Frage aus und beugt sich in seine Richtung – ein körperliches Signal, das Intimität vermitteln soll. »Ich will Ihnen helfen«, fährt sie fort. »Ich bin auf Ihrer Seite.« Während sie das sagt, sieht sie ihn eindringlich an. »Sie können mit mir sprechen, Marc.«
Marc. Jetzt sind sie schon beim Vornamen angekommen. Die ganz schweren Geschütze.
Dr. Wieland greift nach ihrem Clipboard und einem Kugelschreiber, auf dem Egmont Hotel steht, dann lehnt sie sich in ihrem Sessel zurück und lächelt verbindlich. »Erzählen Sie mir alles. Von Anfang an.«
Bei dieser Formulierung schießt ihm ein Artikel durch den Kopf, den er vorhin im Wartebereich angefangen hat zu lesen. Eine Reportage über den Geburtsvorgang. Darin stand, dass jede Geburt ein blutiges und chaotisches Ereignis ist, ganz gleich, wie kultiviert die werdenden Mütter auch sein mögen. Dass jeder von ihnen unter denselben Schmerzensschreien zur Welt kommt. Ein demokratischer Akt: fluchende Frauen, machtlose Männer, blutverschmierte Babys.
Aber das ist nicht, was Wieland meint, wenn sie sagt von Anfang an. Sie meint den NIP und Marcs Zeit bei der Esec. Sie will nicht wissen, wo er herkommt oder wie er aufgewachsen ist. Es interessiert sie nicht, wie oft sein Vater ihn geschlagen hat oder dass es ihm schwerfällt, Beziehungen einzugehen. Für Dr. Carolin Wieland ist er nichts weiter als ein Träger, der außer Kontrolle geraten ist – ein Fehler im Gesamtbild, den es zu korrigieren gilt.
Wenn die wüssten, was er weiß, wäre er längst tot.
»Sie driften wieder ab, Marc«, sagt Wieland, und er sieht sie an. »Ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie mit mir reden.«
Er antwortet nicht.
»Nichts von dem, was Sie mir in unseren Gesprächen anvertrauen, wird je diesen Raum verlassen.« Ernster Blick. »Sie sind hier sicher.«
Es klingt aufrichtig. Vermutlich empfindet er das so, weil ein Teil von ihm ihr glauben will – ihr und dem System, das im Begriff ist, ihn loszuwerden.
Während Wieland ihn weiter prüfend ansieht, fragt er sich, wie er hierhergekommen ist: in diese psychiatrische Einrichtung unter ständiger Beobachtung. Aus dem Jetzt betrachtet – in zivil auf einem harten Stuhl mit niedriger Rückenlehne und einer diagnostizierten Psychose –, weiß er, dass es ein Fehler war. Das alles.
Es wäre zu einfach, seinem Vater die Schuld zu geben. Auch wenn er ein selbstgerechtes Arschloch war – ein Perfektionist, der Erziehung als etwas Handfestes verstand. Wo es weniger Worte gibt, gibt es auch weniger Missverständnisse. Ein Mann besticht durch Taten, hat er immer gesagt. Wo Frauen nur reden, haben Männer zu handeln. Ein paar Ohrfeigen sind hilfreich, um jemanden auf Kurs zu halten. Manchmal auch eine Faust. Am besten in die Rippen, da sieht man die Blutergüsse nicht. Natürlich hat er das alles nur getan, um ihn abzuhärten. Es geschah in seinem eigenen Interesse.
Marc hätte alles getan, um ihm zu gefallen. Er hat trainiert, hat Medaillen gewonnen in Boxkämpfen und Triathlons. Er hat als Drittbester seines Jahrgangs abgeschlossen – woraufhin sein Vater lapidar meinte, dass man sich niemals mit einem drittklassigen Ergebnis zufriedengeben sollte.
Wenn Marc an sein Ich aus jener Zeit zurückdenkt, sieht er einen Kerl, den er hasst. Einen Schwächling, der an seiner Fassade arbeitet, damit niemand merkt, wie bedürftig er ist. Jemanden, der sich für die Liebe und Anerkennung seines Vaters verraten hat.
Nach seinem Abschluss in Sportwissenschaften und Politik entschied er sich fürs Militär – dieselbe Rolle wie vorher, nur ein anderer Vorgesetzter. Marc mochte die Idee von Kodex und Werten. Diese Eindeutigkeit, die allem zugrunde liegt. Nichts hinterfragen, nur ausführen, was andere ihm befehlen. Wie das geht, wusste er. Aus heutiger Sicht ein weiterer Beweis dafür, dass er keine Ahnung hatte, wer er ist. Und noch weniger, wer er mal sein will.
Marc war Anfang dreißig, als er sich bei der Esec bewarb. Ein hochdekorierter und erfahrener Soldat – trainiert, indoktriniert, gehorsam – und damit perfekt für den Job. Er gehörte zu den ersten Esec-Agenten. Eine streng geheime Spezialeinheit des europäischen Militärs, eine Schnittstelle zwischen den Streitkräften und Interpol. Es war ein Pilotprojekt, das zu Beginn ohne Kenntnis oder Zustimmung der europäischen Bevölkerung durchgeführt wurde – und nach wie vor Bestand hat. Genauso heimlich wie damals.
Die Esec hat sie ausgebildet, um zu töten, zu verhören und zu kämpfen. Unsichtbare Killer, denen man alles beibringen und die man überall einsetzen kann. Damals dachte Marc, er würde das Richtige tun. Aber vermutlich ist das immer so, wenn man einer Elite angehört, wenn man einer der Besten ist. Er wurde süchtig nach diesem Gefühl. Nach der Anerkennung, nach diesem ganz bestimmten Nicken seines Kommandeurs und dessen Hand auf seiner Schulter. Gut gemacht, mein Sohn. Marc weiß, was das über ihn aussagt. Doch das ändert nichts daran, dass es sich damals gut angefühlt hat, endlich jemand zu sein. Einer, zu dem andere aufschauen. Einer, der den Neuankömmlingen zeigt, wie es geht, gewissenlos und effizient. Von dem Kerl von früher ist nichts übrig geblieben. Von dem danach auch nicht.
»Die Sitzung ist zu Ende«, sagt Dr. Wieland mit einem Blick auf die Uhr. »Ein Pfleger bringt Sie zurück in Ihre Unterkunft.«
Marc erhebt sich und geht zur Tür. Ein mechanisches Summen, dann wird sie von außen geöffnet. Davor wartet ein Mann mit Mund-Nasen-Schutz. Sie gehen den Korridor hinunter, ein namenloser Pfleger und er.
Marc würde gern behaupten, dass er sich bei der Esec neu erfunden hat. Doch die Wahrheit ist, dass die ihn neu erfunden haben. Die haben ihn gemacht. Zu einer Maschine aus Fleisch und Blut, die Blut vergießt, ohne es zu hinterfragen. Und genau das hat er getan: Leichenberge angehäuft und danach abends mit Kameraden Bier getrunken. Mit Männern, die waren wie Brüder – insbesondere Samuel. Marc und er haben sich jeden Tag ein Lebenszeichen geschickt – sechs Jahre lang. Ohne Ausnahme. Egal, wo sie eingesetzt waren, egal, wie der Auftrag lautete.
Samuels letzte Nachricht kam vorgestern. Da war er bereits draußen.
Seither hat Marc nichts von ihm gehört.
19:44 Uhr – Berlin Silvie Mankowitz
Ich sitze in einem Taxi in Richtung Treffpunkt. Mein Kopf ist wie in Watte, es fällt mir schwer zu atmen. Als würde mich jemand in der Wahrheit ertränken. Ich bin da in was reingeraten, höre ich Samuel wieder und wieder sagen. Seine Stimme wie ein Wurm in meinem Kopf. Ich habe nicht gefragt, in was. Ich habe so gut wie gar nichts gesagt. Ein paar Satzbrocken. Wann? – Ja, kenne ich. – Ich komme dorthin. Der Rest steckt mir noch immer im Hals. Wer ist hinter dir her? Was wollen die? Ich habe dich vor zwei Jahren beerdigt. Sie haben gesagt, du bist tot.
Ich denke an den Tag zurück. Er war wie aus dem Bilderbuch: blauer Himmel, raschelnde Blätter, trockene Wärme, eingelullt von jenem trägen Gefühl der Faulheit heißer Spätsommernachmittage. Als es geklingelt hat, saß ich auf der Terrasse und habe gelesen. Ich weiß noch, dass ich nicht aufstehen wollte, aber Matthieu lag schlafend neben mir, also bin ich zur Tür gegangen. Barfuß. Der Dielenboden war angenehm kühl. Und da waren sie, zwei Männer in Uniform mit ernsten Mienen und straffen Schultern. Ihre Gesichter trugen die Art von gefasster Trauer, wie man sie Soldaten beibringt. Männlich und aufrichtig. Ich weiß noch, dass ich sie hereingebeten habe und dass sie dann sagten, ich solle mich setzen. Ich bin ihrer Aufforderung gefolgt. Sie sind stehen geblieben. Es war klar, was gleich kommen würde, trotzdem habe ich bis zuletzt auf eine andere Erklärung für ihr Erscheinen gehofft.
Es war schließlich der Soldat mit den freundlicheren Augen, der es ausgesprochen hat: Ihr Bruder wurde bei einem Einsatz getötet. Die Samtpolsterung war unpassend weich unter meinen Handflächen. Ein Satz wie ein Schlag in die Eingeweide, so schmerzhaft, dass man keine Luft mehr bekommt, und dazu der viel zu sanfte Stoff des Sessels.
Ich musste ein paar Dokumente unterschreiben, dann haben sie mir die Urne ausgehändigt. Unser aufrichtiges Beileid, sagten die beiden Männer vollkommen synchron. Danach sind sie gegangen. Matthieu hat von alldem nichts mitbekommen. Als er knapp eine Stunde später aufwachte, saß ich noch immer in dem Sessel, die Urne auf dem Schoß. Ich sah aus wie vorher, aber ich war nicht mehr derselbe Mensch.
Vielleicht hätte es mich damals stutzig machen sollen, dass sie ihn eingeäschert haben. Dass es keinen Körper gab, den ich hätte identifizieren können. Gefallene Soldaten werden bei uns grundsätzlich vor Ort verbrannt. Zur Seuchenvermeidung. Und um zu verhindern, dass ihre Leichen entwendet werden – ein Standardprozedere. Abgesehen davon, sind sie so leichter zu transportieren.
Ich habe es nicht hinterfragt. Stattdessen habe ich mich um eine Urnenbestattung gekümmert. Um Einladungen, um eine Traueranzeige, um das Blumenarrangement. Während der Trauerfeier hat es genieselt. Es war ein Tag wie aus Grautönen gemacht. Dunkel gekleidete Gestalten, bleiche Gesichter, schneeweiße Taschentücher.
Ich wische mir die Tränen von den Wangen und blicke aus dem Seitenfenster des Taxis. Alles, was ich damals wollte, war, noch einmal sein Gesicht sehen. Weil ich mich im Laufe der Zeit nicht mehr im Detail daran erinnern konnte. Irgendwann habe ich Fotos gebraucht als Gedächtnisstütze. Ich wusste nicht, dass man ein Gesicht vergessen kann. Sogar das des Menschen, den man am meisten liebt.
Seit seiner Bestattung war ich jede Woche an Samuels Grab. Ich habe ihm frische Blumen gebracht – Blumen, die kurz zuvor abgeschnitten wurden, um vor einer Wand aus weißem Marmor zu verrotten. Meistens saß ich auf einer der Bänke, den Blick auf die glatte Steinplatte gerichtet, als würde ich darauf warten, dass Samuel sie eines Tages von innen aufschiebt.
»Da wären wir«, sagt der Taxifahrer und schaltet das Innenlicht ein.
Ich schaue in seine Richtung. Neben der Wagennummer am Armaturenbrett steht in schwarzer Handschrift Isan.
»Sie zahlen per NINK?«
»Nein«, sage ich. »Apple Pay.«
Isan zieht kaum merklich die Brauen hoch, als wäre Apple Pay eine Sache des letzten Jahrhunderts, dann tippt er den Fahrpreis in ein kleines Gerät und reicht es mir.Ich halte meine Uhr an die Schnittstelle, das leise Ping bestätigt die Zahlung.
Ich gebe ihm das Gerät zurück. »Danke«, sage ich, danach öffne ich die Tür und steige aus.
Noch vierzehn Minuten.
Ich muss noch was erledigen. In einer halben Stunde bin ich da.
Wohin wollte Samuel? Was hatte er vor? Ich versuche, mich an den genauen Inhalt des Gesprächs zu erinnern, aber es sind nur Fetzen übrig. Das vibrierende Handy, Samuels Stimme – eine Stimme, von der ich sicher war, sie nie wieder zu hören. Danach bloß noch Bruchstücke. Ein Blackout. Einer der Moderatoren, der einen Witz macht, Lacher im Publikum. Ich in der ersten Reihe, die versucht zu begreifen, was gerade passiert. Erinnerungen, die in mir aufsteigen und platzen, Schmerz, der so unvermittelt zurückkommt, als hätte man einen Schalter umgelegt.
Ich habe das Auditorium überstürzt verlassen – nicht geduckt und rücksichtsvoll, wie man es sonst tun würde. Das Echo meiner Absätze hallte durchs Foyer. Harte, kurze Laute auf Fliesenboden. Samuel hat währenddessen weitergesprochen, schnell und leise, als hätte er sich irgendwo versteckt.
Noch fünf Minuten.
Was hat er herausgefunden? Und wer ist hinter ihm her?
Die Esec? Wollen die ihn töten?
Wenn es so ist, hat Samuel keine Chance.
03:25 Uhr (Berlin +7h) – Manila Mayari Morales
Irgendwas stimmt nicht.
Mayari legt ihren Zeigefinger auf den Scanner und lädt die Seite neu. Es sollten Videos und Bilder sein, Social-Media-Posts, Hass und Hetze – Content, vor dem die weltweite Community geschützt werden muss. Stattdessen sind es E-Mails und Akten, Tonaufnahmen, Mitschnitte von Telefonaten, haufenweise Daten von irgendwelchen NINKs.
Mayari legt ein weiteres Mal den Zeigefinger auf den Scanner. Sie sollte sich nicht erinnern. Weder an die Namen noch an die Inhalte, die sie eben gelöscht hat. Aber sie erinnert sich an alles.
Erst dachte sie, es läge an der Müdigkeit – Mayari konnte tagsüber kaum schlafen, was die ohnehin schon harte Nachtschicht nicht leichter macht. Aber es liegt nicht an der Müdigkeit – Mayari ist oft müde bei der Arbeit. Es ist etwas anderes.
Irgendwas stimmt nicht.
Die ersten Aussetzer hatte ihr NINK bereits gestern. Mayari war sich sicher, es hätte etwas mit dem Softwareupdate zu tun. Nur dass außer ihr kein anderer Content-Moderator davon betroffen zu sein schien. Jedenfalls hat keiner etwas gesagt. Es ist also kein allgemeines Problem.
Einen Moment überlegt Mayari, ihren Vorarbeiter anzusprechen. Aber ihre Beurteilung steht unmittelbar bevor, und Mayari will nicht negativ auffallen. Dafür erinnert sie sich zu genau an das, was vor zwei Monaten mit Arnel passiert ist – und sein Regelverstoß war nur eine Formsache. Nein, Mayari wird nichts sagen.
Sie mag ihren Job nicht besonders – vor allem die Schichtarbeit –, verlieren darf sie ihn trotzdem nicht. Immerhin hängen fünf Menschen an dem Lohn, den Delite ihr bezahlt. Montag bis Samstag, jeweils zwölf Stunden – zwei Mal sechs, mit zwei Coffee-Breaks und fünfundzwanzig Minuten Mittagspause. Eine Woche Tagschicht, eine Woche Nachtschicht. Sonntags hat sie frei. Mayari nimmt sich dann jedes Mal vor, Freunde zu treffen und auszugehen. All das zu tun, wozu sie sonst nicht kommt. Aber meistens ist sie so müde, dass sie einen Großteil des Tages einfach verschläft. Ohne die Erholungsphasen jeden Sonntag würde sie das Pensum nicht schaffen.
Sie will sich nicht beklagen. Mayari ist nicht die Einzige, die gern ein anderes Leben hätte. Aber das andere Leben gibt es nur in anderen Ländern. Letztlich sind sie hier nicht mehr als humane Ressourcen. Eine Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die dem reichen Teil der Weltbevölkerung zu Diensten ist.
In den vergangenen Jahren war Mayari so selten tagsüber draußen, dass sie vergessen hat, wie sich Sonnenlicht auf der Haut anfühlt. Echte Luft. Das Meer. Mayari lebt in einem Paradies, in dem Millionen Touristen Urlaub machen, während sie in Parzelle 653 sitzt und arbeitet. Hangar acht, Reihe sechs, Parzelle 53. Eigentlich ist das ihre Adresse. Zwei Quadratmeter Schreibtisch und Monitore in einer von zwölf riesigen Hallen voll mit ITlern und Content-Moderatoren, deren Aufgabe darin besteht, sämtliche Inhalte zu prüfen, die von Social-Media-Usern oder der firmeninternen Crawler-SecWare Spider als potenziell gefährlich eingestuft werden. Das sind mehrere zehntausend Redflags pro Tag, von denen jede einzelne Meldung gesichtet und überprüft werden muss. Unbedenklicher bis grenzwertiger Content wird freigegeben, alles andere gelöscht.
Anfangs war Mayari überfordert von dem, was sie sich da ansehen musste. Die Videos und Bilder von Folter, Enthauptungen und Gruppenvergewaltigungen verfolgten sie bis tief in den Schlaf. Manchmal war es so schlimm, dass sie von ihren eigenen Schreien wach wurde. Seit dem NINK ist das besser.
Mayari hat sich an ihren Job gewöhnt – an die strikten Leitlinien und Protokolle, an die Arbeitsbedingungen – das künstliche Licht, die summenden Klimaanlagen, die staubtrockene Luft der Server und Rechner, die Kameras, die wie Augen aus den Decken blicken. Mayari weiß, welchen Kollegen sie trauen kann – genau zwei – und welche jeden Regelverstoß auf der Stelle zur Anzeige bringen würden – alle anderen. Sie hat gelernt, sich auf ihre Angelegenheiten zu konzentrieren, und die Abläufe so zu automatisieren, dass ihr so gut wie nie Fehler unterlaufen. In ihrer Division ist sie auf Platz zwei der Top Ten. Und an Jack wird sie es auch noch vorbeischaffen – der hat schon zweimal den Extraurlaub abgestaubt. Dieses Jahr ist sie dran.
Mayari hat gearbeitet wie eine Maschine. Eine Schicht nach der anderen. Damit endlich ihr digitales Guthaben ausreicht, um ihrer Mutter die Knie-OP bezahlen zu können, die sie so dringend braucht. Nicht bei irgendeinem dieser Hinterhofstümper, sondern bei einem richtigen Arzt. Bei jemandem, der nicht nur mit Wodka desinfiziert.
Ihre Mutter ist seit über einem Jahr nicht arbeitsfähig. Sie kann weder laufen noch sitzen, braucht bei allem Hilfe. Es muss die Hölle für sie sein. Mayari wird immer noch wütend, wenn sie daran denkt, dass die Versicherung sich damals geweigert hat, den Noteingriff zu übernehmen. Es war eindeutig ein Arbeitsunfall – ein Maschinenarm, der sich löst und ihrer Mutter das Knie zertrümmert, deutlicher ging es ja wohl kaum. Trotzdem hat das Unternehmen sich geweigert, dafür aufzukommen. Stattdessen haben Mayari und ihr Bruder die OP acht Monate lang abbezahlt.
Das alles wäre zu verkraften gewesen, wenn sie wenigstens geholfen hätte. Hat sie aber nicht. Ohne Schmerzmittel übersteht ihre Mutter nicht einen Tag. Mayaris Bruder Efren besorgt ihre Medikamente am Schwarzmarkt – Restbestände und Präparate, die in klinischen Studien durchgefallen sind. Er versucht, ausgemusterte Tabletten aufzutreiben und nicht die gepanschten, aber zur Not müssen es auch die tun. Die zugelassenen kosten das Zehnfache. Würde Mayari die kaufen, hätten sie nicht genug zu essen.
Dass ihre Mutter Schmerzmittel nehmen muss, deren Produktion in anderen Ländern eingestellt wurde, weil die Nebenwirkungen zu gravierend waren, verdrängt Mayari, so gut sie kann. Dieses Russische Roulette zum Runterschlucken.
Aus diesem Grund lässt Mayari für gewöhnlich auch die Finger davon. Bloß ganz selten, wenn ihre Migräne so schlimm wird, dass sie es nicht mehr aushält, macht sie eine Ausnahme. Mit Sehstörungen kann sie nicht arbeiten. Und wenn sie ausfällt, wird sie nicht bezahlt. Manchmal muss sie das Risiko eingehen.
Abgesehen davon sind es nur noch ein paar Wochen, dann hat sie das Geld zusammen.
Die schafft sie jetzt auch noch.
Bei diesem Gedanken fällt Mayaris Blick wieder auf die angezeigten Redflags. Sie scrollt durch die Dateien. Ein militärischer Einsatzbericht, eine verschlüsselte E-Mail. Dann noch eine. Und überall derselbe Name: Samuel Mankowitz.
21:56 Uhr – Berlin Silvie Mankowitz
Ich stehe in der Küche und mache Lasagne – Sugo, Béchamelsoße, Pastaplatten, das volle Programm. Ich tue es, um mich abzulenken. Und um nicht alle Notaufnahmen der Stadt abzutelefonieren. Im Wohnzimmer läuft der Fernseher auf voller Lautstärke – ein ZDF Spezial, das ich nicht richtig verfolge. Stattdessen reibe ich Käse – sehr viel mehr, als für das Rezept nötig – und suche nach Gründen, warum mein Bruder nicht aufgetaucht ist.
Nach anderen als den offensichtlichen.
Wenn es ihm möglich gewesen wäre, hätte Samuel sich gemeldet, da bin ich mir sicher. Aber das hat er nicht. Kein Anruf, keine Nachricht. Ich weiß, was das bedeutet. Er hat es vorhin am Telefon selbst gesagt: Wenn sie mich kriegen, töten sie mich. Sie haben ihn gekriegt. Alles spricht dafür. Trotzdem schiebe ich den Gedanken weg und klammere mich weiter an eine Hoffnung, die es eigentlich gar nicht gibt. Ich verteile den Käse. Währenddessen spuckt mein Verstand mir Alternativen entgegen. Eine nach der anderen.
Vielleicht war sein Akku leer.
Vielleicht wurde Samuel aufgehalten.
Vielleicht hat das, was er noch erledigen musste, länger gedauert.
Vielleicht ist er gerade erst am Treffpunkt angekommen.
Ich halte einen Moment inne und schaue auf die Uhr, dann rufe ich per Sprachbefehl zum gefühlt hundertsten Mal bei der Nummer an, von der aus Samuel mich kontaktiert hat. Nichts.
Vielleicht hätte ich länger auf ihn warten sollen. Vielleicht sollte ich noch mal hinfahren. Andererseits hat Samuel meine Handynummer. Und er kennt diese Adresse. Immerhin war es mal seine.
Es ist ein seltsamer Gedanke, dass wir unsere ersten Lebensjahre hier verbracht haben. Die Vorstellung fühlt sich beinahe erfunden an. Wie bei Kindern, die spielen, dass sie Tierärzte sind oder Eltern.
Als unsere damals gestorben sind, waren mein Bruder und ich allein zu Hause. Ich erinnere mich noch, dass unsere Tante Marion uns damals mitten in der Nacht geweckt hat. Im Wohnzimmer haben ein Polizist und eine Psychologin auf uns gewartet. Vielleicht waren es auch zwei Polizisten, das weiß ich nicht mehr. Samuel und ich saßen in unseren Pyjamas auf dem Sofa – sie waren dunkelblau mit kleinen Bären drauf. Und dann hat Marion es uns gesagt. Eure Eltern sind bei einem Autounfall gestorben. Ich habe es nicht kapiert. Weil es doch ein ganz normaler Mittwoch war und sie mittwochs immer ausgegangen sind. Jede Woche. Seit Jahren.
Ein paar Stunden vorher habe ich meiner Mutter noch die Haare gewaschen. Manchmal durfte ich das. Sie waren lang und blond wie meine. Das Shampoo hat nach Blumen gerochen. Ich habe diesen Geruch danach lange gesucht, aber nie mehr gefunden. An dem Abend des Unfalls hat unsere Mutter ein schwarzes Kleid getragen. So als hätte sie geahnt, was passiert.
Ich habe mir später oft vorgestellt, wie sie aus dem Autowrack gezogen wurde. In ihrem schwarzen Kleid, mit den runden Diamantohrsteckern. So elegant. Ich wollte nicht an das Blut denken, aber es war überall. In ihrem Gesicht, in ihren Haaren, an den Händen. Ein leuchtender Rotton um leere Blicke. Als wären die Körper unserer Eltern Überreste, die nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Wie Verpackungen aus dem Supermarkt, die man recycelt.
Als unsere Mutter sich an dem Abend von uns verabschiedet hat, habe ich sie gefragt, ob ich ihre Ohrringe mal erbe, wenn sie tot ist. Ich war elf. Damals dachte ich, Menschen sterben erst als Großeltern und nicht am selben Abend.
Ich habe jahrelang geglaubt, es wäre meine Schuld gewesen. Dass meine Frage nach den Ohrringen der Auslöser für ihren Unfall war. Dass ich den Tod damit erst auf ihre Fährte gebracht habe. Hier, nimm die beiden, ich will die Ohrringe. Über meine Schuldgefühle habe ich nie mit jemandem gesprochen. Nicht mal mit Samuel. Stattdessen habe ich aufgehört, mir Dinge zu wünschen. Weil ich zu große Angst davor hatte, dass Gott, oder wer auch immer dafür verantwortlich war, mich missverstehen und mir als Nächstes meinen kleinen Bruder nehmen könnte.
Ich schließe die Augen. Der Druck dahinter steigt immer weiter, mein Hals ist trocken, eine Trockenheit von Tränen, die man nicht weint. Ich reiße mich zusammen, so wie ich mich immer zusammenreiße, und schiebe die Lasagne in den Ofen. Samuels Lieblingsessen. Das wird mir erst jetzt bewusst.
Als ich die Küchenuhr auf fünfundvierzig Minuten stelle, höre ich, wie ein Schlüssel ins Schloss gesteckt und umgedreht wird.
Matthieu.
Es war klar, dass er nach der Verleihung hierherkommt. Immerhin war das der Plan. Das Filmfest, danach ein Taxi zu mir, ein Gläschen Champagner auf seinen Erfolg, und wenn genug Alkohol geflossen ist, vielleicht noch eine schnelle Nummer im Wohnzimmer. Im Anschluss hätte Matthieu geduscht und sich auf den Weg zum Flughafen gemacht, um die Nachtmaschine nach Vancouver zu nehmen. Nach dem Film ist vor dem Film. Matthieu ist ein gefragter Mann.
Mich jeden Moment seinen Vorwürfen stellen zu müssen – wo ich war, warum ich ihm nicht Bescheid gegeben habe, wie ich ihn einfach dort stehen lassen konnte – ist gerade das Letzte, was ich brauche. Er ganz selbstgerecht und meine Gründe daneben unbedeutend. Er wird mir Fragen stellen, deren Antworten ihn im Grunde nicht interessieren. Weil alles, was zählt, er ist – und dass ich nicht da war.
Ich schaue an mir runter, auf das pastellgelbe Seidenkleid, das ich noch immer trage, halb verdeckt von der Kochschürze, und wappne mich für das, was gleich kommt. Ich höre, wie Matthieu sich im Flur die Schuhe von den Füßen tritt und seinen Schlüssel ans Brett hängt. Währenddessen schenke ich mir einen weiteren Schluck Gin ein und trinke ihn in einem Zug leer. Mein Kopf dröhnt dumpf, es ist exakt der Schmerz, bei dem ich jedes Mal glaube, der Tumor ist zurück. Diesmal inoperabel. Und wenn schon. Ich hänge schon lang nicht mehr am Leben.
Als ich das denke, taucht Matthieu neben mir auf. Er bleibt im Türrahmen stehen, noch im Anzug, aber ohne Fliege, barfuß. Die zwei oberen Knöpfe seines Hemds sind offen, in einer Hand hält er die goldene Trophäe, in der anderen eine Zigarette.
»Wo zum Teufel warst du?«, fragt er. Angetrunkene Augen, verletzter Männerstolz. »Hast du wieder mal einen wichtigen Anruf bekommen, ja? Von einer deiner Quellen?« Er macht einen Schritt auf mich zu. »Du bist gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Einfach abgehauen. Du hast mir noch nicht mal eine Scheißnachricht geschickt.« Als ich Luft hole, um etwas zu erwidern, hebt Matthieu abwehrend die Hände. »Und jetzt sag bloß nicht, du hättest mich nicht erreicht – mein NINK ist immer aktiv.«
Sein gottverdammter NINK.
Wenn ich jetzt anfange zu sprechen, werde ich schreien. Und dann werde ich Dinge sagen, die ich nicht mehr zurücknehmen kann. Dass es das war, dass ich ihn verlasse. Dass wir eine traurige Entschuldigung für eine Beziehung sind. Zwei Menschen, die ausschließlich um sich selbst kreisen, die sich kein bisschen für den anderen interessieren, ein lauwarmer Kompromiss, den wir bloß aufrechterhalten, weil wir uns viel zu sehr davor fürchten, allein zu sein.
»Hast du eigentlich eine Ahnung, was ich mir für Sorgen um dich gemacht habe? Nur, um dann hierher zu kommen und festzustellen, dass du« – er zeigt auf den Ofen – »… kochst!«
Ich atme tief ein, spüre, wie meine Rippen sich dehnen, mein Brustkorb, mein Bauch. Alles in mir tut weh, angefangen bei meinem Kopf, bis hin zu meiner Haut. Ja, ich bin gegangen. Ja, ich hätte eine Nachricht schreiben sollen. Ja, Matthieu hat sich Sorgen gemacht. So große Sorgen, dass er bis zum Ende der Veranstaltung geblieben ist. Genau so lange, wie er auch mit mir geblieben wäre – weil er seinen verdammten Flug nach Vancouver kriegen muss.
»Weißt du, wie das ist, wenn man sich während seiner Dankesrede an seine Frau wendet, und ihr Sitzplatz ist leer?«
Ich bin nicht deine Frau, denke ich, sage es aber nicht, weil es nichts zur Sache tut. Es wäre Öl im Feuer.
»Kannst du dir vorstellen, wie peinlich das für mich war? Wie die Leute mich angesehen haben?«
Ich trinke einen großen Schluck Gin aus der Flasche, spüle die Verachtung hinunter, die ich für Matthieu empfinde – und für mich, weil ich nichts sage. Weil ich ihm nicht entgegenbrülle, dass er sich ins Knie ficken kann. Dass mein Bruder mich angerufen hat. Der Bruder, von dem es hieß, er wäre tot – und der bis vor drei Stunden noch gelebt hat. Ich hatte die Chance auf ein letztes Treffen mit ihm. Auf Klarheit. Darauf, ihn in den Arm zu nehmen und von ihm in den Arm genommen zu werden. Und jetzt ist da nichts. Keine Klarheit, kein Treffen, keine Ahnung, wo er ist.
Ich stelle die Flasche unsanft auf dem Küchentresen ab und wende mich Matthieu zu, bereit für den Angriff, bereit, unsere Beziehung zu beenden, ihn aus meinem Leben zu streichen, den Fehler zu revidieren, den ich vor knapp fünf Jahren gemacht habe – da klingelt es.
Samuel, denke ich und renne zur Tür.
Als ich sie aufreiße, blicke ich in das Gesicht eines Fremden.
05:25 Uhr – Manila Mayari Morales
»Was wolltest du vorhin eigentlich fragen?«, sagt Emmalyn und reicht Mayari einen Kaffee, danach setzt sie sich zu ihr auf die klapprige Holzbank.
Mayari zögert. Sie kennt Emmalyn gut, aber nicht besonders lang. Trotzdem vertraut sie ihr – etwas, das sie, wenn es nach Ramil geht, nicht tun sollte. Jeder da drin würde dich sofort verraten, wenn er dadurch einen Vorteil hätte. Auch Emmalyn.
Ramil vertraut niemandem. Er sagt, mit ihr ist es anders, aber Mayari glaubt ihm nicht.
Sie trinkt einen Schluck Kaffee, irgendwann sagt sie beiläufig: »Hattest du schon mal Probleme mit deinem NINK?«
»Einmal«, antwortet Emmalyn, während sie mit einem kleinen Holzstäbchen die Kondensmilch von der Seitenwand des Glases kratzt. »Nach der Zahn-OP. Da haben sie mich zwei Tage freigestellt, weißt du noch?«
»Richtig«, sagt Mayari. »Ich wusste nicht, dass es mit deinem NINK zu tun hatte.«
»Doch, doch«, erwidert Emmalyn. »Das Narkosemittel, das sie zur Betäubung verwendet haben, hat zu einem Komplettausfall geführt. Boom. Kein Zugriff mehr.« Emmalyn zuckt mit den Schultern. »Kam zu der Zeit wohl öfter vor. Ein paar Monate später wurde das Mittel vom Markt genommen.«
Deswegen sind sie laut Vertrag dazu verpflichtet, alle Medikamente, die eingenommen werden, unverzüglich zu melden. Etwas, das Mayari vergessen hat.
»Wieso?«, fragt Emmalyn. »Hast du denn Probleme?«
»Hatte«, sagt Mayari. »Gestern nach dem Systemupdate. Ein kurzer Glitch. War aber nach ein paar Minuten wieder weg.«
»Tja«, erwidert Emmalyn. »Hätten uns vielleicht nicht die B-Ware einsetzen sollen, was?«
Mayari zwingt sich zu einem Lächeln und trinkt einen Schluck Kaffee. »Denkst du, ich sollte das mit dem Glitch trotzdem melden?«
»Wieso?«, fragt Emmalyn. »Hast du denn noch Probleme?«
»Nein«, lügt Mayari.
»Na also.« Sie lächelt. »Dann gibt es auch nichts zu melden. Oder?«
22:22 Uhr – Berlin Dr. Irene Kallmann
»Ich bitte Sie«, sagt Irene Kallmann trocken. »Die können unmöglich glauben, dass ich mit der Sache zu tun habe.«
Hobeck seufzt. »Da wäre ich mir nicht so sicher. Immerhin sind Sie diejenige, die von seinem Tod am meisten profitiert.«
Kallmann runzelt die Stirn. »Ich hätte die Wahl morgen sowieso gewonnen.«
»Natürlich hätten Sie das«, sagt Hobeck. »Aber nach außen hin sind Sie Ihren größten Konkurrenten los. Und in Ihrer letzten Rede haben Sie gesagt, und ich zitiere hier wörtlich: Ich werde alles tun, um Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor diesem Mann zu schützen.«
»Das war Wahlkampf, Herrgott noch mal.« Kallmann atmet tief ein. »Wäre Nowak nicht draufgegangen, würde ich sagen, er macht das nur, um mir zu schaden.«
»Frau Ministerin«, sagt Hobeck mit einem Lächeln im Mundwinkel. »Ich würde wirklich dazu raten, solche Dinge lediglich zu denken. Nicht jeder teilt Ihren Sinn für Humor.«
»Das war kein Humor.«
Hobeck sieht sie ernst an. »Frau Dr. Kallmann, es heißt schon jetzt hinter vorgehaltener Hand, Sie seien nicht sonderlich betroffen gewesen, als man Sie über den Tod des Ministers informiert hat.«
Kallmann macht ein abschätziges Geräusch. »Als ob mir in dem Zusammenhang irgendjemand Betroffenheit abgenommen hätte. Jeder weiß, dass Nowak und ich uns nicht mochten.«
»Genau das ist das Problem«, sagt Hobeck. »Wenn man Sie mit seinem Tod in irgendeiner Weise in Verbindung bringt, werden Sie die Wahl verlieren. Also – seien Sie betroffen.«
Kallmann lehnt sich in ihrem Bürostuhl zurück. Sie ist im Laufe ihrer Karriere schon vieles genannt worden. Eine Maschine. Unmenschlich. Herzlos. Die Klassiker nicht zu vergessen: Emanze, schwieriger Fall, Karrierebiest. Meistens von irgendwelchen Männern. Vermutlich weil die von einer Frau etwas anderes erwarten. Unterwürfig, verständnis- und liebevoll soll sie sein. Eine Mutter eben. Aber Kallmann ist keine Mutter, sie ist Politikerin – zu Hause auf einem Parkett, auf dem man nur überlebt, wenn man gut reden kann und sich nicht zu schade ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Und damit ist nicht gemeint, Kontrahenten abzuknallen. Eher, dass eine Hand die andere wäscht. Tut man es nicht, wird man verraten. Politik ist ein stetiges Geben und Nehmen, man schuldet Gefallen und gewährt welche. Kallmann hat stets peinlich genau darauf geachtet, mehr zu gewähren als zu schulden – sie weiß sich im Minenfeld politischer Machenschaften zu bewegen. Wäre dem nicht so, wäre sie ihnen längst zum Opfer gefallen. Eine weitere Figur auf der Bühne der Macht, die der Masse zum Fraß vorgeworfen wird. Survival of the fittest in Reinform. Kallmann kennt die Spielregeln, sie weiß, wann sie sie brechen kann und wann nicht, hat gelernt, die Schachzüge ihrer Gegner vorherzusehen. Nur deswegen ist sie jetzt da, wo sie ist. Weitsicht. Eine Eigenschaft, die bei einer Frau schnell als manipulativ ausgelegt wird – und bei einem Mann als vorausschauend.
Doch mit dieser Wendung hat sie nicht gerechnet. Ja, Johannes Nowak war eine Pein im Arsch. Ein chauvinistischer Drecksack, den sie nicht vermissen wird. Aber ermorden lassen hätte sie ihn deswegen nicht. Sie wollte ihn bei den Bundestagswahlen schlagen. Sie wollte seinem Ego irreparablen Schaden zufügen, das ja. Aber für mehr war er einfach nicht wichtig genug.
»Weiß man mittlerweile, wer für die Tat verantwortlich ist?«, fragt Kallmann.
Hobeck schaut auf. »An Feinden hat es Nowak nicht gemangelt, es gäbe also mehrere Möglichkeiten«, erwidert er. »Aber die Vorgehensweise sieht für mich nach jemandem mit militärischem Hintergrund aus. Vielleicht auch Geheimdienst.« Er macht eine Pause. »Wenn es so ist, stört mich die Nähe des Täters zur Esec.«
»Sie meinen wohl eher, die Nähe des Täters zu mir.«
Hobeck sagt nichts dazu. Wenn er schweigt, ist das nie ein gutes Zeichen.
»Gottverdammte Esec«, murmelt Kallmann.
Ihr Sprecher lächelt amüsiert. »Haben Sie die nicht damals ins Leben gerufen?«, fragt er.
»Ich war daran beteiligt, ja«, sagt Kallmann. »Das bedeutet nicht, dass es richtig war. Die Esec, ein Vereinigtes Europa …«
»Wenn ich mich recht erinnere, gehörten Sie zu den größten Befürwortern der USE.«
»Natürlich. Alles andere wäre Selbstmord gewesen.« Kallmann dehnt ihr Genick, doch es will nicht knacken. »Wir standen mit dem Rücken zur Wand. Entweder ein Vereinigtes Europa oder in der Bedeutungslosigkeit versinken. Mittlerweile denke ich, die Bedeutungslosigkeit wäre vielleicht besser gewesen.«
Kallmann erinnert sich an den Anfang zurück. 2022. Ukrainekrise. Sie hätte nicht für möglich gehalten, dass es tatsächlich zu einem Krieg kommt – so viel zu ihrer Weitsicht. Kallmann schüttelt den Kopf. Das alles erscheint ihr wie ein anderes Leben, dabei ist es gerade mal elf Jahre her.
Sie war damals schockiert gewesen, wie schnell es ging. Russlands Angriff. Der massive Anstieg von Öl- und Gaspreisen, Versorgungsängste, eine wachsende Unsicherheit der Märkte, Europa, die Pufferzone zwischen den Fronten – geografisch nah an Russland, verbündet mit den USA. Und Deutschland zwischen der Pflicht zu handeln und geschichtlich angehäufter Schuld. Es war ein Albtraum. Ost-West-Gefälle, Weltanschauungen, die aufeinanderprallen, Ernteausfälle, Handelskriege und damit verbundene Preissteigerungen, explodierende Inflationsraten. Mit so einer Größenordnung war nicht zu rechnen gewesen.
Im Nachhinein hat Kallmann sich oft gefragt, was wohl passiert wäre, hätte die Zentralbank die Zinsen damals nicht so drastisch erhöht. Andererseits, was hätten sie sonst tun sollen? In irgendeiner Form mussten die Finanzmärkte ja reagieren. Gegensteuern. Versuchen, den Kollaps der Währungen aufzuhalten. Auch wenn es ihnen letztlich nicht gelungen ist – trotz all ihrer Bemühungen. Es müssen nur genug Leute gegen etwas wetten, dann hat man keine Chance. In dem Zusammenhang wurde Kallmann klar, in was für einem kranken System sie lebten. Ein System, in dem ein paar Wenige die Geschicke aller lenkten. Und dann wurde ihr klar, dass es davor nicht anders gewesen ist – nur weniger offensichtlich.
Kallmann weiß noch, wie sie an jenem Abend neben Eduard auf dem Sofa saß und sagte: Das wird der Euro nicht überstehen.
Und genauso kam es. Euro, Dollar, Pfund, Yen … alles Geschichte. Nur noch Papier. Von einem Tag auf den anderen. Auf der ganzen Welt war es Menschen nicht mehr möglich, ihre Kredite zu bedienen. Die Immobilienblase platzte. Währungen brachen zusammen. Erspartes, Geldeinlagen, Aktienvermögen, einfach weg. Und das trotz der vehementen Anstrengungen der damaligen Regierungen, einen Crash zu verhindern. Wer früh genug auf Kryptowährungen gesetzt hat, ist über Nacht verdammt reich geworden. Alle anderen sind verarmt.
Selbstverständlich hat sich Kallmann vor diesem Hintergrund für ein Vereinigtes Europa starkgemacht. Aber das bedeutet nicht, dass sie der alten Welt nicht manchmal nachtrauert. Ein paar Grenzen, Bargeld, weniger Überwachung – das hatte auch etwas für sich.
Und was die Nähe von Nowaks Mörder zur Esec betrifft: die findet auch Kallmann beunruhigend – wenn auch nicht aus denselben Gründen wie Hobeck.
Zu viel öffentliches Interesse an ihrer Verbindung zur Esec wäre ungut. Vor allem jetzt. Kaum einer ist so eng mit den Europäischen Spezialeinheiten verbandelt wie sie – dabei spielt es keine Rolle, dass Kallmann in der vergangenen Amtsperiode dem Ministerium für Familie und Soziales vorstand. Die acht Jahre davor war sie für die Verteidigung zuständig – der größte Etat, den es in dem Ressort je gegeben hat: notwendig gemacht durch den Ukrainekrieg. So viel Kapital für neue Waffen und Verteidigung wie nie zuvor. Ein gemeinsames Militär und ein Verbund aus Geheimdiensten waren die einzig logische Konsequenz. Natürlich wurden damals Fragen gestellt – wofür das Sondervermögen eingesetzt wird, was genau Kallmann damit vorhat –, doch aus strategischen Gründen war es ihr möglich, einen Großteil dessen unter der Hand zu regeln. Die anderen, die davon wissen, werden nichts sagen – schließlich stecken sie selbst mit drin.
Es wäre ein herber Rückschlag, würde man sie mit Nowaks Tod in Verbindung bringen – zumal sie tatsächlich nichts damit zu tun hat.
Kallmann fragt sich, wer es war. Und ob dieser Jemand etwas ahnt.
Zur selben Zeit – Republik Aserbaidschan – Präsidentenpalast
Er hat seinen Kammerdiener beauftragt, das Badewasser einzulassen, die Wassertemperatur bei exakt achtunddreißig Grad. Davor hat er sich massieren lassen, so wie jeden Abend. Es hat gutgetan. Sevdas starke Hände, die den Stress aus seinem Nacken kneten, im besten Sinne schmerzhaft. Die Hitze des Massageöls wirkt noch nach, sie liegt wie Feuer auf seiner Haut.
Er sitzt in seinem Bademantel an seinem riesigen Mahagonischreibtisch. Ein Staatsmann. Eine Legende. Auch wenn seine Macht geerbt ist, er hat sie sich nachträglich verdient – sie gehalten, allen Widrigkeiten zum Trotz. Den Putschversuchen und Aufständen, den Schreien nach Modernisierung und Demokratie. Er hat alles erfolgreich niedergeschlagen. Beseitigt, wer sich ihm in den Weg stellte.
Sein Blick fällt erneut auf das Stück Papier, das vor ihm liegt. Mit Wappen und Wasserzeichen. Er hat den Text mit Füller verfasst – es schien ihm dem Anlass angemessen.
Diesen Brief zu schreiben, ist ihm schwergefallen – vermutlich, weil ihm die meisten Schriftstücke lediglich zur Unterschrift gereicht werden: Erlässe, Gesetze, Todesurteile. In seiner Signatur dagegen ist er geübt. Am liebsten setzt er sie auf Autogrammkarten. Er hat noch Anhänger. Wenn auch nicht mehr so viele wie früher.
»Präsident Ismailov«, sagt einer seiner Bediensteten.
Er blickt auf. »Ja?«
»Alles ist vorbereitet.«
»Auch die Musik?«, fragt er.
»Selbstverständlich, mein Präsident. Op. 51Valse Sentimentale von Tschaikowsky, wie von Ihnen gewünscht.«
»Sehr gut«, sagt er. »Abtreten.«
Der Diener nickt untergeben, dann verlässt er rückwärts den Raum und schließt die Tür hinter sich.
In dem Moment regt sich Widerwille in Ismailov. Als wäre er uneins mit sich selbst. Doch der Entschluss ist gefasst. Nun gilt es, ihn umzusetzen.
Ismailov atmet tief aus, faltet den Brief, steckt ihn in einen der Umschläge aus Büttenpapier und versiegelt ihn. Er hat diesen Ring von seinem Vater geerbt. So wie er sein ganzes Leben von seinem Vater geerbt hat. Ein König ohne Titel. Wenigstens auf Lebenszeit. Immerhin dafür hat Ismailov per Dekret selbst gesorgt.
Er hat lange nicht mehr an seinen Vater gedacht. Doch es wundert ihn nicht, dass er es heute tut.
Ismailov schiebt den schweren Stuhl zurück, erhebt sich und geht in den privaten Trakt des Präsidentenpalasts. Er hat sein gesamtes Leben hier verbracht. Als Kind, als Jugendlicher, als Mann.
Als er wenig später das Badezimmer betritt, läuft Tschaikowsky. So tragisch schön, so pathetisch, so überaus passend. Die Luft ist feucht, Dampf schwebt den hohen Decken entgegen.
Ismailov legt seinen Brief gut sichtbar auf den Beistelltisch neben der Wanne, danach geht er zum Waschbecken hinüber und greift nach dem Rasiermesser. Selbst das Messer hat er von seinem Vater. Er war schon als kleiner Junge beeindruckt davon – von der scharfen Klinge. Aber noch mehr vom Schimmern des Elfenbeingriffs.
Mit dem Messer in der Hand geht er zurück zur Wanne, schält sich aus seinem Seidenbademantel, hängt ihn an seinen angestammten Haken und steigt ins heiße Wasser. Er gleitet langsam hinein, lässt sich Stück für Stück davon verschlucken, seine Haut zieht sich kribbelnd zusammen.
Ismailov atmet ein letztes Mal tief ein. Er spürt, wie sich seine Lunge ausdehnt, seine Rippenbögen, sein unterer Rücken. Etwas in ihm sträubt sich. Ein Teil in ihm will es nicht tun. Doch er ist nicht stark genug. Die Entscheidung ist längst gefallen.
Bei diesem Gedanken setzt er die Klinge an und öffnet sich die Arme.
Zur selben Zeit Silvie Mankowitz
Während ich den Mann in der Tür ansehe, breche ich innerlich zusammen. Doch von außen merkt man es nicht. Meine Finger umfassen die Türklinke. Ich stehe da und atme. Begreife die Situation wie mit Händen. Der Mann sieht sogar aus wie ein Fernsehkommissar. Ein Matthias Koeberlin für Arme in Jeans und Lederjacke. Er hält mir seinen Dienstausweis entgegen. Frank Schachinger, Kriminalpolizei