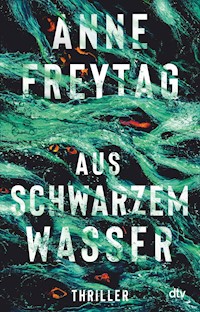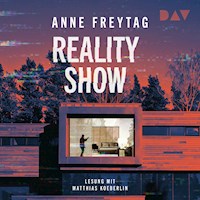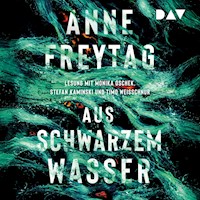13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Sie sind in derselben Jahrgangsstufe und trotzdem in verschiedenen Welten. Julia, Marlene und Leonard im Zentrum der Aufmerksamkeit, der Rest irgendwo in ihrer Umlaufbahn. Dann geschieht etwas, das alles verändert: Eines Morgens macht plötzlich eine Internetseite die Runde, die bis dato auf privat gestellt war. Darauf zu finden sind Julias ungefilterte Gedanken, Bomben in Wortform, die sich in kürzester Zeit viral verbreiten. Es sind Einträge, die ein ganz anderes Bild des beliebten Mädchens zeigen, das alle zu kennen glauben.
Wer hinter der Aktion steckt, ist zunächst unklar, doch nach und nach kommt heraus: Gründe dafür hätten einige.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Als Julia an diesem Morgen die Schule betritt, spürt sie sofort, dass etwas anders ist. So als hätte sich die Zusammensetzung der Luft verändert.
Die Zwillinge Marlene und Leonard sind die Stars der 12. Jahrgangsstufe. Julia ist mit beiden befreundet und hat sich so auch ihren Platz an der Spitze gesichert. Doch dann verliert sie ihren Laptop, auf dem sie ihre geheimsten Gedanken als Blogeinträge festgehalten hat. Es sind kluge, nur allzu wahre und immer wieder auch bitterböse Kommentare über das Leben – aber auch über ihre Freunde und Mitschüler. Als kurz darauf ihre Texte veröffentlicht werden, gerät das gesamte Sozialgefüge des Jahrgangs ins Wanken, und Julia wird binnen kürzester Zeit zur Ausgeschlossenen. Aber wer steckt hinter der Aktion? Linda, die jahrelang von Julia und den Meller-Zwillingen gemobbt wurde? Lindas bester Freund Edgar, der heimlich in Julia verliebt ist? Oder doch jemand ganz anders? Vielleicht gar jemand aus Julias engstem Kreis? Wer auch immer die Fäden zieht: Nach diesen Einträgen ist nichts mehr so, wie es mal war …
Anne Freytag hat International Management studiert und als Grafikdesignerin gearbeitet, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihre ersten beiden Bücher wurden für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, ihr dritter Roman »Nicht weg und nicht da« für den Buxtehuder Bullen 2018. Außerdem erhielt sie den Bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte Literatur. Zuletzt bei Heyne fliegt erschienen: »Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte«.
ANNE FREYTAG
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Anne Freytag
Copyright © 2020 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Favoritbüro, München
Umschlag- und Innenillustrationen: Martina Frank, München
[[>>]] Little Hurricane, »OTL« © 2017
[[>>]] Keaton Henson, »10am Gare du Nord« © 2013
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-25623-4V002
www.heyne-fliegt.de
Der krumme Baum lebt sein Leben,
der gerade Baum wird ein Brett.
(chinesisches Sprichwort)
Diese Geschichte ist für all die krummen Bäume
da draußen. Ich wünsche euch ein schönes Leben.
Prolog
Der Tag, an dem alles anders wurde, war ein Donnerstag. Das Datum weiß ich nicht mehr. Dafür erinnere ich mich umso genauer an den weißen Hasen, den ich am selben Morgen um kurz vor acht auf dem Grünstreifen zwischen Straße und Trambahnschienen gesehen habe. Ich stand an einer roten Ampel, Musik in einem Ohr, den Straßenlärm im anderen, und da saß er, allein und völlig unbeeindruckt. Von den Autos, vom Benzingestank, von der flirrenden Hitze ganz knapp über dem Asphalt. Er hat einfach nur existiert, ganz klein und plüschig irgendwo mitten im Berufsverkehr. Und entgegen dem Klischee hatte er kein bisschen Angst. Er war wie ein Wolf unter den Hasen. Und ich wollte sein wie er.
PROTOKOLL
München, Donnerstag, 21. Mai, 11:45 Uhr
Direktorat, Städt. Käthe-Kollwitz-Gymnasium
Betreff: Mobbingvorfall Julia Nolde
Anwesende:
• Frau Dr. Ferchländer, Rektorin
• Herr Weigand, Konrektor
• Edgar Rothschild, Schüler der 12. Jahrgangsstufe
• Benjamin Rothschild, Vater des Schülers, Erziehungsberechtigter
Edgar:
Ich war es nicht.
Frau Dr. Ferchländer:
Soweit ich weiß, hast du den Jutebeutel aber gefunden. Ist das korrekt?
Edgar:
Ja, das ist richtig. Im Bus. Aber ich habe das nicht getan.
Herr Weigand:
Du verstehst aber doch sicher, dass es einigen hier schwerfällt, das zu glauben.
Herr Rothschild:
Mein Sohn lügt nicht. Wenn er sagt, er hat es nicht getan, dann hat er es nicht getan.
Frau Dr. Ferchländer:
Es liegt uns fern, Ihren Sohn zu beschuldigen.
Herr Rothschild:
Tatsächlich? Denn genau so klingt es für mich.
Herr Weigand:
Wir versuchen lediglich zu rekonstruieren, was passiert ist, das ist alles.
Herr Rothschild:
Ich würde sagen, Sie wissen ziemlich genau, was passiert ist. Sie wissen nur nicht, wer es war.
Frau Dr. Ferchländer:
Wir wollen die Wahrheit.
Herr Rothschild amüsiert:
Die Wahrheit? Und wessen Wahrheit genau?
Frau Dr. Ferchländer:
Sie denken, es gibt mehr als eine?
Herr Rothschild:
Es gibt immer mehr als eine.
Frau Dr. Ferchländer:
Nun gut. Blick zu Edgar. Dann erzähl mir mal deine.
ZWEI TAGE VORHER,
DIENSTAG, 19. MAI
14:07 Uhr
Manchmal glaubt Edgar, dass es Menschen wie ihn hauptsächlich deswegen gibt, damit man die Besten mit irgendwas vergleichen kann. Denn gäbe es nur die Besten, wären sie ja Durchschnitt und damit nicht die Besten, sondern einfach normal. Wenn man diesen Gedanken einmal zu Ende denkt, macht eigentlich erst er sie zu etwas Besserem. Dementsprechend findet Edgar, sie sollten Leuten wie ihm dankbar sein. Aber das sind sie nicht. Er schätzt, dafür sind sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
Mit ihr ist das nicht groß anders. Für ein paar Wochen dachte er es, aber so ist es nicht.
Edgar sitzt hinten im Bus, vorletzte Reihe links, so wie immer, wenn er allein fährt. Er hört »In the Morning« von Jefferson Airplane, und sein Blick ist auf sie gerichtet wie eine geladene Waffe. Er sieht nur ihre dunklen Haare und ihren Nacken. Sogar der ist verletzlich. Sie schaut aus dem Fenster, irgendwo hin, auf die vorbeiziehenden Bäume. Er kann ihr Gesicht nicht sehen, nur eine Idee von ihrem Profil.
Vor ein paar Tagen sind sie noch zusammen in die Schule gefahren und nach dem Unterricht dann wieder zurück. Die Erinnerung daran fühlt sich seltsam fremd an. Als wäre er gar nicht dabei gewesen, sondern jemand anders. Als hätte ihm nur jemand davon erzählt.
Ihre Freundschaft, oder wie man das auch nennen mag, beschränkte sich ausschließlich auf die Busfahrten. Davor und danach sprachen sie nicht miteinander. Als wären sie ein Geheimnis. Etwas, von dem man anderen nicht erzählt. Sie, weil er ihr peinlich war, er, weil es ihm ohnehin keiner geglaubt hätte. Als ob ein Mädchen wie sie sich mit einem wie ihm abgibt. Ihr Nacken ist schmal und zierlich. Edgar will sich nicht vorstellen, wie ihre Haut riecht, tut es aber immer wieder. Sie hat kleine runde Ohren. Ohrmuscheln, denkt er. Bei ihr passt der Ausdruck.
Vor nicht mal drei Monaten kannten sie sich noch nicht. Er war einer von denen, die in ihrer Welt keinen Namen haben, irgendein Statist, der um sie und ihresgleichen kreist. Ein Pluto in ihrer Umlaufbahn. Wäre sie nicht umgezogen, wäre das auch so geblieben. Sie und er fein säuberlich abgegrenzt durch Trennlinien, wie in einer Turnhalle, die jedem Spieler seinen Platz zuweisen. Man könnte sie natürlich übertreten, aber man tut es nicht. Das verstößt gegen die Regeln. Als wäre es nicht nur eine Markierung auf einem Boden, sondern eine Tatsache, die jeder instinktiv versteht.
Edgar hat eigentlich nichts gegen seine Welt. Er wollte nie einer von den Beliebten sein. Zumal er gar nicht weiß, warum man sie so nennt. Beliebt. Wenn überhaupt, mögen sie sich untereinander – und nicht einmal da ist er sich sicher. Alle anderen fürchten sie nur. Die hässliche Fratze unter der Oberflächlichkeit. Sie sind mächtig, nicht beliebt. Und doch wirken sie so. Dieses kleine Bisschen schöner, das kleine Bisschen besser, so als würde in ihrer Mitte mehr gelacht, lauter gefeiert und intensiver gelebt als bei den Normalen. Die sind nur der Dunstkreis, in dem sie sich bewegen. Wie ein Spucknebel um sie herum.
Trotzdem mochte er die Busfahrten mit ihr. Sie waren eine Klammer um seinen Tag. Ein Sprung aus seiner Realität in eine andere. So eine Art Ausflug in eine Zwischenwelt zwischen ihrer und seiner. Als wäre er ein Hase, der einen Haken schlägt.
Er muss zugeben, dass es ihn überrascht hat, wie gut man mit ihr reden kann. Davor war sie immer nur das Mädchen mit dem kindlichen Gesicht und den großen Brüsten. Dann wurde sie Leonards Freundin – vermutlich wegen genau dieser Attribute. Und dann auf einmal ist sie witzig und klug, eine Person, die eine Meinung hat und nicht nur Brüste.
Edgar wünschte, er wüsste es nicht. Wenn er nie mit ihr gesprochen hätte, hätte er sie weiterhin als das sehen können, was sie immer für ihn war: eine gute Vorlage, um sich einen runterzuholen. Ein Mädchen mit Marzipan-Armen und einem schönen Mund. Aber seit er weiß, dass aus diesem Mund interessante Dinge kommen, und was es mit ihm macht, wenn sie ihn mit diesen Lippen anlächelt, kann er sie nicht mehr so sehen. Wie bei einer dieser optischen Täuschungen, bei denen man erst gar nichts erkennt und dann, wenn einem jemand die Lösung verraten hat, nichts anderes mehr. Man kann es nicht mehr nicht sehen. Genau so geht es ihm mit ihr.
Noch eine Station, dann steigt sie aus. Edgar schaut weiter in ihre Richtung und wartet darauf, dass sie den Stopp-Knopf drückt, und in derselben Sekunde tut sie es, als hätte sein Gedanke ihren linken Arm gesteuert. Sie hebt ihn, blass und weich, und ein Ping-Laut verrät, dass der Wagen halten wird. Vor ein paar Tagen saß er noch neben ihr. Auf dem Platz, auf dem sie jetzt sitzt – dem hinter der Glasscheibe direkt neben dem Ausstieg. Den am Fenster hat sie frei gelassen. So, als wäre sie ein menschliches Absperrband, das ihm unmissverständlich sagt: Du bist nicht willkommen.
Dann steht sie auf. Kein Blick zu ihm, kein Lächeln, nichts. Sie ist nur körperlich anwesend, in Gedanken ist sie längst ausgestiegen.
Der Bus wird langsamer, Edgar sieht die Haltestelle, hört ein Bremsgeräusch. Und in seinem Brustkorb breitet sich eine Schwere aus, die so etwas ist wie Sehnsucht. Am liebsten würde er mit ihr aussteigen, sie fragen, was auf einmal mit ihr los ist. Ob er etwas falsch gemacht hat. Aber das hat er bereits getan. Gestern bei der Rückfahrt und heute auf dem Weg zur Schule. Und beide Male hat sie ihn auflaufen lassen. Wie kommst du darauf, dass etwas los ist?, hat sie gefragt und ihn dabei angesehen, als wären sie Fremde. Und damit wurden sie es wieder. Als hätte sie mit diesem einen Blick die vergangenen Wochen unwiderruflich gelöscht und Edgar mit nur einem Satz in sein Feld zurückgeschlagen.
Die Türen öffnen sich, und der Tag draußen ist grau und gleichgültig. Genau wie sie. Ein farbloser Einschub in einen Sommer, der alle Rekorde bricht. Es ist schwül, ein Wetter auf der Kippe. Sie steigt aus und sonst niemand ein, dann schließen sich die Türen, und der Bus setzt sich schleppend in Bewegung, als wäre er ein sehr alter Mensch, dem die feuchte Luft zu schaffen macht. Edgar blickt aus dem Fenster, zu ihr, und dann, ganz plötzlich schaut sie auf, nur ganz kurz, zwei Wimpernschläge vielleicht. Sie sieht ihn direkt an, und er schaut zurück, und die Leere in ihrem Gesicht ist wie ein Abgrund. Zwei große Augen, hinter denen es so dunkel ist, dass Edgar Gänsehaut bekommt. Als hätte jemand ihr Wesen ausgeschaltet wie eine Nachttischlampe.
Sie überquert die Straße, den Kopf gesenkt, den Rucksack auf den Schultern. Heute hat sie keinen Jutebeutel dabei. Er sieht ihr nach, bis der Bus die Unterführung erreicht, dann reißt sein Blick ab, wie ein Faden, der zu sehr unter Spannung stand.
Irgendwas muss in den letzten drei Tagen passiert sein. Am Freitag war sie noch ein anderer Mensch.
13:24 Uhr
Also dafür, dass Rothaarige angeblich aussterben, sieht Linda erstaunlich viele von ihnen. Gerade radelt sie hinter einer her. Und gestern im REWE hat sie sogar zwei gesehen. Vielleicht fallen sie ihr aber auch nur deswegen auf, weil ihre Mutter das neulich mal beim Frühstück erwähnt hat. Da hat sie die Zeitung zur Seite gelegt, Linda und ihren Vater entrüstet angeschaut und gefragt: »Wusstet ihr, dass Rothaarige aussterben?« Sie hat es gesagt, als wäre es etwas Persönliches. Als befürchtete sie, dass jeden Moment jemand die Küchentür aufstoßen und sie erschießen könnte, nur weil sie rote Haare hat. Eigentlich sind die gar nicht wirklich rot, sie sind eher orange. Das klingt hässlich, aber das ist es nicht. Die Haare ihrer Mutter sind schön, Lindas sind langweilig. Sie hat die von ihrem Vater geerbt – was bei genauerer Betrachtung wieder für das Aussterben der Rothaarigen spricht. Bei Linda ist es ein schmutziges Blond geworden, ganz knapp vor Grau. Ein Farblos, das ihr Gesicht umrahmt. Ein paar Mädchen an ihrer Schule haben sich die Haare grau gefärbt. Deshalb sind Lindas jetzt grün. Sie will auf keinen Fall das, was die anderen haben. Ärgerlich genug, dass sie die gleiche Luft wie sie atmen muss. Ihre Mutter würde sie jetzt korrigieren, wenn sie zu Hause wäre. Sie würde sagen: »Dieselbe, Linda, nicht die gleiche. Da gibt es einen Unterschied.« Und den würde sie ihr dann lang und breit erklären. Dann eben dieselbe Luft, es ist Linda egal.
Sie rollt die letzten Meter auf ihrem Fahrrad bis zum Gartentor, dann bremst sie und steigt ab. Die rothaarige Frau fährt weiter. Und die Sonne steht am Himmel wie ein riesiger Scheinwerfer. Als wäre das Leben eine Bühne und Linda eine kleine Darstellerin ohne Text. Sie schaut auf das Haus, in dem sie wohnt, in dem sie immer gewohnt hat, es ist klein mit einem spitz zulaufenden Dach. Wie ein Tipi umgeben von Baumkronen. Ganz oben ist ihr Zimmer. Überall Dachschrägen und Balken. Ihr Vater sagt immer wieder, wenn er mehr Geld hätte, würde er das Haus umbauen. Moderne Glasfronten, ein großzügiges Wohnzimmer, vielleicht sogar ein Anbau. Sie ist froh, dass er keins hat. Ja, das Haus ist proportional zu klein für das Grundstück, die Räume sind schlecht geschnitten, die Fenster schließen nicht richtig, und im Winter ist es kalt. Aber es hat Charakter. Es ist wie ein Mensch, mit dem sie zusammenwohnen. Wie eine Großmutter, die sie ihr Leben lang kennt. Mit allen Geräuschen und Gerüchen. Es stört nicht, dass der Lack überall abblättert, an den Fensterläden und an dem schmiedeeisernen Balkongeländer. Das spielt alles keine Rolle. Dass das Haus irgendwann mal hellblau war und weiße Fensterläden hatte. Inzwischen ist beides eine undefinierbare Mischung aus verblichen und Witterung, und es sieht trotzdem schön aus.
Lindas Großmutter väterlicherseits hat das Haus vor vielen Jahren für wenig Geld gekauft. Das Land ist inzwischen ein Vermögen wert. Um sie herum stehen fast ausschließlich Villen. Alte und neue. Und ein paar von diesen modernen Klötzen, Beton und deckenhohe Fenster. Ihr Haus ist wie eine einzelne Speerspitze zwischen den Flachdächern. Ein Störfaktor, den jeder in der Gegend kennt – eine Tatsache, auf die Linda insgeheim stolz ist.
Sie schiebt ihr Rad über den Kiesweg. Und das leise Knirschen klingt wie eine Begrüßung. Ihre Eltern sind noch nicht da, weder das Auto ihrer Mutter noch das Fahrrad ihres Vaters stehen in der Auffahrt. Linda lächelt. Sie mag es, wenn sie das Haus nach der Schule erst mal ein paar Minuten für sich hat. Ohne Stimmen und jemanden, der spricht. Nicht gleich ein Und? Hast du die Klausur rausbekommen? oder ein Haben Momo und du euch inzwischen wieder vertragen?. Einfach nur sie und die Stille. Der einzige Haken an der Sache ist, dass Linda dann das Mittagessen machen muss. Denn der, der zuerst heimkommt, kocht. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz im Hause Overbeck. Es gibt nicht viele solche Gesetze, nur eine Handvoll oder so, doch die sind dafür unbedingt einzuhalten. Zum Beispiel die Geschirrspüler-Regel. Wer den sauberen Geschirrspüler aufmacht, muss ihn auch ausräumen. Was nicht selten dazu führt, dass ihr Vater und sie bei akuter Kleiner-Löffel-Knappheit – sie sind beide totale Joghurt-Junkies –, um den Geschirrspüler herumschleichen wie Raubtiere, in der Hoffnung, der jeweils andere möge zuerst einknicken und die Klappe öffnen. Lindas Mutter trifft es so gut wie nie. Manchmal glaubt Linda, dass sie irgendwo im Haus ein Geheimversteck hat, wo sie sauberes Geschirr für sich bunkert, anders kann Linda es sich nicht erklären. Neben der Geschirrspüler-Regel gibt es noch die für Klopapierrollen. Diese wiederum unterteilt sich in zwei Bereiche. Erstens: Aufgebrauchte Klorollen müssen unter allen Umständen ausgewechselt werden. Und zweitens: Wer auch immer die letzte Klorolle aus der Verpackung holt, muss die Familien-Einkaufsliste um den Punkt Klopapier ergänzen. Sie haben so eine App, die sich auf ihren drei Handys automatisch aktualisiert. Man kann sogar sehen, wer was wann hinzugefügt hat. Totale Kontrolle. Die Klopapier-Regel hat Lindas Vater eingeführt. Jeder, der ihn ein bisschen kennt, würde ihn als friedliebenden Menschen beschreiben, Linda sogar manchmal als Waschlappen, aber beim Anblick einer fast leeren Klopapierrolle mit nur noch zwei Alibi-Blättern dran vergisst er sich. Da rastet er aus. Irgendwann hat Lindas Mutter ihr mal gestanden, dass sie es manchmal extra »vergisst«. Ihr genauer Wortlaut war: »Also, ab und zu, wenn wir uns gestritten haben, mache ich das ja absichtlich. Da lasse ich die leere Rolle hängen. Nur um ihn zu ärgern.« Linda fragt sich manchmal, ob Toilettenpapier auch in anderen Familien so ein Thema ist, und kann es sich nicht vorstellen. Bei den Overbecks hängt der gesamte Haussegen davon ab. Und auch davon, wie die Klopapierrolle aufgehängt wurde, denn das verrät laut ihrer Mutter sehr viel über den Charakter eines Menschen. Sie sagt, das erste Blatt muss nach vorne schauen. Auf keinen Fall nach hinten. Leute, die das Toilettenpapier so hinhängen, sind elende Geizkragen. »Achte mal darauf«, sagt sie dann jedes Mal. »Es ist wirklich so. Ganz schlimme Geizkragen. Alle.« Linda kann das bisher nicht unterschreiben, trotzdem hängt sie es so auf, wie ihre Mutter es haben will.
Die dritte Familien-Regel ist eine, die es wohl fast überall gibt: keine Drogen. Und dabei spielt es keine Rolle, welche. Ihre Eltern unterscheiden nicht zwischen hart und weich. Es ist alles Teufelszeug. Aber ihre Eltern wären nicht ihre Eltern, wenn es nicht eine Ausnahme gäbe: und das ist Gras. Immerhin eine Pflanze. Trotzdem bestehen Lindas Eltern darauf, dass sie nur mit ihnen kifft. Wenn du mal Lust auf einen Joint hast, Kleines, dann sagst du es uns einfach und wir besorgen etwas. Kein Witz. So sind ihre Eltern. Alte Hippies. Alleine wird nicht gekifft, aber mit ihnen ist es vollkommen okay. Sie kennen jemanden, der seine eigenen Pflanzen zieht und der bringt ihnen dann was vorbei. »Da weiß man wenigstens, wo es herkommt«, sagt ihre Mutter. Linda kifft nicht besonders oft mit ihren Eltern, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Meistens draußen auf der Terrasse, wenn die Nachbarn grillen, dann riecht es keiner. Das letzte Mal war mit Edgar irgendwann im letzten Juni – kurz bevor Momo an ihre Schule kam und alles anders wurde.
Neben dem Drogenverbot gibt es noch die Kondompflicht. Sex an sich ist ganz klar erlaubt. Sogar sehr gesund, laut ihrer Mutter, sie hat da einige Studien dazu gelesen. Wenn Linda also Sex haben will, ist das vollkommen in Ordnung, auch unter dem Dach ihrer Eltern – allerdings NUR mit Kondom. Wenn es nach Lindas Vater ginge, am liebsten zwei übereinander – er hat in seiner Praxis schon zu viele ungewollte Schwangerschaften miterlebt, vor allem bei Minderjährigen. Seit sie mit Momo zusammen ist, ist das kein Thema mehr, aber davor mit Edgar war es eins. »Er ist ein wirklich netter Junge«, hat ihr Vater damals gesagt, »du weißt, wie sehr ich ihn mag, aber auch wirklich nette Jungen können ein Mädchen schwängern«.
Und zu guter Letzt wäre da dann noch die Sache mit dem Kochen. Bei Linda läuft es eigentlich immer auf Pasta hinaus. Oft nur mit etwas Butter und Salz, ansonsten mit irgendeiner Soße aus dem Glas. Manchmal fragt sie sich, ob sie deswegen so einseitig kocht, weil sie hofft, dass ihre Eltern irgendwann so sehr von ihren Nudelgerichten genervt sind, dass sie sich mit dem Nachhausekommen etwas beeilen oder die Koch-Regel einfach kippen, aber sie erweisen sich, was das betrifft, als ziemlich resistent. Also wird sie kochen – ein weiteres Mal Pasta mit Butter.
Die anderen
Clemens: Die kann von Glück reden, dass sie nichts über mich geschrieben hat. Andererseits wundert es mich schon ein bisschen, dass ich wirklich gar nicht erwähnt wurde. Ich meine, wir waren drei Jahre zusammen in einer Klasse. Und dann schreibt sie nichts über mich? Echt jetzt?
Johanna: Ich verstehe überhaupt nicht, was das alles soll. Mich interessiert nicht, was die dumme Kuh denkt. Offen gestanden hätte ich ihr so viele Gedanken gar nicht zugetraut.
Nathan: Ich mochte sie eigentlich immer ganz gern, wir hatten ein paar Projekte zusammen – aber nach dem, was ich jetzt so gelesen habe, gehe ich ihr lieber aus dem Weg. Sonst richtet sich am Ende ihr nächster Ausbruch noch gegen mich.
Kathi: Ich wusste immer, dass sie eine falsche Schlampe ist. Ich meine, eine, die so aussieht, was kann man da erwarten?
Tatjana: Mein Gott, sie war einfach nur ehrlich. Das, was da steht, stimmt doch alles. Abgesehen davon war es privat. Das eigentliche Arschloch der Geschichte ist doch die Person, die die Einträge auf öffentlich gestellt hat. Mal im Ernst, wer macht so was?
Paul: Also ich hab da ja so eine Vermutung, wer dahinterstecken könnte. Ist nur so ein Gefühl. Andererseits spricht dagegen, dass diese Person auch in den Einträgen erwähnt wird. Was wiederum auch ein geschickter Schachzug sein könnte, um so von sich selbst abzulenken. Über mich stand natürlich nichts auf der Seite. Ich bin nicht wichtig genug. So gesehen ist das vielleicht eine ganz gute Sache.
14:18 Uhr
Die übernächste Haltestelle ist Edgars. Viktualienmarkt. Und ja, es gibt tatsächlich Menschen, die da wohnen, auch wenn das viele überrascht. Als wäre der Viktualienmarkt so eine Art Disneyland. Was natürlich Quatsch ist. In den Seitenstraßen leben ganz normale Leute. Ein seltsames Gleichgewicht aus Alteingesessenen und Yuppies, wobei die Alteingesessenen langsam aussterben – und mit ihnen das Gleichgewicht. Die Wohnung, in der Edgar und sein Vater wohnen, ist direkt über dem Juweliergeschäft, das seine Urgroßeltern aufgebaut haben. Edgar weiß nicht genau, wann das war. Irgendwann. Es ist ein kleiner, vollgestopfter Laden mit antikem Schmuck. Er gehörte ihnen, bis die Nazis kamen. Danach gehörte er wieder ihnen. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine mit so vielen Tretminen, dass er sie meistens gar nicht erst anschneidet. Sein Nachname verrät ohnehin genug: Rothschild. Und nein, sie sind nicht mit den Rothschilds verwandt. Zumindest nicht, soweit er weiß.
Edgar schaut in Richtung Digitalanzeige. St.-Jakobs-Platz. Passt auch zum Thema. Genau wie der Streifenwagen, der immer auf dem Gehweg steht. Zwei Polizisten, die den ganzen Tag aufpassen, dass bei der Synagoge nichts passiert. Edgar fragt mich manchmal, ob zwei Polizisten reichen würden, wenn tatsächlich mal was wäre. Wohl eher nicht. Vermutlich sind vier Polizisten einfach zu teuer. Also stellt man zwei hin. Gar keine Bewachung käme bestimmt nicht gut an beim Zentralrat der Juden. Edgar darf das sagen, immerhin ist er selbst einer. Trotzdem ein Reizthema. Am besten, man schneidet es gar nicht erst an.
Der Bus fährt weiter, gleich erreicht er den Zebrastreifen. Edgar könnte auch mit der S-Bahn in die Schule fahren. Am Marienplatz fahren sie alle. Es würde bestimmt schneller gehen, der Weg mit dem Bus ist weit. Edgar ist zwei Mal täglich über vierzig Minuten unterwegs. Aber er muss nicht umsteigen. Und Edgar hasst es umzusteigen. Da sitzt er lieber eine Dreiviertelstunde lang einfach nur da und hört Musik. Abgesehen davon erinnert ihn diese Buslinie an seine Mutter. Irgendwann hat sein Vater mal erwähnt, dass sie eine Freundin in der Gegend hatte. Und wenn sie die besucht hat, hat sie immer den 62er-Bus genommen. Vermutlich romantisiert er das. Dazu neigt man ja, wenn jemand tot ist.
Ja, seine Mutter ist tot. Sie ist von ihnen gegangen, kurz bevor Edgar laufen konnte. Laut seiner Tante hat er am Tag ihrer Beisetzung seine ersten Schritte gemacht. Vielleicht wollte er wegrennen. Oder sie suchen. Er erinnert sich nicht mehr. Er war damals so klein, dass er sie nicht mal vermisst. Was ihn irgendwie nervt. Als wäre er um das angemessene Gefühl der Trauer betrogen worden.
Ihr hat er seinen Namen zu verdanken. Edgar. Nach Degas. Sie hat seine Bilder geliebt. Sein Vater wollte ihn Adam nennen. Ein Glück, dass er sich nicht durchgesetzt hat. So hat Edgar wenigstens ihren Namen, wenn er sie schon nie hatte. Seine Mutter ist tot und irgendwie trotzdem überall. Wie Glasscherben, die man erst bemerkt, wenn man barfuß in sie hineingestiegen ist. Jeder Versuch, über sie zu sprechen, hinterlässt viele kleine Wunden. Sein Vater und er reden nicht darüber, aber die ganze Wohnung hängt voll mit Fotos, die beweisen, dass es sie gab. Die zeigen, dass das, was seine Tante immer wieder sagt, nämlich, wie ähnlich er ihr sieht, stimmt. Dieser Fremden, in der er mal herangewachsen ist. Und manchmal, ganz selten, da erinnert er sich doch an etwas. Wobei erinnern eigentlich zu viel gesagt ist. Es sind keine konkreten Bilder, nur Gefühle, die unvermittelt und ohne jeden Zusammenhang in ihm aufsteigen wie Luftblasen aus der Tiefe. Irgendwelche Erinnerungen, die so weit weg sind, dass er sie nicht mehr greifen kann. Wie ein Gedanke, den man eben hatte und der dann auf einmal weg ist. Lediglich das Wissen, dass es ihn gab, ist noch da, so wie ein Nachgeschmack, während der Inhalt sich längst in Nichts aufgelöst hat.
Nur so kann Edgar sich erklären, warum er bei dem Geruch von warmem Milchreis mit Zimt ausnahmslos jedes Mal weinen muss. Ähnlich verhält es sich bei einer bestimmten Sonnencreme. Und wenn die Linden blühen. Dann schmerzt es plötzlich so tief und so sehr, dass er sich sicher ist, dass es etwas mit ihr zu tun haben muss. Dass sein Unterbewusstsein noch etwas weiß, das er schon lange vergessen hat.
Edgar wollte seinen Vater oft danach fragen, aber er hat es dann nie getan. Er will ihn nicht daran erinnern, dass sie weg ist – als müsste er ihn daran erinnern. Als wäre ihre Abwesenheit nicht ohnehin in jedem Winkel dieser viel zu großen Wohnung spürbar. Das Fehlen eines Menschen kann größer sein als der Mensch selbst. Als hätte es einen Verstärker. So eine Art Echo.
Der Bus biegt rechts in Richtung Viktualienmarkt ab, und Edgar drückt den Stopp-Knopf. Abgesehen von ihm und der alten Dame mit Hund, die ganz vorne sitzt, ist niemand da. Die Straße ist voll mit Fußgängern. Für sie ist es keine Straße, für sie ist es eine Verlängerung der Fußgängerzone. Die letzten Meter ziehen sich jedes Mal hin. Deswegen bleibt Edgar möglichst lange sitzen. Die Digitalanzeige wechselt auf Viktualienmarkt, die Schirme und Stände kommen näher, in der Mitte ragt der Maibaum weiß-blau in den bedeckten Himmel wie eine Lanze, die versucht, ihn zu durchdringen.
Edgar sieht seine Haltestelle, rappelt sich auf und geht zum Ausstieg. Dabei hält er sich abwechselnd an den Stangen fest, links, rechts, links, rechts. Dann fällt sein Blick auf den Platz, auf dem sie vor ein paar Minuten noch saß. Und in genau dem Moment, als der Bus zum Stehen kommt und die Türen sich für Edgar öffnen, bemerkt er den Jutebeutel auf dem Sitzplatz am Fenster.
Sie hatte also doch einen dabei.
14:14 Uhr
Als es Julia auffällt, bleibt sie so abrupt stehen, als wäre sie in vollem Lauf mit jemandem zusammengestoßen. Ein paar Sekunden lang bewegt sie sich nicht, steht einfach nur da, mitten auf dem Gehweg, ein gelähmter Körper, keine Gedanken mehr und gleichzeitig zu viele. Dann trocknet ihr Mund aus, und ihr Herz beginnt zu rasen. Sternchen mitten am Tag, ein farbloses Flirren vor einem grauen Himmel.
Sie sieht sich noch auf den Stopp-Knopf drücken, sieht sich dabei zu, wie sie aufsteht und absichtlich nicht zu Edgar schaut, überall hin, nur nicht zu ihm. Sie sieht sich, wie sie dem enttäuschten Ausdruck in seinen Augen ausweicht, und wie sie dann wenig später aussteigt.
Ohne ihre Jutetasche.
»Nein«, sagt sie seltsam tonlos. Und noch mal, leiser: »Nein.«
Dann dreht sie sich um und rennt zurück in Richtung Haltestelle. Und während sie rennt, schießen ihr einzelne Sätze durch den Kopf. Es sind ihre Worte. Hart und ehrlich. Sie hinterlassen ein Gefühl wie Einschusslöcher.
Als Julia die Straßenecke erreicht, kann sie kaum noch atmen. Sie hat Seitenstechen, die Baumkronen der Platanen pulsieren, eine einzelne Schweißperle läuft ihr über die Schläfe, und das kitzelnde Gefühl passt nicht zum Moment. Julia hält sich die Seite und starrt auf das leere Bushäuschen. Es steht da wie ein stilles Sinnbild für zu spät.
Natürlich ist es zu spät. Sie selbst hat den Bus wegfahren sehen. Das war erst vor ein paar Minuten. Und dann fragt sie sich, ob sie ihn noch einholen könnte, wenn sie zurückläuft und das Fahrrad holt. Aber etwas in ihrem Kopf sagt Nein. Sie hätte gleich das Rad nehmen sollen. Warum hat sie nicht daran gedacht? Hätten sie nicht umziehen müssen, hätte sie den Rollerschein zu Ende gemacht. Mit dem Roller hätte sie ihn eingeholt. Nur, dass es dann gar nicht erst passiert wäre, weil sie in dem Fall nie in diesem gottverdammten Bus gesessen hätte. Weil ihr Leben dann anders weitergegangen wäre – nämlich so wie vorher. Sie in ihrer alten Wohnung, die so viel mehr Zuhause war, inmitten ihrer Freunde, die ihr damals viel mehr wie Freunde vorkamen. Doch dann denkt sie an Edgar. Daran, dass sie ihn vor ein paar Wochen noch nicht kannte. Und wie gern sie ihn jetzt hat. Wäre sie nicht hierher umgezogen, hätte sie auch nichts über ihn geschrieben, weil er in ihrem Leben keine Rolle gespielt hätte. Er wäre ein Fremder geblieben. Ein Gesicht in der Masse. Jetzt, da sie ihn mag, wäre das bedauerlich. Andererseits wüsste sie das nicht.
Edgar. Vielleicht hat er die Jutetasche ja bemerkt. Vielleicht hat er sie mitgenommen. Julia stellt sich vor, wie er beim Aussteigen an dem Platz neben dem Ausgang vorbeikommt. Wie er dasteht und darauf wartet, dass sich die Türen öffnen, und wie er den Beutel dann sieht. Auf dem Sitz neben dem Fenster. Wo eigentlich er hätte sitzen sollen. Wo er auch gesessen wäre, wenn er und sie zusammen nach Hause gefahren wären. Dann hätte Edgar gesagt: Julia, warte, deine Tasche. Und dann hätte sie sie jetzt noch. Doch sie sind nicht zusammen nach Hause gefahren, weil sie sonst mit ihm hätte reden müssen. Und sie konnte nicht mit ihm reden. Weder mit ihm noch mit sonst jemandem. Schon gar nicht darüber.
Julia schiebt den Gedanken weg und denkt den vorherigen weiter. Wenn Edgar den Jutebeutel gesehen hat, hat er ihn auch mitgenommen, da ist sie sich sicher. Und wenn er ihn mitgenommen hat, wird er hineinschauen. Die Frage ist, was er danach tun wird. Nachdem er hineingeschaut hat. Würde er den Laptop öffnen? Nein, das würde er nicht. Nicht Edgar. Aber wenn er es nun doch tut? Dann wird er die Einträge sehen. Jedes Wort, das sie geschrieben hat.
Julia schließt kurz die Augen.
Sie hat sich nicht bei Wordpress abgemeldet. Sie hat noch kurz darüber nachgedacht, es dann aber gelassen, weil Leonard nach dem Duschen zurück ins Zimmer kam. Er hat ihr über die Schulter geschaut, und da hat sie schnell auf irgendeinen anderen Post geklickt und den Laptop danach zugeklappt. Vor ein paar Wochen wäre das alles kein Problem gewesen. Da hätte der Laptop beim nächsten Öffnen das Passwort verlangt. Aber das hat sie so genervt, dass sie es deaktiviert hat. Nicht einfach nur den Zeitraum verlängert, nein, sie hat die Sicherheitsabfrage einfach komplett abgestellt. So als hätte sie es insgeheim darauf angelegt, dass jemand ihre Gedanken liest. Julia fragt sich, was sie an Edgars Stelle tun würde. Wenn sie seinen Laptop hätte. Sie würde ihn nicht öffnen. Sie wäre neugierig, aber sie würde es nicht tun. Edgar wird es auch nicht tun. Nein, er nicht.
Und doch bleibt ein winziger Restzweifel. Wie feuchter Dunst, der sich an einer Fensterscheibe absetzt, wenn es geregnet hat. Letzten Endes sagt sie sich, dass der Akku vermutlich ohnehin bereits leer ist. Vielleicht hofft sie das aber auch nur.
Julia steht noch immer an der Ecke und starrt auf das Bushäuschen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Als wäre es nicht wahr, wenn sie sich nur lange genug nicht von der Stelle rührt. Aber es ist wahr. Und dann hofft sie, dass Edgar den Beutel übersehen hat. Dass er ohne ihn ausgestiegen ist. Und dass der Beutel einfach verschwindet. Irgendwo in irgendeinem Fundbüro des MVV.
Doch sie glaubt nicht, dass er ihn übersehen hat. Edgar ist keiner, der Dinge übersieht. Er hat ihn ganz bestimmt bemerkt. Und wenn er ihn bemerkt hat, hat er ihn auch mitgenommen – was jedoch nicht bedeuten muss, dass er die Einträge liest.
An diesem Gedanken hält Julia fest. Sie klammert sich daran.
Und geht dann nach Hause.
Die anderen
Vincent: Ich kenne sie im Grunde ja gar nicht. Habe nie mit ihr geredet. Mir ist immer nur ihr Riesenbusen aufgefallen.
Janina: Ich fasse es nicht, dass sie das geschrieben hat. Ich meine, es waren ja nicht nur ihre Geheimnisse, die da veröffentlicht wurden, sondern auch die von anderen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie so eine ist.
Momo: Verdient hat sie es. Ich glaube, das denkt jeder. Jetzt weiß sie endlich, wie es sich anfühlt, fertiggemacht zu werden. Ich mochte sie nie besonders, das ist kein Geheimnis. Nein, ich habe kein Mitleid mit ihr.
Linda: Also mir tut sie schon irgendwie leid. Was komisch ist, weil ich sie nie mochte. Aber es war so etwas wie ein Tagebuch. Sollte man nicht wenigstens in ein verdammtes Tagebuch seine Gedanken reinschreiben können, ohne Angst davor haben zu müssen, dass jemand sie liest?
Edgar: Es denkt doch sowieso jeder, dass ich es war.
14:32 Uhr
Die Wohnung ist dunkel, als Julia ankommt. Zweieinhalb leere Zimmer und ein Zettel auf dem Küchentisch. Das »J« in der oberen rechten Ecke heißt, dass er für sie bestimmt ist. Sie greift danach und liest: Joghurt, Quark, Brot, Eier, Aufschnitt. Das Wort Aufschnitt hat ihre Mutter doppelt unterstrichen, weil Julia dazu neigt, ihn zu vergessen. Sie und ihre Mutter wissen beide, dass es Absicht ist. Dass Julia sich dagegen wehrt, tote Tiere einzukaufen. Doch ihre Geschwister mögen die nun mal gern, auch wenn sie gar nicht wissen, was sie da essen.
Julia steht da und starrt auf den Zettel. Und der Moment scheint ihr seltsam absurd. Als wäre ihr Leben ein Wagen, der mit rasender Geschwindigkeit auf einen Abgrund zurast, und sie soll zum Lidl gehen. Separatorenfleisch kaufen, das sich ihre kleinen Geschwister dann in Scheiben auf ihre Brote legen können. Zusammengeklebten Abfall, für den ihre Mutter auch noch Geld bezahlt. Es ist ekelerregend.
Julia verharrt ein paar Sekunden neben dem Tisch. Wie angeschossen. Nur das schnelle Ticken der Uhr füllt die Stille. Julia greift nach den zwanzig Euro, die ihre Mutter unter den Einkaufszettel gelegt hat, und steckt sie ein, dann nimmt sie eine leere Jutetasche vom Garderobenhaken im Flur. Bei seinem Anblick schluckt sie. Ihre Kehle umgibt ein Kloß aus Zorn und der Angst vor dem, was passieren könnte. Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht bleiben ihre Gedanken und Geheimnisse ja einfach bis zur Endstation auf dem blauen Buspolster liegen. Und dann findet sie der Fahrer. Ein älterer Mann, den ihre Sicht auf die Welt kein bisschen interessiert, weil er eigene Sorgen hat. Echte Sorgen. Vielleicht läuft es ja so. Oder aber Edgar liest sie, diese Gedanken, die ihr oftmals schon beim Schreiben peinlich waren. Jeder Eintrag ein Schwall aus erbrochenen Worten.
Julia hat sich oft gefragt, wie es wohl wäre, wenn man alles laut sagen würde, was man denkt. Wenn man kein Blatt vor den Mund nimmt und keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten anderer. Und in ihrer Vorstellung war das irgendwie befreiend gewesen. So, als würde man erst dann wirklich zu sich selbst stehen, wenn man seine Meinung laut ausspricht. Aber in diesem Moment wird ihr klar, dass das eigentlich Besondere an Gedanken ist, dass man sich aussuchen kann, mit wem man sie teilt – und ob man es tut. Nicht wie sein Äußeres, das jeder sehen kann, ganz einfach, weil es da ist. Ganz plump und offensichtlich, so wie ihre Brüste an ihrem Oberkörper. Diese sexuelle Ablenkung von ihrem Gesicht. Julia hat sich mit der Zeit an die Blicke gewöhnt. Und auch an die seltsame Stille, die ihnen folgt.
Als Kind hatte Julia Ballettunterricht. Da war sie noch ein zierliches Geschöpf mit filigranen Gliedmaßen und knochigen Beinen. Mit dreizehn hat sie damit aufgehört, weil ihr Körperbau nicht mehr passte. Sie wurde ganz weich und rund, etwas, das man vielleicht gern anfasst, aber sicher nicht in ein Tutu steckt. Davor war Julia einfach nur ein Mensch. Irgendwas zwischen Kind und Frau, das niemanden interessierte. Und dann veränderte Julia sich. Von außen und von innen. Auf einmal war sie voll mit einer Lust, für die sie sich auf eine besonders tiefe Art schämte. Es war, als würde sie immer weiter in ihr aufsteigen, bis sie überlief. Sie schaute heimlich Sex-Videos im Internet und löschte danach den Verlauf, damit ihr niemand auf die Schliche kommen konnte. Am liebsten mochte sie Videos, in denen Männer sich selbst befriedigten, konnte sich aber nie wirklich erklären, warum. Manchmal schrieb sie darüber. Über das, was sie dachte und tat. Weil sie so fasziniert und überfordert davon war. Von sich selbst und ihrem Körper, von seiner befremdlichen neuen Wirkung auf andere und vom monatlichen Bluten. Sie schrieb über das Einführen von Tampons und Unterleibsschmerzen. Und über Gefühlsschwankungen, die sie manchmal so plötzlich trafen wie eine Ohrfeige. Es tat gut, das alles loszuwerden, eine Deponie dafür zu finden.
Julia zieht die Wohnungstür hinter sich zu. Sie verlässt das Haus und geht die Straße hinunter in Richtung Lidl. Das graue Wetter steht stur zwischen den Häusern, als wäre die Luft zu dick, um sich zu bewegen. Vor ein paar Monaten war ihr Leben noch richtig toll. Eine Lüge, ja, aber eine richtig gute. Es war die Art von Leben, die andere sich gern überziehen würden wie einen Handschuh. Und dann kam diese beschissene Eigenbedarfskündigung und ein paar Wochen später der Umzug hierher. Zu viert in diese winzige Wohnung, die gerade mal halb so groß ist wie ihre alte. Zweieinhalb Zimmer und zweiundsechzig Quadratmeter. Das halbe Zimmer gehört ihr. Die Kleinen teilen sich das große, und ihre Mutter klappt sich jeden Abend das Schlafsofa im Wohnzimmer aus. Sie wollte, dass Julia etwas Privatsphäre hat. Raum für sich, hat sie es genannt. Aber eigentlich ist es mehr so etwas wie eine Speisekammer, in der sie schläft. Sechs, vielleicht sieben Quadratmeter zwischen Küche und Bad. Bei der Besichtigung fiel das Wort »Hauswirtschaftsraum«. Ihr halbes Zimmer hat eine Tür, ein kleines Fenster und keine Heizung. »Da holen wir dir noch eine, bevor es kalt wird«, sagt ihre Mutter jeden zweiten Tag. »So eine kleine elektrische. Die kriegen wir da schon irgendwie unter.« Julia will gar nicht an den Winter denken. Und auch nicht an morgen. Und am wenigsten an den Termin am Freitag.
Am liebsten würde sie zurückspulen. Dann wäre sie jetzt nicht in dieser Situation. In ihrem alten Leben war es besser. Das stimmt. Und trotzdem fühlt Julia sich undankbar, wenn sie das denkt, weil ihre Mutter wirklich tut, was sie kann – sogar mehr als das. Sie arbeitet wie eine Verrückte und beschwert sich nie. Abends kocht sie für sie alle, und danach lesen sie oder Julia den Kleinen etwas vor. Sie fragt sich, wie ihre Mutter das schafft. Julia hilft und jobbt ab und zu nebenher, aber besonders viel bringt es nicht ein. Nicht genug, um von echter Unterstützung sprechen zu können.
Julias Mutter sagt, die neue Gegend ist wie ein Dorf in der Stadt. Und irgendwie stimmt das. Es gibt keine U-Bahn und keine S-Bahn. Nur den Bus. Und viele Fahrräder. Und ACAB-Tags an den gekachelten Wänden der uralten Unterführungen. Anfangs wusste sie nicht, was das bedeutet, doch dann hat Edgar es ihr erklärt.
Julia weiß, dass sie ohne den Kollegen ihrer Mutter nicht mehr in München wären. Dann wären sie nach Landsberg am Lech gezogen. Sie hatten dort sogar schon ein paar Wohnungen besichtigt. Julia hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Wegen ihrer Freunde. Und wegen Leonard. Und jetzt weiß sie nicht mal, ob sie diese Menschen überhaupt mag. Also, wirklich mag. Nicht nur an der Oberfläche, sondern tiefer. Diese echte Art von Mögen, die Julia gerade erst so richtig kennenlernt. Vielleicht hat sie sie mal gemocht. Oder sie wollte sie nur mögen. So wie sie sich damals in Leonard verlieben wollte, was aber leider nicht passiert ist. Als der sie das erste Mal oben ohne gesehen hat, hat er laut geschluckt. Daran erinnert sich Julia noch genau. An dieses kehlige, durstige Geräusch. Es war wie ein seltsames Kompliment an sie gewesen. Er saß ihr in Boxershorts gegenüber, und seine Erektion hat sich nach ihr ausgestreckt. Und irgendwie hat sie sich davon geschmeichelt gefühlt. Davon, dass sie der Grund dafür war.
Vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt gewesen, nach Landsberg am Lech zu ziehen. Dann hätten sie sich getrennt, Leonard und sie. Und nicht miteinander geschlafen. Kein erstes Mal. Und auch danach nicht mehr. Sie hätte nicht all diese schrecklichen Dinge über ihn geschrieben, weil nichts davon je passiert wäre. Doch leider ist alles wahr. Und es ist passiert.
In der Sekunde, als sie das denkt, summt ihr Handy. Schon wieder er. Er ruft bereits zum vierten Mal an. Und sie geht bereits zum vierten Mal nicht hin. Leonard wird sich Sorgen machen, aber sie kann im Moment nicht mit ihm reden. Es gibt Probleme, die sind zu groß, um sie mit anderen zu teilen. Die passen nicht in ein Gespräch. Genau genommen passen sie nicht mal in ein ganzes Leben.
Julia steckt das Handy ein und biegt rechts auf den Lidl-Parkplatz. Er ist riesig und halb leer. Während sie sich dem Flachbau nähert, versucht sie, nicht daran zu denken, welche Folgen es haben könnte, dass sie ihren Laptop im Bus hat liegen lassen. Sie kann ihrer Mutter nicht davon erzählen. Genauso wenig wie von dem Termin in drei Tagen. Und dann schießt ihr durch den Kopf, dass Edgar vielleicht gerade den Eintrag von Montagmorgen liest. Und bei diesem Gedanken wird ihr ganz plötzlich übel. Es ist die Stufe, kurz bevor man kotzen muss. Wenn sich der Speichel bereits im Mund sammelt. Julia macht ein paar Schritte zu einem Gebüsch und spuckt ins trockene Gras. Die Sonne scheint durch milchige Wolken auf sie herunter, sie brennt auf ihre Haare, diese ungewöhnliche Hitze zu dieser Jahreszeit. Ein Mai wie ein Juli. Sie spuckt noch einmal aus. Und dann denkt sie, dass das eigene Gehirn bei aller Transparenz der vielleicht letzte wirklich private Ort ist, den man hat. Und sie hat ihres ausgeleert, sich im Internet ausgeschüttet, als wäre es ein sicherer Platz für ihre Gedanken.
Julia spürt einen Blick auf sich und zwingt sich weiterzugehen. Die Frau in dem roten Auto schaut ihr nach, besorgt, wie eine Mutter schauen würde, dann verlässt sie den Parkplatz, und die kurze Überschneidung ihrer beiden Leben endet.
Julia hat Edgars Handynummer nicht. Wenn sie sie hätte, könnte sie ihn fragen, ob er die Jutetasche mitgenommen hat. Aber sie hat ihn nie nach seiner Nummer gefragt. Weil sie nur im Bus miteinander befreundet waren. Dafür war er ihr gut genug. Jedoch nicht für ihre Scheinwelt. Julia hätte es verdient, wenn er nie wieder mit ihr spricht. Sie würde auch nicht mehr mit sich reden, wenn sie er wäre. Andererseits hätte Julia das an seiner Stelle von Anfang an nicht getan. Als sie das denkt, erreicht sie endlich die elektrische Schiebetür des Discounters. Und da geht ihr durch den Kopf, dass es fast beeindruckend ist, wie wenig man von sich selbst halten kann.
Zeitgleich
Linda sitzt auf dem Fensterbrett, sie hat ihre nackten Füße auf dem dicken Ast direkt davor abgestellt, und balanciert die Schüssel mit der Pasta auf den Knien. Sie hat doch noch ein paar Kirschtomaten aufgeschnitten und Bergkäse gerieben. Und jetzt sieht sie dabei zu, wie der langsam schmilzt und sich an die Nudeln klebt. Er wird zu einer würzig riechenden Schicht, die Linda jeden Moment mit ihrer Gabel durchstoßen wird. Sie spießt drei Nudeln auf, der Käse zieht feine Fäden, dann steckt sie sie sich in den Mund. Ihre Mutter wird später vermutlich noch einen Löffel Schmand unterrühren. Und ihr Vater Schnittlauch darauf geben.
Linda hört »The World to Come« von Fredrika Stahl und isst, während die Blätter sanft im Wind erzittern – ein wohliges Geräusch, das Linda fast so liebt wie einen Menschen. Es ist ein guter Moment. Die intensive Wärme des Frühsommers, die heiße Luft an ihren nackten Waden, das Lied, das irgendwie melancholisch ist und irgendwie schön. Und der Geschmack des Käses, der auf eine seltsam irrationale Art perfekt zum Rascheln der Baumkrone passt. Nach der halben Portion ist Linda satt und hätte gern einen größeren Magen, weil es so gut ist. Ein zufriedenes, träges Gefühl macht sich in ihr breit. Ungefähr so stellt sie es sich vor, eine Katze zu sein.
Als ihr Handy vibriert, unterbricht die eintreffende Nachricht kurz den Song, dann läuft er weiter, als wäre nichts gewesen. Linda stellt die Schüssel zur Seite. Bestimmt ist es Momo, die ihr schreibt, dass sie sich verspätet.
Momo heißt eigentlich Simone. Eine ganze Weile wusste Linda das nicht. Erst als sie irgendwann mal ihren Personalausweis gesehen hat. Momos richtiger Name ist Simone Bergmann. Als sie klein war, hat sie sich selbst Momo genannt, weil sie Simone nicht aussprechen konnte. Dabei ist es dann irgendwie geblieben. Linda liebt solche Spitznamen. Spitznamen, die eine Bedeutung haben. Sie selbst heißt Linda, und alle nennen sie Linda – das ist nicht gerade einfallsreich.
Ihr Blick fällt auf die Uhr. In eineinhalb Minuten ist Momo zu spät. Sie verspätet sich ständig. Eigentlich ist es fast ein Witz, dass sie ihr das überhaupt noch schreibt. Sinnvoller wäre es, nur dann eine Nachricht zu schicken, wenn sie pünktlich kommt. Das würde ihr sehr viel Zeit sparen. Auf Momo zu warten, ist für Linda in den vergangenen Monaten zu so etwas wie einem kranken Hobby geworden.
Die Sache mit Momo und ihr ist kompliziert. Eine von ihnen ist eigentlich immer damit beschäftigt, der jeweils anderen irgendwas zu verzeihen. Oder vorzuwerfen. Mit Edgar war das nie so. Linda und er waren ausgeglichen gewesen wie zwei Waagschalen. Was Linda irgendwann gegen Ende entsetzlich langweilig fand. Das würde sie Edgar so natürlich niemals sagen. Abgesehen davon war es ja nicht nur langweilig. Auch am Ende nicht. Es war auch schön. Auf eine sehr berechenbare gemütliche Art und Weise. So wie eine Tasse Tee schön ist. Oder Wollsocken. Momo und sie sind das andere Extrem. Nicht wie zwei Waagschalen, eher wie eine Wippe. Die meiste Zeit stehen sie an irgendeinem Abgrund, irgendwo zwischen zu gut, um wahr zu sein, und dem nächsten großen Drama. Als hätten sie beide einen Kippschalter im Gehirn, den die jeweils andere nur zu gern umlegt. Wenn sie sich verstehen, verstehen sie sich ohne Worte. Und dann verstehen sie sich wieder gar nicht. Kein Wort mehr, ganz gleich, wie gut sie gewählt sind.
Linda war vor Momo nur mit Edgar zusammen, daher weiß sie nicht, ob das bei Mädchen vielleicht immer so ist. Zwei hormonelle Zeitbomben, die sich gegenzeitig zünden. Das könnte natürlich sein. Oder aber, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Linda schaut auf das Display ihres Handys und liest:
MOMO BERGMANN:
Ich hab meine Roller-Schlüssel nicht gefunden. Tut mir leid. Bin gleich da.
Zur Antwort schickt Linda ihr nur ein Ok. Mehr nicht. Und dann fragt sie sich, ob sie absichtlich gemein zu ihr ist. Ob sie es ihr extra schwer macht.
Momos Reaktion folgt nur ein paar Sekunden später.
MOMO BERGMANN:
Ich mache es wieder gut.
Bei dem Anblick des kleinen Zungen-Icons muss Linda lachen. Und etwas tief in ihrem Bauch zieht sich zusammen, als sie sich Momos Gesicht zwischen ihren Beinen vorstellt.
Linda hat immer irgendwie gewusst, dass sie auf Mädchen steht. Zumindest auch. Auf Mädchen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als auf Jungs. Vielleicht steht sie aber auch einfach nur mehr auf Momo als damals auf Edgar. Wieder etwas, das sie ihm niemals sagen würde.
Jedenfalls hat sie es immer gewusst. Anfangs nur ganz neblig, wie ein Dunst, der alles durchdringt, der aber nicht wirklich greifbar ist. Früher hat sie sich darüber keine Gedanken gemacht. Sie hat einfach gern Brüste angeschaut und diese Tatsache nicht weiter hinterfragt. Weil vielleicht ja jeder gerne Brüste anschaut. Sie sind ja auch schön.
So richtig bewusst ist es ihr erst geworden, als ihre Mutter sie dann dazu gezwungen hat, mit ihr ins Fitnessstudio zu gehen. Vielleicht ist gezwungen das falsche Wort. Wobei, nein, eigentlich trifft es das ziemlich genau.
Linda war damals zwölf. Ein blasses Mädchen mit vorhangartigen Haaren und abgenagten Fingernägeln. Wenn sie heute alte Bilder von sich sieht, will sie sich auch mobben. Sie darf das sagen, immerhin geht es um sie. Ihre ersten sieben Schuljahre waren scheiße. Vom Wesen her war Linda dünn wie ein Windhauch, dafür hat sie rein körperlich umso mehr Angriffsfläche geboten. Sie war ein dickes Kind. Vielleicht auch nur mollig. Aber das hat gereicht. Da war kein bestimmter Anlass, kein Streit, kein blöder Kommentar ihrerseits. Nur ein schweigsames dickes Kind. Als wäre das eine universelle unausgesprochene Einladung für andere, mal reinzuschlagen. Mit den Fäusten oder verbal. Bei Linda waren es keine echten Schläge – wenn man davon absieht, dass Philipp Weber beim Schulausflug nach ihr getreten hat. Aber erstens hat er sie verfehlt, was bei ihrer damaligen Körperfülle nicht gerade für seine Treffsicherheit spricht, und zweitens war es echt nur ein Mal. Rein körperlich betrachtet ist sie also eigentlich ganz gut davongekommen. Wobei sie ihre Speckschicht vermutlich besser gegen ihre Tritte hätte schützen können als gegen die Spitzen, die in Form von Worten viel tiefer in sie drangen. So tief, dass sie irgendwann zu Wahrheiten wurden. Weil es manchmal reicht, etwas oft genug zu hören, damit es stimmt. Es muss nicht wirklich wahr sein. Es genügt, es zu glauben. Und Linda hat es geglaubt. Dass sie hässlich ist und fett und schwach. Dass alles an ihr schwabbelt, sogar ihr Gehirn. Komischerweise hat sie das am meisten getroffen. Dass ihr Gehirn schwabbeln könnte. Aus dem Jetzt betrachtet, war das nicht mal besonders originell. Aber sie war damals erst sieben. Und da hat es wehgetan.
Linda hat ihren Eltern nie etwas davon erzählt, weil sie Angst davor hatte, dass die dann etwas dagegen unternehmen würden, weil Erwachsene zu so etwas neigen. Die kommen dann mit Lösungen, die nichts bringen. Sprechen mit der Lehrerin, mit den Eltern der anderen Kinder, oder schlimmer noch: mit den Kindern selbst. Nur, dass das nichts geändert hätte. Man bekämpft Arschlöcher nicht mit Vernunft, das hat Linda früh verstanden.
Ihre Mutter bemerkte irgendwann, dass etwas nicht in Ordnung war. Sie hat gesagt, Linda sei wie ein Foto gewesen, das mit der Zeit immer blasser wurde. Als würde die Schule einen Teil ihrer Tochter ausradieren. Und als würde jeden Tag etwas weniger von ihr nach Hause kommen. Am Gymnasium wurde es noch schlimmer. Aber Linda hat weiterhin geschwiegen. Sie hat es für sich behalten. Doch irgendwann ist es aus ihr herausgebrochen. Als wäre sie ein Knoten, der endlich geplatzt ist.
Linda erinnert sich nicht mehr an die Einzelheiten, sie weiß nicht, warum sie ihrer Mutter ausgerechnet an dem Tag davon erzählt hat, ob es einen bestimmten Grund gab oder ob das Maß einfach voll war. Es war in der siebten Klasse, das weiß sie noch, und auch, dass sie nebeneinander im Auto saßen – in dem alten Honda Civic ihrer Mutter, den sie gefahren ist wie einen Rennwagen. Linda weiß noch, dass sie angefangen hat zu heulen und dass sie dann einfach nicht mehr aufhören konnte. Dass sie geschluchzt hat. Dass ihr ganzer Körper bebte.