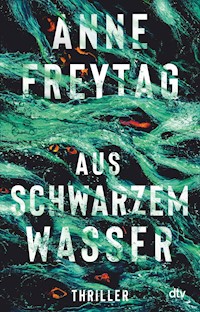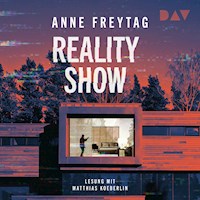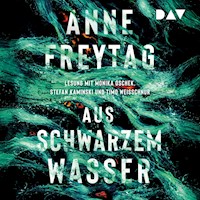13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Rosa und Frank begegnen sich am anderen Ende der Welt. Durch Zufall oder weil es so sein soll. Sie sind sich ähnlich und doch grundverschieden – Rosa widersprüchlich, Frank ruhig. Zusammen sind sie nicht nur weniger allein, sondern ziemlich nah dran an vollständig. Sie beschließen, gemeinsam weiterzureisen und einen alten Camper zu kaufen. Doch dann taucht unerwartet Franks bester Freund David auf, und mit ihm ändert sich alles. Sind drei einer zu viel oder hat genau er noch gefehlt? Diese Frage stellt sich immer wieder, während sie zu dritt Tausende Kilometer durch Australiens unendliche Weite fahren, vor ihnen nur der Horizont, über ihnen nichts als Himmel und zwischen ihnen mehr, als Worte je beschreiben könnten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
DAS BUCH
Manchmal sucht man sich seine Weggefährten nicht selbst, manchmal tut es das Leben. So ist es auch bei Rosa und Frank. Die beiden begegnen sich in Sydney, ohne einander gesucht zu haben, und beschließen schon bald darauf, zusammen weiterzufahren. Sie kaufen einen alten Camper und bereiten gerade alles für die Reise vor, als unerwartet David auftaucht – Franks bester Freund und sein absolutes Gegenteil. Laut, witzig, offen und erfahren. Ein Teil von Frank will, dass er verschwindet, der andere, dass er bleibt. Und er bleibt.
Sind drei einer zu viel, oder hat genau er noch gefehlt? Das ist nur eine der Fragen, die Rosa, Frank und David sich auf ihrem gemeinsamen Weg durch Australien stellen. Einem Weg, der sie an ihre Grenzen und an einzigartige Orte führt, der sie fordert und miteinander verbindet. Ein Weg, der sie für immer verändern wird ...
Als hätte man auf Pause gedrückt – Anne Freytag feiert in ihrem neuen großen Roman eine Zeit, wie es nur sie nur einmal gibt: die Zeit zwischen der Schule und allem, was danach kommt.
DIE AUTORIN
Anne Freytag hat International Management studiert und als Grafikdesignerin und Desktop-Publisherin gearbeitet, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Erwachsenen- und All-Age-Romanen widmete. Für ihre ersten beiden Jugendbücher wurde die Autorin zwei Mal in Folge für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Für ihren dritten All-Age-Roman »Nicht weg und nicht da« erhielt sie den Bayerischen Kunstförderpreis 2018 in der Sparte Literatur.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Anne Freytag
Copyright © 2019 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Martina Vogl
Umschlaggestaltung und Illustrationen: Ann-Kathrin Hahn,
Das Illustrat, München
Innenillustrationen: Das Illustrat, München
Zitatnachweis [[siehe hier]]: Copyright © 1952 John Steinbeck,
East of Eden
Zitatnachweis [[siehe hier]]: Robert Seethaler, Das Feld
Copyright © 2018 Hanser Verlag Berlin, S. 234
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-23354-9V003
www.heyne-fliegt.de
Für alle, die ihren Weg noch suchen.
Ihr findet ihn zwischen den Zeilen.
»And now that you don’t have to be perfect,
you can be good.«
JOHN STEINBECK
Es ist noch gar nicht so lange her,
da war Rosa nur eine Farbe
und David mein bester Freund.
Seitdem ist viel passiert.
27. Mai. Noch zwei Tage.
Es fühlt sich an wie das Dach der Welt. Und wir stehen oben drauf. Ganz oben. Nebeneinander in einer mondlosen Nacht. Und das Gefühl ist so groß und laut, wie die Weite still ist. Ich war schon oft glücklich in meinem Leben, aber das hier ist anders. Wie ein Glas, das so voll ist, dass es überläuft. Die Sterne fließen langsam über den Horizont. Man kann dabei zusehen, wie sie hinter dem Rand der Welt verschwinden. Und die Milchstraße über unseren Köpfen scheint so nah, als könnten wir mit den Fingerspitzen in sie eintauchen wie in einen Teich. Unser Lagerfeuer brennt orange und rot in die Dunkelheit, es flackert in ein Blau, das fast schwarz ist, erhellt unsere Gesichter, dann sind sie wieder dunkel.
Außer uns ist niemand da. Und es fühlt sich an, als wären wir allein auf der Welt. Drei Punkte, die man vergessen hat. Die Funken steigen in den Himmel, und der Song, den wir hören, hallt aus den Lautsprechern in das weite Nichts um uns herum. Es ist ein Gefühl, als könnte ich lachen und weinen, und beides wäre richtig. Beides würde passen. Beides wäre ich. Es sind nur noch zwei Tage. Zwei Tage, dann sind wir vorbei. Dann gehen wir wieder zurück, jeder dahin, wo er hergekommen ist.
Aber noch nicht. Noch sind wir hier, stehen Hand in Hand auf dem Dach unseres Campers. Verwaschene Umrisse mit Mückenstichen und gebräunter Haut irgendwo im Outback. Die Musik unterstreicht die Stimmung und die Farben und die vergangenen Monate. Sie untermalt uns wie ich in mein Buch.
Es läuft dasselbe Lied, das ich ein paar Wochen vor meiner Abreise gehört habe. Damals, als ich noch nicht wusste, was kommt.
Und dann kam alles anders.
Der Anfang.
Mitte Dezember, Sydney: Rosa
Der erste Satz, den er zu mir sagt, ist: Willst du das obere oder das untere Bett. Ich mag seine Stimme sofort.
»Ich nehme das untere«, sage ich.
Er lächelt mich an, es ist ein Lächeln zwischen schüchtern und erleichtert. Er wollte das obere Bett.
»Ich heiße Frank«, sagt er.
»Meine Schildkröte hieß Frank«, sage ich.
Mit dieser Antwort hat er nicht gerechnet. Ich wollte es auch eigentlich nur denken.
»Wie bist du auf den Namen gekommen?«, fragt er.
Mit dieser Antwort habe ich nicht gerechnet.
»Ich weiß nicht«, sage ich, »ich kannte nie jemanden, der Frank hieß.«
»Mochtest du Frank?«, fragt er.
»Ja«, sage ich, »sehr.«
»Lebt er noch?«
»Es war ein Weibchen«, sage ich.
»Frank war ein Weibchen?« Sein Tonfall ist fragend und amüsiert.
»Was soll ich sagen?«, sage ich. »Ich war ein seltsames Kind.« Pause. »Und nein, Frank ist tot.«
»Das tut mir leid«, sagt Frank.
»Muss es nicht«, erwidere ich, »Frank war ziemlich alt, als sie gestorben ist.«
»Das freut mich zu hören.« Er lächelt. Diesmal mit Schalk.
»Wir haben sie in unserem Garten neben den Hamstern und Meerschweinchen begraben«, sage ich. »Ich habe ihr ein kleines Kreuz aus Zweigen gebastelt.«
»Klingt so, als hätte Frank es ziemlich gut getroffen«, sagt Frank.
»Hat sie. Mein Vater hat bei der Beerdigung sogar ein paar Worte gesagt. Hier liegt Frank oder so ähnlich.«
Ich denke an den Moment zurück. An Frank in dem Schuhkarton, an das kleine Kreuz, an meinen Vater. Er hat meine Hand gehalten. Das war lange, bevor er und ich aufgehört haben, miteinander zu sprechen.
Frank sagt: »Das volle Programm also.«
Ich sage: »Ja.« Und dann: »Zu dir passt der Name besser als zu meiner Schildkröte.«
»Das höre ich gern«, sagt Frank. »Und wie heißt du?«
»Rosa«, sage ich. »Ich heiße Rosa.«
Fünf Tage später: Frank
Ich machte mir nie wirklich viel aus Mädchen. Auch nicht aus Jungs. Ich bin nicht schwul. Lange dachte ich, ich wäre gar nichts, würde mich nur zum Denken hingezogen fühlen. Körperlichkeit erschloss sich mir nicht. Der ganze Schweiß und die aufdringliche Nähe, die seltsamen Laute, die Tatsache, was Menschen bereit waren, dafür zu tun.
Irgendwann schlief ich mit einem Mädchen aus meinem Kurs, ich tat es aus Neugierde, empfand es als angenehm, doch es löste sonst nicht viel in mir aus, jedenfalls nichts, was blieb. Danach war es vorbei, und ich dachte nicht mehr daran. Wie ein erledigter Punkt auf einer Liste. Ein gutes Gespräch hinterließ mehr bei mir, eine Art der Erregung, die nichts Körperliches an sich hatte und Stunden anhalten konnte, manchmal sogar Tage.
Rosa steht vor dem Spiegel. Sie wirkt nackt und ist doch bekleidet. Ein Trägertop mit Spitzenbesatz, eine kurze Jeans, mehr als kurz. Man sieht den Schatten ihres BHs, die Form ihrer Brust, die Länge ihrer Beine. Rosa steht da und schminkt sich, ich stehe da und sehe sie an, tue so, als würde ich auf mein Handy schauen, schaue daran vorbei, zu ihr, zu dieser Nacktheit, die ein fremdes Unbehagen in mir auslöst. Wie eine Überreizung meines Körpers. Schneller Herzschlag, feuchte Hände, trockene Schleimhäute.
Als ich Rosa zum ersten Mal sah, fiel mir auf, wie sehr sie versuchte, nicht hübsch zu sein. Doch das ist sie. Mit Augen, die mal tief, mal gelangweilt in die Welt blicken. Dunkel wie Geheimnisse. Sie sagte, sie heiße Rosa, ich fand, das passt nicht zu ihr. Aber irgendwie tut es das doch. Auf eine paradoxe, seltsame Art und Weise. Ihr Name macht sie weiblicher, und sie hält mit ihrer Art dagegen.
Vergangene Nacht träumte ich, wie wir miteinander schliefen. So etwas träume ich nicht. Nie. Wie ich auf ihr lag und sie sich an mir festhielt. Ihr nackter Körper fühlte sich weich an, wie er sich gegen meinen presste, sie hatte die Hände in meinen Haaren vergraben. Als ich erwachte, war es mitten in der Nacht und ich schweißgebadet. Erregung und Schuldgefühle in einem Tauziehen, das meinen müden Verstand überforderte. Ich versuchte, wieder einzuschlafen, doch es gelang mir nicht, ich war zu aufgewühlt, also beschloss ich, duschen zu gehen – und holte mir einen runter.
Danach plagte mich ein schlechtes Gewissen.
Das tut es noch.
Zur selben Zeit: Rosa
Frank ist einer, der zu viel nachdenkt. Ich habe ihn gesehen, und da habe ich es gewusst. Noch vor dem ersten Satz. Noch vor dem Gespräch über Frank. Wir standen beide da neben dem Stockbett, und es war, wie in einen männlichen Spiegel zu schauen.
Jetzt zeigt die Reflexion mich und hinter mir ihn. Ich drehe mich um, und Frank schaut weg. Die Art, wie er es tut, verrät, dass er mich angesehen hat. Ich weiß nicht, was seine Blicke mir sagen sollen. Frank ist schwer zu lesen. Einerseits ernsthaft, andererseits kindlich, zu alt für sein Alter und trotzdem jungenhaft. Mit ihm zu reden ist einfach, über ihn nicht. Dafür über alles andere.
Ich weiß nicht viel über ihn. Ein paar Fakten, den Rest dichte ich mir zusammen. Er lebt in Heidelberg, kommt aber ursprünglich aus Hamburg, er ist siebzehn Jahre alt. Sein Geburtstag ist der 15. Juli, sein Sternzeichen Krebs. Frank will Informatik und Psychologie studieren. Ich finde, das passt nicht zusammen, er sagt, das tut es doch. Frank hört am liebsten Jazz und klassische Musik. Er ist klug, mit einem interessanten Gesicht und Blicken mit sehr viel Subtext.
Frank und ich sind die beiden einzigen Alleinreisenden in einem Zimmer mit zehn Betten. Die anderen sind mit ihren besten Freunden, der Freundin, dem Freund oder sonst wem unterwegs. Nur wir nicht. Wir sind allein. Jeder für sich. Ich weiß nicht, was Franks Grund ist, ich kenne nur meinen.
»Kann ich dich was fragen?«, fragt Frank.
»Klar«, sage ich.
Er steckt das Handy ein.
»Wieso bist du allein hier? Ich meine, in Australien. Warum nicht mit jemandem zusammen?«
Ich mustere ihn. Wie kann er genau das fragen, was ich eben gedacht habe? Und warum passiert es mit ihm so oft?
Er sieht mich wartend an, geduldig und interessiert, so wie meistens. Ich sage: »Ich weiß schon lang, dass ich nach Australien will. Und dann habe ich Simon kennengelernt.« Ich mache eine Pause. »Nach einem halben Jahr habe ich ihn gefragt, ob wir gemeinsam nach Australien fahren wollen, einen Camper kaufen.« Ich denke an den Moment zurück. An Simon und mich nachts am See. Wir hatten Sex im Wasser. Danach habe ich ihn gefragt. Er war noch in mir, hat mich festgehalten, ich hatte die Beine um seinen Körper geschlungen, wir waren Brust an Brust und unsere Küsse nass. »Er wollte lieber eine Interrail-Tour machen«, sage ich. »Durch Europa.«
»Und du?«, fragt Frank. »Was wolltest du?«
»Ich weiß es nicht«, lüge ich. »Und dann war es ohnehin egal. Ein paar Monate später war Schluss.«
Ich erzähle ihm eine Wahrheit mit Leerstellen. Keine Lüge, aber auch nicht alles.
Frank sieht mich ein paar Sekunden lang an, dann fragt er: »Wer hat Schluss gemacht, du oder er?«
»Er«, sage ich.
Fünf Monate zuvor: Rosa
Ich versuche zu verstehen, was er gerade gesagt hat. So wie einen komplizierten Satz bei einer Übersetzung. Als würde ich alle Worte kennen, bis auf das eine, das man braucht, damit der Inhalt Sinn ergibt. Eine seltsame Übelkeit liegt in meinem Magen, mein Körper zittert angespannt, ich fühle mich, als wäre ich krank und gerannt. Mit Fieber und Schweißausbrüchen. Ich sitze reglos da, alles passiert innen, draußen ist nur Leere, weil der Satz in meinem Kopf einfach nicht ankommen will. Das Wort Schluss, die Bedeutung von vorbei. Mein Körper versteht es vor meinem Verstand.
Simon schaut mich an, als wäre sein Blick Erklärung genug. Seine Augenbrauen liegen wie ein Dach in seinem Gesicht. Wie bei einem Hund, der Mitleid hat.
»Es tut mir ehrlich leid«, sagt er zum dritten Mal.
Ich sage zum dritten Mal nichts.
Das zwischen uns stimmt für mich nicht mehr.
Du bist mir immer noch wichtig, aber (ein Seufzen) ich glaube, es ist besser, wenn wir Schluss machen.
Die Zeit mit dir war schön.
Ich hoffe, du hasst mich jetzt nicht.
Irgendwann steht er auf, und die Matratze federt. Es ist dieselbe Matratze, auf der wir vorgestern noch miteinander geschlafen haben. Da war die Zeit mit mir sicher auch schön.
Er geht in Richtung Tür, ich schaue ihm nach mit brennenden Augen und einem Gefühl, als wäre ein Knoten in meiner Brust. Er ist so groß, dass mein Herz dagegen schlägt. Mein Kopf ist voll mit Leere und Erinnerungen. Mit einem Abspann von Simon und mir. Er läuft wie ein kleiner Film, den man bei einer Beerdigung zeigt.
Simon dreht sich um und schaut mich an. Er steht in der Tür, mit einem Fuß schon aus meinem Leben verschwunden, mit dem anderen noch da. Ich weine nicht, sage nichts, sehe ihn nur an. Anfangs wollte ich nichts von ihm. Er war mir zu glatt, zu sehr von sich eingenommen, zu beliebt, zu wenig wie ich. Und jetzt liebe ich ihn, und er hofft, dass ich ihn nicht hasse.
Mein Herz schlägt schnell und schwer, als wäre es anstrengend, als wäre es beschädigt oder angebrochen. Durchzogen von unsichtbaren Haarrissen. Und dann geht er. Ohne ein weiteres Wort, ohne einen Abschied, ohne ein viertes Mal: Es tut ihm leid.
Simon war ein Jahr meines Lebens. Und jetzt ist er ein Fremder, der meine Geheimnisse kennt.
19. Dezember, Sydney: Frank
Ich frage mich, was Rosa denkt. Vermutlich an ihn, was genau, bleibt verborgen hinter einer Maske aus Gleichgültigkeit. Ich frage nicht nach, ihr Blick sagt, es geht mich nichts an. Und das tut es nicht.
»Was ist mit dir?«, fragt sie. »Warum bist du allein in Australien?«
Sie ahnt es, da bin ich sicher. Ich erwähnte David beiläufig, nannte ihn meinen besten Freund, danach sagte ich nichts mehr über ihn. Hätte ich es getan, hätte Rosa gespürt, wie wütend ich bin, und dann hätte ich es erklären müssen. Und dann wäre sie auf meiner Seite gewesen, zum einen, weil ich im Recht bin, zum anderen, weil sie David nicht kennt. Sie hätte schlecht über ihn gesprochen, und ich hätte mich dazu verpflichtet gefühlt, ihn zu verteidigen. Aber ich will ihn nicht verteidigen, er hat es nicht verdient, verteidigt zu werden. Als letztes von mir.
»Es war anders geplant«, sage ich schließlich.
»David und du«, sagt sie, »ihr wolltet zusammen nach Australien, richtig?«
Ich nicke.
»Was ist passiert?«, fragt sie.
»Es hat nicht geklappt«, sage ich.
Wir sehen einander an. Als würden unsere Augen das Gespräch weiterführen, während wir schon fertig sind. Ich werde nicht mehr dazu sagen. Die Wahrheit über David passt nicht in einen Satz. Die Wahrheit dauert länger.
Rosa mustert mich, dann sagt sie: »Was hältst du von Rührei mit Toast?«
Wir stehen in der Küche des Hostels, sie ist aufgeräumt, aber nicht sauber. Ein Zustand, den ich nicht ausstehen kann. Alle putzen ein bisschen, aber niemand richtig. Die Edelstahloberflächen sind verschmiert, sie wurden halbherzig abgewischt, ich sehe die Bahnen, die der Lappen genommen hat. Kurven und Strecken, die den Dreck nur verteilen. Überall sind Essensreste und Krümel, auf dem Tresen neben uns steht benutztes Geschirr, jemand hat es stehen lassen. Ich hole Teller und Besteck aus einem Schrank und spüle alles ab, die Rückstände, das eingetrocknete Ei auf der Gabel.
Die Küche ist voll ausgestattet, doch die Messer sind stumpf, die Pfannen widerlich, die meisten Teller haben abgeschlagene Kanten oder Sprünge, weil niemand auf die Sachen achtet, sie gehören ihnen nicht, sie benutzen sie nur.
Rosa macht uns Rührei mit Käse. Es ist mehr Käse als Ei, doch ich beschwere mich nicht, es schmeckt gut, so eins hatten wir gestern bereits. Ich sehe ihr gerne zu, wie sie die Eimasse hin und her schiebt. Immer dieselben Bewegungen, nach links, nach rechts, dann im Kreis.
Ich buttere den Toast. Rosas Toast muss sofort gebuttert werden, gleich wenn er aus dem Toaster springt. Die Butter muss hineinschmelzen, man darf sie nicht mehr sehen. Ich frage mich, ob ihr Typ das auch weiß. Ob er das auch gemacht hat. Ob er wie ich auf derlei Kleinigkeiten achtete, weil ihn alles an ihr interessierte, so wie mich alles an ihr interessiert – so wie mich noch nie alles an jemandem interessiert hat.
»Hier«, sagt Rosa und reicht mir einen Teller.
Wir setzen uns an einen der Tische und essen. Sie stützt den Ellenbogen ab. Das tut sie immer. Mein Großvater würde sagen, es ist unkultiviert, ich finde, es sieht bequem aus. Rosa isst nur mit einer Gabel, als wäre sie zu faul, beide Hände zu benutzen. Die linke hat sie fast immer in den Haaren. Ich mag, wenn sie die Haare offen trägt. So dunkelbraun und lang. Oft zieht sie ein Bein an den Körper, meistens das rechte, dann sieht es aus, als würde sie es umarmen.
Sie isst, und ich esse. Als sie von ihrem Toast abbeißt, klingt es knusprig. Wir schweigen auf diese Art, auf die man nur mit wenigen schweigen kann, ab und zu treffen sich unsere Blicke über der Tischplatte. So wie jetzt. Rosa schaut mich an, nicht ernst, aber auch nicht freundlich, einfach ein Blick, echt und direkt so wie sie. Wie ein Konzentrat ihres Wesens in fast schwarzen Augen. Wir kauen und sehen einander an. Der Moment ist angenehm und unangenehm zugleich, zwei widersprüchliche Gefühle, die sich in meinem Inneren gegeneinander stemmen. Ich will sie fragen, was sie denkt, mich stundenlang mit ihr unterhalten, einfach nichts sagen und weiter schweigen, sie anfassen, ihre Haut, ihr Knie, ihren Arm. Mit ihr will ich alles. Ich wollte nie alles, immer nur reden, immer nur den Bruchteil des Ganzen.
Rosas Augen lächeln, ihre Lippen nicht, dafür tun es meine. So wie meistens, wenn ich sie ansehe. Es passiert ohne mein Zutun, als wäre es die natürliche Reaktion meiner Mundwinkel auf ihren Anblick.
Drei Tage zuvor: Rosa
Frank hat mir verraten, warum er im Stockbett nicht gern unten schläft: Weil er, wenn er dort liegt, nicht aufhören kann, sich vorzustellen, wie es zusammenbricht und ihn zerquetscht. Er meinte, dass er das schon als Kind hatte. Im Schullandheim und auf Klassenfahrten. Ich habe ihm erzählt, dass ich immer oben schlafen wollte, aber dass mein älterer Bruder das Vorrecht hatte – ganz einfach, weil er älter war. Ich habe Frank erzählt, dass ich Julian eines Abends gefragt habe, ob ich vielleicht auch mal eine Nacht oben schlafen darf, und dass er Nein gesagt hat. Also habe ich das getan, was kleine Geschwister eben tun: Ich habe mir gewünscht, dass er aus dem Bett fällt. Und genau das ist passiert. Mein Bruder hatte eine Gehirnerschütterung und ich ein schlechtes Gewissen. Danach habe ich nie wieder gefragt, ob ich oben schlafen darf.
Wenn ich jetzt nachts daliege und hochschaue am anderen Ende der Welt, dann vermisse ich die Leuchtsterne, die ich als Kind an den Lattenrost meines Bruders geklebt hatte. Wenn ich ehrlich bin, vermisse ich nicht nur sie. Hier ist es sehr dunkel und sehr weit weg.
Ich liege da und bin wach, und mein Körper ist seltsam schwer. Meine Arme fühlen sich an, als würden sie nicht zu mir gehören, als würden sie und meine Beine nur das Bett mit mir teilen – wie Wärmeflaschen, die die Hitze noch unerträglicher machen. Ich bin in einem Raum voller Atemgeräusche. Fünf Stockbetten, zehn Menschen, Kleiderschränke, ein Tisch, zwei Fenster. Alles Pressspan und Plastik. In einem dieser Betten liege ich. Und über mir Frank. Seine Matratze ist ein schwarzes Rechteck vor einer schwarzen Decke. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Eines dieser Atemgeräusche gehört zu ihm. Seltsam, was das für einen Unterschied macht.
Ich hatte diese genaue Vorstellung davon, wie es sein wird, in Sydney anzukommen. Wie ich sein werde. Wie es sich anfühlen wird. Aber so war es nicht. Nichts davon. Es ist ein ziemlich schmaler Grat zwischen Wegfahren und Ankommen. Manchmal liegen Welten zwischen dem, was man denkt, und dem, wie es dann ist. Vor zwei Wochen wollte ich nach Hause. Jetzt habe ich nur noch Heimweh.
13 Tage vorher, 3. Dezember: Rosa
Ich bin 1,65 m groß, daran hat sich nichts geändert, aber ich fülle mich nicht aus. Mein Inneres schlackert wie ein einst maßgeschneiderter Anzug, der nun nicht mehr passt. Man merkt es mir nicht an, so wie man mir nie etwas anmerkt, wenn ich es nicht will. Doch unter der Oberfläche sieht es anders aus. Die Unsicherheit nagt an mir, ich bin kleiner als sonst. Als wäre Selbstsicherheit etwas, das man überzieht wie einen Pullover, und ich habe meinen verloren. Die Stimme in meinem Kopf hatte mich gewarnt. Sie hat gesagt:
Was, wenn dich niemand mag?
Was, wenn dein Englisch nicht gut genug ist? Was ist, wenn dich keiner versteht? Was ist, wenn du nichts verstehst?
Und warum überhaupt Sydney? So toll ist es da doch gar nicht.
Fahr lieber nach London.
Oder besser noch: Bleib zu Hause.
Ich bin nicht zu Hause geblieben. Ich bin geflogen – und hatte die ganze Zeit Angst. Seit die Maschine in München abgehoben ist, fühlt sich dieser Schritt an wie ein Fehler. Die Selbstzweifel fressen sich an mir satt und füllen den freiwerdenden Raum mit negativen Gedanken.
Lang wird es nicht dauern, dann gibt sie auf, wirst sehen.
War ja klar, dass sie es nicht lange alleine aushält.
Sie ist wirklich erbärmlich.
Versagerin. Versagerin. Versagerin.
Ich will nicht weinen, und ich tue es auch nicht, doch der Tränenschleier ist die ganze Zeit da, wie eine Decke, die nicht wärmt, sondern nur das Bild verzerrt. Ich dachte, Alleinsein liegt mir. Ich dachte, ich genüge mir als Gesellschaft. Ich dachte, es reicht, woanders zu sein, um anders zu sein. Und ich bin anders, doch ich wollte ein besseres Anders. Als würde mir Australien etwas schulden, weil das Flugticket so teuer war. Aber Australien schuldet mir nichts – das hat es mir unmissverständlich klargemacht. Gleich nach der Landung. Vor ein paar Stunden.
Es sind die längsten meines Lebens.
Der Himmel war grau und die Luft getränkt in Regen, der dann nicht gefallen ist. Ich bin mit einem Shuttle in die Stadt gefahren, es ging schnell. Ich wäre gern noch länger in dem gekühlten Bus sitzen geblieben. Der Rucksack schien schwerer als die vierzehn Kilo. Aber das Schwere war nicht der Rucksack, das Schwere war ich. Eine Mischung aus Gedanken und Müdigkeit.
Das Hostel zu finden, war nicht ganz einfach. Und als ich es dann gefunden hatte, wollte ich nicht bleiben. Mein erster Gedanke war einfach nur Nein. Keine Erklärung, nur Nein. Aber ich hatte die ersten Nächte bereits bezahlt und für eine Stornierung war es zu spät, also wurde aus dem Nein ein Ja.
Jetzt stehe ich in irgendeiner Straße in Sydney, überall sind Menschen, die hier zu Hause sind, die sich auskennen, die hierhergehören. Ich bin viel zu lange wach. Ich will schlafen. Aber es ist noch hell, mitten am Tag, noch zu früh, um schlafen zu gehen. Menschen umspülen mich wie eine Insel in einem Fluss, manche genervt, die meisten bemerken mich gar nicht.
Seit ich in München ins Flugzeug gestiegen bin, habe ich mit fast niemandem gesprochen. Ein paar Sätze mit irgendwelchen Flugbegleiterinnen, eine Bestellung bei McDonald’s in Dubai, ein kurzer Anruf bei meiner Mutter, um ihr zu sagen, dass ich angekommen bin, ein flüchtiges Hello am Flughafen bei der Passkontrolle. Die Einsamkeit hält mich fest, als hätte sie acht Arme. Leute gehen an mir vorbei und ihrem Leben nach. Sie sind im Jetzt und ich allein. Ich würde gern mit einem von ihnen reden, einen von ihnen einfach festhalten, irgendwas fragen. Aber ich tue es nicht, ich schließe lieber kurz die Augen und konzentriere mich auf das Geräusch von Reifen auf Asphalt. Es klingt wie zu Hause. Aber ich bin nicht zu Hause. Die Sonne brennt auf mich herunter, meine Winterhaut kribbelt. Es ist Dezember und viel zu heiß. Der Gehweg ist voll, viele Füße in verschiedenen Schuhen, Sandalen, Flipflops, Anzugschuhe, sauber und schmutzig. Alles ist anders. Es sieht ähnlich aus, aber das ist es nicht. Die Jahreszeit, die Sprache, der Verkehr auf der linken Seite, die Hochhäuser, der goldene Fernsehturm. Alles erinnert mich daran, dass ich weit weg bin von allem, was ich kenne.
Eine einzelne Träne läuft über meine Wange und verschwindet in meinem Mundwinkel. Einsamkeit ist ein sehr viel größeres Gefühl, als ich dachte. Sie hat mich verschluckt, und jetzt treibe ich in ihr wie in einem riesigen Becken, bin unter Wasser und weiß nicht, wo oben und wo unten ist. Wie in einer Blase, die sich mit mir bewegt, die mich in ihrer Mitte hält. Dieses Gefühl erinnert mich an den Film Passengers mit Jennifer Lawrence. Simon und ich haben ihn damals zusammen im Kino angeschaut. Und auf dem Heimweg hat er mich zum ersten Mal geküsst. Wenn ich an diesen Abend zurückdenke, erinnere ich mich hauptsächlich daran. An diesen ersten Kuss. Und an die Szene mit dem Pool und der Schwerelosigkeit. Die habe ich kaum ausgehalten. Alles daran war unerträglich. Als würde ich es nicht nur von außen mit ansehen, sondern als ginge es um mich, als würde ich ertrinken. Genauso fühle ich mich in diesem Moment. In der Einsamkeit. Auch wenn da nirgends Wasser ist und ich nicht im Weltraum bin. Auch wenn die Schwerkraft mich hier stehen lässt, vollkommen reglos, das Gefühl ist dasselbe.
Ich setze mich auf eine Parkbank in irgendeiner Straße, von der ich den Namen nicht kenne, das Handy in der Hand, kurz davor, meine Mutter anzurufen, kurz davor zu weinen, kurz davor zu vergessen, warum ich hierher wollte.
Ich schicke Simon meine australische Nummer und warte. Und er antwortet nicht. Unter meiner Nachricht steht: gelesen. Es sollte dastehen: ignoriert.
Ich stecke das Handy weg, ziehe die Beine an den Körper, ganz nah an die Brust, mache mich klein, noch kleiner, als ich bin. Darin bin ich gut. Und dann kommen die Tränen. Sie laufen über mein Gesicht und Menschen an mir vorüber. Es sind so viele, sie sind überall. Und ich wie unsichtbar. Als gäbe es mich nicht.
18. Dezember: Rosa
Es war ein Dienstagmorgen, als ich beschlossen habe, meinen Rückflug umzubuchen. Ein paar Tage lang bin ich durch Sydney geirrt, von einer Sehenswürdigkeit zur anderen, als würde ich darauf hoffen, irgendwo doch noch der Rosa zu begegnen, die ich in Australien werden wollte. Aber ich habe sie nicht gefunden. Sie war entweder nicht da oder immer einen Schritt voraus.
An diesem Dienstagmorgen habe ich die Adresse von Emirates gegoogelt. Zwei Stunden später stand ich an einem ihrer Schalter. Meine Hände waren so kalt, dass ich meine Finger nicht mehr richtig abwinkeln konnte. Nur ein Wort in meinem Kopf. Immer und immer wieder.
Versagerin, Versagerin, Versagerin.
Als ich an der Reihe war, meinte die Mitarbeiterin, dass sie mich auf einen Flug in elf Wochen umbuchen könnte. Elf Wochen. Kurz habe ich nichts gesagt, stand einfach nur da und habe sie angeschaut, als würde das etwas ändern. Als würde sie dann bestimmt doch einen früheren Flug finden. Aber so war es nicht. Irgendwann habe ich mich bedankt und bin gegangen. Durch Häuserschluchten und heiße Luft, zurück in ein Hostel, in das ich nicht wollte. Das mich offensichtlich auch nicht wollte, denn als ich dort ankam, hieß es, dass ich mein Zimmer räumen müsse, weil es auf dem Stockwerk einen Befall von Bettwanzen gegeben habe.
Ich musste umziehen. Aber erst in der dritten Jugendherberge hatten sie ein Bett frei. Ich dachte, das wäre der Tiefpunkt, aber es war der Anfang. Der Anfang von Frank und mir.
Meistens weiß man nicht, wenn etwas beginnt. Nicht gleich. Nicht in dem Moment. Wenn überhaupt, dann viel später. Aber manchmal ist es anders. Manchmal spürt man, dass sich etwas ändert, in der Sekunde, in der es sich ändert. Das mit Frank war so ein Moment. Als wären wir zusammen abgebogen, als hätten wir die Richtung geändert, er meine und ich seine.
Wir haben angefangen, Dinge zusammen zu machen. Zu frühstücken, einzukaufen, zu kochen. Wir haben nicht groß darüber geredet, wir haben uns einfach verstanden. Und aus einem Essen wurden zwei und aus zwei Spaziergängen wurden drei, und heute haben wir uns den ganzen Nachmittag unterhalten, weiter in den Abend, die halbe Nacht. Vorgestern habe ich ihm gezeigt, wo er eine Prepaid-Karte bekommt, und im Gegenzug hat er mir gezeigt, welche Tipps er sich in seinem Reiseführer markiert hat.
Ich glaube, Frank ist der letzte Mensch unter fünfundsechzig, der Reiseführer liest. Er blättert sie nicht nur durch, er schaut nicht nur die Bilder an, so wie ich es tue, er studiert sie richtig. Von Anfang bis Ende. Manchmal denke ich, Frank ist ein alter Mensch, gefangen im Körper eines Jungen. Die Art, wie er spricht, die Wörter, die er benutzt, die Sache mit den Reiseführern, die Musik, die er mag, die Bücher, die er liest, die Schuhe, die er trägt – Birkenstocks aus dunkelbraunem Leder. Er tut das alles, als wäre es ganz normal, als würde das jeder machen. Diese Eigenschaft mag ich besonders an ihm. Dass er sich nicht am Rest der Welt orientiert, sondern nur an sich selbst. Es gibt nicht viele Menschen, die so sind.
Ich glaube, ich kenne nur einen. Ihn.
Frank
Der einschneidendste Moment meines Lebens war der Tod meines Großvaters. Ich war nicht bei ihm, als er starb. Niemand war bei ihm. Er saß in seinem Sessel. Ich lag in meinem Bett und schlief, ein Stockwerk darüber. Das Kaminfeuer brannte sich leer, die Glut war noch heiß. Ich stand morgens in der Tür zum Wohnzimmer, dreizehn Jahre alt und schaute in tote Augen. In der Hand hielt ich ein Päckchen. Zu seinem letzten Weihnachtsfest hatte ich ihm nichts geschenkt, ich war nicht rechtzeitig fertig geworden. Dann war es fertig und mein Großvater tot. Ich würde viele Tage meiner Zukunft für einen Abschied geben. Für ein paar Minuten mit ihm. Monate, sogar Jahre.
Der 27. Dezember vor fünf Jahren war ein Tag mit Schnee und Eis, die Kälte fraß sich in die Haut, machte sie rissig. Es roch nach Frost, die Wiesen und Fenster waren bedeckt von Reif und Eisblumen. Mein Großvater hatte dieses Wetter geliebt. Den Winter, das milchige Blau des Himmels, die klirrend kalte Luft, den Schnee und seine Stille. Er hatte den Tag gut gewählt.
Meine Mutter war jung Mutter geworden. Jung und zu früh. Zwei Jahre zuvor hatte sie ihre eigene verloren. An einen Krebs, der zu lange unbemerkt blieb. Meine Mutter war siebzehn, als sie meinen Vater traf. So alt wie ich heute. Sie verliebten sich, mit ihm ging es ihr besser, doch die Beziehung zerbrach. Wir waren nicht ganz ein Jahr eine Familie, zu kurz, um sich daran zu erinnern. Mein Vater beendete, was nie hätte beginnen dürfen. Sie hatten nie zusammengepasst. Wenig später gab es bereits eine andere, vielleicht auch schon vorher, wahrscheinlich schon vorher. Mein Vater hatte immer irgendeine Frau, ohne ging es nicht, ohne konnte er nicht sein. Ohne mich schon. Das fiel ihm leicht.
Ich blieb bei meiner Mutter. Die Bruchstücke, die ich aus dieser Zeit noch weiß, ergeben kein schönes Bild. Eine kleine dunkle Wohnung, meine Mutter, die weint, Augenringe. Ich war fünf, als mich mein Großvater zu sich nahm. Die Gründe hat er nie genannt. Weder warum genau dann, noch warum überhaupt – warum nicht früher, warum nicht später. Ich erinnere mich noch, dass ich anfangs Angst vor ihm hatte. Vor seinem faltigen Gesicht und diesen hellblauen Augen, kalt wie gefrorenes Wasser. Seine Haut war gebräunt, nicht grau und fahl wie bei den meisten alten Leuten, die schon im Leben leblos aussehen. Er hatte ein vom Wetter gegerbtes Gesicht, war groß, mit strengem Blick und breiten Schultern, seine Haltung aufrecht wie ein Ausrufezeichen. Er wirkte wie ein Soldat, nicht wie ein alter Mann. Doch wenn er lachte, wurde er ein anderer Mensch und die Falten freundlich. Sie wischten den Zorn von seiner Stirn, den Horror, den er gesehen haben musste, die Erinnerung an den Tod. Mein Großvater erzählte mir oft Geschichten. Von früher, vom Krieg, davon, wie er meine Großmutter kennengelernt hatte, diese wunderschöne Frau mit dem haselnussfarbenen Haar und den veilchenblauen Augen. Wenn er von ihr sprach, musste ich an meine Mutter denken. Auch sie hatte veilchenblaue Augen.
Im Internat wurde ihre Adresse wieder zu meiner, doch ich war nie dort, immer bei David oder im Gebirge. Meine Mutter und ich hatten dieses stillschweigende Übereinkommen, uns aus dem Leben des jeweils anderen herauszuhalten. Wenn sich jemand von der Schule bei ihr meldete, gab sie vor, über alles Bescheid zu wissen, was mich betraf. Im Gegenzug blieb ich weg. Meine Mutter hatte irgendwann einen neuen Freund und dementsprechend keine Verwendung für einen Sohn. Mich störte das nicht, sie war mir im Laufe der Zeit zu fremd geworden, um sie zu vermissen. Wir hatten einige halbherzige Versuche unternommen, einander kennenzulernen, doch die Kluft war zu groß, um sie zu überwinden. Wenn ich sie ansah, sah ich keine Mutter, ich sah lediglich ein Gesicht, das mich entfernt an mein eigenes erinnerte.
Manchmal frage ich mich, wie ich geworden wäre, wenn mein Großvater mich damals nicht zu sich geholt hätte. Wenn ich bei ihr geblieben wäre in dieser dunklen kleinen Wohnung. In ihrer Trauer. In diesem unguten Gefühl, das immer da war, nicht sichtbar, aber überall. In ihr, in mir, in den Vorhängen und Wänden. Ich wäre nicht ich geworden. Jedenfalls nicht dieses Ich, eher ein anderes. Vielleicht ein gutes, aber vermutlich nicht. Was ich an mir mag, habe ich von ihm. Er war konservativ, aber nicht rückständig, unglaublich stur, der sturste Mensch, dem ich je begegnet bin. Er war geduldig, wurde nie laut. Er konnte mit Blicken mehr sagen als die meisten Menschen mit Worten. Er liebte den Geruch von Leder und von brennendem Holz. Und von Milch, kurz bevor sie kochte. Er reparierte Dinge, er sagte, es wäre wichtig zu wissen, wie sie innen aussähen, wie sie funktionierten, sie zu verstehen und nicht nur zu benutzen. Mein Großvater hasste Ungerechtigkeit. Und Sprichwörter und Floskeln. Er sagte: Finde deine eigenen Worte, nimm nicht die von anderen. Und er sagte: Bleib bei dir. Lange wusste ich nicht, was er damit meinte, erst einige Jahre später. Es war ein guter Rat. Es war einer von vielen.
Im Haus meines Großvaters lagen überall dunkle Schokolade und harte Bleistifte herum. In Schubladen, im Bücherregal, auf dem kleinen Tisch neben seinem Sessel, in der Küche. Er sagte: Schreib deine Gedanken auf, Junge, sonst sind sie weg. Er notierte seine bis zu seinem Tod. Jeden Abend und jeden Morgen. In kleine Bücher mit linierten Seiten und schwarzem Ledereinband. Er trug immer eines bei sich. Immer in der hinteren Hosentasche.
Als er starb, hat er sie mir vermacht.
Der letzte Eintrag ist vom 26. Dezember, nur wenige Stunden vor seinem Tod. Er lautet:
Es war ein gutes Leben.
24. Dezember, Weihnachten: Frank
Ein paar Gedanken.
In drei Tagen ist der 27. Dezember. Vergangene Nacht habe ich wieder von ihm geträumt. Wir standen in unserem Waldstück, irgendwo zwischen hohen Tannen in einer ruhigen Dunkelheit, die alles leiser machte. Der Himmel war wie ein Deckel über uns, voll mit Sternen, mehr als ein Himmel haben kann. Erst sprachen wir nicht, standen einfach nebeneinander, barfuß im Schnee, in einer Kälte, die ich nicht wahrnahm, weil er bei mir war. Er musterte mich mit ernsten Augen, sein Haar war weiß, ich fragte mich, ob es wirklich so weiß gewesen war, und wusste es nicht mehr. Altersflecken, buschige Brauen, eine Haut wie Papier. Ein bisschen wie Clint Eastwood. Sie hatten Ähnlichkeit, nicht nur in meinem Traum.
Er fragte, wie es mir geht. Ich sprach sofort von Rosa. Von meiner Verwirrung, von meinen Gefühlen für sie. Ich erzählte ihm alles, nicht nur einen Auszug der Wahrheit, die ganze Wahrheit, ungefilterte Gedanken, unordentlich und durcheinander – genau wie ich. Ich erzählte ihm von meinen Ängsten, der Erregung, den Reaktionen meines Körpers, fremd und gut und doch zu viel.
Er antwortete nicht, nicht mit Worten, doch sein Blick sagte: So fühlt es sich an, wenn man das erste Mal liebt, mein Junge.
So körperlich?
Ja, auch so körperlich.
Dann ist es nicht falsch?
Nein, ist es nicht.
Dann weinte ich. Vollkommen still, Tränen ohne jeden Laut. Vielleicht aus Erleichterung, ich weiß es nicht. Mein Großvater legte seine Hand auf meine Schulter, wie er es so oft getan hatte. Seine große schwere Hand, warm wie ein Versprechen. Als er sie wegnahm, wurden meine Füße kalt, und ich wachte auf. Zuletzt sah ich noch sein Gesicht. Hellblaue Augen mit weißen Wimpern. Mein erster wacher Gedanke war, wie sehr er mir fehlt. Mein zweiter war David.
Ich schaute zu Rosa hinunter, sie schlief neben ihrem Schlafsack, ein Schweißfilm glänzte auf ihrer Haut, ihr Haar wirkte nicht dunkelbraun, sondern schwarz auf dem weißen Kissen. Als mir David vor ein paar Wochen eröffnete, dass er doch nicht mit nach Australien kommen würde, war ich wütend auf ihn. Nicht nur wütend. Es war mehr. Ich war enttäuscht. Australien war seine Idee gewesen. Ich hatte monatelang neben der Schule gearbeitet. So viele Nachhilfestunden in so vielen Fächern. Seinetwegen. Weil er wegwollte, aber nicht allein, aber unbedingt weg. Ich wollte nicht weg, es gab keinen Grund zu gehen. Nur ihn. Also ließ ich mich überreden, so wie ich mich schon so oft von ihm hatte überreden lassen. Weil er mehr war als ein Freund, und weil ich es mochte, wichtig zu sein.
Ich sagte zu – und er mir dann ab. Keine Entschuldigung, nur ein Satz zwischen anderen Sätzen, nebenbei. Als spielte es keine Rolle. Er ließ mich hängen.
Jetzt bin ich froh, dass er es getan hat.
Zur selben Zeit, woanders: David
Das alles hier ist so eine verlogene Scheiße. Die Jacht, dieses Frühstück, mein Vater, der die ganze Welt bemerkt, nur mich nicht. Ich sehe ihn an, esse einen Toast mit Butter und rauche eine Zigarette dazu – was alle am Tisch nervt, aber keiner sagt etwas. Verdammte Heuchler. Ich würde es gerne sagen, es laut aussprechen: Ihr. Seid. Heuchler.
Ich lege den Toast weg und schaue von Gesicht zu Gesicht. Schein von guter Laune, soweit das Auge reicht. Sie lachen und essen, reden über den bevorstehenden Ausflug, das Wetter, die fluffigen Pancakes – kein Witz, Franzi, diese komische Bekannte meiner Mutter sagt das wirklich. Fluffig, sie kriegt sich kaum ein, sagt es immer wieder. Es sind die besten verfickten Pancakes, die sie je gegessen hat. Wir haben es verstanden. Am liebsten würde ich einen davon nehmen und ihr damit das Maul stopfen. Aber das wäre nicht nett, und wir sind doch alle nett. Und höflich. Und verdammt noch mal gut gelaunt.
Ein kurzes Räuspern, dann ergreift mein Vater das Wort. Alle verstummen, als wäre Gott persönlich zu unserem Scheißfrühstück erschienen. Ich höre nicht zu, zünde mir lieber die nächste Zigarette an, weil es Franzi nervt. Alles, was Franzi nervt, heitert mich auf.
Ihre Tochter Sandra lächelt mich zweideutig an. Das tut sie schon die ganze Zeit. Sie und ihr Bruder sind angepasst und neureich, aber wer ist das in diesen Kreisen nicht. Nathan spricht nicht viel, vielleicht tue ich ihm unrecht, vielleicht ist er anders. Aber Sandra ist genau wie ihre Eltern: Sie will um jeden Preis gefallen – im Moment vor allem mir. Ich frage mich, wie weit sie gehen würde, wenn ich es darauf anlege. Wahrscheinlich nicht weit. Ich wette, sie ist eine von denen, die einen Rückzieher machen, kurz bevor es zur Sache geht. Am besten, wenn man schon auf ihr draufliegt. Es gibt viele solche Mädchen. Die denken, sie wollen, und dann sehen sie einen erigierten Penis, und dann wollen sie doch nicht. Mit denen halte ich mich nicht auf.
Irgendwann beendet mein Vater seinen Monolog. Es fehlt nicht viel, und die Idioten am Tisch klatschen. Ich würde gerne meinen Zigarettenstummel in Franzis Richtung schnippen. In ihre Haare. Sie würden bestimmt gut brennen. Es kostet mich einiges an Beherrschung, es nicht zu tun.
»Dann wollen wir mal«, sagt mein Vater, aber ich will nicht. Noch in derselben Sekunde sind sie alle auf den Füßen. Wie verängstigte Schulkinder, die einen Hieb mit der Rute fürchten, wenn sie nicht spuren. Soldaten in Badebekleidung.
Ich bleibe sitzen. Mein Vater tut so, als würde es ihm nichts ausmachen, aber es ärgert ihn, das weiß ich.
Die letzten beiden Züge von meiner Zigarette nehme ich allein. Ich kann nicht glauben, dass ich Frank wegen dieser Scheiße hier abgesagt habe. Wegen ihr und der Aussicht auf einen Job, den ich gar nicht haben will. Ich bin so ein verfickter Vollidiot.
Weihnachten, irgendwann mittags: Rosa
Es ist Weihnachten. Mein Bruder hat mir eine Nachricht geschrieben, und ich habe geantwortet, aber in meinem Kopf kommt es trotzdem nicht an. Fröhliche Weihnachten, kleine Schwester, stand da. Du fehlst hier.
Er fehlt mir. Er und Mama. Und meine kleine Schwester Pia. Ich glaube, ich vermisse sogar Edgar ein bisschen, und den hab ich noch nie vermisst. Meine Mutter und er haben vor vier Jahren geheiratet. Ich hab ihn wirklich gern, aber er ist nicht mein Vater, nur der von Pia. Er ist die Sorte Mann, die sonntags Frühstück macht und meine Mutter zum Lachen bringt. Ganz anders als mein Vater. Als Mama mich vorhin angerufen hat, hat sie geweint. Sie meinte: Es ist ganz anders hier ohne dich. Ich wollte ihr sagen, dass sie mir fehlt, aber ich habe es nicht getan. Frank saß mir gegenüber, und ich kam mir albern vor. Wie ein kleines Kind, das seiner Mama sagt, dass es sie vermisst, während er nichts zu vermissen scheint. Als wäre er mittig ausgerichtet, wie ein Pendel, das aufgehört hat zu schwingen. Ich habe meiner Mutter später eine Nachricht geschrieben, aber das ist nicht dasselbe.
In ein paar Stunden gibt es bei meiner Familie Abendessen. Gans und Knödel und zum Nachtisch Edgars Mousse au Chocolat. Sie stehen gerade alle in der Küche. Alles wie immer. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so zusetzen würde, heute nicht bei ihnen zu sein. Vielleicht bin ich ja doch ein Mensch.
Frank geht neben mir her und sagt nichts. Es hat knapp unter vierzig Grad, und die Luft steht stickig in den Straßen wie ein trotziges Kleinkind, das nicht weitergehen will. Leuchtende Plastik-Weihnachtsmänner und Rentiere zieren die Schaufenster, in den Geschäften laufen Christmas-Carols. Frank und ich holen zwei Pizzen und gehen weiter zum Bondi Beach. Ich kann mir kaum etwas Unweihnachtlicheres vorstellen.
Wir setzen uns auf Strandtücher und bohren unsere Füße in den Sand. Ich schaue den Surfern zu, während Frank mit seinem winzigen Taschenmesser die Pizzen aufschneidet. Er braucht ewig, und mein Magen knurrt. Irgendwann legt er endlich das Messer weg, schließt den Karton und macht Musik an. Der Song ist jazzig und entspannt und irgendwie wie Frank. Als ich nachsehe, wie er heißt, steht auf dem Display: »Severe Season«,Interpret: Howe Gelb & Lonna Kelley. Das Lied macht mich traurig und glücklich.
Frank reicht mir meinen Pizza-Karton, und ich öffne den Deckel. Und dann muss ich lachen.
Jedes Stück sieht aus wie ein Weihnachtsbaum. Frank hat mir acht kleine Weihnachtsbäume mit Salami geschenkt.
Ich glaube, ich habe selten etwas Schöneres bekommen.
Zur selben Zeit: David
Wir haben sehr früh zu Abend gegessen. Hummer und den ganzen Scheiß. Typen mit weißen Handschuhen sind mit tausend Tellern an den Tisch gekommen. Ganz ehrlich, es war die reinste Völlerei.
Ich gehe ins Wasser, stehe einfach nur da, mitten in den Farben, unter einem riesigen Himmel, der so verdammt kitschig aussieht, dass er fast schon wieder geil ist. Rosa und rot und lila und alles. Es haut mich fast um. Ich stehe auf einer Sandbank irgendwo im Ozean, und es ist friedlich. Wären da nicht diese Scheißgedanken an M. – ich schiebe sie weg, drücke sie unter Wasser, bin ein Fleck auf der Welt, neben einem lächerlich großen Boot.
Vorhin standen wir alle hier bis zum Bauch und haben Champagner getrunken. Es wurde laut gelacht und war verlogen. Ich habe alles und fühle nichts. Weil es die falschen Menschen sind. Leute, die sich eigentlich nichts zu sagen haben, aber andauernd reden. Mein Vater ist ein Meister darin, Worthülsen so klingen zu lassen, als hätten sie Inhalt. Meine Mutter ist auch nicht schlecht. Bei ihr sind es nur andere Themen. Der Garten, Cocktailpartys, Maniküre, Schuhe, der Tennisclub. Sie kann sich stundenlang mit anderen Frauen über nichts unterhalten und dabei eine richtig gute Zeit haben. Ich war früher auch so. Beim Segeln, beim Skifahren, beim Weggehen. Ich konnte mit jedem: reden, Spaß haben, rummachen. Ich hatte bedeutungslose Gespräche, bedeutungslose Beziehungen und bedeutungslose Freundschaften. War immer umgeben von Leuten, doch die meisten waren Fremde. Und dann kam das mit M. Eine Nacht, die alles verändert hat. Nicht lange danach lernte ich Frank kennen. Einen stillen, seltsamen Jungen mit halblangen Haaren und einer inneren Ruhe, die sofort etwas mit mir gemacht hat. Frank ist mein Gegenteil. Er denkt, wo ich handle, er ist still, wo ich laut bin. Er mag Bücher, ich Filme. Er steht früh auf, ich schlafe lang. Ich mache Sport, er nicht.
Wir haben nichts gemeinsam. Und irgendwie alles. Ich wollte immer einen Bruder. Und dann hatte ich ihn. Jemanden, mit dem ich reden konnte. Jemanden, der zugehört hat.
Jemanden, der zu mir gehört hat.
Fünf Tage später: Rosa
Frank und ich sitzen auf dem Dach unseres Hostels, es ist einer unserer Lieblingsplätze geworden, ein Ort, von dem niemand etwas weiß, weil alle anderen sich von dem kleinen Verbotsschild abschrecken lassen. Ich hätte mich auch abschrecken lassen. Frank nicht. Er sagte: Sie werden uns kaum erschießen und öffnete die Tür.
Es dämmert, und alles ist blau. Wir waren den ganzen Nachmittag hier oben, weit weg von allem. Wie eine Geschichte, die parallel zu einer anderen verläuft, ein zweiter Handlungsstrang neben der Realität. Frank hat gelesen – einen Roman von John Steinbeck –, ich habe in mein Buch geschrieben, wir haben spät zu Mittag gegessen, wir haben uns unterhalten, aber die meiste Zeit waren wir einfach nur hier oben, jeder für sich, nebeneinander. So stelle ich es mir vor, mit jemandem glücklich zu sein. Zu zweit allein, aber niemals einsam.
Ich beobachte Frank, während er liest. Er schaut aufs Papier, wie er manchmal mich ansieht. Als wäre ich etwas Zerbrechliches, etwas, auf das man achtgeben muss. Er betrachtet die Zeilen fast zärtlich, seine Blicke haben etwas von Händen. Er hält das Buch und liest, dann schaut er an seinem Buch vorbei zu mir. In meine Augen, in mich hinein. Wenn er mich so ansieht, fühle ich mich schutzlos, und gleichzeitig ist es, als hätte mich vor ihm noch nie jemand wirklich gesehen – nicht so. Nicht wie er.
»Ist alles in Ordnung?«, fragt Frank.
»Ja«, sage ich. »Bei dir?«
Er nickt.
Ich warte darauf, dass unser Blick abreißt, dass Frank weiterliest, doch er tut es nicht. Er legt den Roman zur Seite und setzt sich aufrecht hin. Die Luft riecht kurz nach ihm. Sauber und warm. Nach Haut und Mann und Deo.
Dann sagt er: »Es erstaunt mich, dass du Tagebuch schreibst.«
»Es erstaunt dich?«, frage ich. »Warum?«
»Weil du in allem versuchst, kein Mädchen zu sein«, erwidert er.
»Das ist nicht wahr«, sage ich.
»Ich denke doch«, sagt Frank.
Und ich sage nichts. Vielleicht, weil es stimmt. Ich will kein typisches Mädchen sein, obwohl ich nicht mal weiß, was das ist – ein typisches Mädchen. Vermutlich genau das, was ich mit Simon war. Diese Version von mir, die das Richtige sagen und das Richtige tun wollte. Das Richtige war alles, was ihm gefallen hat. Es hatte nichts mehr mit mir zu tun, nichts mit dem, was ich will. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so werde, wenn ich mich verliebe. So ein Klischee. Eins von den Mädchen, über die ich selbst gelacht hätte.
»Was denkst du?«, fragt Frank.
»Gar nichts«, sage ich, weil zu viel eine komische Antwort wäre. Eine, die ich erklären müsste, aber nicht erklären will. Stattdessen sage ich: »Ich schreibe nicht nur. In mein Buch, meine ich.« Pause. »Ich zeichne überwiegend.«
»Und das macht es weniger zu einem Tagebuch? Die Tatsache, dass du zeichnest?« Er fragt es nicht von oben herab, nicht rechthaberisch, es ist einfach nur eine Frage.
Und weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, sage ich: »Nicht nur Mädchen schreiben Tagebuch.«
»Ich weiß«, entgegnet er. »Ich tue es auch.«
Natürlich tut er das. Und es passt zu ihm, es einfach so zu sagen. Weil es ihm egal ist, was ich darüber denke, was irgendjemand denkt. In Franks Kopf sind keine Schubladen, das Wort man kennt er nicht, in seiner Welt spielt es keine Rolle, was man tut oder nicht tut. Dieses man, von dem niemand so recht weiß, wer es ist, sich aber dennoch daran hält.
»Ich habe dich nie in ein Tagebuch schreiben sehen«, sage ich.
»Ich schreibe meist dann, wenn du schläfst«, sagt er.
Ich will ihn fragen, ob er etwas über mich geschrieben hat, und weiß nicht, ob ich es tun soll.
»Hast du etwas über mich geschrieben?«, frage ich.
»Selbstverständlich«, antwortet er.
»Was hast du über mich geschrieben?«
Er sieht mich an mit einem von seinen langen Blicken, dann erwidert er: »Das, was ich dir nicht sagen kann.«
Es ist nur ein Satz, aber er sagt so viel, dass ich schweige.
Vielleicht, weil es mir mit ihm genauso geht.
Zwei.
31. Dezember, Silvester: Frank
Rosa trägt ein Kleid und eine Netzstrumpfhose mit Maschen, die so groß sind wie meine Handteller. Darunter nichts als Haut. Ihre Haare sind offen und glänzen. Sie ist geschminkt, stärker als sonst, die Augen dunkel, die Lippen rot. Ich konnte Silvester nie sonderlich viel abgewinnen. Es waren Traditionen und Bräuche, die nichts in mir auslösten. Ganz im Gegensatz zu diesem Anblick – was zugegebenermaßen nur wenig mit Silvester zu tun hat. Rosa steht da in ihrem viel zu kurzen Kleid, die Chucks passen nicht dazu, dafür zu ihr. Die Kombination ist wie sie: widersprüchlich und spannend. Oben elegant und unten nicht. Mit unglaublich langen Beinen. Gott, sie hat lange Beine.
Rosa kommt näher, und ich nehme die Kopfhörer ab.
»Lass uns abhauen«, sagt sie. »Ich bin am Verhungern.«
Wir verlassen das Hostel, betreten Straßen und Gehwege voller Menschen. In der Ferne erhebt sich die Harbour Bridge in den Himmel. Die Luft ist noch heiß vom Tag, der Asphalt und die Gebäude glühen nach, eine stehende Hitze zwischen hohen Häusern. Frauen in schwarzen Kleidern, die dunkel glitzern in einer Nacht wie warmes Wasser, Männer in weißen Hemden und zu viel Aftershave, Backpacker in kleinen Gruppen, die laut lachen. Wir fließen alle in Richtung Hafen, so verschieden wir sind, ein zäher Brei aus guter Laune und Vorfreude. Als wäre so ein neues Jahr ein Versprechen dafür, dass alles besser wird.
Ich blicke auf Rosas Hand und möchte danach greifen. Ihre kleine Hand in meine nehmen. Ich rieche ihr Shampoo. Es riecht cremig und ein bisschen nach Kokos. Mein Handy vibriert in meiner Hosentasche. Vermutlich ist es David. Ich schaue nicht nach, ich gehe nicht hin. Es ist mir egal.
Ein paar Minuten später erreichen Rosa und ich das Restaurant. Es ist ein kleiner Sushi-Laden mit nur sieben Tischen. Wir waren bereits zwei Mal dort, bestellten etwas zum Mitnehmen und aßen es dann am Hafen. Rosa weiß nichts von dem reservierten Tisch, sie denkt, wir essen unterwegs, am Straßenrand, im Gehen, in irgendeinem Hauseingang.
Eine junge Frau mit porzellanfarbener Haut und flächigem Gesicht kommt auf uns zu. Mit ihr hatte ich gesprochen, als ich vergangene Woche allein herkam. Auf ihrem Namensschildchen stand Lea. Sie sagte, es wäre kein Problem. Plötzlich die Frage, ob sie es vergessen haben könnte, ob es vielleicht sogar besser wäre. Ein reservierter Tisch hat etwas von einer Verabredung. Mein Magen wird flau, ein Gefühl kurz vor der Übelkeit, weiche Knie, ein nach außen hin nicht erkennbares Zittern, innen ist es überall.
Lea nimmt zwei Speisekarten von einem Stapel und zeigt auf den letzten freien Tisch.
Rosa sagt: »We just want to order some take-away.«
Lea sieht kurz zu mir, ich schüttle den Kopf, und sie lächelt.
»This young man made table reservations.«
Rosa schaut von Lea zu mir.
»Du hast einen Tisch reserviert?«, fragt sie.
Ihre Stimme klingt überrascht, ihre Augen verraten nicht, ob gut oder schlecht. Sie hat ihr skeptisches Gesicht, mit dem geraden Mund und den zusammengezogenen Brauen. Rosa wartet auf eine Antwort, Lea wartet auf uns. Sag etwas, denke ich, doch dann reicht es nur für ein Nicken. Ich spüre meinen Herzschlag im ganzen Körper, bis in die Haut. Die Sekunden breiten sich leer in mir aus.
Plötzlich lächelt Rosa. Sie sieht mich an und dann weg, führt kurz die Hand zum Mund, eine verlegene Geste, die ich von ihr nicht kannte, die nicht zu ihr passt und sehr zu ihr passt. Sie sieht mich wieder an. Es ist ein Von-unten-Blick, ein Augenaufschlag. Mein Lächeln geht über mein Gesicht hinaus, als würden selbst meine Schultern lächeln. Dann bringt uns Lea zu unserem Tisch.
Fünfunddreißig Minuten später: Rosa
Ich halte mich an der Tischplatte fest und bekomme kaum noch Luft vor Lachen. Meine Bauchmuskeln stehen kurz vor einem Krampf. Frank sitzt mir gegenüber, Tränen laufen über seine Wangen, er lacht lautlos in seine Sushi-Platte, die Stäbchen vibrieren in seiner Hand. Seine Stoffserviette ist runtergefallen, sie liegt unter dem Tisch. Frank holt Luft, atmet ein, lacht weiter, dieses Mal laut, er steckt mich damit an, wie ich eben ihn.
Um uns herum essen sechs Paare zu Abend. Dazwischen Frank und ich. Als wir uns vorhin hingesetzt haben, habe ich mich gefragt, wie wir zusammen aussehen. Ich habe mich gefragt, ob wir herausstechen, ob wir zu jung sind, was die anderen wohl von uns denken – die echten Erwachsenen. Ich fand meine Schuhe auf einmal unpassend. Und dann dachte ich, wenn meine Schuhe unpassend sind, sind Franks Birkenstocks es auch. Jetzt ist es mir egal. Das alles. Die sechs Paare, und was sie vielleicht denken.
Ich spüre ihre Blicke. Spüre, dass sie gern wüssten, warum wir so lachen. Was so komisch ist. Aber ich weiß selbst nicht, was so komisch ist. Alles. Nichts davon. Wir. Es ist, als würden Frank und ich einen seltenen Dialekt sprechen, den abgesehen von uns niemand versteht. Er lacht mit mir und ich mit ihm. Nicht wir über andere, sondern zusammen. Sein Lachen ist unkontrolliert und raumgreifend, nicht leise und zurückhaltend, wie sein Lächeln es ist. Es ist ein großartiges Lachen. Kehlig und warm.
Ich weiß nicht, womit es angefangen hat. Es war irgendeine Kleinigkeit. Etwas, das für jemand anders vermutlich nicht besonders lustig gewesen wäre. Vielleicht war es auch nicht lustig. Vielleicht war es die seltsame Situation. Die plötzliche Anspannung zwischen uns. Oder die kaum hörbare asiatische Musik, die im Hintergrund lief. Diese Stille. Das fehlende Geräusch von Besteck auf Geschirr, nur lautlose Stäbchen und leise Unterhaltungen. Ein Meer aus Gemurmel, durchbrochen von unserem Lachen.