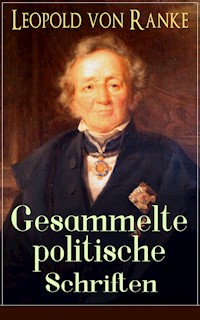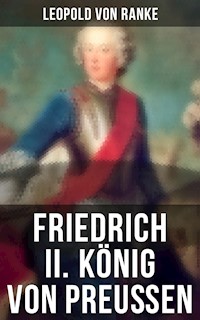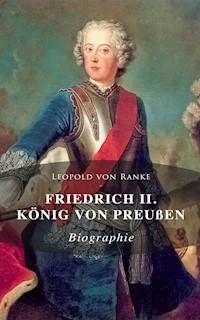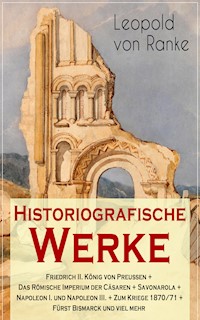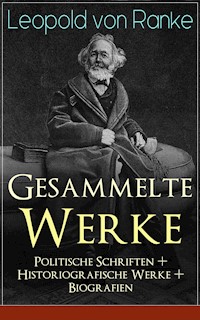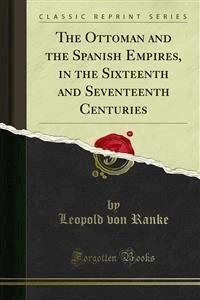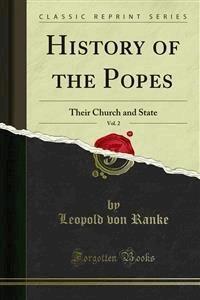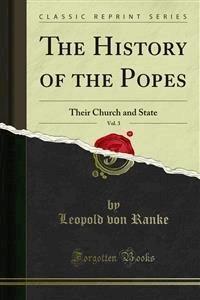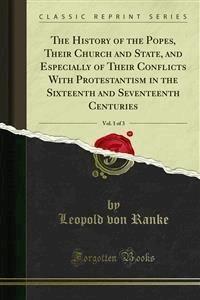Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Aus Zwei Jahrtausenden Deutscher Geschichte" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Franz Leopold Ranke (1795-1886) war ein deutscher Historiker, Historiograph des preußischen Staates, Hochschullehrer und königlich preußischer Wirklicher Geheimer Rat. Leopold von Ranke gilt als einer der Gründerväter der modernen Geschichtswissenschaft, der sich um eine möglichst große Objektivität bei der Wiedergabe der Geschichte bemühte. Inhalt: Eintritt der Germanen in die Geschichte Weichen der Römer. Emporkommen der Franken. Die Franken und die anderen deutschen Stämme. Begründung der deutschen Kirche. Karl der Große. Entstehung des Deutschen Reiches Sächsische und Fränkische Kaiser. Kampf zwischen Kaiser und Papst. Späteres Mittelalter Kolonisation im Osten Die Reformation. Zum Dreißigjährigen Kriege. Deutschland und Frankreich zur Zeit Ludwigs XIV. Zur Geschichte Preußens. Nach der Besiegung Napoleons. Zwischen Wiener Kongreß und Bismarck Zur Zeit Bismarcks
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus Zwei Jahrtausenden Deutscher Geschichte
Zusammengefaßte Darstellungen der großen Entscheidungen Deutscher Geschichte von Cäsar bis Bismarck
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel. Eintritt der Germanen in die Geschichte
Zusammenstoß mit Caesar
Die Herrschaft der Welt konnte unmöglich abhängig bleiben von den turbulenten Fraktionen des römischen Forums; große Männer bilden sich nur im Kampfe mit den allgemeinen Weltelementen aus.
Nun war Rom im Orient doch noch nicht bis an das Ziel gelangt, welches Alexander der Große bereits erreicht hatte. Seine Herrschaft umfaßte noch keineswegs die den hellenistisch-mazedonischen Königen unterwürfig gewordenen Völkerschaften. Im Süden hatte es diese bei weitem überboten; im Kampfe mit Karthago waren ihm Libyen und allmählich auch der größte Teil von Spanien anheimgefallen. In dem Kampfe mit den keltischen Nationalitäten hatte es das obere Italien, einen Teil der Alpen und das südliche Gallien eingenommen. Hier aber stieß es noch auf ein anderes Völkersystem, welches gleichsam eine Welt für sich bildete, das wie das mittlere, so auch das nordöstliche Gallien, Britannien und Germanien erfüllte. Bisher hatten in demselben die keltischen Völkerzüge und politischen Einrichtungen vorgewaltet. Jetzt aber trat, ohne daß sich genau sagen ließe, wie und wodurch, das germanische Element in den Vordergrund. Mit diesem und seinen Einwirkungen traf nun Julius Cäsar, als er nach Gallien ging, unmittelbar zusammen. Daß er ihnen Einhalt tat, bildete die erste Bedingung eines geordneten Zustandes der westlichen Welt überhaupt, wozu es unerläßlich war, den noch halb nomadischen völkerschaftlichen Bewegungen ein Ende zu machen und die Seßhaftigkeit der Landeseinwohner fest zu begründen.
Nach einem Siege über die keltischen Helvetier i. J. 58 v. Chr., durch welchen sich Cäsar der Herrschaft über die gallischen Stämme, die oft zweifelhaft geworden war, versichert hatte, geriet er in Konflikt mit den Germanen, die in einem ähnlichen Anlauf wie die Helvetier selbst gegen Gallien begriffen waren. Eigentlich in einem inneren Streit der Gallier unter sich und zugleich im Gegensatz zu den Römern waren germanische Stämme von jenseit des Rheines nach Gallien gezogen worden. Die Arverner und Sequaner, Gegner der Römer und Äduer, hatten sie herbeigerufen; die Äduer waren von ihnen besiegt und beinahe vernichtet worden. Zugleich aber hatten nun die Germanen im Gebiete der Sequaner ihre Sitze aufgeschlagen. Diese aber wurden ihnen bereits zu enge: denn neue Völkerscharen kamen unaufhörlich herüber: und nichts anderes schien bevorzustehen, als daß die Sequaner, zur Auswanderung gezwungen, sich andere Sitze in Gallien suchen würden. An der Spitze der Germanen stand ein König, in dessen Persönlichkeit sich die ungestüme Tapferkeit und gewalttätige Sinnesart der vordringenden Germanen repräsentierte, des Namens Ariovist.
Cäsar, durch ein besonderes Senatuskonsult verpflichtet, den Äduern Hilfe zu leisten, forderte den König auf, die Geiseln, die er von ihnen in Händen habe, zurückzugeben. Aber damit war er noch nicht zufrieden: er verlangte zugleich, daß Ariovist keine Germanen weiter über den Rhein herüberkommen lasse. Schon das römische Interesse schien ihm das zu fordern: denn aus dem weiteren Vordringen und der daraus unvermeidlich hervorgehenden Verwirrung könne ein neuer Anfall gegen die römische Provinz und Rom selbst sich entwickeln, wie der zimbrisch-teutonische gewesen sei. Es könnte übertrieben scheinen, die Unternehmungen Cäsars auf die Verteidigung der Römer beziehen zu wollen; aber so verhält es sich doch: die politische Stellung, welche sie auch in sozialer Hinsicht gegen das keltisch-germanische Europa genommen hatten, gebot ihnen, zu ihrer eigenen Sicherheit den spontanen Völkerbewegungen ein Ende zu machen. Der Widerstreit der Germanen und Römer tritt sogleich bei diesem Schritt hervor. Welches Recht hatten die Römer, den germanischen Stämmen zu gebieten, daß sie jenseit des Rheines bleiben sollten? Ariovist ließ vernehmen: so wenig er sich um das kümmere, was Rom in seiner Provinz vornehme, so wenig stehe den Römern ein Recht zu, ihm vorzuschreiben, was er in den von ihm eingenommenen Landesteilen zu tun habe; er besitze dieselben mit dem nämlichen Recht wie die Römer: durch die Gewalt des Schwertes.
Auf Cäsar machte es Eindruck, daß Ariovist Anstalt traf, sich Vesontios zu bemächtigen, eines festen Platzes, der allen seinen Unternehmungen zum Rückhalt dienen konnte, und daß zugleich die Nachricht einlief, der suevische Stamm, dem Ariovist angehörte, sei im Begriff, in großen Scharen über den Rhein zu kommen. Wenigstens so viel mußte er besorgen, daß Ariovist ihm zu stark werden würde, um ihn zurückzutreiben. Mit der Raschheit, die, wie einst bei Alexander, so auch bei Cäsar das vornehmste Moment seiner glücklichen Kriegführung bildete, eilte er herbei und nahm Vesontio selbst in Besitz. Seinen Römern, die vor dem Anblick der Germanen, dem wilden Feuer, das sich in ihren Gesichtszügen und Augen malte, zurückschraken, führte er zu Gemüt, daß es doch dieselben Feinde seien, die einst Cajus Marius aus dem Felde geschlagen habe. Nach beiden Seiten hin schwebte ihm der zimbrische Krieg vor Augen. Noch einmal ist es dann zwischen Cäsar und Ariovist zu einem Zwiegespräch gekommen auf einem Hügel, der sich auf einer Ebene erhob. Jeder hatte zehn Reiter bei sich, die in einiger Entfernung halten blieben. Da hat nun Cäsar den Ariovist erinnert, daß er ja seinen Titel »König« den Römern verdanke, und ihnen nicht verargen könne, wenn sie ihrer Gewohnheit gemäß die ältesten Bundesgenossen, die Äduer, gegen ihn in Schutz nähmen; er wiederholte seine früheren Anmutungen, Ariovist war nicht so sehr Barbar, um sich von dem römischen Namen und der Bundesgenossenschaft der Äduer imponieren zu lassen; er verhehlte Cäsar nicht, daß er von seinen Feinden in Rom aufgemuntert werde, ihm zu widerstehen; er nahm eine vollkommene Gleichheit in Anspruch; jener Aufforderung der Römer, Gallien zu verlassen, setzte er seinerseits die Aufforderung entgegen, daß die Römer ebenfalls aus dem freien Gallien weichen sollten.
Die beiden Armeen trafen im oberen Elsaß aufeinander, und bei der Kriegsübung und Tapferkeit der Germanen hätte das Zusammentreffen mit ihnen für Cäsar sehr gefährlich werden können, wären sie nicht durch einen Aberglauben, der sich, wie einst in der Schlacht gegen Perseus, an den Wechsel in der Erscheinung des Mondes anknüpfte, in ihren Bewegungen zurückgehalten worden; die weisen Frauen weissagten Unglück, wenn man vor dem nächsten Neumond ein ernstliches Treffen unternehme. Cäsar vermochte ein kleines Lager unmittelbar in der Nähe des Feindes zustande zu bringen und zu behaupten. Hierauf schritt er zum Angriff auf das Lager der Germanen vor, die, nach ihren Stämmen gesondert, nicht länger aufschieben konnten, sich ihm entgegenzustellen.
Cäsar griff sie an der Seite an, wo sie am schwächsten waren, und hatte hier – es war sein rechter Flügel – bald die Oberhand. Aber auf der andern waren die Germanen im Vorteil, als die Reserve heranrückte und die Schlacht auch auf diesem Flügel begann.
Die Flucht der Germanen wurde besonders dadurch für sie verderblich, daß sie den Rhein hinter sich hatten, über den zurückzugehen keine Vorbereitung getroffen war; der größte Teil des Heeres ward niedergemetzelt. Ariovist entkam auf einem Kahn, den er am Ufer angebunden fand. Er ist bald darauf, wahrscheinlich infolge erhaltener Wunden, umgekommen.
So vollzog sich der erste Kampf zwischen Römern und Germanen mit offenen und gerechten Waffen. Nach einiger Zeit folgte ein zweiter, bei dem aber Cäsar den Sieg durch eine zweideutige und beinahe verräterische Vorrichtung gewann.
Die Germanen verließen Gallien. Hierauf wurde Cäsar Herr in dem ganzen mittleren Gallien, als dessen Beschützer gegen die gefährlichsten Feindseligkeiten er auftrat.
Weitverzweigte Kämpfe in Gallien wurden hierdurch in den nächsten Jahren hervorgerufen.
Aber indem trat die alte Gefahr an der germanischen Grenze in aller Stärke hervor. Sie kam diesmal nicht von den Sueven, sondern von andern Völkerschaften, die von den Sueven aus ihren Sitzen verdrängt waren, den Usipetern und Tenchterern. Sie überfielen das Gebiet der Menapier, welche von den Ardennen gegen den Rhein und zum Teil auch auf dem rechten Ufer desselben wohnten, und beraubten sie ihrer Ländereien zu beiden Seiten des Rheines und ihrer Vorräte. Die Menapier gehörten zu den belgischen Völkerschaften. Cäsar wollte und konnte nicht dulden, daß die Germanen den Rhein überschritten. Noch einmal stießen hier, wie im Kampfe mit den Helvetiern und Ariovist, die beiden Systeme zusammen, welche die Welt teilten: das der Seßhaftigkeit und der damit verbundenen bürgerlichen und militärischen Ordnung und das der freien Bewegung unabhängiger Völkerschaften, die ihre Sitze nach Bedürfnis wechselten. Noch vor dem gewohnten Anfang der Feldzüge ging Cäsar ihnen entgegen. Die Usipeter und Tenchterer ließen vernehmen: vor den Sueven seien sie zurückgewichen, dem tapfersten Volke der Erde, dem selbst die Götter nicht widerstehen könnten; vor einem andern Volke zurückzuweichen seien sie nicht gemeint; sie forderten Cäsar auf, ihnen andere Wohnsitze anzuweisen. Er sagte ihnen, in Gallien gäbe es deren keine, aber er machte ihnen Hoffnung, ihnen bei den Ubiern, einem germanischen Stamme, der bereits mit ihm gegen die Sueven verbündet war, Aufnahme zu verschaffen. Nach einigen Bedenken gingen die beiden Völkerschaften darauf ein und baten nur, mit den Ubiern erst selbst verhandeln zu dürfen. Cäsar meinte jedoch, ihre Absicht sei, durch Verzögerungen des Rückzuges Zeit zu gewinnen, bis der größere Teil ihrer Reiterei, der nach einer niederrheinischen Landschaft ausgezogen war, zurückgekehrt sei.
Indem man nun noch verhandelte, war es zu einem Zusammentreffen zwischen der anwesenden germanischen Reiterei und den Römern gekommen, in welchem die Germanen trotz ihrer Minderzahl die Oberhand behaupteten, da die Römer, denen Cäsar, durch jene Gesandten selbst veranlaßt, geboten hatte, den Kampf zu vermeiden, bis er mit seinem ganzen Heere ihnen zu Hilfe komme, nicht recht vorbereitet auf den Kampf waren. Cäsar bekam auf der Stelle zu empfinden, daß der Vorteil der Germanen auf die Gallier aufregend wirke. Die Sache hätte für ihn sehr gefährlich werden können, wenn indes der Rest der germanischen Reiterei zurückgekommen wäre. Wäre er in Nachteil geraten, so würde sich der größte Teil von Gallien gegen ihn empört haben. Indem langten nun die Fürsten und Ältesten der beiden Völkerschaften in seinem Lager an, um jenen Reiteranfall, der ohne ihr Vorwissen geschehen sei, zu entschuldigen. Daß es ihr voller Ernst war, die Streitigkeit friedlich zu schlichten, läßt sich nicht bezweifeln; denn wie würden sie sonst die vornehmsten Leute, die sie für Krieg und Rat besaßen, in das Lager der Feinde geschickt haben? Sie meinten ohne Zweifel, daß diese durch das allgemeine Völkerrecht, welchem die Gesandtschaften heilig waren, auch inmitten der Feinde ihres Lebens sicher seien. Diese Heiligkeit fremder Gesandtschaften war einer der vornehmsten Grundsätze der altrömischen Religion; aber für Cäsar bestanden diese Rücksichten schon nicht mehr: er sah nur die Gefahr, welche aus einem doch immer möglichen Widerstande der Völkerschaften erwachsen konnte. Er ließ die zahlreiche und vornehme Gesandtschaft in seinem Lager festhalten und griff die beiden Völkerschaften an, die nun, zugleich überrascht und des besten Teiles ihrer Führer beraubt, dem Anfall der Legionen nicht widerstehen konnten, auseinandergeworfen wurden und so gut wie möglich über den Rhein zu kommen suchten.
Das Verhalten Cäsars in dieser Angelegenheit hat ihm in Rom die schwersten Vorwürfe zugezogen. Der strenge Cato hat im Senat die Handlung als eine solche geschildert, die den Fluch der Völker auf die Römer herabziehen müsse: er meinte, man solle Cäsar den Feinden überliefern. Wir wollen diese Ideen der alten Volksreligionen nicht erörtern, aber eingestehen muß man doch, daß die Handlung Cäsars die bösesten Nachwirkungen herbeigeführt hat. Gegen Ariovist hatte er einen offenen Krieg geführt; den Usipetern und Tenchterern dagegen war er auf eine Weise begegnet, welche nicht anders als die bitterste Feindseligkeit in den Germanen erweckt und jahrhundertelang die westliche Welt in Entzweiung gehalten hat. Ein Teil der Völkerschaften, namentlich jene in die Nachbarländer entfernten Reiterscharen, hatten sich zu den Sigambern gerettet, welche das rechte Rheinufer zwischen Ruhr und Sieg inne hatten, und bei ihnen gute Aufnahme gefunden. Cäsar forderte die Auslieferung der Übergetretenen; die Sigamber waren nicht gemeint, eine solche zuzugestehen; sie beschieden sich, das römische Reich jenseit des Rheines anzuerkennen. Aber, so sagten sie, wenn er nicht dulden wolle, daß der Fluß von Germanen überschritten werde, welches Recht habe er, den Bewohnern des rechten Ufers Befehle zu erteilen?
Cäsar beschloß, den Germanen zu zeigen, daß römische Heere sie auch jenseit des Rheines heimzusuchen vermöchten.
Im Sommer 55 brachte er wirklich eine Brücke über den tiefen und reißenden Strom zustande – denn der Fahrzeuge und Boote, welche ihm die befreundeten Ubier anboten, sich zu bedienen, verschmähte er –, auf der er denselben überschritt. Der Schrecken, den seine Siege in den germanischen Nationen erweckt hatten, ging vor ihm her. Die Sigamber wichen auf den Rat der aus der letzten Schlacht zu ihnen Geflüchteten in unzugängliche Waldungen zurück. Die Sueven riefen alle waffenfähigen Mannschaften auf einen Platz zusammen, wo sie eine Schlacht annehmen zu können meinten; Cäsar war jedoch nicht der Meinung, sie daselbst aufzusuchen. Er glaubte, der Ehre der Waffen genug getan und seinen Zweck erreicht zu haben, und kehrte nach Gallien zurück. Nach einiger Zeit aber erschienen doch wieder germanische Kriegsscharen zur Unterstützung der Feinde, die er in Gallien zu bekämpfen hatte, und er hielt es aufs neue für notwendig, über den Rhein zu gehen: aufs neue beschieden die Sueven ihre eigenen Mannschaften und ihre Bundesgenossen nach der Bergwaldung Bacenis, welche Chauker und Sueven voneinander schied, um die Römer daselbst zu erwarten. Aber Cäsar hatte auch diesmal nicht die Absicht, tief in das Land vorzurücken, da er keiner genügenden Zufuhr sicher war: er hielt es für genug, nachdem er auf seiner Brücke zurückgegangen, einen Teil derselben stehenzulassen und durch Befestigungen zu sichern, wie Alexander durch die Erbauung eines Lagers der indischen Nation die Rückkehr seiner Mazedonier gedroht haben soll. Die Germanen sollten die Rückkunft Cäsars jeden Augenblick fürchten müssen und selbst denen, welche aus Gallien bei ihnen ihre Zuflucht suchten, die Aufnahme verweigern.
Eindringen der Römer in Germanien
Wollte man das Verdienst des cäsarischen Hauses um das römische Reich im allgemeinen bezeichnen, so würde es darin zu sehen sein, daß es die keltischen Bewegungen, die bisher die Grenzlande der Kultur durch unaufhörliche Angriffe in Atem gehalten hatten, allenthalben überwältigte. Alles greift ineinander: die Eroberung Galliens durch Cäsar, die Organisation dieser großen Gebiete durch Augustus, die Bezwingung der keltischen Völkerstämme, denen einst Alexander der Große begegnet war, die Besitznahme der Alpenpässe. Überall wurden die Kelten romanisiert.
Da stießen nun aber die Römer nochmals mit den Germanen zusammen, deren Sonderung von den Kelten in diesen Zeiten zwar nicht geschehen, aber zuerst historisch erkennbar ist.
In der Epoche der Oberherrschaft der Kelten über Mitteleuropa haben sich auch Germanen nicht selten ihren Kriegszügen angeschlossen. Das hörte aber auf, seitdem die Römer den keltischen Völkern siegreich entgegentraten. Eine Zeitlang war es zweifelhaft, ob die Römer oder die Germanen das Übergewicht erlangen würden; unwiderruflich war es jetzt an die Römer übergegangen, denen nun die Germanen in ihrer Besonderheit gegenüberstanden.
Die Kämpfe der Römer mit den Germanen, die dann erfolgten, knüpfen unmittelbar an die Unternehmungen Cäsars an. Nach wie vor war den Römern das meiste daran gelegen, den Einwirkungen der Germanen auf Gallien ein Ende zu machen. Mit der Überwältigung gallischer Renitenten beschäftigt, hielt es der Gehilfe des Augustus, Vipsanius Agrippa, für notwendig, noch einmal über den Rhein zu gehen; er war der zweite der römischen Feldherren, der Germanien betrat. Wenn er es ratsam fand, diejenigen den Römern befreundeten Ubier, welche noch auf dem rechten Rheinufer wohnten, auf das diesseitige Gebiet zu verpflanzen, so veranlaßte er dadurch wieder, daß die Sueven, deren Feinde von jeher, um so mächtiger wurden, so daß sie den Rhein überschritten; sie mußten mehr als einmal zurückgewiesen werden. Aber der kleine Krieg dauerte immer fort. Nach einigen Jahren regte sich die alte Feindseligkeit der Sigambern und der von ihnen aufgenommenen Stämme der Usipeter und Tenchterer aufs neue: sie schlugen einige Römer, deren sie habhaft wurden, ans Kreuz, gleich als wäre es ihnen noch darum zu tun gewesen, die erlittene Unbill an den Römern zu rächen. Sie gingen dann über den Rhein, überfielen die römische Reiterei, der sie einen Hinterhalt gelegt hatten, und drangen bis zu dem eigentlichen Lager der Römer, welches Marcus Lollius befehligte, vor; sie erfochten auch hier wider Erwarten den Sieg [16. v. Chr.]. Unter diesem Eindrucke einer fortdauernden Kriegsgefahr von seiten der Germanen, die mit den unbotmäßigen Galliern im Verständnis waren, haben die Römer den Gedanken gefaßt, die Nation, die sich ihnen bei ihrem Vorhaben der Welteroberung in den Weg stellte, mit Gewalt zu bezwingen und ihrem Imperium einzuverleiben.
Nachdem in den nächsten zwanzig Jahren die Germanen bis zur Weser unterworfen worden waren, kam es zu einer Erhebung im innern Deutschland, welche dessen Unabhängigkeit rettete und damit zugleich dem Fortgang der römischen Welteroberung Einhalt tat.
Die Legionen in Germanien waren einem Manne von politisch-militärischem Rufe, der zur Pazifikation eines Landes von zweifelhaftem Gehorsam besonders geeignet erschien, anvertraut worden. Es war Publius Quintilius Varus, dessen Vater zu den Republikanern gehört hatte, der aber selbst durch seine Gemahlin Claudia Pulchra mit der Familie des Augustus in verwandtschaftliche Verbindung getreten war. Als Präses von Syrien hatte er dem kaiserlichen Hause in den Verwicklungen mit Judäa, die zugleich volkstümliche und religiöse waren, die besten Dienste geleistet und die Herrschaft Roms im Osten wesentlich befestigt. Seine Stärke bestand in der Verbindung der jurisdiktionellen Autorität mit dem Übergewicht der Waffen. In Germanien sollte Varus nicht eigentlich Krieg führen, sondern das friedliche Verhältnis ausbilden, das Tiberius angebahnt hatte. Er war von einer Körperbeschaffenheit und Gemütsart, die ihm die stolze Ruhe des Lagers, erwünscht machten. Nicht ohne eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat man den Silberfund von Hildesheim von der Haushaltung, die Varus in seinem Lager eingerichtet hatte, hergeleitet: das prächtige Gerät entspräche seinem Hang und seiner Art und Weise zu leben.
Die Überlieferung ist, Varus habe gemeint, die Germanen durch die Rutenbündel des Liktors und den Ruf des Herolds an die Unterordnung unter die Römer zu gewöhnen; er habe sogar Landesversammlungen abgehalten und Ladungen vor seinen Richterstuhl ergehen lassen. In seinem Lager übte er eine Gerichtsbarkeit aus, die wenigstens nicht allen Germanen unangenehm zu sein schien; denn daß die Streitsachen durch wohlerwogenen Spruch, nicht durch Zufall und Gewalt, etwa durch den Ausschlag eines Zweikampfes, entschieden wurden, war vielen ganz recht. Die meisten jedoch nahmen Anstoß daran: Rede und Gegenrede bei dem Verfahren waren ihnen nicht verständlich; das Leben des Germanen schien davon abzuhängen, ob der Prokonsul in zorniger Aufwallung oder in milder Stimmung sei.
Und wie hätte es der streitbaren Jugend des Landes nicht mißfallen sollen, einem Römer zu gehorchen, der nicht einmal Kriegsruhm besaß? In dem vornehmsten Stamme des Wesergebirges, den Cheruskern, der nach dem Fall der Sigambern der nächste war, auf den sich die römischen Herrschaftsbestrebungen erstreckten, regte sich, ohne das ein besonderer Anlaß gemeldet würde, das eingeborene Selbstgefühl. Der Grund lag ohne Zweifel darin, daß sie dazu beigetragen hatten, den Römern Pannonien zu unterwerfen; in dem dadurch erweckten Bewußtsein ihrer Kraft wollten sie nicht den Römern selbst unterworfen werden wie die Pannonier.
Unter ihnen lebte ein junger Mann, der diese Feldzüge mitgemacht und römische Ehren erworben hatte, nach dem germanischen Kriegsgott Arminius genannt. Der zeitgenössische Geschichtschreiber, der eben auch in Pannonien gedient hat und den deutschen Helden persönlich gekannt haben wird, sagt von ihm: er sei von edler Herkunft, starkem Arm, rascher Auffassung und einer bei den Barbaren ungewöhnlichen geistigen Entschlossenheit gewesen; aus seinen Augen habe das Feuer seiner Seele hervorgeleuchtet. Recht eine Ausgeburt und ein Ausdruck der germanischen Natur: heldenmütig, sorglos, feurig und rasch. Aber das nicht allein; mit diesen Eigenschaften wird man in großen Verwicklungen nicht ausreichen: zugleich leidenschaftlich angeregt und in der Tiefe planvoll.
Das Verhältnis zu den Römern hatte, wie angedeutet, Zwietracht unter den Cheruskern selbst hervorgebracht. Die beiden Parteien, von denen die eine sich fügen wollte, die andere nicht, verfolgten einander mit dem bittersten Haß. Wir vernehmen, daß manche Römischgesinnte von den Gegnern niedergemacht worden sind. Man kann nicht zweifeln, zu welcher Partei Arminius gehörte.
Der erwähnte Geschichtschreiber, der den Begebenheiten sehr nahestand, berichtet: Arminius habe die unsichere Lage der Römer erkannt und nach und nach auch andere überzeugt, man könne sie überwältigen, wenn man sie in ihrer vermeintlichen Sicherheit angreife. Zur Ausführung eines solchen Gedankens aber gehörte, daß man ihn in undurchdringliches Dunkel verhüllte.
Wohl wurde Varus gewarnt von den Vornehmsten der Cherusker selbst, einmal oder zweimal. Die ersten, unter denen Segestes genannt wird, sollen dem Prokonsul den Vorschlag gemacht haben, die Führer der beiden Parteien verhaften zu lassen und eine Untersuchung anzustellen, wem er am meisten vertrauen dürfe. Aber Varus achtete nicht darauf; er sah, wie es scheint, in dem Hader der Stammeshäupter nur einen persönlichen Zwist; er bildete sich ein, die, die bei ihm verklagt wurden, oftmals seine Tischgenossen, auf immer an seine Person gefesselt zu haben. Immer weiter griff der nationale Widerwille um sich. Die Anwesenheit der Legionen in einem festen Lager, das den Mittelpunkt aller weiteren Fortschritte der Römer bildete, schien der Jugend des Landes, welche Verlangen danach trug, in der bisherigen Ungebundenheit, die dem alten Herkommen entsprach, zu leben, unerträglich.
Man faßte den Entschluß, den verhaßten Feind anzugreifen, aus dem Lande zu treiben oder zugrunde zu richten.
In dem ausführlichen Bericht, den Dio Cassius aufbewahrt hat, lesen wir: Varus habe von seinem Lager aus eine Anzahl fester Positionen eingenommen, mit denen er die feindseligen Regungen niederzuhalten meinte, und dann sich verleiten lassen, zur Unterdrückung eines Aufruhrs, dessen Ausbruch ihm gemeldet wurde, tiefer in das Land vorzurücken. Indem die Römer auf einem Zuge durch eine Landschaft, die noch keine Straßen darbot, in Verlegenheit gerieten, schritten die einverstandenen Stammeshäupter dazu, den in der Stille vorbereiteten Angriff ins Werk zu setzen. Die Natur des Landes kam den Germanen zu Hilfe. Es ist der Nachteil, in den eine militärisch disziplinierte Armee bei ihrem Vorrücken durch eine im primitiven Zustand befindliche Waldregion gerät, welchen uns die weitere Erzählung darbietet. Die vielfach durchschnittenen Anhöhen, die Talgründe, die man überbrücken mußte, anhaltende Regengüsse, die den Weg noch schwieriger machten, ein hinzutretender Sturm, in welchem die Äste und Wipfel der mächtigen Bäume herabstürzten, – alles dies wirkte zusammen, um die Römer an dem Aufschlagen einer regelmäßigen Lagerbefestigung zu verhindern; ihre in der Eile aufgeworfene Verschanzung wurde von den herandringenden Germanen angegriffen und erobert. Man wird dabei, wenn es erlaubt ist, so fernabliegende Ereignisse zu vergleichen, an die Lage von Saratoga erinnert, welche die Freiheit von Amerika begründet haben: auch in dem Angriff der Germanen lag doch eigentlich Verteidigung …
Durch den unerwarteten Unfall mitten im Glück in seiner Seele gebrochen, tötete sich Publius Quintilius Varus, nachdem er für die Sache des Augustus im Kampfe unterlegen war. Einer der Unterbefehlshaber, Cejonius, hat es, dem älteren Berichte zufolge, über sich gewonnen, als er den größten Teil der Körner vernichtet sah, sich gefangen zu geben, wurde aber von den Siegern umgebracht: denn Erbarmen kannten diese nicht. Die Anwälte in den Gerichtssitzungen, die ihnen in die Hände fielen, haben die Germanen getötet, gleich als würde damit nur eine zischende Natter aus der Welt geschafft.
Viele Römer von vornehmster Herkunft, die sich bei Varus befanden, weniger um den Krieg zu lernen, als durch den Kriegsdienst sich den Weg zu senatorischem Range zu bahnen, sind dabei in Gefangenschaft geraten und mußten fortan als Hirten oder Hauswächter dienen.
Die gleichzeitigen Römer gaben das Unglück der Verblendung des Varus, der Feigheit der andern Führer, noch mehr aber dem dunklen Walten des Geschickes Schuld. Und auch die Geschichte muß bestätigen, daß dem Ereignis eine allgemeine und auf immer nachwirkende Bedeutung zukommt. Augustus, erzählt man, habe in heftiger Erregung von dem Schatten des Varus die ihm anvertrauten Legionen zurückgefordert. Er soll selbst eine Bewegung in Rom gefürchtet und Vorkehrungen gegen eine solche getroffen haben; denn sein Thron beruhte auf der Meinung von der Unbezwinglichkeit seiner Kriegsheere.
Aber die Germanen hatten es bloß auf Abwehr, nicht auf eigene Angriffe abgesehen. Lucius Asprenas, der Neffe und Legat des Varus, hütete mit ein paar andern Legionen den Rhein und sorgte dafür, daß das rechtsrheinische Gebiet nicht völlig verlorenging.
So hat Augustus selbst noch erleben müssen, daß, wie im Osten durch die Parther, so im Westen durch die Germanen dem römischen Reiche Grenzen gesetzt wurden. Eben das gehört zur Signatur der Zeit, daß die innere Konsolidation und die äußere Begrenzung, wenigstens die kontinentale, in dem Leben des Augustus zusammentreffen.
Nach seinem Tode trat nun vor allem das Werk der Konsolidation des Reiches hervor, das wir sogleich berühren werden. Nachdem das Prinzipal einen Fortsetzer in Tiberius gefunden hatte, wurde der Krieg gegen Germanien, der aber nicht, wie früher, auf Landeseroberung zielte, sondern nur darauf, die Ehre der römischen Waffen herzustellen, wieder aufgenommen.
Mit seinen nach einigem Schwanken zu vollem Gehorsam zurückgeführten Legionen drang der Neffe des Tiberius, Sohn des Drusus, der bereits den Beinamen Germanikus getragen hatte, unter dem wir seinen Sohn allein kennen, in Deutschland ein, um die Germanen wieder des Sieges zu entwöhnen, die erlittene Niederlage an ihnen zu rächen.
Im Jahre 15 hatte er die Überreste der in der Varusschlacht gefallenen Römer begraben; doch hatte der Anblick des Schlachtfeldes einen solchen Eindruck auf die Gemüter gemacht, daß bei dem Rückzug, welcher, sowie Armin sich erhob, angetreten werden mußte, der Schatten des Varus schreckend vor dem Anführer Cäcina aufstieg.
Im Jahre 16 machte Germanikus den Versuch, den empörten Volksstämmen von einer andern Seite her beizukommen. Er hat da zweimal einen Vorteil erfochten, das erstemal bei jenem Walkürenfelde Idistaviso, das zweitemal bei dem sogenannten Steinhuder Meer, wo er sich ein blutiges Andenken stiftete. Dadurch war die Niederlage erst gerächt; die beiden in die Hände der Germanen gefallenen Adler waren auf die eine oder die andere Weise wieder herbeigebracht worden. Aber an Unterwerfung war nicht zu denken. Ein Sturm, welcher die Flotte traf, verleidete den Römern vollends jeden Gedanken an eine Erneuerung des Kampfes. Die Erinnerung an Varus, der Schrecken des Meeres wirkten zusammen.
Entscheidend war aber die Entschließung des Liberius selbst. Dieser hielt dafür, wie er an Germanikus schrieb, daß man nun genug gekämpft und genug Unfälle erlitten habe; für die Niederlage des Varus sei Rache genommen und in Germanien nichts mehr durch offene Waffen zu erreichen: man müsse die Germanen ihren inneren Entzweiungen überlassen.
Tiberius bekräftigte dies mit dem eigenen, von ihm gegebenen Beispiel. Noch einen andern allgemeinen politischen Grund könnte man nicht in Abrede stellen. Denn welches auch der Ausgang der Kriege in Deutschland sein mochte, so berührte derselbe die höchste Gewalt in Rom zu nahe, um leichthin versucht zu werden. Wenn sie unglücklich verliefen, so wurden die Zustände in Gallien und Italien selbst bedrohlich. Aber auch ein glücklicher Erfolg war gefährlich, da ein solcher dem Cäsar in Rom leicht einen Nebenbuhler verschaffen konnte. Aus allen diesen Gründen hat Tiberius den Germanikus abberufen und den ferneren Angriffen auf Deutschland Einhalt getan – eigentlich eine Entschließung, welcher in der Verflechtung der geschichtlichen Ereignisse eine hohe Bedeutung zukommt: die beiden Welten, die germanische und romanische, wurden dadurch fürs erste voneinander geschieden.
Die Germanen wurden, wie Tiberius mit Recht bemerkte, für die römische Welt durch ihre inneren Entzweiungen unschädlich. Schon bei den Rachezügen des Germanikus war das zutage gekommen.
Arminius hatte sich mit der Tochter jenes Segestes vermählt, der ihn einst bei Varus angeklagt hatte. Von der durch den Sieg zur Herrschaft gelangten Partei bedrängt, rief Segestes gleich bei dem ersten Zuge des Germanikus die Römer zu Hilfe, und diese befreiten ihn aus der Burg, in welcher er belagert wurde. Die Gemahlin des Arminius selbst fiel in ihre Hände. Anschaulich und schön wird sie von Tacitus geschildert: sie vergoß keine Tränen, sie ließ keine Bitten vernehmen; sie hielt die Hände an dem Busen zusammen und schaute auf ihren schwangeren Schoß. Sie teilte die Gesinnung ihres Gemahls, nicht die ihres Vaters; ihr Schicksal lag darin, daß sie im Streite zwischen beiden in die Hände der Feinde geraten war; sie ist die erste deutsche Frau, welche in der Historie erscheint; auf dem größten und berühmtesten aller geschnittenen Steine des Altertums, der die Apotheose des Augustus, den Triumph des Germanikus darstellt, glaubt man ihr Abbild zu entdecken. So ist auch Armin eigentlich die erste greifbare, verständliche Gestalt der deutschen Urzeit. Keine Sage hat ihn durch populäre Ausschmückung der Geschichte entrückt; sie würde ihn den Blicken wieder verhüllt haben.
Mit doppelter Kriegsleidenschaft erfüllte es Armin, daß seine Gemahlin samt seinem Kinde in die Hände der Römer gefallen war. Dann aber forderte noch eine ältere Feindseligkeit seine Tatkraft heraus. Es war die einen Augenblick beschwichtigte, dann wieder ausgebrochene Zwietracht zwischen Cheruskern und Sueven, von welcher das gegenseitige Verhältnis der germanischen Stämme untereinander eine Zeitlang beherrscht wurde. Marbod war während des Kampfes zwischen Cheruskern und Römern, der so höchst unerwartet ausbrach, ruhig geblieben. Nun aber rief die emporkommende Macht der Cherusker die alte Eifersucht wieder wach. Semnonen und Langobarden fielen von Marbod ab und traten dem Kriegshelden bei; aber auch Marbod hatte, und zwar unter den Cheruskern selbst, Bundesgenossen, was die volle Entwicklung der Macht dieses Stammes unter Arminius überhaupt verhinderte. Zwischen Marbod und Arminius ist es zu einer großen Feldschlacht gekommen, die jedoch zu keiner definitiven Entscheidung führte. Marbod rief die Hilfe der Römer an; diese aber sahen der Feindseligkeit der Germanen untereinander mit selbstsüchtiger Ruhe zu. Marbod erschien ihnen allezeit sehr gefährlich. Tiberius hatte dessen Verhältnis zu Rom mit dem verglichen, in welchem einst Philipp von Mazedonien zu Griechenland, Pyrrhus zu den Römern gestanden, – nicht mit Unrecht, wie ja die vornehmsten der späteren Angriffe gegen Rom eben von Stämmen vollzogen wurden, die dem Reiche des Marbod angehörten. Auch die Gotonen werden unter diesen genannt. Ein vornehmer Gotone aber war es, der, von Marbod verjagt, in der gefährdeten Lage desselben den Mut faßte, in dessen Gebiet mit einer starken Mannschaft einzubrechen; es gelang ihm, unterstützt von einigen Großen, die Burg des Reiches einzunehmen, in welcher die einst von den Sueven zusammengeraubten Schätze aufbewahrt wurden. Marbod verzweifelte, sich zu behaupten, und nahm die Einladung des Tiberius, nach Italien zu kommen, an (im Jahre 19 unserer Ära). Eine lange Reihe von Jahren hat er noch in Ravenna, wohin auch einer der pannonischen Häuptlinge gebracht worden war, gelebt: seine Anwesenheit diente dazu, die Feindseligkeiten der Völkerschaften, über die er geboten hatte, im Zaum zu halten.
Auf der andern Seite geriet auch Armin in Verdacht, nach einer allgemeinen Oberherrschaft zu trachten. Von seinen eigenen Verwandten ist er umgebracht worden.
Von weiteren Vorgängen in dem inneren Germanien erfahren wir lange Zeit wenig; die Germanen blieben auf sich selbst angewiesen. Aber eben dies ist die Zeit, aus der wir einen Bericht über ihre Zustände von Meisterhand besitzen, der uns einen Blick in die älteste occidentale Welt und zugleich in die deutsche Vergangenheit eröffnet.
Die Griechen sind auf ihre Heldensagen und deren poetische Darstellung, die Homer auf eine mannigfaltig ausgearbeitete, aber doch ebenfalls mit Dichtung erfüllte Tradition verwiesen; die Urzeit der Germanen wird von einem Historiker ersten Ranges geschildert, der sie gekannt hat; es ist Cornelius Tacitus.
Schon ein Menschenalter vorher hatte der Philosoph Seneca den moralischen Wert und die hohe Bestimmung der Germanen hervorgehoben. Wo finde man, sagt er, eine Nation, die mutvoller, waffenbegieriger, zu jeder Unternehmung bereitwilliger sei als die Germanen? »In den Waffen werden sie geboren und erzogen, auf nichts anderes wenden sie Sorgfalt. Gegen die Härte ihres Himmels sind sie wenig geschützt. Sie wissen nichts von verweichlichendem Luxus oder von Reichtum. Wenn sie vernünftige Ausbildung und strenge Zucht erhalten, so wird es auch für Rom notwendig werden, auf die echt römischen Sitten zurückzukommen.« In diesem Sinne nun sah sie Tacitus an.
Auffallend vor allem ist bei ihm, wie weit er den Begriff Germanien ausdehnt. Er betont den germanischen Ursprung der Nervier und Trevirer auf das stärkste und schildert dann das linke Rheinufer, obwohl den Römern unterworfen, doch als ein im Grunde germanisches Land; in Wahrheit ist den Germanen die Hut der Grenzen und des Flusses selber anvertraut. Denn nicht dazu sind sie aufgenommen worden, um bewacht zu werden, sondern um zu bewachen. Die oberrheinischen und niederrheinischen Stämme des linken Ufers sind noch alle Germanen, nur mit dem Unterschied, daß jene ihre volle Freiheit bewahren, diese dem römischen Imperium angehören.
Leicht geht Tacitus über das Dekumatenland weg, das von Galliern bevölkert ist; berichtet aber dann über deren vorliegende Grenznachbarn, die Chatten, deren Gesinnung er in den Worten schildert, daß sie nicht sowohl die Schlachten lieben als den Krieg. Mit Vorliebe erwähnt er die Mattiaker – sie saßen damals am Taunus –, welche die römische Autorität am meisten anerkennen, ferner die Usipeter und Tenchterer den Ubiern gegenüber. An Stelle der Brukterer, mit denen Drusus geschlagen hatte, finden wir bei Tacitus die Chamaver und Angrivarier, von denen die Brukterer niedergeworfen, wenn auch nicht vernichtet worden waren; Tacitus preist die Gunst der Götter, die den Römern vergönnt habe, die Germanen sich untereinander zugrunde richten zu sehen. Eigentlich nur bis zu den Friesen reicht seine Kunde. Die Seefahrten waren aufgegeben; von der Elbe hörte man kaum mehr; man sprach auch hier von den Säulen des Herkules, genauere Kenntnis legt Tacitus erst wieder an den Tag, wo er der germanischen Völker am linken Ufer der Donau gedenkt. Er erwähnt die Hermunduren in ihrem friedlichen Verkehr mit den Römern und die Beziehungen der Markomannen und Quaden zu denselben, die noch Könige aus einheimischem Stamme haben, jedoch nicht ohne Einwirkungen von Rom zu erfahren. Das Verhältnis der Germanen zu Rom bildet den vornehmsten Gegenstand seiner Aufmerksamkeit. Und was hätte für Rom wichtiger sein können als die Nachbarschaft einer großen Nation, die das Rheingebiet zu beiden Seiten des Flusses inne hatte und an der oberen Donau mächtig vordrang? Von dem inneren Germanien hat Tacitus keinen deutlichen Begriff.
Und auch in dem, was er über die volkstümlichen Institutionen mitteilt, ist er nicht selten vieldeutig und dunkel. Aber dabei sind doch die Nachrichten, die er gibt, unschätzbar. Wir dürfen von dem Moment nicht scheiden, ohne das eine und das andere, was bezeichnend ist, hervorzuheben. Vor dem Inhalt seines Berichts über die Religion der alten Germanen treten die Kombinationen mit anderweiten Mythologien, die er selbst andeutet und die man sonst daran geknüpft hat, zurück: so eigenartig und charakteristisch erscheint sie. Wie Tacitus die Germanen als ein unverfälschtes Urvolk betrachtet, so hat auch die religiöse Stammessage, die er mitteilt, ein autochthonisches Gepräge. Von dem Gotte, der selbst wieder aus der Erde geboren ist, stammt der Urvater des Volkes, von dessen drei Söhnen die Stämme, welche die Nation bilden, ihren Ursprung herleiteten: Ingävonen, Istävonen, Herminonen, deren Namen wieder in späteren Götternamen auftauchen. Es ist ein vergebliches Bemühen, die verschiedenen Völkerschaften, welche in der Geschichte auftreten, auf diese Stämme zurückzuführen. Die Sage hat mehr einen religiösen Inhalt: man nimmt darin die Idee der Gemeinschaft der Nation wahr, die jedoch nur in dunklem Bewußtsein festgehalten wurde.
Die Germanen verehrten die Gottheit nicht in Tempeln; die dichtesten Haine waren ihre Tempel: dahin bringt man die eroberten Adler; von da entnimmt man die Zeichen, unter denen man ausrückt. Das Wiehern der in den heiligen Hainen aufgezogenen Rosse gilt bei ihnen als eine bessere Vorbedeutung der Zukunft, als Vogelflug oder Schau der Eingeweide.
Die Semnonen, welche nach der Zeit Marbods als die mächtigsten unter den Sueven erscheinen und sich für die ältesten und vornehmsten von allen halten, schicken ihre Abgeordneten an die Stätte uralter und unvordenklicher Anbetung, von welcher sie ihren Ursprung herleiten: da wohne der Gott, der die Welt beherrsche: alles andere müsse ihm unterworfen sein. Der Dienst des Gottes beginnt mit dem Opfer eines Menschen: niemand wagt den Hain anders als gebunden zu betreten, zum Zeichen wahrscheinlich doch der vollen Abhängigkeit der Lebenden von der Gottheit. Sie feiern gleichsam das Geheimnis ihres Ursprunges und ihrer Macht.
Nirgends tritt diese Idee großartiger hervor als in der Verehrung der Mutter Erde, welche Langobarden, Angeln, Varinen und andere Völker vereinigte. Man verehrt in ihr nicht allein die allgemeine Mutter, sondern die lebendige Göttin, welche ihre Völker besucht und sich um sie bekümmert. Auf einer Insel des Ozeans ist ein von dem Unheiligen rein gehaltener Hain, in welchem sie erscheint. Nur Einem Priester ist es erlaubt, in einem Allerheiligsten ihre Gegenwart wahrzunehmen und zu verkündigen. Auf einem bereit gehaltenen bedeckten Wagen, den nur dieser Priester zu berühren die Erlaubnis hat, wird sie dann unter dessen Vortritt einhergefahren. Es ist eine Art von Gottesfriede, den sie verkündigt. Die Nationen, welche sie verehren, sind von verschiedenen Stämmen; während der Anwesenheit der Göttin aber ruhen die Waffen, bis die Göttin, befriedigt durch den Anblick der Ihren, zurückgefahren und in den See des Haines gebadet, verschwindet. Die Sklaven, welche bei ihrer Umfahrt Dienste geleistet haben, werden in demselben See ertränkt: ohne Schrecken ist das Göttliche nicht.
Unverkennbar ist, wie nahe sich diese Zeremonien mit der Stammessage berühren. Die Mutter Erde und der Gott, welcher der Stammvater der Nation ist, erscheinen nebeneinander, der eine und die andere an ihrer besonderen Stätte; in der Idee gehören sie ohne Zweifel zusammen.
Von einem beherrschenden priesterlichen Einfluß, wie ihn die Druiden in Gallien ausübten, ist bei den Germanen nicht die Rede. Auch halten sie nicht klanartig an einem geborenen Stammesoberhaupt zusammen. Die Stammesverfassungen beruhen, wie wir sie kennenlernen, auf dem Begriff individueller Freiheit. Der Priester, der überhaupt nicht als Gebieter, sondern als Vollzieher uralter Satzungen auftritt, hat bei den Landesversammlungen, in welchen die großen Landesangelegenheiten beraten werden, eine gewisse Befugnis, die aber nicht weitergeht als auf die Erhaltung der allgemeinen Ordnung; in die Beratung greift er nicht ein; diese hängt von den freien Männern ab, die aus ihren Wohnsitzen dazu herbeigekommen sind, nicht gerade auf den festgesetzten Tag: denn zu ihrer Freiheit gehört es, auch hierin nicht vollkommen gebunden zu sein.
In dieser politisch-militärischen Verfassung hatte seit Cäsar schon eine gewisse Veränderung stattgefunden.
Bei Cäsar tritt die Idee des Stammes noch überwiegend hervor: an dem hohen Rat der Vornehmsten und Stammeshäupter nimmt auch die Menge teil. Hier werden kleinere Unternehmungen beschlossen; dem, der sie vorschlägt, gesellt sich eine freiwillige Jugend bei. Wenn der ganze Stamm in Krieg gerät, wird ein Anführer ernannt, dem das Recht über Leben und Tod zusteht. Anderthalb Jahrhunderte später, in den Zeiten, in welchen Tacitus schrieb, tritt das Moment, daß kleinere Unternehmungen unter einem Führer, dem sich ein freiwilliges Gefolge anschließt, ausgeführt werden, in den Vordergrund. Diese freien Gefolgschaften, welche sich zu Kriegszügen vereinigen, die doch von der allgemeinen Landesversammlung nicht beschlossen sind, finden sich nirgends in der Welt wieder. Sie entsprechen dem natürlichen Trieb zu einer freien Kriegsübung, welche doch nicht ohne eine innere Ordnung sein kann.
Fürsten, zuweilen auch Könige, stehen an der Spitze. Was bedeuten aber diese Namen? Gab es einen Uradel der Nation, aus welchem sie hervorgingen, oder sind sie ein Erzeugnis der Umstände und der damit zusammenhängenden Unternehmungen überhaupt? Daß dabei auch eine Wahl vorkommt, ist unzweifelhaft, ebenso aber, daß auf Herkunft und Verdienst der Ahnherren Rücksicht genommen wird. In den Gefolgschaften gibt es verschiedene Grade, gleichsam eine Rangordnung. Der Führer und das Gefolge hängen aber wieder durch das Gefühl gegenseitiger Verpflichtungen zusammen: der Führer sorgt für das Gefolge; das Gefolge ist verpflichtet, den Führer bis aufs äußerste zu verteidigen.
Doch genug hiervon für meinen Zweck, der nur dahin geht, die Grundzüge der alten Zustände in Erinnerung zu bringen. Die Germanen besaßen religiöse Institutionen von einem gewissen Tiefsinn, obwohl ohne Doktrin, politische und militärische Einrichtungen, welche für die Zukunft maßgebend werden, und eingeborene Elemente der Kultur, welche später reifen sollten.
An eine allgemeine Einheit war nicht zu denken; aber durch männliche Tugend, strenge Sitte und persönliches Verdienst wird doch alles zusammengehalten, welch ein Mißbrauch des Wortes wäre es, sie als Barbaren zu bezeichnen! Und so stark war das alte Germanien trotz seiner Entzweiungen, daß es dem Fortschritt der römischen Eroberung Einhalt tat und noch auf einige Jahrhunderte eine Welt für sich blieb.
Zweites Kapitel. Weichen der Römer. Emporkommen der Franken
Die Sagengeschichte, die sich in jedem Stamme besonders gebildet hat, gehört einem andern Gesichtskreis an, als dem rein historischen. So mag es mir denn auch bei den Franken erlaubt sein, von den Erzählungen, die ein mehr oder minder fabelhaftes Gepräge tragen, abzusehen.
Das große Ereignis, durch welches der Zustand der westlichen Welt – ich weiß nicht, ob man sagen soll, verändert oder nur wiederhergestellt worden ist – die massenhafte Ansiedlung der Germanen auf dem linken Rheinufer, ist nicht erst eingetreten, nachdem die Römer ihre Grenzbefestigungen am Rhein aufgegeben haben; man muß es – denke ich – in die Zeit setzen, in welcher Magnentius die römischen Grenztruppen am Rhein gegen Constantius [um 350] ins Feld führte; der hatte fränkische Scharen auf seiner Seite. Indem er nun aber den Limes am Rhein der Besatzungen entblößte, welche den Germanen immer die Spitze geboten hatten, wurden diese in dem Rheingebiete überhaupt mächtig. Aus einer Stelle des Libanius über Julian entnimmt man, wie oben angedeutet, daß das Eindringen der Germanen in das römische Gebiet in diese Epoche gefallen ist; man gab es dem Mangel an römischen Truppen in jenen Regionen, noch mehr aber der Aufforderung des Constantius schuld, welcher in der Absicht, Magnentius, der in den Grenzgebieten seinen vornehmsten Rückhalt hatte, zu widerstehen, die Umwohner aufgefordert habe, sich an die bestehenden Verträge nicht weiter zu kehren und so viel Land zu nehmen als sie könnten. So ergossen sich die Germanen über das römische Rheingebiet. Die römischen Kastelle wurden umlagert, die Vici eingenommen; man sah die Einwohner mit ihren Habseligkeiten in kläglicher Gestalt abziehen. Wer Weib und Kind vor Insulten zu schützen versuchte, wurde niedergehauen. Die Dienstfähigen wurden zum Anbau des germanischen Landes abgeführt, während die Germanen in den eroberten Territorien verblieben. Denen, die sich in festen Städten behaupteten, blieb doch nur ein sehr geringes Gebiet übrig; sie waren genötigt, innerhalb der Mauern selbst die freien Plätze mit dem Pflug zu beackern, um von dem Ertrag der Saaten zu leben; sie waren beinahe noch schlechter daran als die gefangen Fortgeführten …
Das Wesentliche der Weltbewegung liegt darin, daß die Franken, welche in Gallien vordrangen, eben solchen Stämmen angehörten, in denen das altgermanische Wesen auf das stärkste ausgeprägt war. Auch darin unterscheiden sich die Franken von den Goten, daß ihre Stämme nicht in den militärischen Dienst der Römer eingetreten sind. Wenn das bei einigen Oberhäuptern der Franken früher der Fall gewesen ist, so hat es doch mit dem Vordringen der Stämme nichts zu schaffen.
Die erste aggressive Bewegung fränkischer Stämme gegen das römische Reich wird von König Chlojo gemeldet, der sich erst über den Zustand der Römer in den Grenzlanden unterrichtet und dann mit einem zahlreichen Heer über den Rhein geht, durch den Kohlenwald nach Tournai, dann nach Cambrai vordringt, hier die Römer entweder vor sich hertreibt oder niedermacht und dann eine Richtung gegen die Somme hin einschlägt [um 450]. Über dies letzte Unternehmen haben wir ein Zeugnis, gegen dessen historischen Wert sich keine Einwendung machen läßt, in dem Panegyrikus des Sidonius auf Majorian, der sich schon lange vor seiner Thronbesteigung im Gebiet der Atrebaten mit Chlojo geschlagen hat. Man sieht da vor allem den Eindruck, welchen die Erscheinung der Franken auf die Gallo-Römer machte. Ihr blondes Haar ist von dem Nacken über die Stirn gezogen, man erblickt nur eben den glänzenden, weißen Nacken; man nimmt ihre blauen scharfen Augen wahr. Panzer tragen sie nicht, wohl aber sind sie mit Schilden bewehrt. Ihr Knie ist nackt, aber die hohen Gestalten treten bei der enge anschließenden Kleidung um so kräftiger hervor. Sie vergnügen sich damit, ihr Wurfgeschoß in die Luft zu schleudern, doch mit sicherem Blick, wo dasselbe treffen wird. Dem eilen sie dann mit beinahe wetteifernder Geschwindigkeit nach. Noch als Knaben haben sie sich an die Waffen gewöhnt und sind derselben vollkommen mächtig geworden; wenn sie einmal unterliegen, so weichen sie doch nicht zurück; sie fallen auf der Stelle, gleich als wären sie unbesiegt, wie Sidonius sagt; sie leben gleichsam noch nach ihrem Tode.
So erscheint die kriegsbereite Jugend dieser wohlgeordneten germanischen Stämme in offenem Kampfe gegen die Römer in den belgischen Provinzen. Es bildete eine neue Phase in dem Kampfe, auf welchem die Fortentwicklung der Weltgeschichte beruht, wenn diese fränkischen Scharen, indem sie auf eigene Hand und, ohne sich von ihren Stammesgenossen loszureißen, zu neuen Unternehmungen schritten, unter dem Nachfolger Chlojos Meister der Grenzgebiete wurden. Sie hatten dann einen nationalen Rückhalt; eine Organisation konnte gegründet werden, der nach beiden Seiten hin ein entscheidender Einfluß zufallen mußte.
Vornehmlich unter Chlojos Enkel Chlodwig (481–511) dehnten die Franken unter siegreichen Kämpfen mit den Römern, Alemannen, Burgunden und Goten ihre Herrschaft in Gallien aus.
Chlodwig ist der Mann, durch welchen im Gegensatz zwischen den Römern und den Germanen der entscheidende Schritt zu einer beide Elemente umfassenden neuen Ordnung der Dinge geschehen ist. Durch die Siege, die er erfocht, brachte er die höchste Autorität in Gallien in die feste Hand eines mächtigen Königsstammes. Er trat gleichsam in die Stelle des Kaisertums und hielt dadurch die Idee der Katholizität, die in demselben vorwaltete, allen Abweichungen kirchlicher Natur gegenüber aufrecht. Dadurch eröffnete er zugleich den Franken und allen Germanen die Möglichkeit, weiteren Fortbildungen Raum zu geben in engster Verbindung mit der allgemeinen Kultur, die sich nun einmal an die Kirche des athanasianischen Bekenntnisses anschloß. Wir erörtern nicht seine moralischen Qualitäten. Chlodwig erscheint in der Mitte der Zeiten und Nationen als eine heroische Kraft, die ihre Verbindung begründet und sie gleichsam vermittelt; auf seinen Handlungen beruht die Geschichte von Deutschland und Frankreich …
Es ist ein vielleicht nicht von hohem geistigen Schwunge ausgegangenes Ereignis, aber von unausdenkbarer historischer Wirksamkeit so für Gallien wie für die Welt überhaupt, daß Chlodwig mit seinem Gefolge das Christentum annahm.
Indem diese Kriegsgenossenschaft hierauf den Glauben unter den stammverwandten Franken und anderen Germanen bis an den Rhein und über den Rhein ausbreitete, machte sie der uralten Feindseligkeit der germanischen Völker gegen Römer und Gallier ein Ende. Sonst möchte eine vollkommene Germanisierung, wie sie im Rheintal, den Niederlanden und Britannien sich vollzog, auch an der Marne und Seine nicht verhindert worden sein. Die Religion glich, wie ihre Bestimmung ist, den schroffsten Gegensatz der Nationalitäten aus; die Franken konnten die Stätten, wo sie anbeteten, nicht mehr zerstören wollen. Vielmehr schlossen sie sich ihren Bekehrern auch in der besondern Form des Glaubens und des Dienstes, welche diese ihnen überlieferten, mit frischem Eifer an. Noch war der Streit zwischen dem katholischen und dem arianischen Bekenntnis nicht ausgefochten; das letztere, zu dem sich Westgoten und Burgunder hielten, erlangte durch die Einwanderung dieser Völker eine neue Macht in Gallien, zum tiefsten Mißvergnügen der rechtgläubigen Bischöfe. Aber eben bei den Franken, mit denen manche von ihnen schon lange in Verbindung standen, fanden sie Hilfe. Der heilige Remigius, der Chlodwig und sein Volk zu Reims in die Kirche aufgenommen hat, war nicht nur als ein Zerstörer der Götzenbilder, sondern auch als ein glücklicher Streiter gegen die Arianer berühmt. Der Ehrgeiz des fränkischen Heerkönigs und der Religionseifer der romanischen Bischöfe traten in den engsten Bund. Unterstützt von der Bevölkerung des Landes warfen Chlodwig und seine Söhne die Macht der germanischen Könige, welche Arianer waren, in Gallien nieder und blieben Meister in allen Provinzen, sowie sie ihre Herrschaft weit nach dem innern Germanien hin ausdehnten. Sie vollzogen, was das römische Reich nicht mehr vermocht hatte, sie wehrten den Andrang des kolonisierenden Germanentums von Gallien ab und bezwangen im Innern die abweichenden Sekten. Die Eroberer beschützten die romanische Nationalität und die Einheit der katholischen Kirche. Als dem römischen Reiche seine Waffen versagten, ward der allgemeine Ruin durch die bekehrten Barbaren verhütet.
Wie mancher von den blondgelockten Königen erschien gleichsam als ein Priester Gottes und wollte so erscheinen. Wenn sie ihre Schätze der Kirche zuwandten, so lag ihnen ohne Zweifel daran, die Pracht des äußeren Dienstes zu vermehren; aber zugleich hatte ihre Freigebigkeit auch eine Beziehung auf das besiegte Volk. Die Schriftsteller der Zeit bezeichnen es als den vornehmsten Beweggrund zu den Schenkungen an die Kirche, daß sie genug haben müsse, um freigebig zu sein, damit diejenigen, welche nichts besitzen, doch etwas besitzen; und man kennt die Satzung des Konzils von Orleans, nach welcher der Ertrag der von dem König geschenkten Ländereien auch zur Ernährung der Armen und zum Loskauf der Gefangenen bestimmt sein soll. Die Kirche brachte die bisher ganz verabsäumte unterste Klasse der Bevölkerung und ihr Bedürfnis mit dem Sieger in Beziehung.