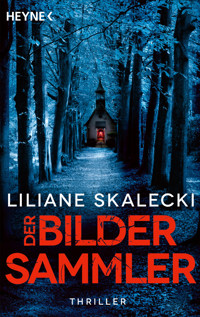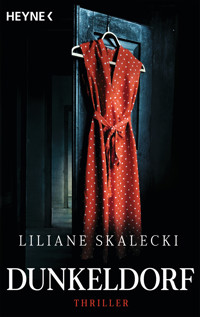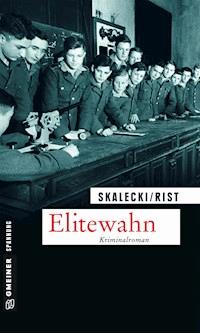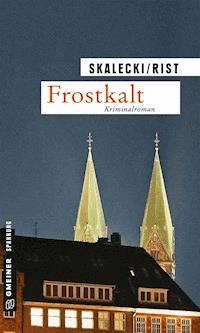Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Malie Abendroth und Lioba Hanfstängl
- Sprache: Deutsch
Die Gärtnerin Malie traut ihren Augen nicht - wie ist das artgeschützte Schuppentier auf die Insel Mainau gelangt? Gemeinsam mit der Tierschützerin Lioba versucht sie, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Als ein chinesischer Arzt ermordet wird, und jemand versucht, bei ihr einzubrechen, wird klar, dass die beiden Frauen in ein Wespennest gestochen haben. Mehr und mehr verdichten sich die Hinweise, dass ein Malie nahe stehender Mann vom Aussterben bedrohte Tiere schmuggelt. Ein gefährliches Spiel beginnt...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liliane Skalecki / Biggi Rist
Ausgerottet
Der. 1. Fall für Malie Abendroth und Lioba Hanfstängl
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Aus dramaturgischen Gründen haben wir eine Außenstelle des Referats 55 – Abteilung 5 – des Regierungspräsidiums Karlsruhe für Natur- und Umweltschutz in Konstanz erschaffen, das im Roman auch noch für Bauvorhaben zuständig ist.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Galyna Andrushko / shutterstock.com
ISBN 978-3-8392-5346-5
Widmung
Für Ralf, wie wunderbar, dass es dich gibt. Biggi.
Für Georg, Marian, Arlena und Marcel. Liliane.
Für Paul – stellvertretend für die bedrohten Tierarten dieser Welt.
Zitat
»Der Einzige, der einen Ozelotpelz wirklich braucht, ist der Ozelot.«
Bernhard Grzimek
»Eine der blamabelsten Angelegenheiten ist es, dass das Wort ›Tierschutz‹ überhaupt geschaffen werden musste.«
Theodor Heuss
»Wenn der Mensch den Tiger umbringen will, nennt man das Sport. Wenn der Tiger den Menschen umbringen will, nennt man das Bestialität.«
Georg Bernhard Shaw
»Die Natur braucht sich nicht anzustrengen, bedeutend zu sein. Sie ist es.«
Robert Walser
Personen
Malie Abendroth: Begeisterte Gärtnerin auf der Insel Mainau
Alicha Kurz: Malies Zwillingsschwester, Tierärztin im Leipziger Zoo
Jonas – Jo – Rosenfeld: Bruder der Zwillinge
Pranee Rosenfeld: Mutter von Malie, Alicha und Jo
Markus Rosenfeld: Pranees Schwager und Inhaber von Rosenfeld ImpEx
Patrizia Rosenfeld: seine Ehefrau
Falk Andresen: Malies Jugendfreund, Fotograf
Neo Schwarz: Freund und Kompagnon von Jonas Rosenfeld
Max Losens: Referatsleiter im Amt für Bau, Natur- und Umweltschutz Konstanz
Huang Cai: Heilpraktiker in Litzelstetten
Rufus Trenkwitz: Zoohändler in Konstanz
Lioba Hanfstängl: Tierschützerin und Angestellte beim Amt für Bau, Natur- und Umweltschutz Konstanz
Kemal Demir: Journalist und Freund von Falk Andresen
Elin Demir: seine Frau
Lisa Röhrig: Medizinische Fachangestellte bei Huang Cai
Wim Röhrig: Lisas Bruder und Mitstreiter von Lioba Hanfstängl
Tiere
Paul : Ohrenschuppentier aus Vietnam
Rajah: Sibirischer Tiger/Amurtiger
Prolog
Über die Jahre des Wartens auf die ganz große Story war er zumindest reich an Erfahrungen geworden. Die Erfahrung, dass andere ihm zuvorgekommen waren, die Erfahrung, dass sich die ganz große Geschichte als ganz kleiner Furz erwiesen hatte, oder schlichtweg die Erfahrung, dass sich kein Mensch für seine Berichte großartig interessierte.
Doch dieses Jahr sollte definitiv die Wende in seiner journalistischen Karriere bringen, gleich zwei öffentlichkeitswirksame Artikel würden ihm dazu verhelfen. Für den zweiten standen die Recherchen kurz vor ihrem Abschluss. Ein letztes aufklärendes Gespräch heute, und der mit Abstand brisanteste seiner Berichte würde voraussichtlich in 14 Tagen erscheinen. Er hoffte, dadurch endlich die Grenzen seiner regionalen Tätigkeit zu durchbrechen und bundesweit Aufsehen zu erregen. Vielleicht würde eines der großen Magazine wie »Geo« die Story ebenfalls abdrucken, so sein Traum. Als freier Mitarbeiter war er seit drei Jahren für den Südkurier tätig – in dieser Zeit hatte er es noch nicht zu einer festen Anstellung gebracht. Kemal Demir wurde manchmal angst und bange, wenn er an seine Familie dachte, doch jetzt waren ihm zwei heiße Stories quasi direkt in den Schoß gefallen.
Mehrere Monate Recherche, und zur Belohnung würde morgen sein Artikel zur Brandserie, die Konstanz in Atem gehalten hatte, erscheinen. Auf Seite eins. Ein Versicherungsagent war der Erste gewesen, der ihm brisantes Material hatte zukommen lassen. Mehrere Großbauten waren in den letzten drei Jahren ein Opfer der Flammen geworden. Anfangs waren die Geschäftsinhaber oder Eigentümer in Verdacht geraten, große Versicherungssummen einkassieren zu wollen. Doch wie ein Jagdhund hatte Kemal Demir die echte Fährte aufgenommen. Hinter den Bränden steckte ein windiger Bauunternehmer, der hoffte, sich mit neuen Bauaufträgen eine goldene Nase zu verdienen. Doch er hatte die Rechnung ohne den Journalisten gemacht.
Kemals Vater war in den 60ern nach Deutschland gekommen, heute war er Besitzer mehrerer Gemüseläden in und um Leverkusen und stolz darauf, dass sein Sohn in Deutschland Abitur gemacht hatte. Und das mit einem sehr guten Abschluss. Doch statt BWL zu studieren und aus den Läden seines Vaters ein kleines oder größeres Obst- und Gemüseimperium zu erschaffen, hatte Kemal es vorgezogen, Journalistik in Dortmund zu studieren. Nach mehreren Volontariaten war er dann schließlich beim Südkurier gelandet. Sehr zu seinem Verdruss hatte man ihn seitdem hauptsächlich immer dann losgeschickt, wenn es zu Auseinandersetzungen zwischen jungen Türken kam, ein türkischer Laden überfallen worden oder das Kopftuchverbot mal wieder Gesprächsthema Nummer eins war, und er die Anschauungen türkischstämmiger Lehrerinnen zu Papier bringen sollte. Am spektakulärsten und ergiebigsten waren ihm noch seine Recherchen zu den in die Türkei verschleppten jungen Frauen erschienen, die dort einen Cousin oder sonstigen Verwandten oder auch Freund der Familie heiraten sollten. Allerdings war in Konstanz nur ein Fall bekannt geworden, sodass die von ihm geplante Serie ein abruptes Ende gefunden hatte.
Das heiße Eisen, das er im Moment am Schmieden war, hatte ihn zwar wieder, zumindest in Gedanken, ins Ausland befördert, aber dieses Mal hatte er Istanbul und Anatolien weit hinter sich gelassen. Seine Recherchen konzentrierten sich auf Südostasien und den von dort ausgehenden illegalen Handel mit geschützten Tieren nach Deutschland. Und Konstanz war einer der Dreh- und Angelpunkte des widerlichen Geschäfts. Davon war Kemal Demir immer mehr überzeugt.
Mehr durch Zufall war er auf dieses brisante Thema gestoßen. Als er an einem der letzten schönen Herbsttage des vergangenen Jahres durchs Krebsbachtal joggte, war ihm fast das Herz stehen geblieben, als er am Wegesrand eine Schlange entdeckt hatte. Groß, gelblich mit braunen Flecken, vollkommen regungslos. Zuerst dachte er, sie wäre tot, doch als er sie vorsichtig mit einem langen Stock antippte, bewegte sich das Tier träge in der goldenen Herbstsonne. Einer der Polizisten, die er über seinen Fund benachrichtigt hatte, war ein Schlangenkenner, der das Tier sofort als einen jungen Python identifiziert hatte. Die Nachfrage im Reptilienhaus in Unteruhldingen hatte ergeben, dass dort kein Tier vermisst wurde. Die Schlange war offensichtlich von jemandem ausgesetzt worden. Ein paar Tage später besuchte Kemal seinen Fund im Reptilienhaus. Die Betreiber der Auffangstation hatten den Python aufgenommen. Kemal erfuhr, dass hier immer wieder ausgesetzte Exoten eine neue Heimat fanden. Auf welchem Weg die Schlangen, Echsen und Schildkröten, die hier beherbergt wurden, in die deutschen Haushalte gekommen waren, war nur in den wenigsten Fällen nachvollziehbar. Ob legal oder illegal, man sah es den Tieren nicht an. Viele waren vermutlich ins Land geschmuggelt worden. Warum sich beispielsweise jemand eine Diamantklapperschlange freiwillig ins Haus holte, erschloss sich dem Journalisten nicht.
Und so betrat Kemal Demir die Welt des Tierschmuggels, ein milliardenschweres Geschäft des organisierten Verbrechens. Wie kamen die Tiere ins Land? Welche Helfershelfer standen bereit, um sie weiterzuvermitteln? Wer, außer den Schmugglern, verdiente daran? Auf diese letzten Fragen erhoffte er sich heute eine Antwort.
Sie hatten sich für den Abend in einem Restaurant an den Rheinterrassen verabredet. Sein Auto hatte Kemal am Parkplatz P+R am Seerhein in Konstanz stehen lassen und war zu Fuß die Promenade entlanggegangen. Über die seit Kurzem nach einer aufwendigen Sanierung wiedereröffneten Fußgänger- und Fahrradbrücke war er dann zu seinem Verabredungsort gelangt. Nun wartete er bereits seit mehr als 20 Minuten auf seinen Gesprächspartner. Immer öfter schaute er ungeduldig auf seine Armbanduhr. Sie hatten halb neun vereinbart, und jetzt war es schon kurz vor neun. Kemal, der zwar muslimischen Glaubens war, aber alles nicht so eng sah, hatte sich ein Bier bestellt. Er spielte mit dem Filzdeckel, malte mit seinem Kugelschreiber kleine Spiralen darauf. In dem Lokal herrschte reger Betrieb, Hartgesottene saßen sogar draußen. Als ein unangenehmer Sprühregen einsetzte, flüchteten die Gäste mit eingezogenem Kopf in die Gaststube. Jedes Mal, wenn die Tür geöffnet wurde, fuhr ein kalter Windstoß herein. Auch wenn die Tagestemperatur für einen Apriltag recht angenehm gewesen war, war es nicht wegzudiskutieren, dass der Frühling es noch schwer hatte, sich durchzusetzen.
Um kurz nach neun saß Kemal bei seinem zweiten Bier. Für das Treffen mit seinem Informanten hatte er einen Tisch im hintersten Winkel der Gaststube ausgewählt, um ungestört zu sein. Auf dem Holztisch lag sein Notizblock, und nachdem der Bierfilz vollgekritzelt war, begann er die erste Seite des Blocks zu verzieren. Dabei klickte er in rhythmischen Abständen auf den Knopf des Kugelschreibers, und die Mine erschien und verschwand im Wechsel. Wo blieb der Typ denn nur? Eigentlich hätte der die Fragen auch am Telefon beantworten können, doch der Kerl hatte auf ein persönliches Treffen bestanden. Genauso gut hätte Kemal auch bei ihm vorbeischauen können, aber das war dem Mann ebenso wenig recht gewesen. Wenn Kemal so darüber nachdachte, eigentlich merkwürdig. Was wäre denn dabei gewesen? Hatte der Mann etwas zu verbergen oder waren die Informationen so brisant, dass er um sein Wohlbefinden fürchten musste? Egal, es gab eben seltsame Menschen auf dieser Welt.
Die Bedienung schaute fragend zu ihm herüber, doch er schüttelte den Kopf. Ein drittes Bier würde es nicht geben, und zudem hatte er so allmählich die Nase voll. Schon viertel nach neun, und immer noch saß er alleine am Tisch. Wieso hatte er sich nicht die Handynummer geben lassen? Jetzt konnte er ihn noch nicht einmal erreichen, um zu fragen, was denn los sei. Kemal seufzte tief, es war ja nicht das erste Mal, dass man ihn versetzte. Als die Kellnerin am Nebentisch die Bestellung aufnahm, raunte er ihr ein »Zahlen, bitte« zu. Sie nickte lächelnd. Wahrscheinlich dachte sie, wenn der Typ schon nichts mehr trank, dann machte er wenigstens den Tisch für die nächsten Gäste frei.
Der Sprühregen war mittlerweile zu einem stetigen Nieselregen geworden, wie er im Schein der Straßenlaternen erkennen konnte, als er aus dem Fenster sah. Zu Fuß brauchte er etwa 20 Minuten bis zum Parkplatz, was ausreichen würde, um bis auf die Knochen nass zu werden. Und wie immer hatte er den Schirm im Auto liegen lassen. Na, super, das hatte ihm jetzt gerade noch gefehlt. Er bezahlte, gab ein kleines Trinkgeld, packte Block und Stift in seine Umhängetasche.
Schon wenige Meter nach Verlassen des Lokals rann ihm der kalte Regen trotz des hochgeschlagenen Jackenkragens unangenehm den Nacken hinunter, und er zog die Schultern noch ein klein wenig höher. Nun hatte sich auch noch durch die milden Tagestemperaturen ein üppiger Nebel über dem Rhein und damit auch über der Brücke zusammengebraut, man konnte kaum die Hand vor Augen sehen. Vereinzelt kamen ihm Radler entgegen oder rauschten an ihm vorbei, der Großteil von ihnen mit schlechter oder gar keiner Beleuchtung, und er fragte sich nicht zum ersten Mal, ob Radfahrer wie die Fledermäuse über ein Radarsystem verfügten.
Diffuses Licht, das von einer Taschenlampe zu kommen schien, bewegte sich auf ihn zu.
»Herr Demir?«
Hinter dem Taschenlampenlicht schälte sich eine Gestalt aus dem Nebel. Die Stimme kam ihm vage bekannt vor. Ahh, sein vermisster Gesprächspartner. Hatte sich dann doch noch entschlossen zu kommen. Der Mann lehnte nun trotz des grässlichen Wetters entspannt am Brückengeländer.
»Tut mir leid, mir kam noch was dazwischen«, es war eine reine Floskel, wie Kemal am Klang der Stimme erkennen konnte. Das Licht der großen, schweren Taschenlampe erlosch.
Der Journalist nahm die dargebotene Hand, schüttelte sie kurz.
»Schon gut, ich habe geglaubt, Sie kämen gar nicht mehr.«
Er würde seine Fragen stellen, hoffte auf kurze, präzise Antworten, und dann, ab nach Hause.
»Los kommen Sie, wir gehen zurück ins Lokal, das ist ja ein Sauwetter heute. Ich muss mir Notizen machen, dafür ist hier nicht unbedingt der geeignete Ort. Es geht mir hauptsächlich um das Prozedere. Wie gehen diese Leute vor und so weiter«, stellte er seine einleitende Frage und machte die ersten Schritte in die Richtung, aus der er soeben gekommen war.
»Ja, das Prozedere. Wo fang ich da am besten an?«
Der Mann ging neben ihm her, blieb plötzlich stehen, beugte sich über das Geländer und knipste die Lampe wieder an.
»Haben Sie das eben auch gehört? Mein Gott, ich glaube, da unten schreit jemand um Hilfe!«
Kemal hielt abrupt, stellte sich direkt neben den Mann, beugte sich ebenfalls über das Geländer und lauschte angestrengt in die Dunkelheit, die auch das Licht der Taschenlampe nicht zu durchdringen vermochte.
»Ich kann nichts hören. Und erkennen kann man gar nichts bei dieser Suppe!«
Statt einer Antwort erhielt Kemal einen gewaltigen Schlag mit der Taschenlampe an die linke Schläfe. Sofort wurde ihm schwindelig, goldene Punkte tanzten vor seinen Augen, für einige Sekunden war er völlig benommen. Noch bevor er seinem Erstaunen und seinem Schmerz Ausdruck verleihen konnte, packten ihn zwei Arme an Kragen und Gürtel, um ihn über das Geländer zu hieven. Kemal Demir stürzte kopfüber in die eiskalten Fluten des Rheins, und die große Story versank mit seiner Leiche.
Kapitel 1
Das in hellen Farben gestaltete Wartezimmer war voll, wie immer am Montagvormittag. Bequeme Stühle erleichterten den zumeist geduldigen Patienten das Warten, diverse Zeitschriften lagen bereit, um darin zu stöbern, oder man überließ sich dem beruhigenden Anblick der Goldfische, die in ihrem Aquarium, das in der Ecke einen Platz gefunden hatte, langsam ihre Bahnen zogen. Natürlich gab es auch genügend Patienten, die nur Augen für ihr Handy hatten und mit affenartiger Geschwindigkeit ihre Daumen über das Display huschen ließen.
»Frau Röder, bitte«, erklang die Stimme der jungen medizinischen Fachangestellten durch die geöffnete Glastür des Wartezimmers.
Ächzend stemmte sich eine schwer übergewichtige Frau aus dem Freischwingerstuhl und schlurfte zur Rezeption, hinter der die Sprechstundenhilfe saß. An ihrem lilafarbenen Kasak prangte ein Namensschildchen oberhalb der linken Brust und ließ die Patienten wissen, dass sie es mit Lisa Röhrig zu tun hatten.
»Zimmer eins, Frau Röder. Nehmen Sie bitte schon mal Platz, Herr Doktor kommt gleich«, lächelnd wies sie nach rechts den Gang entlang.
»Herr Doktor«. Huang Cai besaß überhaupt keinen Doktortitel, wünschte jedoch, dass man ihn so ansprach. Das wäre für die Patienten einfacher, hatte er Lisa erklärt, als er sie eingestellt hatte. Ja, klar doch, hatte sie gedacht, aber wenn der gute Huang es so haben wollte, ihr war es egal. Schließlich bezahlte er deutlich über Tarif, und ein 13. Monatsgehalt gab es auch. Für ihre kleinen Extradienste, die er ihr ab und an nach Praxisschluss auftrug, bezahlte er sie jedes Mal mit barer Münze. Er nannte es immer den Tag des Fisches, wenn sie abends länger bleiben sollte. Beim allerersten Mal hatte er ihr erklärt, der Fisch sei in China auch ein Symbol für Fülle und Wohlstand.
Die Patientin nickte nur, schleppte sich schwer atmend in das Behandlungszimmer. Wenige Minuten später erschien ein kleiner, schmächtiger Mann, der sie mit einem mitleidsvollen Lächeln und einem sanften Händedruck begrüßte.
Huang Cai stammte aus China und betrieb seit knapp zehn Jahren seine Praxis in der Nähe von Konstanz. Am Anfang war es schwer für den chinesischen Arzt gewesen, in der Provinz Fuß zu fassen, doch das war lange her. Heute kamen die Patienten zum Teil sogar aus Stuttgart, um sich von ihm behandeln zu lassen. Traditionelle chinesische Medizin und Akupunktur lagen seit Jahren voll im Trend, obwohl die Behandlungen von den Patienten selbst bezahlt werden mussten. Zwar übernahmen die meisten Krankenkassen auch die Kosten für die Akupunktursitzungen, aber nur, wenn man zu einem speziell dafür ausgebildeten Mediziner ging. Fand die Akupunktur bei einem Heilpraktiker statt, gab es keinen Cent.
Die Praxis lief mittlerweile sehr gut. Noch vor ein paar Jahren hatte sie nicht genug abgeworfen, um Huangs luxuriösen Lebensstil zu finanzieren. Er selbst glaubte an die Heilkraft des Horns der Nashörner oder der Bärengalle und hatte eine Möglichkeit gefunden, sich diese Bestandteile der chinesischen Medizin zu beschaffen. Dies war kostspielig, aber Huang gab die Kosten an seine Patienten weiter. Zum fünffachen Preis. Mindestens. Und die Nachfrage war groß.
Ilse Röder kam seit etwa einem Jahr zu Huang Cai, fühlte sich bei dem Chinesen besser aufgehoben und betreut als bei ihrem bisherigen Hautarzt Dr. Möller, der sie seit Jahren wegen ihrer Schuppenflechte behandelte. Eigentlich war sie schon mit ihm zufrieden gewesen, doch die Krankheitsschübe kamen nun häufiger. Eine systemische Therapie, die Möller vorgeschlagen hatte, lehnte sie ab, sie wolle keine Chemie in sich hineinpumpen, hatte sie Möller mitgeteilt. Die UV-Therapie hatte sie nach wenigen Sitzungen eingestellt, obwohl sie ihr gutgetan hatte. Der Weg zu Möllers Praxis war ihr einfach zu beschwerlich gewesen. Nach dem letzten schweren Schub hatte Dr. Möller ihr einen langen Vortrag gehalten. Wenn sie schon die Therapien ablehne oder nicht durchhalte, solle sie bitte endlich wenigstens ihre Lebensgewohnheiten umstellen, er predige es ihr doch nun schon seit Jahren, und nichts würde sich ändern. Keine Zigaretten mehr, keinen Alkohol, bessere Hautpflege. Durch ihre schlechte Ernährungsweise hätte sie ja nun auch noch Diabetes und Bluthochdruck. Von ihren gut und gerne 30 Kilogramm Übergewicht mal ganz abgesehen. Ob sie denn glauben würde, mit einer stärkeren Kortisoncreme wäre alles getan?
Was weiß der denn schon, hatte sich Ilse Röder gedacht. So einfach war das nicht. Wie viele Diäten hatte sie schon probiert? Hatte alles nichts gebracht. Eine Zeit lang hatte sie sich gezwungen, dreimal in der Woche einen Spaziergang zu unternehmen, damit sie wenigstens etwas Bewegung bekam, denn die meiste Zeit saß die Buchhalterin auf ihrem Bürostuhl. Doch auch das hatte sie wieder eingestellt, nachdem der Winter und damit das Schmuddelwetter Einzug gehalten hatten. Und was war denn bitte an zwei Gläsern Wein am Abend auszusetzen, oder auch des Öfteren drei, um die Einsamkeit etwas erträglicher zu machen? Eine weitere Kur, wie sie sie vor fünf Jahren erhalten hatte, war von ihrer Krankenkasse abgelehnt worden.
Dann hatte eine Bekannte ihr von dem chinesischen Heiler erzählt, und seither kam sie regelmäßig hierher. Die Akupunktur linderte ihre Beschwerden, und vor allem war Huang Cai immer sehr nett. Zumindest zu ihr. Sie hatte auch schon des Öfteren mitbekommen, wie er zu anderen Patienten ziemlich unfreundlich war. Aber das konnte ihr ja egal sein. Er hielt ihr keine Predigten, die sie nicht hören wollte. Die Kortisoncreme ließ sie sich weiterhin von Dr. Möller verschreiben, ging aber sparsamer damit um, damit sie nicht ständig nach einem Rezept fragen musste.
»Frau Röder, wie geht es Ihnen denn heute?«, fragte Huang Cai.
»Was soll ich sagen, Herr Doktor«, schnaufte Ilse Röder, »heute ist es wieder ganz schlimm.«
Sie öffnete ihre Bluse über dem mehr als üppigen Dekolleté, um Huang einen Blick auf ihre Haut werfen zu lassen. Mehrere, schuppige, gerötete, zum Teil kreisrunde Plaques waren zu sehen.
»Am Rücken habe ich auch solche Stellen, und an den Armen und Beinen«, klagte Ilse Röder.
»Lassen Sie mich das mal bitte sehen«, forderte Huang Cai die Frau auf.
Schwerfällig entkleidete sich die Patientin, ein unangenehmer Geruch ging von ihrem Körper aus und stieg dem Chinesen in die Nase. Körperhygiene stand bei Ilse Röder nicht sehr hoch im Kurs. Zwischen den schweren Brüsten hatte sich ein Hautpilz entwickelt. Unter dem Busen sah es bestimmt auch so aus, ebenso in den Hautfalten am Bauch und in der Leistengegend, mutmaßte Huang, was sich bei genauerer Untersuchung als richtig erwies.
»Das ist ein Hautpilz, Frau Röder. Ich gebe Ihnen Kräuter zur Herstellung von Bädern mit, ebenso eine chinesische Heilsalbe zum Eincremen und einen Tee, den Sie dreimal täglich trinken müssen. Achten Sie darauf, die Hautfalten sauber und trocken zu halten. Am besten, Sie legen sich ein Tuch zwischen Ihre Brüste. Bitte kommen Sie nächste Woche wieder, lassen Sie sich einen Termin geben. Ich denke, zumindest die Sache mit dem Pilz wird sich dann deutlich gebessert haben. Was das andere Problem angeht: Ich erwarte jeden Tag die Lieferung eines seltenen Naturstoffes, den ich gerne bei Ihnen zur Behandlung der Schuppenflechte einsetzen möchte. Allerdings ist das Mittel nicht gerade billig.«
»Was soll es denn kosten?«
»Ich hoffe, Sie bekommen jetzt keinen Schock. Pro Behandlung kostet das 350 Euro.«
Der Chinese zog wie zu einer Entschuldigung die Schultern hoch.
Ilse Röder schluckte. Das war eine Menge Geld.
»Und wie viele Behandlungen sind nötig?«
»Ich denke mit drei bis vier würden wir auskommen. Schwer vorherzusagen. Vielleicht reichen auch schon zwei. Jeder Patient spricht anders darauf an.«
Drei bis vier. Ilse Röder überlegte. Wirklich leisten konnte sie sich das nicht. Bei vier Behandlungen wäre sie 1.400 Euro los. Nun, sie musste wohl in den sauren Apfel beißen. War nicht in zwei Monaten der kleine Sparvertrag fällig? Das Geld wäre dann zumindest sinnvoll eingesetzt.
»Und die Schuppenflechte wird dann wirklich besser?«, fragte sie voller Hoffnung.
»Versprechen kann ich nichts. Aber in Ihrem speziellen Fall, schätze ich, dass Sie zu 90 Prozent beschwerdefrei sein und dauerhaft bleiben werden, wenn die Behandlung zu Anfang in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird. Also nach der Erstbehandlung über drei bis vier Wochen, brauchen Sie nur noch alle sechs Monate behandelt werden.«
90 Prozent! Wow.
»Ach, Herr Doktor, das wäre so schön. Ich möchte das auf jeden Fall versuchen.«
Glücklich und dankbar lächelte die dicke Frau den schmächtigen Chinesen an.
»Das ist eine gute Entscheidung, Frau Röder. So, und jetzt setze ich Ihnen noch ein paar Nadeln.«
Huang Cai rieb sich im Geiste die Hände, während Ilse Röder ihren massigen Körper auf die Behandlungsliege wuchtete, die bedrohlich quietschte. Tapfer ertrug sie die kleinen Nadelstiche.
Huang Cai war verärgert.
Warum meldet sich mein Kontaktmann nicht?, fragte er sich, nachdem er Frau Röder die Nadeln entfernt und die Patientin verabschiedet hatte.
Die verdammten getrockneten Seepferdchen, die er zur Herstellung des Pulvers benötigte, das er seinem schwerreichen Patienten Rudolph Seiffert versprochen hatte, sollten längst eingetroffen sein. Seiffert hatte ihm mit Schamesröte im Gesicht anvertraut, dass seine deutlich jüngere Frau nicht genug bekommen konnte.
»Sie wissen schon, was ich meine, Herr Doktor«, hatte er heiser geflüstert. Er brauche irgendwas, um sie bei Laune zu halten. Es sollten aber nicht diese blauen Pillen sein, deswegen wäre er zu ihm, Huang Cai, gekommen. Er wäre nun nicht mehr der Jüngste, und man wisse ja nicht, ob das, was man so im Internet bestellen könne, nicht vielleicht doch irgendwann Nebenwirkungen zeigen würde. Huang Cai hatte wissend genickt und ihm das gewünschte Potenzmittel versprochen. Exklusiv für Herrn Seiffert und ganz auf seine Bedürfnisse abgestimmt. Und nun wartete er schon seit Tagen auf diese getrockneten Meeresbewohner.
In der Mittagspause schickte der Chinese eine SMS mit dem vereinbarten Code, um sich mit seinem Lieferanten zu treffen. Sie benutzten mehrere Codes, die verschiedene Treffpunkte repräsentierten. Huang Cai hatte diese Sicherheitsmaßnahme vorgeschlagen. Seinem Lieferanten war die Idee zunächst albern erschienen, wie aus einem schlechten Spionagefilm. Doch Huang hatte darauf bestanden. Niemand würde mit den Codezahlen etwas anfangen können, falls das Handy einmal in falsche Hände geraten sollte. Heute hatte sich Huang für Code sieben entschieden, was bedeutete, dass sie sich abends um acht in einer Weinstube in Allensbach treffen wollten. Huang Cai hatte in all den Jahren, die er mittlerweile in diesem Teil der Welt lebte, die regionalen Weine schätzen gelernt. Sein Handy vibrierte. Die Nachricht seines Geschäftspartners klang vielversprechend und zauberte ihm ein Lächeln auf sein Gesicht.
Er sah auf seine teure Schweizer Uhr. Die Mittagspause war vorbei, und die Patienten warteten auf ihren Heiler. Huang Cais ganz persönliche Allheilmittel jedoch waren ein guter Wein und vor allem qián – Geld.
»Frau Hanfstängl, noch so ein Ding, und …«
»Was, und …, Sie können mir gar nichts verbieten. Wie ich meine Freizeit gestalte, geht Sie überhaupt nichts an, Herr Losens«, antwortete die kräftig gebaute Frau ruhig, aber bestimmt.
»Frau Hanfstängl, so nehmen Sie doch Vernunft an. Sie zerren unsere Behörde in den Fokus der Öffentlichkeit, und das können wir uns nach dem Skandal mit der KMVA1 nun wahrlich nicht leisten.«
Max Losens stand mit gerötetem Gesicht und Schweißperlen auf der Stirn vor ihrem Schreibtisch. Wieder einmal dachte Lioba, dass dieser Mann eine mehr als unglückliche Figur hatte. Sie selbst sah auch nicht aus wie eine Gazelle, aber zumindest stimmten bei ihr die Proportionen. Bei Losens hingegen war die Körpermitte sehr prominent, die Extremitäten im Verhältnis viel zu dünn, nichts passte irgendwie zusammen.
»Hätten Sie und die anderen Herren Ihre Hausaufgaben gemacht, wäre es gar nicht so weit gekommen. Dass das ganze Ding in die Luft geflogen ist, und dabei noch ein Arbeiter ums Leben kam, ist doch ein Versäumnis der Behörde. Haben Sie kontrolliert? Nein. Dass dort illegal giftiger Müll verbrannt worden ist, hat man doch gerochen. Bis zum Himmel hat’s gestunken. Aber nein, keine Gefahr für die Umwelt, keine Gefahr für Mensch und Tier«, höhnte sie.
»Sie können von Glück sagen, dass drei Jahre später kein Hahn mehr danach kräht«, fuhr sie fort, »und ein Bauernopfer war doch gleich gefunden. Frau Stückelberg wurde in Frühpension geschickt. Und Sie? Fein haben Sie sich aus der Affäre gezogen und den Unschuldigen gespielt. Aber mich hier frech anmachen, mir vorwerfen, ich würde mit meinen Aktionen, die ich – ich betone es noch einmal – in meiner Freizeit mache, unsere Behörde verunglimpfe. Dass ich nicht lache.«
»Frau Hanfstängl«, Max Losens war bei der Erinnerung an das damalige Unglück zusammengezuckt – und wie knapp er mit sauberer Weste rausgekommen war – und verlegte sich nun aufs Flehen.
»Ich bitte Sie inständig, Sie können von mir aus schützen und retten wen, was und wie Sie wollen, aber doch bitte hinter den Kulissen. So etwas geht einfach nicht.«
Mit der Rechten fuhr er sich durch sein schütteres Haar, das leicht fettig glänzte. Auf seiner dunkelblauen Krawatte entdeckte Lioba einen kleinen Fleck, Eigelb, wie die passionierte Tierschützerin erkannte. Wahrscheinlich ein Ei von einem dieser geschundenen Hühner aus Käfighaltung!
Max Losens tippte mit dem rechten Zeigefinger energisch auf die Zeitung in seiner Linken und warf dann der Büroangestellten im selben Ressort, Frau Lioba Hanfstängl, den heutigen Südkurier quasi vor die Nase. Lioba kannte die Schlagzeile »Ich opfere mich auch für Bäume« bereits.
Sie hatte es nicht ganz auf das Titelblatt geschafft, aber Seite drei war ihr sicher gewesen. Auf einem riesigen Foto erkannte man die Umweltaktivistin Lioba Hanfstängl eindeutig. In eine Art sackleinenes Gewand gehüllt – zusammengenäht aus drei uralten Kartoffelsäcken, zusammengehalten durch eine blutrote Kordel – hatte sie sich mit Handschellen und einer langen Kette an einen Baum gefesselt. Die Handschellen aus dem Internet waren von bester Qualität, saßen eng um ihre kräftigen Handgelenke. Den Schlüssel hatte Wim Röhrig, ihr getreuer Helfer, nachdem die Handschellen zugeschnappt waren, demonstrativ verschluckt. Und in diesem Büßergewand umarmte Lioba Hanfstängl den Baum wie eine liebende Mutter, lehnte die Wange an seinen rauen Stamm und blickte wie ein waidwundes Reh in die Kamera. Nichtsdestotrotz sah sie sich in der Lage, ein Interview geben zu können. Die Presse war bereits im Vorfeld über ihre Aktion informiert worden.
»Frau Hanfstängl, warum gerade dieser Baum? Blutbuchen sind doch nun nicht so selten, und dies ist zudem ein nicht geschütztes Exemplar«, so die Einschätzung der angehenden Reporterin, die als Volontärin ihren ersten großen Einsatz hatte.
»Wehret den Anfängen, wehret den Anfängen …«, doch weiter war Lioba mit bebender Stimme nicht gekommen. Kaum waren die Töne des Martinshorns an ihre Ohren gedrungen, hatte die Polizei die kleine Versammlung bereits aufgelöst, die Reporterin verscheucht und die Handschellen in Nullkommanix geknackt. Der arme Wim hatte den Schlüssel wohl umsonst geschluckt. Lioba hatte allerdings nichts verbrochen, und so hatte man sie lediglich verwarnt und einen Platzverweis ausgesprochen.
Doch eins musste man der Reporterin lassen. Sie hatte diese etwas verunglückte Aktion wunderbar aufgebauscht, hatte offensichtlich zur Person Lioba Hanfstängl recherchiert. In ihrem Artikel nahm die junge Frau Bezug auf das »Attentat« auf den Hühnerbaron Waldemar von Mäuselen, den Lioba vor fünf Jahren mit in rote Farbe getränkten Tennisbällen traktiert hatte. Von Mäuselen hatte kein Aufsehen erregen wollen und auf eine Anzeige verzichtet. Die Umweltschützerin war mit einer Zahlung von 500 Euro an eine soziale Einrichtung davongekommen.
»Frau Hanfstängl, überlassen Sie solche Aktionen doch der Jugend, dem NABU, dem WWF oder was weiß ich wem. Aber um Himmels willen, hören Sie damit auf. Ihr Vater ist seit Langem CDU-Mitglied, das muss Sie doch irgendwie beeinflusst haben«, redete Max Losens, kurzatmig vor lauter Aufregung, weiter auf Lioba ein. Sein dicker Bierbauch bebte geradezu.
»Herr Losens, Sie sollten sich mal hören. Vielleicht habe ich gerade deswegen einen so intensiven Zugang zum Natur- und Tierschutz. Aus den Kindern der Nazis sind doch auch zum Teil Radikale geworden. Und was ich mache, ist doch noch harmlos. Also kein Grund zur Aufregung. Was soll unserem Amt schon an Schaden zugefügt werden? Warten Sie mal die Leserbriefe in den nächsten Tagen ab. Die stehen alle hinter mir. Klopfen Sie mir also ruhig auf die Schulter, vielleicht fällt dann auch ein wenig von der positiven Resonanz auf Sie oder die Behörde ab. Schließlich ist der Umweltschutz ja unsere Aufgabe.«
»Warum betonen Sie das Wort ›Behörde‹ immerzu? So langsam frage ich mich, ob Sie einen bestimmten Zweck verfolgen. Aber ich warne Sie, Frau Hanfstängl, sägen Sie nur nicht an dem Ast auf dem Sie sitzen. Ich bin immer noch in einer Position, in der ich Sie ganz schnell hier raus habe. Ein Wort über …, tja, über Pflichtverletzungen, derer Sie sich schuldig gemacht haben, und Sie können sich einen neuen Job als Tippse suchen.« Geringschätzig sah er auf sie herunter.
Nachdem das Betteln nichts gebracht hatte, drohte er ihr nun also. Lioba schob ihren Schreibtischstuhl zurück, stand auf, die Hände vor sich auf den Artikel gestützt, und sah ihn mit giftigem Blick an.
»Tippse, ich hör wohl nicht recht. Wollen Sie sich wirklich mit mir anlegen, Herr Losens? Vorsichtig! Passen Sie mal lieber auf, dass ich nicht Ihnen irgendwas ans Bein binde. Wie gesagt, den Giftmüll haben Sie mit Bravour überstanden. Aber wie sagt man so schön, wo Rauch ist, ist auch Feuer.«
Lioba Hanfstängl nahm den Südkurier, knüllte ihn zusammen, warf ihn in den Papierkorb.
»Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich hab zu tun.«
Ein konsternierter und ratloser Max Losens verließ ohne ein weiteres Wort nach diesem Rausschmiss das Büro. Vor Frauen, die ihm Paroli boten, hatte er schon immer Respekt gehabt. Was zum Teufel hatte diese dämliche Kuh denn jetzt schon wieder vor?
Malie Abendroth trat fleißig in die Pedale ihres Rennrades auf dem Weg zu ihrer Arbeit auf der Insel Mainau. Sie fuhr konzentriert, doch gleichzeitig nahm sie den beginnenden Frühling in all seinen Facetten um sich herum wahr. Von Weitem hörte sie das Gebrumme der Fahrzeuge auf der L219. Da hatte es wohl jemand besonders eilig. Das Aufheulen eines Motors beim Schalten drang an ihr Ohr, und sie hätte jeden Cent darauf verwettet, dass es sich um einen Ferrari handelte. Sie kannte den Sound nur zu gut, fuhr doch ihr jüngerer Bruder Jonas – Jo – seit geraumer Zeit einen dieser italienischen Luxusschlitten. Malie hatte über diese Extravaganz nur den Kopf geschüttelt. Aber so war Jo nun einmal. Wie ein kleiner Junge hatte er sich stolz in dem noblen Autosalon, der ausschließlich Edelmarken wie Jaguar, Maserati oder eben Ferrari vertrieb, dieses knallrote Geschoss zugelegt. War Jo etwa in der Gegend? Nein, er hätte sich bestimmt gemeldet. Und außerdem fuhren in dieser Region einige dieser Karossen herum. Man war schließlich nicht arm, wenn man direkt am Bodensee lebte.
Noch vor drei Wochen hatten sich Malie und ihr jüngerer Bruder in einem Biergarten am See zum Essen getroffen, und Jo hatte erzählt, dieses Wochenende wäre er in Zürich, sei dort zeitlich ziemlich eingespannt und würde es wohl nicht schaffen, an den Bodensee zu kommen. Schade. Malie freute sich immer, ihren Bruder zu sehen, auch, wenn es manchmal nur für eine Stunde war. Jo war witzig und ein toller Unterhalter, immer mit Neuigkeiten aus der alten Heimat im Gepäck und so für Malie eine wichtige Verbindung zur Familie in Bremen, da Jo in regelmäßigen Abständen zwischen der Hansestadt und dem Bodensee pendelte.
Auf dem Mitarbeiterparkplatz standen bereits mehrere Autos, und bei der extra für Motorradfahrer eingerichteten Umkleidekabine war die Yamaha des Azubis Lukas abgestellt, der sein ganzes Geld in die Maschine steckte. Hotel Mama machte es möglich. Malie Abendroth fuhr weiter über die Brücke, passierte das Schwedenkreuz, das seinen Namen den Schweden verdankte, die nach Ende des 30-jährigen Krieges das wertvolle Bronzekreuz als Beute hatten mitnehmen wollen. War wohl doch zu schwer gewesen. Malie winkte Karl, einem der Gärtner, zu, der schon auf seinem Aufsitzmäher saß und die Grünflächen mähte. Ihr Weg führte sie in Richtung Palmenhaus. Wie immer schenkte sie dem riesigen, aus knallbunten Blumen bestehenden Pfau einen Blick, passierte den Weinberg und den angrenzenden Schwedenturm und schließlich die italienische Wassertreppe. Sie lenkte ihr Fahrrad am Rosengarten vorbei und erreichte das Palmenhaus. Das große Gewächshaus mit mehr als 20 verschiedenen Palmenarten gehörte zu den Attraktionen der Insel. Nicht nur die Palmen, auch die Architektur des hochtransparenten Acrylglasbaus machten das Gebäude zu etwas Besonderem. Bis vor einigen Wochen waren gut und gerne 3.000 Orchideen hier arrangiert worden. Die Orchideenschau gehörte zu den Highlights des Jahres und hatte jede Menge Arbeit für Malie und ihre Kollegen bedeutet.
Als sie den filigranen Glaskörper betrat, tauchte zwischen den Gewächsen der Azubi Lukas auf. Der junge Mann war der Sohn einer Mitarbeiterin, und alle kannten ihn mehr oder weniger von Kindesbeinen an. Die meisten, so wie auch Malie, duzten sich mit Lukas, ihn zu siezen wäre allen vollkommen albern vorgekommen, nur weil er mittlerweile 18 Jahre alt war. Lukas war das nur recht.
»Alles klar hier, Lukas?«, erkundigte sich Malie. »Das sieht ja schon klasse aus!«, lobte sie den jungen Mann.
Acht große runde Tische standen geschickt zwischen den Palmen platziert und waren bereits festlich eingedeckt für eine Hochzeitsgesellschaft. Lediglich der Blumenschmuck fehlte noch.
Lukas grinste, er freute sich über das Lob, besonders, da es von Malie kam.
»Ich geb’s auch an die andern weiter, hab das ja nicht allein gemacht«, gab er dann bescheiden zurück.
Malie klopfte Lukas anerkennend auf die Schulter und machte sich auf den Weg zum Schmetterlingshaus. Der Anblick des Gärtnerturms, dessen Untergeschosse noch aus dem Mittelalter stammten, beeindruckte sie immer wieder aufs Neue. Der Turm beherbergte in seinem achteckigen Aufbau und unter seinem Helmdach wechselnde Ausstellungen vom Frühjahr bis in den Herbst. An einer Seite rankte eine riesige weiß blühende Kletterrose empor, rechts und links der Eingangstreppe blühten noch große Rhododendron-Hybride, ein Traum in Purpurrot. Diese Züchtung, »Olin. O. Dobbs«, war eine von Malies Lieblingssorten. Rhododendren in allen Farben und Formen mochte sie von Kindesbeinen an, und wenn sie zur Blütezeit in ihrer Heimatstadt Bremen war, stattete sie dem Rhododendronpark mit seinen mehr als 3.000 Arten immer einen Besuch ab.
Im Schmetterlingshaus angekommen, begann sie mit ihrer Arbeit. Gedankenverloren zupfte sie an dem riesigen Farn herum, der seine gefiederten Arme einem der kleinen Teiche entgegenreckte. Daneben trug die Heliconia rostrata ihren bizarr anmutenden rotgelben Blütenstand zur Schau. Schmetterlinge in allen Größen taumelten trunken vom Blütennektar von Pflanze zu Pflanze – bunte, schillernde Farbtupfer in der 30 Grad warmen Feuchte des Gebäudes.
Was war das denn? Wer hatte hier einen Leinensack hingeschmissen? Und zerrissen war er auch noch! Schlamperei!
Plötzlich stach Malie ein seltsamer Geruch in die Nase, den sie nicht einordnen konnte. Irgendwie erdig. Ungewöhnlich. Vorsichtig teilte sie die dichten Blätter, versuchte zu erkennen, ob dahinter der Urheber dieses Geruchs versteckt war. Sie zuckte zurück, als ein Wesen vor ihren Augen auftauchte, das sie für eine Sekunde glauben ließ, sie halluziniere.
Etwa einen halben Meter entfernt, direkt vor ihrem Gesicht, hatte sich ein Tier eine Kuhle gegraben. Nur ein Teil des seltsamen Bewohners war zu sehen, der über und über mit harten, großen, dunkelolivfarbenen Schuppen bedeckt war und einem überdimensionalen lebenden Tannenzapfen glich. Das Tier schien sie nicht bemerkt zu haben, und Malie ließ den Blättervorhang sanft zurückgleiten, um es nicht zu stören.
Aus der Hosentasche ihrer pinkfarbenen Shorts fummelte sie ihr Handy hervor, wählte die Kamera an und schaltete den Blitz aus. Wieder schob sie die Blätter mit einer Hand zur Seite und machte mehrere Aufnahmen von dem seltsamen Geschöpf. Malie hatte so etwas bisher nur im Zoo gesehen. Die erste grundlegende Frage schoss ihr durch den Kopf. Wie war das Tier überhaupt in das Schmetterlingshaus gelangt? Hatte es jemand absichtlich hierher gebracht? Malie beschloss, dem neuen Bewohner erst mal seine Ruhe zu gönnen und ihren Fund für sich zu behalten. Niemand brauchte vorerst zu erfahren, was sich hinter dem Farn eingenistet hatte.
Während sie ihren Rundgang durch das Schmetterlingshaus machte, Blüten für die Futterstationen der bunten Falter pflückte, die Wasserschildkröten und Fische im Teich fütterte, versuchte sie eine Antwort auf ihre Frage zu finden, wie um alles in der Welt dieses merkwürdig aussehende Tier hier hereingekommen war. Das Schmetterlingshaus war videoüberwacht. Wenn etwas Ungewöhnliches auf dem Video zu erkennen wäre, würde sie es von Bastian, der sich um die Technik kümmerte, erfahren.
Sie verließ das Schmetterlingshaus und ging zum in der Nähe liegenden Café »Vergissmeinnicht«, um sich eine Kaffeepause zu gönnen und weiter über ihren Fund nachzudenken. Vor dem Café befand sich ein großes Rondell, in dem sich diverse Kakteenarten den Platz mit Sukkulenten teilten, einige blühten gerade in verschiedensten Rottönen, ein wunderschöner Anblick.
»Hallo, was darf ich Ihnen bringen?«, wurde sie freundlich von einer jungen Frau begrüßt, als sie auf der Terrasse an einem der Holztische Platz genommen hatte. Sie gehörte zu einer Gruppe Jugendlicher, die entweder einen schwierigen sozialen Hintergrund hatten oder einen besonderen Förderbedarf verlangten. Die jungen Leute, Deutsche und Migranten, nahmen an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme teil, die vom Fachpersonal des Bereichs »Pro Integration« vom Verein »Gärtnern für alle« unterstützt wurde, deren Vorsitzende die Hausherrin der Mainau, Sandra Gräfin Bernadotte af Wisborg, war. Malie hielt das für eine hervorragende Sache, und sie freute sich für alle, die hier auf der Insel in der Gastronomie oder auch im Gartenbau die Möglichkeit bekamen, sich besser in der Gesellschaft zurechtzufinden. Eine solche Initiative war nicht unbemerkt geblieben, und vor einigen Jahren hatte das Café Vergissmeinnicht dafür den Kultur-Initiativ-Preis der europäischen Kulturstiftung »Pro Europa« erhalten.
Malie bestellte einen Milchkaffee und eine Butterbrezel. Während sie darauf wartete, betrachtete sie die Fotos, die sie von dem Gast im Schmetterlingshaus gemacht hatte. Es war eindeutig ein Schuppentier, ein Pangolin. Wie der Zufall es wollte, war sie bei ihrem letzten Besuch in Leipzig mit ihrer Zwillingsschwester Alicha, die dort als Tierärztin arbeitete, bei diesen eigenartigen Geschöpfen gelandet. Ihre Schwester war stolz darauf, in einem der führenden Zoos Europas zu arbeiten. Leipzig war bekannt für seine Artenschutzprojekte und seine erfolgreichen Nachzuchten.
Die Erinnerung an ihren Besuch in diesem wunderschönen Zoo und an die putzig aussehenden Tiere, tauchte vor Malies innerem Auge auf.
»Pangoline sind vom Aussterben bedroht«, hatte ihre Schwester ihr erklärt. »Ihrer Schuppen und ihres Fleisches wegen werden sie gnadenlos gejagt. Und die Schuppentiere sind hilflos. Alles, was sie machen, wenn sie angegriffen werden, ist, sich zu einer Kugel zusammenzurollen. Die Wilderer brauchen sie nur vom Baum zu pflücken oder vom Boden aufzuheben. Schrecklich ist das. Und mittlerweile sind sie in Südostasien rar geworden, deshalb fangen diese geldgeilen Menschen nun auch Pangoline in Afrika und schmuggeln sie nach China.«
Die junge Frau, die dem Aussehen nach pakistanischen oder indischen Ursprungs war, brachte die Bestellung und wünschte einen guten Appetit. Malie biss ein Stück von der Brezel ab, kaute genüsslich, trank einen Schluck Kaffee. Um sicherzugehen, schaltete sie erneut ihr Handy an und befragte das Internet. Sie verglich die Bilder und klassifizierte dann ihren Fund als Ohrenschuppentier. Wie zum Teufel war es auf die Insel Mainau gekommen? Hatte es jemand ausgesetzt, der mit dem Tier nicht mehr klarkam? Aber, woher hätte diese Person das Schuppentier gehabt? Man konnte es nicht einfach wie einen Hund vom Züchter oder einen Kanarienvogel im Zoohandel kaufen. Das Tier besaß einen hohen Wert, schließlich war der Handel mit Schuppentieren lukrativ. Doch nicht nur das. Er war vor allem illegal. Besonders in China war die Nachfrage nach den begehrten Schuppen groß, glaubte man doch dort, sie könnten, zu einem »medizinischen« Pulver verarbeitet, bestimmte Krankheiten heilen. Und auch das Fleisch wurde gerne verwertet, es galt als besondere Delikatesse. Malie schüttelte den Kopf. So ein Humbug, medizinisches Pulver aus Pangolinschuppen. Da die Schuppen aus nichts anderem als Keratin bestanden, konnte man genauso gut Fingernägel kauen und hoffen, dass man dadurch geheilt wurde.
Malie recherchierte weiter, und ihr wurde beinahe übel, als sie verschiedene Zeitungsartikel zum Thema »Pangoline und die Jagd auf sie« las. So waren 22.000 Schuppentiere innerhalb von 14 Monaten getötet worden, und dies nur innerhalb eines Teils der Insel Borneo. Und je weniger Tiere es freilebend gab, desto höher war logischerweise der Profit der Schmuggler. Sie informierte sich weiter über die Lebensgewohnheiten des Tieres und seine bevorzugte Nahrung. Ameisen und Termiten sowie deren Eier waren sein Leibgericht. Viel mehr stand nicht auf dem Speiseplan, ab und an mussten auch Käfer oder Würmer dran glauben. Aber das war es dann auch schon.
Wie machen die das im Zoo?, fragte sie sich stumm. Ameisen züchten? Wohl kaum. Hier auf der Insel konnte das Pangolin jedenfalls nicht bleiben, das war klar. Womöglich kam es noch auf die verzweifelte Idee, die Schmetterlinge oder ihre Puppen in seinen Menüplan aufzunehmen. Vielleicht sollte sie ihre Schwester befragen, sie war schließlich die Fachfrau. Malie versendete eine Nachricht an Alicha mit der Frage nach dem Futter für Pangoline. Anrufen war meist zwecklos, Alicha hatte immer alle Hände voll zu tun und nahm meist gar nicht erst ab. Als Malie den letzten Schluck Kaffee getrunken und die Butterbrezel verzehrt hatte, pfiff ihr Handy und vermeldete eine Nachricht. So schnell hatte sie tatsächlich nicht mit einer Antwort gerechnet. Ausgezeichnet.
»Mit einem Spezialbrei aus Mehlwürmern, Kokospulver, Eigelb, Vitaminen, Heilerde und auch Bienenlarven. Und noch einiges mehr. Wieso interessiert dich das?«
»Nur so«, schrieb Malie zurück, »habe gerade einen Artikel über die Tiere gelesen, und dass Leipzig der einzige Zoo in Europa ist, wo man sich Pangoline anschauen kann.«
Zurück kam ein Smiley und der Kommentar, sie sollte doch mal wieder zu Besuch kommen.
Möglichweise komme ich früher, als dir lieb ist, Schwesterherz, und bring dir noch einen vierbeinigen Freund mit, dachte Malie und schämte sich dafür, Alicha nur die halbe Wahrheit gesagt zu haben.
Doch sie hatte einen Entschluss gefasst. Sie würde das Pangolin mit nach Hause nehmen, und sobald ihre Zeit es erlaubte, nach Leipzig in den Zoo bringen. Dass sie sich damit auch auf illegalem Terrain bewegen würde, war ihr klar, doch was hätte sie anderes tun sollen? Die naheliegende Lösung, die Polizei einzuschalten oder den Tierschutz anzurufen, verwarf Malie sofort. Bei ihrer Schwester in Leipzig wäre das Tier am besten aufgehoben, und bis dahin würde es bei ihr ein geborgenes Plätzchen haben. In ihrem Wintergarten war es warm und feucht, und den Futterbrei würde sie wohl irgendwie zusammenmischen können. Hoffte sie.
Malie hatte vor fünf Jahren eine alte Villa im Konstanzer Vorort Litzelstetten für ein kleines Vermögen gekauft und sich dabei in den Immobilienmakler verliebt. Nach drei Jahren war die Beziehung in die Brüche gegangen, seither war sie Single und genoss ihre Freiheit. Sie hatte noch einiges an Geld zusätzlich hineingesteckt und die Villa liebevoll eingerichtet. Seitlich des auf einer kleinen Anhöhe stehenden Hauses hatte sie einen großen Wintergarten anbauen lassen, der mittlerweile viele üppige tropische Pflanzen beherbergte, sodass der runde niedrige Tisch und die beiden großen Bambussessel mit ihren farbenfrohen dicken Kissen beinahe eingewachsen erschienen. Lediglich der Ausblick von den Sesseln auf den Bodensee war pflanzenfrei. Hier war es immer sehr warm, tropisch eben, wie die Pflanzen und Malie es liebten. Beheizt wurde der Wintergarten durch Solarzellen, um Heizkosten zu sparen. Zwischen einer Bananenstaude, einer Palme und zwei riesigen Alocasien, landläufig bekannt als Elefantenohr, plätscherte ein kleiner Brunnen, der einen Auslauf in einen Teich hatte. Im Augenblick blühte eine Frangipani und verströmte ihren schweren süßen Duft.
Nun brauchte das Tierchen noch einen Namen. Ich taufe es Paul. Wenn es sich später herausstellt, dass es ein Mädchen ist, kann ich es immer noch Paula nennen.
Max Losens fragte sich nicht zum ersten Mal, wie er, der doch eigentlich ein echter Hosenscheißer war, sich auf eine so gefährliche Sache hatte einlassen können. Aber irgendwie war alles zusammengekommen.
In der Schule war er immer der Letzte gewesen, der in eine Sportmannschaft gewählt worden war. Damals war er noch schlank und drahtig gewesen. Trotzdem. Man hatte ihn ungerne ins Team geholt. War ein Handball auf ihn zugeflogen, war er lieber ausgewichen, statt den Ball aufzufangen, denn es hatten ihm die Hände wehgetan. Oft glaubte er, seine Mitspieler legten absichtlich alle Kraft in den Wurf, nur um ihn doof dastehen zu lassen, weil sie genau wussten, dass er zur Seite sprang. Ähnlich war es beim Fußball, beim Volleyball, immer hatte er Angst, sich wehzutun, oder schlimmer noch, sich zu verletzen. Er war weder wagemutig noch abenteuerlustig. Max bevorzugte die Theater AG, setzte sich auch lieber in einen Schauspielsaal statt in ein Fußballstadion.
Auf einer Reise nach Sankt Petersburg – Kultur pur – war er Jarmilla begegnet. Klein, hübsch, auf der Suche nach einem Mann, der ihr ein sorgloses Leben bescheren würde. Ihre Wahl war auf Max Losens gefallen. Damals war er gerade ein knappes Jahr geschieden gewesen, er war Valerie zu langweilig geworden. Genau das hatte sie zu ihm gesagt. Zu langweilig. Während der Jahre mit Valerie hatte er aus seinem Desinteresse gegenüber allen Sportarten, Wandern, Reisen in exotische Länder keinen Hehl gemacht. Doch urplötzlich war es seiner Gattin wie Schuppen von den Augen gefallen, dass sie einen echten Mann haben wollte, nicht so einen Waschlappen, dessen größte körperliche Anstrengung darin bestand, täglich einen Kugelschreiber zu halten. Valeries Worte hatten ihn tief verletzt, und sie war mit den beiden gemeinsamen Söhnen Knall auf Fall ausgezogen.
Bei Jarmilla sollte ihm dies nicht passieren. Sogar ein Jahresabo für ein Fitnessstudio hatte er sich zugelegt, an seinem allmählich zur Fülle neigenden Körper gearbeitet. Doch das war Jarmilla egal gewesen, es hatte sie nicht beeindruckt. Die sportliche Betätigung gehörte der Vergangenheit an. Wozu sich schinden, wenn seine Frau noch nicht einmal Wert darauf legte. Was seine zweite Frau allerdings liebte, war ein Hauch von Luxus. Nicht zu viel, denn sie wusste, das konnte sich Max nicht so einfach leisten. So war es zumindest anfangs gewesen. Hier ein Designerkleid, da ein teures Parfüm. Nach der Geburt seiner Ältesten, Maximiliane, war er so voller Stolz und Glück, dass er einen Halbkaräter an Jarmillas Finger gesteckt hatte. 999er Gold, und das zu einem Zeitpunkt, als der Goldpreis seinen Höchststand erreicht hatte.
Jarmilla hatte geschnurrt wie ein Kätzchen. Max hatte mit dem Ring den Appetit nach mehr bei Jarmilla angeregt, und aus dem Kätzchen war ein gefräßiger Tiger geworden. Nicht, dass Losens den sich mehr und mehr anhäufenden Luxus nicht auch genossen hätte. Ein neues Badezimmer – eine wahre Wellnessoase – wurde eingerichtet, neue Möbel, ein riesiger Flachbildschirm, der Kleiderschrank seiner Frau platzte bald aus allen Nähten. Die Reisen wurden kostspieliger, ebenso die Abendessen bei »Rudolfo« oder »Chez Guillaume« begleitet von teuren Weinen und gekrönt von prickelndem Champagner. Der Tod seiner Mutter, wie sich Max mit einem schlechten Gewissen eingestand, kam gerade richtig. Die alte Frau hatte schon lange ein unwürdiges Dasein gefristet, war jahrelang mehr dahinvegetiert und endlich gestorben, was Max ein kleines, aber feines Erbe bescherte. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Allein die Reise auf diesem Luxusliner hatte ihn ein halbes Vermögen gekostet.
Den Einkaräter hatte er dann nach Nadines Geburt an Jarmillas Finger gesteckt. Während Maximiliane ein echtes Mamakind war, hing Max Losens mit einer wahren Affenliebe an seiner Jüngsten, eine Liebe, die Nadine zu 100 Prozent zurückgab.
Nadine war fünf Jahre alt gewesen, als sich in ihr der Wunsch nach einem Haustier geregt hatte. Jarmilla hatte zugestimmt, aber bitte weder Hund noch Katze, die waren, im Gegensatz zu den Kindern, während einer Kreuzfahrt nur schwer unterzubringen. Ein Kaninchen würde Frau Stolzenfels, die Nachbarin, übernehmen. Also hatte sich Max Losens mit Nadine an der Hand zur Zoohandlung von Rufus Trenkwitz aufgemacht. Mümmel, ein schwarz-weiß geflecktes Zwergkaninchen, lebte seither in der Familie Losens, von Nadine liebevoll gehegt und gepflegt.
Max Losens hatte anfangs Bedenken, einer Fünfjährigen ein Kaninchen anzuvertrauen. Aber die Kleine machte ihre Sache bestens, zeigte sich verantwortungsvoll und diszipliniert, natürlich mit kleiner Hilfe ihrer Mutter. Der Käfig wurde regelmäßig gereinigt, mit frischem Stroh ausgestreut, Mümmel fehlte es an nichts. Und so war es Losens zur Angewohnheit geworden, alle 14 Tage mit Nadine die Zoohandlung aufzusuchen, um neues Stroh, Heu, Knabbermüsli, und was das Tier sonst noch so brauchte, einzukaufen. Meist musste er einige Meter entfernt parken, da die Parkplätze direkt vor Trenkwitz’ Geschäft belegt waren. Doch an einem Frühlingstag vor drei Jahren hatte er Glück gehabt. Oder auch nicht. Der neue silberfarbene Audi glänzte im Sonnenlicht, das Leder roch erdig und neu, die Fußmatten entbehrten jeden Dreckkrümels. Den Audi hatte er quasi jungfräulich am Tag zuvor vom Autohaus Weller übernommen.
»Schicker Wagen.«
Trenkwitz stand an der Eingangstür und begutachtete seinen Neuerwerb, während Nadine die bunten Wellensittiche, die in den großen Käfigen herumflatterten, beobachtete.
»Für den muss man ja ein nettes Sümmchen hinblättern. Oder ist der gebraucht?«
Im Nachhinein fragte sich Max Losens, warum er nicht schon bei dieser Frage stutzig geworden war.
»Nein, krachneu«, unverhohlener Stolz schwang in seiner Stimme mit.
Trenkwitz kratzte sich seinen roten Schopf.
»Ein Diesel. Nicht schlecht. Und Platz für die ganze Familie. Was kostet der denn so, wenn ich fragen darf?«
»Na ja, Sie könnten es auch bei Weller erfragen. Aber mit allem Drum und Dran, so an die 70.000.«
Trenkwitz pfiff durch die Zähne, dann lachte er dröhnend.
»Hätte ich das geahnt, hätte ich die Beamtenlaufbahn eingeschlagen. Sie sitzen doch in der Verwaltung, wenn ich mich nicht irre, oder? Natur- und Umweltschutz, nicht wahr? Ja, ja, Trenkwitz, und du haust hier zwischen all deinen Tierchen und Futtertüten.«
Max Losens war das Gespräch schon etwas unangenehm gewesen. Musste er sich wegen seines Gehalts oder seiner Ausgaben rechtfertigen? Wohl kaum. Was dachte sich dieser Mensch eigentlich?
»Herr Trenkwitz, gibt es die auch in größer?«
Nadine hatte auf einen Wellensittich gezeigt, dessen Gefieder in einem besonders kräftigen Blau schillerte.
»Nein, meine Kleine, einen Wellensittich gibt es nicht größer. Es gibt natürlich größere Vögel, die genauso farbig sind, noch bunter, noch schillernder. Vögel, so farbenfroh, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Aber die gibt es hier nicht zu kaufen.«
Auch das wissende Lächeln, das sich Rufus Trenkwitz erlaubte, als er Tage später per Zufall Max und Jarmilla traf, die gerade von einem exorbitant teuren Abendessen bei »Rudolfo« kamen, hatte Max Losens nicht ahnen lassen, was auf ihn zukam.
Kein Vierteljahr später stand er wieder einmal mit Nadine in der Zoohandlung. Trenkwitz hatte einen prächtigen Bildband über exotische Vögel vor dem Kind ausgebreitet.
»Das Buch schenk ich dir. Dann kannst du mal schauen, welch prächtige Vögel es auf der Erde gibt. Und, wenn du groß bist und so viel Geld verdienst wie dein Papa, kannst du dir vielleicht einmal einen dieser Vögel kaufen.«
Nadine hatte sich sofort in das Buch vertieft und blätterte fasziniert darin herum.
»Das können wir doch nicht annehmen. Das ist doch viel zu teuer.«
Max Losens fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Das Gefühl, Trenkwitz wolle irgendwas von ihm, wollte nicht weichen. Und es trog ihn nicht, denn schon kam der Zoohändler zur Sache. Er zog Losens ein Stück zur Seite und raunte ihm mit gesenkter Stimme zu: »Herr Losens, so ab und zu beantrage ich ja auch eine Genehmigung bei Ihrer Verwaltung. Sie wissen schon, was ich meine, diese Formulare, die benötigt werden, wenn eines der seltenen Tiere«, an dieser Stelle machte Trenkwitz eine bedeutsame Pause, »von mir aus einer legalen Zucht übernommen und weitervermittelt wird.«