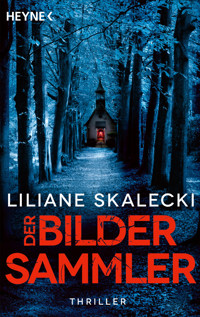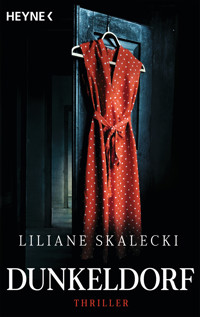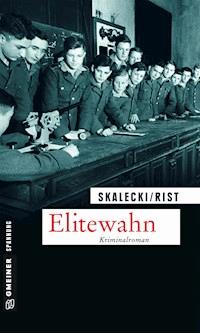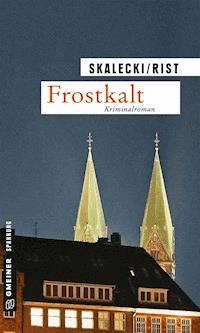Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Heiner Hölzle
- Sprache: Deutsch
Während des WM-Spiels Deutschland - England 2010 wird ein Mann schwer verletzt im Bürgerpark aufgefunden. Bevor er stirbt, haucht er einen Namen. Kommissar Heiner Hölzles Ermittlungen ergeben, dass der Mann bereits seit mehr als 35 Jahren als tot gilt. Hölzle und sein Team tauchen tief ein in die Geschehnisse der 70er-Jahre, der Zeit der RAF, und finden Verbindungen zu einem Entführungsfall sowie zum Bombenattentat auf dem Bremer Hbf. Und plötzlich muss sich Hölzle auch noch mit dem Verfassungsschutz auseinandersetzen, der ein reges Interesse an dem Fall zu haben scheint …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biggi Rist / Liliane Skalecki
Rotglut
Kriminalroman
Zum Buch
Totgeglaubt Während des WM-Spiels Deutschland – England 2010 wird ein Mann schwer verletzt aufgefunden. Bevor er stirbt, haucht er einen Namen. Hölzles Ermittlungen ergeben, dass der Mann seit mehr als 35 Jahren als tot gilt. Der Tote besitzt gefälschte Papiere, die ihn als französischen Staatsbürger ausweisen, stammte aus Bremen und hatte in den 70er-Jahren Kontakt zur linksradikalen Szene. Warum kehrte er nach Jahrzehnten zurück? Hölzle und Kollegen tauchen tief ein in die damaligen Geschehnisse und finden Verbindungen zu einem Entführungsfall sowie zum Bombenattentat auf den Bremer Hauptbahnhof 1974. Ein Selbstmord erweist sich als Mord. Ein weiterer Teil des Mosaiks, welches die Polizisten zusammenfügen müssen. Dann sieht sich Hölzle auch noch mit dem Verfassungsschutz konfrontiert, der sich für den Fall zu interessieren scheint. Die Lage spitzt sich zu, als zwei Frauen entführt werden. Für den Kommissar beginnt ein Wettlauf mit der Zeit ….
Dr. Liliane Skalecki, 1958 in Saarlouis geboren, studierte nach einer Banklehre Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Vorderasiatische Archäologie an der Universität des Saarlandes. Seit 2001 lebt sie mit ihrer Familie in Bremen. Sie schreibt für die Zeitschrift »Pferdesport Bremen« und veröffentlichte bisher Fachartikel, Sachbücher sowie Chroniken und Unternehmerdarstellungen. www.liliane.skalecki.info
Biggi Rist, 1964 in Reutlingen geboren, arbeitete nach der Ausbildung an der Naturwissenschaftlich-technischen Akademie in Isny/Allgäu in der medizinischen Labordiagnostik und zwei Jahre in der Forschung. Als 7-jährige schrieb sie sich selbst Geschichten und ist Co-Autorin wissenschaftlicher Publikationen. Zwei Jahre lebte sie in Melbourne/Australien, bevor sie mit ihrem Mann nach Lilienthal zog. www.johanna-von-wild.de
Impressum
Die Handlung dieses Kriminalromans ist frei erfunden, das Bombenattentat am Bremer Hauptbahnhof im Dezember 1974 hat sich aber tatsächlich ereignet.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart,
unter Verwendung des Fotos von: © travelguide – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4196-7
Widmung
Für Ralf und meine Eltern. Biggi
Für meine Familie. Für meine Eltern. Liliane
In memoriam Heinz
Zitat und Gedicht
Wir leben alle vom Vergangenen und gehen am Vergangenen zu Grunde.
Johann Wolfgang von Goethe
*
Fuchs, du hast die Gans gestohlen,
gib sie wieder her, gib sie wieder her!
Sonst wird dich der Jäger holen
mit dem Schießgewehr,
sonst wird dich der Jäger holen
mit dem Schießgewehr!
Seine große, lange Flinte
schießt auf dich das Schrot,
schießt auf dich das Schrot,
dass dich färbt die rote Tinte und dann bist du tot,
dass dich färbt die rote Tinte und dann bist du tot.
Liebes Füchslein lass dir raten,
sei doch nur kein Dieb, sei doch nur kein Dieb!
Nimm, du brauchst nicht Gänsebraten,
mit der Maus vorlieb,
nimm, du brauchst nicht Gänsebraten,
mit der Maus vorlieb!
Ernst Anschütz 1824
Prolog
Juli 1961, Bremen
Die Welt liegt zu seinen Füßen. Er ist unbeschwert, fühlt sich frei. Ein gutes Abitur in der Tasche wird ihm alle Möglichkeiten eröffnen. Seiner Zeit bei der Bundeswehr sieht er mit einer Mischung aus Spannung und Vorfreude entgegen.
Der Junge liegt auf dem alten, mit Segeltuch bespannten Liegestuhl und überfliegt noch einmal seine Einberufungspapiere. Holzminden, Pionierbataillon 1, keine drei Stunden von Bremen entfernt.
Es ist heiß. Er greift nach seiner Cola, trinkt das Glas in einem Zug leer. Irgendetwas hat ihn eben beim Rasenmähen gestochen, und er reibt sich den rechten Knöchel. Er geht seiner Mutter zur Hand, verdient sich ein paar Mark. Gerade schneidet sie die verwelkten Rosen ab, dabei kann sie ihn nicht gebrauchen, er schneidet immer an der falschen Stelle. Der Junge liebt seine Mutter, aber manchmal geht sie ihm doch auf die Nerven mit ihrer Pedanterie.
»Schatz? Schaaatz?«
Träge öffnet er die Augen, die Einberufungspapiere sind ihm aus der Hand gefallen und liegen auf der Terrasse. »Hmmm«, brummt er schläfrig.
»Schau, dass du heute Abend zum Essen da bist. Papa kommt rechtzeitig von seiner Dienstreise aus Wiesbaden zurück und er wird sich so freuen, wenn er hört, dass du womöglich in seiner alten Kaserne unterkommst. Vielleicht sogar noch in seinem alten Bett.«
Er rollt mit den Augen, was seine Mutter natürlich nicht sehen kann. »Ach, Mama, die alten Flohpritschen gibt’s schon lange nicht mehr.«
Er hört ihr unbeschwertes Lachen, und es wird ihm einmal mehr bewusst, wie sehr er sie liebt. Natürlich liebt er auch seinen Vater, aber auf eine andere Weise. An ihm schätzt er seine Ehrlichkeit, seine Geradlinigkeit. Sein Vater tut in seinen Augen immer das Richtige, er möchte einmal so sein wie er.
»Schaaatz, auf dem Dachboden der Garage steht der Behälter mit dem Läusegift, sei so nett und krabbel eben mal hoch. Die Läuse fressen mir bei der Hitze noch die ganzen Rosen auf.«
Er stemmt sich aus dem wackeligen Liegestuhl. An das Garagentor angelehnt, steht die alte Holzleiter. Die beiden untersten Sprossen müssten endlich einmal ausgetauscht werden. Irgendwann würden sie durchbrechen. Der Junge steigt gleich über die dritte Sprosse auf die Leiter, drückt die Luke auf, klemmt sie fest, damit sie ihm nicht auf den Kopf kracht, und schiebt sich durch ein Spinnennetz auf den Dachboden. Suchend schaut er sich nach der Flasche mit ihrem giftigen Inhalt um. Plötzlich erstarrt der junge Mann. Sein Herz setzt einen Schlag aus.
Die Sonne schickt ein paar Strahlen durch einen losen Dachziegel, goldene Staubpunkte tanzen darin, umgeben seinen Vater, hüllen ihn ein.
Der Junge schreit nicht. Ganz ruhig steht er da, als betrachte er ein Bild im Museum. René Magritte. Sein Vater hängt da am Balken wie ein Melonenhut-Mann von Magritte. Dunkler Anzug, rote Krawatte, die Arme seitlich am Körper hängend, die Beine baumeln über einem Koffer, lächerlicherweise hat er noch seinen braunen Hut auf dem Kopf. Warum ist der nicht heruntergefallen, als sein Vater den Koffer, auf dem er gestanden hat, weggeschubst hat? Es ist nicht sein üblicher Reisekoffer. Der Inhalt dieses Koffers hier wurde nie in die Schubladen eines Hotelzimmers in Wiesbaden eingeräumt.
Der Koffer, den der Junge registriert, ist uralt. Aus braunem Pappmaschee gemacht, aufgesprungen, als er umgefallen ist. Sein Inhalt liegt zu Füßen des baumelnden Vaters. Der Blick des Jungen fällt auf eine aktuelle Ausgabe des ›Spiegels‹, der Eichmann-Prozess beherrscht zurzeit die Presse. Sein Vater hat doch nie den ›Spiegel‹ gelesen, wundert sich der junge Mann. ›Linke Kampfpresse‹, so des Vaters Wertung.
Der Junge weiß, es hat keinen Sinn mehr, den Vater von dem Strick um seinen Hals zu befreien. Er macht einen Schritt nach vorne, hebt ein Bündel Briefe auf, alt, mit Briefmarken darauf, die er noch nie gesehen hat. Er sieht die Umschläge durch. Alle an seine Mutter adressiert. Annelie Höffner, ihr Mädchenname. Die Schrift eindeutig die seines Vaters. Riesige Anfangsbuchstaben und dann die Buchstaben, immer kleiner werdend, so schräg nach rechts, dass sie fast liegen. Alle stammen aus dem damals besetzten Lothringen, sind chronologisch geordnet. Die Stempel sind verblasst, doch einen einzigen kann er entziffern. Natzweiler. Sofort werden in seinem Kopf Bilder lebendig, die er noch vor Kurzem im Fernsehen gesehen hat, Bilder von einem der grausamen Konzentrationslager. Der erste Brief stammt von 1941, der letzte von 1945.
Seit dem Beginn des Prozesses in Israel um Adolf Eichmann verfolgt der Junge alle Nachrichten aufmerksam. Die Namen der Konzentrationslager sind ihm seit ein paar Monaten geläufig. Natzweiler-Struthof gehört dazu.
Was hat sein Vater dort zu suchen gehabt? Er als Wehrmachtsoffizier, als Nachschubführer in Lothringen. Stolz hat sein Vater ihm erzählt, wie vielen Kameraden er dort aus dem Schlamassel geholfen hatte. Dass er sich nie wirklich mit dem Nazi-Regime identifiziert hatte.
Der Junge stößt den Koffer mit dem Fuß an. Ein großer brauner Umschlag lugt darunter hervor. Vorsichtig öffnet der Junge ihn, als fürchte er sich davor, dessen Inhalt kennenzulernen. Ein offizielles Schreiben steckt darin. Er überfliegt es: SS-Obersturmbannführer Martin Gottfried Weiß ernennt SS-Hauptsturmführer Alwin Reddersen zum Schutzhaftlagerführer des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof, datiert 2. Februar 1941. Wer, um alles in der Welt, ist Alwin Reddersen, und warum hat sein Vater dieses Schreiben aufbewahrt?
Seine Hand greift noch einmal in den Umschlag. Sie zieht einen alten Ausweis hervor. Bräunliches Papier, die Unterschrift Himmlers auf der rechten Seite springt ihm ins Auge. Noch verarbeitet sein Gehirn nicht, was seine Augen sehen:
Schutzstaffel der NSDAP, Ausweisnummer, ausgestellt auf Alwin Reddersen, geboren am 4. Februar 1904. Das Foto auf dem Ausweis zeigt eindeutig seinen Vater.
Das Bild seines Vaters, das er bisher in seinem Herzen getragen hat, zerbricht in 1.000 Stücke. Die Welt scheint stillzustehen. Jetzt ist es an der Zeit zu schreien.
11. Dezember 1974, Bremen
Nur noch fünf Stunden. Dann wird er im Flugzeug sitzen, das ihn in seine neue Heimat bringt, wo er die Chance hat, noch einmal ein neues Leben zu beginnen. Es tut ihm nicht leid. Zumindest nicht um seine Ehe, seine alte Heimat, Freunde oder womöglich um seinen Job. Den einzig bitteren Preis, den er wirklich bezahlen muss, ist die Trennung von seiner kleinen Tochter. Er ist nicht sentimental oder gläubig und religiös schon gar nicht. Trotzdem. Weihnachten steht vor der Tür.
Seitdem die Kleine auf der Welt ist, genießt er die Festtage mit ihr. Sein letztes Weihnachtsgeschenk für sie wird der Spielwarenladen kurz vor dem Fest ausliefern. Lange hat er vor den Regalen gestanden und nach einem geeigneten Geschenk Ausschau gehalten. Sein Blick war schließlich auf eine nostalgische Puppenstube gefallen, riesig und ganz aus Holz. Sechs Miniaturzimmer, fein möbliert mit Biedermeiermöbelchen. Die Küche mit kleinen Delfter Kacheln hinter dem Herd, den man sogar mit den Fingerspitzen öffnen konnte. Die Wäsche auf den kleinen Bettchen war mit echter Spitze besetzt. Passende Bewohner gab es auch dazu: Vater, Mutter, ein Dienstmädchen, ein kleiner Foxterrier und das kleine Mädchen, knapp drei Zentimeter groß, mit einer winzigen blauen Schleife im Haar.
Schluss damit. Jetzt ist keine Zeit für traurige Gedanken. Er muss schauen, dass er es hinter sich bringt und seine Spuren perfekt verwischt, denn er befürchtet – nein er ist sich sicher –, dass man nun auch ihn im Visier hat und er auf der Abschussliste steht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nur gut, dass er schon länger vorgesorgt hat, falls etwas passieren sollte und er verschwinden muss.
Die Zeit kriecht dahin, immer wieder sieht er auf die große Uhr, die über der Anzeigetafel hängt. Noch drei Stunden. Hoffentlich geht alles glatt.
Ein letzter Blick in seinen Pass, in dem seine Bordkarte steckt. Beste Wertarbeit. Yves Renard, langsam spricht er den Namen vor sich hin, genießt den Klang. Ein guter Name. Der Fuchs. Der Mann hält sich selbst für so schlau wie dieses Tier. Yves Renard ist geboren am 22. November 1941. Das Französisch des Mannes ist fließend und absolut akzentfrei, ebenso sein Englisch. Ein weiterer Blick auf die großen schwarzen Zeiger. Noch eine knappe Stunde bis zum Abflug.
Er verfügt über genügend Geld. Dass dafür ein Mensch sein Leben lassen musste, beeindruckt ihn nicht sehr. Das Schicksal anderer ist ihm völlig gleichgültig.
Da hatte er schon fast mehr Mitleid mit dem Penner gehabt. Mit Bedacht hatte er sich den Obdachlosen herausgesucht, der ihm am meisten heruntergekommen erschienen war. Er kennt die Brücke über der Kurfürstenallee, unter die sich die Männer, geschützt vor der Kälte durch Zeitungen und Pappe, zurückziehen. Glückliche besitzen einen Schlafsack.
Im Schutz der Nacht war er dort hingefahren, hatte dem Penner eine Flasche Korn unter die Nase gehalten und ihn mit dem Versprechen, eine zweite für ihn zu haben, zu seinem Auto gelockt. Die 100 Meter zu seinem Golf hatte er den Alten, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, stützen müssen. Dann war es schnell gegangen, ein gezielter Schlag ins Genick, und der Mann, den niemand vermissen würde, war hinter dem Auto zusammengesackt. Dann lag der Tote im Kofferraum seines Wagens und verströmte den Geruch von Alkohol, Verwahrlosung und Tod.
So früh am Morgen war es noch dunkel gewesen, und auf der einsamen Landstraße war er allein unterwegs. Eichen ohne Laub bildeten eine bizarr aussehende Allee. Ganz ruhig und voll konzentriert hatte er den Wagen aus der Stadt gelenkt. Die Landstraße hatte er sich genau eingeprägt und den Baum direkt hinter der lang gezogenen Kurve ausgewählt. ›Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit …‹, würde es später im Polizeibericht heißen.
Noch einmal überprüfte er den Sicherheitsgurt – wie gut, dass jede Neuzulassung seit Anfang des Jahres mit Gurten ausgestattet sein musste –, versuchte, unverkrampft zu sitzen und steuerte gezielt auf die dicke Eiche zu. Zügig, aber nicht zu schnell, er wollte das Verletzungsrisiko so gering wie möglich halten.
Der Wagen knallte mit der Beifahrerseite gegen den Baum, sein Körper wurde nach vorne gerissen und sofort wieder nach hinten geschleudert. Ohne Gurt hätte er das nicht überstanden. Der Aufprall war härter, als er angenommen hatte. Mit Nacken- und Kopfschmerzen würde er jetzt wohl eine Weile klarkommen müssen.
Er schnallte sich ab, schälte sich aus dem Auto und streckte sich. Der Wagen hatte ganz schön etwas abbekommen, der Baum hatte die Beifahrerseite trotz der niedrigen Geschwindigkeit komplett eingedrückt. Er nahm einen Hammer, um dessen Kopf er ein Handtuch gewickelt hatte, aus dem Kofferraum und lehnte sich weit in den Wagen hinein. Dann schlug er von innen auf die Windschutzscheibe ein, bis ein feines Netz von Rissen entstand. Tod durch Genickbruch beim Aufprall auf die Windschutzscheibe – die Polizei warnte nicht umsonst. ›Erst gurten, dann starten …‹ – so ähnlich würde man es später im Weser-Blitz lesen können.
Die Leiche des Penners zerrte er aus dem Kofferraum und wuchtete sie auf den Fahrersitz, drapierte den Kopf auf dem Lenkrad, den Gurt ließ er hängen. Jetzt kam noch eine unangenehme Sache. Auch wenn er vorhatte, das Auto mitsamt dem Penner anzuzünden, war es doch besser, ihm eine Kopfverletzung beizubringen, nur für den Fall, dass dieser nicht vollständig verbrannte. Angewidert verzog er das Gesicht und schlug mit der flachen Seite des Hammers frontal gegen die Stirn des Toten.
Zufrieden mit seinem Werk, zog er sich seinen Ehering mit dem eingravierten Heiratsdatum und den Vornamen ab und schob ihn über den knochigen Ringfinger des Alten. ›Bei welcher Temperatur schmilzt Gold eigentlich?‹, dachte er. ›Möglicherweise ist der Ring dann nur noch in Spuren zu sehen. Egal.‹
Zufrieden betrachtete er sein Werk. Unter einer dicken Plane im Kofferraum verbarg sich ein Benzinkanister. Er war aus Plastik, leicht und handlich.
Sorgfältig übergoss er seinen Golf mit der hoch entzündlichen Flüssigkeit und achtete darauf, keinen Spritzer abzubekommen. Bis auf den letzten Tropfen entleerte er den Behälter und stellte ihn dann neben den Hammer, um den noch das Handtuch gewickelt war. Die Sachen würde er mitnehmen und sich ihrer später irgendwo entledigen.
Aus seiner linken Hosentasche fischte er eine Streichholzschachtel. Eines der Hölzer riss er an und ließ es nahe am rechten Vorderreifen des Wagens fallen. Sofort stand alles in Flammen. Eine enorme Hitze, die ihn zurückweichen ließ, breitete sich blitzschnell aus. Nun musste er sich beeilen. Ein Feuer in dieser Größenordnung konnte auch auf einer einsamen Landstraße schnell entdeckt werden. Zwar hatte er bei der Auswahl seines ›Unfallortes‹ darauf geachtet, dass auch kein Gehöft in der Nähe lag, die Bauern waren schließlich Frühaufsteher, aber man konnte ja nie wissen.
Kurz starrte er nochmals fasziniert in die Flammen.
›Der Fahrer des Wagens verbrannte bis zur Unkenntlichkeit …‹ – eine weitere Zeile im späteren Polizeibericht.
Er nahm Kanister und Hammer und machte sich auf den Weg zu einem Mietwagen, den er bereits am Tag zuvor, nicht weit entfernt von der ausgesuchten Unfallstelle, abgestellt hatte. Im Kofferraum hatte er vorsorglich einen kleinen Koffer und eine Umhängetasche deponiert.
Das Handtuch schüttelte er aus, faltete es sorgfältig zusammen und legte es in den Koffer. Zwei Minuten später saß er im Auto und fuhr Richtung Flughafen. Unterwegs hatte er noch kurz auf einem Rastplatz angehalten und den Kanister mitsamt dem Hammer in einen Mülleimer geworfen.
Allmählich dämmerte der Morgen, der Straßenverkehr nahm zu, je näher er dem Flughafen kam. Lange dauern würde es wohl nicht, bis das ausgebrannte Autowrack entdeckt wurde. Aber er lag gut in der Zeit.
Am Flughafen suchte er zunächst die Herrentoilette auf, um sich umzuziehen, denn Pullover, Hemd und Cordhose rochen trotz aller Vorsicht nach Benzin. Die Kleidung stopfte er in eine Plastiktüte, die er anschließend unter dem Berg dreckiger Papierhandtücher, die sich im Papierkorb nahe dem Waschbecken angesammelt hatten, vergrub. Jetzt trug er nur eine leichte Leinenhose und ein langärmeliges Polohemd, die Tweed-Jacke von Yves Saint-Laurent lag lässig über seinem Arm. Im Flughafen war es warm genug und nach draußen in die Kälte musste er nicht mehr. An seinem Zielort würden deutlich wärmere Temperaturen herrschen als in Deutschland.
Zuletzt hatte er den Mietwagen zurückgegeben, die Frau am Schalter hatte ihm noch einen guten Flug gewünscht.
Eine junge Dame am Check-in hatte ihn beflissen angelächelt, einen Blick in seinen Pass geworfen und ihm seine Bordkarte überreicht. »Bon voyage, Monsieur et un séjour agréable à Paris.«
»Merci«, hatte er ihr charmant zugezwinkert.
Die Lautsprecherdurchsage lässt verlauten, dass sein Flugzeug bereit zum Einsteigen ist. Der Mann strafft die Schultern und geht durch die Fluggastbrücke, die direkt ins Flugzeug führt. Sein neues Leben hat in diesem Moment begonnen.
Acht Monate zuvor, April 1974, Bremen
Mit lautem Gelächter verabschieden sich die fünf Studenten von ihren drei Kommilitonen, die noch auf ein Beck’s in der Kneipe ›Rote Ameise‹ im Viertel sitzen bleiben. Professor Schlaufheimer ist bereits vor einer halben Stunde gegangen. Er hatte seine acht Studenten auf ein Bier eingeladen. Die jungen Leute sind Teilnehmer seines Arbeitskreises ›Die neuen Partisanen – der Weg in das Unrecht‹. Schlaufheimer, Professor für Jura und Rechtsethik, hat mit ihnen in heißen Diskussionen darüber gestritten, ob sich aus den Studentenbewegungen Ende der 60er Jahre in Italien oder Deutschland zwangsläufig Terrorgruppen bilden mussten.
Der Professor, ein Mann um die 40, ist das große Vorbild seiner Studenten. Mit seinen langen, dunklen Locken, der schlanken Statur und der immer gleichen Kleidung – schwarze Hose, schwarzer Rolli – unterscheidet er sich kaum von seinen Schülern. Der Professor ist einige Tage zuvor aus Chile zurückgekehrt, wo er sich mit Vertretern der Kirche getroffen hatte, um sich über die Menschenrechtsverletzungen und die Zustände in den Foltergefängnissen zu informieren. Sein Bericht hat bei den Studenten großes Entsetzen hervorgerufen.
Und nun besitzen die USA und einige westeuropäische Länder die Frechheit, dem Diktator Pinochet Wirtschaftshilfe zuzusagen. Wobei das eigentlich nicht verwunderlich ist, denn schließlich haben die Amerikaner den Putsch im vergangenen Herbst unterstützt.
Die Kneipe ist, obwohl es bereits auf die Sperrstunde zugeht, immer noch voll, und dichter Zigarettenqualm dringt in jede Ritze der schlichten Holztische und Stühle, bleibt in der Kleidung der Gäste hängen.
»Wir sollten es machen wie der Andi«, tönt einer der drei Studenten, ein Junge von vielleicht 19 Jahren, mit fettigen blonden Haaren und einem Ziegenbärtchen. Das Kinn hat er tief in seinen grob gestrickten Pullover gesteckt, sodass nur die Unterlippe mit dem Bartansatz knapp hervorlugt.
»Was nuschelst du da, was für ein Andi?«, fragt seine Tischnachbarin. Ihre Gedanken sind eben noch bei Schlaufheimer gewesen. Einfach ein klasse Typ. Und diese Augen! Dunkelblau, himmlisch.
»Ja, der Andi eben. Der hat echt Courage. Hat einfach ’ne Bombe ins Karstadt-Kaufhaus geworfen. So etwas sollten wir machen. Und wenn die Bullen uns festnehmen, werden wir der Öffentlichkeit zurufen, was wir von dem Schwein Pinochet halten.« Der Blonde hat sich in Rage geredet.
Das Mädchen stoppt seinen Redefluss. Wie eine etwas zu groß geratene Audrey Hepburn sitzt sie mit übereinandergeschlagenen Beinen am Tisch. Ihre schwarzen Haare hat sie hochgesteckt und mit einer riesigen Sonnenbrille dekoriert.
»Jetzt halt mal die Luft an, Nummer 3. Da gehen doch jede Menge unschuldiger Leute drauf. Und überhaupt. Von welchem Andi faselst du die ganze Zeit? Nummer 6, du bist doch unser Mister Allwissend, von welchem Andi ist denn hier die Rede?«
Der als Nummer 6 Angesprochene rollt mit den Augen. Mit einer fahrigen Handbewegung schiebt er sich die dunklen Haarfransen, die ihm in die Stirn hängen, hinter sein linkes Ohr. Er zieht noch einmal an seiner Zigarette und drückt sie auf der Tischplatte aus.
»Stehst du heute auf dem Schlauch? Er meint den Baader. Der hat doch mit der Gudrun und noch ein paar Leutchen vor ein paar Jahren Brandsätze in einem Frankfurter Kaufhaus gelegt und gezündet. Ging um die Scheiße in Vietnam.«
»Ach, der Andi. Klar. Aber haben sie den nicht geschnappt, zusammen mit dem Jan-Kurt und dem Holgi?« Sie nippt an ihrem Bier.
Nummer 6 stöhnt genervt auf. »Jan-Carl1, nicht Jan-Kurt, und der andere heißt auch nicht Holgi. Das ist doch kein Meerschweinchen. Holger, Hol-geer, hörst du?«
Das Mädchen nickt ergeben. »Andererseits, eigentlich sind das doch richtige Verbrecher«, wirft sie ein, »ich meine, ihretwegen sind doch auch schon ein paar Menschen ums Leben gekommen. So weit darf das Ganze auch nicht gehen. Da hätt ich dann doch Skrupel.« Das Mädchen verstummt leicht verunsichert, als ihre beiden Begleiter sie ungläubig anstarren.
»Das glaub ich jetzt nicht. Wo hat denn unser Prinzesschen die letzten Jahre verbracht? Hat dir nicht eben der Schlaufi berichtet, was gerade in Chile passiert? Man muss auch mal Farbe bekennen. Meinst du, der Benno2 ist nur zum Spaß auf die Straße gegangen und hat sich über den Haufen schießen lassen?« Ziegenbärtchen haut mit der Faust auf den Tisch.
»Er und die anderen haben in Berlin gegen ein Unrechtsregime protestiert. Und was machen unsere Bonzen? Laden den König von Persien ein und knallen den Benno ab wie einen räudigen Köter.«
»Schah«, korrigiert ihn sein Gegenüber.
»Schah, König, Kaiser. Ist doch alles die gleiche Scheiße. Man muss schon für seine Prinzipien einstehen, Nummer 4. Zur Not mit Gewalt. Klar, Unschuldige sollten dabei nicht draufgehen …«
»Ja, aber …«, versucht seine Kommilitonin einzuwenden.
»Nix aber. Schau dir doch die Guerillas an. Ich meine unsere Guerillas, die vom 2. Juni.« Er trinkt das Beck’s direkt aus der Flasche und wischt sich mit dem Handrücken den Mund ab.
Das Mädchen zuckt hilflos mit den Schultern und schüttelt schweigend den Kopf.
»Kriegst du gar nix vom echten Leben mit?«, der Dunkelhaarige wirft theatralisch den Kopf in den Nacken und hebt die Hände.
»Jetzt pass mal auf, Kleines, es ist dringend an der Zeit, dass du Nachhilfe bekommst. Bei dir hat der Schlaufi ja eindeutig versagt. Oder schläfst du mittwochs immer?« Er winkt der Bedienung mit der leeren Flasche. Sie nickt und bringt ihm ein neues Bier.
»Also«, fährt er fort, »der Benno starb am 2. Juni, so heißen auch die Guerillas – ›Bewegung2.Juni‹. Die machen auch mit Bombenanschlägen auf sich aufmerksam. Hier mal ein Yachtclub, da mal auf die Bullen höchstpersönlich, alles in Berlin. Bremen ist ein richtig dröges Nest dagegen.«
Das Ziegenbärtchen hebt erneut die Faust und verteidigt seine Heimatstadt.
»Also bitte. So dröge auch wieder nicht. Der passive Widerstand hat hier Tradition. Ich war 68 dabei, als wir in Bremen mit Sitzblockaden die Erhöhung der Bus- und Bahnpreise verhindert haben. Es fing mit wenigen Leutchen an, am Schluss waren wir ein paar Tausend. So eine Demo müssten wir Studenten doch auch wieder hinkriegen. Ist besser, als ’ne Bombe ins Karstadt-Kaufhaus zu werfen. Da hat Nummer 4 recht.« Um seine Worte zu unterstreichen, hebt er seine Flasche und prostet dem Mädchen zu.
Der andere lässt sich nicht beirren. »Du weißt doch selbst, wie sie mit Demonstranten umgehen. Und wenn sie in noch so friedlicher Absicht kommen. Der Benno ist tot, den Rudi3 hat es fast ins Jenseits befördert. Und glaubt ihr, wir könnten einfach so gegen Pinochet demonstrieren, wo jetzt die Amis und der Westen den Arsch unterstützen? Nee, da müssen wir uns was Besseres einfallen lassen. Wir müssen dem chilenischen Volk unsere Solidarität bekunden, sie finanziell unterstützen. Eine Bank überfallen oder so. Los, ihr beiden Null-Nummern, macht euch mal ein paar Gedanken.«
»Ich find das mit den Nummern doof.« Das Mädchen trinkt den letzten Schluck seiner abgestandenen, lauwarmen Cola-Cognac-Mischung. »Die Idee von Schlaufi, uns nur noch mit Nummern anzusprechen, damit wir unsere Identität verlieren, so wie die Insassen im Foltergefängnis, war ja am Anfang klasse, aber jetzt? Das Seminar ist doch rum, was soll der Unsinn dann noch?« Sie spielt mit dem Bierdeckel, der vor ihr liegt. Ihre Stimme, der sie bewusst eine rauchige Note verleiht, klingt nun nörglerisch, als sie fortfährt:
»Wenn wir uns schon dem Befreiungskampf anschließen, dann brauchen wir auch richtige Decknamen. Ich nenn mich Gretchen, wie die Frau vom Rudi. Dann bist du der Rudi und dich nennen wir Benno.«
»Ach nee, guck mal einer an. Wenn’s um die Liebe geht, hört Madame auch zu. Gretchen – sehr schön aufgepasst. Aber ihr seid doch Kindsköpfe. Decknamen, so ein Quatsch«, grinst das Ziegenbärtchen die beiden Freunde an.
»Nix da, wenn schon, denn schon.« Der Dunkelhaarige zottelt seine Haare zurecht und setzt sich sein grünes Wollkäppi auf. Die Zigarette, die er sich frisch angezündet hat, hängt locker in seinem Mundwinkel, sein linkes Auge hat er leicht zusammengekniffen, weil der Rauch das Auge reizt. Aber Hauptsache, lässig aussehen und versuchen, sich nichts anmerken zu lassen.
»Nennt mich fortan Che Guevara«, gibt er großkotzig von sich.
Das Ziegenbärtchen glotzt seinen Freund an, entlässt Kinn und Bärtchen aus dem Wollpulli.
»Also, so brauchst du mir auch nicht zu kommen«, raunzt er den Kumpel beleidigt an. »Du pickst dir wohl immer die Rosinen raus. Wenn schon, dann ist das mein Deckname. ›Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche‹, hat Che gesagt. Der Spruch ist auf meinem T-Shirt aufgedruckt. Auf meinem, wie ihr vielleicht mal mitbekommen habt.« Er tippt sich mehrfach mit dem Zeigefinger auf die Brust.
Das Mädchen versucht zu beschwichtigen, legt die Hand auf seinen Unterarm.
»Wisst ihr was, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann teilen wir uns den Namen. Ich taufe dich hiermit auf den Namen Che«, sie weist mit dem Finger auf das Ziegenbärtchen und deutet das Kreuzzeichen an. Dann wendet sie sich dem anderen zu. »Du, mein Lieber, sollst auf den Namen Gue hören, und meiner Wenigkeit sei für immer der Name Vara verliehen. Amen.«
Die beiden Jungs sehen sich an. Was ist denn in die gefahren? Dann prusten sie los.
»Na dann, auf Che, Gue und Vara.« Die drei stoßen an, lachen sich kaputt.
Die so eben getaufte Vara seufzt auf. »Der Deckname Tanya würde mir auch gefallen, aber der ist ja schon weg. Dieses Milliardärsmädchen, diese Patty Hearst, ist jetzt ja auch im Untergrund. Im Februar entführt und jetzt schon so von der Sache überzeugt, dass sie Mitglied der Organisation geworden ist und mit denen zusammen Banken überfallen hat. Und sie heißt jetzt wie die Gefährtin von Che, also dem echten Che, meine ich. Tanya. Wie romantisch.« Sie wird rot.
»Das ist es! Wir machen es wie diese ›Symbionese Liberation Army‹. Die wollten doch ein paar Millionen Dollar für das verwöhnte Püppchen erpressen und das Geld dann den Armen geben. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen in den USA so dahinvegetieren. Geld für Waffen haben sie genug, aber nix zu fressen für ihre Armen. Da muss ein moderner Robin Hood ran. Wir schnappen uns irgendeinen Bonzen!« Che reißt begeistert die Arme in die Luft.
»Jetzt mach aber mal halblang, Kumpel. Ich meine, in Bremen wimmelt es zwar davon, aber du kannst ja nicht einfach bei einem klingeln und ihn bitten, sich für den guten Zweck als Entführter zur Verfügung zu stellen«, wiegelt Gue ab.
»Ja, ja, ich bitte um einen besseren Vorschlag, Nummer …, eh, Gue.« Che dreht sich eine neue Zigarette, leckt das Blättchen ab und klopft die Enden auf den Tisch, bevor er sie ansteckt. Dann spuckt er mit gespannten Lippen ein paar Tabakfasern aus.
»Ehrlich gesagt, finde ich die Idee im Grunde gar nicht so schlecht«, räumt Gue ein, »nur dass wir nicht irgendeinen entführen. Denk doch mal nach! Allein unsere Eltern haben Freunde und Bekannte, die ein paar Hunderttausend oder Millionen wert sind. Wir nehmen einen davon mit, lassen uns das Geld geben und bringen ihn wieder zurück. So einfach ist das.« Er sieht seine beiden Freunde Beifall heischend an.
»Oder wir pressen Inhaftierte aus den deutschen Foltergefängnissen frei«, schlägt Vara eifrig vor. Sie kommt jetzt so richtig in Fahrt. »Wie die Italiener. Habt ihr das vor zwei Tagen nicht gelesen? Ich hab noch gedacht, das wäre für Schlaufis Seminar noch die Krönung gewesen. Die ›Brigate Rosse‹«, sie rollt das ›R‹ genüsslich, »die haben doch diesen Staatsanwalt aus Genua entführt. Sossi. Und den halten die so lange fest, bis sie die inhaftierten Kämpfer des – lasst mich mal überlegen, irgendwas mit Oktober, ist ja auch egal – freilassen. Das ist doch ’ne heiße Nummer.«
»Hirngespinste. Eine Sitzblockade, das ist reell, von allem anderen lassen wir die Finger. Ich meine, ihr habt zu tief ins Glas geschaut. Mit so was versaut man sich ja seine ganze Zukunft. Ich geb ja gern zu, dass ich eben hier noch groß getönt habe. Aber so was in die Realität umzusetzen, nee, ich weiß nicht. Da krieg ich dann doch kalte Füße. Apropos kalte Füße, ich geh jetzt nach Hause, dieselbigen unter die Decke stecken. Und ihr werdet auch besser wieder nüchtern.«
Das Ziegenbärtchen namens Che erhebt sich, greift seinen Parka und legt einen Zehnmarkschein auf den Tisch.
»Ist ja schon gut. Wir kommen mit raus. War ja nur so eine Idee. Aber trotzdem, die hat was.« Vara wirkt ernüchtert und enttäuscht. Sie und der Dunkelhaarige werfen ein paar Münzen zu dem Geldschein, schlingen sich die schwarz-weiß gemusterten Palitücher um den Hals und verlassen mit ihrem Freund die Kneipe.
»Also dann, bis demnächst. Wir können uns gern mal bei mir zu Hause treffen. Auf ein Tässchen Tee mit Schuss oder so. Wenn ihr wollt, besorg ich noch was zu rauchen. Meine Alten machen bald wieder mal die Flatter.« Vara wirft den beiden eine Kusshand zu, schließt ihr Fahrradschloss auf und verschwindet im Dunkeln.
»Verrückte Nudel. Man könnte fast meinen, die hat es ernst gemeint.« Die beiden Jungs winken ihrer Freundin zum Abschied zu, Gue mit geballter linker Faust.
»Ich glaube, mein Bett kann noch etwas warten. Wie wär’s mit einem letzten Bierchen im Stubu, damit wir wieder einen klaren Kopf kriegen?« Che versieht das Wort ›klar‹ mit Lufthäkchen. »Die Füße kannst du auch noch später unter die Decke stecken.« Er sieht seinen Freund aufmunternd an.
»Okay, dann geh, Gue. Aber im Eiltempo, bevor der Laden dichtmacht.« Sie lachen meckernd und sich gegenseitig in die Seiten knuffend, steuern sie die nächste Kneipe an. Doch Varas Idee lässt Gue trotz seiner Vorbehalte nicht los.
1 Jan Carl Raspe, Andreas Baader und Holger Meins befanden sich in der Realität bereits seit 1972 in Haft
2 Benno Ohnesorg, Student. Erschossen bei einer Demonstration gegen den Schah von Persien in Berlin 1967.
3 Rudi Dutschke, Wortführer der West-Berliner Studentenbewegung
Mai 2010, Sassandra, Elfenbeinküste
Yves Renard lehnt sich in seinem Schaukelstuhl, der auf der Veranda steht, zurück. Die Regenzeit, die bis Ende Juni dauert, hat begonnen. In zwei Stunden wird seine Kneipe öffnen und Joseph Kutesa, Barkeeper, Restaurantchef und Koch in einer Person, hat bereits begonnen, die Fische auszunehmen, die er am frühen Morgen auf dem Markt besorgt hat. Die Süßkartoffeln köcheln vor sich hin, Joseph wird sie zu einer dicken Paste als Beilage zum Fisch verarbeiten.
Es ist heute bereits das dritte Glas Weißwein. Yves weiß, dass er nicht so viel trinken sollte, aber in seinem Zustand kommt es auf die paar Flaschen am Tag auch nicht mehr an.
Das kleine Lokal in Sassandra läuft im Moment ganz gut, obwohl die Stadt, etwa 270 km vom Regierungssitz Abidjan entfernt und südlich des Parc National du Gaoulou gelegen, nur ganz allmählich zur Normalität zurückgekehrt ist. Touristen verirren sich nur ab und zu an die wunderschöne Südküste des Landes. Man kann nur hoffen, dass die politische Lage nun einigermaßen stabil bleiben wird. Renard ist trotz der jahrelangen Unruhen im Land geblieben. Der Regierungsarmee im Süden des Landes bringt er auf jeden Fall mehr Vertrauen entgegen als den Rebellen im Norden. Er ist gespannt auf die Neuwahlen Ende Oktober, wenn er sie noch erlebt. Seine Krankheit schreitet fort.
Er liebt dieses Land, und auch, als die französische Bevölkerung aufgerufen worden war, die Elfenbeinküste zu verlassen, hatte er sich nicht beeindrucken lassen. Er ist geblieben, hat seine Kneipe mit Joseph mehr schlecht als recht über Wasser gehalten. An vielen Tagen hatten sie gar nicht geöffnet, doch mit Joseph, einem einheimischen Kru, an seiner Seite hat er alle brenzligen Situationen gemeistert. Joseph, der nun fast 20 Jahre bei ihm arbeitet, ist sein engster Freund geworden. Wenn er selbst mal nicht mehr ist, fällt ›La Corne‹ an Joseph. Dies hat er schriftlich niedergelegt.
Viel ist die Kneipe zwar nicht wert, aber er hat sonst nichts, was er Joseph hinterlassen kann. Yves muss unwillkürlich schmunzeln. Bei der Namenssuche für seine Bar hat ihn damals dann doch die Sentimentalität gepackt. La Corne – das Horn. Er hat doch irgendwo seine Wurzeln im Bremer Stadtteil Horn, die er nie zu kappen vermocht hat.
Yves schiebt sich seine Lesebrille über die Augen und blättert die Matin Fraternité auf. Es interessiert ihn nicht wirklich, was die Presse schreibt, aber der Fisch ist in mehrere Lagen Papier verpackt gewesen, und die äußerste besteht aus vier Seiten der Matin von vor zwei Tagen.
Ein riesiges Foto springt ihm ins Auge: gut gekleidete Damen und Herren beim Empfang dreier neuer Mitarbeiter des deutschen Botschafters Stephan Keller, aufgenommen im Park der Botschaft.
Yves weiß, dass Keller seit zwei Jahren Deutschland an der Elfenbeinküste vertritt. Er überfliegt den Artikel. Er stammt von einem deutschen Journalisten, der als Pressesprecher für die Botschaft tätig ist. Plötzlich kneift Yves die Augen zusammen, reibt die Brille am Hemdzipfel sauber und starrt noch einmal auf den langen Artikel, in den ein kleineres Foto integriert ist: Der Botschafter schüttelt einem Mann die Hand. Ungläubig liest er den Text unterhalb des Bildes.
›Besonders herzlich begrüßte der Botschafter den Diplomaten Dr. Hans-Joachim Teschen, der seit drei Monaten in Abidjan seinen Dienst versieht. Keller und Teschen kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in Bremen, als Keller von 1996 bis 1999 Protokollchef der Senatskanzlei der Freien Hansestadt war.‹
Yves wird schwindlig. Nach so langer Zeit … Gut sieht er aus, der Teschen. Der hat seinen Weg gemacht. Ob der wohl verheiratet ist, Kinder hat?
Plötzlich muss er sich vor Schmerzen krümmen. Er sollte doch allmählich auf etwas Stärkeres umsteigen, der billige Weißwein benebelt nur noch ungenügend. Doch guter Whiskey und starke Schmerzmittel sind teuer. Wäre Teschen in seiner Lage, für den wäre gesorgt. Der Staat würde ihm einen angenehmen Lebensabend spendieren, und er hätte genug Geld, um sich in den besten Krankenhäusern behandeln zu lassen.
Der Funken einer Idee glimmt in seinem Kopf auf. Warum sollte nicht auch jemand für Yves Renard sorgen? Oder besser noch, für seine Tochter? Aus dem Funken wird eine Flamme. Yves rafft sich aus seinem Schaukelstuhl auf, die Schmerzen sind für den Augenblick vergessen. Er hat einen außergewöhnlichen Plan gefasst.
»Joseph«, ruft er, »bring mir mal das Telefonbuch raus!«
16. Juni 2010, zwischen Abidjan und Paris in 12.000 Metern Höhe
Yves Renard hat sich eben einen kleinen Cognac an Bord der A320 gegönnt. Zuletzt ist er diese Strecke vor mehr als 35 Jahren geflogen. Was für einen Luxus diese Flugzeuge heutzutage bieten! Dieser Airbus ist mit der alten Boeing 707 überhaupt nicht zu vergleichen.
Ab und zu ist Yves in Abidjan auf dem Flugplatz ›Felix Houphouet Boigny‹ gewesen und hat die startenden und landenden Flugzeuge beobachtet. Nicht, dass er Heimweh gehabt hätte.
Den Flugpreis von knapp 1.000 Euro hätte er sich unter normalen Umständen gar nicht leisten können. Aber was sind schon normale Umstände. Sein ganzes Leben als normal zu bezeichnen, wäre der reinste Witz.
Yves lehnt sich in seinem Sitz zurück. Neben ihm schnarcht eine dicke Französin, die ihm schon vor dem Start erklärt hat, unter welch unsäglicher Flugangst sie leide, aber dass sie doch ihren neugeborenen Enkel besuchen wolle, denn ihr Schwiegersohn sei als Chirurg in der Polyclinique Internationale Sainte Anne-Marie in Abidjan tätig. Daher hätte sie den weiten Weg von Frankreich angetreten. Ach Gott, ach Gott, wenn nur ihre Tochter und der Enkel in Paris wären, so ganz traute sie der Ruhe im Moment ja nicht. Ihr Schwiegersohn müsse natürlich in Abidjan bleiben, er sei doch so ein begnadeter Arzt, richtig goldene Hände hätte er, und der Kleine sei ja so entzückend. Wenn doch nur nicht dieser Dauerregen gewesen wäre, da würde sie ganz asthmatisch, hat sie ihn angekeucht. Irgendwann ist ihm der Kragen geplatzt.
»Dann halten Sie mal die Luft an, bevor Sie mir hier noch ersticken.« Beleidigt hat sie ihn aus ihren Glubschaugen angeschaut, tief geseufzt, um dann augenblicklich in einen komatösen Schlaf zu fallen.
Yves hängt nun seinen eigenen Gedanken nach. Es hat lange gedauert, bis er endlich Kontakt mit Teschen aufnehmen konnte. Der war zunächst für drei Wochen ins Landesinnere verschwunden. Als er dann wieder aufgetaucht war, war kein Termin zu bekommen gewesen. Erst vor 15 Tagen hatte es dann geklappt.
Er stand Teschen in dessen klimatisiertem Büro gegenüber, schüttelte ihm die Hand und wartete darauf, dass sein Gegenüber ihn wiedererkannte.
»Nun, Monsieur Renard, was kann ich für Sie tun?« Teschens Französisch war fast so gut wie seines, jedoch hört man den harten deutschen Akzent.
»Für mich nichts, aber für meine Tochter«, gab er kurz angebunden zurück.
»Ist sie hier in Schwierigkeiten geraten? Dann ist allerdings die französische Botschaft dafür zuständig.«
Yves musterte ihn einen Augenblick und antwortete in deutscher Sprache.
»Sie erkennen mich nicht, was?« Er sah ihm direkt in die Augen. Teschen runzelte die Stirn, blickte ihn fragend an. Er versuchte, das Gesicht einzuordnen. Alt, zerknittert, krank. Nein, er wusste nicht, wer sein Gegenüber war.
»Wir kennen uns seit über 35 Jahren. Wir hatten denselben Geldgeber.«
Teschen spürte den Sarkasmus in der Stimme des Mannes. Noch einmal blickte er Yves eindringlich ins Gesicht. Dann dämmerte ihm, wer dieser Mann sein musste. In seinen Augen spiegelten sich Angst und Entsetzen.
»Ich dachte, Sie wären tot«, flüsterte er.
»Es spielt keine Rolle, was Sie dachten oder denken. Setzen Sie sich, ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen.«
Und nun sitzt Yves Renard im Flugzeug nach Paris. Morgen früh um 5.55 Uhr Ortszeit wird er am Flugplatz Charles de Gaulle ankommen und direkt im Anschluss um 7.45 Uhr nach Bremen weiterfliegen.
20. Juni 2010, Bremen
Saskia Uhlenbruck stand oder besser saß noch immer neben sich. Bis vor fünf Minuten hatte ihr ein Mann gegenübergesessen, der vor fast 36 Jahren bei einem Autounfall umgekommen war. Zumindest hatte sie das all die Jahre geglaubt.
Sie wollte gerade Feierabend machen, als der Mann in ihrer Praxis auftauchte. Saskia Uhlenbruck war Psychologin und hatte sich einen Raum bei einer Ärztegemeinschaft angemietet. Die Sprechstundenhilfe hatte den Mann einfach zu ihrer Tür geschickt, weil sie wusste, dass Saskia heute keine Termine mehr hatte. Der Fremde hatte angegeben, es handle sich um einen Besuch privater Natur.
Zuerst glaubte sie natürlich nicht, was er ihr erzählte, doch dann zog er ein altes Foto aus seiner Brieftasche. Leicht zerknittert und die Farben verblasst, aber das Foto zeigte eindeutig Saskia an der Hand ihres Vaters Raimund. Sie kannte dieses Bild oder, besser gesagt, ein ähnliches, das in einem Fotoalbum klebte, welches bei ihrer Mutter in einer Schublade lag.
Schlecht sah er aus, todkrank. Auf ihr drängendes Nachfragen gab er schließlich an, dass er an Tuberkulose litt und die Infektion bereits so weit fortgeschritten war, dass keine Aussicht auf Heilung mehr bestand. Nicht nur die Lunge war befallen, sondern auch die Lymphknoten. Der Erreger war multiresistent, was die Behandlung mit teuren Medikamenten langwierig machte und in Afrika sowieso unerschwinglich war. Er sei nur zurückgekommen, um seine Tochter ein letztes Mal zu sehen, sagte er. Dann bat er sie um Verzeihung, versprach, sie würde sich nie wieder Sorgen machen müssen, und ging.
Sie hatte während der ganzen Zeit, in der ihr Vater ihr dies alles berichtete, kaum etwas gesagt, nun bereute sie es beinahe. Aber, was, bitte, hätte sie auch sagen sollen? Und was hatte er gemeint mit ›sie brauche sich nie wieder Sorgen zu machen‹? Sie kannte ihren Vater ja gar nicht. Diesen Part hatte all die Jahre Bertram Uhlenbruck übernommen, ihr Stiefvater. Drei Jahre alt war sie gewesen, als es hieß, ihr Vater wäre bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das hatte ihr zumindest ihre Mutter erzählt. Sie selbst hatte überhaupt keine Erinnerung an diesen Menschen, kannte ihn lediglich von Fotos. Drei Jahre nach dem Tod ihres Vaters heiratete ihre Mutter Hannelore wieder, und Bertram Uhlenbruck war Saskia ein guter Vater.
›Verdammt, Mama, hast du mich vielleicht die ganzen Jahre über angelogen?‹, dachte sie zornig und zugleich tief verletzt. Tränen schossen ihr in die Augen, und sie fühlte, wie sich eine eiserne Faust in ihren Magen krallte. Saskia riss sich zusammen, schnappte ihre Tasche und verließ ihr Zimmer. Ohne einen Abschiedsgruß hastete sie an der Rezeption vorbei, an der eine der medizinischen Fachangestellten noch die Karteikarten des Tages wegräumte. Sie machte sich nicht die Mühe, die Tür hinter sich zu schließen, und rannte die Treppe hinunter.
Als sie schwer atmend auf die Straße trat, taten ihr die Sonnenstrahlen wohl. Dieses Jahr hatte es lange gedauert, bis der Winter vorbei gewesen war und endlich der Sommer ein Einsehen hatte mit Mensch und Tier, die allesamt nach Licht und Wärme gierten. Nun war es herrlich warm und es sollte noch richtig heiß werden, wenn man den Meteorologen Glauben schenken durfte.
Saskia Uhlenbruck wollte noch nicht nach Hause. In den vier Wänden ihres Zwei-Zimmer-Appartements würde sie wahrscheinlich verrückt werden. Sie schlug den Weg in Richtung Bürgerpark ein. Die Praxisgemeinschaft hatte in der Wachmannstraße ihre Räumlichkeiten, und so war es nicht weit bis zum Park. Sie liebte diesen riesigen Landschaftsgarten mit seinen gewundenen Wegen, den Wasserläufen, einem Tiergehege, dem Natur- und Erlebnispfad und seinen Liegewiesen. Selbst reiten durfte man in einem Teil des Parks. In den verschiedenen Lokalen konnte man gut essen, und im Sommer wechselten sich Theatervorstellungen, Jazz und klassische Konzerte mit bunten Kinderfesten ab.
Sie spazierte zum Meiereisee und suchte sich auf der Veranda der Meierei einen Platz. Der Blick war einfach grandios, er reichte über das Parkhotel bis in die Stadt hinein, man konnte sogar die Türme des Doms sehen, und mitten auf der Meiereiwiese grasten sieben Schwarzbunte.
Ein Kellner eilte sofort herbei. Saskia Uhlenbruck bestellte ein Glas Grauburgunder und eine kleine Flasche Mineralwasser, nach Essen war ihr nicht zumute und daher winkte sie ab, als er fragte, ob sie denn die Speisekarte haben wollte.
Als sie mit ihrem Glas Wein in der Hand in der Sonne saß, fühlte sie sich etwas ruhiger, doch sie wusste, dass ihr noch ein schwerer Gang bevorstand und die Ruhe nur von vorübergehender Dauer war. Sie zögerte es lange hinaus, den letzten Schluck Wein zu trinken, doch schließlich bezahlte sie und wählte für den Rückweg eine andere Strecke, die sie zu ihrem Auto bringen würde, das sie ganz in der Nähe der Praxis geparkt hatte. Der Weg führte sie über die Hachezbrücke mit ihrem schönen schmiedeeisernen Geländer, und sie blieb kurz stehen, um einer Entenmutter mit ihrer riesigen Kinderschar hinterherzublicken. An der Parkallee angekommen, überquerte sie die Straße und ging zu ihrem roten Mini-Cooper, der auf einem der für die Praxis reservierten Parkplätze stand.
Seufzend schloss sie ihr Auto auf und fuhr los. Zunächst hatte sie überlegt, ob sie nicht doch zuerst in ihre Wohnung in Horn fahren sollte. Sie fühlte sich ausgelaugt und erhitzt, und eine kühle Dusche hätte ihr sicher gutgetan, auch, um vielleicht den Kopf wieder klar zu bekommen. Doch dann hatte sie sich entschieden, ohne Umweg ihre Mutter aufzusuchen, die in Oberneuland wohnte.
Saskia Uhlenbruck parkte direkt vor dem hübschen Haus mit den azurblauen Fensterläden. In diesem Haus war sie groß geworden. Bevor sie ausstieg, musste sich Saskia einen Moment sammeln. Dann ging sie entschlossen den gepflasterten Weg zur Haustür, rupfte gedankenverloren eine verblühte Rhododendronblüte ab und warf sie unter den riesigen Busch. Eigentlich hatte sie noch einen Haustürschlüssel für alle Fälle, aber der lag in ihrer Wohnung. Sie klingelte.
»Hallo, mein Schatz«, freute sich ihre Mutter, als sie öffnete. Sie breitete die Arme aus, um ihre Tochter zu umarmen. »Was treibt dich zu mir? Komm mit nach hinten, wir sitzen auf der Terrasse. Es ist so wunder…«, weiter kam Hannelore Uhlenbruck nicht, denn Saskia fiel ihr ins Wort und schob sie einfach zur Seite.
»Ich muss mit dir reden, allein«, sagte sie mit Nachdruck.
Hannelore Uhlenbruck sah ihre Tochter aufmerksam und zugleich etwas ängstlich an. »Ist was passiert?«
»Kann man so sagen«, gab Saskia trocken zurück und wunderte sich über sich selbst, dass sie so ruhig blieb. »Ich hatte gerade eine Begegnung der unheimlichen Art. Schon mal mit einem Toten gesprochen?« Jetzt standen sie in der Küche und lehnten an der Esstheke. Ihre Mutter blickte sie verständnislos an.
»Ach, hallo, Saskia!«, dröhnte Bertram Uhlenbrucks Stimme, der gerade durch die Terrassentür ins Esszimmer gekommen war. Er war auf dem Weg in die Küche, um sich ein Bier aus dem Kühlschrank zu nehmen, und hatte die beiden Frauen sprechen gehört. Uhlenbrucks Glatze war durch einen leichten Sonnenbrand gerötet und sein stattlicher Bauch wogte vor ihm her. »Komm, setz dich mit raus, es ist herrlich.« Er beugte sich über die Theke und gab ihr einen Kuss auf die Wange.
Sie schüttelte den Kopf. »Nee, lass mal. Ich will was mit Mama besprechen und …«
»Dabei störe ich. Schon kapiert. Bin gleich wieder unsichtbar.« Bertram zwinkerte seiner Stieftochter zu, flitzte, soweit es seine Leibesfülle erlaubte, zum Kühlschrank und verschwand mit der beschlagenen Flasche wieder nach draußen.
Hannelore Uhlenbruck fasste ihre Tochter am Arm. »So, und jetzt raus mit der Sprache. Was ist los, was ist so dramatisch, dass Bertram es nicht hören soll? Und was meintest du vorhin mit dem Toten?«
Saskia öffnete ebenfalls den Kühlschrank und nahm ein Mineralwasser aus der Flaschenhalterung. Wie sollte sie nur anfangen? Im Auto hatte sie genau gewusst, was sie ihrer Mutter sagen wollte. Voller Zorn, voller Enttäuschung und tief verletzt, waren ihr die Sätze nur so im Kopf herumgegangen. Und jetzt? Jetzt wusste sie überhaupt nichts mehr. Komisch, ihren Patienten empfahl sie immer ›nur raus mit der Sprache‹. Es war fast zum Lachen.
»Saskia?« Ihre Mutter hielt ihr ein Glas hin. Schließlich schraubte sie den Verschluss auf und schenkte sich ein. Saskia Uhlenbruck trank einen Schluck, atmete tief durch und fasste sich ein Herz.
»Ich habe Vater getroffen.«
Hannelore Uhlenbruck verstand gar nichts. »Ja, und? Ich versteh nicht, was du mir sagen willst.«
Saskia schnaubte durch die Nase und wunderte sich erneut darüber, dass sie so gelassen blieb. »Ich meine nicht Bertram.«
Selten hatte sie so viele Gefühle sich auf dem Gesicht eines Menschen in so kurzer Abfolge widerspiegeln sehen wie jetzt bei ihrer Mutter: Verstehen, Angst, Wut, Ablehnung.
»Das kann nicht sein. Was redest du da? Dein Vater ist tot, und das weißt du.« Hannelores Gesichtszüge hatten sich verhärtet. Saskia fühlte sich in ihrem Verdacht bestätigt. Ihre Mutter hatte sie all die Jahre angelogen und log immer noch. Sie stieß sich von der Esstheke ab und lehnte sich mit dem Rücken an die Küchenzeile.
»Das ist kein Quatsch. Ich habe ihn gesehen. Er war bei mir in der Praxis. Weißt du, wie sich das anfühlt? Nach fast 36 Jahren kommt mein tot geglaubter Erzeuger und zieht ein altes Foto heraus, auf dem zu sehen ist, wie er mich an der Hand hält. Lüg mich jetzt nicht weiter an! Ich will wissen, warum? Warum hast du das getan?« Mit jedem Satz war sie lauter geworden, der ganze Schmerz, die ganze Enttäuschung über diesen Verrat ihrer Mutter brachen nun aus ihr heraus. Sie machte zwei Schritte nach vorne, fasste ihre Mutter an beiden Armen, schüttelte sie und schrie: »Warum, Mama? Warum?« Sie stieß ihre Mutter von sich, brach schluchzend zusammen, rutschte an der Küchenzeile nach unten und blieb auf dem Fußboden sitzen.
Hannelore Uhlenbruck half ihr auf, führte ihre hemmungslos weinende Tochter zu einem der Esszimmerstühle und drückte sie sanft auf einen Stuhl.
»Was ist denn bei euch los? Man hört Saskia bis nach draußen«, fragte Bertram Uhlenbruck, der wieder hereingekommen war, beunruhigt. Geschockt blickte er auf seine Stieftochter, die wie ein Häufchen Elend zusammengesunken am Tisch saß und sich nicht beruhigen konnte.
»Jetzt nicht, Bertram«, sagte Hannelore leise. »Lass uns bitte allein.« Uhlenbruck zuckte hilflos mit den Schultern und zog sich wieder auf die Terrasse zurück.
Hannelore stand schweigend neben ihrer Tochter, strich ihr nur immer wieder liebevoll über die Haare. Nach ein paar Minuten schien Saskia sich wieder gefangen zu haben, ihre Tränen waren versiegt, und sie saß mit dem Taschentuch, das ihre Mutter ihr gegeben hatte, in der geballten Faust wie erstarrt am Tisch. Hannelore stellte zwei kleine Gläser hin und schenkte sich und ihrer Tochter einen Grappa ein. Den brauchten sie jetzt wohl beide. ›Mein Gott, Raimund, du Idiot. Wieso bist du nur wieder aufgetaucht?‹, dachte sie. Sie leerte ihr Glas in einem Zug. Saskia trank nichts. Abwartend betrachtete sie ihre Mutter.
»Es tut mir leid. Ich dachte, es wäre besser so. Für dich. Für uns …«, begann Hannelore ihren Erklärungsversuch.
»Besser? Was soll daran besser sein? Besser als was? Besser, ich glaube, mein Vater sei tot, als dass eure Ehe gescheitert sei?« Nun trank sie doch einen kleinen Schluck Grappa, der wie Feuer ihre Kehle hinabrann.
»Du verstehst das nicht«, hob Hannelore wieder an.
»Dann erklär’s mir, verdammt noch mal!«, unterbrach Saskia sie erneut. »Und zwar so, dass ich es verstehe.«
Hannelore Uhlenbruck schwieg. Wie anfangen? Und warum alte Geschichten aufwärmen? Doch sie kannte ihre Tochter gut genug, um zu wissen, dass diese sofort merken würde, wenn sie nach Ausflüchten suchte, und außerdem wollte ihr sowieso nichts einfallen. Sie hätte nie gedacht, dass diese Situation einmal eintreten würde, hatte sich nie Gedanken darüber gemacht, was sie in einem solchen Fall ihrer Tochter erzählen würde. Wozu auch, sie war sicher gewesen, dass Saskias Vater nie wieder in ihrer beider Leben treten würde.
»Ich höre«, forderte Saskia und sah ihre Mutter erwartungsvoll an.
»Also gut, ich werde dir erzählen, was damals alles passiert ist.« Hannelore fuhr sich durch die schwarz gefärbten Haare und begann, ihre Fingernägel zu betrachten. »Du warst grade mal drei Jahre alt, als dein Vater seinen Unfall hatte. Oder besser gesagt, er hat diesen Unfall inszeniert, um aus Deutschland zu verschwinden.«
Saskia schaute ihre Mutter verwirrt an. »Bitte? Wieso das denn? Was hatte er verbrochen?«
Hannelore hob die Hand, um sie in ihrem Redefluss zu stoppen.
»Lass mich einfach erzählen, Kind. Dein Vater war bei einer Sicherheitsfirma angestellt. Er leitete dort die Einsätze bei Großveranstaltungen, also zum Beispiel bei großen Konzerten, Besuchen von berühmten Persönlichkeiten und so. Aber auch, wenn sich Politiker trafen, wie der damalige Bremer Bürgermeister Koschnick, der Willy Brandt empfing. Mitte der Siebziger war ja allerhand los in Deutschland. Helmut Schmidt wurde Bundeskanzler, nachdem Brandt zurückgetreten war, die RAF terrorisierte das Land. Auch in Bremen gab es Sympathisanten. Irgendwann kamen Gelder auf unser Konto, die ganz sicher nichts mit dem Job deines Vaters zu tun hatten, auch wenn er mich dies hat glauben lassen wollen. Worin dein Vater verwickelt war, weiß ich nicht. Ich habe nie herausgefunden, woher das Geld kam. Ehrlich gesagt, wollte ich es auch nie wissen. Er hat ja so gut wie nie über seine Arbeit gesprochen. Ich habe eben erwähnt, es war die Zeit der RAF. Auch dein Vater hat schon immer mit der linken Szene sympathisiert. Suchte Begegnungen mit Gleichgesinnten. Ich habe keine Ahnung, was er sich davon versprochen hat. Einmal ist er sogar nach Wolfsburg gefahren, um dort irgendwelche Kontakte zu knüpfen. Ich hatte schon ein ungutes Gefühl, aber er wollte nicht auf mich hören. Zuerst habe ich ja alles für Spinnerei gehalten, aber er hat die Sache sehr ernst genommen. Ich habe wirklich keinen Schimmer, auf was oder mit wem er sich dann doch eingelassen hatte, aber irgendetwas ist verdammt schiefgelaufen. Saskia, du warst ja fast noch ein Baby. Da war es schon besser, wenn ich nichts gewusst habe. Jedenfalls hatte er plötzlich Angst um sein Leben, und daraufhin beschloss er unterzutauchen. Es ist ihm offensichtlich gelungen, wie man sieht«, beendete sie ihre Erzählung mit Bitterkeit in der Stimme.
Saskia Uhlenbruck saß sprachlos da. Sie hatte eigentlich all die Jahre nie gefragt, was für ein Mensch ihr Vater gewesen war. Seine Stellung hatte Bertram Uhlenbruck übernommen, als er Hannelore geheiratet und auch ihr, Saskia, seinen Namen gegeben hatte.
Hannelore richtete sich in ihrem Stuhl auf, schenkte sich nach, trank einen Schluck und fuhr fort.
»Er hatte mir, als er verschwand, einen Brief geschrieben mit der Bitte, dir und auch sonst niemandem zu sagen, dass er noch lebte. Gott sei Dank kam der Brief erst nach seiner Beerdigung an, ich glaube, meine schauspielerische Leistung hätte dieser nicht Stand gehalten, mit dem Wissen, dass da jemand ganz anderes im Auto verbrannt ist.« Sie schüttelte den Kopf, nach all den Jahren immer noch ungläubig, was damals alles passiert war. Dann blickte sie ihrer Tochter in die Augen und fuhr fort. »Bevor er verschwand, hat er dir noch ein Weihnachtsgeschenk zukommen lassen. Die Puppenstube. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.« Sie sah ihre Tochter fragend an.