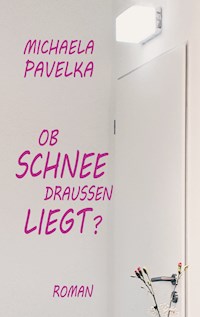Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Robert, der unter seinem zynischen Vorgesetzten leidet und zunehmend depressiv wird, plagen lebhafte Mordphantasien. Er wünscht seinem Chef den Tod. Vera, die einen ausgeprägten Widerwillen gegen die Welt entwickelt hat und die Horrornachrichten im Radio nicht mehr ertragen kann, gerät sporadisch in den Sog ihrer suizidalen Phantasien. Und der junge Amadeus hat aufgrund einer tiefen seelischen Verwundung seinem musikalischen Talent den Rücken zugekehrt. Als sie nach längerem Leidensweg endlich Unterstützung durch erfahrene Psychotherapeuten erhalten, findet das bis dahin Unausgesprochene Ausdruck und ermöglicht Entwicklungen. Ausgesprochen Unerhörtes nimmt seinen Lauf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert, der unter seinem zynischen Vorgesetzten leidet und zunehmend depressiv wird, plagen lebhafte Mordphantasien. Er wünscht seinem Chef den Tod.
Vera, die einen ausgeprägten Widerwillen gegen die Welt entwickelt hat und die Horrornachrichten im Radio nicht mehr ertragen kann, gerät sporadisch in den Sog ihrer suizidalen Phantasien.
Und der junge Amadeus hat aufgrund einer tiefen seelischen Verwundung seinem musikalischen Talent den Rücken gekehrt.
Als sie nach längerem Leidensweg endlich Unterstützung durch erfahrene Psychotherapeuten erhalten, findet das bis dahin Unausgesprochene Ausdruck und ermöglicht Entwicklungen.
Ausgesprochen Unerhörtes nimmt seinen Lauf.
Michaela Pavelka, Jahrgang 1965, arbeitet seit 20 Jahren als Psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis.
2009 erschien ihr erster Roman „Das Land hinter dem Horizont“.
Ihr zweiter Roman „Im Schatten der Stille“ erschien 2011.
„Ausgesprochen unerhört“ ist ihr dritter Roman.
Von Michaela Pavelka
sind bei BoD außerdem erschienen:
Das Land hinter dem Horizont (2016)
Im Schatten der Stille (2018)
„Du brauchst nur weiter zu gehen, komm nicht auf Scherben zum Stehen.“
Andreas Bourani
Ich danke ganz herzlich meinem Mann Norbert und meiner Tochter Sophia-Maria für die wertvollen Anregungen und das sorgfältige Lektorat.
Bei meiner Tochter bedanke ich mich außerdem für die Bildbearbeitung und die Gestaltung des Covers.
Inhalt
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
eins
Beim nächsten Mal zähle ich bis drei, flüsterte Vera Weiß, beim übernächsten Mal bis vier und dann bis fünf. Ich schließe die Augen, heute nur für eine Sekunde. Die Straße ist frei. Ich fahre langsam, aufmerksam. Es dämmert bereits. Herbst 2015. Der Herbst kann nicht enttäuschen, da man von ihm jede Art von Wetter erwartet oder auch nicht. Die meisten sitzen wahrscheinlich zu Hause bereits beim Abendessen. Eine Sekunde ist kurz. Was soll da passieren? Außerdem bin ich in der 30er-Zone. Frage mich immer wieder, wie es sich anfühlen wird, der Aufprall, kurz bevor man das Bewusstsein verliert. Eine Frage der Geschwindigkeit. Eine Frage von Leben und Tod. Hunderte Male habe ich es mir vorgestellt. Das Auto, das Haus direkt in der Rechtskurve, der Aufprall. Wieso baut man ein Haus direkt in einer Kurve, so nah an der Fahrbahn? Wie fühlt es sich an, wenn die Airbags sich öffnen?
Oder auf der Autobahn. Ja, da habe ich tatsächlich schon bis zwei gezählt, zwei Sekunden lang die Augen geschlossen, während ich mit 120 km/h auf gerader Strecke fuhr, vor mir sah ich in großem Abstand ein anderes Auto, keine Ahnung, was für ein Fabrikat. Es hätte nichts passieren können, keine Kurve, kein Stau in Sicht. Jemand, der erkältet ist und während der Fahrt niest, schließt meist auch die Augen, wenigstens für einen kurzen Moment. Was mich antreibt und umtreibt, weiß ich nicht. Traurig bin ich. Eine tiefe Traurigkeit wühlt in mir wie ein Schwelbrand. Unpassender Vergleich. Eigentlich denke ich bei Traurigkeit eher an die Farbe Blau oder an Dunst, Nebel und Wasser. Nein, es ist kein Schwelbrand, der in mir glüht, sondern ein alles durchziehender Dunst, ein Nebel oder Tau, fühlt sich an wie Schritte in unberührtem Schnee.
Im Radio berichteten sie über den Anschlag in Paris vom 13. November 2015. Gotteskrieger des Islamischen Staates schossen wahllos auf unschuldige Menschen in Restaurants, im Konzertsaal und sprengten sich vor einem Fußballstadion in die Luft. Was glauben die? Dass sich Gott in einem Staat niederlassen würde, der auf Blut gegründet wurde? Wie kann man Gott mit seinem Gegenspieler verwechseln? Übersehene Paradoxien. Vera Weiß schaltete das Radio aus. Sie versuchte, an etwas anderes zu denken, an ihre Arbeit als Ärztin, an ihren Kollegen Theo Stern und die gute langjährige Zusammenarbeit. Der Herbst bescherte der Praxis die typische Grippewelle. Im Wartezimmer ein einziges Geschniefe.
Um 20.00 Uhr hatte Vera die Praxis verlassen. Zu Hause angekommen, freute sie sich auf einen ruhigen Abend in ihrer kleinen, gemütlichen Dachgeschoss-Wohnung. My home is my castle ging es ihr durch den Kopf, während sie die Tür hinter sich schloss mit dem Gefühl, die Welt endlich wieder aussperren zu können. Wenigstens für ein paar Stunden wollte sie dem Lärm, dem Entsetzen dieser Welt entkommen.
Noch immer lag der Geruch von Melisse in der Luft, einem ätherischen Öl, das sie stets in ihren Verdampfer träufelte, der auf einer Vintage-Kommode im Wohnzimmer stand. Daneben ein braunes Holzkästchen, das aussah wie eine kleine Schatztruhe. Hier bewahrte sie die Teelichter und Streichhölzer auf. Sie liebte das Geräusch, das Streichholz auf der Reibfläche und den aufsteigenden Geruch von Schwefel. Ganz bestimmt, dessen war sie sich sicher, gehörte dieses Geräusch, verbunden mit dem Schwefelduft zu jenen Ereignissen, die der Vergangenheit angehörten, die zunehmend in Vergessenheit geraten würden. Vera wird es bewahren, das Geräusch und auch diesen Geruch. Sie bewahrte alles Mögliche und Unmögliche auf, Wesentliches und Unwesentliches, nebensächliche Details, die kaum jemand beachtet. Ihr Gedächtnis war ein riesiger Raum, in dem Unzähliges gelagert wurde und miteinander in Verbindung stand.
In der Küche stand noch das Geschirr vom Frühstück auf der Spüle. Sie öffnete den Gefrierschrank und zog eine Pizza Tonno heraus. Ihr Magen knurrte. Sie schob die Pizza in den Backofen, verließ die Küche und ging ins Wohnzimmer. Müde ließ sie sich auf ihre Couch fallen, ein Kissen unter dem Kopf, den Blick zur Decke, den Gedanken freien Lauf.
Seit einem Jahr hatte sie jede Woche einen Termin bei einem Psychotherapeuten, Heinrich Hugott. Sie mochte ihn ganz gern. Manchmal fand sie, dass er etwas zu still war. Offensichtlich hatte er eine Vorliebe für Schweigen. Mittlerweile konnte sie bei ihm mehrere Arten des Schweigens unterscheiden. Da gab es einmal das Schweigen, das einfach nur Nachdenken bedeutete, wenn er über eine Antwort nachdachte. Dann gab es das beredte Schweigen, das darauf hinwies, dass er etwas aussprechen wollte, aber aus irgendeinem Grund vorzog, es nicht zu tun. Manchmal hatte sie den Eindruck, dass er es gar nicht bemerkte, dass es einfach nur beiläufig geschah so wie man atmet, ohne darüber nachzudenken.
Doch es gab auch Momente, da schien er sich mit einem stillen Blick versichern zu wollen, dass sie seine unausgesprochene Botschaft gehört hatte, die er zwischen die Zeilen geflochten hatte. Was sie jedoch heraushörte oder hineininterpretierte, konnte keiner Prüfung unterzogen werden. So bleibt Unausgesprochenes ungehört und unerhört. Und sie spürte, dass manches sich verflüchtigen würde, wenn sie es jemals in Worte kleiden würde. Es gibt Realitäten, die nur bleiben, wenn man sie nicht benennt.
Hin und wieder war sein Schweigen auch Ausdruck einer Enttäuschung.
Und verwundert stellte sie eines Tages eine ganz neue Art des Schweigens bei ihm fest. Es war ein Schweigen, das sie als Systemabsturz bezeichnete und das von hochgezogenen Augenbrauen, einem verdutzten Gesichtsausdruck und einem leeren Blick begleitet war, so als wisse er nicht, wie er das, was sie gesagt hatte, einordnen sollte, als drehte er ein Puzzleteil in seiner Hand auf der Suche nach der passenden Lücke.
Besondere Aufmerksamkeit erforderten seine mehrdeutigen Aussagen, jene Sätze, die zwar aus Worten bestanden, die aber irgendwie nur Platzhalter waren für irgendwelche Bedeutungen, die man je nach Phantasiebegabung hineinlegen konnte oder nicht.
Es hatte etwas Kryptisches. Tagelang versuchte sie herauszufinden, was er denn gemeint haben könnte und entdeckte eines Tages, dass sie mehr über ihn als über sich selbst nachdachte.
Bedeutungsschwere Sätze, so schön sie auch klingen mögen, können ihr Ziel eben verfehlen.
Vera fragte sich, ob er wusste, dass seine Worte vielleicht ganz anders interpretiert wurden, als er glaubte.
Hin und wieder jedoch hatten seine Sätze eine unbeschreibliche Wirkung.
So ergab es sich, dass an einem jener Tage, an denen Vera seit dem frühen Morgen bereits den Eindruck hatte, dass irgendetwas Besonderes, etwas Ungewöhnliches geschehen würde, die Worte von Hugott bis in ihr Innerstes vordrangen und liegen blieben wie Samenkörner auf vorbereiteten Boden.
Es gibt Momente, die teilen die Zeit in ein Davor und ein Danach. Manchmal spürt man es sofort. Manchmal jedoch wird es einem erst viel später bewusst.
Für seine zweiundsechzig Jahre, dachte Vera, sah er erstaunlich jung aus. Ziemlich glatte Haut. Vielleicht wegen seiner spärlichen Mimik. Man hätte ihn auf Mitte Fünfzig schätzen können. Offensichtlich hatte er eine Schwäche fürs Essen. Ob für gutes Essen konnte man nicht sagen. Aber er aß deutlich mehr, als seinem Körper gut tat. Seine Figur hatte etwas von Buddha. Sein Hemd spannte über seinem Bauch und die breiten Ringe an seinen Händen gruben sich in seine fleischigen Finger, die, wenn er etwas in seinen Computer tippte, aussahen wie träge Tänzer.
Der Geruch von Pizza drängte sich in Veras Gedanken. Sie räkelte sich auf dem Sofa und schaute auf ihre Armbanduhr. Noch fünf Minuten.
Immer wieder dachte sie an das, was Hugott ihr beim letzten Mal zum Schluss noch gesagt hatte, kurz bevor sie eigentlich schon gehen wollte.
Sie war schon im Aufstehen begriffen, als er diese Worte sprach, langsam und eindringlich, einer hypnotischen Suggestion gleich:
„Sie sind immer so vernünftig. Tun Sie doch mal etwas Spontanes, etwas, das Sie sonst nicht tun würden. Tun Sie doch einfach mal etwas Ungewöhnliches!“
Etwas Ungewöhnliches tun, etwas, das man sonst nicht tut, ein Wagnis eingehen, ohne zu wissen, was es auslöst und welche Kreise es zieht?
Manche Worte sind wie Pfeile, die einen Menschen in eine bestimmte Richtung schießen.
Vera erhob sich vom Sofa, lief in die Küche und kam mit einer dampfenden Pizza zurück, stellte sie auf den Esstisch und setzte sich auf einen der sechs antiken Stühle, die nie jemals alle benutzt wurden. Das Wasser lief ihr im Mund zusammen. Sie teilte die Pizza in acht Teile und zog sich ein Stück vom Teller. Der Käse warf kleine Bläschen.
Etwas Ungewöhnliches tun.
Sie schaltete ihren Laptop ein und gab den Suchbegriff King-Dom bei Google ein. Seit vielen Wochen lag ihre Freundin Monika Vogel ihr damit in den Ohren. King-Dom sei ein Forum der besonderen Art. Man könne dort ein Profil erstellen und mit interessanten Männern in Kontakt treten. Vera konnte sich die Begeisterung ihrer Freundin nicht erklären und wollte herausfinden, was es damit auf sich hatte.
Als sich die Startseite von King-Dom öffnete, schüttelte sie den Kopf bei dem, was sie dort zu lesen bekam. Sie klickte sich durch verschiedene Profile und fragte sich teils neugierig, teils fassungslos, was die Leute dort so umtreibt, wie man Gefallen daran finden kann, sich auspeitschen zu lassen oder selbst jemanden zu schlagen und ob sich manche User eigentlich nicht schämen, ihren Rücken, der voller blutiger Striemen war, zur Schau zu stellen. Auf einem der Profile las sie, dass der Meister sehr zufrieden war mit seiner stolzen Sklavin. Das war der Moment, in dem sie kurz davor war, sich aus dem Forum auszuloggen. Sie dachte an die Sklaverei und wie viel Leid man damals den Sklaven zugefügt hatte. Kein Sklave war jemals stolz darauf, Sklave gewesen zu sein. Die Menschen in King-Dom hatten da etwas gründlich missverstanden.
Schließlich siegte Veras Neugier und sie erstellte sich ein Profil, um der Sache auf den Grund zu gehen. Aus den Gesprächen mit ihrer Freundin wusste sie, dass sie sich irgendeinen Profilnamen wählen könne, aber am besten irgendetwas mit Lady.
Nach kurzer Überlegung machte sie folgende Angaben.
User-Name: Lady Morgan.
Größe: 1,70 m.
Gewicht: 60 kg.
Beziehungsstatus: Ledig.
Bisherige Erfahrungen: Normal.
Neigungen: Neugierig.
Neigungen, was soll denn damit gemeint sein? Eigenartig. Einfach mal abwarten, was passiert. Wahrscheinlich halten die mich für bescheuert, bestenfalls für normal oder eventuell gar für unerfahren. Wie auch immer.
Dann klickte sie wieder verschiedene Profile an, um nachzuschauen, was die anderen denn so schreiben. Sie schluckte, wollte ihren Augen nicht trauen.
Oh Gott! Bin ich hier richtig? Was schrieb dieser Mann in seinem Profil? Oh je!
Erfahrung mit Sinnesentzug, Keuschhaltung, Strom, Gerte, Käfighaltung. Gibt es hier Tiere? Verrückt! Und sein Name? Fürst der Finsternis. Heutzutage kommt der Teufel im Anzug daher. Das dachte sie schon lange. Und er steht auf 24/7. Was ist das denn schon wieder? Wo treibt sich Monika da bloß herum? Hier soll es stilvolle Männer geben? Macht eher den Eindruck, dass das hier das Tor zur Hölle ist, wo sich eine Horde Irrer herumtreibt. Oh, was ist das? Da blinkt etwas auf meinem Profil. Eine Mail. Von wem? Wie öffnet man die denn bloß? Mal drauf klicken. Aha. Geht ja.
Sir Dom:
Guten Abend, verehrte Lady Morgan!
Mit Interesse habe ich die wenigen Angaben in Ihrem Profil gelesen und gehe davon aus, dass Sie hier neu sind. Ich heiße Sie herzlich willkommen.
Gruß Sir Dom
Was antwortet man da? Nachdenklich kaute Vera auf ihrer Pizza.
Klingt ja eigentlich fast normal. Ungewöhnlich freundlich, ja höflich. Irgendwie verlockend.
Einfach mal zurückschreiben. Im Notfall mache ich schnell den Computer aus.
Lady Morgan:
Guten Abend, Sir Dom!
Vielen Dank für Ihre freundliche Nachricht. Ja, ich bin neu hier.
Sir Dom:
Was führt Sie hierher in diese Gefilde?
Lady Morgan:
Das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Interesse?
Neugier?
Sir Dom:
Das ist doch ein guter Anfang. Neugier worauf?
Lady Morgan:
Auf das, was hier los ist. Hört sich dämlich an. Ich weiß. Eine Freundin hat mir erzählt, dass man hier interessante Herren kennen lernen könnte.
Sir Dom:
Das ist gewiss. Lächel.
Lady Morgan:
„Gewiss“ hört sich gut an. Lächel.
Sir Dom:
Haben Sie denn Erfahrungen mit dominanten Herren?
Lady Morgan:
Tja. Dominant? Wieso? Gute Frage. Weiß nicht. Glaube nicht. Oder doch? Man ist ja immer schon mal einem dominanteren Mann begegnet. In meinen Träumen oder Albträumen vielleicht.
Sir Dom:
In Ihren Träumen? Wovon träumen Sie denn?
Lady Morgan:
Sie sind so direkt. Das ist mir ein bisschen peinlich. Das möchte ich jetzt vielleicht lieber doch nicht sagen.
Sir Dom:
Ein anderes Mal? Möchten Sie es mir ein anderes Mal sagen?
Lady Morgan:
Wer weiß.
Sir Dom:
Die Kommunikation mit Ihnen gefällt mir.
Lady Morgan:
Oh, Sie machen mich verlegen.
Sir Dom:
Verlegen – das ist gut.
Lady Morgan:
Was ist denn daran gut?
Sir Dom:
Einfach so.
Lady Morgan:
Ich schreibe auch gerne mit Ihnen. Warum sind Sie denn hier in dem Forum?
Sir Dom:
Ich liebe es, eine Frau zu führen, sie zu entwickeln, zu ihrer vollen Entfaltung zu bringen.
Lady Morgan:
Zu führen? Entwickeln? Wieso?
Sir Dom:
Das würde ich Ihnen gerne näher bringen.
Lady Morgan:
Und wie?
Sir Dom:
Ich würde Sie es gerne erleben lassen, wenn Sie erlauben, Lady Morgan.
Ich muss mich jetzt allerdings für heute verabschieden.
Sehen wir uns hier wieder? Das würde mich freuen.
Lady Morgan:
Ich würde mich auch freuen. Also sagen wir bis bald.
Da war er schon offline. Ihre letzte Nachricht hatte er gar nicht mehr gelesen. Komisch. Naja. Egal. Sie schaltete ihren Laptop aus, klappte den Deckel herunter. Das letzte Stück Pizza aß sie kalt, pickte mit dem Zeigefinger noch ein paar Krümel vom Teller.
Wenig später legte sie sich ins Bett und schaltete ihre Nachttischlampe aus, ein Relikt aus Kindertagen, von dem sie sich nie hatte trennen können. Eine völlig schlichte Lampe, ein Kugelfuß mit einem pyramidenartigen Lampenschirm aus orangem Stoff, ein Geschenk der Patentante zu ihrer Kommunion.
Sie zog die Bettdecke bis zum Hals und starrte in die Dunkelheit. Erst allmählich zeichneten sich Umrisse ab, tauchten die Gegenstände wie aus dem Nichts auf.
Es wurde eine unruhige Nacht, in der sie von dunklen Gestalten mit Masken und schweren schwarzen Umhängen träumte, die nur mit einem Messing-Verschluss vor der Brust zusammengehalten wurden. Sie irrte durch ein großes Schloss mit verwinkelten Gängen und Feuerfackeln an den Wänden. Als sie eine breite Steintreppe hinauf lief, kam ihr ein Mann entgegen, groß, dunkel gekleidet. Durchdringend war sein Blick. Nur kurz berührte er ihren Arm mit seiner Hand. Er trug schwarze Lederhandschuhe. Im Vorbeigehen drehte er sich noch einmal kurz zu ihr um. Ihre Blicke begegneten sich und ein tiefer Schauer durchfuhr ihren Körper. Dann verschluckte ihn die Finsternis.
zwei
Der Regen schlug ihm ins Gesicht, als er vor seiner Haustür stand und den Schlüssel in der Jackentasche suchte. Manfred Stein hasste es, mit nassen Schuhen ins Haus zu gehen. Da er allein lebte, musste er schließlich selbst putzen und seine Hausarbeiten erledigen. Seiner Ansicht nach war das Frauensache, aber sie liefen ihm ständig davon. Sie wussten meinen Wert wohl nicht zu schätzen, dachte er.
Als er die Türschwelle übertreten wollte, spürte er einen Widerstand, einen feinen Draht an seinem Schienbein, der vor seiner Tür gespannt war. Er bückte sich, verwundert, Kopf schüttelnd, fluchte und löste den Draht, warf ihn achtlos zur Seite. Wahrscheinlich die Nachbarskinder! Wenn es seine Kinder wären, würde er ihnen Respekt beibringen.
Schließlich ging er in den Hausflur, doch bevor er die Tür schließen konnte, wurde sie durch einen Windzug ins Schloss geschlagen. Durchzug. Wieso Durchzug?
Verwundert ging Herr Stein ins Wohnzimmer, um nach den Fenstern zu schauen. Er schaltete das Licht an. Die Terrassentür stand offen und ein Fenster war gekippt. Ihm stockte der Atem. Er war sich sicher, dass er am Morgen, bevor er zur Arbeit gefahren war, alle Fenster geschlossen hatte. Und wieso war die Terrassentür geöffnet? Er lauschte, versuchte irgendein ungewöhnliches Geräusch auszumachen. Aber es war ganz still. Nur der Wind zerrte an der morschen Schuppentür in seinem Garten und wirbelte die Blätter auf dem Rasen auf. Leise schlich er zum Wohnzimmerschrank, öffnete die oberste Schublade und nahm eine kleine Pistole heraus. Geschmeidig lag sie in seiner Hand. Sein Herz hämmerte. Er beobachtete den Raum. Ihm war, als läge ein fremder Geruch in der Luft.
Die Polizei kam nach zehn Minuten. Beim Klingeln legte er seine Waffe schnell wieder in die Schublade. Gemeinsam schritten sie jeden Raum ab. Nichts fehlte. Einbruch ohne Diebstahl. Falls ihm in den nächsten Tagen doch noch auffallen sollte, dass etwas fehlte, sollte er sich melden.
Gern wäre er an diesem Abend nicht allein geblieben. Aber es gab niemanden, den er hätte anrufen können oder wollen.
Die kleine rote Leuchtdiode seines Anrufbeantworters blinkte. Er drückte die Play-Taste: Guten Tag, Herr Stein, Ihre Brille ist fertig. Sie können sie abholen.
Er genehmigte sich einen Whisky, trank direkt aus der Flasche. Seine Hand zitterte. Das Adrenalin kribbelte in seinen Fingerspitzen.
Erschöpft schleppte er sich die Treppe hoch, die Flasche Whisky in der Hand. Die Holzstufen knarrten. Im Badezimmer zog er sich aus, hängte seine Jeans über den Badewannenrand und stopfte die restliche Kleidung in einen Wäschekorb, der eh schon überfüllt war. Der Ärmel seines weißen Hemdes lugte unter dem Deckel hervor.
Seine Brille, filigran und rahmenlos, legte er auf die Fensterbank, bevor er in die sehr geräumige Dusche stieg.
Er versuchte sich zu entspannen, doch wirklich sicher fühlte er sich nicht, obschon er sämtliche Rollladen herunter gelassen hatte und den Schlüssel in der Haustür hatte stecken lassen. Nach einigen Minuten, die ihm endlos schienen, begann er, sich ruhiger zu fühlen. Er setzte sich auf den Boden der Dusche. Das warme Wasser prasselte auf ihn herab. Kurz öffnete er die Tür, langte nach dem Whisky und nahm erneut einen großen Schluck aus der Flasche. Die braune Flüssigkeit hinterließ eine heiße Spur in seiner Speiseröhre, ein scharfes Rinnsal. Er lehnte sich an die Glaswand und schloss die Augen.
Er versuchte erst gar nicht, nicht an sie zu denken, an Janine Tanner, seine jüngste Mitarbeiterin, einundzwanzig Jahre, Kurven an den richtigen Stellen, langes blondes Haar und blaue Augen. Für ihn jedoch unerreichbar, das wusste er und es saß wie ein Stachel in seinem Fleisch. Nicht nur, dass sie einen Partner hatte, nein, es war sein Alter, seine fünfzig Jahre, die zur unüberwindbaren Grenze wurden. Grenzen mochte er nicht, zumindest, wenn andere sie setzten.
Ihn reizte ihre Wehrlosigkeit, wenn er sie zurechtwies, ihr hilfloser Blick. Sie hatte dann so etwas Bittendes in ihren Augen, das ihn sehr erregte.
Gründe, sie zu kritisieren, gab es immer. Die ließen sich finden oder konstruieren, zum Beispiel, wenn sie zu lange oder zu unprofessionell mit einem Telefonkunden sprach, der eine Störung seiner Telefonanlage meldete. Oder er ließ einfach etwas von ihrem Schreibtisch verschwinden und fragte am nächsten Tag erbost nach, wo denn dieses oder jenes Schriftstück geblieben sei. Ob sie denn keine Ordnung halten könnte?
Noch einmal öffnete er die Tür der Dusche und griff nach der Flasche. Der Spiegel des Alibertschranks beschlug von dem Wasserdampf. Dann zog er die Tür wieder zu und ließ