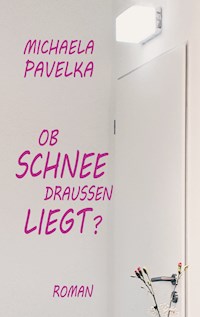
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeden Tag beobachtet die vierjährige Lina mit ihrem Fernglas den Mann im Haus gegenüber. Dies ist ihre einzige Möglichkeit, am Leben außerhalb des Krankenzimmers teilzunehmen, in dem sie mehrere Monate in Isolation verbringt. Dr. Greifer, in den 1960er-Jahren konfrontiert mit einer ihm völlig unbekannten Krankheit, kämpft um das Leben des kleinen Mädchens. Im Frühjahr 2020, eingebettet in die Atmosphäre der Corona-Pandemie, erzählt Lina ihre ungewöhnliche Geschichte der interessierten Enkelin Juna. Überrascht erkennt diese, dass ihre Großmutter besondere Fähigkeiten entwickelt hat. Es scheint für Lina selbstverständlich zu sein, Dinge zu wissen, die man eigentlich gar nicht hätte wissen können. Natürlich ist dies für ihren Beruf als Kriminalkommissarin von großem Nutzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jeden Tag beobachtet die vierjährige Lina mit ihrem Fernglas den Mann im Haus gegenüber.
Dies ist ihre einzige Möglichkeit, am Leben außerhalb des Krankenzimmers teilzunehmen, in dem sie mehrere Monate in Isolation verbringt.
Dr. Greifer, in den 1960er-Jahren konfrontiert mit einer ihm völlig unbekannten Krankheit, kämpft um das Leben des kleinen Mädchens.
Im Frühjahr 2020, eingebettet in die Atmosphäre der Corona-Pandemie, erzählt Lina ihre ungewöhnliche Geschichte der interessierten Enkelin Juna. Überrascht erkennt diese, dass ihre Großmutter besondere Fähigkeiten entwickelt hat.
Es scheint für Lina selbstverständlich zu sein, Dinge zu wissen, die man eigentlich gar nicht hätte wissen können. Natürlich ist dies für ihren Beruf als Kriminalkommissarin von großem Nutzen.
Michaela Pavelka, Jahrgang 1965, arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis.
2009 erschien ihr erster Roman „Das Land hinter dem Horizont“.
Ihr zweiter Roman „Im Schatten der Stille“ erschien 2011. 2018 ist ihr dritter Roman „Ausgesprochen unerhört“ erschienen.
Wenn Schnee liegt,
ist die Dunkelheit ein kleines bisschen heller.
Ganz herzlich bedanke ich mich bei meinem Mann Norbert und meiner Tochter Sophia-Maria für ihre wertvollen Anregungen.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 1
Damals
Ob Schnee draußen liegt?
Lina schiebt die Bettdecke zur Seite, setzt sich auf und lehnt sich an die Wand. Die Morgendämmerung wird irgendwann einsetzen. Jetzt jedenfalls noch nicht. Sie schaut zum Fenster, ein dunkles Rechteck, wie ein schwarzes Bild an einer Wand. Hier hört die Welt auf. Kein Lichtstreifen am Himmel. Nur eine Ahnung von Licht, das von Laternen ausgeht, meterweit unten, unerreichbar. Sie steigt aus dem Bett, schiebt einen Stuhl vor das Fenster und klettert auf die breite Fensterbank aus kaltem Marmor. Sie presst ihre Stirn an die Scheibe. Um die Nase herum schlägt sich ihr Atem an dem kalten Glas nieder. Ihre kleinen Hände, links und rechts neben ihrem Kopf, drücken gegen die Scheibe, als wollten sie diese herausdrücken. Ihre Hände fühlen die Kälte. Draußen muss es eisig sein.
Still liegt die Straße unter ihr. Dunkel ist der Asphalt. Kein Schnee. Es hat wieder nicht geschneit. Lina nimmt ihr Fernglas, das sie immer auf der Fensterbank stehen lässt und sieht, wie sich ein Taxi nähert. Es hält an und entlässt einen Mann auf den Bürgersteig. Er verschwindet in einem Hauseingang. Hinter einem Fenster wird es hell. Der Mann legt seinen Mantel über einen Stuhl, seinen Hut behält er auf dem Kopf und trinkt aus einer Flasche. Er sieht aus wie Pan Tau. Dann öffnet er seinen Schlips und einen Knopf an seinem Hemd. Gestern kam er auch mit dem Taxi. Wo kommt er her? Er verlässt das Zimmer und im Nebenraum geht ein Licht an - Milchglas. Bestimmt das Badezimmer. Pan Tau wäscht sich jetzt vielleicht und geht ins Bett.
Lina zählt noch drei weitere helle Fenster. Nur wenige Menschen sind noch wach. Der Himmel ist sternenklar. Sie träumt vom Fliegen. Wenn sie fliegen könnte, wäre sie fort. Doch es geht nicht, denn das Fenster ist zum Schutz verriegelt, wie wahrscheinlich alle Fenster in den Zimmern, damit sie nicht wegfliegen, die Kleinen, wie die Vögel es tun, sobald sie den Luftzug spüren, der ihnen den Weg in die Freiheit weist.
Mit ihrem Finger zeichnet sie ein Herz auf die beschlagene Scheibe und schreibt Mama hinein.
Es war ein so schöner Tag, als wir den Schneemann gebaut haben, geht es Lina durch den Kopf. Wie lange war das her? Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Alle hatten mitgeholfen, die Eltern und auch der Bruder. Und obwohl es bitterkalt war, kam es einem nicht so vor. Wir hatten so viel Spaß und warfen Schneebälle. Ich griff noch einmal in den Schnee, um dem Schneemann runde Bäckchen zu machen. Doch sie waren nicht weiß, sondern rosa. Dann ging alles sehr schnell. Mama rannte, Papa auch. Sie trugen mich ins Haus, wuschen meine Hände. Das weiße Handtuch verfärbte sich rot.
Wieder fährt ein Auto durch die Straße, dahinter ein Krankenwagen, aber ohne Blaulicht. Ansonsten nichts zu sehen. Lina fühlt die kalte Fensterbank an ihren Beinen.
Seit dem Schneemann bin ich hier in diesem Zimmer mit der geschlossenen Tür. Es ist langweilig.
Andere Kinder teilen sich ein Zimmer und dürfen es auch verlassen. Ich darf das nicht. Es darf auch niemand zu mir herein, nur Doktor Greifer und die Krankenschwestern. Selbst meine Eltern dürfen nicht zu mir. Sie stehen auf dem Flur vor meinem Zimmer und schauen durch die Glasscheibe. Ich kann sie nicht hören, wenn sie etwas sagen, sehe nur Lippen, die sich bewegen.
Dann lege ich meine Hand an die Scheibe, Mama auch. Sie sieht sehr traurig aus. Wenn meine Eltern abends wieder gehen, weine ich immer und schreie. Dann kommt Schwester Sarah mit einer Spritze zu mir. Danach weiß ich nichts mehr. Wenn ich wieder wach werde, ist es so still und leer. Da ist nur das leise Surren der Neonlampen und Geräusche hinter meiner Zimmertür.
Ich hasse Neonlicht.
Es war ein Sonntag, als ich hier ankam. Der Tag ist eigentlich völlig egal, aber ich merke mir eben so etwas.
Mama sagte, dass wir einen Ausflug machen, dass wir uns ein Krankenhaus anschauen. Das sei doch bestimmt interessant. Wir klingelten an einer großen Tür, nachdem wir viele Treppen nach oben gelaufen waren. Ein Mann in weißem Kittel öffnete. Er war freundlich, hockte sich zu mir und sagte, er sei Doktor Greifer. Mama nickte. Stumm tauschten sie Blicke aus. Mama sagte, dass er mir die Station zeigen werde. Er nahm meine Hand und lief los.
Unbekannte Gerüche. Stickige Luft. In einem der Zimmer weinte ein Kind. Ein Junge mit Gipsbein humpelte an der Wand entlang. Da blieb ich plötzlich stehen. Ich wollte nach Hause. Doch es gab kein Zurück.
„Lina, du musst hier bleiben.“
Ich wollte mich losreißen, doch er hielt mich fest. Ich sah nur noch den Rücken meiner Mutter und die schwere Tür, die hinter ihr ins Schloss fiel.
Zurück war ausgelöscht.
´Mama´, flüstert die Vierjährige, während sie auf der Fensterbank sitzt und nach draußen schaut, in die Nacht mit ihren menschenleeren Straßen. Die Dächer der parkenden Autos sind nicht weiß. Es hat wieder nicht geschneit. Schwarz ist der Asphalt und niemand nimmt Notiz von ihr.
Lina gleitet von der Fensterbank herab und legt sich ins Bett. Sie dreht sich auf die Seite, schiebt die rechte Hand unter ihr Gesicht und blickt zur Wand gegenüber, an der ihre Tafel lehnt, eine weiße Tafel mit gelbem Rahmen, an der sie und Doktor Greifer bunte Buchstaben geheftet hatten. Magnetbuchstaben, kreuz und quer über die Tafel verteilt. Ein kleines Durcheinander. Und in der Mitte geradlinig angeordnet ein Wort:
HOFFNUNG
Er hatte gesagt, sie dürfe niemals aufgeben. Niemals. Ob sie verstehe, was er ihr sagte? Sie nickte. Dabei schaute er in zwei sehr müde Augen, nicht sicher, ob sie wirklich wusste, wovon er sprach. Du darfst die Hoffnung niemals aufgeben, verstehst du das, liebe Lina? Während sie nun in dieser schneelosen Nacht zur Tafel schaut, denkt sie daran, wie sie ein paar Tage zuvor zusammen das Wort geschrieben hatten. Ihre Hände hatten in den Buchstaben gesucht. Dann hatte sie ihm das H gereicht und ihn gebeten, Hoffnung an die Tafel zu schreiben.
Sie hatte ihn genau beobachtet, wie er mit seinen großen Händen jeden einzelnen Buchstaben an die Tafel geheftet hatte. Dabei benannte er jeden einzelnen Buchstaben. Leise sprach sie mit.
HOFFNUNG
Es sollte immer an der Tafel stehen.
Immer.
Nachts leuchtete sie das Wort mit der Taschenlampe an.
Sie musste es unbedingt sehen, um sich an seine Worte zu erinnern, die von Heilung sprachen.
Kapitel 2
Frühjahr2020
„Bitte, Oma, erzähl mir, wie das damals war, als du im Krankenhaus warst. Mama hat gesagt, ich soll am besten dich selbst fragen.“
„Es ist keine schöne Geschichte. Sie ist voller Schmerz und Einsamkeit. Sie schmeckt bitter und trostlos. Bist du dir denn wirklich sicher, dass du sie hören möchtest, Juna?“
„Ja, das will ich!“
„Gut. Dann setzen wir uns jetzt aufs Sofa. Ich muss mich allerdings so setzen, dass ich in den Garten schauen kann.“
„Warum das?“
„Das gehört dazu.“
„Du sitzt sowieso immer auf diesem Platz. Ist es DESWEGEN?“
Lina nickte. Dann reichte sie ihrer verwunderten Enkelin eine Fleecedecke.
„Ich brauche keine Decke.“
„Nur für den Fall, dass dir kalt wird. Leg sie einfach neben dich.“
Juna legte die Decke auf das Sofa, setzte sich und streckte die Beine aus.
„Ich beschreibe dir zuerst einmal das Zimmer. Wenn du auf dem Flur standest, war links von der Eingangstür ein rechteckiges, großes Fenster, durch das du ins Zimmer hineinschauen konntest. Jeder, der daran vorbeilief, konnte hineinsehen. Immer, ob ich es wollte oder nicht.
Stell dir nun vor, dass du hineingehst. An der Wand gegenüber befand sich ein Fenster. Zur linken Seite, direkt an der Wand stand mein Bett und ein kleines Nachtschränkchen. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du auf dem Bett sitzt, schaust du direkt gegenüber auf eine Wand, vor der ein Tisch mit zwei Stühlen stand und links davon in ausreichendem Abstand ein Kleiderschrank. Die Wände waren weiß gestrichen und kahl. Der Raum war nicht sehr groß. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass er klein war. Ich kann es nicht genau sagen. Einen Kindergeburtstag hätte man dort jedenfalls nicht ausrichten können. Dafür war das Zimmer auf jeden Fall zu klein.“
„Und wie lange warst du im Krankenhaus?“
„Von November bis Februar. Das hörte ich immer meine Mutter sagen. Von November bis Februar. Die Jahreszahl hat sie nicht dazu gesagt. Meinem Gedächtnis haben sich die Monate eingebrannt: November bis Februar.“
„Das ist ziemlich lange.“
„Ja. Ich werde dir jetzt von meinem Kalender erzählen, den mir meine Eltern gebracht hatten, damit ich sehen konnte, wann sie mich wieder besuchen kommen. Damals durfte man nicht täglich Besuch empfangen und die Zeit, die meine Eltern bleiben durften, war auch nur sehr begrenzt.“
Kapitel 3
Damals
Zeit ist bunt.
Mama und Papa haben mir einen Kalender gebastelt. Er besteht aus einer langen Schnur, an der rosa- und blaufarbene Schleifen befestigt sind. Ich habe ihn entlang der Wand aufgehängt. Für jeden Tag gibt es eine Schleife. Bei einer rosa Schleife kommt Mama zu Besuch, manchmal auch Papa. Bei einer blauen Schleife kommt niemand.
Ich habe alle blauen Schleifen unter mein Kopfkissen gelegt. Schwester Sarah hat sie morgens gefunden und sie wieder festgebunden. Es bringt nichts, die blauen Schleifen zu entfernen. Dadurch kommt Mama nicht schneller.
„Wann darf ich nach Hause?“
„Kleine, ich weiß es nicht. Deine Wunden müssen erst verheilt sein.“
„Warum habe ich diese Wunden überall? Was ist mit mir?“
„Ach, Lina, wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht.“
„Auch Doktor Greifer weiß es nicht?“
„Nein, auch er nicht. Wir müssen warten und alles versuchen, damit du gesund wirst.“
„Warum darf ich nicht aus dem Zimmer wie die anderen Kinder?“
„Wir möchten verhindern, dass du eine Infektion bekommst.“
„Eine Infektion? Was ist das?“
„Dann dringen Bakterien in deine Wunden ein und alles wird noch schlimmer.“
„Was sind Bakterien?“
„Ach, Lina, du kannst vielleicht Fragen stellen! Also, Bakterien sind winzige, unsichtbare Tierchen, die sich in deinen Körper hineinfressen, dich fürchterlich krank machen und dir weh tun.“
„So wie es in der Nacht war, als meine Hände angefangen haben, weh zu tun?“
Schwester Sarah überlegte einen Augenblick, kratzte sich am Kinn und antwortete.
„Genau! So ungefähr.“
Lina zuckte zusammen. Erste Tränen liefen die Wangen hinunter.
„Das ist so gemein! Die Bakterien überfallen einen in der Nacht, wenn man schläft. Da kann man sich nicht wehren.“
Sie begann zu schluchzen. Ihr kleiner Körper vibrierte.
Der Gesprächsverlauf gefiel Schwester Sarah gar nicht mehr und sie versuchte schnell, das Thema zu wechseln.
„Komm, Kleine, genug gefragt. Jetzt erstmal Morgenwäsche, Fieber messen und dann Frühstück.“
Lina zieht den Schlafanzug aus. Mitten im Raum steht ein kleines, schlankes Mädchen mit halblangem, blondem, lockigem Haar. Salbenverbände an Beinen und Armen. Kompressen am Bauch, Salbenreste im Gesicht. Sofort beginnt sie, an Bauch und Hals zu kratzen. Schwester Sarah hält ihre Hände fest.
„Stopp! Nicht kratzen!“
„Es juckt und brennt!“
„Ich weiß. Aber wenn du kratzt, machst du alles noch viel schlimmer. Ich muss jetzt deine Verbände wechseln. Nicht kratzen, okay?“
Lina nickt stumm.
Behutsam legt Sarah Arme und Beine frei. Sie beißt sich auf die Lippe. Noch nie hat sie Vergleichbares gesehen. Rohes, rotes Fleisch. Manche Stellen sehen krustig aus, andere, als fräße sich Säure durch jede Zelle. Das Kind löst sich auf, denkt Sarah. Ihr Körper zersetzt sich. Hoffentlich breitet es sich nicht weiter aus!
Vorsichtig tupft Sarah die Haut ab.
Immer wieder zuckt Lina zusammen, doch weint sie nicht.
„Werde ich wieder gesund?“
Zärtlich streicht Sarah dem Mädchen über den Kopf und spürt, wie sich Haare lösen.
„Das hoffen wir doch! Bestimmt! Nachher kommt noch der Doktor zu dir. Er gibt dir wieder Medizin. Wir müssen geduldig sein.“
Lina nickt nur.
Sie schaut zum Fenster, dem dunklen Rechteck, das die Welt dahinter noch nicht preisgibt. Das Neonlicht spiegelt sich in der Scheibe und aufgrund der Dunkelheit des frühen Morgens sieht sie in dem Fenster nur das, was sich in ihrem Zimmer befindet, als würde dieses kleine, kalte, kahle, weiße Gefängnis draußen seine Fortsetzung finden.
Als Schwester Sarah den Raum verlässt, um das Fieberthermometer zu holen und sich an der Tür noch einmal umdreht, sieht sie Lina die Fensterbank hochklettern. Sie stellt sich auf, die Handflächen gegen die Scheibe gedrückt und schaut über die Lichter der Stadt.
Ihre Augen suchen das Fenster von Pan Tau.
Tatsächlich ist Licht in seiner Wohnung.
Doch sehen kann sie ihn nicht.
Plötzlich hört sie die Tür. Doktor Greifer kommt herein.
„Guten Morgen, Lina!“
„Hallo!“
Sie steigt von der Fensterbank herab.
„Wie geht es dir?“
„Mir ist kalt.“
„Lass mich schnell nach deiner Haut sehen. Dann kann Schwester Sarah dich wieder anziehen.“
„Kannst du mich nicht anziehen?“
Dr. Greifer versucht, ihren Blick einzufangen. Doch sie schaut zu Boden.
„Möchtest du das gern?“
Ein geflüstertes Ja.
„Lina, schau mich doch mal an!“
Mit seiner Hand umfasst er ihr Kinn und hebt den Kopf.
Trotzdem sieht sie an ihm vorbei.
„Lina?“
„Ja.“
„Schau mich mal an, bitte!“
Nur ein kurzer Blick.
„Ich ziehe dich jetzt wieder an.“
„Zuerst die Salbe, Doktor!“
„Selbstverständlich, und dann erst die Verbände! Ich sehe, du kennst dich schon gut damit aus.“
Er versucht ein Lächeln.
Sie nickt.
„Sieht mein Gesicht auch so aus?“
„Nicht ganz so schlimm, Lina. Es wird besser werden, ganz bestimmt. Irgendwann.“
Kapitel 4
Frühjahr 2020
Wann ist irgendwann?
´Irgendwann´…
´Irgendwann´, meine liebe Juna, das ist für ein Kind zu unsicher. Wann soll das sein?
´Irgendwann´ bedeutet, dass es vielleicht niemals geschieht. ´Irgendwann´, das beinhaltet, dass derjenige, der es sagt, vielleicht selbst nicht daran glaubt.
´Irgendwann´ verlegt den Tag in den Bereich des Unwahrscheinlichen.
´Irgendwann´ würde es besser werden, sagte man mir. ´Irgendwann´ konnte mein Kalender nicht darstellen.
Dafür gab es keine Farbe und keine Schleife. ´Irgendwann´ war nicht messbar.
Für mich dehnte sich die Zeit an jedem einzelnen gottverdammten Tag in ihrer endlosen Eintönigkeit, eingesperrt in einem desolaten Zimmer mit ein paar wenigen Spielzeugen. Nur ab und zu öffnete sich die Tür, wenn ich medizinisch versorgt wurde oder Doktor Greifer sich zu mir setzte. Und dreimal pro Woche, ja, ich meine, es war dreimal pro Woche, stand meine Mutter vor dem Fenster oder mein Vater. Doch es geschah immer wieder einmal, dass ich meine Eltern verpasst hatte. Wie grotesk das klingt! Ja, ich hatte sie verpasst, obschon ich nirgendwo anders war als in diesem kahlen Isolierzimmer. Ich hatte geschlafen, während sie vor der Scheibe standen. Und niemand, wirklich niemand vom Personal hatte mich geweckt. Wenn ich dann im Nachhinein wach wurde und man mir sagte, meine Eltern seien schon wieder fort, war der Schmerz, das Gefühl der Verlorenheit, unerträglich. Ein Sturz in den Abgrund, der so tief war, dass es nicht einmal einen Aufprall gab.
Bestenfalls wussten sie nicht, was sie taten. Schlimmstenfalls war es Absicht.
Und gegenwärtig beschweren sich die Menschen, wenn sie zwei Wochen zu Hause in Quarantäne bleiben müssen und nur zu zweit draußen herumlaufen dürfen, um dem Corona-Virus Einhalt zu gebieten. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was es bedeutet, monatelang als kleines Kind in einem Isolierzimmer zu leben, ohne Familie und ohne Freunde, ohne Telefon, ohne Smartphone, ohne WhatsApp, Twitter oder Facebook. Zwei Wochen wären für mich ein paar rosa und blaue Schleifen gewesen und die Gewissheit, dass die Einsamkeit bald ein Ende hat.
Kapitel 5
Damals
Es ist bereits früher Abend und Dr. Greifer sitzt noch immer in seinem Büro und zermartert sich den Kopf. Er weiß nicht einmal, mit welcher Krankheit er es zu tun hat. Bisher sind nicht alle Bereiche der Haut betroffen. Doch die betroffenen Stellen, an denen sich die Haut ablöst, sehen übel aus und lassen nichts Gutes hoffen.
Hilflosigkeit ist das dominante Gefühl, das ihn begleitet, gepaart mit dem quälenden Wissen, dass es für Lina grausam sein muss, sich Woche um Woche in Isolation zu befinden. Ganz gleich, wie er entscheidet, es ist immer sowohl richtig als auch falsch. Hebt er die Isolation auf, so dass das Mädchen nicht so einsam ist, so riskiert er, dass die Krankheit sich aufgrund einer Infektion verschlimmert. Das wäre fatal.
Belässt er es bei der Isolation, womit das Risiko einer zunehmenden Verschlechterung eingedämmt wird, so wird Lina vereinsamen. Ein einziges Dilemma.
Er wippt mit seinem Schreibtischstuhl und starrt auf die dicken Fachbücher in den Regalen. Sie bleiben die Antwort schuldig. Neuland. Unerforschtes Gebiet. Versuch und Irrtum. Er kann nur ausprobieren, was ihm irgendwie erfolgversprechend erscheint.
Die Medikamente waren bisher wirkungslos.
Er blättert wieder in ihrer Akte. Irgendetwas muss er übersehen haben. Noch einmal von vorne. Es begann nachts. Das Mädchen wurde wach, weil die Hände brannten.
Sie ging ins Schlafzimmer der Eltern. Diese konnten nichts erkennen und waren zunächst nicht weiter besorgt. Aber die Haut an den Händen schmerzte. Ein paar Tage später bauten sie einen Schneemann und die Haut öffnete sich. Ab da wurde die Krankheit offensichtlich. Jetzt ist sie bereits einige Zeit hier. Nichts hat bisher geholfen.
Vielleicht sollte ich Kollegen hinzuziehen. Vielleicht hatten sie einen ähnlichen Fall. Vielleicht hat jemand von ihnen etwas auf einem Kongress gehört. Vielleicht steht etwas in der neueren Literatur. Vielleicht….
Er liest die Eintragungen der Nachtschwester.
25. November:
18.00 Uhr: Temperatur 39,5 Grad.
20.00 Uhr: Lina ist noch wach.
23.00 Uhr: Linas Bettdecke liegt neben dem Bett. Ich decke sie zu.
1.00 Uhr: Lina sitzt mit ihrem Fernglas am Fenster und schaut nach draußen. Sie ist ruhig dabei. Ich unternehme nichts.
2.00 Uhr: Lina ist immer noch am Fenster.
3.00 Uhr: Sie schläft. Irgendwie riecht es merkwürdig in dem Zimmer.
Was meint die Nachtschwester denn damit, dass es merkwürdig in dem Zimmer riecht? Er schüttelt den Kopf. Was soll denn das für eine Aussage sein? Und warum schläft Lina so schlecht? Wie oft sie nachts auf der Fensterbank sitzt! Was beobachtet sie eigentlich?
Dr. Greifer steht vom Schreibtisch auf, schiebt den Stuhl zur Seite und läuft leise vor sich hin murmelnd in seinem Büro auf und ab.
„Merkwürdiger Geruch, schläft schlecht, sitzt am Fenster mit Fernglas.“
Er schüttelt den Kopf. Schließlich bleibt er am Fenster stehen und schaut in die Dunkelheit. Er betrachtet das Haus gegenüber. In manchen Wohnungen ist Licht, in anderen nicht. Es ist nicht viel, das er erkennen kann. Er denkt daran, wie oft Lina auf der Fensterbank sitzt und mit ihrem Fernglas nach drüben schaut. Sie beide sehen dieselbe Häuserzeile. Was beobachtet sie nur? Ist das eigentlich erlaubt? Schnell verwirft er diesen Gedanken, als ihm bewusst wird, dass es für sie die einzige Möglichkeit ist, das Zimmer zu verlassen, auch wenn es nur visuell ist, die einzige Möglichkeit, am Leben teilzunehmen und wenigstens ein bisschen das Gefühl zu haben, irgendwo dabei zu sein.
Kapitel 6
Damals
Heute ist ein blauer Tag. Ich öffne die blaue Schleife an meinem Kalender, entferne sie von der Schnur.
Mama und Papa kommen nicht vorbei.
Schwester Sarah bringt das Frühstück, Brötchen mit Marmelade, keine Butter. Käse ist auch wieder nicht dabei. Ist für mich verboten. Mama hat mir oft Vanillepudding und Haferbrei mit Banane gekocht. So etwas gibt es hier auch nicht. Alles, was ich mag, hat man mir weggenommen. Selbst Kakao darf ich nicht trinken, aber immer wieder diesen widerlichen Möhrensaft! Und essen soll ich, was ich nicht mag.
Nach dem Frühstück lege ich mich erneut ins Bett, schaue zur Decke, drehe mich nach links und schaue zur Wand, spucke dagegen und verwische alles mit der Hand, drehe mich auf die rechte Seite und sehe die Tafel.
Hoffnung steht da in bunten Buchstaben. Ich bin so müde und bin wohl eingeschlafen, denn auf einmal steht Schwester Sarah mit dem Mittagessen in der Tür. Ich habe keinen Hunger. Sie zwingt mich, etwas zu essen. Es sieht ekelhaft aus und riecht auch so. Schwester Sarah sagt, ich soll das essen. Leber und wabbelige Pilze. Sie fühlen sich an wie Rotze im Hals. Mir ist schlecht und es gluckert im Bauch. Er tut weh. Ich kann nichts dafür, aber ich muss brechen. Alles voll, der Tisch und auch die Ärmel von meinem Schlafanzug mit den Astronauten darauf. Zum Glück haben sie so Glaskuppeln auf dem Kopf. Sonst hätten sie alles ins Gesicht bekommen. Schwester Sarah ist böse auf mich. Aber ich wollte doch sowieso nichts essen. Ich schiebe das Essen sonst immer von meinem Teller und schütte es unter das Bett. Nur heute wollte sie unbedingt dabei sitzen bleiben. Das Abendessen ist auch nicht besser. Es gibt Brote mit Wurst. Ich esse nur das Brot. Wurst stinkt und ich mag sowieso nichts essen.
„Ach, Lina, musste das sein? Kannst du nicht ´was sagen, wenn du dich übergeben musst?“
„Es war so schnell. Ich wollte auch gar nichts essen.“
„Wie sollst du dann gesund werden? Jetzt komm mal mit zum Waschbecken! Zieh dich aus und leg deine Sachen auf den Boden!“
„Ich will nach Hause.“
„Das geht noch nicht.“
„Wann dann?“
Schwester Sarah dreht den Wasserhahn auf und hält einen Waschlappen unter den Wasserstrahl.
„Ich weiß nicht.“
Lina hält ihre Hände ins Waschbecken und beginnt zu weinen.
„Was ist heute für ein Tag?“
„Ende November. Es ist Ende November.“
Ende November ist doch kein Tag, denkt Lina. Es soll mich wohl nicht interessieren, geht es ihr durch den Kopf. Ich komme hier eh so bald nicht raus. Irgendwann halt. Ist hier doch sowieso egal. Wieso frage ich auch?
Für mich gibt es nur rosa und blaue Tage.
Heute ist ein blauer Tag.
Kapitel 7
Frühjahr 2020
„Ein blauer Tag“, wiederholte Juna leise.
Lina hielt inne und wartete einen Moment, bevor sie weitersprach.
„Blaue Tage waren qualvoll. Eigentlich waren alle Tage qualvoll, nur auf unterschiedliche Art und Weise. Die blauen Tage waren trostlos, ohne die Freude auf meine Eltern, eine einzige gähnende Leere. An den rosafarbenen Tagen freute ich mich auf meine Eltern und gleichzeitig waren sie überschattet von dem extremen Schmerz, wenn sie wieder gingen oder man mich eben nicht geweckt hatte.
All mein Wollen, Sehnen und Bitten und Flehen – all das blieb ohne Erfolg. Weder durften meine Eltern zu mir ins Zimmer, noch durfte ich auf den Flur. Und niemand sagte mir, wann ich jemals wieder nach Hause durfte.
Die Zeit breitete sich vor mir aus wie ein endloses Meer ohne Land in Sicht. Der Horizont verschob sich täglich weiter nach hinten.
Für Schwester Sarah mochte das belanglos sein, dass ich manchmal fragte, was gerade für ein Tag war. Doch ich wollte einen Fixpunkt, etwas Konkretes, etwas zum Festhalten.
Für mich waren damals Begriffe wie írgendwann und Ende November mit einer Auflösung der Zeit verbunden. Ich konnte es nicht in Worte fassen, aber ich fühlte sehr genau, dass es für mich keine baldige Befreiung geben würde. Das Isolierzimmer, in dem ich war, löste die Zeit auf. Meine Krankheit verdammte mich zu einer gefühlten Endlosigkeit, in der sich niemand bemüßigt fühlte oder es wagte, mir genaue Zeitangaben zu machen. Niemand wusste, wann und ob ich überhaupt jemals gesund werden würde. Niemand sprach mit mir über meine Krankheit. Sie sprachen über mich, aber nicht mit mir. Ich las nur in den Gesichtern, versuchte zu interpretieren, wenn sie die Verbände wechselten, mich wuschen oder auf das Thermometer schauten. Fieber bedeutete für mich kein Wissen um eine Temperaturangabe, keine Zahl. Ich las die Höhe der Temperatur in dem Entsetzen der Gesichter, wie ich überhaupt vieles in den Gesichtern und ihren Bewegungen las. Und dann überließen sie mich meinen Phantasien und meinen Ängsten.
They left without a word.
Sie dachten wohl, wenn sie nicht mit mir über meine Krankheit sprechen, dann sei es nicht so schlimm für mich. Doch das Gegenteil war der Fall, denn die Phantasie kennt bekanntlich keine Grenzen.
Und mit meinen Eltern konnte ich auch nicht sprechen. Sie standen schließlich auf dem Flur. Okay, man mag einwenden, wegen der Gefahr einer Infektion. Aber sie hätten Schutzkleidung und Desinfektionsmittel für die Hände bekommen können. Dreimal in der Woche, nur dreimal durfte ich meine Eltern sehen und immer nur getrennt durch die Glasscheibe, eine absolut stumme Kommunikation, ohne ein hörbares Wort, ohne eine Berührung. Steril, stumm.
Nur zu Doktor Greifer hatte ich eine Verbindung. Auf ihn freute ich mich und er reparierte mein Spielzeug.“
„Immerhin. Aber wahrscheinlich hatte er wenig Zeit, nicht wahr?“
Lina wandte das Gesicht ab. Noch im Wegdrehen erkannte Juna diesen Blick, den sie schon als Kind an ihrer Oma kennengelernt hatte, nur nie zu deuten wusste. Es lag etwas unaussprechlich Schmerzvolles in ihm, etwas Geheimnisvolles, das sie verbarg.
Die Antwort kam flüsternd.
„Stimmt. Er hatte wenig Zeit. Und manchmal passierte es, dass er schon auf dem Weg zu mir war, ich ihn vor der Glasscheibe sah, kurz davor, die Tür zu öffnen und Schwester Sarah eilte aus dem Dienstzimmer, rief ihn und er ging fort. Vielleicht ging es um einen Notfall. Dann konnte es geschehen, dass er gar nicht mehr kam. Aber wenn er kam, musste ich oft erst Spritzen über mich ergehen lassen, bevor er mit mir spielte oder mir Geschichten erzählte. Meine Mutter sagte später einmal zu mir, dass sie im Krankenhaus mit mir experimentiert hatten.
Learning by doing.
Das Unbekannte zu verstehen, ist wie das Bereisen eines fernen Kontinentes.
Sie konnten nur ausprobieren, was ihnen einfiel und dann beobachten, was passierte. Letztendlich war ich Teilnehmer in einem Experiment, der Erste einer Studie. Niemand wusste Bescheid. Wir waren Unwissende. Allesamt.“
„Das ist sehr gruselig!“
„Einmal gab mir eine Krankenschwester, es war nicht Schwester Sarah, und ich weiß ihren Namen nicht mehr, das Fieberthermometer in die Hand und sagte, sie komme gleich wieder, sie müsse noch irgendetwas holen. Ich sollte das Thermometer auf keinen Fall fallen lassen wegen des Quecksilbers darin. Es sei giftig. Nun, was glaubst du, was passierte?“
„Du hast es fallen lassen?“
„Ja. Und ich weiß bis heute, wie ich auf die Scherben blickte und die silbrigen kleinen Kügelchen, die ausliefen. Ich habe es als Bild im Kopf, die feinen, dünnen Splitter und diese silbergrauen Tröpfchen des Quecksilbers. Es hatte etwas unwiderstehlich Faszinierendes. Die Schwester hat natürlich geschimpft.“
„Das wundert mich jetzt nicht. Das war ja zu erwarten.“
„Stimmt. Es war nicht schwer, Voraussagen zu treffen, selbst für mich damals, obwohl ich noch ein kleines Kind war.“
Schweigen erfüllte den Raum. Juna schaute in den Garten, in dem sich die ersten Zeichen des nahenden Frühlings zeigten, kleine Knospen am Mandelbaum, ungeöffnet noch, das erste zaghafte Gelb der Forsythien. Ein sanfter Nieselregen hatte eingesetzt. Der Liguster tropfte.
Wie sehr Juna ihrer Mutter ähnelt, ging es Lina durch den Kopf, die feine Gesichtszeichnung, die hohen Wangenknochen, die Form der Augen. Nur die Lippen sind anders, etwas voller, expressiver. Lina ließ ihre Enkelin gewähren und unterbrach sie nicht in ihren Gedanken. Sie wartete geduldig, bis Juna das Gespräch wieder aufnahm.
„Oma, würde es dir eigentlich heutzutage schwerfallen, wenn man dich in zweiwöchige Quarantäne schicken würde? Wegen der Corona-Pandemie, du weißt schon. Immer mehr Menschen sind infiziert oder müssen als Verdachtsfall zwei Wochen zu Hause bleiben. Wie wäre es für dich, wenn du nicht mehr vor die Tür gehen dürftest? “
„Es würde mir nicht schwerfallen. Im Gegenteil. Ich kann sehr gut allein sein, manchmal zu gut. Dann bin ich dankbar, wenn sich jemand bei mir meldet, also sozusagen an meine Türe klopft und mich herausholt. Ich hoffe immer, dass man es mir nicht übel nimmt, wenn ich abtauche. Hin und wieder brauche ich es, dass mich jemand ruft. Es ist keine Interesselosigkeit, wenn ich mich zurückziehe. Ich merke es einfach nicht. Es ist, als wäre ich in diesem Zimmer von damals, eingeschlossen, obwohl die Tür nicht mehr verschlossen ist.
Ich freue mich, wenn jemand anruft oder vorbeikommt. Du tust es, mehr noch, du bist ehrlich an mir interessiert. Das rührt mich mehr, als du dir vorstellen kannst. Dafür möchte ich dir danken.
Und weißt du was, jetzt machen wir beide mal eine Pause. Lass uns etwas essen! Hast du Lust, ein paar Brötchen zu holen? Ich mache uns Rührei. Tomaten, Käse und Gurken habe ich im Haus.“
Juna war überrascht über den plötzlichen Themenwechsel.
Aber so war ihre Großmutter eben. Manchmal wechselte sie spontan das Thema.





























