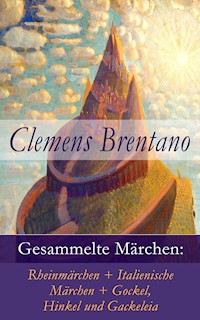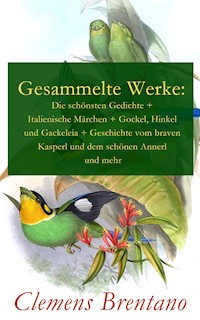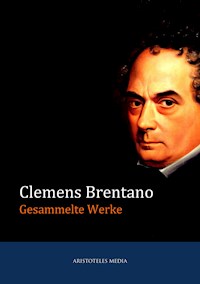0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die 'Ausgewählten Werke von Clemens Brentano' bieten eine umfassende Sammlung von Gedichten, Dramen und Erzählungen dieses bedeutenden deutschen Schriftstellers aus der Romantik. Brentano's literarischer Stil zeichnet sich durch eine leidenschaftliche Darstellung von Liebe, Natur und Religion aus, wobei er häufig Mystik und Volkstümlichkeit verbindet. Seine Werke reflektieren nicht nur die Zeit seiner Entstehung, sondern bieten auch zeitlose Themen, die bis heute relevant sind und die Leser auf eine poetische Reise mitnehmen. Brentano's Einfluss auf die deutsche Literaturgeschichte ist unbestreitbar, und diese Ausgabe ermöglicht es Lesern, sein umfangreiches Schaffen aus erster Hand kennenzulernen. Clemens Brentano war ein vielseitiger Schriftsteller, der sich nicht nur in der Poesie, sondern auch in der Literaturkritik und als Herausgeber hervortat. Seine persönlichen Erfahrungen und seine tiefe Verbindung zur katholischen Spiritualität prägten sein Schreiben und verliehen seinen Werken eine einzigartige Tiefe und Emotionalität. Brentano's Werke sind geprägt von einer intensiven Auseinandersetzung mit der Romantik und der deutschen Kultur, und seine Fähigkeit, emotionale Resonanz beim Leser zu erzeugen, ist bemerkenswert. Für Liebhaber der deutschen Romantikliteratur und für Leser, die sich für zeitlose Themen wie Liebe, Natur und Spiritualität interessieren, sind die 'Ausgewählten Werke von Clemens Brentano' ein absolutes Muss. Diese Sammlung bietet einen Einblick in das Schaffen eines der wichtigsten Autoren seiner Zeit und lädt dazu ein, sich von seiner poetischen Schönheit verzaubern zu lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ausgewählte Werke von Clemens Brentano
Books
Inhaltsverzeichnis
Erzählungen:
Märchen:
Romane:
Dichtung:
Briefwechsel:
Die Schachtel mit der Friedenspuppe (1815)
Ein preußischer Edelmann, dessen Güter dicht an der sächsischen Grenze lagen, hatte ein junges Weib und seine zwei Knaben verlassen, um als Freiwilliger mit mehreren Männern und Jünglingen seiner Herrschaft den Fahnen des Fürsten Blücher von Wahlstadt zu folgen. Er hatte die Schlachten an der Katzbach, bei Leipzig, bei Laon und auf dem Montmartre mitgeschlagen, hatte geholfen, die entführte preußische Viktoria von Paris nach Berlin, heiliger und bedeutender als je, zurückzubegleiten. Die Sache des Vaterlandes war getan, und seiner Verpflichtungen entlassen, kehrte er nach seinem Gute zurück, und fand Weib und Kind, Freunde, Nachbarn und Untertanen liebender, treuer, bewährter und heiterer, als er sie verlassen. Nachdem er die ersten acht Tage seiner Rückkehr ganz seiner Gattin und seinen Kindern gelebt hatte, wendete er seine Aufmerksamkeit auf den Zustand seines Gutes, das, in der Nähe eines Schlachtfeldes liegend, mehrere Brandstätten aufzuweisen hatte. Bei seinen noch durch die Nachwehen vieler angestrengten Kriegsleistungen mannigfach behinderten Glücksumständen nur das Dringendste vermögend, beschloß er zuerst, eine Scheune wiederherzustellen, die niedergebrannt war. Als die Arbeiter alle berufen waren, die ihrem lieben Herrn zum Wiedersehen die Hände drückten, teilte er ihnen die Geschäfte aus, und sein Jäger wies den Zimmerleuten die Stämme im Forste an. Einige Steine, zum Fundamente nötig, schienen schwieriger herbeizuschaffen, denn da jene Gegend durchaus eine Ebene von leichtem Sandboden ist, waren die nächsten Felder um das Schloß seit langer Zeit zu vorkommenden Bauten von allen Steinen abgelesen worden. Sein Amtsbote sagte ihm, daß einige hundert Schritte vor dem Dorfe auf einer kleinen Anhöhe, wo das französische Bivouak gestanden, durch ausgehöhlte Feuerstellen ein großer Steinblock entblößt worden sei. Der Baron begab sich mit dem Amtsboten nach jener Stelle, und fand den entblößtem Stein noch angeschwärzt von dem Feuer der Feldküche jener Feinde, die nie wieder im freien Felde bei uns kochen sollen. Indem er, den Stein anschauend, unwillkürlich ausrief: »Die Flamme ist hinausgefahren, der Ruß ist geblieben!«, bemerkte er in dem Betragen des neben ihm stehenden Amtsboten ein Zucken und ungeduldiges Zurückhalten, und da er ihn deshalb schärfer anblickte, wollte dieser seine Unachtsamkeit hinter einem untertänigen Lächeln verstecken, aber zur großen Verwunderung des Barons sah dieser den schmunzelnden Mund des Amtsboten sich in ganz widernatürliche Lachfalten ziehen; die rechte Wange blieb unbewegt, und die linke, das ganze Lachgeschäft auf sich nehmend, zog den Mund bis zum Ohrläppchen hinauf. »Was Teufel schneidet Er für Gesichter?« sprach der Baron. Worauf der Amtsdiener wieder seine gewöhnliche Amtsmiene annahm, und seinem Herrn antwortete: »Ach, Herr Baron, hier auf der Stelle ist mir die Fatalität geschehen, hier an dem Stein, und darum übernahm mich der Zorn und die Ungeduld, als ich hierher trat, daß es mir in allen Gliedern zuckte. Als die Franzosen hier bivouakierten, war ich im Schlosse ziemlich allein; Weiber und Kinder aus dem Dorfe waren mit dem Vieh in den Wald geflüchtet, die Bauern hatten sich bewaffnet gegen Groß-Beeren gezogen, und ich war zurückgeblieben, um doch das Schloß nicht ganz leer dem Feinde zu überlassen. Sie hatten mich bald erwischt, ich hatte mir den Kopf verbunden und mich krankstellend zu Bette gelegt. Die Türen flogen durch Kolbenstöße auf. Zu plündern war nicht viel, wir hatten alles geflüchtet und vergraben, ich schien ihnen noch das Beste, was sie gefunden. Sie rissen mich aus dem Bette, da war ich bald frisch und gesund; aber die Not ward noch größer, ich sollte einem fatalen kümmerlichen blassen Gesellen, dem der Geiz und die Habsucht aus den Augen sah, tausend Fragen beantworten, die ich nicht verstand, denn er sprach französisch. Er war Sergeant, so nannte ihn sein Geselle, und während dieser, der besser Deutsch zu können glaubte, mein Examen übernahm, und auch nichts weiter vorbrachte als: ›Vor dich Coujon, vor dich Spißbub, vor mich du vin, de l'eau de vie, vor mich du pain, du beurre, poulets, poulets!‹ und ich immer lamentierte: ›Allfort, allfort!‹ schnitt der Sergeant mit dem Säbel die rotseidene Tapete an den Wänden herunter, denn ich hatte mich in die Gerichtsstube gelegt, weil ich da den ganzen Hof übersehen konnte. Ich protestierte gegen die verletzte Tapete, aber er gab mir ein Messer in die Hand, und trieb mich mit den Worten: ›Allons! coupez, Monsieur Allforte!‹ an, mit zu schneiden. Wir waren im besten Schneiden, als er mich etwas von Kosaken fragte, und da ich ihm hierauf antwortete: ›Viel, viel Kosaken!‹, ärgerte er sich, daß ich nicht auch ›Allfort‹ erwidert hatte. Er mußte nun in dem Schlosse nicht mehr recht trauen, und gab, indem er den Rock auszog, dem anderen mehrere Befehle, und ich mußte ihm die Tapete um den Leib herumwinden, wobei er einigemal sagte: ›Kolik, Kolik!‹ Nun gingen sie in den Hof, der sich währenddem mit Soldaten angefüllt hatte, ich mußte folgen. Der Offizier sprach noch etwas von Kosaken, und führte die Schar, die aus höchstens 150 Mann bestand, hierher auf den Hügel, weil hier die Heerstraße zu übersehen ist. Sie hatten bald ihre Einrichtung getroffen. Hier brieten sie einen Hammel am Spieß, und ich mußte den Braten wenden, der Sergeant begehrte wieder allerlei von mir; da ich aber immer ›Allfort‹ erwiderte, faßte er im Zorn mir die Haare hier über dem linken Ohr und riß sie mir mit solcher Gewalt aus, daß mir der Mund schief davon in die Höhe fuhr. Ich fing ein heftiges Geschrei an, und in demselben Augenblick schlug die Flamme aus dem Scheunendach. Einige Franzosen, die mit Licht unter dem Strohdach versteckten Vorrat gesucht, hatten die Scheune angesteckt. Als der Offizier die Flamme sah, wurde er äußerst ergrimmt. Es war Abend, er fürchtete sich, durch sie verraten zu werden, und mit Recht, denn ein Trupp Kosaken, der in der Nähe streifte, zog sich nach der Flamme heran. Es fiel ein Schuß der ausgestellten Vorposten, bald hörten wir Hurrah, und sahen am hellen Schein des Abendhimmels die Spieße der Kosaken vorüberfliegen. Es schien eine große Menge zu sein; die Franzosen waren schnell beisammen, sie eilten dem Walde zu, doch dort drüben am Jägerhaus, wo sie etwas vorsichtiger gingen, weil sie die Stangen von des Jägers Bohnenfeld, das verdächtig gegen den Abendschein abstach, etwa auch für Kosaken hielten, kamen sie in die Mache; es fielen noch einige Schüsse, die Flamme der brennenden Scheune leuchtete über das Feld; ich sah, wie das Getümmel sich in den Wald verlor, und eilte sodann mit mehreren Bauern, welche das Feuer herbeigelockt, die Scheune vollends niederzureißen, damit das Feuer nicht um sich griffe. Bis gegen Morgen waren wir fertig, in der Angst und Arbeit hatte ich die Schmerzen nicht so an meiner Kopfwunde empfunden, am Morgen wurden sie heftig, ich bekam einen Gesichtskrampf, und erst seit die gnädige Frau mir etwas Balsam gegeben, leide ich keine Schmerzen mehr, nur daß mir das Maul beim Lachen so hinauffährt. Das wird mir wohl ewig anhängen! – Wie ich nun mit dem gnädigen Herrn hierher trat, kam mir die ganze Geschichte wieder in die Glieder.« Der Baron gab hierauf dem Amtsboten einen Taler, und bezeugte ihm sein Mitleid, scherzhaft schließend: »Er muß sich des Lachens enthalten und immer eine rechte Amtsmiene machen.«
Schon begann der getröstete Amtsbote mit der Schaufel den Stein noch mehr zu entblößen, und der Baron hieb eine Birke um, den Block damit zu lüften, als die Baronin mit der Zeitung den Hügel heraufkam. Er warf sein Beil nieder und durchlief die Blätter mit der Begierde, die ihm, der lange von dem Vaterlande im Kriegstreiben getrennt, sehr natürlich war. Alles ist an den Blättern, die ruhig das Forum und den Gemüsemarkt des täglichen Lebens ausstellen, unter solchen Umständen interessant, ja selbst die ewig wiederkehrenden Namen der Auktionskommissaire, Buchhändler, und Schenkwirte. Die Baronin folgte seinen Blicken; die Ungeduld, mit welcher er las und alles Vaterländische liebzukosen schien, tat ihr selbst wohl – »Gut! das muß geschehen«, sagte der Baron, »und zwar hier auf der Stelle.« Die Baronin fragte, was er meine, und er las ihr aus der Vossischen Zeitung die Aufforderung eines deutschen Patrioten vor, den 18. Oktober, den Jahrestag der Leipziger Schlacht, mit Freudenfeuern auf allen Anhöhen zu feiern. – »Das geht in einem hin, gnädiger Herr«, sagte der Amtsbote, »wir werden den Stein hier doch mit Feuer sprengen müssen.« – »Desto besser«, erwiderte der Baron, »das Freudenfeuer der errungenen Freiheit sprengt dem Frieden die Fundamentsteine.« – »Wir müssen den Stein nun etwas in die Höhe wuchten«, sagte der Amtsbote, »und kleinere Steine unterlegen, damit die Flamme unter ihm wegziehen kann.« Der Baron brachte seinen Birkenstamm herbei, doch sie bemühten sich vergebens den Block zu bewegen. Indem sie in der Arbeit einhaltend über den Weg hinabsahen, erblickten sie gegen den Wald hin einen Zug aus russischer Gefangenschaft rückkehrender Franzosen. – »Das sind Zugvögel«, sagte der Amtsbote, »die bringen den Frühling, wann sie gehen.« – »Glück auf den Weg!« sagte der Baron. Der Trupp war schon den Wald hinein, sie versuchten von neuem, den Stein in die Höhe zu wuchten, als ein einzelner Franzose, der neben einer schwer bepackten Kibitke herschlenderte, ihre Anstrengungen bemerkend, sich mit Höflichkeit zu ihrer Hilfe anbot und, sein Fuhrwerk verlassend, ohne ihre Antwort abzuwarten, den Hügel herauf eilte. Schnell und heftig ergriff er den Hebebaum, und der Stein wich bald ihren vereinten Anstrengungen. Der Baron dankte, und fragte ihn, wo er geboren sei, wo er gefangen worden. Doch kaum hatte er gesagt, daß er das Unglück gehabt, in Paris geboren, und das Glück gehabt, in Moskau gefangen worden zu sein: so hörten sie unten am Wege den Schrei einer weiblichen Stimme. – »Ach, meine Frau!« rief der Gefangene aus, und eilte hinab. Der Baron und seine Frau folgten ihm auf dem Fuße, und fanden ihn unten hinter einem kleinen Busche beschäftigt, eine junge Person von sehr angenehmer Bildung einer Ohnmacht zu entreißen. Aber wie groß war des Barons Erstaunen, als er sie eine ihm wohlbekannte bunte Schachtel fest umklammern sah, und seine beiden Kinder neben ihr, welche ihn und die Mutter um Hülfe anflehten, weil die Französin die Pariser Friedenspuppe fortnehmen wolle. Der Baron beruhigte die Kinder, wenn es ihm gleich selbst verdächtig vorkam, die Französin die Schachtel mit solchem Eifer umfassen zu sehen, welche eine Pariser Modepuppe von Wachs, von der ersten Friedensmode, mit einem Chapeau à l'Angoulême au Bouquet de Lys enthielt, die er seiner Frau von Paris mitgebracht hatte. Die Baronin sagte ihm, daß die Kinder ihr mit der Schachtel, als sie herausgegangen, gefolgt seien, um sie hier unten, wo sie oft im Schatten spielten, zu betrachten; das weitere verstehe sie nicht. Sie könne unmöglich die feingebildete hübsche Frau für eine Diebin halten. Und nun verband sie ihre Bemühungen mit jenen des Franzosen, seine Frau zu sich zu bringen. Diese schlug kaum die Augen auf, als ihr Mann sie der Sorge der Baronin überließ und die Schachtel, von welcher nur der Zustand seiner Frau ihn zurückgehalten hatte, mit Heftigkeit und einem an den tiefsten Ingrimm grenzenden Ausdruck von Schmerz erfaßte. Der Baron näherte sich ihm fragend, was ihn und seine Frau so sehr an dieser Schachtel interessiere, die er von Paris mitgebracht habe. – »Ach«, rief er, »von Paris! – So ist sie es dann gewiß! – Was meine Frau angeht, so kann ich nicht begreifen, wie diese Schachtel sie interessieren kann, aber für mich ist es die Büchse der Pandora; all mein Unglück ist aus dieser Schachtel. hervorgegangen.« Während er dieses sagte, hatte sich seine Frau erholt, und sich ihm am Arme der Baronin genähert; als sie aber die Schachtel in seinen Händen sah, begann sie von neuem zu wanken, indem sie ausrief: »Ah, la boîte fatale!« Der Franzose blickte sie zürnend an, aus seinen Augen funkelte Angst und Verdacht. »Wie«, rief er aus, »wie, Antoinette, du kennst diese Schachtel?« – Sie schien über seine Heftigkeit zu erschrecken, und irgend etwas in ihrer Seele zu verbergen, was sie ungern bekannt wußte. Die Anstrengung brachte sie mehr zu sich selbst, und sie sagte mit einer Sammlung, die ihrem Zustande nicht natürlich schien: »Louis, die kleine Puppe darin hat mich so wunderbar erschreckt, sie erinnerte mich an die Leiche eines Kindes!« – »Ha! die Leiche eines Kindes! Unglückliche«, rief der Franzose aus, »welches Kindes? sprich!« – »Des Kindes meiner Freundin zu Moskau; erinnerst du dich nicht, Louis, wie ich damals betrübt war?« – »Zu Moskau«, sagte der Franzose kalt, »zu Moskau! – Hm, wohlan! laß uns unsere Reise fortsetzen«; und, sich ganz vergessend, wollte er die Schachtel nach seinem Wagen tragen, der am Wege hielt. Die Kinder des Barons, welche die geliebte Puppe nicht eine Minute aus den Augen verloren hatten, wollten schon schreien: »Er nimmt der Mutter ihre Puppe mit«, als auch der Baron ihm in den Weg trat, und ihn ersuchte, er möge nicht vergessen, daß die Schachtel seines Unglücks ihm nicht gehöre, und ihm das Seinige zurückgeben. Auch die Französin rief ihrem Manne heftig zu: »Louis, du vergißt dich; gib die Schachtel zurück, nimmermehr werde ich mit der unseligen Schachtel reisen.« – »Mit der unseligen Schachtel?« sagte der Franzose, und blickte sie forschend an, indem er sich beschämt dem Baron näherte. – »Mein Herr!« fuhr er fort, »verzeihen Sie mir eine Handlung, aus deren Unüberlegtheit Sie die Heftigkeit meines Interesses für diesen Gegenstand sehen können.« – »Ach«, sagte die Französin bestürzt zu der Baronin, »sie interessiert ihn so heftig!« – »Diese Schachtel«, fuhr der Franzose zu dem Baron fort, »mein Herr, ist mir von ungemeinem Wert, Ihnen kann eine jede dieselben Dienste tun; begehren Sie, was ich vermag, nehmen Sie die Puppe zurück, lassen Sie mir die Schachtel.« – Die kleine Französin sank bei diesem heftigen Anteil ihres Mannes an der Unglücksschachtel von neuem in Ohnmacht. »Mein Herr«, sagte der Baron, »sie wird mir durch die wunderbare Angst, die Sie und Ihre Frau mit derselben verknüpfen, mit jedem Augenblick geheimnisvoller; denn sie ward mir schon in Paris mit seltsamen Anmerkungen verkauft; ich überlasse sie Ihnen um keinen anderen Preis als um ein offenes Eingeständnis der Umstände, welche sie Ihnen so wert macht. Ihre arme kleine Frau ist überdem in einem Zustande, der ihr einige Ruhe nötig macht; können Sie sich von Ihrer Kolonne trennen, so bringen Sie die Nacht bei mir zu, und erzählen Sie mir Ihre Geschichte, die nicht ohne Merkwürdigkeit sein kann.«
Der Franzose erklärte, daß er mit jener Kolonne, die wir hatten in den Wald ziehen sehen, nur zufällig zusammengetroffen sei, und daß er auf einen eigenen russischen Paß reise. Wenn der Baron seine Gastfreundschaft auch auf seinen Schwiegervater, der vorausgehend, mit einem Gefangenen jenes Transports in ein Gespräch vertieft, sich in den Wald verloren habe, ausdehnen wolle, so sei er bereit, sein Anerbieten anzunehmen. Der Baron bat ihn, die Frauen nach dem Schlosse zu bringen, und übernahm es, den Schwiegervater selbst im Walde einzuholen, da er doch dort ein Geschäft habe; er möge ihm nur sagen, wie er ihn erkennen könne. – »Sie beschämen mich mit Ihrer Güte«, erwiderte der Franzose. »Sie werden meinen Schwiegervater an einem grünen russischen Pelzrock und einer Zobelmütze leicht erkennen; er muß unter den letztern sein, sein Name ist St. Luce.« – Nun hoben sie die Französin in den Wagen, die Baronin saß neben ihr, und der Franzose lenkte die Pferde nach dem Schlosse. Der Baron hatte kaum den Wald betreten, als er auch besorgte, er würde die Gefangenen nicht mehr einholen, denn er konnte sie auf einer ziemlich langen geradelaufenden Wegstrecke nicht mehr erblicken. Da hörte er plötzlich neben sich im Gebüsch ein Geräusch, wie von zwei heftig ringenden Menschen: »Tu ne retourneras pas, malheureux!« schrie der eine; der andere rief: »A l'aide, à l'aide! au meurtre! on me tue!« Der Baron eilte zu, er sah den ihm beschriebenen Schwiegervater, den er suchte, von einem Franzosen niedergeworfen, der im Begriff war, ihm ein Messer ins Herz zu stoßen. Indem er den Mörder niederreißen wollte, hörte er deutsche Stimmen, und ein Schuß fiel, der seine Hilfe unnötig machte. Der Franzose fiel; er war in den Unterleib getroffen. Ein Korporal, von der Eskorte, einen seiner Gefangenen vermissend, war zurückgeeilt, und hatte ihn, als er ihn in der Gewalttätigkeit begriffen sah, niedergeschossen. Der Mann, den der Baron gesucht hatte, und den wir künftig St. Luce nennen, erhob sich, mit Blut bedeckt; er hatte zwar keine tödliche Wunde, aber das Messer war ihm mehrere Male durch die Hand gezogen, und er schwer an den Fingern verletzt. Der Korporal, der den Baron kannte, weil er in dem Feldzug unter ihm auf den Vorposten gestanden, begrüßte ihn, und bat ihn um seinen Rat in diesem Vorfall. Der Baron erklärte ihm, daß der Verwundete nicht transportiert werden könne, daß er ihn und den Angefallenen auf sein Schloß bringen lassen wolle, um die Sache untersuchen zu lassen. Ihm, dem Korporal, wolle er ein paar Zeilen an den die nächste Marschstation kommandierenden Offizier zu seiner Beglaubigung mitgeben, und er könne sich sodann, wenn er aufgefordert werde, einstellen. Während der Baron dem Korporal diese Nachricht mit Bleistift in seine Schreibtafel schrieb, waren durch den Lärm die nahen Zimmerleute und der Amtsbote, der früher zu ihnen gegangen war, um Späne zu sammeln, auf den Tummelplatz gekommen; der Baron fertigte den Unteroffizier ab, schickte den Amtsboten nach einem Wundarzt und dem Justiziar des Guts, und ließ den verwundeten Franzosen von den Zimmerleuten nach dem Schlosse tragen. St. Lucen hatte er die Hand mit Schnupftüchern verbunden, und führte ihn, den der Schreck und der Blutverlust auch sehr geschwächt hatte, am Arm. Auffallend war es, daß St. Luce dem Baron als seinem Retter noch nicht gedankt hatte; er ging in einer wunderbaren Unruhe neben ihm her, und als sie an einer offenen Kartoffelgrube mit dem Verwundeten vorüberkamen, unterbrach er zuerst sein Stillschweigen, und rief den Zimmerleuten heftig zu: »Halt, halt, ici, enterrez ce malheureux!« Der Baron versicherte ihn, der Mann sei keineswegs tot. – »Nicht tot?« schrie St. Luce, und riß sich vom Arm des Barons los. Er trug das Messer, womit jener ihn verwundet hatte, in seiner gesunden Hand, und stürzte gegen den Verwundeten, um ihn zu durchbohren; doch riß ihn der Baron glücklicherweise schnell genug zurück. Er verwies ihm heftig seine unzeitige Rachsucht, die ihn selbst verdächtig mache, wand ihm das Messer aus der Hand, und faßte ihn etwas fester am Arm. Als sie in die Nähe des Schlosses kamen, fragte St. Luce den Baron, ob er nicht eine Kibitke mit Schimmeln bespannt gesehn habe, und dieser erwiderte ihm, daß er seinen Schwiegersohn und seine Tochter auf dem Schlosse finden werde. Der Baron ging mit seinem Zuge hinter dem Schlosse herum, um seine Frau und die Französin nicht zu erschrecken. Er brachte den St. Luce in eine Gartenstube, und befahl seinem Jäger, bei ihm zu bleiben; den Verwundeten aber ließ er auf ein Bett in die Gerichtsstube legen, und berief die Gerichte des Dorfes zu seiner Bewachung. Nun begab er sich zu den Gästen hinab, und bat seine Frau, die kleine Französin, die weinend auf dem Sofa lag, auf die Verwundung ihres Vaters vorzubereiten. Er selbst ging mit dem Franzosen, dessen Name Frenel war, in eine andere Stube, um ihn von dem gewaltsamen Vorfall zu unterrichten; doch dieser war so voll von der Schachtel, daß er sich wenig um seines Schwiegervaters Wunde zu bekümmern schien. Als er aber die lange freundliche Unterhaltung desselben mit seinem Gegner vor der Tätlichkeit, sodann des letztern Worte: »Non, tu ne retourneras pas«, und zuletzt wieder den Wunsch des St. Luce, seinem bereits gefangenen Gegner den Rest zu geben, vernommen hatte, wurde er sehr bedenklich. Er ergriff plötzlich die Hand des Barons, und sprach heftig: »Ach, mein Herr, wenn mein Schwiegervater ein Verbrecher wäre, wenn meine geliebte Antoinette« – hier übernahm ihn der Schmerz, und er brach in heftige Tränen aus. Der Baron sagte ihm: »Ich nehme allen Anteil an Ihnen, den mir die gänzliche Unbekanntheit mit Ihren Umständen erlaubt; die Ereignisse haben sich um Sie so schnell gehäuft, daß wir eines nach dem andern vornehmen müssen. Wollen Sie mir vor allem zu Ihrem Schwiegervater folgen? Ich glaube, es wird, ehe sein schwer verwundeter Gegner stirbt, wichtig sein, Nachrichten von der Ursache ihres Handels von ihm zu erhalten.« – Sie waren im Begriffe, zu ihm zu gehen, als die Baronin mit Madame Frenel hereinkam, die auch zu ihrem Vater wollte. Sie ersuchte ihren Mann, allein mit ihm reden zu dürfen. Dieser ward über diese Zumutung verdrießlich, ja es schien, als wenn sich ein tiefer Verdacht gegen sie in ihm regte. Er versagte es ihr platterdings, allein mit ihrem Vater zu sprechen, und so begab er sich denn mit ihr und dem Baron zu St. Luce. Dieser saß sehr niedergeschlagen in einer Ecke, und während die Seinigen sich mit ihm unterhielten, meldete der Jäger dem Baron, daß er ihm eine goldene Uhr geboten habe, wenn er ihn hinauf zu dem andern Gefangenen lassen wolle. Dieses machte den Baron noch aufmerksamer auf St. Luce, und er war sehr froh, daß der Gerichtshalter und der Chirurg angefahren kamen. Der Baron schickte den letzteren sogleich zu dem schwer Verwundeten, und machte den Gerichtshalter mit allen Umständen bekannt, besonders anmerkend, daß die Trödlerin, welche ihm die Schachtel in Paris verkaufte, ihm dieselbe mehrere Male als eine wahre Unglücksschachtel voll Zank und Streit geschildert, und vom Ankauf abgeraten habe. Der Gerichtshalter, ein kluger umsichtiger Mann, entwarf bald den Plan der Untersuchung. »Den Verwundeten«, sagte er, »wollen wir, so noch Hoffnung zu seiner Rettung ist, ganz den Händen des Arztes überlassen, er entgeht uns nicht; den St. Luce müssen wir zuerst vernehmen, und zwar ganz allein; auch darf er nicht wissen, in welcher Lage sein Feind ist, ob tot oder lebendig. Die Geschichte mit der Schachtel scheint mir durch die Tochter mit dem Vater, durch diesen vielleicht wieder mit dem Mörder zusammenzuhängen. Diese Geschichte lassen wir uns vor allem von Frenel freundschaftlich erzählen, und nehmen sie zu Protokoll. Doch«, unterbrach er sich, »lassen Sie uns diese Schachtel sogleich einmal oben dem schwer Verwundeten vor Augen bringen, so ganz zufällig; vielleicht entdecken wir etwas durch sie.« Der Baron ging, die Schachtel zu holen; der Gerichtshalter ersuchte Frenel und seine Gattin, kraft seines Amtes, den St. Luce zu verlassen, welches sie sogleich taten. Hierauf begab er sich mit dem Baron, der die Schachtel trug, zu dem schwer Verwundeten. Der Chirurg hatte soeben seine Wunde verbunden, die er für sehr gefährlich hielt; doch könne er, meinte er, in jedem Falle noch einige Tage leben. Der Gerichtshalter sendete ihn nun hinab, die Hand des St. Luce zu verbinden. Nun näherte sich der Amtsbote dem Baron und trug in der Hand eine rotseidene Binde; er lächelte, und der Mund fuhr ihm wieder links am Ohr hinauf: »Sehen Sie, Herr Baron, der Vogel hat sich gefangen; sehen Sie, das ist das Stück Tapete, das er hier herabgeschnitten« (die entblößte Fläche war noch an der Wand, und der Kranke hatte sie vor Augen), »er hat sie noch um den Leib gehabt; es ist derselbe, der mir das schiefe Maul gemacht.« – Der Baron bewunderte die Menge der Zufälle, und schickte den Amtsboten nach andern Verrichtungen. Nun setzte er die Schachtel auf einen Tisch, dem Verwundeten im Gesicht, zu den Füßen seines Bettes. Der Gerichtshalter beobachtete denselben; er schien bei dem Geräusch in seiner Nähe anfangs unempfindlich, und öffnete die Augen nur halb; kaum aber sah er die Schachtel zu seinen Füßen, als Schrecken sich aller seiner Gesichtszüge bemeisterte, und er leise die Worte ausrief: »Ah, mon dieu, je suis perdu!« – »Meine Vermutung«, flüsterte der Gerichtshalter dem Baron zu, »ist gerechtfertigt; lassen wir die Schachtel noch hier stehen, und den Verwundeten für jetzt in Ruhe.« Sie gingen hinab, und befahlen vorher dem wachhabenden Schulzen, dem Gefangenen, so er es verlangte, die Schachtel in der Nähe zu zeigen, doch sie ihm nicht in die Hände zu geben. Als sie zu St. Luce kamen, erkundigte dieser sich mit großer Angst um den Zustand seines Gegners. Der Gerichtsdiener sagte ihm, er sei tot, und er erscheine hier bei ihm, die Veranlassung ihres Handels zu erfahren. Bei dem Worte »tot« erheiterte sich das Angesicht von St. Luce auffallend, ja er stand vom Stuhle auf, und sagte mit großer Lebhaftigkeit: »Er ist den Händen der Gerechtigkeit entgangen, seine öffentliche Strafe, die seine Familie hätte beschimpfen können, ist ihm erspart; das freut mich herzlich.« – »Kennen Sie seine Familie?« fragte der Gerichtshalter. – »Ich kenne sie nicht«, erwiderte St. Luce, »ich habe ihn früher nie gesehen, als heute, da uns der Weg als Landsleute zufällig zusammenführte.« Als der Gerichtshalter diese Erklärungen aufgeschrieben, trat der Chirurg mit der Schachtel herein, und sagte, er habe den Verwundeten über diese Schachtel in größter Unruhe gefunden, und bringe sie deswegen herab. – »Er lebt also noch«, rief St. Luce aus, und veränderte die Farbe. Der Chirurg setzte die Schachtel auf den Tisch, St. Luce erblickte sie, und war wie vom Blitz getroffen, er verhüllte das Gesicht, und rief aus: »Gott, das ist Zauberei!« – »Kennen Sie diese Schachtel?« fragte der Gerichtshalter; St. Luce sammelte sich, und erwiderte: »Welche Schachtel?« – »Diese«, sagte der Gerichtshalter, sie ihm vorhaltend, »welche Ihr Schwiegersohn auch erkannt hat.« – »Mein Schwiegersohn«, sagte St. Luce bestürzt, »mein Schwiegersohn kann sie nicht kennen.« – »Aber Sie?« fuhr der Gerichtshalter fort. – »Ich sage, er kann sie ebenso wenig kennen als ich«, versetzte St. Luce. – »Ich sehe diese Unmöglichkeit nicht ein«, sagte der Gerichtshalter, »er kennt sie, er ist über sie bestürzt gewesen, und Ihre Tochter ist sogar in Ohnmacht über dieselbe gefallen.« – »Meine Tochter«, sagte St. Luce, »ist eine Visionnaire, sie weiß nicht, was sie will.« Nun setzte er sich verdrossen nieder. Der Gerichtshalter tat mehrere Fragen an ihn, aber er antwortete nur mit Ausflüchten. Man eröffnete hierauf ein ordentliches Protokoll mit ihm, die Antworten waren: Er heiße Pierre St. Luce, sei zu Lyon Kürschner gewesen, als ein treuer Anhänger der königlich Gesinnten beim Ausbruch der Revolution mit seiner Frau und damals vierjährigen Tochter emigriert, im Dienste eines russischen Edelmanns nach Moskau gekommen, und habe sich dort etabliert. Seine Frau sei gestorben, Frenel, sein Schwiegersohn, sei bei dem Eintritt der Franzosen in Moskau in sein Haus gekommen, habe es vor Brand und Plünderung geschützt; sei bei dem Rückzuge der Franzosen als Gefangener freiwillig zurückgeblieben, habe durch seine Fürsprache die Erlaubnis erhalten, in Moskau in seinem Hause sich aufzuhalten; dort habe er sich seines Geschäfts, des Rauhwarenhandels, ernsthaft angenommen, und da er ihm erklärt, daß er von rechtlichen Eltern und nicht unvermögend sei, da er zu seiner Tochter und diese zu .ihm eine große Zuneigung gehabt, so habe er sie ihm zur Ehe gegeben. Jetzt, da der königliche Thron wieder in Frankreich aufgerichtet sei, habe er seine Handlung in Moskau einem Freunde übergeben, um seinen Schwiegersohn in sein Vaterland zu begleiten und sich entweder in Lyon ansässig zu machen oder, sobald er gesehen, ob Frenel seiner Tochter wirklich ein so reichliches Auskommen geben könne, als er es verheißen, wieder nach Moskau zurückzukehren. Da er auf dieser Reise heute, seinem Wagen vorausgehend, mit der Kolonne der Gefangenen zusammengetroffen sei, habe er mit seinem Gegner ein Gespräch über sein Vaterland angeknüpft, und so hätten sie die Vorangehenden aus dem Gesichte verloren. Sie hätten aber über die Wiederherstellung des alten königlichen Hauses und die Aufhebung der Bonapartischen Dynastie gesprochen, und da sein Gegner sehr gegen den König geredet, und ihm auch sogar die weiße Kokarde von seiner Pelzmütze habe herabreißen wollen, sei ein heftiger Wortwechsel aus ihrem Gespräche geworden, worauf sein Gegner ihn plötzlich mit dem Messer angefallen. Daß er aber, als dieser bereits gefangen gewesen, mit dem Messer gegen ihn gelaufen, sei aus einem plötzlich aufwallenden Rachegefühl gegen denselben entstanden, teils aber auch aus patriotischem Eifer, um sein aufblühendes Vaterland von einem übelgesinnten Mitgliede zu befreien. –
Als er dem Gerichtshalter erklärt hatte, daß dies alles sei, was er zu sagen habe, rückte ihm dieser die Schachtel vors Gesicht, und sagte: »Aber, mein Herr, Sie würden mich verbinden, wenn Sie mir aufrichtig erklärten, was Sie bei dem Anblicke dieser Schachtel so bestürzt hat, daß Sie ausriefen: es sei Zauberei!« – St. Luce sagte: »Ich muß wirklich gestehen, die Schachtel brachte mich in einige Verlegenheit; eine ähnliche wurde bei mir in Moskau von einem Franzosen als Beutegut von unschätzbarem Inhalt, voll Kleinodien, gegen die Summe von 15 000 Livres versetzt, die ich ihm bei dem Rückzuge darauf vorgeschossen; diesen Schatz hatte ich zu Moskau in meinem Garten vor meiner Abreise vergraben. Sie können denken, wie sehr ich erschrecken mußte, dieses jener so ähnliche Gerät, das vielleicht gar dasselbe ist, in Ihren Händen vor meinen Augen zu sehen. Ist es jene Schachtel, so habe ich erstens die 15 000 Livres verloren, zweitens kann ich in meinem Vaterlande zum Ersatz angehalten werden, wenn der Eigentümer mich auskundschaftet, drittens hänge ich von Ihrer Verschwiegenheit ab, denn es war Todesstrafe darauf gesetzt, wer deponierten Raub zurückhalte. Ich ersuche Sie daher flehentlich, mir nicht zu verbergen, woher Ihnen die Schachtel zugekommen, und mich aus meiner Unruhe zu reißen.« – »Ihre Erklärung ist mir einstweilen genug«, sagte der Gerichtshalter, »aber der Schrecken Ihrer Tochter und Ihres Schwiegersohnes bei dieser Schachtel, wie sollen wir diesen erklären?« – St. Luce antwortete hierauf: »So Sie meiner Tochter meine Aussage über die Schachtel vorlegen, zweifle ich nicht, daß sie dieselbe eingestehen wird; sie wußte um jene Deponierung. Mein Schwiegersohn aber wird nicht klar darüber aussagen können, es sei denn, daß seine Frau geschwatzt hätte, und sollte er verwirrt darüber aussagen, so hat sie ihm vielleicht Unwahrheiten gesagt. Das muß sich finden.« – »Das muß sich finden!« sagte der Gerichtshalter mit jener Kälte, die einem Lügner vor Gericht durch Mark und Bein schneidet. St. Luce aber war ruhig, und sagte nochmals: »Sans doute, cela doit se trouver! s'il vaudra la peine de démêler les contes qu'une jolie femme aime à faire à son époux en cas de nécessité.« – Dies sagte er mit einer so französischen Leichtigkeit und einem so frivolen Lächeln, als wisse er, daß es auch Deutsche gibt, die solchen allerliebsten Lug und Trug zu den sogenannten läßlichen Sünden rechnen, die mit Küssen gebüßt werden, oder mit Wurst wider Wurst. Der Gerichtshalter aber sagte nochmals: »Das wird sich finden, und es wird sich auch finden, warum Ihr Gegner bei dem Anblicke der Schachtel ausgerufen hat: ›O mein Gott, ich bin verloren!‹ Wie wäre es, mein Herr, wenn er der Depositair jener Schachtel in Moskau bei Ihnen wäre; wie wäre es, wenn er im Walde die Rückgabe derselben von Ihnen begehrt hätte; wie wäre es, wenn Sie ihn verleugnet hätten; wie wäre es, wenn er zu den Worten, mit welchen er Sie anfiel: ›Non, tu ne retourneras pas‹ noch hinzugesetzt hätte. ›avant de me rendre le trésor, que j'ai déposé chez vous‹?« – St. Luce war auf diesen Einwurf des Gerichtshalters nicht vorbereitet, er konnte seine Bestürzung nicht verbergen; doch bald sammelte er sich wieder, und sagte: »Mein Herr, eine allgemeine Amnestie und Gnade wird jetzt überall von den erhabenen Herstellern der bürgerlichen Ordnung gehandhabt; Sie sind ein Repräsentant dieser erhabenen Monarchen, lassen auch Sie solche Milde gegen mich obwalten; erklären Sie meinem Gegner, daß ich bereit bin, ihm seine 15 000 Livres zu lassen, wenn er nicht weiter von der Schachtel reden will.« – »Wie hoch war von Ihnen der Wert der Schachtel angenommen?« fragte der Gerichtshalter. – »Auf 30 000 Livres«, erwiderte St. Luce, »und ich Unglücklicher muß die 15 000 Livres verlieren; ich will sie auch gern verlieren, und ihm ewige Verschwiegenheit versprechen, wenn er mich wegen der Schachtel nicht in Anklage bringt.« – »Er wird schlecht mit diesem Vorschlag zufrieden sein«, sagte der Gerichtshalter, »und Sie würden gut dabei fahren, da die Schachtel noch bei Ihnen in Moskau steht; denn dieses ist die Schachtel nicht, die müßte denn über Paris von Moskau hierher gekommen sein.« – Auf diese Erklärung konnte St. Luce kaum mehr zur Fassung kommen, und er sah die Schachtel von neuem mit großer Unruhe an. Endlich brach er aus: »Wohlan, so erklären Sie ihm, daß ich bereit bin, ihm noch 15 000 Livres zu geben, so er weiter gar nichts mehr von dieser Schachtel erwähnt, und obenein, daß ich bereit bin, seinen Anfall auf mich als eine Ehrensache anzusehen.« – »Obgleich dieses keine Aufträge für eine untersuchende Gerichtsperson sind«, sagte der Gerichtshalter, »so werde ich doch alles für Sie tun, was ich tun kann; Sie selbst aber bringen sich in einen ungeheuren Verlust, da ich es Ihrer Regierung nicht verschweigen kann, daß Sie in Moskau einen so bedeutenden Schatz geraubtes Gut verborgen haben, das Sie werden ausliefern müssen.« – St. Luce sagte hierauf: »Das muß ich verschmerzen; ich werde Ihnen die Designation des Ortes einliefern, wo ich es vergraben habe; hoffentlich wird es noch dort ruhen; sollte es aber durch Verräterei entkommen sein, so bleibt kein Mittel, mir zu helfen.« Der Baron und der Gerichtshalter begaben sich nun wieder zu dem Verwundeten; er war etwas aufgerichtet, und imstande zu sprechen. Auf die Frage des Gerichtshalters sagte er folgendes aus: »Ich heiße Pigot, und bin ein Douanenoffizier von Rouen, wo ich, mit den Kohorten nach Lützen ziehend, meine Frau verließ; in der Lützner Schlacht ward ich von den Russen gefangen, und kehre jetzt nach Hause zurück. Hier im Walde stieß ich auf den Totengräber Dumoulin von Paris; er leugnete mir ab, daß er es sei, und wollte sich für einen Pelzhändler St. Luce aus Lyon ausgeben; diese Unverschämtheit ärgerte mich, und wir kamen in Streit; ich erklärte ihm, er solle aus Frankreich bleiben, es sei nur zu bekannt, welchen schmählichen Handel er in der Schreckenszeit mit Kleidern, Kleinodien und Altertümern aus den Grüften der größten französischen Familien getrieben. Dieses mein Drohen machte ihn wütend, und er drohte mir mit seinem Stockdegen, worüber ich ergrimmt mit dem Messer auf ihn zuging; das Übrige ist Ihnen bekannt.«
Der Gerichtsverwalter sagte nun zu ihm: »Dumoulin oder St. Luce erklärt, daß er Sie nicht kenne, nämlich, daß er Ihren Namen nicht wisse.«
Pigot: Das ist wahr.
Gerichtshalter: Aber er erklärt doch, ein Geschäft mit Ihnen in Moskau gemacht zu haben.
Pigot: Ich war nie in Moskau.
Gerichtshalter: Besinnen Sie sich; ist er Ihnen nicht noch 15 000 Livres schuldig?
Bei den Worten 15 000 Livres veränderte Pigot die Farbe. »15 000 Livres?« sagte er, »ich wüßte nicht.«
Gerichtshalter: Kennen Sie diese Schachtel?
Pigot. Sie scheint mir bekannt.
Gerichtshalter: Sind Sie zufrieden, wenn Sie sie ohne ihren Inhalt zurückerhalten?
Pigot: Allmächtiger Himmel, ich verlange ihren Inhalt nie mehr zu sehen!
Gerichtshalter: Sie riskieren auch nichts dabei, denn diese Schachtel ist nicht die, welche Sie meinen; jene ist noch in Moskau in Ihres Gegners Hause vergraben. Sind Sie zufrieden, daß die Juwelen, welche jene Schachtel enthält, an die russische Regierung zurückgestellt werden?
Pigot ward bei dem Worte »Kleinodien« sehr vergnügt und sagte: »Ich bin alles zufrieden.«
Diese Bereitwilligkeit zu den Vorschlägen seines Gegners, verbunden mit der Verschiedenheit ihrer Aussagen, befremdete den Gerichtshalter, und er brach das Verhör ab, weil er fürchtete, daß er beiden zu irgend einem Einverständnis durch seine Fragen Hülfe geleistet. Überdem war es Abend geworden, und dieser bot Gelegenheit zu vertraulicher Erforschung Frenels und seiner Gattin. Diese letztere war bereits durch die Baronin so gewonnen, daß sich alles von ihrer Offenheit erwarten ließ. Der Baron ließ den beiden Arrestanten ein gutes Abendbrot auf ihre Stuben bringen, und die übrige Gesellschaft setzte sich auch zu Tische. Beim Nachtische trank der Baron die Gesundheit der alliierten Monarchen und Ludwigs des Achtzehnten, worauf Frenel herzlich Bescheid tat. Hiernach trank der Gerichtshalter das Wohl aller tapferen Streiter für die gute Sache, und auch der edlen Frauen, welche in dieser Zeit, wo das ganze Vaterland zu einer Familie geworden, dem Hause so treulich beigestanden; dann trank man die Gesundheit der Gegenwärtigen, und der Gerichtshalter wendete sich mit dem Glase zu Frenels Gattin und sagte: »Es gilt dem Andenken Ihrer verewigten Frau Mutter, der Frau Dumoulin.« Frenel wendete sich bei diesem Namen zu seiner Frau, die bestürzt schien, und fragte: »Antoinette! hieß deine Mutter nicht St. Luce, wie dein Vater?« Antoinette sagte: »Ich weiß nicht, woher der Herr Gerichtshalter diesen Namen hat; ich habe ihn in Moskau einigemal auf alten Briefen bei meinem Vater gesehen, und er hat mir gesagt, er habe sie von einem Stiefbruder geerbt.« – »Weil wir auf die Sache kommen« , fuhr der Gerichtshalter fort, »so muß ich Sie bitten, mir zu erzählen, ob denn die Schachtel, welche heute so mancherlei Bewegungen bei uns hervorgebracht, jener, auf welche Ihr Herr Vater in Moskau seinem verwundeten Gegner 15 000 Livres vorgeschossen, und die, mit Kleinodien gefüllt, dort in seinem Garten vergraben liegt, so sehr ähnlich ist, daß auch Sie, als Sie ihr Ebenbild erblickten, durch die Furcht, jenes teure Pfand möge dort entwendet sein, erschüttert wurden?« – Antoinettens Verwunderung stieg bei diesen Reden mit jedem Augenblick. Sie sagte: »Ich weiß nichts von einer solchen deponierten Schachtel.« – Der Gerichtshalter bat sie, der Erforschung der Wahrheit kein unnötiges Hindernis in den Weg zu legen, da ihr Vater und sein Gegner, eben der, welcher die Schachtel bei ihm verpfändet gehabt, bereits alles eingestanden. Sie schüttelte den Kopf und sagte: »Ich weiß, bei Gott! nichts von jener deponierten Schachtel.« Frenel, der seine Gattin mit gespannter Erwartung ihres Geständnisses angeblickt hatte, sagte nun zu ihr: »O meine liebe Antoinette, gestehe es, diese Schachtel hat dich nur durch die Ähnlichkeit mit jener deponierten so erschüttert; meine Ruhe, meine Liebe zu dir hängt an dem Geständnisse der Wahrheit.« Antoinette erwiderte ihm: »Du setzest mir einen hohen Preis, ja den höchsten, um diese Erklärung oder um die Wahrheit?« Frenel sagte: »Ja, um die Wahrheit allein.« – »So erkläre ich dir dann«, versetzte Antoinette, »um den Preis deiner Ruhe und deiner Liebe, daß ich von einer deponierten Schachtel nichts weiß.« – Dies war ein Donnerschlag für Frenel. »Meine Herren«, sagte er zu dem Gerichtshalter und zum Baron, »nach dieser Erklärung sehe ich, daß Sie von Ihren Inquisiten belogen sind, die auf eine ganz andere Art mit der Schachtel zusammenhängen dürften. Darf ich Sie ersuchen, Herr Baron, mir zu erzählen, wo Sie in Paris zu dieser Schachtel gekommen sind?« – Der Baron nahm das Wort und sagte: »Als ich die Friedensmodepuppe in Paris gekauft, sah ich bald, daß ich sie in meinem militärischen Felleisen unbeschädigt nicht transportieren könnte, und suchte mir also bei einer Trödlerin, die gleich an der Ecke meiner Straße« – »Welcher Straße?« unterbrach ihn Frenel – »der Rue St. Mathurin in der Vorstadt St. Antoine«, versetzte der Baron, und fuhr fort: »Die Trödlerin, eine junge, hübsche Frau, suchte ihre Schachteln durch, und keine wollte sich schicken. Nur diese alte bunte Schachtel, die hoch oben in einem Winkel stand, überging sie immer. Ich machte sie darauf aufmerksam, und bat sie, dieselbe auch zu versuchen, denn sie schien mir passend. Sie erwiderte aber: ›Ach diese! das ist die Unglücksschachtel, die mag ich Ihnen nicht geben, so sehr sie mir zuwider ist. Meine selige Mutter machte mich immer mit ihr zu fürchten; sie hatte sie mit vielem alten Geräte von einer Dame, bei der sie diente, erhalten. Sie sagte mir immer, da liege Zank und Streit, ja der Tod selbst darin, und drohte mir, sie zu öffnen, wenn ich nicht artig war. Nein, ich möchte die einem so artigen Herrn nicht verkaufen; sie könnte sie mit der schönen Dame brouillieren, der Sie die schöne Puppe schicken wollen.‹ – Die Schachtel wurde mir dadurch nur interessanter; ich nahm sie herab, die Puppe paßte genau hinein, ich wurde des Handels einig, und trug die Friedenspuppe in der Schachtel des Kriegs, Streits und Todes triumphierend davon. Sie können sich denken, wie mich nun heute die mannigfaltige Intrige um diese Schachtel interessieren muß. Sollte die gute selige Mutter der Trödlerin doch recht gehabt haben? Ich bitte Sie, Herr Frenel, halten Sie nun Ihr Versprechen, und erzählen Sie uns Ihre Geschichte und die der Schachtel.«
Hierzu ließ sich nun Frenel bereit finden, und erzählte folgendes:
»Der Chevalier Montpreville war Witwer; er hatte eine einzige Tochter, die ihrer verstorbenen trefflichen Mutter nicht würdig war, doch durfte man sie damit entschuldigen, daß sie ihre Mutter früh verloren und ihr Vater eben nicht glücklich in der Wahl ihrer Erzieherinnen mag gewesen sein. Er hatte einen Geschäftsfreund, den Advokaten Sanseau; dessen Frau, welche auch eine Tochter und einen Sohn hatte, ward die Pflegemutter der Mademoiselle Montpreville. Als sie erwachsen war, nahm sie der Chevalier wieder zu sich, denn er liebte sie, als sein einziges Kind und den letzten Sprossen seines Hauses, das mit ihr erlöschen sollte. Die Revolution brach aus, die Prinzen, der Adel wanderten aus. Der Chevalier blieb; er wagte es weder sein Kind zu verlassen, noch sie dem Verlust seiner Güter auszusetzen, überdies lebte er einsam und ohne Zusammenhang mit dem Hofe. Sein Ratgeber war immer der Advokat Sanseau, dessen Familie seine Tochter fleißig besuchte, und dort recht in eine Schule des neuen Systems ging. Der Advokat Sanseau war ein naher Verwandter des bekannten Bierbrauers und großen Revolutionärs Sanseau. Dieser besuchte täglich sein Haus, und wenn der Advokat nicht ganz in sein System einging, so war es nur, um sich mancherlei Verhältnisse mit Andersgesinnten zu schonen, die ihm einträglich waren. Er suchte nach und nach überzutreten, doch sein Sohn und seine Tochter standen schon mitten im Haufen der Freien und Gleichen. Mademoiselle Sanseau wurde einst von dem Bierbrauer eingeladen, die Freiheit bei einem allegorischen Zuge vorzustellen, und da Mademoiselle Montpreville zugegen war, machte er ihr den Antrag, die Rolle der Gleichheit zu übernehmen. Sie hatte große Lust dazu, nur fürchtete sie, ihren Vater, der solche Grundsätze noch nicht bekannt hatte, dadurch zu kränken. Der junge Sanseau, welcher bereits einen Teil der Geschäfte seines Vaters übernommen hatte, und als einer der feurigsten republikanischen Redner im Klub und an den Straßenecken bekannt war, war schon seit mehreren Jahren der Liebhaber der Mademoiselle Montpreville. Der Advokat, sein Vater, unterstützte dieses Verhältnis in der Stille, weil er noch die Gesinnungen des Chevaliers fürchtete, den er nach und nach zu dem neuen System, und endlich zu dieser Verbindung zu stimmen gedachte.
Zu dem Feste hatte der junge Sanseau mehrere Gedichte verfertigt; er bestürmte seine Geliebte, die Mademoiselle Montpreville, die Rolle der Gleichheit zu übernehmen, und sie wich endlich seinen Beschwörungen, und ihrer Eitelkeit, öffentlich zu erscheinen. Der Gleichheitsrock wurde geschneidert und angezogen. Der dezenteste war er eben nicht; die Gesellschaft fand die Mademoiselle bezaubernd, der junge Sanseau umarmte sie, und der ganze Unterschied zwischen ihr und der schlechten Gesellschaft, in der sie sich befand, ihre Unschuld, gingen an diesem Tage verloren. Sie waren alle frei und gleich, obschon sie eine ziemlich garstige Gleichheit vorstellte, denn sie war häßlich; und so gleich und eben sie überall war, wo man Unebenheiten nicht uneben findet, so war sie doch auf der einen Schulter etwas zu uneben, und die Pariser Witzlinge bemerkten, als sie in dem Tempel der Vernunft spazierte, daß sie etwas hautaine, daß sie eine Achselträgerin, daß sie noch nicht ganz gleich sei. Der Advokat schien den Schritt der Mademoiselle Montpreville zu ignorieren, aber er benutzte ihn; er bearbeitete den Chevalier zu dem Entschluß, auf seinen Adel zu resignieren, um sein Vermögen zu retten. Der Chevalier war beinahe entschlossen; den letzten Stoß sollte eine rührende Szene geben. Am Abende vor dem öffentlichen Feste lud er den Chevalier zu sich ein. Da erschien auf einer kleinen Bühne der junge Sanseau als der Patriotismus, der zum Kampfe ziehen wollte; er sah die Noblesse, Mademoiselle Montpreville, unter einem Stammbaum mit vielen Wappen schlummern, der, vom Blitze getroffen, niederzustürzen und sie zu zerschmettern drohte; er bedauerte ihre Gefahr, er wollte sie wecken. Da erschien ein Liebesgott in dem Baum, und schoß ihm einen Pfeil in das Herz. Der im Baum herumkletternde Liebesgott brach mehrere Äste nieder, der Patriotismus riß die Noblesse auf, er machte ihr seine Erklärung. Der Liebesgott schoß auch Ihr einen Pfeil in das Herz, doch zierte sie sich noch, ehe sie sich ergab. Sie umarmte den Stammbaum, da führte sie der Patriotismus in den Tempel der Freiheit; diese riet ihnen, sich eine Hütte aus dem alten Stammbaum zu bauen, und kleidete die Noblesse als Egalité ein, und nun stürzte sich die Egalité und der Patriotismus dem Chevalier Montpreville zu Füßen und baten um seinen Segen. Der Chevalier war überrascht, aber er war nicht ungeneigt; auch wäre Weigerung gefährlich gewesen, denn das ganze Festspiel war unter den Augen und dem lauten Beifalle der heftigsten Jakobiner, die der Bierbrauer mitgebracht hatte, vorgegangen. Der Chevalier gab seine Einwilligung, seinen Segen, der Stammbaum ward niedergerissen, ja der wirkliche Stammbaum des Chevaliers, welchen der Advokat unter anderen Papieren im Hause hatte, ward herbeigebracht und auf dem Altar des Vaterlandes verbrannt. Der Chevalier weinte dabei: ›Tränen der Rührung‹ rief der Patriotismus aus, und die Gleichheit setzte ihm eine Bürgerkrone auf, worauf der Bierbrauer ein ›Vive la nation, vive la liberté, vive l'égalité, vive le citoyen Montpreville!‹ ausrief, das die ganze Gesellschaft nachbrüllte, worauf das Fest mit Champagner und Ça ira geschlossen wurde. Am folgenden Tage ging die Citoyenne Montpreville als etwas bucklichte Egalité neben der Liberté, Citoyenne Sanseau, im öffentlichen Aufzuge, und am Abend ward sie von dem Maire zur Citoyenne Sanseau erklärt. Der alte Montpreville nahm das junge Paar in sein Haus; sein Schwiegersohn war ein Taugenichts, seine Tochter nicht viel besser. Die frechen Reden und Handlungen seiner Kinder bewegten den Vater oft zu Ermahnungen, und nun nannte man ihn einen Aristokraten. Der Advokat starb, mit ihm verlor Montpreville seinen letzten Beistand gegen die Insolenzen des Schwiegersohns, dem er zu lange lebte. Sein Unglück wuchs mit jedem Tage, und so entschloß er sich endlich, um seine Tochter und ihren Mann zu bestrafen, wieder zu heiraten. Eine jüngere Freundin seiner verstorbenen Frau, arm und ohne Unterstützung, die ihm aus der Provinz ihre Lage geschildert hatte, war sein Augenmerk. Er besuchte sie, er brachte sie als sein Weib zurück. Er trennte sich von seinen undankbaren Kindern, und hatte bald die Freude, daß ihm seine Gattin ihre Schwangerschaft ankündigte. Montpreville verschwieg seinem Schwiegersohne seine Hoffnung, er wollte seines Glückes erst recht gewiß sein. Aber der Arme sollte diese Freude nicht erleben. Er starb im fünften Monate vor meiner Geburt, denn ich bin die Frucht dieser Ehe, und ließ eine tiefbetrübte Witwe zurück. Sanseau hatte kaum den Tod meines Vaters erfahren, als er unter den beleidigendsten Äußerungen mit einigen Gerichtspersonen seines Gelichters in die Wohnung meiner Mutter drang, um sich in den Besitz der Verlassenschaft meines Vaters zu setzen. Meine Mutter saß weinend in ihrem Kabinette, sie war fremd, und hatte, da sie der verwilderten Zeit wegen sehr einsam gelebt, keine Freunde und keinen Beistand. Endlich drangen Sanseau und der Kommissair auch in dieses Gemach, und Sanseau kündigte ihr auf die beleidigendste Art an, sie möge ihr Bündel schnüren und in Zeit von vierundzwanzig Stunden das Haus verlassen, denn alles, was hier zurückgeblieben, sei sein rechtmäßiges Eigentum. Meine Mutter stellte ihm mit bittern Tränen vor, er möge sie jetzt doch nicht in ihrem Schmerze mißhandeln und dies Haus, das der Leichnam ihres Gatten und seines Schwiegervaters noch nicht verlassen habe, nicht durch seine Gewalttätigkeiten schänden. Aber er setzte ihr mit solcher Härte und Grausamkeit zu, daß sie endlich in der Bitterkeit ihres Schmerzes ausrief: ›Mein Herr, wenn Sie mein Geschlecht und meinen Stand, wenn Sie die Gattin Montprevilles, wenn Sie den Leichnam Ihres Schwiegervaters nicht ehren, so haben Sie Achtung vor seinem Kinde, das ich seit fünf Monden unter meinem Herzen trage.‹ – Sanseau war hierdurch stumm gemacht; der Kommissair sagte zu ihm: ›Citoyen, hier ist jetzt nichts mehr für Sie zu tun.‹ Er faßte über die Aussage meiner Mutter ein Instrument ab, und die Barbaren verließen das Haus unter Fluchen und Schimpfen. Sie ergab sich ihrem Schmerz, die Leiche meines Vaters ward zur Erde bestattet, und die Unglückliche lebte bis zur Zeit meiner Geburt mit einer treuen Magd, einsam und fromm, doch nicht ohne mannigfaltige Kränkung von Seiten Sanseaus, der ihr mehrmals drohte, sie untersuchen zu lassen, weil er ihren Zustand für verstellt halte, und der ihre Wohnung beständig von seinen Kreaturen bewachen ließ, damit sie nicht etwa inzwischen etwas aus der Verlassenschaft des Vaters verschleppe. Endlich fühlte meine Mutter die Stunde meiner Geburt nahe. Sie schickte den Diener meines Vaters nach der Hebamme, aber ich schien zu ungeduldig, auf diese traurige Welt zu kommen: die Hebamme kam zu spät; meine Mutter brachte mich unter dem Beistande ihrer Magd zur Welt. Als der Diener mit der weisen Frau zurückkam, schickte ihn meine Mutter sogleich an Sanseau, um ihm meine Geburt bekannt zu machen. Die Wut und die Verzweiflung dieses Elenden und seines Weibes war nicht auszusprechen; sie erklärten, sie würden sich, sobald es schicklich sei, von meinem Dasein überzeugen. Morgens war ich geboren, und als gegen Abend die Wöchnerin etwas Ruhe in ihrem Gemach begehrte, und das Gesinde in dem Vorsaal sich zusammen an das Kamin setzen wollte, fand die Magd auf einem Stuhle am Fenster in einer Schachtel, in dieser Schachtel, die Sie alle kennen –«
»O Jesus!« schrie hier Madame Frenel auf, »o ich Unglückliche! Ich habe sie hingesetzt, ich war dazu gezwungen! –« und ihre Sinne verließen sie.
»Unseliges Weib!« rief hier Frenel aus, »du hast die Leiche des neugeborenen Kindes hingesetzt; du, mein Weib, mußtest mich um alles bringen!« Hier sprang er auf, und überließ sich einer vollkommenen Verzweiflung. Mit vieler Mühe brachte ihn der Baron und der Gerichtshalter zur Ruhe. Antoinette wurde in das Gemach der Baronin gebracht, und Frenel erzählte, als er sich gefaßt, doch nicht mehr so ruhig als zuvor: »Sie fanden die Leiche eines Kindes, nackt, nur mit einem Vorhange bedeckt. Sie waren bestürzt, sie scheuten sich, es meiner Mutter zu sagen. Endlich übernahm es die Amme, das Kind, da es bereits dämmerte, wegzutragen und zu begraben; aber kaum war sie vor der Türe, als Sanseau und seine Gattin ihr begegneten, sie aufhielten, sie untersuchten, und das Kind, das sie, um es besser zu verbergen, aus der Schachtel in ihre Schürze genommen hatte, entdeckten. Sie lärmten, sie riefen Zeugen, sie gingen zum Kommissair des Viertels, der Prozeß eröffnete sich, man erklärte mich für untergeschoben, und das tote Kind für die Frucht meiner Mutter. Sanseau ward zum Erben eingesetzt, meiner Mutter blieben 30 000 Livres, die ihr als Wittum in den Ehepakten ausbedungen waren, und ich selbst durfte den Namen meines Vaters nicht tragen. Sie fand an ihrem Arzt einen rechtschaffenen Mann, der ihr das Leben zwar nicht erhalten konnte, aber sie doch in der Hoffnung sterben ließ, daß er mir die 30 000 Livres, die sie mir als eine Schenkung versicherte, weil ich als ihr rechtmäßiger Erbe nicht anerkannt war, treu bewahren und, als mein Vormund, sich meiner annehmen werde.
Dieses, meine Herren, ist meine Geschichte. Sollte ich nicht erschrecken, als ich hier diese unglückliche Schachtel wieder sah, deren Inhalt mich um Mutter, um Hab und Gut, um Ehre und Namen gebracht, und nun, nun muß ich gar erfahren, daß mein Weib, die ich über alles zärtlich liebte, diese unselige Schachtel dort hingesetzt hat! O das ist, um sich den Tod zu geben! Und es ist bestimmt dieselbe Schachtel, denn die Mutter der Trödlerin, bei welcher Sie sie gekauft haben, Herr Baron, ist dieselbe vertraute Magd meiner Mutter gewesen, welche ihr in ihrer Geburtsstunde beigestanden. Sie erzog mich bis in mein achtes Jahr, und hat mir oft von der Schachtel erzählt. Nachher kam ich in eine Pension. Die bonne Marguerite, so hieß die Magd, heiratete den Trödler; ich bin oft aus der Schule mit meinen vertrauten Kameraden bei ihr gewesen, um diesen die fatale Schachtel zeigen zu lassen. Übrigens ward mir diese unselige Geschichte noch die Veranlassung zu manchem Verdruß, meine Mitschüler schimpften mich Wechselbalg, und ich mußte mich darum oft abwechselnd mit ihnen balgen. Als ich endlich in die Konskription fiel, hatte ich auch mit manchem meiner Kameraden darum Händel, wenn ich gleich vor den Kugeln der Feinde immer glücklich davon kam. Bei dem Brande von Moskau, als ich durch die Straßen irrte, um irgend jemand zu retten, sprang mir Antoinette aus dem Hause ihres Vaters entgegen, und flehte mich auf französisch um Hülfe gegen einige trunkene Plünderer an, die sie verfolgten. Ich war Sergeant, ich befahl ihren Verfolgern, sie in Ruhe zu lassen, führte sie in ihre Wohnung zurück, und trat in die Türe mit gezogenem Degen. Die Gegner schimpften mich; es mochte mich einer kennen, sie schimpften mich Wechselbalg, ich drang mit dem Degen auf sie ein, es gelang mir, sie gut zu bezahlen; aber auch ich hatte mein Teil; ich sank, von mehreren Wunden entkräftet, unter ihrer Türe. Ich ward in das Haus gebracht, sie pflegte mich, ich lernte sie lieben. Der Rückzug der Armee begann, ich war vergessen. Ich genas, ich zeigte mich dem Gouverneur als Gefangener an, der Aufenthalt ward mir vergönnt, ich half meinem Schwiegervater in seinem Geschäft, der Frieden ward geschlossen, ich heiratete Antoinetten, sie ist zwei Monate mein Weib, wir ziehen nach Frankreich, mein Vermögen in Besitz zu nehmen, und hier muß ich auf eine so überraschende Art erfahren, daß sie, die ich über alles liebe, an jenem mir gespielten Betruge teilhat! – Doch, meine Herren, ich muß nun alles wissen; Sie werden nicht zweifeln, daß ich im höchsten Grade gespannt bin, die Auflösung einer Intrige zu erfahren, die mir so teuer zu stehen gekommen ist. Erlauben Sie, daß ich mich zu meiner Frau begebe, um von ihr zu erfahren, auf welche Weise sie Teilnehmerin eines so schändlichen Betruges geworden ist.«
»Ihre Frau ist zu jung«, sagte der Baron, »um wissentlich Anteil an diesem Handel gehabt zu haben.«
»Sie ist nur vier Jahre älter als ich«, erwiderte Frenel, »man wird sie gemißbraucht haben, wie mich selbst; aber es ist doch ein schreckliches Ereignis, das sie befleckt.«
Der Baron ging zu Bette, Frenel zu seiner Frau. Beide waren unerschöpflich in Klagen und Erklärungen. Die Angst lag über dem Haupte Sanseaus; St. Luce hatte die ganze Lüge durchstudiert, in welche er die Untersuchung aufgelöst hatte, und bereitete sich auf den folgenden Tag vor. Aber es sollte ihm leichter und schwerer werden. Die Stube, in welcher Frenel und seine Frau schlief, war dicht neben der Gerichtsstube, ihr Bett stand an der Wand, die Sanseaus Lager berührte, eine ehemalige Tür, die in einen Wandschrank verwandelt worden war, machte jedes Wort in der Stille der Nacht hörbar. Frenel und seine Frau hatten das Herz zu voll, um zu flüstern, sie durchliefen in ihrem Gespräche alles, was sie erfahren, und was sie sich zu eröffnen hatten. Sanseau erwachte, hörte, verstand, und erfuhr, daß sein Feind neben ihm sei, daß man seine Geschichte ganz wisse, daß aller Ausweg vergebens sei. Feig war er nicht, er löste den Verband seiner Wunde. Schon rann sein Blut über das Bett zur Erde nieder, er fiel in Krämpfe. Der Schulz, der bei ihm zur Wache war, ward munter; der Chirurg eilte zum Kranken, er sah, was vorgefallen war, und ergriff die schleunigsten Mittel, die ihm zu Gebote standen, das wenige Leben, das dem Kranken noch übrig blieb, zurückzuhalten. Über den Bemühungen des Arztes erwachte das Haus; der Gerichtshalter und der Baron eilten herbei. Als der Kranke zur Besinnung gekommen war und sie bemerkte, winkte er ihnen, zu seinem Lager zu treten, und redete sie mit folgenden Worten an: »Die göttliche Gerechtigkeit will nicht, daß ich sterbe, ohne wieder gutgemacht zu haben, was mir noch gutzumachen übrig ist. Der Selbstmord, den ich vor zwei Stunden durch die Auflösung meines Verbandes an mir versuchte, ist mir nicht gelungen. Ich weiß alles, mein Neffe ist hier; der rächende Himmel hat ihn zum Schwiegersohne des Mannes gemacht, von dessen niedriger Gesinnung ich um 15 000 Livres das Mittel erkaufte, mich in den Besitz seines Vermögens zu setzen; ich habe heute nacht die Unterredungen der beiden Eheleute gehört, die neben mir schliefen. Ich fühle, wenige Minuten bleiben mir noch zur Wiedererstattung. Zu erforschen ist nichts mehr von mir, die Wahrheit ist in Ihren Händen. Dumoulin wußte nichts von dem Gebrauch, den ich mit der Leiche des Kindes vorhatte; er tat, was ums Geld bedungen war; auch meinen Namen hat er nicht gewußt, so wie ich ganz ohne Kenntnis des Kindermordes bin, den er zu diesem Zwecke begangen. Alles dieses erkläre ich Ihnen frei, und in der Hoffnung auf das Erbarmen Gottes, und bitte Sie, meinen letzten Willen zu empfangen.« – Der Gerichtshalter setzte nun das Testament Sanseaus auf, in welchem er die ganze Geschichte seines Betruges eingestand, seinen Schwager zum Erben seines ganzen Vermögens einsetzte, ihn um Schonung für seine Frau und um Stiftung einer Totenmesse für ihn an seinem Sterbetage in der Kirche St. Denis zu Paris bat. Nachdem ihm dieses Instrument vorgelesen war, und er es unterzeichnet hatte, diktierte er noch einen sehr rührenden Brief an seine Frau, und bat, man möge seinen Schwager, den Chevalier de Montpreville, und dessen Gattin zu ihm rufen. Der Baron ging, bereitete sie vor, und brachte sie an das Bett des Kranken. Montpreville wollte ihm die Hand reichen; Sanseau aber reichte ihm das Testament, und sagte nichts als: »Ayez pitié de moi, mon beau-frère, pardonnez à un malheureux, et priez Dieu, qu'il me pardonne.« Mehr konnte er nicht hervorbringen, er starb unter dem Ausruf Frenels: »Oui, oui, que Dieu vous pardonne, mon pauvre cousin, comme je vous pardonne de tout mon coeur.« – Ohne Tränen der Umstehenden ist er nicht verschieden. Frenel weinte aufrichtig, und seine gute Frau weinte auch um ihren bittersten Feind; sie hatten ihm herzlich verziehen. Sie verließen die Stube, und der Gerichtshalter protokollierte den Willensakt und den Tod Sanseaus. Hierauf begab er sich mit dem Baron, Frenel und seiner Frau zu dem angeblichen St. Luce; er ging den beiden letztern lebhaft entgegen, und grüßte sie mit den Worten: »Endlich sehe ich euch wieder, liebe Kinder!« Aber Frenel zog seine Frau zurück, und reichte ihm Sanseaus Testament hin, indem er sagte. »Dumoulin, leset den letzten Willen von Sanseau, meinem Schwager; er bittet Euch wegen dem Anfall auf Euer Leben um Verzeihung; er hat ihm das seine gekostet. Auch ich habe ihm verziehen, denn die Leiche, die Ihr ihm um 15 000 Livres verkauftet, ward, als ich zur Welt kam, meiner Mutter untergeschoben, und somit ich aus meines Vaters Erbschaft gestoßen. Alles ist gutgemacht, Ihr fehlt allein noch; bekennet, und gebt Mademoiselle Marie Geneviève de Renaut, die Ihr als Kind geraubt, ihren Eltern zurück, oder wollt Ihr mir diesen Auftrag überlassen?«
Diese Worte, kalt und scharf ihm in das Angesicht gesprochen, waren zu viel für die unverschämteste Stirne; er wankte, erblaßte und sank auf sein Bett nieder, und die gute Frenel, von gewohnter Kindesliebe gerührt, fiel ihrem Manne weinend in die Arme: »O Louis!« rief sie aus, »laß ihn nicht verderben, er hat auch mich nicht verderben lassen!« – Da hob Dumoulin die Hand empor, ohne sein Antlitz zeigen zu können, und rief aus: »Antoinette, du bist mein Kind nicht, aber erbarme dich meiner, du bist ja nicht schlecht durch mich geworden; ach verzeih, verzeih! und dann verlasse mich!« – Da reichte ihm Antoinette die Hand und sprach: »Ihr habt mir vieles geraubt, vielleicht zu meinem Besten; seid aufrichtig, Ihr habt es mit guten Menschen zu tun; Gott lohne Euch alles, was Ihr für mich getan, und erleichtere Euer Herz!« – »Das ist zuviel! zuviel!« rief Dumoulin aus; »weg, weg, verlaß mich, daß ich nicht verzweifle!« – Und als sie von neuem ihn beruhigen wollte, ward sein rohes Gemüt von so heftiger Leidenschaft zerrissen, daß der Baron die weinende Frau wegbringen mußte. Frenel aber faßte Dumoulin in seine Arme und sagte: »Entsetzlicher Mensch, mäßige dich, und tue das Deine; wir sind keine grausamen Richter, heute aber ist ein Tag der Rechenschaft. Heute vor einem Jahre rechneten die Völker mit einander; es ist dir für dein Gericht ein sehr heiliger Tag anberaumt; geh in dich, lies den letzten Willen Sanseaus, und füge hinzu, was du verschuldet hast.« – »O mein Herr«, rief Dumoulin aus, »das will ich, das will ich! verlassen Sie mich, gönnen Sie mir einige Stunden Zeit, ich will Ihnen alles niederschreiben, was ich weiß.« – Da gab ihm Frenel das Testament, und sie ließen ihn allein.