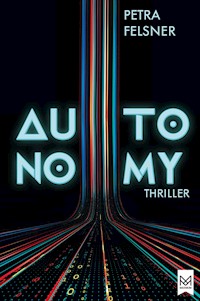
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Nora Achtziger
- Sprache: Deutsch
HAST DU DIE KONTROLLE? "Ich starrte meinen Bildschirm an. Immer wieder FlexDrive. Hatte wirklich niemand die übergreifende Verbindung hinter all diesen tödlichen Crashs gesehen? Das konnte doch kein Zufall sein." München, 2037: Die 16-jährige Nora kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat es geschafft, einen Praktikumsplatz beim Milliardenunternehmen AutoDat zu erlangen. AutoDat kümmert sich um die selbstlernenden Algorithmen für das autonome Fahren des Sub-Unternehmens FlexDrive, das inzwischen die Straßen beherrscht. Als begabte Hackerin arbeitet sich Nora schnell ein. Zusammen mit Cole, dem smarten und arroganten Sohn des Londoner Chefs von FlexDrive, gerät Nora in ein Komplott, das weit größere Ausmaße hat, als sie sich zu Beginn ihrer heimlichen Ermittlungen ausmalen können. Gemeinsam stoßen sie auf einen Algorithmus, den es so nicht geben dürfte. Ist er der Grund für die mysteriösen Unfälle? Ehe sich's Nora versieht, ist sie einer riesigen Verschwörung auf der Spur – und wird selbst zum Ziel … In einer Welt, in der Daten Macht bedeuten, ist jedes Mittel recht, um die Kontrolle zu behalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra Felsner
AUTONOMY
Thriller
Über das Buch
Sie lenken dich.
„Ich starrte meinen Bildschirm an. Immer wieder FlexDrive. Hatte wirklich niemand die übergreifende Verbindung hinter all diesen tödlichen Crashs gesehen? Das konnte doch kein Zufall sein.“
München, 2037: Die 16-jährige Nora kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat es geschafft, einen Praktikumsplatz beim Milliardenunternehmen AutoDat zu erlangen. AutoDat kümmert sich um die selbstlernenden Algorithmen für das autonome Fahren des Sub-Unternehmens FlexDrive, das inzwischen die Straßen beherrscht.
Als begabte Hackerin arbeitet sich Nora schnell ein. Gemeinsam mit Cole, dem smarten und arroganten Sohn des Londoner Chefs von FlexDrive, gerät Nora in ein Komplott, das weit größere Ausmaße hat, als sie sich zu Beginn ihrer heimlichen Ermittlungen ausmalen können. Gemeinsam stoßen sie auf einen Algorithmus, den es so nicht geben dürfte. Ist er der Grund für die mysteriösen Unfälle?
Ehe sich’s Nora versieht, ist sie einer riesigen Verschwörung auf der Spur – und wird selbst zum Ziel …
In einer Welt, in der Daten Macht bedeuten, ist jedes Mittel recht, um die Kontrolle zu behalten.
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Copyright © 2023 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2023
Lektorat: Diana Schaumlöffel
Korrektorat: Angelika Wiedmaier
Layout: Alin Mattfeldt
Covergestaltung: Alin Mattfeldt
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: Booksfactory
Made in Germany
ISBN 978-3-948346-96-6
Inhalt
Über das Buch
Impressum
Widmung
Anmerkung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Epilog
Chat-Begriffe
Danksagung
Die Autorin Petra Felsner
Weitere Jugendthriller im Verlag
Und so geht es weiter
Widmung
Für Jo, Ines und Micha, die das Buch Kapitel für Kapitel bei seiner Entstehung begleitet haben.
Anmerkung
Die Erklärung der Chat-Abkürzungen befinden sich am Ende des Buches
Prolog
München-Schwabing, Montag, der 27.07.2037, 8:30 Uhr
Sie hatte den letzten Tropfen Kaffee getrunken und stellte gerade die Tasse in das Spülbecken, als sie das leichte Vibrieren am Handgelenk spürte, das die Ankunft ihres Lifts ankündigte. Leider war der Selbstreinigungsmodus ihrer Küche immer noch nicht in Ordnung, und sie musste entweder ihr Frühstücksgeschirr stehen lassen, was ihr allerdings aus Hygienegründen widerstrebte, oder sie würde zu spät zu ihrem Geschäftstermin kommen. Also lieber eine unaufgeräumte Küche in Kauf nehmen. Das war wirklich ungemein lästig. Vermutlich war das Problem nur ein Software-Update. Dennoch hatte sie nun schon zwei Tage lang der Firma Easy Home hinterhertelefonieren müssen, die das Problem bisher nicht lösen konnte. Zwei Tage lang Geschirr spülen und Küche reinigen. Dinge, für die sie als erfolgreiche Managerin bei einer weltweit agierenden IT-Firma nicht wirklich Zeit hatte. Eine Erinnerung schoss ihr durch den Kopf, und fast musste sie trotz des Ärgers grinsen. Gestern hatte sie in einem Newsflash gesehen, dass es eine neue internationale Bewegung namens NoElectronics gab, deren Mitglieder erklärt hatten, vollkommen ohne elektronische Geräte leben zu wollen. Absoluter Unsinn, und für sie unvorstellbar. Sie selbst konnte sich Elektronik nicht mehr aus ihrem Leben wegdenken. Weder in ihrem Beruf noch im Privatleben. Kein Arm-Device, oder abgekürzt AD, das sich wie ein hauchdünner Computer vom Handgelenk angefangen an den Großteil ihres Unterarms schmiegte. Das AD plante für sie ihre privaten und beruflichen Termine, sorgte dafür, dass sie sich im Münchner Transportsystem ohne Wartezeiten schnellstmöglich fortbewegen konnte, und kümmerte sich sogar noch um ihre Gesundheit. Einfach grandios, diese elektronischen Helfer. Da konnte man über kleinere Instandhaltungsprobleme hinwegsehen.
Wieder spürte sie das leichte Vibrieren an ihrem Handgelenk. Sie sah auf das Display: Ihr Lift wartete schon. Sie klemmte sich ihre Tasche unter den Arm und rannte die Treppe hinunter. Eine freundliche Stimme flötete aus ihrem Armband: „Melanie, immer mit der Ruhe. Du könntest stürzen. Ich werde deinem Lift Bescheid geben, dass du unterwegs bist.“ Sie hielt kurz inne und atmete tief durch.
Die Haustür öffnete sich wie von Geisterhand, als sie im Erdgeschoss ankam, und direkt vor dem Eingang stand ihr Lift. So wie es aussah, diesmal ein Fahrzeug der neuesten Generation der autonomen Autoflotte von FlexDrive. Ökonomisch von den Ausmaßen her, im Inneren komfortabel eingerichtet und mit der neuesten Elektronik ausgestattet. Sie konnte sich auf dem Weg ins Büro über ihre heutigen Termine informieren oder auch noch eine halbe Stunde zur Entspannung einen Kurzfilm ansehen oder die News des Tages. Manchmal war das Letztere allerdings nicht sehr erbaulich, da Politik selten einen guten Start in den Tag bedeutete. Sie entschied sich dafür, noch kurz die Augen zuzumachen und sich so mental auf einen anstrengenden Tag vorzubereiten. Auf ihr elektronisches Gefährt konnte sie sich verlassen, denn die Unfallrate in München war seit der Einführung der autonomen Fahrzeugflotte drastisch gesunken. Ein fantastisches Ergebnis, wenn man den Medien glauben konnte. Immer weniger Autos wurden hier noch von Menschen gesteuert, denn es war eine Genehmigung notwendig, um von der Stadt München die Erlaubnis für nicht-autonomes Fahren innerhalb der Stadtgrenzen zu bekommen. Das konnte ihr nur recht sein, denn Autofahren gehörte noch nie zu ihren Hobbys. Ihrem Ex-Mann gab schnelles Fahren und eigenständiges Lenken den Kick. Ihr nicht. Ihrer beider Interessen waren nicht nur bei diesem Thema zu unterschiedlich, was wohl letztendlich auch zu ihrer Trennung geführt hatte. Sonja, ihre beste Freundin, hatte ihr empfohlen, eine der Virtual Reality Dating-Plattformen zu nutzen, um wieder jemanden kennenzulernen. Sie sei mit ihren zweiundfünfzig Jahren noch nicht zu alt und auch gesundheitlich eigentlich noch recht fit. Gesundheit, ja. Ein prominentes Thema. Gerade vor ein paar Tagen hatte sie den vorgeschriebenen Gesundheitscheck ihrer Krankenkasse durchführen lassen. Das Ergebnis hatte sie noch nicht erhalten, aber sie hatte sich ja immer gesund ernährt und fühlte sich gut. Dennoch, man wusste nie, was im eigenen Körper vorging, Kontrolle war besser. Außerdem kam die Krankenkasse dafür auf.
Ihr Lift, also das autonome Fahrzeug, in dem sie saß, hatte bereits auf ihre Playlisten zugegriffen, und leise ertönte Musik aus ihrer Jugend. Sie hatte die Augen geschlossen und döste zu den Songs von Ariana Grande vor sich hin.
Sie wusste nicht, wie viel Fahrtzeit vergangen war, als sie plötzlich eine ungewohnte Erschütterung spürte. Sie schlug die Augen auf und sah zu ihrem großen Entsetzen, dass sich das Auto nicht mehr in dem üblichen morgendlichen Verkehr einreihte, sondern im Begriff war, in die Straßenabgrenzung zu krachen.
Es vergingen nur noch Zehntelsekunden, bis ihr Lift die Brüstung der Brücke durchbrach und sie durch den harten Aufschlag auf der Wasseroberfläche die Besinnung verlor. Die automatischen Sicherheitsvorkehrungen des Lifts hatten versagt, und jegliche Rettung kam zu spät, um sie vor dem Ertrinken zu retten, als das Fahrzeug langsam auf den Grund der Isar sank.
1
Life sucks! Oder auf gut Deutsch: Das Leben ist hart. Und meines, das bereits sechzehn lange Jahre währende Leben der Nora Achtziger, ist eins der härtesten.
Eigentlich hatte der heutige Tag mit der Aussicht auf lebensverändernde Umstände begonnen.
Zum einen schien die Sonne, was Ende Juli in München schon mal nicht zwingend der Fall ist. Sommer ist der Name für eine Jahreszeit und steht nicht immer in Korrelation mit gutem Wetter. Zum anderen war heute der erste Tag meines Praktikums bei AutoDat, einer der beiden führenden Firmen im Bereich der Datenmobilität. Zu ihren Subunternehmen zählte unter anderem FlexDrive, das mit seiner autonomen Fahrzeugflotte das Rückgrat des Münchner Transportsystems bildete. Ich hatte mich so richtig auf diesen Tag gefreut, weil der ganze Bereich des autonomen Fahrens auf mich eine Faszination ausübte, die ich nicht erklären konnte.
Hierzu muss man vielleicht noch sagen: Ich bin ein Geek. Ein Computerfreak. Ein Hacker. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Programmieren ist meine Leidenschaft. Algorithmen für autonomes Fahren zu entwickeln, sind mein absoluter Traum. Meine besten Freunde sind mein Laptop und mein AD, das ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen habe. Der einzige Mensch, der mich annähernd versteht, ist mein Informatiklehrer, der mir auch diesen Ferienjob durch seine Connection verschafft hat. Ich liebe ihn! Also nicht im körperlichen Sinne, sondern ich meine damit eher, dass wir wirklich auf einer Wellenlänge sind.
Früher war ich ganz eng mit meiner Nachbarin Lilly befreundet. Wir wohnen im Süden von München in einem Kaff namens Sauerbrunn, und Lilly und ich haben zusammen die ganze Umgegend unsicher gemacht, sind auf Scheunendächer und Bäume geklettert, von dem ein oder anderen Dach oder Baum auch wieder hinuntergefallen, haben Obst aus den Gärten geklaut und den Jungs den Kopf verdreht. Dann ist irgendetwas passiert, und Lilly hing nur noch mit einer anderen Clique und in der Disco ab, und ich vor meinem Computer. Am wohlsten fühle ich mich in den vier Wänden meines Zimmers, das einer skurrilen Mischung aus einem Hightech-Elektronik-Laden und einer Schrotthalde gleicht. Meine Mutter hat kategorisch erklärt, dass sie mein Zimmer nie wieder betreten würde und dass ich auf mich alleine gestellt sei, was die Instandhaltung meines Habitats betrifft. Mein Vater ist eigentlich nur am Arbeiten, von daher hat er eh keine Zeit, sich mit mir oder meinem Zimmer näher zu beschäftigen, und meinen vier jüngeren Geschwistern habe ich kategorisch und unter Androhung drakonischer Strafen den Zutritt zu meinem Reich verboten.
Die einzige Gefahr droht somit vonseiten der Achtziger-Oma, denn sie ist das verrückteste Mitglied der gesamten Achtziger-Familie und stellt sogar mich in den Schatten. Mit ihren zweiundachtzig Jahren ist sie noch ungemein rüstig und hat vor Kurzem ihr großes Interesse an Computern entdeckt. Man muss sich mal vorstellen, dass sie letzte Woche, während ich in der Schule war, Dungeons & Dragons auf meinem Laptop installiert hat. Das Spiel, ich glaube, es hat wirklich schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, hatte sie von einem ihrer Stammtischfreunde empfohlen bekommen, seines Zeichens auch Rentner und in der gleichen Altersklasse. Als ich heimkam, war sie gerade am Ende des zweiten Levels angekommen und so in das Spiel vertieft, dass sie mich fast mit ihrem Joghurtlöffel erschlagen hätte, weil sie mich für den Dunkelelfen hielt, der ihr einen Beutel Gold entwendet hatte.
Nur mit der Hilfe meiner Mutter und einer Ladung hervorragend duftender Pfannkuchen konnte ich mein Zimmer evakuieren, meinen Computer zurückerobern und die Achtziger-Oma wieder in die reale Welt befördern.
Zurück zum heutigen Tag und dazu, wie er nach einem vielversprechenden Start so enttäuschend verlaufen konnte. Der Downturn begann schon beim Frühstück. Meine Geschwister schliefen noch, was in Anbetracht des Beginns der Sommerferien auch durchaus berechtigt war, und mein Vater war bereits in der Arbeit. Meine Großmutter wippte vergnügt auf ihrem Stuhl zu einem Metallica-Song, den man trotz ihrer Kopfhörer vermutlich bis zu den Friesischen Inseln hören konnte. Meine Mutter schnippelte Obst für unser Müsli.
„Nora, hast du eigentlich schon einmal etwas von NoElectronics gehört?“
„Ne, keine Ahnung“, grummelte ich meine Mutter an. Ich hatte nicht besonders gut geschlafen und fühlte mich viel zu matschig, um einen guten Eindruck bei meinem neuen Chef und den Arbeitskollegen zu machen.
„Ich habe überlegt, ob wir uns dieser Bewegung nicht vielleicht anschließen sollten.“
Ich horchte auf. Es klang so, als würde diese Bewegung möglicherweise eine Beeinträchtigung meines Daseins bedeuten. Jetzt hieß es: aufgepasst.
„NoElectronics-Anhänger verzichten auf alle elektronischen Geräte.“
Oje. Downward Spiral!
„Dein Vater und ich wollten heute mal mit dem Verzicht auf das Auto anfangen. Es macht dir doch nichts aus, mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu fahren?“
„Prima“, die Achtziger-Oma sah hellauf begeistert aus, „da mache ich auch mit. Das ist ja wie früher, als es noch keine Kühlschränke gab.“ Als ob meine Oma das wirklich erlebt hätte. Sie wusste doch gar nicht, von was sie sprach.
„Oma, wie willst du denn dann Dungeons & Dragons spielen?“, fragte ich sie und dachte, dass ich ein solides Argument gegen NoElectronics gefunden hatte.
„Der Huber hat vorgeschlagen, dass wir ab jetzt zu Rollenspielen übergehen. Das macht mehr Spaß, meint er.“
Für einen kurzen Moment hatte ich einen Flash, in dem ich meine Oma in mittelalterlichen Klamotten durch den Wald springen und mit einer Armbrust auf harmlose Spaziergänger und Hundehalter zielen sah. Ungläubig musste ich blinzeln.
Nicht, dass ich daran zweifeln würde, dass die Achtziger-Oma dazu imstande wäre. Ich war mir nur nicht im Klaren darüber, wie die örtliche Polizei mit der Tatsache umgehen würde, dass eine Horde rüstiger Rentner den Sauerbrunner Forst in ein Eldorado für Mittelalter-Rollenspiele verwandeln wollte.
Aber jedes Problem zu seiner Zeit. Zunächst einmal musste ich dafür sorgen, mich rechtzeitig bei meiner Praktikumsstelle einzufinden. Ich wollte ja nicht gleich am ersten Tag zu spät kommen. Das käme sicher nicht gut an.
Ich verabschiedete mich schnell von meiner Mutter und der Achtziger-Oma und schnappte mir in der Diele meinen Rucksack inklusive Laptop sowie meine Jacke mit den in der Kapuze eingebauten Kopfhörern. Bei dem Wetter heute hätte ich beim besten Willen keine Jacke gebraucht, aber ich wollte vermeiden, dass meine Eltern sie in ihrem NoElectronics-Wahn vielleicht einer gemeinnützigen Organisation spenden würden – sie enthielt schließlich Elektronik. Also band ich sie mir sicherheitshalber um die Hüften. Dann schwang ich mich auf mein nicht mehr ganz taufrisches Fahrrad, um den Zug Richtung Stadtmitte zu erwischen.
Die meisten meiner Mitschüler, die auch im Münchner Umland lebten, hatten Jahreskarten für die autonomen Autos von FlexDrive. Da meine Eltern im letzten Jahr einiges an unserem Haus reparieren lassen mussten und wir darüber hinaus fünf Kinder waren, die Nahrung, Kleidung und Schulsachen brauchten, saß bei uns das Geld nicht ganz so locker. So kam es, dass ich immer noch auf mein Fahrrad angewiesen war oder auf unseren alten VW, der mit einem autonomen Fahrzeug so viel gemeinsam hatte wie eine Kerze mit einer LED-Lampe. Und natürlich auch auf einen Fahrer, denn Geld für meinen eigenen Führerschein musste ich mir erst noch verdienen. Und wenn man dem allgemeinen Trend folgte, war es sowieso fraglich, ob man überhaupt noch einen Führerschein brauchte.
Auf dem Weg in die Stadt bat ich mein AD, mir ein Zugticket zu besorgen und mir den schnellsten Weg zum Bürogebäude von AutoDat in die Kopfhörer zu spielen. Für jeden, der sich wundert, warum ich mein AD höflich bitte: Ich weiß, dass es sich nur um ein Stück Elektronik handelt, aber ich fühle mich einfach besser, wenn ich zuvorkommend mit den Sprachassistenten meiner Geräte umgehe. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass irgendwann unsere elektronischen Geräte intelligenter sind als die Menschheit und die Kontrolle über die Erde übernehmen werden. Ist es dann nicht vorteilhaft, wenn man sich provisorisch auf diese Eventualität vorbereitet und sich mit ihnen gut gestellt hat?
Eigentlich hatte ich genügend Zeit eingeplant, um wie vereinbart pünktlich um neun Uhr bei AutoDat einzutreffen. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, waren ein riesiger Auflauf von Polizei, Feuerwehr und eine undurchdringliche Menschenmenge auf der Corneliusbrücke, die ich, um mein Ziel zu erreichen, noch überqueren musste. Also retour und über die nächste Brücke, was mich trotz Laufschritts wertvolle fünfzehn Minuten kostete. Die letzten hundert Meter legte ich in Rekordzeit hin, und nur knappe fünf Minuten zu spät hechtete ich schweißgebadet in die großzügige und mit Marmorfliesen ausgelegte Eingangshalle des modernen, achtstöckigen Bürogebäudes der Münchner AutoDat-Filiale.
Hinter einem eleganten Empfangstresen sah mich ein älterer, bebrillter Pförtner verwundert und etwas mitleidig an. Völlig außer Atem schilderte ich ihm, warum ich hier war und dass ich mich bei Herrn Käfer von der Qualitätsabteilung melden sollte. Nur Sekunden später stand ich, einen Gästeausweis für den Zugang zum AutoDat-Bürogebäude in der Hand, in einem von drei gläsernen Wänden umgebenen Aufzug, der an der Außenwand des Gebäudes nach oben rauschen und mich im sechsten Stock abladen sollte. Wäre ich nicht so nervös gewesen, dann hätte ich sicher die Aussicht genießen können. So konzentrierte ich mich eher auf mein Aussehen in der verspiegelten Aufzugtür. Jeans, weiße Bluse und meine saubersten Sneakers. Passabel! Meine dunkelbraunen langen Haare hatte ich zu einem einigermaßen ordentlichen Pferdeschwanz gebunden. Ich gehörte nicht zu den Mädchen, die sich gerne schminken und aufstylen, aber was ich sah, stellte mich zufrieden. Der Aufzug gab ein dezentes Klingeln von sich, und die Tür schob sich zur Seite.
Ich hüpfte über die Schwelle und wollte eben um die nächste Ecke biegen, als mein Vorwärtsdrang jäh von einer Tasse Kaffee abgebremst wurde, deren Inhalt sich über meine weiße Bluse, Jeans und Sneakers ergoss.
„O nein! Verdammt!“, entfuhr es mir. „Warum muss so etwas immer nur mir passieren?“ Das konnte doch einfach nicht wahr sein.
Ich sah von mir und meinen kaffeegetränkten Klamotten hin zu der Kaffeetasse und demjenigen, der an ihrem Henkel hing: Etwa ein Meter neunzig, schlank, braune kurze Haare, Dreitagebart, auf den ersten Blick ungemein gut aussehend. Mein Mund stand offen, und mein Gehirn ging auf Stand-by-Modus.
„O Mann, Girlie, kannst du nicht aufpassen? Du kannst von Glück reden, wenn mein Anzug keine Flecken abbekommen hat. Die Reinigung ist nicht günstig. Der ist von Boss.“ Er hatte eine dunkle angenehme Stimme mit einem deutlichen englischen Akzent.
Langsam nahm ich auch den Inhalt seiner Worte in mich auf.
„Äh, Augenblick. Du …“ Ich verbesserte mich schnell, obwohl er höchstens ein paar Jahre älter war als ich. „… Sie sind mit Ihrer Tasse genauso schnell um die Ecke gebogen wie ich.“ Aus dem Augenwinkel suchte ich seine Klamotten nach Flecken ab.
„Und es sieht nicht so aus, als hätten Sie auch nur einen Spritzer abgekriegt. Ich sehe allerdings aus, als hätte ich in Ihrem Kaffee gebadet.“ Ich deutete auf den riesigen braunen Fleck auf meiner vormals weißen Bluse.
„Na, dann pass nächstes Mal einfach besser auf. Außerdem denke ich nicht, dass deine Kleidung sehr hochwertig ist.“ Abschätzig musterte er mich von Kopf bis Fuß. „Ach, und bring diese Tasse Cindy.“
Er drückte mir die leere Tasse in die Hand und ging einfach an mir vorbei, ohne mich auch nur eines weiteren Blickes zu würdigen.
Völlig verdutzt stand ich da, im wahrsten Sinne des Wortes wie ein begossener Pudel, und versuchte meine Sprache wieder zu finden.
„Was für ein arrogantes Ekel“, brach es aus mir heraus.
„Da hast du wirklich recht“, ertönte eine helle Stimme aus der Richtung, die ich ursprünglich eingeschlagen hatte.
„Ich bin Cindy, die Sekretärin von Herrn Käfer.“
Eine etwa dreißigjährige, kleine, dafür aber sehr runde Frau kugelte auf mich zu.
„Die, der du die Kaffeetasse geben sollst.“ Sie grinste.
„Du bist Nora, oder? Unseren guten Cole hast du ja schon kennengelernt, wie ich eben gesehen habe. Er ist der Sohn des Londoner Chefs unserer FlexDrive-Gruppe, und bringt gerade die DA, also unsere Data-Analytics-Abteilung im siebten Stock, zur Verzweiflung. Zum Kaffeetrinken kommt er immer zu uns, weil er behauptet, unser Kaffee würde besser schmecken. Wenn du mich fragst, völliger Blödsinn, denn wir haben auf jedem Stockwerk die gleichen Maschinen.“ Sie schnappte kurz nach Luft. „Das war leider nicht der Empfang, den du, denke ich, erwartet hast. Komm doch erst mal mit in die Kaffeeküche, damit wir dich zumindest ein bisschen wiederherstellen können. Danach bring ich dich zu Herrn Käfer.“
Cindy schleppte mich in die Küche und bemühte sich redlich, die Kaffeeflecken zumindest von meiner Jeans und den Schuhen zu entfernen. Dabei plapperte sie munter immer weiter, und so erfuhr ich, dass sie schon fünf Jahre bei AutoDat war. Also quasi fast seit der Firmengründung. Eine prima Gelegenheit, etwas über das Unternehmen zu lernen, also unterbrach ich sie auch nicht.
„Herr Käfer ist erst mein zweiter Chef hier. Und ich arbeite seit zwei Jahren für ihn. Vorher war ich bei Legal, also unserer Patent- und Rechtsabteilung. Der Käfer ist sehr korrekt und manchmal ein bisschen steif, aber das sind wohl Voraussetzungen für den Leiter einer Qualitätsabteilung.“ Cindy lächelte mich strahlend an und begutachtete das Ergebnis ihrer Reinigungsversuche.
„Besser geht’s, glaube ich, nicht“, konstatierte sie schließlich.
Ich sah an mir hinunter. Die Schuhe und Jeans sahen wieder ziemlich okay aus. Die Bluse war für den heutigen Tag wirklich nicht mehr zu retten, aber das war klar gewesen.
„Um den Fleck auf der Bluse zu verdecken, bekommst du von mir ein Tuch. Ich habe eins in meinem Cube.“
Und schon zog mich Cindy aus der Küche, die ich jetzt schon recht gut kannte, und in den Bürobereich hinein, den ich erst mal mit Staunen betrachtete.
Das Büro der Qualitätsabteilung nahm etwa die Hälfte des sechsten Stockwerks ein. Im hinteren Bereich befanden sich zwei Räume. Bei einem war die Tür geschlossen – vermutlich das Büro von Herrn Käfer, dem Chef. Bei dem zweiten Raum stand die Tür weit offen, und ich konnte einen langen Tisch erkennen, der von Stühlen gesäumt war. Ein Besprechungsraum. Das restliche Büro sah wirklich genial aus und war ein, wie ich von Cindy lernte, Großraumbüro mit einzelnen Cubicles, auch Cubes genannt, die für die Mitarbeiter bestimmt waren. Das coolste war eine supergemütliche Sitzecke mit kunterbunten Sofas, Sesseln und kleinen Beistelltischchen, die an drei Seiten von riesigen Bildschirmen umgeben war, auf denen verschiedene Sendungen oder Filme zu sehen waren.
Cindy zeigte auf die Bildschirme. „Auf jedem der Screens laufen parallel drei verschiedene Programme oder Filme. Je nachdem aus welcher Richtung du auf den Screen siehst, kannst du dich für eines der Programme entscheiden. Und alle Mitarbeiter haben Kopfhörer, über die wir den Ton auswählen können. Das ist wirklich super für die Pausen.“
Und dann fügte sie hinzu: „Und wenn du mal keine Lust hast, in deinem Cube zu arbeiten, dann kannst du deine eigenen Programme oder Arbeitsmaterialien auch über die großen Screens laufen lassen. Wobei, eigentlich ist das selten notwendig, denn unsere Cubes sind quasi Screens für sich und ziemlich modern.“
Mit diesem Worten führte sie mich in das nächst gelegene Cubicle. Cubicles kenne ich schon lange, denn in jedem amerikanischen Film sieht man sie immer, wenn Büroszenen vorkommen. Rechteckige, enge Schachteln mit circa einen Meter vierzig hohen Seitenwänden, in denen jeweils ein Mitarbeiter vor seinem Computer sitzt. Das sah für mich immer eher nach Massentierhaltung aus. Die Cubes hier waren damit gar nicht zu vergleichen, sondern richtig klasse.
Cindys Cube bestand aus bestimmt einen Meter achtzig hohen Seitenwänden, die eigentlich keine Wände waren, sondern Bildschirme. Auf einem der Bildschirme prangten Strand und Palmen, auf dem zweiten war ein kleines Kind zu sehen, das gerade durch eine Wohnung hüpfte und einer älteren Frau das Leben schwer machte, und auf dem dritten Screen war eine E-Mail und daneben ein geschriebener Text abgebildet. Offensichtlich nutzte Cindy den ersten Screen für Urlaubsfotos, den zweiten, um zu sehen, was ihr Kind trieb, während sie arbeitete, und den dritten Bildschirm für ihre Arbeit. In der Mitte ihres Cubes stand kein Schreibtisch mit Computer drauf, wie ich es erwartet hätte, sondern ein bequemer Stuhl mit integrierter, wegklappbarer Tastatur und einer Hightech-Maus. Das war alles. Na, wenn das nicht der Arbeitsplatz der Zukunft war. Das ließ mich ja fast meinen Kaffeefleck vergessen.
Apropos Kaffeefleck. Cindy zog eine Schublade aus einem modernen Tischchen, das neben dem Stuhl stand, und drückte mir einen Schal in die Hand. Pink. Absolut nicht meine Farbe. Aber in Anbetracht dessen, dass sie mich strahlend anlächelte und es ja wirklich gut mit mir meinte, konnte ich mich kaum darüber beschweren. Mit einem heimlichen Seufzer schlang ich mir das Farbmonster um die Schultern und deckte so gut es ging das unerwünschte bräunliche Muster auf meiner Bluse ab.
Dann brachte mich Cindy zum Chef der Abteilung. Herr Käfer war schätzungsweise so um die vierzig, also ein bisschen jünger als meine Eltern, mittelgroß, kräftig gebaut, mit bereits lichtem Haar über der Stirn, und sah sehr seriös aus. Er trug schwarze Schuhe, eine graue Anzughose und ein definitiv sauberes weißes Hemd. Offensichtlich hatte er heute noch keinen Zusammenstoß mit diesem Cole aus der DA.
Auch sein Büro war … wow! Supermodern und richtig geschmackvoll eingerichtet. Hier ließ es sich wirklich aushalten. Außerdem hatte es Fenster bis zum Boden, die eine wirklich tolle Aussicht über die Dächer der Münchner Altstadt boten. Herr Käfer kam mir entgegen und schüttelte mir freundlich die Hand. Fester Händedruck. Der Mann war mir sympathisch. Allerdings warf er einen etwas verwirrten Blick auf meinen leuchtfarbenen Umhang.
„Nora Achtziger“, stellte ich mich vor. Er nickte.
„Mein Name ist Klaus. Klaus Käfer. Aber bei AutoDat duzen wir uns alle. Dein Informatiklehrer, Josef Bauer, hat in den höchsten Tönen von dir gesprochen. Wir kennen uns schon lange. Josef war mein Student, als ich an der TU am Informatik-Lehrstuhl habilitiert habe. Ich gebe ziemlich viel auf seine Meinung.“
Ich wurde ein bisschen rot, denn ich war es nicht gewohnt, dass sich jemand euphorisch über meine schulischen oder sonstigen Leistungen äußerte.
„Leider habe ich heute wenig Zeit für dich, denn wir haben gerade einen Unfall von unserer FlexDrive-Fahrzeugflotte reinbekommen, zu dem wir mit höchster Priorität den Algorithmus auf Fehlfunktionen untersuchen müssen.“
„Oh. Hat es etwas mit der Polizei und Feuerwehr auf der Corneliusbrücke zu tun? Da war heute früh ein ziemlicher Menschenauflauf“, platzte es aus mir heraus. O nein, erst mal denken, dann sprechen. Ich hatte jetzt vermutlich einen ziemlich neugierigen und sensationslüsternen Eindruck bei ihm hinterlassen.
Sofort zeichnete sich auch eine Falte auf seiner Stirn ab, und er nickte kurz.
„Also, willkommen im Team, Nora. Cindy wird dir die anderen Kollegen vorstellen“, beendete er das Gespräch mit mir. Dann wandte er sich an Cindy: „Cindy, kannst du bitte dafür sorgen, dass Eric Nora einarbeitet und ihr ein paar einfache Test-Algorithmen zum Starten gibt.“
Dann beschäftigte er sich auch schon wieder mit einer hereinkommenden Nachricht auf einem seiner Bildschirme, und Cindy zog mich aus seinem Büro.
Nun ging der Vorstellungsmarathon erst so richtig los. Die Qualitätsabteilung bestand neben Klaus Käfer und Cindy noch aus sieben weiteren Mitarbeitern, wovon sich mehr als die Hälfte um Ausgangskontrolle, also die Algorithmen kümmerte, die neu releast, also neu eingesetzt wurden. Nur zwei Leute waren für die Fehleranalyse von Field Returns, den im Einsatz auftretenden Fehlern, verantwortlich. Eric Miller war einer der beiden Field-Returns-Spezialisten, und – o Jesus! – dem Aussehen nach, ein absoluter Nerd. Er sah mit seinen zerfransten Jeans und der mit verschiedenen Logos bestickten schwarzen Lederjacke aus wie ein Hells-Angels-Rocker. Allerdings fragte ich mich, ob es ein Motorrad gab, das seinen Ausmaßen standhalten würde. Er war nicht groß, dafür fast ebenso breit und in seinem Cube waren etwa zehn Plastikeimer mit verschiedensten Süßigkeiten übereinandergestapelt. Sein Alter war undefinierbar und lag irgendwo zwischen dem meinen und dem von Klaus Käfer. Seine schwarzen Haare hatte er mit einer verspiegelten Sonnenbrille zurückgeschoben und im Nacken zu einem Pferdeschwanz gebunden.
„Hey, Babe!“, tönte es mir mit unverkennbarem amerikanischen Akzent entgegen. „Great, dass ich hier endlich Unterstützung bekomme. Ich arbeite ja schon wie ein Pferd, aber es ist einfach viel zu viel zu tun. Wir sind völlig unterbesetzt.“
„Pferd?“, dachte ich mir, „wohl eher Nilpferd.“ Er sah so schrill aus, dass ich mir ein Lachen verkneifen musste, aber irgendwie war er auf seine ganz eigene Art auch richtig sympathisch. Er kam mir fast vor wie ein Hacker aus einem dieser amerikanischen Blockbuster. Und schon hatte ich seine Patschhand in der meinen und wurde in eine Umarmung gequetscht, dass ich nicht mehr wusste, ob ich ihr, ohne zu ersticken, entkommen konnte. Unsere Zusammenarbeit begann vielversprechend.
Cindy strahlte übers ganze Gesicht und schob mich zu Eric ins Cube. Nicht das neben Eric viel Platz gewesen wäre, aber ich versuchte, mich so schlank wie möglich zu machen.
„Eric ist seit einem Jahr bei uns und hat vorher für AutoDat in Kalifornien programmiert. Er ist einer der Entwickler unserer ersten autonomen Algorithmen. Wir nennen ihn auch The Brain. Er ist ein richtiger Schatz.“ Und damit tätschelte sie seinen Arm, der dem Rüssel eines Elefanten ähnelte.
„Es ist wirklich Wahnsinn, dass so ein intelligenter Typ wie Eric es so lange in der Qualitätsabteilung aushält.“
Eric wurde leicht rosa. „Na bei den Kollegen.“ Dabei sah er Cindy mit einem schmachtenden Blick an.
Aha, wenn da nicht gerade eine gehörige Anzahl an Hormonen zwischen den beiden hin und her flitzten, dann fresse ich einen Besen.
Sollte mir recht sein. Ich war zum Arbeiten hier, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn Eric wirklich Algorithmen für autonomes Fahren entwickelt hatte, dann konnte ich ’ne ganze Menge von ihm lernen, solange ich schlank genug blieb, um mich mit ihm in einem Raum aufzuhalten. Und er war nett. Mit ihm zusammenzuarbeiten, würde sicher viel Spaß machen.
Eric versprach mir, dass er mir für morgen schon einen einfachen Algorithmus aus den aktuellen Returns heraussuchen würde, mit dem ich üben konnte.
Den verbleibenden Tag verbrachte ich damit, noch einige Kollegen kennenzulernen und von jedem einen kurzen Überblick über ihre Aufgabenfelder und aktuellen Themen zu bekommen.
Die technische Datenassistentin hieß Rihanna, und sah aus als hätte sie ihre Karriere als Model knapp verfehlt. Über Mode lässt sich bekanntlich streiten, und ihr Gesicht musste sie abends sicherlich mit einer Spachtel abschminken.
Der zweite Kollege, der sich neben Eric um die Returns kümmerte, hieß Ronald. Er war mir auf den ersten Blick unsympathisch, aber ich konnte nicht wirklich herausfinden, woran es lag. Ronald war Ende zwanzig, hatte blonde gegelte Haare und stechende stahlblaue Augen, die ein wenig zu nahe beieinanderstanden, um gut auszusehen. Er erinnerte mich an einen Hai im Anzug, denn neben Klaus Käfer war er der Einzige im Team, der businesslike gekleidet war. Okay, er fühlte sich vermutlich als der Nächste in der Reihe, um den Chefposten zu übernehmen. Da war mir Rocker Eric doch deutlich lieber, und ich dankte Gott für diese kleine Gabe, ihn als Betreuer und Ansprechpartner zugewiesen bekommen zu haben.
Der Nachmittag verging wie im Flug. Fast hätte ich den Tag trotz der Kaffee-Misere als Erfolg gewertet, wenn ich nicht auf dem Heimweg im gleichen Zugabteil wie Lilly und ihre Clique gesessen hätte, die mich zunächst wie Luft behandelten. Das konnte mir eigentlich egal sein.
Als ich aber dann Gesprächsfetzen wie „Nerd“, „… und du warst wirklich mal mit der befreundet …“ aufschnappte, traf es mich schon. Denn eigentlich hatte ich mich mit Lilly früher wirklich gut verstanden, und wir waren zusammengehangen wie Pech und Schwefel. Während sie sich aber vor einem Jahr ihren meiner Meinung nach sehr oberflächlichen neuen Freunden zugewandt hatte, war ich meinem Frust erlegen und hatte mich verkrochen. Wie bereits erwähnt: Life sucks!
2
Ich schlug die Augen auf.
Heute war mein zweiter Tag bei AutoDat. Der heutige Tag konnte eigentlich nur besser laufen als der gestrige. Diesen Gedanken hegte ich genau bis zu dem Zeitpunkt, als ich meine Mutter und Oma beim gemeinsamen Frühstück antraf, oder vielmehr bei dem Versuch, ein Frühstück herzurichten, und zwar ohne Verwendung elektronischer Geräte. Dass ich mit dem Fahrrad zum Bahnhof würde fahren müssen, war mir eh klar gewesen und konnte mich nicht weiter erschüttern.
Eben wollte ich noch mit ziemlich vom Schlaf verklebten Augen meine Kaffeetasse unter unseren Kaffeeautomaten stellen, als meine Oma sie mir aus der Hand riss. Verdattert sah ich sie an und blinzelte.
„Die Kaffeemaschine kannst du nicht verwenden“, krächzte sie. „Wir sind doch jetzt voll bei Notorisch dabei.“
„NoElectronics“, verbesserte meine Mutter sie.
„Na, auch egal. Also deinen Kaffee übergießt du mit kochendem Wasser und seihst ihn dann mit dem Handsieb ab.“ Ungläubig starrte ich sie an.
„Und wie komme ich an das kochende Wasser? Unser Herd hat doch auch zig elektronische Funktionen, wie zum Beispiel Selbstreinigung und Programmierung der einzelnen Kochplatten.“
„Oh. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ach ja, ich hab’s. Wir zünden draußen ein Feuer an und hängen einen Kessel mit Wasser drüber. In null Komma nix haben wir kochendes Wasser.“ Die Achtziger-Oma strahlte mich siegesbewusst an.
Fassungslos stand ich da – der Kaffeevollautomat so nahe, aber dennoch unerreichbar.
„Wisst ihr was? Ich habe es eh ein bisschen eilig heute, ins Büro zu kommen. Ich bin ja neu dort und will einen guten Eindruck machen. Ich trinke dann meinen Kaffee dort.“
Ich drückte beiden einen Kuss auf die Wange, krallte mir meinen Rucksack und machte mich auf den Weg. Als meine Oma mir noch hinterherrief, dass sie für heute Nachmittag mit ihren Stammtischrentnern das erste Fantasie-Rollenspiel geplant hätte und wann ich denn in etwa heimkommen würde, dachte ich nur noch: „Nichts wie weg!“
Auf dem Weg in die Stadt ging mir der gestrige Unfall durch den Kopf. Eine Frau war ertrunken, als ihr Lift auf der Corneliusbrücke durch die Brüstung gebrochen und in die Isar gestürzt war. Es musste alles so plötzlich passiert sein, dass sie sich nicht selbst befreien konnte, und die Rettungskräfte waren zu spät zum Unfallort gekommen, um sie noch lebend zu bergen. Als ich es in den News gesehen hatte, konnte ich es fast nicht glauben, weil die Mauer der Brücke so richtig massiv aussah. Die Frau tat mir sehr leid. Es musste schlimm sein, in einem Fahrzeug ins Wasser zu fallen und dann darin gefangen zu sein, bis einem langsam die Luft ausging. Aber vielleicht war sie ja gar nicht bei Bewusstsein gewesen. Auf jeden Fall – schrecklich, sich das auch nur auszumalen.
In den letzten Monaten hatte es ein paar Unfälle in München gegeben, in die autonome Fahrzeuge von FlexDrive verwickelt waren. Erst im Mai war eines der FlexDrive-Autos mit einem achtundfünfzigjährigen Fahrgast gegen einen vor ihm fahrenden Lastwagen geprallt. Der Mann war kurze Zeit später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Ich war in den News darauf aufmerksam geworden, weil ich gerade erst meinen Praktikumsvertrag bei AutoDat unterschrieben hatte. FlexDrive, das Subunternehmen von AutoDat, hatte seinen Hauptsitz in London – wo auch dieser dämliche Cole mit seiner noch dämlicheren Kaffeetasse herkam. Wobei, die Kaffeetasse konnte ja eigentlich nichts dafür und stammte vermutlich auch nicht aus London.
FlexDrive hatte die Marktführung im Bereich der autonomen Fahrzeuge im urbanen Bereich und nutzte zu hundert Prozent die Programm-Algorithmen von AutoDat. Das Geschäftsmodell von FlexDrive war MaaS, also Mobility-as-a-Service, und beinhaltete somit auch Robo-Taxis, eigenständig fahrende Taxis ohne Fahrer.
Trotz dieser beiden wirklich schrecklichen Unfälle war ich überzeugt, dass autonomes Fahren eine der faszinierendsten Erfindungen des 21. Jahrhunderts war. In den letzten zehn Jahren hatte sich hier so viel getan, und selbst wenn es gelegentlich zu Unfällen mit den Lifts kam, es war kein Vergleich zu früher. Noch vor zwanzig Jahren gab es über dreitausend Verkehrstote in Deutschland pro Jahr und fast vierhunderttausend Verletzte. Kaum vorstellbar. Nach neuesten Statistiken war die Zahl der Verkehrsunfälle seitdem um circa dreißig Prozent zurückgegangen. Und in einer Studie hatte ich gelesen, dass bis 2050 sogar ein Rückgang von fünfzig Prozent erreicht werden könnte. Das war wirklich eine der Innovationen, bei der ich mich engagieren wollte. Dann kam mir wieder die NoElectronics-Bewegung in den Sinn, und ich schüttelte unwillkürlich den Kopf. Die wollten wirklich in die Steinzeit zurück. Zugegeben, nicht alle technischen Errungenschaften waren gut für die Menschheit, aber komplett auf Elektronik zu verzichten, war ja ein absoluter Blödsinn und würde sich nie durchsetzen.
Ich sinnierte ein wenig vor mich hin und hätte fast verpasst, rechtzeitig aus der Bahn auszusteigen. Doch heute lief alles glatt, und ich stand um Viertel vor neun in der Eingangshalle von AutoDat. Der Pförtner hatte sogar einen Mitarbeiterausweis für mich bereitliegen, mit dem ich für die nächsten Wochen Zutritt zum Aufzug und den Büros bekam. Das hatte Cindy gestern noch alles für mich organisiert.
Stolz stieg ich in den Aufzug, sah aber zu meinem Entsetzen, dass schon jemand drinstand. Und zwar Cole.
Ich stammelte ein zögerliches „Guten Morgen“.
„Na, noch ganz saubere Klamotten heute?“
„Äh, ja, klar. Ich bin ja heute noch mit niemanden zusammengestoßen, der seine Kollegen mit Kaffee übergießt.“ Und um von dem gestrigen Missgeschick abzulenken, fügte ich hinzu: „Du kommst von unten? Was ist denn im Untergeschoss?“
„Na die Garage, für diejenigen die noch mit dem eigenen Auto in die Stadt kommen. Ich habe da unten meinen Ferrari geparkt. Den habe ich aus London mitgebracht. Ist quasi ein Oldtimer und hat noch nen richtigen Verbrennungsmotor. Vielleicht nehme ich dich ja mal auf ’ne Spritztour mit. Du glaubst nicht, was der für einen Sound hat.“ Er musterte mich kurz von oben bis unten. „Dafür musst du dich aber ein bisschen schicker anziehen.“
Uhhh. Nein danke. Was für ein Angeber. Dieses hochnäsige Getue war ja unerträglich. Sehr schade eigentlich, denn vom Aussehen her war er wirklich mein Typ. Nervös kontrollierte ich die Nummern der Stockwerke, die an uns vorbeiflitzten.
„Ich muss jetzt raus. Sechster Stock. Bis demnächst dann.“
Und schon katapultierte ich mich so schnell wie möglich aus dem Aufzug, um auch nur keine Minute länger neben diesem Londoner Schnösel zu stehen.
Als die Türen des Aufzugs sich wieder geschlossen hatten, drehte ich mich kurz zu der verspiegelten Fläche um. Wieso sollte ich mich schicker anziehen? Ich trug meinen schwarzen Rock, der bis knapp über die Knie ging, und schwarze Sandalen. Schwarz ist wirklich meine Farbe. Damit kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Allerdings beschwerte sich meine Mutter immer, wenn ich nur Schwarz und Grau trug. Meist mit den Worten: „Gehst du denn zu einer Beerdigung?“ Daher hatte ich meine schwarzen Klamotten mit einer beigen Kurzarmbluse kombiniert. Dann noch meine Haare gut gekämmt und ein bisschen Kajal um die Augen. Natürlich nicht zu viel, damit ich nicht gothic-like rüberkam.
Ich riss mich zusammen. Warum zweifelte ich an mir wegen eines Kommentars dieses Typen? Der Kerl interessierte mich doch überhaupt nicht, und zum großen Glück arbeitete er ja auch nicht in der Qualitätsabteilung. Ich würde ihn also nur selten sehen. Und er hatte sicher einen Münchner Fanclub, der Schlange stand, um in seinem Ferrari mitzufahren. Ein Gedanke zuckte durch meinen Kopf: Wie war er überhaupt an die Fahrerlaubnis für München herangekommen? Sein Ferrari war schließlich ein Verbrenner-Fahrezug. Ich hatte gehört, dass das extrem schwierig war. Natürlich gab es Ausnahmegenehmigungen, aber eine Erlaubnis für Spritztouren mit einem Ferrari zu bekommen, war mehr als außerhalb der Norm. Vielleicht hatte er auch nur angegeben, und in der Garage stand gar kein Ferrari. Das konnte ich ja ziemlich leicht in einer meiner Pausen überprüfen. Ihm auf den Kopf zuzusagen, dass er ein Aufschneider sei, würde mir eine gewisse Genugtuung geben, und er würde in Zukunft seine blöden Kommentare für sich behalten.
Nun wieder gut gelaunt und mit dieser Idee schwanger startete ich meinen ersten richtigen Arbeitstag bei AutoDat.
Die Zusammenarbeit mit Eric lief richtig gut und noch viel besser als ich erwartet hatte. Eric sah schnell, dass ich wirklich eine Leidenschaft fürs Programmieren mitbrachte und erklärte mir zunächst wichtige Details zu den einfacheren Algorithmen.
Es kam sehr viel auf AI, also Artificial Intelligence, an. Auf Deutsch: künstliche Intelligenz. Die Programmierer nutzten selbst lernende Algorithmen, die durch praktische Übung stetig besser wurden. Bei AutoDat und FlexDrive wurden viele komplexe Verkehrssituationen eingeübt, um sicherzustellen, dass die Steuer-Algorithmen diese Situationen in Zukunft erkennen konnten und die autonomen Fahrzeuge dementsprechend richtig reagieren würden.
Bei den Returns, also wenn es zu Fehlern während des Betriebs der autonomen Fahrzeuge kam, musste AutoDat herausfinden, warum der jeweilige Algorithmus das Fahrzeug falsch geleitet hatte.
Eric gab mir einen einfachen Fall, bei dem es darum ging, warum einer der FlexDrive-Lifts letzte Woche beim Einparken einen Begrenzungspfosten leicht gestreift hatte. Von Cindy hatte ich auch ein eigenes Cubicle zugewiesen bekommen, gleich neben dem von Eric, in dem ich den Algorithmus und die Computersimulation der Verkehrssituation auf den Bildschirmen parallel bearbeiten konnte. Ich war nach kurzer Zeit schon derart in den Algorithmus vertieft, dass ich fast das Mittagessen verpasst hätte, wäre Cindy nicht irgendwann neben mir gestanden, um mich zu fragen, ob ich mit ihr und Eric zum Pizza-essen gehen wolle.
Ich freute mich, dass sie an mich gedacht hatten, und spürte jetzt auch ein leichtes Grummeln in der Magengegend. Also schnappte ich meinen Rucksack, und wir verließen gemeinsam das Büro. Vor dem Aufzug überlegte ich kurz, ob es ratsam war, zusammen mit den beiden vollschlanken Kollegen einzusteigen oder ob ich vielleicht doch die Treppe nehmen sollte. Nachdem ich allerdings am Morgen eine Aufzugfahrt mit dem ziemlich ausladenden Ego von Cole überstanden hatte, konnte mich eigentlich nichts mehr schrecken. Ich presste mich zu Cindy und Eric in die Kabine, hielt die Luft an und dankte meinem Schicksal, dass der moderne Aufzug die sechs Stockwerke schnell bewältigte. Im Erdgeschoss angekommen, atmete ich tief aus.
AutoDat hatte auch eine kleine Cafeteria im Erdgeschoss des Gebäudes, die schon zum Bersten voll mit Mitarbeitern aus den verschiedenen Abteilungen war. Das Unternehmen war erfolgreich und hatte in den letzten Jahren die Mitarbeiterzahl deutlich erhöht. Die Cafeteria war dem nicht mehr gewachsen und hätte dringend vergrößert werden müssen. Cindy erklärte mir, während wir auf den Ausgang zusteuerten, dass sich im zweiten Stock des Gebäudes auch ein kleines Schwimmbad und ein Fitnessraum befänden, die ich jederzeit während meiner Pausen nutzen könnte. Das war wirklich toll, denn ich liebte es, Schwimmen zu gehen, und ich beschloss auch gleich morgen meine Badesachen mitzubringen, um den Pool zu testen. Fitnessstudios mied ich wie die Pest. Die waren nicht so mein Ding.
Nachdem das Wetter auch heute noch wunderbar sonnig und warm war – offensichtlich dauerte der Münchner Sommer dieses Jahr doch länger als zwei Tage an, was eine positive Überraschung war – setzten wir uns unter einen großen Sonnenschirm auf der Terrasse einer kleinen Pizzeria, die zwei Straßen vom AutoDat-Gebäude entfernt lag.
Ich war in Hochstimmung. Ich saß mit zwei sehr netten Kollegen bei Sonnenschein in einem gemütlichen Restaurant, und der Geruch nach Holzofen-Pizza umschmeichelte meine Nase. Außerdem hatte ich eine tolle und interessante Praktikumsstelle, würde ein bisschen Geld verdienen und eine Menge lernen.
Meine Hochstimmung hielt etwa fünf Minuten an, denn dann hörte ich ein kehliges Lachen, das mir bekannt vorkam. Natürlich. Cole saß mit Rihanna an einem der kleineren Tische am anderen Ende der Terrasse. Warum tauchte dieser Typ immer wieder auf? Ich konnte Cole nur von hinten sehen, aber Rihanna hatte ich direkt im Blick. Sie himmelte ihn regelrecht an. Na die beiden hatten sich wirklich gegenseitig verdient. Mir fiel ein, dass ich nach dem Essen noch kurz in der Garage vorbeischauen könnte, um zu sehen, ob es diesen Ferrari auch wirklich gab. Ich schlürfte an meiner eisgekühlten Limonade und fühlte mich schon wieder ein bisschen selbstbewusster. Irgendwie hatte dieser Kerl etwas, was mich reizte, ich konnte es aber nicht so richtig deuten.
Cindy war meinem Blick gefolgt und runzelte die Stirn.
„Das erklärt, warum Cole immer zu uns zum Kaffeetrinken kommt. Die beiden Turteltäubchen passen ja blendend zusammen.“
Ich konnte ihr da nur zustimmen.
„Übrigens ist Cole ab morgen für ein paar Wochen bei uns in der Abteilung, denn es ist mit seinem Vater vereinbart, dass er alle Bereiche der Unternehmensgruppe kennenlernt. Er bekommt das Cubicle neben dir.“
Nur durch absolute Selbstbeherrschung konnte ich gerade noch vermeiden, dass die Limonade, die ich gerade genussvoll durch einen Strohhalm in meinen Mund gesogen hatte, während meines plötzlich auftretenden Hustenanfalls auf dem Shirt von Eric landete. Leider war es für das Glas, das ich in der Hand hielt, zu spät, und es klatschte, in tausend Scherben zerberstend, auf die Fliesen.















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













