
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Nora Achtziger-Reihe
- Sprache: Deutsch
SIE KENNEN DEINE GEDANKEN! Endlich nahmen sie ihm die Augenbinde ab. Sie hatten ihn auf einer Liege festgebunden und er konnte sich kaum einen Millimeter bewegen. Drei Männer waren zu sehen. Alle trugen schwarze Masken. Hatten sie ihn hierhergeschleppt? Soweit er seine Umgebung erkennen konnte, befand er sich in einem Labor. Silicon Valley, 2038: Nach einem aufregenden letzten Jahr und mit frisch erworbenem Abschluss in der Tasche tritt die 18-jährige Nora ihr Auslandsstudium an der renommierten Berkeley University in Kalifornien an. Eigentlich plant sie, ihren guten Freund Eric besuchen. Doch dieser verschwindet kurz vor ihrer Ankunft spurlos und hinterlässt Nora nur eine kryptische Nachricht. Hat seine neue Arbeit beim Start-Up Mindread.ai etwas damit zu tun? Mindread.ai ist ein Vorreiter im Bereich Künstliche Intelligenz. Offenbar steht das Start-Up kurz vor dem Durchbruch, indem es mittels KI die Gedanken von Menschen extrahieren kann. Da Erics Arbeitskollegen sich bedeckt halten und die Polizei nichts unternimmt, beginnt Nora auf eigene Faust mit den Nachforschungen. Diese führen sie zu dem undurchsichtigen Lee, der nicht nur bei Mindread.ai arbeitet, sondern außerdem ihr Tutor in einem Programmierkurs ist. Weiß er mehr, als er zugibt? Erst als ein Mitarbeiter von Mindread.ai stirbt und in Noras Zimmer eingebrochen wird, erkennt sie, dass sie selbst in größter Gefahr schwebt … Gemeinsam mit ihren neuen Freunden will Nora den Fall aufklären. Doch kann sie ihnen wirklich vertrauen? In einer Welt, in der Künstliche Intelligenz die Gedanken der Menschen entschlüsseln kann, liegt die wahre Macht im Zugriff auf diese sensitiven Informationen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra Felsner
MINDREAD
Thriller
Über das Buch
Sie kennen deine Gedanken!
Endlich nahmen sie ihm die Augenbinde ab. Er war auf einer Liege festgebunden und konnte sich kaum einen Millimeter bewegen. Drei Männer waren zu sehen. Alle trugen schwarze Masken. Hatten sie ihn hierhergeschleppt? Soweit er seine Umgebung erkennen konnte, befand er sich in einem Labor.
Silicon Valley, 2038: Nach einem aufregenden letzten Jahr und mit frisch erworbenem Abschluss in der Tasche tritt die 18-jährige Nora ihr Auslandsstudium an der renommierten Berkeley University in Kalifornien an. Eigentlich plant sie, ihren guten Freund Eric zu besuchen. Doch dieser verschwindet kurz vor ihrer Ankunft spurlos und hinterlässt Nora nur eine kryptische Nachricht. Hat seine neue Arbeit beim Start-up Mindread.ai etwas damit zu tun?
Mindread.ai ist ein Vorreiter im Bereich Künstliche Intelligenz. Offenbar steht das Start-up kurz vor dem Durchbruch, indem es mittels KI die Gedanken von Menschen extrahieren kann.
Da Erics Arbeitskollegen sich bedeckt halten und die Polizei nichts unternimmt, beginnt Nora auf eigene Faust mit den Nachforschungen. Diese führen sie zu dem undurchsichtigen Lee, der nicht nur bei Mindread.ai arbeitet, sondern außerdem ihr Tutor in einem Programmierkurs ist. Weiß er mehr, als er zugibt?
Erst als ein Mitarbeiter von Mindread.ai stirbt und in Noras Zimmer eingebrochen wird, erkennt sie, dass sie selbst in größter Gefahr schwebt …
Gemeinsam mit ihren neuen Freunden will Nora den Fall aufklären. Doch kann sie ihnen wirklich vertrauen?
In einer Welt, in der Künstliche Intelligenz die Gedanken der Menschen entschlüsseln kann, liegt die wahre Macht im Zugriff auf diese sensitiven Informationen.
Inhalt
Über das Buch
Impressum
Widmung
Vorbemerkung
Prolog
1 Up in the air
2 Welcome
3 AI
4 MindRead.ai
5 Das Arm-Device
6 Lee
7 Sir Reginald
8 Midnight Rendezvous
9 Apokalypse
10 SERIX
11 Big Basin
12 Fran
13 Gedanken-Scan
14 Im Labor
15 Filmset
16 Showdown
17 Ende gut, alles gut?
Epilog
Chat-Begriffe
Abkürzungen
Anhang
Danksagung
Die Autorin Petra Felsner
Der erste Band
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Copyright © 2024 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2024
Lektorat: Bernadette Lindebacher
Korrektorat: Angelika Wiedmaier
Layout: Alin Mattfeldt
Umschlaggestaltung: Alin Mattfeldt
Umschlagmotiv: © Laura Crazy / Shutterstock, cybermagician / Shutterstock
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: CPI books GmbH
CO2 neutral produziert
Made in Germany
ISBN 978-3-98679-057-8
Widmung
Für Fred und Ben
Vorbemerkung
Die Erklärungen der Chat-Abkürzungen befinden sich am Ende des Buches
Prolog
Kalifornien, Silicon Valley, Donnerstag, 19.8.2038, 23:15 Uhr
Endlich nahmen sie ihm die Augenbinde ab. Er war auf einer Liege festgebunden und konnte sich kaum einen Millimeter bewegen. Drei Männer waren zu sehen. Alle trugen schwarze Masken. Hatten sie ihn hierhergeschleppt? Soweit er seine Umgebung erkennen konnte, befand er sich in einem Labor. Verzweifelt versuchte er sich loszureißen, aber das konnte er sich auch sparen. Keine Chance! Dafür hatten die Typen schon gesorgt.
Sein Abend war definitiv anders als geplant verlaufen. Er war gerade aus seiner Lieblingsbar in einer der ruhigeren Seitenstraßen San Franciscos getreten und wollte eben in sein Auto einsteigen, um zu Helen zu fahren, als mehrere Männer über ihn herfielen, ihn packten, fesselten und in den Kofferraum eines auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkenden Autos warfen. Er hatte nicht den blassesten Dunst, was sie von ihm wollten. Kommunikation war nicht möglich, denn sie nutzten seinen eigenen Seidenschal, um ihn mundtot zu machen. Mehr als ein „Hmpf“ konnte er nicht von sich geben. Helen fand seine Marotte mit den Seidenschals schon immer ein bisschen albern und nun rächte sich seine Vorliebe für bunte Halstücher. Aber jede bekannte Persönlichkeit hatte eine Marotte, da war die Sache mit den Schals eher harmlos – das war zumindest seine Meinung.
Sehr sanft gingen die Männer nicht mit ihm um. Was war ihr Plan? Wollten sie ihn erpressen? Da gab es doch im Vergleich zu ihm ganz andere Leute hier in Kalifornien. Die hatten zig Milliarden herumliegen. Dagegen war er ein kleiner Fisch. Das konnte eindeutig nicht der Grund für seine Entführung sein.
Jetzt begann einer der Männer an seinem rechten Arm eine Infusion zu legen. Instinktiv fing er an zu zappeln, aber ein zweiter Mann hielt ihm eine Pistole an die Schläfe, was ihn augenblicklich steif wie ein Brett werden ließ. Der Mann mit der Infusion musste ein Profi sein. Im nächsten Moment floss bereits irgendeine Flüssigkeit durch seine Vene. Shit! Was sollte das? Er wurde schläfrig, nahm aber wahr, dass Elektroden auf seinem Kopf angebracht wurden und ein 5D-Virtual-Reality-Display-Cube über seinem Gesicht positioniert wurde. Er spürte Wind auf der Haut, ein seltsamer Geruch schoss in seine Nase, und er sah Bilder vor seinen Augen, die ihm bekannt vorkamen. Sehr bekannt sogar. Er war ihr Schöpfer.
Kalifornien, Big Basin Redwoods State Park, Freitag, 20.8.2038, 0:30 Uhr
Es war stockdunkel und die funzeligen Scheinwerfer seines Autos spendeten gerade so viel Licht, dass er nicht von der hügeligen und kurvenreichen Straße des State Parks abkam und am Stamm irgendeines dieser riesigen und einschüchternden Redwoods endete. Keine erbauliche Aussicht! So faszinierend diese Bäume bei Tag waren, so unheimlich waren sie in dieser Finsternis. Die Schatten der Zweige warfen verzerrte Fratzen auf die Straße. Erics Hände am Lenkrad zitterten, die Augen hielt er nur mühsam offen und er war sich bewusst, dass er bald anhalten musste. Er war völlig übernächtigt, hatte er doch die letzte Nacht nicht geschlafen und war nun schon über eine Stunde unterwegs, seit er kurz nach 23 Uhr in Los Gatos im Silicon Valley losgefahren war. Auch konnte er die Steuerautomatik seines sonst autonom fahrenden Jeeps nicht nutzen, da er sie wohlweislich deaktiviert hatte. Ebenso wie sein GPS, alle Extras seines Cockpits sowie sämtliche Verbindungen zur Cloud. Das war sicherer, und er hoffte, dass er so nicht getrackt werden konnte. Sie durften ihn nicht finden.
Seit dem einschneidenden Erlebnis im vergangenen Jahr, als er fast in einem autonomen Fahrzeug umgekommen war, hatte er immer sichergestellt, dass er seine Autos selbst programmieren konnte. Für ihn selbstverständlich ein Klacks, da er zu den zehn besten Software-Programmierern des Silicon Valley gehörte. Und das wollte was heißen, denn hier hatten sich über die letzten Jahrzehnte viele Hightech-Firmen angesiedelt, die zweifelsohne die besten Brains der Branche beschäftigten. Deshalb hatte ihn auch vor sechs Monaten das Start-up MindRead.ai als Chief Technology Officer angeworben.
Genie hin oder her – im Moment fühlte er sich vollkommen überfordert und wäre am liebsten wieder umgekehrt, um aus diesem verdammten Wald herauszukommen. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass er verfolgt wurde, war groß! Zu erschreckend war, was er in den letzten vierundzwanzig Stunden herausgefunden hatte, und unvorsichtigerweise hatte er Spuren hinterlassen. Elektronische Spuren! Eric musste einstweilen verschwinden und durchdenken, was sein nächster Schritt sein konnte. Zur Polizei gehen? Er war unsicher. Genau deshalb hatte er sich kurzerhand Joes Campingausrüstung geschnappt, die dieser immer im Garderobenschrank im Eingang des Büros von MindRead.ai deponierte, hatte den Inhalt des Bürokühlschranks auf ein paar Plastiktüten verteilt und war ins Auto gesprungen, um in der Wildnis des State Parks unterzutauchen.
Und hier war er. Jetzt galt es zunächst, einen einsamen Platz zum Übernachten zu finden. Die normalen Campingplätze waren für ihn nicht geeignet, da im August viele Familien im State Park Urlaub machten und die Plätze somit alles andere als einsam waren. Aber es gab sogenannte „Walk-in“-Camp Sites, die man nur zu Fuß und nicht mit dem Auto erreichen konnte. Er erinnerte sich vage daran, einen Wegweiser zu einem dieser Plätze gesehen zu haben, als er vor einem Monat mit den Kollegen einen Wanderausflug hier im State Park gemacht hatte. Er hatte sich damals geschworen, dass es das erste und letzte Mal sein würde, dass er an diesen Ort gekommen war. Aber so konnte man sich täuschen!
Er war eben nicht der sportliche Typ, sondern verbrachte seine Zeit lieber vor der Tastatur, idealerweise mit einem kalten Bier und einer Sardellenpizza von Mario, der gleich neben ihrem Office seine Pizza Corner hatte.
Endlich erreichte er die Abzweigung, die er gesucht hatte. Er steuerte sein Auto auf einen kleinen, nicht asphaltierten Fahrweg, der circa 500 Meter vom Hauptweg in die allumfassende Dunkelheit des Waldes führte, um dann plötzlich im Nichts zu enden.
Eric stieg aus, kramte die Taschenlampe aus den Campingsachen und leuchtete vorsichtig in alle Richtungen. Von rechts hörte er ein Rascheln und zuckte zusammen. Danach war es wieder ruhig. Eric hakte in Gedanken die Liste der gefährlichen Wildtiere Amerikas ab. Bären, Kojoten … Nein! Die gab es seines Wissens hier nicht. Pumas, Wildschweine … schon eher, aber mit denen würde er hoffentlich fertigwerden! Füchse, Waschbären, Streifenhörnchen, Kaninchen … alle harmlos! Eigentlich sollte ihm hier nichts passieren – zumindest ging von den Tieren hier keine unmittelbare Gefahr aus. Eher von den Menschen, die ihm möglicherweise gefolgt waren.
Nun versuchte er die Ausrüstung und das mitgebrachte Essen in den viel zu kleinen Rucksack zu quetschen. Ein unmögliches Unterfangen. Es endete damit, dass er einen überquellenden Rucksack auf dem Rücken hatte und zusätzlich zur Taschenlampe noch zwei Plastiktüten in jeder Hand. Er stapfte los und kam etwa hundert Meter weit, bis er über eine Wurzel stolperte, der Länge nach hinschlug und dabei die Taschenlampe verlor, die durch den Sturz auch sofort ausging. Mist! Er rappelte sich hoch und raufte sich verzweifelt die Haare. Was tat er nur hier? Er war immerhin Programmierer und kein Pfadfinder! Vielleicht hätte er sich besser irgendwo in den belebten Straßen San Franciscos verstecken sollen, zum Beispiel in Chinatown, wo Tag und Nacht ein ziemliches Gewusel herrschte. Allerdings war das Risiko, dort entdeckt zu werden, wesentlich größer. Im Manager Magazin war erst vor Kurzem ein ausführlicher Artikel über ihr Start-up MindRead.ai erschienen, inklusive Fotos des gesamten Teams. Und weil er als CTO im Zentrum des Artikels gestanden hatte, konnte ihn leicht jemand aufgrund der Fotos identifizieren.
Es half alles nichts, er musste sich weiter durch diesen Dschungel schlagen. Was hatte noch auf dem Schild gestanden? 0.7 Meilen? Das sollte doch zu schaffen sein! Die Taschenlampe konnte er leider nicht mehr zum Leben erwecken, also musste er sein Arm-Device nutzen, um mit dem schwachen Leuchten, das von seinem Unterarm ausging, den Weg zu finden. Die anderen Funktionen des ADs hatte er deaktiviert und jegliche Verbindung zum Netz und der Cloud unterbrochen.
Langsam tastete er sich voran. Schritt für Schritt, um nicht wieder einer dieser Killerwurzeln zum Opfer zu fallen. Nach schier endlosem Marsch durch die Dunkelheit hörte er zuerst das Plätschern eines Bachs und erreichte schließlich eine kleine Lichtung. Er ließ sich erst mal schwer schnaufend fallen und kramte seine eingepackten Schätze aus dem Rucksack: Wurfzelt – sehr gut, es konnte nicht so schwer sein, das aufzustellen. Schlafsack – auch gut, leider hatte er auf die Schnelle keine Isomatte gefunden, er musste also auf dem blanken Zeltboden schlafen. Ihm tat beim bloßen Gedanken schon der Rücken weh. Ein Kocher mit einer kleinen Gasflasche – prinzipiell eine fantastische Idee, wenn er daran gedacht hätte, Streichhölzer oder ein Feuerzeug mitzunehmen. Vielleicht hatte er noch eines im Auto. Aber es war sowieso gerade wieder mal die höchste Stufe für Waldbrandgefahr in der Bay Area, also lieber Finger weg von allem, was mit Feuer zu tun hatte.
Danach inspizierte er noch seine Essensvorräte und war damit halbwegs zufrieden. Er knabberte einen der Chocolate Chip Cookies – Schokolade machte bekannterweise glücklich - und begann das Zelt aufzustellen. Natürlich war es nicht so einfach, wie der Werbespruch auf der Verpackung versprach. Eric hatte seine Mühe damit und verhedderte sich dreimal so sehr in den Spannleinen, dass er fast ein Messer zurate gezogen hätte. Letztlich stand das Zelt – nicht schön, aber zweckmäßig. Es würde schon nicht über ihm zusammenbrechen.
Nachdem er die Campingausrüstung und das Essen in seine wackelige Behausung geschoben hatte, kroch er selbst hinein und schloss die Augen. Er atmete tief ein und aus, um sich zu beruhigen.
Die Tatsache, dass die vielen Geräusche des Waldes für ihn ungewohnt waren und er sich trotz des Zelts, das ihn schützte, ziemlich unwohl fühlte, ließ ihn jedoch noch lange wach liegen. Und nicht zuletzt war es auf dem harten Boden echt unbequem. Ihm war völlig unverständlich, warum so viele Menschen gerne zum Zelten gingen. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, fiel er in einen unruhigen Schlaf.
„Hier ist er, packt ihn euch!“
Eric fuhr hoch. Die Stimme hätte ihn von den Toten geweckt! Er kannte sie. Er hatte sie vor seiner Flucht gehört. Zusätzlich blendete ihn ein heller Lichtstrahl, der die dünne Außenhaut des Zelts mit Leichtigkeit durchdrang.
Und dann ging alles sehr schnell. Kräftige Hände packten das kleine Zelt und schnürten es so um ihn zusammen, dass er sich wie ein Hotdog im Brötchen fühlte und sich beim besten Willen nicht mehr bewegen konnte. Kurz bevor ihn etwas Hartes an der Schläfe traf und ihn die Sinne verließen, hörte er noch: „Schön, dass du unsere Gastfreundschaft mit so großer Begeisterung annimmst.“
Das daraufhin erklingende hämische Lachen verfolgte ihn bis in die Bewusstlosigkeit.
1 Up in the air
Deutschland, Flughafen München, Samstag, 21.8.2038
Ich ließ mich mit gemischten Gefühlen im Flieger nach San Francisco auf meinen Sitz fallen. Eben noch hatte ich mich von meiner Familie verabschiedet, die mich geschlossen zum Flughafen begleitet hatte. Meine Eltern wollten mich bis kurz vor dem Abflug mit guten Ratschlägen überhäufen, woraufhin ich sie vehement daran erinnern musste, dass ich seit genau einem Tag achtzehn war und somit volljährig, also durchaus allein klarkommen würde. Schließlich hatte ich im letzten Jahr mit meinen Freunden Matt und Eric ein Komplott innerhalb des Milliardenkonzerns AutoDat aufgedeckt! Das sollte ein ausreichender Beweis für meine Selbstständigkeit sein.
Ich wusste ja, dass sie es gut meinten, aber ein bisschen nervig war es schon. Und so gern ich meine Großmutter mochte, mischte die verrückte Nudel, wie konnte es anders sein, wieder den ganzen Flughafen auf. Zuerst hatte die Achtziger-Oma so getan, als wäre sie schlecht zu Fuß, um dann zu allem Übermaß den Rollstuhl, den ihr das Flughafenpersonal freundlicherweise zur Verfügung stellte, quasi als Rennwagen zu nutzen. Als sie dann so schnell durch einen Shop heizte, dass die kostbaren Parfümfläschchen nur so wackelten, musste dringend etwas geschehen. Als hinge er nicht besonders an seinem Leben, stellte sich ihr ein mutiger Angestellter des Shops in den Weg. Zum Glück waren nicht seine Schienbeine das Ende ihres Höllentrips, sondern der danebenliegende Parfüm-Promotion-Stand. Schade nur um die vielen Proben, die auf die Oma hinunterregneten. Meine Brüder, die elfjährigen Zwillinge Tom und Max, johlten, und meine beiden Schwestern Ida und Ria gingen hinter einem hohen Parfümregal in Deckung, um nicht mit der Achtziger-Oma in Verbindung gebracht zu werden. Allerdings sahen alle interessiert dabei zu, wie ich unsere Oma aus dem Berg der Schachteln klaubte, wobei ich bewusst den Augenkontakt zu dem Angestellten des Shops mied und dazu meine langen Haare erfolgreich als Schutzschild nutzte.
„Ui, das war spaßig“, rief die Verursacherin des ganzen Chaos. „Warum hältst du mich denn fest?“
„Vergiss es!“, zischte ich ihr zu und nahm sie in den Polizeigriff. Endlich kam mir meine Mutter zu Hilfe – gut so, Oma war ja schließlich ihre Verantwortung und nicht meine –, sodass ich zumindest versuchen konnte, mich vom Kern des Geschehens zu entfernen. Der Angestellte, ein junger Mann um die zwanzig, starrte mich mit offenem Mund an. Ich zuckte mit den Achseln: „Großeltern.“ Als ob das alles erklären könnte, was eben vorgefallen war. Dann sah ich kurz an mir hinunter, ob auch alles okay war, weil er nicht aufhörte zu starren. Ich konnte aber an meinem 1,70 Meter großen Selbst und meinem, meiner Meinung nach, passablen Aussehen sowie meinen dunkelbraunen Haaren – zugegeben, sie waren inzwischen ungewöhnlich lang und mit roten Strähnen versehen – nichts Ungewöhnliches entdecken. Und ob ich irgendwelche Flecken im Gesicht hatte, war ohne Spiegel nicht festzustellen. Also lächelte ich ihm freundlich, wenn auch etwas verkrampft, zu, während ich mich daran machte, den Promotion-Ständer wieder aufzurichten und die Proben mit beiden Händen in die dafür vorgesehene Schale zu schaufeln.
Um das Debakel zu einem positiven Ende zu bringen und um zu vermeiden, dass ich möglicherweise meinen Flug verpassen würde, entschied sich mein Vater kurz entschlossen für einen großzügigen Einkauf – keine Ahnung, ob er überhaupt die Etiketten beachtete –, was wiederum die Verkäuferin, die kurz vor dem Hyperventilieren war, relativ schnell beruhigte.
„Excuse me, my dear, I’ve got the window seat next to you.“ Ich wurde von einem schottischen Akzent aus meinen Gedanken gerissen und schnellte ganz automatisch aus meinem Sitz. Dabei hätte ich den alten und etwas gebrechlich wirkenden Mann, der neben mir stand und verzweifelt versuchte, sein Handgepäck im Fach über unseren Sitzen zu verstauen, fast umgerissen. Im letzten Moment fing ich den kleinen Koffer mit einem „Umpf“ auf – hatte er Steine dabei? – und bugsierte ihn nun meinerseits vorsichtig in die Ablage. Dankbar sah er mich an, nickte mir freundlich zu und quetschte sich dann an mir vorbei auf seinen Sitz. Dann lächelte er mich von der Seite an und setzte zu einer Verbeugung an, zumindest, soweit es die engen Sitze im Flugzeug zuließen.
„Darf ich mich vorstellen? Sir Reginald. At your service, miss!“
Ich musste ein bisschen grinsen. Er war so höflich und formal, richtig alte Schule. Irgendwie süß. Und hatte einen ziemlich heftigen schottischen Akzent, was gut zu ihm passte. Allerdings, wobei er mir behilflich sein wollte, war mir erst mal schleierhaft. Oder war At your service nur so eine typisch englische Redewendung? Ich war gerade froh, mal eine Pause von meiner Oma zu haben, und schon hatte ich den nächsten Rentner an der Backe. Egal, er machte einen sehr netten Eindruck und es war praktisch unmöglich, einen zweiten Menschen zu treffen, der so verrückt wie die Achtziger-Oma war. Sie war zweifelsohne ein Unikat.
„Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir Reginald. Ich heiße Nora, Nora Achtziger. Fliegen Sie auch nach San Francisco, oder geht es bei Ihnen von dort weiter?“
„Ich komme aus Edinburgh und besuche meinen Enkel in San Francisco. Er arbeitet dort bei einer Versicherung und wollte, dass ich ihn besuchen komme.“ Er sah mich ganz ergriffen an und fügte hinzu: „Ist nicht unbedingt selbstverständlich. Ihr jungen Leute habt ja sicherlich interessantere Dinge zu tun, als uns langweilige Rentner zu beschäftigen.“
Meine Gedanken schweiften sofort wieder zu meiner Großmutter. Eine langweilige Rentnerin war sie mit Sicherheit nicht. Es kam jedoch auch ein klein wenig schlechtes Gewissen in mir hoch, als ich an sie dachte. Seit einem Monat hatte sie mir in den Ohren gelegen, dass sie mich nach San Francisco begleiten müsse, weil es dort so cool sei, ich ja nicht alleine ohne sie zurechtkäme, und sie außerdem in den Filmstudios von Warner Bros. den Riesenhai aus der Serie MEG streicheln wollte. All meine Versuche, ihr zu erklären, dass erstens der Meg nicht echt, sondern computeranimiert war, zweitens kein Hai in dieser Größe, wenn er denn existieren würde, in Studios oder einem Wasserpark überleben könnte, und es drittens, in welchem Fall auch immer, eine außerordentlich blöde Idee wäre, einen Hai zu streicheln, verklangen ungehört. Na gut, Babyhaie in einem Meeresaquarium mal ausgenommen. Meine Oma ließ sich leider von meiner Argumentation nicht überzeugen, weshalb letzten Endes meine Mutter intervenieren musste. Sie wies darauf hin, dass ich gerade am Anfang viel Zeit für mein Auslandsstudium bräuchte und mich daher nicht mit der Achtziger-Oma beschäftigen könne. Ich müsse mich doch voll auf mein Studium konzentrieren! Das sei sehr wichtig, da ich schließlich ein Stipendium bekommen hätte, und dafür müsse man schon was leisten.
Bis hierher stimmte ich völlig mit ihr überein.
Und sie würden dann alle in sechs Monaten gemeinsam nach Kalifornien fliegen, um mich zu besuchen und gemeinsam mit mir einen Trip durch die Nationalparks im Westen der USA zu machen.
Okay. An dieser Stelle hatte ich mich dann verschluckt, denn das war nicht ausgemacht gewesen. Immerhin, sechs Monate Galgenfrist – bis dahin floss noch viel Wasser die Isar hinunter. Und der Oma genügte fürs Erste die Aussicht auf einen zukünftigen Roadtrip.
„Nora“, hörte ich jetzt Sir Reginald neben mir, „was sind denn deine Pläne in San Francisco? Eine größere Reise?“
Ich löste mich von den Gedanken an meine haistreichelnde Oma, wandte mich wieder Sir Reginald zu und begann begeistert zu erzählen: „Ich habe mich für ein einjähriges Auslandsstudium für Medizintechnik an der University of Berkeley eingeschrieben. Berkeley ist weltberühmt für diesen Bereich, vor allem in Verbindung mit künstlicher Intelligenz.“
Er hörte gespannt zu, gab aber zu verstehen, dass er von Technik, und vor allem von künstlicher Intelligenz, so gar keine Ahnung hatte.
„Für solche Sachen bin ich zu alt, meine Liebe. Künstliche Intelligenz ist für mich, wenn mein AD von alleine weiß, was ich morgen Abend essen möchte und die Zutaten dafür schon im Kühlschrank bereitstehen.“ Er räusperte sich. „Und vor allem, wenn alles, was mir gut schmeckt, durch gesündere Alternativen ersetzt wird, weil ich doch in meinem Alter auf meine Gesundheit achten muss. Sagt zumindest mein AD. Manchmal finde ich das Ding schon recht bevormundend.“
Er sah so entrüstet aus, dass ich lachen musste. Ich konnte mir ein Leben ohne AD gar nicht vorstellen, denn schon als kleines Kind hatte ich mein erstes bekommen. Ich kannte auch fast niemanden, der keines besaß. Die ADs kümmerten sich um die ganze Logistik unseres täglichen Lebens, denn man konnte alles, was im Internet zur Verfügung stand, sofort in Erfahrung bringen, mit den ADs fast wie mit Menschen kommunizieren, und ihnen Aufträge erteilen. Da sie – je nach Größe – einen Großteil des Unterarms bedeckten, nutzten viele Leute sie auch als modisches Accessoire.
„Ich sehe schon, Sie haben ein zwiespältiges Verhältnis zur KI. Ich glaube aber, dass man auch viel Gutes damit tun kann. Ein guter Freund von mir ist seit ein paar Monaten CTO und Lead-Programmierer bei einem KI-Start-up im Silicon Valley. Die Firma heißt MindRead.ai - haben Sie von der schon mal gehört?“
Sir Reginald verneinte, aber schaute interessiert.
„MindRead.ai hat seinen Sitz in Los Gatos und sie nutzen innovative Forschungen im Bereich KI, um das menschliche Gehirn zu analysieren und Gedanken zu lesen.“
Sir Reginald sah mich zweifelnd an, also fuhr ich fort.
„Das kann man zum Beispiel in der Medizin anwenden. Dass man mit KI die Prognosen für Komapatienten besser diagnostizieren kann, das wissen wir schon seit über zwanzig Jahren. Aber wirklich festzustellen, was Komapatienten wahrnehmen und denken, das ist schon eine ganz andere Sache, und, das muss man ehrlich sagen, revolutionär in der Medizin. Sie müssen wissen, dass viele Komapatienten vielleicht eine Chance hätten, wenn man ihnen nicht die lebensverlängernden Maßnahmen abschalten würde. Und warum tut man das? Weil man nicht weiß, ob sie jemals wieder aufwachen und wie der Zustand ihres Gehirns ist.“
Jetzt nickte mein Sitznachbar schon ein bisschen wohlwollender. „Junge Dame, da magst du schon recht haben. Und das klingt wahrlich faszinierend. Aber hast du keine Angst, dass es Menschen geben könnte, die diese Technologie missbrauchen?“
„Leider haben Sie in diesem Punkt recht, Sir Reginald. Ich habe letztes Jahr hautnah mitbekommen, wie es ist, wenn jemand die Programmierung autonomer Autos für seine Zwecke nutzt.“
Er sah mich neugierig an. Und dann schilderte ich ihm meine Erlebnisse vom letzten Sommer, als meine Freunde Matt, Eric und ich einem Verbrecher namens Engel auf die Schliche gekommen waren. Engel arbeitete damals in einer Führungsposition bei dem Unternehmen AutoDat, einem der größten im Bereich der Erstellung und Prüfung von Algorithmen für autonome Fahrzeuge, und hatte versucht, Zugriff auf eine Vielzahl personenbezogener Daten zu bekommen. Denn der Zugang zu dieser Art von Daten gibt Unternehmen Macht, und Engel wollte vor allem eines, nämlich Karriere machen. Indem er seine Position nutzte, um einige dieser autonomen Fahrzeug-Algorithmen umzuschreiben, hatte er den Tod von Passagieren in Kauf genommen und wollte auch uns, nachdem wir seinem Geheimnis auf die Spur gekommen waren, um die Ecke bringen. Wir schafften es, Engel zu entkommen und das Komplott letztendlich auffliegen zu lassen. Bedauerlicherweise konnte sich Engel seiner Strafe entziehen und verschwand. Zum Glück hatten wir alle seit über einem Jahr nichts mehr von ihm gehört, was hoffen ließ. Dennoch hatte ich oft genug die Situation vor Augen, als wir in dem autonomen Auto eingeschlossen waren und schon dem Tod ins Auge sahen. Ich hatte auch noch jede Menge Albträume zu diesem Thema, die erst langsam weniger wurden.
„Das ist ja eine schreckliche Geschichte!“ Sir Reginald sah mich prüfend an. „Und nachdem dir das passiert ist, verteidigst du immer noch diese KI? Bemerkenswert!“
„Ich denke einfach, wir müssen Programme mit Kontrollmechanismen entwickeln, die einen Missbrauch nahezu unmöglich machen. Deshalb möchte ich mich in dem Bereich auch engagieren. Und bin sehr froh, dass jemand wie mein Freund Eric in so einer leitenden technischen Position ist. Er würde nie dem Missbrauch einer so kritischen Technologie zustimmen.“
Meine Gedanken schweiften zu Eric. Eric Miller war letztes Jahr noch bei AutoDat in der Qualitätsabteilung tätig gewesen und einer der besten Programmierer, die ich kannte. Und das wollte etwas heißen, denn ich war selbst Hackerin und kannte einige Leute in der Hacker-Community, die erheblich was draufhatten. Dieser Fakt hatte mir letztes Jahr auch geholfen, die korrupten Algorithmen ausfindig zu machen.
Eric hatte mich während meines Praktikums bei AutoDat angelernt und ich hatte den lustigen Kollegen mit seinem schrulligen Aussehen – ein Hells-Angels-Rocker-Verschnitt mit zum Pferdeschwanz zusammengebundener, schwarzer Mähne - gleich ins Herz geschlossen. Er hatte uns durch seinen Glauben an das Gute im Menschen unbewusst in große Gefahr gebracht.
Aber Schwamm drüber. Wir saßen danach letztlich alle im gleichen Boot, besser gesagt Auto, und Eric war so zerknirscht, dass man ihm nicht ernsthaft böse sein konnte. Auf jeden Fall waren wir inzwischen richtig gute Freunde. Leider hatte er vor einigen Monaten angekündigt, in die USA zurückzuziehen. Sehr schade! Ich konnte ihn nun nicht mehr jederzeit in München auf einen Kaffee treffen. Ich mochte den liebenswerten Kerl sehr, verstand aber seine Entscheidung, denn es war für ihn als Amerikaner eine Rückkehr in seine Heimat, und er hatte diese fantastische Stelle als CTO von MindRead.ai bekommen. Na ja, eigentlich sollte das Start-up total begeistert sein, Eric bekommen zu haben, schließlich war er ein Hauptgewinn für jede Firma, in der er arbeitete.
Er hatte mir bisher immer sehr euphorische Nachrichten bezüglich seines neuen Jobs geschickt - wie spannend das Thema war, wie super das Team und so weiter. Allerdings hatte ich in der letzten Woche ein paar Chats von ihm bekommen, die beunruhigend klangen - Eric klagte plötzlich über Finanzierungsschwierigkeiten bei MindRead.ai. Das letzte Lebenszeichen von Eric kam letzten Mittwoch, als er geschrieben hatte, wie sehr er sich freue, mich bald wiederzusehen. Und seit Donnerstag herrschte dann plötzlich Funkstille, was ich so gar nicht von ihm kannte. Er hatte sich nicht mal an meinem Geburtstag bei mir gemeldet. Ungewöhnlich! Ich begann mir so langsam Sorgen um Eric zu machen.
Heute Morgen, kurz vor meinem Flug, hatte ich versucht, Matt zu erreichen, den dreiundzwanzigjährigen Juniorpartner einer Londoner Detektei, spezialisiert auf digitale Verbrechen – und leider mein großer Schwarm. Leider – weil ich den gut aussehenden Typen viel zu gern mochte, um zu akzeptieren, dass unsere Beziehung wohl kein wirkliches Fundament hatte. Letztes Jahr hatte ich gedacht, dass er sich auch in mich verliebt hätte, aber außer ein paar flüchtigen Küssen, in die ich wohl mehr hineininterpretiert hatte als er, war daraus nichts geworden. Sehr zu meinem Leidwesen!
Er war kurz nach unserem gemeinsamen Abenteuer nach London zurückgekehrt und ich hörte nur sporadisch von ihm. Gerade wenn er an irgendwelchen superwichtigen Fällen arbeitete, war er oft für ein paar Wochen wie vom Erdboden verschluckt. Ich hinterließ ihm heute nur eine Nachricht, dass ich mir Sorgen um Eric mache, und die Frage, ob er denn etwas von ihm gehört hätte. Natürlich noch immer keine Antwort!
„Was möchten Sie trinken?“ Die Frage des Flugservice-Bots brachte mich zurück in die Gegenwart.
„Ich hätte gerne ein Coke.“ Meine Antwort ging allerdings in einem kleinen Tumult unter, als eine leibhaftige, gut gestylte und geschminkte Stewardess den Bot unsanft eine Stuhlreihe weiterschob. Es gab aufgrund der Helfer-Bots immer nur eine menschliche Stewardess pro Flugzeug, und zwar ausschließlich für die „besonderen“ Fluggäste – und dazu gehörte offensichtlich Sir Reginald. Sie lehnte sich über mich und sprach Sir Reginald etwas hektisch und mit übertriebener Freundlichkeit an, während es ihr gelang, mich gleichzeitig vollkommen zu ignorieren: „Sir Reginald, willkommen an Bord. Ich habe leider eben erst die Information bekommen, dass Sie heute mit uns fliegen. Aber wie kann es denn sein, dass Sie hier in der Economyclass sitzen? Ich werde Ihnen sofort einen Platz in der Businessclass frei machen.“ Sie stand sichtlich unter Stress. „Und hier, für Sie, ein 50 Jahre alter Whisky, handselektiert von unserer Fluglinie“, flötete sie und drängte ihm ein Glas mit einer leicht bräunlichen Flüssigkeit auf, in der ein einsamer Eiswürfel schwamm. „Als Willkommensdrink, wir wissen ja, dass Sie alten schottischen Whisky sehr schätzen.“
Sir Reginald blickte die Stewardess an und nahm sein Whiskyglas entgegen. „Herzlichen Dank auch. Ich möchte gerne hier sitzen bleiben.“
Die Stewardess blinzelte ihn erstaunt an, als hätte er Chinesisch gesprochen, dabei war es doch nur Deutsch mit einem starken schottischen Akzent.
„Aber Sir Reginald, Sie können doch nicht …!“ Und dann musterte sie mich zum ersten Mal mit einem äußerst abschätzigen Blick.
„Aber selbstverständlich kann ich!“ Sir Reginald lächelte sie freundlich an. „Und bitte bringen Sie meiner jungen Freundin hier eine Coke, bitte im Glas und mit mindestens zwei Eiswürfeln.“
Verdattert blickte die Stewardess ihn an. „Aber sicher, ganz wie Sie wünschen.“ Und stammelte noch: „Und Sie sind sich sicher, dass Sie nicht doch noch in die Businessclass …?“
„Nein danke!“
„Ähem!“, räusperte sie sich ein wenig nervös. „Und brauchen Sie ein spezielles Fach für Ihre Ausrüstung?“
„Nein!“, kam es jetzt noch ein wenig schärfer von dem alten Herrn neben mir zurück.
Mit einer Geschwindigkeit, die ich ihr aufgrund der hohen Absätze nicht zugetraut hätte, drehte sich die Stewardess um, und innerhalb von einer Minute hatte ich eine Coke vor mir stehen, im Glas, mit Eiswürfeln.
Dann wandte sie sich wieder an Sir Reginald: „In etwa einer halben Stunde werden wir Ihnen Ihr Essen servieren sowie das für Ihre Begleiterin.“ Wieder streifte mich ein Blick, diesmal eher irritiert. „Falls Sie in der Zwischenzeit irgendetwas wünschen, dann melden Sie sich bitte. Wir haben Ihr AD selbstverständlich bereits mit unserem Board-Service verbunden.“
Ich sah Sir Reginald verwundert von der Seite an. Er zuckte nur leicht mit den Schultern.
„Ich hoffe, es ist für dich in Ordnung, wenn ich hier sitzen bleibe, denn ich finde unsere Gespräche sehr interessant.“
„Äh, ja, gerne“, beteuerte ich etwas verwirrt.
„Sobald man ein paar Aktien der Airlines besitzt, meint jeder plötzlich, sich bei dir beliebt machen zu müssen. Das kann überaus lästig sein. Daher fliege ich gerne inkognito – wie du siehst, funktioniert das aber nicht immer.“ Er seufzte.
Ich ging davon aus, dass er mit „ein paar Aktien“ eher „ziemlich viele Aktien“ meinte, und nickte zustimmend. Mich würde es auch nerven, ständig von irgendjemandem angesprochen zu werden. Allerdings fragte ich mich schon, was die Stewardess mit dem Kommentar zu seiner Ausrüstung bezweckt hatte. Der Koffer war verdammt schwer gewesen. Was da wohl drin war? Vielleicht ein paar Goldbarren? Ich musste insgeheim grinsen. Der alte Herr war bestimmt sehr gut betucht.
Wir unterhielten uns dann noch eine Weile über seine Reisen – er war tatsächlich weit herumgekommen – und er zeigte mir auch ein Foto seines Hauses, oder besser gesagt seiner Burg, in der Nähe von Edinburgh. Sah echt klasse aus, fast wie die Burg aus dem Film Highlander. Es war alles in allem ein recht kurzweiliger Flug und wir genossen beide die Gesellschaft des anderen.
Ich schlief ein bisschen und als ich wieder aufwachte, setzten wir bereits zum Landeanflug auf den San Francisco Airport an. Es war noch hell und die Stadt sah von oben wirklich spektakulär aus. Ich konnte sogar die Golden Gate Bridge erspähen, die die Stadt mit dem gegenüberliegenden Marin County verband und quasi das Tor zur San Francisco Bay war. Die Hängebrücke sah von hier oben sooo klein aus! Ich hatte aber gelesen, dass sie fast zwei Kilometer lang war und letztes Jahr ihren hundertsten Geburtstag gefeiert hatte. Wow!
Sir Reginald sah meine Begeisterung und meinte, dass er bei seinem ersten Besuch in San Francisco vor etwa fünfzig Jahren ähnlich gestaunt hätte wie ich heute.
Bevor wir uns nach der Landung verabschiedeten, tauschten wir noch unsere Kontaktdaten aus. Sir Reginald lud mich zum Tee ein und plante, mich seinem Enkel vorzustellen. Er wollte sich bald bei mir wegen eines Termins melden. Ich nahm seine Einladung gerne an, nicht weil ich unbedingt seinen Enkel treffen wollte, sondern weil es beruhigend war, in einer fremden Stadt nicht ganz ohne ein bekanntes Gesicht dazustehen. Und mein einziger Freund hier, Eric, war nicht erreichbar, was mir inzwischen ein komisches Gefühl in der Magengegend verursachte.
Ich musste durch die amerikanische Grenzkontrolle wie jeder andere auch – was für eine nervige Angelegenheit! Die Office-Bots stellten eine Reihe stereotyper Fragen: Wo kommst du her? Was ist das Ziel und der Zweck deiner Reise? Wo wirst du wohnen? Und so weiter. Erstens waren die gesamten Daten alle in der Airline- und somit auch der Flughafen-Cloud verfügbar, also ein völlig sinnloses Unterfangen. Zweitens zog sich das alles endlos hin und es bildeten sich lange Schlangen bei der Einreise. Dort stand ich auch noch, als plötzlich ein Alarm losjaulte. Wo kam das Geräusch her? Schließlich entdeckte ich seinen Ursprung – im Zollbereich blinkte eine rote Leuchte über einem Gepäckband. Daneben stand gänzlich unberührt Sir Reginald und reichte seinen Arm mit dem AD einem Zollbeamten. Oje! War der alte Herr etwa in Schwierigkeiten? Mitnichten, denn in dem Moment verbeugte sich der Zollbeamte und begann, ihm begeistert die Hand zu schütteln. Er fischte den Koffer vom Rollband und stellte ihn auf einen Service-Bot. Das sah jetzt nicht nach einem Problem aus. Ich war erleichtert … und wieder einmal neugierig, was der gute Sir denn so Besonderes in seinem Gepäck mitschleppte. Als dann auch noch ein groß gewachsener Mann in einem schwarzen Anzug schnellen Schrittes aus einem Polizeibüro stürmte, Sir Reginald erst herzlich begrüßte und ihm dann den Arm freundschaftlich um seine Schulter legte, wusste ich, dass ich mir um Sir Reginald keinerlei Sorgen machen musste. Er war wohl hervorragend mit der hiesigen Polizei bekannt, denn der Mann sah nicht nach einem einfachen Grenzpolizisten aus. Das konnte man an seinem Anzug erkennen, und ganz besonders an seiner Haltung.
Endlich hatte ich die Grenzkontrolle hinter mich gebracht und stand vor dem Flughafengebäude. Hier sah ich mich erst einmal um. Ständig hielten und starteten Lifts, die Reisende ausspuckten und aufsogen. Diese autonomen Mitfahrgelegenheiten hatten die Taxis von früher beerbt, die meine Eltern noch gekannt hatten. Ich orderte meinen Lift und kurz darauf fuhr ich schon in Richtung San Francisco Downtown und dann weiter über die Oakland Bay Bridge zur Berkeley University.
Ich hatte einen Platz im Bayhill Dormitory bekommen. Und ich war schon sehr aufgeregt und neugierig, wie wohl meine Unterkunft für das kommende Jahr aussehen würde.
2 Welcome
Ich stand mit meinem gesamten Gepäck vor dem Gebäude, welches in einer ruhigen Ecke im Nordosten des Campus der Berkeley University lag. Meine Erwartungen waren weit übertroffen worden. Das relativ neue, aber sehr schön angelegte Bayhill Dormitory lag auf einem bewaldeten Hügel und der Blick daraus ging, wie der Name schon angedeutet hatte, auf die San Francisco Bay hinunter. Das Dorm wirkte wie eine Lodge in einem der amerikanischen Nationalparks. Zumindest soweit ich Lodges aus Filmen kannte. Die Außenwände des Gebäudes waren alle aus massiven Holzbalken und es sah urgemütlich aus, wie sich das große Haus in die Landschaft einbettete. Wahnsinn! Hier würde es mir gefallen.
Ich musste mich noch ein bisschen durchfragen, bis ich das Büro des Wohnheims fand, das sich – nicht ganz offensichtlich – an der östlichsten Seite des Gebäudes befand, und schleppte mein Gepäck die Stufen zum Eingang hinauf. Im Büro angekommen, blickte ich mich erst mal um. War ich schon zu spät dran, und das Büro war nicht mehr besetzt? Dann wäre es aber sicher zugesperrt gewesen.
„Hallo?“, fragte ich unsicher.
Nichts.
„Hallo“, rief ich nun etwas lauter.
„Yeah?“, antwortete endlich eine Stimme aus dem Nebenraum.
Ich musste noch eine gefühlte Ewigkeit warten, bis der Stimme auch die Person dazu folgte. Definitiv nicht die Erscheinung, die ich im Büro eines Wohnheims erwartet hätte.
Ein schlanker, aber breitschultriger Typ mit beeindruckender Körpergröße, vielleicht ein paar Jahre älter als ich, schlenderte gelangweilt aus dem Nebenraum und sah mich abschätzend an.
„Ja?“
„Ich bin Nora Achtziger und habe ein Zimmer hier am Campus“, erklärte ich in meinem besten Englisch, auf das ich sehr stolz war. Englisch war eines meiner besten Schulfächer gewesen und die Lehrer hatten immer meine gute Aussprache gelobt.
„Ah. Bist wohl aus Deutschland, oder?“ Oh! War das denn so offensichtlich? „Du musst auf Diana, unsere Admin, warten.“
Er drehte sich ohne einen weiteren Kommentar um und wollte wieder ins Nebenzimmer gehen. Wie bitte, echt jetzt? So ein unfreundlicher Stoffel war mir noch nicht begegnet.
„Hey, warte mal. Wann kommt diese Diana denn wieder?“
Er drehte sich sichtlich widerwillig um und starrte mich genervt an. Dadurch hatte ich auch die Gelegenheit, ihn genauer zu mustern. Pechschwarze, kurze Haare, in leichten Spikes nach oben gekämmt – das war entweder naturbelassen cool, oder er hatte extrem lange vor dem Spiegel gestanden, um die Haare genauso lässig hinzudrapieren. Außerdem hatte er ein paar Piercings im Ohr und auf seinem rechten Arm erspähte ich ein längliches Tattoo, das unter seinem T-Shirt-Ärmel begann und bis zum Handrücken hinunter verlief – eine Schlange. So richtig schräg! Nachdem er auch noch völlig schwarz gekleidet war und dunkle Schatten unter den Augen hatte, hätte ich ihn am ehesten unter der Spezies Vampir angesiedelt. Allein seine gebräunte Haut überzeugte mich, dass ich es wohl doch mit einem Menschen zu tun hatte. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mich beißen würde, war also eher gering, auch wenn er sich entsprechend benahm.
Er sah mich feindselig an. Ich war richtiggehend irritiert. Ich hatte ihm doch überhaupt nichts getan! Allein meine Existenz schien ihm zu missfallen.
„Keine Ahnung. Kann ich dir auch nicht helfen.“
Und damit verschwand er wieder im Nebenzimmer.
Na, hoffentlich waren nicht alle Studenten hier so freundlich wie dieser Typ. Unentschlossen blieb ich im Büro stehen. Zum Glück kam ein paar Minuten später eine Frau mittleren Alters zur Tür herein.
„So sorry, my dear! Ich war nur zehn Minuten weg, ich hoffe, Bradley hat dir in der Zwischenzeit weiterhelfen können?“ Sie sah in Richtung Nebenzimmer und dann zu mir. Aha! Der Nicht-Untote hieß also Bradley. Nicht gerade passend. Ich hatte allerdings keine Lust, sein einnehmendes Wesen besser kennenzulernen, also antwortete ich schnell: „Kein Problem. Ich bin eben erst gekommen. Mein Name ist Nora Achtziger und ich habe ein Zimmer hier im Bayhill Dormitory reserviert.“
„Hallo, Nora, herzlich willkommen in Bayhill! Du wirst dich bei uns wohlfühlen. Bayhill ist mit Sicherheit das schönste Wohnheim hier am Campus. Und ich bin Diana. Wenn du irgendwelche administrativen Fragen hast, dann bist du bei mir immer richtig.“
Diana war sehr freundlich. Ich musste noch ein paar der Unterlagen digital signieren. Danach gab sie mir meinen Zimmercode, der schon bereitlag und den ich auch sofort auf meinem AD aktivierte, begleitete mich hoch in den zweiten Stock eines der zum Wohnheim gehörenden Gebäude und zeigte mir dort mein Zimmer. Ich hatte ein Doppelzimmer, was hieß, dass ich mir den kleinen Wohnraum mit zwei Betten und einem angrenzenden Badezimmer mit einer weiteren Studentin teilen würde. Es war klein, aber hübsch eingerichtet. Und das Fenster ging zur Bay hinaus. Genial!
Nachdem mir Diana ein paar Augenblicke Zeit gegeben hatte, meine neue Umgebung aufzunehmen, meinte sie: „Es tut mir leid, Nora. Wir hatten einen Last-Minute-Wechsel in der Zimmerbelegung. Deshalb wirst du die Studentin, mit der du dein Zimmer teilen wirst, erst in den nächsten Tagen kennenlernen. Ich hoffe, ihr versteht euch gut. Sollte es aber zu Konflikten kommen, dann sprich bitte entweder mit mir oder mit der Bayhill-Leiterin Rose Ashcroft. Wir werden dann sehen, was sich machen lässt.“
Ich bedankte mich herzlich bei Diana, schleppte mein Gepäck ins Zimmer, warf einen letzten Blick aus dem Fenster auf die Bay, wo gerade die Sonne unterging, schickte einen kurzen Chat an meine Eltern und fiel dann erschöpft in mein Bett.
Ich schlief gut, überraschenderweise ohne allzu oft wegen des Jetlags aufzuwachen.
Leider brachte der nächste Morgen keine neuen Erkenntnisse zum Verbleib von Eric. Ich hatte die letzten zwei Tage einige Male versucht, ihn zu erreichen. Auch heute rief ich erneut in seiner Firma an, in der Hoffnung, dass am Wochenende vielleicht jemand im Büro sei, aber erfolglos. Also hinterließ ich nur eine Nachricht mit der Bitte, dass mich Eric doch zurückrufen solle. Ich gab meine Nummer und die neue Adresse im Wohnheim an, wo er mich erreichen könne. Bisher nichts!
Dafür hatte ich etwa zehn Anrufe von meiner Oma, der ich wohl das Phänomen der Zeitverschiebung noch mal genauer erläutern musste, gespickt mit unendlich vielen guten Ratschlägen als Sprachnachricht. Ein kurzer Video-Chat mit meinen Eltern bestätigte meinen leisen Verdacht, dass die Achtziger-Oma noch nicht aufgegeben hatte, mich zeitnah in Kalifornien zu besuchen. Meine Mutter versprach mir jedoch, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die alte Dame an Ort und Stelle festzuhalten.
Nachdem ich mich noch ein bisschen in meiner Behausung für die nächsten zwölf Monate eingerichtet hatte, machte ich mich auf, um meine neue Umgebung zu erkunden. Unweit des Wohnheims befand sich ein größerer Food Court mit mehreren kleinen Restaurants, die Essen aus verschiedenen Ländern anboten – der Vorteil einer Uni mit internationalen Studenten –, und mehreren Cafés. Eines davon gefiel mir besonders und an der Theke erspähte ich Croissants und frisch geschnittenes Obst. Der Geruch nach frisch gemahlenem Kaffee empfing mich, als ich mich näherte. Ja, genau hier wollte ich mich für die nächsten Wochen einnisten. Ich bestellte mein Frühstück an der Theke bei einer superfreundlichen jungen Frau namens Maria und zog mich dann mit meinen Schätzen an einen Tisch im Außenbereich des Cafés zurück. Ich saß nicht lange, als zwei Mädchen, etwa in meinem Alter, mit ihren eigenen Frühstückstabletts auf mich zusteuerten.
„Hey“, sprach mich die eine von ihnen freundlich an. Sie war groß, schlank und hatte blonde kurze Haare und eine ganze Menge Sommersprossen im Gesicht. „Bist du neu hier in Berkeley?“
„Ja, ich bin Nora. Erst gestern Abend in San Francisco gelandet. Ich komme aus Deutschland, aus der Nähe von München.“
„Cool! Ich bin Meg, und das ist Camila. Herzlich willkommen! Dürfen wir uns zu dir setzen?“ Die beiden sahen auf den ersten Eindruck recht sympathisch aus und ich machte ihnen schnell Platz an meinem Tisch.
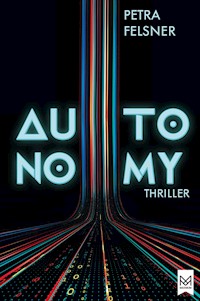














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













