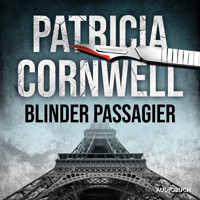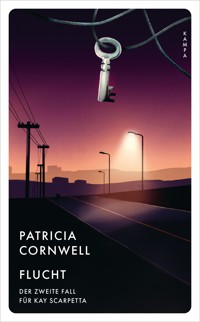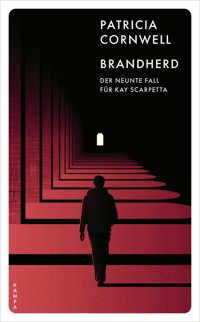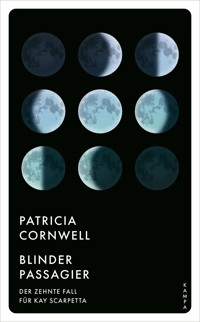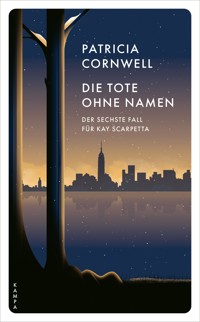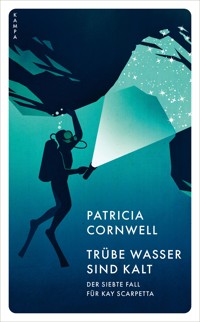16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kay Scarpetta
- Sprache: Deutsch
Dr. Kay Scarpetta ist wieder da, wo alles begann: Die renommierte Pathologin lebt nach vielen Jahren wieder in Virginia, gemeinsam mit ihrem Mann Benton, der als Rechtspsychologe beim Secret Service arbeitet, und ihrer geliebten Nichte Lucy. Aber Scarpettas Start als leitende Gerichtsmedizinerin von Virginia gestaltet sich mühsam: Ihr Vorgänger hat ihr nicht nur eine herrische Sekretärin hinterlassen, sondern auch marode Strukturen. Und es dauert keine vier Wochen, bis Scarpetta es mit einem verstörenden Fall zu tun bekommt: Eine Frau wurde brutal ermordet, ihre Leiche auf einem Bahngleis »drapiert«. Und die Ermittlungen führen Scarpetta gefährlich nah an ihr eigenes Zuhause, ihr privates Umfeld heran. Noch dazu wird die Gerichtsmedizinerin ins Weiße Haus beordert - als Mitglied einer Kommission, die mit Angriffen auf die nationale Sicherheit befasst ist. Bei einer streng geheimen Weltraummission scheint es eine Katastrophe gegeben zu haben, der Kontakt zu den Astronauten ist abgebrochen. Und während Scarpetta im All ermittelt und eine forensische Ferndiagnose aus 400 Kilometern Entfernung stellt, ereignet sich auf Erden ein zweiter, ganz ähnlicher Mord an einer Frau, wieder in der Nähe von Scarpettas Zuhause …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Patricia Cornwell
Autopsie
Ein Fall für Kay Scarpetta
Aus dem amerikanischen Englisch von Karin Dufner
Kampa
Für Staci, du hast es möglich gemacht
&
Für Mom, die mein gruseliges Zeug nicht lesen konnte
Die Welt ist voll von offensichtlichen Dingen, die zufällig niemand je bemerkt.
Sherlock Holmes
Autopsia (griechisch): sich selbst vergewissern.
1
Ein flammend roter Sonnenuntergang verglüht über Alexandrias Old Town am sich verdunkelnden Horizont. Es ist der Montag nach Thanksgiving, kurz vor fünf Uhr nachmittags.
Der böige Wind frischt auf, und ein vom Potomac River heranziehender Nebel verhüllt den Mond. Bäume und Büsche schütteln sich heftig, totes Laub huscht aufgewirbelt über den Asphalt. Unheilverkündende Wolken rücken heran wie eine feindliche Armee. Die Fahnen vor meinem Institut in Northern Virginia flattern wild.
Ich kauere mich vor den feuerfesten Aktenschrank und tippe die Kombination in das einbruchssichere Zahlenschloss ein. Nachdem ich die unterste Schublade geöffnet habe, hole ich den dicken Ziehharmonikaordner heraus, den ich schon seit Monaten mit mir herumschleppe. Der muffige Geruch inzwischen nicht mehr geheimer Behördenakten, die bis in die vierziger Jahre zurückreichen, steigt mir in die Nase. Viele der Dokumente sind zum Großteil geschwärzt.
Bis zur nächsten Sitzung der National Emergency Contigency Coalition, besser bekannt als Doomsday Commission – Arbeitskreis »Jüngstes Gericht« –, die diesmal im Pentagon tagt, muss ich noch eine Menge lesen. Mein Auftrag, direkt vom Weißen Haus, ist nichts für schwache Nerven, allerdings nicht so dringend wie das, was hier direkt vor mir auf mich wartet. Ständig muss ich an die Ermordete denken, die in meinem Kühlfach liegt.
Ich erinnere mich an die Schnittwunden an ihrem Hals und die blutigen Stümpfe, wo ihr jemand die Hände abgehackt hat. Wer sie ist, kann ich nicht sagen; ich weiß nur das, was ihre Leiche mir preisgibt. Sie wurde wie ein Müllsack neben den Bahngleisen auf Daingerfield Island, einige Kilometer nördlich von hier, entsorgt. Das ganze Wochenende lang habe ich mich mit ihr befasst und bin keinen Schritt weitergekommen.
Seit ich meine Stelle vor einem knappen Monat angetreten habe, scheinen sich die unschönen Denksportaufgaben nahtlos aneinanderzureihen. Das alles gewürzt mit einer ordentlichen Portion Intrigenspiele und Feindseligkeiten. Dass ich hier unerwünscht bin, wäre noch untertrieben, und ich habe außerdem einen ziemlichen Schweinestall geerbt. Gerade ziehe ich den weißen Kittel aus, hänge ihn über meinen Schreibtischstuhl und decke das Mikroskop für die Nacht ab, als es in der Ferne donnert. Alles vibriert, und ein Blitz erleuchtet den finsteren Himmel.
In meinem Eckbüro habe ich einen Logenplatz, um das dramatische Wetterschauspiel zu verfolgen. Der Parkplatz, den wir mit dem kriminaltechnischen Labor teilen, hat sich rasch geleert. Straßenlaternen funzeln vor sich hin. Zahlreiche Wissenschaftler, Ärzte und weitere Angestellte hasten zu ihren Autos, während die ersten Regentropfen an meiner Fensterscheibe zerplatzen.
Die meisten Leute kenne ich noch nicht, und offenbar erinnert sich niemand mehr an mich, aus jenen Jahren, die inzwischen eine Lebenszeit her zu sein scheinen. Viele der Millennials waren noch gar nicht auf der Welt, als ich, die erste Frau in dieser Position, Chief Medical Examiner von Virginia wurde. Bevor ich an eine andere Stelle wechselte, war ich mehr als ein Jahrzehnt oberste Gerichtsmedizinerin in diesem Bundesstaat. Damals nahm ich an, dass es ein Abschied für immer wäre. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass ich eines Tages zurückkommen würde. Und ich hoffe, dass das nicht der größte Fehler meines Lebens war.
Auf den Flachbildschirmen an der Wand kann ich die Vorgänge in und vor dem Gebäude in Echtzeit beobachten. In diesen Minuten durchquert der Mann vom Wachschutz die gewaltige Tiefgarage. Ich fühle mich wie eine geisterhafte Voyeurin, als er sich gähnend kratzt, ohne auf die Überwachungskameras an der Decke zu achten. Er ist über sechzig und heißt mit Vornamen Wyatt. Seinen Nachnamen kenne ich nicht.
In seiner Khakiuniform mit braunen Taschenaufschlägen sieht er wie ein Sheriff aus, er marschiert die Betonrampe zur Gerichtsmedizin hinauf und drückt auf einen Knopf an der Wand aus Betonbausteinen. Die massive Tür öffnet sich, sodass die wabernde Abgaswolke eines ausfahrenden Leichenwagens in Sicht kommt. Laut der Liste der zur Bestattung freigegebenen Leichen ist es vermutlich der Suizid aus Fairfax County.
»Dr. Scarpetta?«, reißt meine übereifrige britische Sekretärin mich aus meinen Gedanken. Sie steckt den Kopf durch die Tür zwischen unseren Büros. »Es tut mir ja so leid, Sie stören zu müssen.« Es tut ihr überhaupt nicht leid, und sie spart sich wie meistens die Mühe anzuklopfen.
»Ich mache jetzt Feierabend, und das empfehle ich Ihnen auch.« Ich gehe von Fenster zu Fenster und schließe die Jalousien.
»Ich habe gerade mit August Ryan gesprochen«, verkündet sie. »Ich soll Ihnen ausrichten, dass etwas geschehen ist, bei dem er Ihre Hilfe braucht.«
»Hat es mit der Frau unten zu tun?«, mutmaße ich. Der Ermittler der U.S. Park Police und ich haben seit Freitagabend nicht mehr miteinander gesprochen.
Ich hoffe, dass er endlich neue Informationen für mich hat. Inzwischen sind die Medien auf den Fall aufmerksam geworden, und im Netz kursieren die wildesten Gerüchte und Theorien. Es ist nämlich nahezu unmöglich, ein Gewaltverbrechen aufzuklären, ohne die Identität des Opfers zu kennen.
»Er möchte, dass Sie sich mit ihm treffen.« Meine Sekretärin benimmt sich, als sei sie mir weisungsbefugt und nicht umgekehrt.
Wie immer trägt Maggie Cutbush einen Tweedrock und Mokkassins. Das stahlgraue Haar hat sie frisiert wie in den Fünfzigern. Nun mustert sie mich tadelnd über den Rand der Metallbrille hinweg, die ganz vorne auf ihrer spitzen Nase ruht.
»Aus welchem Grund möchte er denn …«, setze ich an.
»Das erklärt er Ihnen selbst«, unterbricht sie mich.
»Warum haben Sie ihn nicht einfach mit mir verbunden? Eigentlich wäre es sowieso besser gewesen, wenn er mich direkt angerufen hätte. Ich habe ihm am Freitagabend am Tatort meine Mobilfunknummer gegeben.«
»August und ich arbeiten schon seit Jahren zusammen. Deshalb war er so höflich, sich zuerst an mich zu wenden. Er meldet sich bei Ihnen, sobald er im Auto sitzt«, erwidert sie in ihrem reizenden Londoner Akzent, und das ohne jede Spur von Respekt vor der Frau, die hier das Sagen hat.
Offenbar sieht sie dazu keinen Grund, denn schließlich stammt diese Frau in zweiter Generation von italienischen Einwanderern ab und ist in Miamis Unterschicht aufgewachsen. Ich nehme meine Jacke vom Garderobenständer, denn ich will nichts wie raus hier. Und zwar nicht wegen derzeit anwesender Personen oder des Wetters. Heute hat meine Nichte Geburtstag, angesichts der Umstände kein freudiges Ereignis. Trotzdem habe ich eine kleine Feier im Familienkreis bei mir zu Hause geplant.
»Eine von Dr. Reddys Stärken war, dass er delegieren konnte.« Maggie ist noch nicht am Ende ihres Vortrags angelangt. »Er hat seine Kontaktdaten nicht überall verteilt wie Süßigkeiten an Halloween.« So, als ob ich das täte. »Er hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass er für die Polizei nicht auf Abruf bereitsteht. Das ist eine Lektion, die zu lernen Ihnen nicht schaden würde.«
Sie nutzt wirklich jede Gelegenheit, ihren ehemaligen Vorgesetzten zu erwähnen, den früheren Chief Medical Examiner, den ich, wie sich herausstellte, unter falschen Voraussetzungen abgelöst habe. »Zuckerbrot und Peitsche« würde die Ereignisse nach meinem Umzug aus Massachusetts hierher wohl am besten zusammenfassen. Man hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt.
Viel zu spät fand ich heraus, dass Elvin Reddy, anders, als er selbst und einige Leute aus der Chefetage mir versichert hatten, nämlich mitnichten vom Staatsdienst in die Privatwirtschaft wechseln wollte. Stattdessen wurde er zum gesundheitspolitischen Sprecher von Virginia ernannt und führt nun die Oberaufsicht über sämtliche Behörden, die für die Sicherheit und das Wohlergehen der Bevölkerung zuständig sind.
Dazu gehört auch das überregionale Office of the Chief Medical Examiner (OCME). Was heißt, dass er mir gegenüber im Ernstfall weisungsbefugt ist. Ein geschickter politischer Schachzug wie aus dem Lehrbuch.
»Wie Sie selbst feststellen können, dauert es nicht lange, bis so etwas den Leuten zu Kopfe steigt«, fährt Maggie fort. Das muss ausgerechnet sie sagen. »Ich würde vorschlagen, dass Sie einen Ermittler mitnehmen. Fabian hat heute Abend Dienst. Vor ein paar Minuten war er noch an seinem Schreibtisch.«
»Hängt davon ab, womit wir es zu tun haben«, antworte ich. »Wahrscheinlich wird es nicht nötig sein. Ich glaube, ich komme auch allein zurecht.«
Als ich mich nach der Sprühflasche mit gefiltertem Wasser umschaue, entdecke ich sie auf einem Regal neben dem Konferenztisch.
»Wenn die Chefin persönlich erscheint, vermittelt das eine falsche Botschaft. Noch dazu allein. Das ist kein guter Start«, spricht Maggie weiter, als hätte sie es mit einer Anfängerin zu tun.
»Ich bin sicher, dass Sie nur mein Bestes wollen.« Mein Tonfall ist weder spitz noch abweisend.
»Das versteht sich doch wohl von selbst.« Sie blockiert die Tür nach draußen. Ich umrunde die Kisten mit Büchern und anderen Besitztümern, die ich noch auspacken muss.
»Mir ist klar, dass Ihnen mein Stil nicht liegt, Maggie«, beginne ich und besprühe dabei meine Geigenfeige und die eingetopften Orchideen. »Aber ich halte nicht viel von Etikette. Wenn ich mir für etwas zu fein bin, kann ich auch von anderen kein Engagement verlangen.«
Ich verkneife mir den Hinweis auf den wahren Grund, warum man mir wieder die Position der Chefin angetragen hat. Die Anzahl der Fälle, die in den letzten Jahren vernachlässigt oder unsachgemäß behandelt wurden, ist atemberaubend. Insbesondere hier in Northern Virginia, wo es aufgrund der geographischen Lage besondere Probleme gibt.
Mein Büro befindet sich nur knapp acht Kilometer entfernt vom Pentagon. Dass ich in der Zentrale hier in Alexandria eingesetzt werde, wenn ich die Stelle annehme, war von Anfang an klar. Angesichts der vielen Funktionen, in denen mein Mann und ich für die Regierung tätig sind, ist es wichtig, dass wir in der Nähe von Washington, D.C., wohnen.
»Es ist meine Aufgabe, die Polizei zu unterstützen, wenn sie mich braucht«, erkläre ich Maggie zum wiederholten Mal die Sachlage. »Man muss sich also nicht zuerst an Sie wenden.«
»Vermutlich verschieben wir besser Lucys Geburtstagsparty«, wechselt sie abrupt das Thema. »Benton, Pete Marino, Ihre Schwester. Sonst noch jemand? Ich gebe Bescheid.«
»Sonst niemand, und ich stimme Ihnen zu, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist.« Ich werde mich nie daran gewöhnen, dass ich meine Mitmenschen regelmäßig enttäuschen muss.
Nur dass Gewalt und sinnlose Tragödien leider keine Rücksicht darauf nehmen, wer man ist oder ob einem der Zwischenfall zeitlich in den Kram passt. Jemand muss zum Tatort. Also kehre ich zurück an meinen Schreibtisch, fest entschlossen, Lucy dafür zu entschädigen. Wie ich es schon so oft geschworen habe.
»Es muss wirklich entsetzlich für sie sein.« Maggie schüttelt in gespielter Anteilnahme den Kopf. »Ihre Partnerin und ihren Adoptivsohn zu verlieren«, fährt sie fort. Allerdings habe ich nicht die Absicht, meine Nichte und den Grund, warum sie wieder bei mir wohnt, mit Maggie zu erörtern. »Nicht, dass ich diesen Lebensstil wirklich verstehen würde. Jedenfalls ist diese Jahreszeit für unglückliche Menschen besonders schwer.«
»Sie brauchen nicht zu warten.« Ich fordere sie auf, zu gehen und wegen der Wetterverhältnisse vorsichtig zu fahren. Über ihre kränkenden Anspielungen sehe ich hinweg. »Ich melde mich bei August Ryan.«
Hoffentlich hat er etwas Hilfreiches über die Frau in meinem Kühlfach herausgefunden. Man braucht keine Gerichtsmedizinerin zu sein, um festzustellen, dass sie verblutet ist, und zwar nachdem ihr mit einer scharfen Klinge die Halsschlagadern durchtrennt wurden. Wie alt sie ist, weiß ich nicht. Meiner Schätzung nach war sie Ende zwanzig, Anfang dreißig, als ihr jemand von hinten den Schädel eingeschlagen und ihr die Kehle bis hinunter zur Wirbelsäule aufgeschlitzt hat.
Als ich am letzten Freitagabend in einem abgelegenen Waldstück auf Daingerfield Island am Tatort gearbeitet habe, war es stürmisch. Beinahe kann ich das mit Teeröl imprägnierte Holz noch riechen. Regentropfen prasselten auf die Eisenbahnschwellen nieder, während ich jeden Zentimeter der Leiche mit einer Lupe absuchte. Die Lichtkegel der Taschenlampen durchschnitten die stockfinstere Nacht wie eine Lasershow, als Polizisten die ganze Umgebung durchkämmten.
Sie entdeckten nichts als einen platt gedrückten Penny, vermutlich überrollt vom Nahverkehrszug um neunzehn Uhr, als der Lokführer am Bahndamm eine ausgestreckte Gestalt bemerkte, die er zunächst für eine nackte Schaufensterpuppe hielt.
»Tut mir leid, wenn ich Ihnen den Abend vermiese«, beginnt August Ryan in gedehntem Tonfall, als ich den Anruf annehme. »Denn ich bin ziemlich sicher, dass ich das tue. Außerdem kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass die Fahrt hier raus kein Vergnügen wird. Aber wie ich Maggie schon erklärt habe, würde ich Sie nicht drum bitten, wenn es nicht wichtig wäre.«
»Was kann ich für Sie tun?« Ich schreibe Uhrzeit und Datum in mein kleines, in festen Baumwollstoff gebundenes Notizbuch.
»Wir haben eine vermisste Person, und es sieht nicht gut aus.« Der Ermittler der Park Police kommt sofort auf den Punkt.
»Verzeihung, aber geht es um den Fall von Freitagabend?«, hake ich nach. »Glauben Sie, die vermisste Person könnte mit der Frau in meinem Kühlfach identisch sein?«
»Hört sich ganz danach an. Das Alexandria Police Department hat mich informiert, nachdem eine Beamtin eine inzwischen verschwundene Person überprüfen sollte. Ich bin unterwegs in Ihre Gegend. Colonial Landing, am Ufer«, fügt er zu meiner Überraschung hinzu.
Diese neue Wohnsiedlung kenne ich nur allzu gut. Pete Marino und meine Schwester Dorothy leben dort. Die luxuriös ausgestatteten Stadthäuser befinden sich fußläufig zur historischen Altstadt, wo Benton und ich eine alte, renovierungsbedürftige Villa gekauft haben. Lucy wohnt in unserem Gästehaus. Endlich habe ich alle sicher um mich herum versammelt. Das dachte ich wenigstens. Allerdings kann man sich nicht darauf verlassen, dass man irgendwo hundertprozentig sicher vor Gewalt ist.
Auch wenn sie in Old Town Seltenheitswert hat. Tötungsdelikte kommen nur sehr selten vor; es gibt im Durchschnitt eines im Jahr. Laut den Statistiken, die ich gelesen habe, handelt es sich dabei zumeist um einen Raub oder einen häuslichen Streit mit fatalem Ausgang. Vergewaltigungen und Überfälle sind quasi nicht existent. Die Bewohner fürchten sich höchstens vor Einbrechern und Autoknackern.
»Gwen Hainey«, teilt August mir den Namen der vermissten Frau mit. »Dreiunddreißig, biologisch-medizinische Laborantin bei Thor Laboratories. Das ist etwa dreißig Kilometer von Ihnen entfernt in Vienna, eine dieser großen Technikfirmen an der I-95.«
»Thor ist mir ein Begriff, zumindest dem Namen nach. Welche Aufgaben hatte Gwen Hainey dort genau? Ich schreibe mit.«
»Ich habe mit dem Laborleiter gesprochen, und der verrät es mir nicht. Nur dass sie Wissenschaftlerin und mit speziellen Projekten betraut ist. Vielleicht wissen Sie ja, dass ein Großteil der Forschung, die dort betrieben wird, geheime Regierungssachen betrifft.«
»Unter anderem sind sie Pioniere, was die Herstellung von menschlicher Haut, Organen, Blutgefäßen und anderen Körperteilen mit dem 3-D-Drucker angeht. Einschließlich Ohren«, fasse ich kurz für ihn zusammen.
»Wirklich?«
»Das klingt zwar nach Science-Fiction, ist aber bereits Realität.«
»Noch etwas, das unser Leben komplizierter und unsere Arbeit schwieriger macht«, lautet sein einziger Kommentar. Ich kann ihn noch nicht richtig einschätzen.
Am Freitagabend habe ich ihn zum ersten und bislang einzigen Mal erlebt und würde ihn als abgebrüht bezeichnen. Mit allen Wassern gewaschen. Lässt sich nichts anmerken. Nicht leicht, ihn zu fassen zu kriegen. Frisch geschieden, keine Kinder, und ich habe den Eindruck, dass er zu beschäftigt für ein Privatleben ist.
»Wie nimmt man von künstlicher Haut ein DNA-Profil ab?«, dringt Augusts Stimme aus dem Raumlautsprecher.
»Darüber zerbrechen wir uns ein andermal den Kopf«, entgegne ich. »Wann hatte man bei Thor zum letzten Mal Kontakt mit Gwen?«
»Wie es aussieht, nicht seit Thanksgiving. Heute ist sie nicht zur Arbeit erschienen und auch nicht ans Telefon gegangen, das übrigens bis jetzt noch nicht aufgetaucht ist.«
Er erklärt, der Laborleiter sei besorgt gewesen und habe die Polizei verständigt. Die Polizistin, die nach dem Rechten sehen sollte, fand Gwens Haustür verschlossen vor. Offenbar war niemand zu Hause.
»Officer Fruge.« August erkundigt sich, ob ich sie kenne.
Fruge, wie in frugal, und ich habe den Verdacht, dieser ungewöhnliche Name könne einer aus meiner Vergangenheit sein. Deshalb will ich von ihm wissen, ob besagte Polizistin womöglich mit der umstrittenen Toxikologin verwandt ist, mit der ich früher in Richmond zusammengearbeitet habe.
»Ja, ganz richtig«, erwidert er. »Blaise Fruge ist ihre Tochter. Sie war am Freitagabend kurz da, weil sie die Erste am Tatort war.«
Er fügt hinzu, die Polizistin aus Alexandria sei gerade Streife gefahren, als man die Leiche fand. Sie hat den Funkspruch angenommen und war bei meiner Ankunft vermutlich schon wieder weg. Allerdings hätte ich sie ohnehin nicht bemerkt, denn in dem Wäldchen, wo ich die Leiche untersuchte, wimmelte es von Polizisten.
»Übertrieben ehrgeizig und leidet außerdem an Selbstüberschätzung, und das sind die Allerschlimmsten«, spricht August weiter. Mein Trackingarmband vibriert, als einige Nachrichten und E-Mails eingehen. »Die muss man im Auge behalten, denn sie hält sich für die Inkarnation von Sherlock Holmes. Aber weit gefehlt, das können Sie mir glauben.«
»Lassen Sie mich rekapitulieren«, erwidere ich. »Officer Fruge hat den Funkspruch angenommen, der den Leichenfund auf Daingerfield Island meldete. Und nun geht sie einer Vermisstensache nach, die möglicherweise damit in Zusammenhang steht. Ganz schön umtriebig, die Frau.«
»Wenn Sie meine Meinung hören wollen, hat die kein Privatleben.«
»Was geschah nach ihrer Ankunft in Colonial Landing?«
»Sie hat sich vom Verwalter Gwen Haineys Haus öffnen lassen. Da drin hat eindeutig eine Gewalttat stattgefunden.« Während Augusts Stimme aus dem Raumlautsprecher hallt, lese ich die Textnachricht, die Benton mir gerade geschickt hat.
Maggie hat ihn erreicht. Jetzt ist er auf dem Heimweg und zu spät dran, was sonderbar ist. Er hat mir gar nicht gesagt, dass er heute wegwollte. Ich dachte, er arbeitet im Homeoffice. Rasch antworte ich ihm und frage, ob alles in Ordnung sei. Unterdessen schildert August weiter, was Officer Fruge im Haus angetroffen hat.
2
»Ihr Rucksack steht, mit Brieftasche und Schlüssel darin, auf dem Küchentisch und scheint auch nicht durchwühlt worden zu sein. Allerdings fehlt, wie ich bereits erwähnt habe, jede Spur von ihrem Smartphone«, erklärt August, während ich vom Schreibtisch aufstehe. »Wir besorgen uns die Verbindungsnachweise von ihrem Anbieter, um festzustellen, wann und mit wem sie zuletzt telefoniert hat oder von wem sie angerufen wurde.«
»Was ist mit ihrem Auto?«, frage ich auf dem Weg ins Bad, wo ich Kleidung zum Wechseln aufbewahre.
»Soweit mir bekannt ist, hat sie einige Tage pro Woche im Homeoffice gearbeitet.« Seine Stimme folgt mir beim Umhergehen. »An den anderen Tagen ist sie bei Kollegen mitgefahren oder hat einen Fahrdienst bestellt. Es ist kein Wagen auf sie zugelassen.«
»Das finde ich ein wenig ungewöhnlich«, erwidere ich. Eine Nachricht von Benton trifft ein: Bin auf Heimweg von außerplanmäßigem Meeting.
»Was wissen wir sonst über Gwen?« Ich ziehe Schuhe und Hose aus.
»Da wäre noch etwas Sonderbares«, antwortet August. »Wenn man sie googelt, kriegt man kein Ergebnis. So, als würde sie nicht existieren.«
»Auch nicht in den sozialen Medien?« Ich hänge mein Kostüm auf.
»Nichts. Nicht einmal bei Twitter. In den Nachrichten ebenfalls Fehlanzeige. Einfach gar nichts.«
»Was ist mit Fotos in ihrer Wohnung? Vielleicht stehen ja welche in Rähmchen herum. Oder ein Album? Irgendwelche Fotos, auf denen sie abgebildet sein könnte?« Ich setze mich auf den Klodeckel und ziehe warme Socken an. »Wissen wir überhaupt, wie Gwen aussieht?«
Ich stelle mir das Gesicht des Mordopfers vor. Die Frau hat langes braunes Haar und einen athletischen Körperbau. Vermutlich war sie recht attraktiv, auch wenn sich das inzwischen nur noch schwer sagen lässt.
»Dasselbe habe ich Fruge auch gefragt: bis jetzt keine Fotos. Laut ihrem Laborchef ist sie etwa eins achtundsechzig«, spricht August weiter, während ich die Beine in eine schwarze Cargohose stecke. »Ungefähr fünfundsechzig Kilo, braune Augen und schulterlanges braunes Haar.«
»Klingt gut, könnte aber auf viele Menschen zutreffen«, sage ich, wobei ich mit meinem üblichen Dilemma kämpfe: Ich will das Opfer identifizieren. Allerdings wünsche ich weder Gwen Hainey noch sonst jemandem so ein Schicksal.
»Ich habe eine elektronische Kopie ihres Führerscheins«, fährt August fort. »Das Foto ist alt, raspelkurzes blondes Haar. Geboren ist sie am 5. Juni 1988. Laut Führerschein ist sie eins fünfundsechzig, was fast stimmt. Allerdings fünfzehn Kilo schwerer, weshalb ich nicht schwören kann, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt. Offenbar hat sie das Stadthaus nur vorübergehend gemietet, weshalb es hier wenige persönliche Gegenstände gibt.«
»Hat sie ein Tattoo?« Ich schlüpfe in meine Stiefel.
»Ihr Laborleiter hat keines bemerkt. Ich habe ihm nicht verraten, dass die Ermordete eines hat.«
»Und wissen wir, warum Gwen vorübergehend nach Old Town gezogen ist?« Ich binde meine Schnürsenkel zu einer Doppelschleife.
»Soweit ich informiert bin, hat sie erst vor Kurzem bei Thor angefangen. Sie wollte keine Verpflichtungen eingehen, bevor sie nicht sicher sein konnte, dass es mit dem Job klappen würde. Offenbar war es ihr mit dem Einzug in dieses Stadthaus sehr dringend.«
»Wo hat sie denn vorher gewohnt?« Ich ziehe ein langärmeliges schwarzes Funktionshemd mit dem Wappen des OCME an, der Hermesstab und die Waagschalen der Justitia, eingestickt in Blau, Gold und Rot.
»Boston«, antwortet August, während ich das Bad verlasse und mir dabei das Hemd zuknöpfe. »Ich habe Ihnen ein Foto weitergeleitet, das Fruge mir geschickt hat. Eine Zwanzig-Kilo-Kugelhantel direkt neben der Haustür. Ein eigenartiger Platz dafür, außer sie hat das Ding als Türstopper benutzt, oder?«
»Ich öffne gerade das Foto«, teile ich ihm mit.
Die leuchtend blaue Kugelhantel ist rund mit abgeflachter Unterseite und hat eine glänzende Edelstahlschlaufe als Griff. Sie liegt auf der Seite links neben der Haustür auf dem Parkettboden. August fragt sich, ob der Angreifer Gwen womöglich damit auf den Hinterkopf geschlagen hat.
»Immer ausgehend davon, dass sie und das Mordopfer vom Freitagabend ein und dieselbe Person sind«, fügt er hinzu.
»Können wir sicher sein, dass Officer Fruge nichts verändert hat?« Ich vergrößere das Foto auf dem Display.
»Sie sagt Nein. Sie habe nur in den Rucksack geschaut. Bei der Durchsuchung des Hauses trug sie eine Maske und Handschuhe und war sehr vorsichtig. Behauptet sie wenigstens.«
»Und dann?«
»Dann hat sie auf die Kriminaltechnik gewartet. Die haben sich alles angesehen und Videoaufnahmen und Fotos gemacht. Aber sie wollen die Sache erst gründlicher unter die Lupe nehmen und nach Spuren suchen, wenn Sie und ich vor Ort sind.«
»Nur dass wir nicht wissen, ob wir es wirklich mit einem Tatort zu tun haben, richtig?«, spreche ich das Offensichtliche aus.
Ich male mir aus, wie die verschwundene Laborantin nach Hause kommt und die Polizei dabei antrifft, wie sie alles auf den Kopf stellt. Die Anwesenheit der Gerichtsmedizinerin wäre das Sahnehäubchen. So etwas hätte mir in meinem ersten Monat in diesem Job gerade noch gefehlt. Schließlich habe ich schon Ärger genug.
»Glauben Sie, dass es für einen Durchsuchungsbeschluss reicht?«, erkundige ich mich bei August.
»Den kriegen wir innerhalb der nächsten Stunde.«
»Wieso gehen Sie von einem Gewaltverbrechen aus?« Ich öffne den Schrank und hole den großen schwarzen Hartschalenkoffer heraus, der mich stets zum Tatort begleitet. »Von welchen Kampfspuren reden wir?«
»Anscheinend wurde in der Garage Blut gefunden. Außerdem sind die Möbel im Wohnzimmer verschoben worden. Ich denke, Sie sollten besser herkommen«, meint er, und wir beenden das Gespräch.
Ich ziehe die Jacke an, schließe ab und folge dem fensterlosen Flur, vorbei an geschlossenen Bürotüren. Wände und Fußboden sind hellgrau, die Beleuchtung ist gedämpft. Wyatt, der Nachtwächter, kommt aus dem Aufzug auf mich zu. In der Tüte in seiner Hand befindet sich vermutlich sein Abendessen.
»Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht«, sage ich zu ihm. »Und hoffentlich eine ruhige.«
»Hier ist es immer ruhig, Ma’am. Zu ruhig.« Er biegt nach rechts in den Aufenthaltsraum ab, wo der diensthabende forensische Ermittler sich gerade mit einer Cafetière einen Kaffee macht.
Fabian trägt die gleiche aus Funktionskleidung bestehende Uniform wie ich. Mir wäre es lieber, wenn ich ihm nicht ausgerechnet jetzt begegnet wäre. Der große Hartschalenkoffer in meiner Hand verrät, dass ich unterwegs zu einem Tatort bin. Und ich will nicht, dass er mitkommt oder auch nur mit dem Gedanken an diese Möglichkeit spielt.
»Sie sollten nicht allein dort aufkreuzen«, verkündet er. Offenbar hat meine Sekretärin ihn informiert. »Ich habe Maggie gesprochen, als sie vor ein paar Minuten ging. Sie hält es für besser, wenn ich Sie zum Tatort begleite. Ich bin bereit. Den Kaffee können wir ja mitnehmen. Möchten Sie auch einen?«
»Nein danke.«
Es liegt auf der Hand, dass August mit Maggie über Einzelheiten geredet hat, die er besser für sich behalten hätte. Und sie hat dann alles Fabian weitererzählt und erteilt Anweisungen, als hätte sie hier die Leitung inne. Auch das ist ärgerlich.
»Sind Sie sicher, dass ich nicht mitkommen soll?« Er schenkt mir ein strahlendes Lächeln. Wenn er will, kann er wirklich charmant sein, das muss ich ihm lassen.
Bevor er herkam, war er Arzthelfer in Louisiana. Er ist Ende zwanzig und könnte mit seinem Silberschmuck, den Tattoos, dem fein geschnittenen Gesicht und dem schwarzen Haar, das er lang trägt wie Cher, auch als Goth-Model arbeiten. Von meinen drei Ermittlern ist er mit Abstand der beste, denn der eine steht kurz vor der Rente, und der andere ist nicht gerade eine Leuchte.
»Falls ich Sie brauche, gebe ich Ihnen Bescheid«, teile ich Fabian mit. »Aber ich glaube, eher nicht.«
»Ich habe nichts von neuen Lieferungen gehört«, mischt Wyatt sich ein, übertönt dabei den Lärm der Mikrowelle und beäugt mich argwöhnisch. »Es werden auch keine erwartet, oder?«
»Bis jetzt nicht. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt«, antworte ich.
»Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass der Tatort, an den Sie wollen, etwas mit der Ermordeten vom Bahndamm zu tun haben könnte?« Fabian schenkt sich eine Tasse seines starken Kaffees ein, eine rauchige Mischung mit Zichorie, die seine Mutter ihm aus Baton Rouge schickt.
»Vielleicht«, entgegne ich. Dabei frage ich mich, warum es hier offenbar Methode hat, sich übergriffig zu verhalten und mich zu verhören.
»Ich meine ja nur. Wenn es so wichtig ist, dass Sie mal einen Blick drauf werfen sollen?« Er rührt Agavensirup, seinen bevorzugten Süßstoff, in die Tasse. »Brauchen Sie wirklich keine Hilfe? Schließlich ist mir der Fall vertraut.«
Er hat mit mir am letzten Freitag den Tatort untersucht. Allerdings bedeutet das nicht, dass ich ohne ihn aufgeschmissen wäre. Diese Form von Selbstüberschätzung ist die Folge, wenn ein Vorgesetzter sich abschottet und sich nicht für seine Mitarbeiter interessiert. Elvin Reddy hat es geschafft, dass Anmaßung hier inzwischen zum guten Ton gehört.
Ich wünsche Fabian und Wyatt eine gute Nacht und mache mich auf den Weg. Seit Ausbruch der Coronapandemie meide ich Aufzüge, so gut ich kann. Meine Stiefel poltern dumpf über die Betonstufen des Treppenhauses. Ein paar Etagen tiefer öffne ich eine fensterlose Brandschutztür und trete in einen weiteren Flur hinaus. Dieser ist weiß wie in einem Krankenhaus und hell erleuchtet. Es ist keine Menschenseele zu sehen.
Der CT-Raum ist abgeschlossen. Das Lämpchen an der Tür leuchtet grün, die Assistentin hat schon Feierabend. Der Autopsiesaal liegt verlassen da. Die blitzblanken Tische, Rollwagen und Arbeitsflächen aus Edelstahl sind bereit für neue Fälle. Der Nachschub wird niemals abreißen. Es gibt immer den nächsten Unfall oder Mord. Jemand setzt seinem Leben ein Ende oder fällt plötzlich tot um. Und für die Menschen, die er zurücklässt, ist mit einem Mal alles anders.
Als ich mich dem Anthropologielabor nähere, höre ich das gedämpfte Klappern der Knochen, die einige Tage in einem Bleichebad köcheln müssen, um sie zu entfleischen. Durch die Beobachtungsfenster zu beiden Seiten des Flurs kann ich den dampfenden Zwanzig-Liter-Kessel auf der tragbaren Kochplatte sehen. Darin befinden sich die verwesenden und skelettierten sterblichen Überreste, auf die ein Jäger letzte Woche gestoßen ist.
Durch ein anderes Fenster sehe ich die verrotteten Stiefel des Toten, Kleidung, eine Schachtel Marlboro, eine Halbliterflasche Fireball-Whisky und eine Brieftasche samt Inhalt, alles ausgebreitet auf einem mit Papier abgedeckten Tisch im Asservatenraum. Die Todesursache ist noch immer unbekannt. Nach dem, was die Polizei im Haus des Rentners, eines ehemaligen Mechanikers, in der Nähe von Fort Belvoir vorgefunden hat, ist er seit schätzungsweise einem Jahr tot.
In der Aufnahmezone riecht es aufdringlich nach Lufterfrischer, als ich Tatortkoffer und Aktenkoffer auf einen Wagen vor die begehbare Kühl- und Gefrierkammer stelle. Die Digitalanzeige verrät mir die Temperaturen und gibt mir weitere Informationen, die ich mithilfe einer App aufrufen kann. Alles im grünen Bereich. Ich lege Untersuchungshandschuhe und OP-Maske an.
Nachdem ich mir ein Plastiklineal von achtzehn Zentimeter Länge herausgesucht habe, verstaue ich mein Smartphone in einer mikrobenabweisenden Plastikhülle, damit ich nötigenfalls zusätzliche Fotos machen kann. Als ich die Edelstahltür der Kühlkammer öffne, schlägt mir zischend eiskalte und übelriechende Luft entgegen. Der schwarze Leichensack der Ermordeten liegt auf einem Rollwagen in der hinteren Ecke. Auf dem Etikett an ihrer Zehe steht nichts als das Datum – 30/11 – und der Fundort – Daingerfield Island, Bahndamm –, hingekritzelt in verschmierter Tinte.
Als ich den Reißverschluss des dicken Vinylsacks ein Stück weit aufziehe, sieht das Gesicht der Ermordeten noch schlimmer aus als bei der Autopsie vor einigen Tagen. Abschürfungen und Blutergüsse bilden einen scharfen Kontrast zu ihrem blutleeren, bleichen Körper. Die Reaktion des Gewebes auf ihre Verletzungen weist darauf hin, dass sie noch so lange überlebt hat, dass der Mörder sein Werk vollenden konnte.
Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen für einen sexuellen Übergriff. Doch das hat nicht unbedingt etwas zu bedeuten. Wir haben es eindeutig mit einem Sexualmord zu tun, es geht nur um Macht, und ich habe den Verdacht, dass sie den Angreifer nicht kannte, aber ihm anfangs vielleicht vertraut hat. Ansonsten wüsste ich nicht, wie er sich Zutritt zu ihrem Haus verschafft haben sollte. Oder zu dem Ort, wo er sie sonst überfallen hat.
Nach ihrem Tod hat er ihre nackte Leiche auf anstößige Weise am Bahndamm drapiert, um die Fahrgäste an Bord des nächsten Zuges zu schockieren. Zumindest, wenn man meinem Mann, einem forensischen Psychologen, Glauben schenkt, der über eine interne Datenbank aus Albträumen verfügt. Wahrscheinlich hat er recht. Das ist bei Benton meistens so. Dass ihre Leiche absichtlich zur Schau gestellt wurde, steht außer Frage. Ich mache ein Foto von ihrem Gesicht.
Die Pupillen ihrer milchigen Augen sind starr und geweitet. Ihre Lippen sind blau angelaufen und verkrustet. Die klaffende Wunde an ihrem Hals ist dunkelrot und angetrocknet. Wenn ich ihren Kopf zur Seite drehe, steigt mir der dumpfe Gestank gekühlter Verwesung in die Nase. Als ich sie am Tatort untersucht habe, war sie noch nicht lange tot. Die Leichenstarre setzte gerade erst ein.
Seitdem ist sie wieder vergangen. Ihre Muskeln lockern sich, als könnten sie sich nicht mehr gegen das Unvermeidliche stemmen.
Ihr rasierter Hinterkopf fühlt sich durch meine Nitrilhandschuhe kalt und schwammig an, als ich die eingedellte Bruchstelle im Schädel betaste. Ich spüre die Kanten der Knochen, eingedrückt durch einen einzigen heftigen Schlag. Vielleicht mit besagter Kugelhantel. Nach einem Besuch in ihrem Haus werde ich mehr wissen.
Die blutunterlaufene und aufgeplatzte Stelle an der Kopfhaut hat einen Durchmesser von etwa zehn Zentimetern. Die runde Form passt zu der möglichen Waffe. Doch ganz gleich, womit sie auch niedergeschlagen wurde, genügte die Kopfverletzung, um sie sofort schachmatt zu setzen.
Danach konnte sie nicht mehr gehen oder sprechen. Allerdings ist die Wunde nicht die Todesursache, obwohl sie es früher oder später wahrscheinlich geworden wäre. Die Ermordete hat noch lang genug gelebt, um Schwellungen und innere Blutungen zu entwickeln, und starb, nachdem ihr jemand mit einer glatt geschliffenen Klinge die Kehle von einem Ohr zum anderen durchgeschnitten hat.
Nach ihrem Tod hat man ihr die Hände abgehackt, und das heißt, es gibt keine Fingerabdrücke. Vielleicht war das ja der Grund. Nur dass es noch andere Mittel und Wege gibt, um jemanden zu identifizieren. Aber bis jetzt haben wir damit kein Glück gehabt. Sie ist nicht in der FBI-Datenbank Combined DNA Identification System – besser als CODIS bekannt – verzeichnet. Möglicherweise bringt uns ein genealogisches Profil ja weiter.
Andere Beweisstücke, hauptsächlich mikroskopische Partikel von Rost, Holz und verschiedenen im Gleisbett vorkommenden Mineralien, die ich am Tatort gesammelt habe, könnten sich in diesem Zusammenhang als hilfreich erweisen. Außerdem habe ich überall an ihrem Körper, auch in ihrem Haar, Fasern sichergestellt. Ich tippe darauf, dass der Täter sie für den Transport in irgendetwas eingewickelt hat.
Es könnte eine bunte Decke aus Synthetikmaterial gewesen sein, was mich vermuten lässt, dass sie in einem Innenraum angegriffen wurde. Ich male mir aus, wie sie in Panik gerät, vor dem Angreifer zu fliehen versucht und dabei stolpernd mit Gegenständen zusammenstößt, bis er sie packt und bewusstlos schlägt.
Anschließend bringt er sie irgendwohin, um ihr den Rest zu geben, vielleicht zum Bahndamm, wo er sie abgelegt hat. Wir haben zwar bei unserer Durchsuchung des näheren Umkreises Freitagnacht keine Hinweise darauf gefunden, doch der heftige Regen hätte das Blut sicher weggespült. Außerdem ist es in einem so dicht bewaldeten Gebiet wie diesem Park nahezu unmöglich, überhaupt etwas zu entdecken.
Nachdem ich noch einige Fotos gemacht habe, verschließe ich den Leichensack wieder und ziehe die Handschuhe aus. Auf dem Weg nach draußen umrunde ich mehrere Rollwagen, auf denen die anderen Patienten dieser traurigen Klinik liegen. Vor der Kühlkammer entledige ich mich der Schutzkleidung. Alles wandert in einen großen roten Müllsack für kontaminierte Abfälle, und ich gönne mir einen dicken Strahl Handdesinfektionsmittel, bevor ich meine Sachen hole.
Als ich an der Pförtnerloge vorbeikomme, sitzt kein Wyatt hinter der kugelsicheren Glasscheibe. Sicher hat er sich im Aufenthaltsraum verkrochen und beobachtet dort die Überwachungskameras auf dem Flachbildschirm. In der Gerichtsmedizin fühlt er sich unbehaglich, insbesondere nach Büroschluss. Ich fand das schon immer albern, denn es sind nicht die Toten, die einem gefährlich werden.
Ich verlasse das Gebäude durch die Ladezone, wo die Leichen eingeliefert und fortgebracht werden. Sie hat die Größe eines kleineren Hangars und ist momentan bis auf unser Einsatzfahrzeug leer. Nur noch ein Zodiac-Boot und Paletten mit strapazierfähigen Leichensäcken für die Bergung von Wasserleichen, Einweglaken, Kanistern mit Desinfektionsmittel und anderen Verbrauchsartikeln stehen dort herum.
Der mit beigem Kunstharzlack gestrichene Boden ist gerade mit dem Schlauch abgespritzt worden und noch feucht, sodass die Sohlen meiner Stiefel ein leises Schmatzen erzeugen. Als ich die Fußgängertür nach draußen öffne, erschreckt mich das kehlige Dröhnen eines Turbomotors im Leerlauf. Das Geräusch durchdringt die bedrohliche Dunkelheit.
3
Pete Marino nähert sich in seinem Ford-Raptor-Pick-up mit verdunkelten Scheiben der Stelle, wo ich neben dem geschlossenen Rolltor zur Gerichtsmedizin im Platzregen warte. Die Lichtkegel seiner Scheinwerfer beleuchten meinen Dienst-Subaru auf dem für den Chief Medical Examiner reservierten Stellplatz, offenbar das einzige Privileg, das mein Job mir zu bieten hat.
»Immer herein in die gute Stube, Doc. Bei diesem Mistwetter fährst du mir allein nirgendwohin«, donnert seine Stimme durch das heruntergleitende Fenster. Ich habe ihn schon eine ganze Zeit lang nicht mehr so aufgekratzt erlebt; ich glaube, es ist das erste Mal seit seiner Hochzeit.
Eine Strickmütze bedeckt seinen kahlen Schädel, und unter der Tarnjacke trägt er eine kugelsichere Weste. Seine Miene ist, um es in seinen Worten zu sagen, so ernst wie ein Herzanfall. Offenbar hat Maggie ihn erreicht und ihm brühwarm erzählt, dass ich aufgehalten wurde und Lucys Geburtstagsfeier verschieben muss.
Allerdings erklärt das nicht, warum er mich unaufgefordert abholt und mich außerdem herumkommandiert. Doch den Ausdruck in seinem wettergegerbten Gesicht kenne ich. Etwas hat seinen Panikknopf gedrückt. Ich stelle den Tatortkoffer nach hinten neben seine Heckler & Koch MP>5 und eine Munitionskiste aus dem Army-Laden.
»Was ist passiert?« Der wie wild peitschende Regen durchweicht meine Cargohose und strömt mir in die Augen, als ich auf den Beifahrersitz rutsche.
»Es könnte nicht schlimmer sein, Doc.« Er reicht mir ein fadenscheiniges Mikrofasertuch zum Abtrocknen. »Tut mir leid, mehr habe ich nicht da. Aber besser als nichts. Ich dachte, ich hätte hier irgendwo noch eine Rolle Papierhandtücher. Mist! Ich fasse es nicht!«
»Bin ich irgendwie in Gefahr und weiß davon noch nichts?« Beim Abtrocknen steigt mir ein Hauch Armor-All-Cockpitspray in die Nase. »Geht es meiner Schwester gut? Ist Lucy okay? Wieso bist du so aufgeregt?«
»Ich begreife nicht, wie so etwas möglich ist.« Damit meint er nicht das Unwetter oder dass ich ihm das blitzsaubere, nagelneu riechende Cockpit volltropfe.
Als ich den Aktenkoffer auf meinem Schoß abstelle, bemerke ich die 10-mm-Pistole auf der Mittelkonsole. Es ist seine mattgraue Guncrafter Industries 1911, mit einem Trijicon-Zielvisier und maßgefertigtem Griff. Geladen ist die Waffe mit 200er-Munition von Buffalo Bore, mit der man einen Grizzly umnieten könnte.
Und als ob diese Bewaffnung noch nicht ausreichen würde, liegt seine Maschinenpistole inklusive jeder Menge todbringender Munition griffbereit auf dem Rücksitz. Falls wir in eine Schießerei geraten sollten, könnte ich mit der SIG Sauer P226 in meinem Aktenkoffer meinen Teil dazu beitragen, sage ich mir zynisch und frage mich gleichzeitig, ob er allmählich überschnappt.
»Rechnest du mit einem bewaffneten Überfall, einem Aufstand oder einer Revolution?« Ich schnalle mich an. Das war kein Scherz. »Warum bist du so drauf? Du machst mir Angst.« Ständig muss ich an das Mordopfer in meiner Kühlkammer und an die verschwundene Gwen Hainey denken.
»Ich bin ziemlich sicher, wer die Ermordete von Freitagnacht ist. Eine Frau, der Lucy und ich helfen wollten und mit der Dorothy sich angefreundet hatte. Unsere eigene Nachbarin, verdammt.« Als er den Namen laut ausspricht, schießt mein Blutdruck in die Höhe.
»Du und Lucy wolltet ihr helfen?« Ich verstehe kein Wort.
»Wir haben sie einmal in Sicherheitsfragen beraten. Offenbar hat sie nicht auf uns gehört. Der Täter muss sich sehr gut in unserem Viertel auskennen. Dich, mich, ja, uns alle kennt er vermutlich auch. Wahrscheinlich hat er Gwen ausgekundschaftet. Der Himmel weiß, wen sonst noch.«
»Wie Hannibal Lecter so schön sagt, fängt alles damit an, was man sieht.« Marino gibt einen seiner Lieblingssprüche zum Besten und zeigt dabei mit zwei Fingern auf seine Augen. Regen prasselt aufs Dach, als wir über den Parkplatz meines Instituts fahren und an der kleinen Flotte fensterloser Transporter des OCME vorbeirollen. Sie sind glänzend schwarz wie Limousinen. An den Türen prangt in Grau das Wappen von Virginia.
»Der springende Punkt ist, dass es sich vielleicht nicht um ein Tötungsdelikt im privaten Umfeld handelt«, fügt er hinzu.
»Soweit mir bekannt ist, geht niemand bei dem Mord vom Freitagabend von einem privaten Umfeld aus«, erwidere ich überrascht. »Und woher weißt du …«
»Ich habe Dorothy bei dir abgesetzt.« Er unterbricht mich und hört mir nicht richtig zu. »Wir waren unterwegs, um etwas zu erledigen, als die Meldung über den Polizeifunk kam. Ich wollte nicht, dass Dorothy allein zu Hause ist. Jetzt ist sie bei Lucy.«
Er fügt hinzu, er habe Informationen über seine verschwundene Nachbarin. Nur dass ich eigentlich nicht über dieses Thema sprechen darf. Marino ist kein Polizist mehr. Weder er noch Lucy bekleiden einen offiziellen Posten. Ihre neue Agentur ist eine Privatdetektei. Genau genommen dürfte ich im Moment nicht einmal, gemütlich und von schwarzem Leder und Carbon umgeben, in seinem Pick-up sitzen.
Sein neuer fahrbarer Untersatz ist eine der vielen großspurigen Gesten meiner Schwester, seit die beiden im letzten Jahr während des Höhepunkts der Pandemie geheiratet haben. Außerdem hat er ein Sportboot, das am Steg ihres Ufergrundstücks vertäut ist, eine aufgemotzte Harley-Davidson in der Garage und ein unbegrenztes Budget für sein wachsendes Waffenarsenal.
Meine Schwester ist als Autorin von Graphic Novels sehr erfolgreich, und ich muss mich noch an Marinos neuen Reichtum und die veränderte Situation gewöhnen. Am schwersten ist für mich, dass ich mich ihm, anders als in den Anfangstagen unserer Zusammenarbeit, nicht mehr anvertrauen kann. Es ist nicht mehr möglich, ihn einfach so anzurufen oder einen trinken zu gehen, um sich über Mord, Gewalt oder Sonstiges auszutauschen. Ich würde nicht im Traum daran denken, meine Fälle oder irgendetwas Privates mit ihm zu erörtern. Nicht, solange meine einzige Schwester jedes Wort mithört.
»Ich glaube, wir wissen, was aus der Frau geworden ist, zu der du gerade fährst.« Er stoppt an einer roten Ampel. Meine Behörde ist von Kirchen und Beerdigungsinstituten regelrecht eingekreist.
»Wer hat dir erzählt, wohin ich fahre?« Ich hoffe, dass er es nicht aus dem Polizeifunk hat. Das mobile Gerät lädt gerade am Armaturenbrett auf. Die Lautstärke ist auf ein leises Gemurmel heruntergeregelt.
»Maggie hat angerufen, um das Essen heute Abend zu verschieben. Sie sagte, August Ryan wolle sich unbedingt mit dir treffen. Also habe ich eins und eins zusammengezählt«, sagt Marino, während ich die Nachrichten lese, die gerade auf meinem Telefon eingehen. Eine von Lucy ist auch dabei:
Bist du schon bei Marino?, schreibt sie.
In seinem Auto, antworte ich. Offenbar stehen die beiden in Kontakt und hecken irgendetwas aus.
Da meine Nichte offenbar weiß, wohin ich fahre und warum, muss ihr klar sein, dass eine Frau, die sie und Marino nur rein freundschaftlich beraten haben, aller Wahrscheinlichkeit nach ermordet wurde.
»Zum Glück wurde Gwen Haineys Name im Funk nicht erwähnt, nur die Adresse«, sagt Marino, während Lucy und ich weiter texten.
Ich teile ihr mit, dass ich an sie denke und dass wir uns später sehen. Wir werden mit einem ganz besonderen Tropfen anstoßen, den ich von meiner letzten Frankreichreise mitgebracht habe, verspreche ich ihr.
»Kanntest du Gwen Hainey persönlich? Also nicht nur als jemand, der nebenan wohnt und dem du helfen wolltest?«, frage ich Marino.
»Lucy und ich waren bloß einmal bei ihr.« Während wir uns im Stau voranarbeiten, weil ein Stück weiter ein Unfall stattgefunden hat, fummelt er an der Klimaanlage herum. »Das war kurz nach Gwens Einzug. Wir waren höchstens anderthalb Stunden lang dort und haben versucht, ihr ein paar Tipps zu geben.«
»Wie seid ihr überhaupt mit ihr in Kontakt gekommen? Lag es daran, dass ihr in derselben Siedlung wohnt?« Da ich meine Schwester kenne, weiß ich schon, wie die Antwort lautet.
»Dorothy hat sie in ein Gespräch verwickelt«, bestätigt er meine Vermutung.
Offenbar hat Gwen ihr erzählt, sie sei nach Old Town gezogen, um von einem Exfreund wegzukommen, der sie gestalkt hat. Das sei auch der Grund gewesen, warum sie bei Thor Laboratories angefangen habe.
»Jinx Slater, ihr Ex, passt ziemlich gut ins Bild eines Menschen, der gewalttätig werden könnte. Allerdings hat die ganze Sache möglicherweise gar nichts mit ihm zu tun«, sagt Marino.
»Wo hat Gwen vor ihrem Umzug hierher gewohnt?« Ich frage mich, ob sie Marino und Lucy wohl etwas anderes als das erzählt hat, was ich von August Ryan weiß.
»In Boston, ihr Ex lebt noch dort.« Als Marino mir ein Päckchen Kaugummi hinhält, schüttele ich ablehnend den Kopf. »Nach ihrem Abschluss am MIT hat sie dort in einem großen Labor namens Red Feather Biomedical angefangen.« Er stopft sich zwei Kaugummis in den Mund. Ich bin sicher, dass er viel lieber eine rauchen würde.
»Die befassen sich wie Thor mit der Herstellung künstlicher menschlicher Organe, Haut und Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer«, erkläre ich ihm. Vor uns blinkt Blaulicht. Die Verkehrspolizei leitet Fahrzeuge um einen verunfallten schwarzen SUV herum.
Kurz bleibt mir das Herz stehen. Benton fährt einen schwarzen SUV. Doch der hier ist ein BMW. Also nicht seiner.
»Was kannst du mir über die Tote von Freitagnacht sagen, Doc?«, beginnt Marino sein unvermeidliches Verhör.
»Dass sie ermordet wurde. Ein Fall von sexualisierter Gewalt.«
»Schon gut, das ist ja inzwischen allgemein bekannt«, entgegnet er. Ich schweige.
Natürlich sind er und Lucy über das im Bilde, was die Medien gebracht haben. Also wissen sie nur sehr wenig, denn dafür habe ich gesorgt. Die Leiche von Freitagnacht haben sie nicht gesehen, und außerdem habe ich den Fall ihnen gegenüber nicht erwähnt. Es geht sie nichts an, denn offiziell haben sie beide nichts mit der Sache zu tun. Nur dass sich das jetzt ändern könnte.
»Eine tolle Leistung, die wir da abgeliefert haben.« Fest umklammert er das Lenkrad. An seinen dicken Handgelenken treten die Adern hervor. Schon vor seiner Beziehung mit meiner Schwester war er ein Kleiderschrank.
Inzwischen jedoch hat er sich in einen wahren Berg verwandelt. Jeden Tag verbringt er Stunden mit Fitnesstraining und Gewichten, und ich muss zugeben, dass er noch nie so gut in Form war.
»Ein toller Start für einen eigenen Laden, oder?« Entnervt pustet er einen nach Nelken duftenden Luftschwall aus.
»Du musst dich beruhigen. Außerdem sollten wir nicht versuchen, uns selbst zu überholen. Wenn du weiter so dicht auffährst, rammen wir noch jemanden«, gebärde ich mich als Fahrlehrerin.
Dieser Teil der King Street wird von dichtem Wald und großen Anwesen gesäumt. Die eleganten Villen sind festlich geschmückt. Die um Laternenmasten und Säulen gewickelten blauweißen Lichterketten blinken im trüben Dunst. Hinter Fensterscheiben funkeln Weihnachtsbäume. Kerzen verbreiten Gemütlichkeit.
»Ich könnte mich in den Hintern treten, weil ich nicht besser aufgepasst habe. Aber hinterher ist man immer klüger«, spricht Marino weiter. »Aber wie hätte ich das vorhersehen sollen? Wie hat Jinx Slater sie gefunden, falls er es wirklich war? Schließlich hat sie sich jede erdenkliche Mühe gegeben unterzutauchen.«
»Zumindest solltet ihr das glauben«, erwidere ich. »Doch selbst wenn wir annehmen, dass sie die Wahrheit gesagt hat, wundert es mich gar nicht, dass er sie trotzdem aufspüren konnte. In unserer digitalisierten Welt, wo man überall, sogar im Weltraum, von Kameras beobachtet wird, wird es immer schwieriger, sich unsichtbar zu machen.«
»Trotzdem will es mir nicht in den Kopf, warum sie die Alarmanlage abgeschaltet und die Tür aufgemacht hat, falls es so passiert ist«, wendet er ein.
Wenn sie wirklich solche Angst vor ihm hatte, wie behauptet, wäre sie in Panik geraten, sobald er am Wachhäuschen, geschweige denn vor ihrer Haustür, erschienen wäre. Marino vermutet, dass sie sofort die Polizei verständigt hätte.
»Oder mich«, fügt er hinzu. Das Auto mit Allradantrieb rumpelt über den Asphalt. Überdimensionierte Reifen wirbeln Wasser aus Pfützen auf. »Schließlich hatte sie meine Nummer, und Dorothy und ich waren am Freitagabend zu Hause. Ich wäre in zwei Minuten bei ihr gewesen.«
»Gwens Smartphone ist noch immer nicht wiederaufgetaucht«, lasse ich ihn wissen, während ich Nachrichten durchblättere, mit denen ich mich später befassen werde. »Jedenfalls hatte sie eine Alarmanlage, was ein wichtiger Punkt ist. Was ist mit Überwachungskameras, die den Garten oder wenigstens die Haustür im Blick haben?«
»Wir haben es ihr empfohlen, aber sie hatte Angst vor Hackern. Sie hat versprochen, immer die Alarmanlage einzuschalten, wenn sie zu Hause ist.«
»Hat sie die Anlage selbst einbauen lassen?«
»Sie war bei ihrem Einzug schon da.«
»Wer mag wohl sonst noch den Code kennen?«
»Als ich sie gefragt habe, meinte sie, nur der Vermieter für Notfälle. Aber wer weiß, wem sie den Code außerdem gegeben hat«, antwortet Marino.
»Wie wahr. Du musst August Ryan genau dasselbe erzählen wie mir«, erwidere ich.
»Dazu müsste er mir zuhören und sich nicht aufführen wie ein Idiot. Obwohl ich nicht sicher bin, ob das im Bereich des Möglichen liegt. Das tut es beim FBI nämlich praktisch nie.«
»Seid ihr beide euch schon begegnet?«
»Noch nicht, doch er könnte meine Hilfe gebrauchen«, gibt Marino zurück. »Ich kenne mich in Gwens Haus aus, falls sie seit Lucys und meiner Begutachtung nicht irgendetwas verändert hat. Also könnte ich ihm genau sagen, was er dort vorfinden wird.«
»Deine DNA zum Beispiel«, halte ich ihm vor Augen. Als ob die Situation nicht ohnehin schon heikel genug wäre.
»Ich hatte nicht vor, daraus ein Geheimnis zu machen«, antwortet Marino. »Doch das sollte mich nicht daran hindern, mich umzuschauen, hoffentlich bevor eine Horde Polizisten durchs Haus trampelt.«
»Ich bin nicht sicher, wie ich erklären soll, dass ich mit einem Privatdetektiv im Schlepptau anrücke. Oder, noch schlimmer, dass ich mich von einem herumkutschieren lasse.«
»Ich kutschiere niemanden herum. Im Moment bin ich dein Personenschützer, verdammt«, entgegnet er. Allerdings trifft das nicht nur auf den Moment zu.
So verhält er sich schon, seit wir uns kennen. Auf unerklärliche Weise gelingt es ihm immer wieder, sich ohne mein Zutun Einfluss auf mein persönliches Wohlbefinden und meine beruflichen Angelegenheiten zu sichern.
»Natürlich weiß ich es zu schätzen, dass du mich beschützt«, stelle ich so diplomatisch wie möglich fest. »Nur dass ich erst seit einem Monat in diesem Job bin und bereits mehr als genug Schwierigkeiten mit den Leuten hier habe. Deshalb ist das nicht sehr hilfreich.«
Ganz als wäre er wieder Polizist, schaltet er das im Inneren und im Kühlergrill integrierte Blaulicht ein und überholt den Mini Cooper vor uns in einem waghalsigen Manöver.
»Nun, erstens interessiert es mich einen Scheißdreck, was August Ryan von meiner Anwesenheit hält«, poltert Marino los. »Es zählt nur, dass jemand ermordet worden ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach meine Nachbarin, weshalb ich schon aus reinem Selbstschutz wissen muss, was da gespielt wird.«
»Juristisch betrachtet musst du überhaupt nichts«, erinnere ich ihn an die gesetzlichen Vorgaben, die er offenbar vergessen hat.
»Erklärst du mir jetzt endlich, was da läuft, oder soll ich weiter rätselraten?«
»Du weißt, dass ich das nicht darf.«
»Dir kann niemand Vorschriften machen, Doc.«
»Aber es hätte Konsequenzen«, wende ich ein.
»Du bist Chief Medical Examiner des gesamten Bundesstaates«, beharrt er. »Genau wie früher. Die Entscheidung liegt ganz bei dir.«
Damit hat er recht, nur dass da einige Einschränkungen und Vorschriften beachtet werden müssen. Aber ich habe schon einen Plan: Er war bereits früher mein Mitarbeiter, und so unrecht es uns beiden sein mag, führt auch diesmal kein Weg daran vorbei. Denn ohne eine offizielle Funktion darf er mich nicht durch die Gegend chauffieren.
»Oder die Gerichtsmedizin betreten. Oder die Labore. Oder den Gerichtssaal«, fahre ich fort. »Eigentlich jeden Ort außer unseren Wohnungen.«
Das ist zwar nicht neu, doch seit unserer letzten Zusammenarbeit sind einige Jahre vergangen. Und dass meine Schwester inzwischen mit von der Partie ist, macht die Sache nicht einfacher.
»Damit meine ich keinen Posten, der voraussetzt, dass du in meinem Institut ein Büro hast oder dich häufig dort aufhältst«, spreche ich weiter. »Keiner von uns soll sich überwacht oder eingeengt fühlen.« Denn das hätte mir gerade noch gefehlt.
»Und wenn ich trotzdem ein Büro will? Du weißt schon, damit ich Ruhe zum Arbeiten habe, wenn ich dir helfe, und damit ich telefonieren kann, ohne dass jemand zuhört«, protestiert Marino und schaut dabei gleichzeitig in die Rückspiegel.
4
Ich muss keine Hellseherin sein, um zu ahnen, worauf es Marino ankommt: einen Ort ganz für sich allein und ein Stück seines alten Lebens. Vielleicht sogar eine Rückzugsmöglichkeit, weil er gelegentlich Abstand von seiner Frau braucht.
»Und du brauchst jemanden, der dir den Rücken freihält«, ergänzt er, und da liegt er gar nicht so falsch.
»Wir könnten dich als privaten Berater, als Spezialisten für forensische Ermittlungen, beschäftigen«, erfinde ich Berufsbezeichnungen, während ich es mir auf meinem beheizten Ledersitz bequem mache. »Du könntest beim Koordinieren der Ermittler helfen. Aber du wärst mir untergeordnet und würdest nach Bedarf eingesetzt und auch entsprechend bezahlt.«
»Wie viel?«
»So wenig wie möglich. Ehrenamtlich kommt immer gut.«
»Klar.« Er zuckt die Achseln. Vom Himmel fällt dichter Regen. Die Abmachung steht.
Ab diesem Moment bekleidet er eine offizielle Position, die nachvollziehbar und zu rechtfertigen ist. Und das heißt, dass ich ihm schildern darf, was ich über den Mord vom Freitagabend weiß. Ich suche den Videoclip heraus, den mir der Zugführer gegeben hat. Die nur wenige Sekunden dauernde Aufnahme wurde von der nach außen gerichteten Kamera gefilmt, während die hundert Tonnen schwere Lok durch den dunklen, bewaldeten Park auf Daingerfield Island raste.
Als wir an der nächsten roten Ampel hinter einer endlosen Autoschlange anhalten müssen, beugen Marino und ich uns Kopf an Kopf über das Display meines Telefons. Der Zitrusduft von Acqua di Parma steigt mir in die Nase, während wir beobachten, wie die Scheinwerfer des Zugs hinter einer Biegung die Gleise ausleuchten … mit hundertsechzig Kilometern pro Stunde donnert die Lok voran … und dann, plötzlich, das Bremsmanöver, ein ohrenbetäubendes Kreischen von Stahl und zusammengepresster Luft …
Kurz ist die Leiche zu sehen und schon im nächsten Moment wieder verschwunden. Nackt und schutzlos liegt die Tote auf dem Schotter am Bahndamm neben den Gleisen, Arme und Beine ausgebreitet wie ein Schneeengel … Danach nur noch die düsteren Schatten der Bäume und Lichter in der Ferne, die zu einem Schleier verschwimmen, als der Zug, zischend und fauchend wie ein übellauniger Drache, endlich zum Stehen kommt.
»Ich kann nicht sagen, ob sie es ist. Aber hat sie da ein Tattoo auf dem Bauch?« Als die Ampel umspringt, kriecht der Pick-up weiter. »Ich kann es nicht richtig sehen, aber wenn es stimmt, wäre das gar nicht gut. Gwen hat ein Tattoo. Sie und ihr Ex haben sich das identische Motiv stechen lassen.«
»Was für ein Tattoo?«, hake ich nach. Die Scheibenwischer erzeugen ein dumpfes Klatschen, der Donner grollt.
Hoch über uns erhebt sich das George Washington Masonic National Memorial aus dem Nebel. Sein rot und grün erleuchteter Turm ist nur mit Mühe auszumachen.
»Eine Qualle«, erwidert Marino.
»Ich zeige dir jetzt ein paar Fotos, die ich, kurz bevor du kamst, mit meinem Smartphone gemacht habe.«
Ich schaue die Fotos aus der Kühlkammer durch, bis ich auf eine Nahaufnahme vom Tattoo der Toten stoße. Die Qualle ist bunt und hat Augen wie in einem Comic. Ihre langen Tentakel schlängeln sich träge über den Bauch der Frau. Als ich einen kleinen Einschnitt in ihrem Unterbauch vorgenommen habe, habe ich darauf geachtet, das Bild nicht zu zerstören.
Ganz gleich, welche Neuerungen die Technik uns auch zu bieten hat, ich werde weiterhin ein Thermometer in die Leber einführen. Das ist der zuverlässigste Weg, die Kerntemperatur am Tatort zu ermitteln.
»Mist.« Marino wirft einen Blick auf das Foto und fährt mit finsterer Miene weiter. »Schließlich findet man nicht alle Tage jemanden mit so einem Tattoo.«
Also zeige ich ihm eine Nahaufnahme ihres toten Gesichts.
»Ich glaube, sie ist es«, antwortet er. »Ich bin ziemlich sicher.«
»Keine Bestätigung, bevor wir ihre Identität nicht anhand von zahnärztlichen Unterlagen oder DNA sicher bestimmt haben«, betone ich. »Und natürlich muss man ihre Angehörigen benachrichtigen. Doch die Frau, die am letzten Freitagabend ermordet wurde, ist mit ziemlicher Sicherheit Gwen Hainey.«
»Üble Sache«, lautet sein einziger Kommentar.
Ich schaue hinaus in die sturmdurchtoste Dunkelheit, lausche mit halbem Ohr dem leisen Gemurmel am Polizeifunk und schnappe Codes und Telefonnummern auf. Ich bin lange genug dabei, um zu wissen, wann sich die Polizei mehr als sonst vor möglichen Mithörern in Acht nimmt. Allerdings wird jeder, der die Ohren spitzt, zu dem Schluss kommen, dass etwas Schwerwiegendes geschehen ist.
»Wie lange war sie deiner Einschätzung nach tot, als du ankamst?«, erkundigt sich Marino.
»Sie war unbekleidet, sehr schlank mit wenig Körperfett, und außerdem hatte sie den Großteil ihres Blutes verloren«, merke ich an.
Ich blättere in meinem Notizbuch zurück und beleuchte meine kleine, verschnörkelte Handschrift mit der Taschenlampen-App des Smartphones.
»Deshalb wäre sie auf jeden Fall überdurchschnittlich schnell ausgekühlt, insbesondere weil wir mehr oder weniger Kühlschranktemperaturen hatten«, erkläre ich.
Die Kälte hat die meisten postmortalen Veränderungen wahrscheinlich hinausgezögert. Als ich die Leiche am Fundort untersucht habe, herrschte eine Außentemperatur von knapp neun Grad. Leichenstarre und Totenflecken befanden sich noch im Anfangsstadium. Während ich das erläutere, texte ich August Ryan, dass ich im Stau stecke. Obwohl wir in Marinos blinkendem Streitwagen mit seinen überdimensionalen Reifen und seiner Vielzahl an Zusatzscheinwerfern dahinrollen, kommen wir nicht schneller voran als alle anderen auch.
»Sie war seit einigen Stunden tot«, mutmaße ich. »Allerdings hat sie nicht die ganze Zeit über oder auch nur einen Großteil davon im Freien gelegen.«
Ich betrachte die Landschaft da draußen, die gleichzeitig fremd und so vertraut ist. Nichts scheint mehr zu sein wie zuvor. Schmiedeeiserne Gaslaternen flackern im Dunst. Ihr mattes Licht fällt auf den feuchten, mit Backstein gepflasterten Gehsteig, der mit totem Laub und abgebrochenen Zweigen übersät ist. Es sind weder Hundebesitzer noch Jogger unterwegs.
Viele der liebevoll restaurierten Häuser sind denkmalgeschützt, und George Washington hat tatsächlich in einigen von ihnen die Nacht verbracht. Die bewaldeten Grundstücke sind geschmackvoll dekoriert. Es ist kein einziger aufblasbarer Weihnachtsmann und auch kein Rentier in Sicht. Als man Marino über die hier geltenden Einschränkungen in Sachen Ensembleschutz in Kenntnis setzte, musste er zu seinem Bedauern feststellen, dass jegliche Form von Kitsch hier verboten ist.
In Old Town ist alles durchgeplant und makellos gepflegt. Als unpassend geltende Verschönerungen und Ausschmückungen sind nicht erlaubt. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass man ohne Genehmigung weder seine Fensterläden umstreichen noch das Dach neu decken oder einen Notstromgenerator aufbauen darf. Diese schwarze Liste ist der einzige Wermutstropfen angesichts der sonst optimalen Lebensbedingungen. Zumindest habe ich das bis jetzt so empfunden.
Denn die vor Kurzem noch so reizende und idyllische Umgebung erscheint mir mit einem Mal bedrohlich. Die hohen immergrünen Hecken und winterkahlen Bäume peitschen wild im Wind. Die Baptistenkirche ist in einen Nebelschleier gehüllt. Das Licht in ihrem Turm flackert unheimlich, und das Glockengeläut vom Band läuft auf Endlosschleife. Offenbar ein Computerfehler.
Zuckende Blitze erleuchten die gewaltigen Bäume, die auf dem Ivy Hill Cemetery umgestürzt sind. Hier ist der Vater des amerikanischen Raumfahrtprogramms Wernher von Braun in guter Gesellschaft mit weiteren Honoratioren begraben. Ich erhasche einen Blick auf schlammige freigelegte Wurzeln und umgekippte jahrhundertealte Grabsteine. Der Polizeifunk und unsere Smartphones kündigen den Eingang weiterer Nachrichten an.
Noch zehn Minuten, texte ich August, begleitet von einem krachenden Donnerschlag.
Bin im Büro der Verwaltung, schreibt er zurück. Ich bin weiterhin beunruhigt.
Unterschiedliche Wahrnehmungen sind ein Problem. Doch ein viel größeres ist die Frage, ob August und Marino miteinander klarkommen werden. Dass mein neuer Berater gleichzeitig mein Schwager ist, macht die Sache nicht einfacher.
»Jinx arbeitet als Restaurantchef in Bostons North End und verdient sich als Bartender hin und wieder was dazu«, wiederholt Marino das, was Gwen ihm über ihren Ex erzählt hat. »In den letzten beiden Jahren war er meistens arbeitslos und hat angefangen, zu trinken und Drogen zu nehmen. Mit der Zeit kam er immer schräger drauf.«
»Ist etwas davon bestätigt?«
»Nein.« Er öffnet den Aschenbecher und greift wieder nach dem Kaugummipäckchen. »Ich hätte das nachprüfen sollen.«
»Wir prüfen es jetzt nach«, erwidere ich. »Boston ist weit weg von hier. Es sollte nicht schwierig sein rauszukriegen, ob Jinx Slater vor Kurzem einen Ausflug in diese Gegend gemacht hat. Ist er früher schon mal gewalttätig geworden?«
»Nachdem sie ihm mitgeteilt hat, dass sie ihn nicht wiedersehen wollte, soll er sich bedrohlich verhalten haben.«
»Beispiele?«
»Ständige Anrufe. Ein Teddybär mit umgedrehtem Hals vor ihrer Tür. Welke Rosen im Briefkasten. Und wenn sie joggen ging, ist er im Auto langsam hinter ihr hergefahren.«
»Hat sie das bei der Polizei angezeigt?«
»Nein, hat sie nicht, und ich war ziemlich sicher, dass sie log wie gedruckt.«
»Wir wissen beide, dass nicht alle Opfer ehrlich oder unschuldig sind.« Ich lege den Stift aufs Notizbuch und sehe ihn an.
»Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie auch dazugehört hat.«
»Auch schrecklichen Menschen können schreckliche Dinge zustoßen. Und viele denken dann, dass es ihnen recht geschieht.« Das ist eine hässliche Wahrheit, die ich nie öffentlich äußern würde.
»Gwen war nicht sehr sympathisch und schien ziemlich von sich überzeugt zu sein. Sie tat, als hätte sie die Weisheit mit Löffeln gefressen«, erwidert Marino. »Aber du weißt ja, wie es läuft. Dorothy hat Lucy und mich gebeten, ihr zu helfen, und so haben wir es eben getan.«
Wie ich Dorothy kenne, hat sie Gwen mit einem Begrüßungsgeschenk besucht und bei dieser Gelegenheit ein bisschen herumgeschnüffelt und Informationen gesammelt. Distanzlosigkeit, getarnt als Südstaatengastfreundschaft. Sicher hat sie Gwen unaufgefordert Marinos und Lucys Dienste angeboten. Es würde zu Dorothy passen, sich unentbehrlich zu machen.
»Hat Gwen sich eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex besorgt?« Wieder schicke ich eine Nachricht an Benton, denn ich frage mich, ob er schon zu Hause ist. »Nicht dass das in den meisten Fällen etwas nützen würde.«
»Hat sie nicht.«
»Ich bin nur neugierig, ob es für ihre Anschuldigungen irgendwelche Belege gibt.«
»Sie meinte, sie wäre nur vor ihm sicher, wenn sie irgendwohin ginge, wo er sie nicht finden könne«, antwortet Marino. »Also hat sie den Job bei Thor angenommen und ist hierhergezogen. So lautete ihre Geschichte. Ein Teil davon könnte stimmen, aber das meiste ist vermutlich nicht wahr. Lucy und ich haben das nicht überprüft. Wir haben uns nicht weiter mit der Angelegenheit beschäftigt, weil Gwen das nicht wollte. Kein Interesse von ihrer Seite.«
»Warum habt ihr euch überhaupt eingemischt?«
»Dorothy lässt sich nicht mit einem Nein abspeisen«, entgegnet er. »Wenn jemand solche Angst hat wie Gwen, aber jegliche Hilfe ablehnt, ist das für mich ein Hinweis darauf, dass da etwas nicht ganz koscher ist.«
»Ich finde es auch höchst verdächtig«, erwidere ich. Inzwischen sind wir an Alexandrias altem Bahnhofsgebäude aus Backstein angekommen.