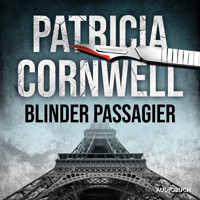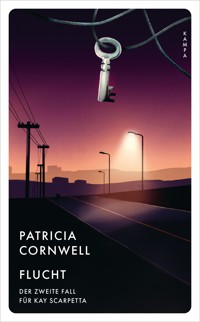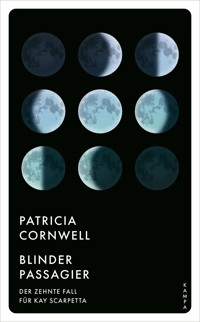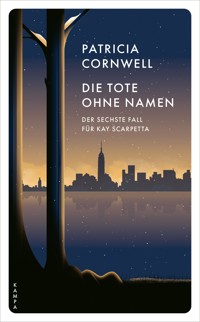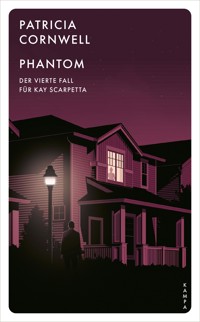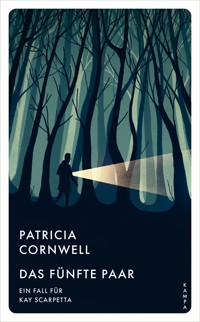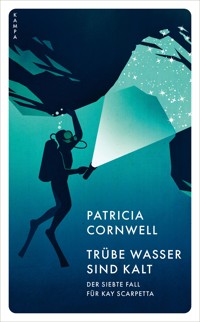
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kay Scarpetta
- Sprache: Deutsch
Dr. Kay Scarpetta soll den Gerichtsmediziner von Tidewater an der Küste Virginias vertreten. Er hat ihr sogar sein einsames Cottage am Meer überlassen, wo sie den Jahreswechsel mit ihrer Nichte Lucy verbringen will. Doch dann wird Scarpetta an Silvester zum nahe gelegenen Schiffsfriedhof der Navy gerufen: Im Elizabeth River treibt eine Leiche. Wieder ein neugieriger Taucher auf der Suche nach Artefakten aus dem Bürgerkrieg, vermutet Scarpetta. Doch bei dem Mann handelt es sich um den Reporter Ted Eddings, einen alten Bekannten der Forensikerin. Bei der Obduktion wird schnell klar, dass er nicht ertrunken ist. Außerdem scheint Eddings sich auf eine Gefahr vorbereitet zu haben: In seiner Wohnung hortete er Waffen und Survival-Magazine. Doch der unheimlichste Fund unter seinen Habseligkeiten ist das Book of Hand, die Bibel der Neuen Zionisten, einer faschistischen Sekte, die mit Aussteigern nicht gerade zimperlich umgeht … Und irgendjemand will Scarpettas Ermittlungen um jeden Preis behindern. Wer steckt hinter den geheimnisvollen Anrufen, den aufgeschlitzten Reifen und den nächtlichen Spuren im Schnee rings um das Cottage?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Patricia Cornwell
Trübe Wasser sind kalt
Der siebte Fall für Kay Scapetta
Aus dem amerikanischen Englisch von Klaus Pemsel
Kampa
Für Susanne Kirk –
Freundin und Lektorin mit Visionen
Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen:
Was hat denn dieser Übles getan?
Ich finde keine Ursache des Todes an ihm.
Lukas 23,22
1
Noch vor Anbruch des letzten Tages im blutigsten Jahr, das Virginia seit dem Bürgerkrieg erlebt hatte, machte ich Feuer und setzte mich an das dunkle Fenster, das mir nach Sonnenaufgang das Meer zeigen würde. Ich saß im Morgenmantel im Schein der Lampe und sah die Jahresstatistik meiner Behörde über die Verkehrsunfälle, Prügeleien, Schießereien und Messerstechereien durch, als um Viertel nach fünf das Telefon klingelte.
»Verdammt«, brummte ich, denn meine Bereitschaft, an Dr. Philip Mants Telefon zu gehen, ließ spürbar nach. »Schon gut, schon gut.«
Sein verwittertes Cottage in der kleinen Gemeinde Sandbridge direkt an der Küste Virginias zwischen dem Marinestützpunkt und dem Naturschutzgebiet Back Bay lag versteckt hinter einer Düne. Mant war mein Leichenbeschauer für den Bezirk Tidewater. Seine Mutter war bedauerlicherweise an Heiligabend gestorben. Unter normalen Umständen hätte Mants Reise nach London, wo er die Familienangelegenheiten regeln musste, keine Notlage in der Gerichtsmedizin Virginias geschaffen, aber seine stellvertretende Forensikerin war im Mutterschaftsurlaub, und der Leichenschauhaus-Aufseher hatte gerade gekündigt.
»Bei Dr. Mant«, meldete ich mich. Vor den Fensterscheiben zauste der Wind die dunklen Umrisse der Kiefern.
»Hier ist Officer Young von der Polizei Chesapeake«, sagte jemand, der wie ein im Süden geborener und aufgewachsener Weißer klang. »Könnte ich bitte Dr. Mant sprechen?«
»Er ist verreist«, entgegnete ich. »Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?«
»Sind Sie Mrs. Mant?«
»Ich bin Dr. Kay Scarpetta, Chief Medical Examiner. Ich vertrete Dr. Mant.«
Der Anrufer zögerte und fuhr dann fort: »Wir haben einen Hinweis auf einen Todesfall bekommen. Einen anonymen Anruf.«
»Wissen Sie, wo es sich ereignet haben soll?« Ich hatte mir schon Stift und Papier bereitgelegt.
»Auf dem Schiffsfriedhof der Navy.«
»Wie bitte?« Ich blickte auf.
Er wiederholte seine Worte.
»Um wen handelt es sich, einen Navy SEAL?« Ich war verblüfft, denn meines Wissens hatten nur die Mitglieder dieser Spezialeinheit im Manöver Zugang zu den in der Werft vertäuten, ausrangierten Schiffen.
»Wir wissen nicht, wer es ist, aber er könnte nach Überbleibseln aus dem Bürgerkrieg gesucht haben.«
»Im Dunkeln?«
»Ma’am, das Gelände ist militärischer Sicherheitsbereich. Aber das hat die Leute schon früher nicht davon abgehalten, sich da herumzutreiben. Sie kommen heimlich in Booten, und das geht immer nur im Dunkeln.«
»So etwas hat der anonyme Anrufer angedeutet?«
»So ziemlich.«
»Klingt ja interessant.«
»Das dachte ich auch.«
»Und die Leiche ist noch nicht gefunden worden«, sagte ich, denn ich wunderte mich immer noch, warum dieser Officer es für nötig gehalten hatte, zu so früher Stunde einen Gerichtsmediziner zu verständigen, wenn nicht einmal eindeutig feststand, dass es eine Leiche gab oder überhaupt jemand vermisst wurde.
»Wir sind auf der Suche danach, und die Navy schickt ein paar Taucher, da kriegen wir die Sache in den Griff, wenn alles gutgeht. Ich wollte Sie lediglich darauf aufmerksam machen. Und richten Sie Dr. Mant mein Beileid aus.«
»Ihr Beileid?«, rätselte ich, denn wenn er von Dr. Mants Situation wusste, warum hatte er dann nach ihm gefragt.
»Ich habe gehört, seine Mutter ist gestorben.«
Ich setzte die Spitze meines Stifts auf das Blatt Papier.
»Würden Sie mir bitte Ihren vollen Namen nennen, und wie Sie zu erreichen sind?«
»S.T. Young.« Er gab mir eine Telefonnummer, und wir legten auf.
Ich starrte in das schwache Feuer im Kamin und fühlte mich unbehaglich und einsam, als ich aufstand, um Holz nachzulegen. Ich wäre viel lieber in Richmond gewesen, in meinem eigenen Haus mit Kerzen in den Fenstern und der mit altem Christbaumschmuck dekorierten Fraser-Tanne. Ich wollte Mozart und Händel hören statt des schrill ums Dach pfeifenden Winds, und ich wünschte, ich hätte Mants freundliches Angebot, in seinem Haus statt in einem Hotel zu wohnen, nicht angenommen. Ich machte weiter mit der Überprüfung der Statistik, aber meine Gedanken schweiften immer wieder ab. Ich stellte mir das schlammige Wasser des Elizabeth River vor, das zu dieser Jahreszeit wohl eine Temperatur von weniger als fünfzehn Grad hatte, und die Sicht betrug bestenfalls einen halben Meter.
Gut, manche tauchten im Winter in der Chesapeake Bay nach Austern oder fuhren fünfzig Kilometer auf den Atlantik hinaus, um einen versunkenen Flugzeugträger oder ein deutsches U-Boot zu erkunden oder andere Wunderdinge, wonach zu tauchen sich lohnte. Aber im Elizabeth River, wo die Navy ihre ausrangierten Schiffe hinbrachte, schien es wenig Verlockendes zu geben, egal bei welchem Wetter. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand dort im Winter nach Einbruch der Dunkelheit allein tauchen sollte, um nach altem Gerümpel oder so zu suchen, und glaubte, der anonyme Hinweis würde sich als pure Spinnerei erweisen.
Ich stand aus dem Lehnstuhl auf und ging ins Schlafzimmer, wo meine Habseligkeiten fast über den ganzen kühlen, kleinen Raum verbreitet waren. Ich zog mich rasch aus und duschte hastig, denn ich hatte schon am ersten Tag hier entdeckt, dass der Boiler nicht viel hergab. Offen gestanden fühlte ich mich überhaupt nicht wohl in Dr. Mants zugigem Haus mit der knorrigen, hellen Kieferntäfelung und den dunkelbraun gestrichenen Böden, auf denen jedes Stäubchen zu sehen war. Mein britischer Deputy Chief schien in einem düsteren Windfang zu leben, und ich fror ständig in seiner spärlich möblierten Bleibe. Zudem verstörten mich hier unidentifizierbare Geräusche, weswegen ich manchmal aus dem Schlaf hochfuhr und nach meiner Waffe griff.
In meinen Morgenmantel gehüllt, das Haar mit einem Handtuch umwickelt, kontrollierte ich Gästezimmer und Bad, um mich zu vergewissern, dass alles für die Ankunft meiner Nichte Lucy am Mittag bereit war. Dann warf ich einen Blick in die Küche, die im Vergleich zu meiner eigenen erbärmlich war. Es schien, als hätte ich bei meiner gestrigen Einkaufsfahrt nach Virginia Beach nichts vergessen, aber ich würde ohne Knoblauchpresse, Spaghettimaschine, Mixer und Mikrowellenherd auskommen müssen. Ich fragte mich schon ernsthaft, ob Mant jemals zu Hause aß oder sich überhaupt hier aufhielt. Wenigstens hatte ich daran gedacht, mein eigenes Besteck und Kochgeschirr mitzubringen, und solange ich gute Messer und Töpfe hatte, würde ich schon zurechtkommen.
Ich las noch ein wenig, schlief dann aber wieder ein. Erneut riss mich das Telefon hoch, und ich griff nach dem Hörer, während sich meine Augen erst noch an das Sonnenlicht gewöhnen mussten, das mir nun ins Gesicht fiel.
»Hier Detective C.I. Roche, Chesapeake«, sagte eine andere, mir unbekannte männliche Stimme. »Soviel ich weiß, vertreten Sie Dr. Mant, und wir brauchen unbedingt sofort eine Antwort von Ihnen. Es sieht so aus, als hätte es auf dem Marine-Schiffsfriedhof einen Todesfall beim Tauchen gegeben. Wir müssen uns an die Bergung der Leiche machen.«
»Ich nehme an, es handelt sich um den Fall, von dem mich einer Ihrer Beamten vorhin schon unterrichtet hat?«
Auf sein langes Schweigen folgte die eher defensive Bemerkung: »Soweit ich weiß, bin ich der Erste, der Sie benachrichtigt.«
»Ein Officer Young rief mich heute früh um Viertel nach fünf an. Einen Augenblick.« Ich sah auf meinen Notizzettel. »Initialen S wie Sam und T wie Tom.«
Wieder Sendepause, dann sagte er im gleichen Ton: »Also, ich habe keine Ahnung, von wem Sie reden, bei uns ist niemand mit diesem Namen.«
Mein Adrenalinpegel stieg, während ich mir Notizen machte. Es war dreizehn Minuten nach neun. Ich war verblüfft über das, was er gesagt hatte. Wenn der erste Anrufer nicht von der Polizei war, wer war er dann, warum hatte er angerufen, und woher kannte er Mant?
»Wann wurde die Leiche gefunden?«, fragte ich Roche.
»Gegen sechs Uhr bemerkte ein Wachmann einen Kahn, hinter einem der Schiffe vertäut. Ein langer Schlauch führte ins Wasser, als würde dort jemand tauchen. Und als sich nach einer Stunde nichts gerührt hatte, wurden wir gerufen. Ein Taucher fand dann die Leiche.«
»Ist sie identifiziert?«
»Wir haben im Boot eine Brieftasche gefunden. Der Führerschein ist auf einen Theodore Andrew Eddings ausgestellt.«
»Der Reporter?«, sagte ich ungläubig. »Der Ted Eddings?«
»Weiß, zweiunddreißig Jahre alt, braunes Haar und blaue Augen, dem Foto nach. Er wohnt in der West Grace Street in Richmond.«
Der Ted Eddings, den ich kannte, war ein preisgekrönter Reporter für Associated Press. Es verging kaum eine Woche, in der er nicht wegen irgendetwas anrief. Einen Augenblick lang konnte ich fast nicht denken.
»Wir haben aus dem Boot auch eine Neun-Millimeter-Pistole geborgen«, sagte er.
Als ich wieder sprach, klang ich sehr entschieden. »Seine Identität darf auf keinen Fall der Presse oder sonst wem bekanntgegeben werden, bevor sie nicht bestätigt ist.«
»Das habe ich allen bereits gesagt. Keine Bange.«
»Gut. Und niemand hat eine Ahnung, warum diese Person auf dem Schiffsfriedhof getaucht haben könnte?«, fragte ich.
»Er könnte nach irgendwelchem Zeug aus dem Bürgerkrieg gesucht haben.«
»Wie kommen Sie zu dieser Vermutung?«
»Eine Menge Leute suchen in den Flüssen hier nach Kanonenkugeln und solchen Sachen«, meinte er. »Okay. Wir machen also weiter und holen ihn raus, damit er nicht länger als nötig dort unten bleibt.«
»Ich möchte nicht, dass er berührt wird, und wenn er noch etwas länger im Wasser bleibt, macht das auch nichts mehr.«
»Was haben Sie vor?« Er klang wieder abwehrend.
»Das weiß ich erst, wenn ich dort bin.«
»Also, ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit notwendig …«
»Detective Roche«, unterbrach ich ihn, »ob es notwendig ist, dass ich zum Tatort komme, und was ich dort tue, liegt nicht in Ihrem Ermessen.«
»Nun ja, ich hab da all die Leute warten, und heute Nachmittag soll es schneien. Niemand will sich da draußen an der Pier die Beine in den Bauch stehen.«
»Nach dem in Virginia gültigen Recht bin ich für die Leiche zuständig, und nicht Sie oder irgendjemand anders, ob von der Polizei, der Feuerwehr, der Rettung oder einem Beerdigungsinstitut. Niemand berührt die Leiche, bis ich es erlaube.« Ich sprach mit gerade so viel Schärfe, dass er merkte, ich konnte auch streng sein.
»Wie schon gesagt, dann werde ich all den Leuten auf dem Gelände mitteilen müssen, dass sie sich zu gedulden haben, und das wird sie nicht freuen. Die Navy setzt mir bereits ganz schön zu, ich solle das Gelände verlassen, bevor Reporter auftauchen.«
»Das ist kein Fall der Navy.«
»Das müssen Sie denen sagen. Es sind ihre Schiffe.«
»Das werde ich ihnen gern sagen. In der Zwischenzeit teilen Sie allen mit, dass ich unterwegs bin«, sagte ich, bevor ich auflegte. Da mir klar war, dass ich erst in ein paar Stunden wieder zu dem Cottage zurückkehren würde, heftete ich an die Haustür eine Nachricht mit verschlüsselten Anweisungen für Lucy, wie sie in meiner Abwesenheit ins Haus gelangen konnte. Ich versteckte einen Schlüssel so, dass nur sie ihn finden konnte, und packte dann meine Arzttasche und die Tauchausrüstung in den Kofferraum meines schwarzen Mercedes. Um Viertel vor zehn war die Temperatur auf drei Grad angestiegen, und meine Versuche, Captain Pete Marino in Richmond zu erreichen, hatten bisher zu nichts geführt.
»Gott sei Dank«, murmelte ich, als endlich mein Autotelefon klingelte.
Ich schnappte es. »Scarpetta.«
»Hi.«
»Du hast deinen Pager an. Das schockiert mich«, sagte ich.
»Wenn du so schockiert bist, warum, zum Teufel, rufst du dann an?« Er klang erfreut, von mir zu hören. »Was ist los?«
»Erinnerst du dich an den Reporter, den du überhaupt nicht leiden magst?« Ich achtete darauf, keine Details preiszugeben, weil wir über Funk sprachen und abgehört werden konnten.
»Welcher denn?«
»Der für AP arbeitet und immer bei mir im Büro vorbeischaut.« Er dachte einen Augenblick nach und sagte dann: »Worum geht’s denn? Hast du einen Termin mit ihm?«
»Bedauerlicherweise ja. Ich bin unterwegs zum Elizabeth River. Chesapeake hat gerade angerufen.«
»Augenblick mal. Nicht die Art von Termin.« Er hörte sich besorgt an.
»Ich fürchte, doch.«
»Ach du Scheiße.«
»Wir haben bisher nur einen Führerschein. Wir können also noch nicht sicher sein. Ich werde runtergehen und ihn mir anschauen, bevor wir ihn rausholen.«
»Jetzt halt, zum Teufel, noch mal, die Luft an«, sagte er. »Warum musst du unbedingt so was machen? Können das nicht andere erledigen?«
»Ich muss ihn sehen, bevor er bewegt wird«, wiederholte ich.
Marino war sehr ungehalten, weil er stets viel zu besorgt war um mich. Er brauchte gar kein Wort mehr zu sagen, um mir das zu vermitteln.
»Ich habe mir bloß gedacht, du könntest eventuell seine Wohnung in Richmond überprüfen«, sagte ich ihm.
»Jaja. Das mache ich todsicher.«
»Ich weiß nicht, was uns erwartet.«
»Also ich wünschte mir, du würdest die das zuerst rausfinden lassen.«
In Chesapeake nahm ich die Ausfahrt Elizabeth River und bog nach links auf die High Street ab, wo ich an Kirchen, Gebrauchtwagenhändlern und Wohnwagensiedlungen vorbeikam. Hinter dem örtlichen Gefängnis und dem Polizeirevier verlor sich die Marinekaserne in weiträumigem, deprimierendem Schrottgelände, das von einem stacheldrahtbewehrten, rostigen Zaun umgeben war. Inmitten dieser riesigen Fläche, wo überall Metall herumlag und das Unkraut nur so wucherte, befand sich ein Kraftwerk, das anscheinend Müll und Kohle verbrannte, um den Schiffsfriedhof mit Energie für sein trostloses und träges Geschäft zu versorgen. Schornsteine und Gleisanlagen waren heute nicht in Betrieb, alle Kräne am Trockendock standen still. Schließlich war Silvester. Ich fuhr auf das Hauptquartier zu, einen Bau aus langweiligen, rotgrauen Hohlblocksteinen, hinter dem sich lange, gepflasterte Kais erstreckten. Am Wachtor trat ein junger Mann in Zivilkleidung und mit Schutzhelm aus seinem Häuschen. Ich ließ das Fenster herunter. Am windgepeitschten Himmel wirbelten die Wolken vorbei.
»Dies ist militärischer Sicherheitsbereich.« Er verzog keine Miene.
»Ich bin Dr. Kay Scarpetta, Chief Medical Examiner«, sagte ich und hielt meine Messingplakette hoch, das Symbol dafür, dass ich bei jedem plötzlichen, unbeobachteten, unerklärlichen oder gewaltsamen Todesfall im Bundesstaat Virginia juristisch zuständig war.
Er beugte sich vor und studierte meine Beglaubigung. Ein paarmal blickte er mir ins Gesicht und starrte auf meinen Wagen.
»Sie sind der Chief Medical Examiner?«, fragte er. »Wie kommt es dann, dass Sie keinen Leichenwagen fahren?«
Ich hatte das schon öfter gehört und antwortete geduldig: »Leute, die in Bestattungsunternehmen arbeiten, fahren Leichenwagen. Ich arbeite nicht in einem Bestattungsunternehmen. Ich stelle die Todesursache fest.«
»Ich brauche noch einen anderen Ausweis von Ihnen.«
Ich gab ihm meinen Führerschein und hatte keine Zweifel mehr daran, dass solche Art von Einmischung nicht aufhören würde, nachdem ich eine Durchfahrtsgenehmigung bekommen hatte. Er trat ein paar Schritte von meinem Auto zurück und hob ein Funkgerät an die Lippen.
»Einheit elf an Einheit zwei.« Er drehte sich von mir weg, als würde er gleich eine Geheimsache durchgeben.
»Zwei«, kam krächzend die Antwort.
»Ich hab eine Dr. Scaylatta hier.« Er sprach meinen Namen so falsch aus wie kaum jemand.
»Zehn-vier. Bereit.«
»Ma’am«, sagte der Wachtposten zu mir, »fahren Sie einfach geradeaus, dann kommt rechts ein Parkplatz.« Er deutete mit der Hand in die Richtung. »Sie stellen Ihren Wagen dort ab und gehen zur Pier zwei, wo Sie Captain Green erwartet. An den müssen Sie sich wenden.«
»Und wo finde ich Detective Roche?«, fragte ich.
»Sie müssen sich an Captain Green wenden«, sagte er noch einmal.
Ich ließ das Fenster wieder hoch, während er ein Tor öffnete, auf dem Schilder mir verkündeten, dass ich nun Gelände betrat, wo Gefahr drohte, Sicherheitsausrüstung verlangt und Parken nur auf eigenes Risiko erlaubt war. In der Ferne ragten graue Frachter, Landungsschiffe, Minensucher, Fregatten und Tragflächenboote bedrohlich in den kalten Himmel. Auf der zweiten Pier hatten sich Rettungswagen, Polizeiautos und eine kleine Menschengruppe eingefunden.
Ich stellte meinen Wagen wie befohlen ab und schritt dann forsch auf sie zu. Sie starrten mir entgegen. Ich hatte meine Arzttasche und die Tauchausrüstung im Auto gelassen und lieferte ihnen so das Bild einer Frau mittleren Alters mit leeren Händen, in Wanderstiefeln, Wollhose und armeegrünem Mantel. Kaum hatte ich den Kai betreten, schnitt mir ein kultiviert aussehender, uniformierter Mann mit grauen Schläfen den Weg ab, als wäre ich unbefugt auf das Gelände eingedrungen. Ohne den Anflug eines Lächelns trat er mir entgegen.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er in einem Ton, der mir Halt gebot. Der Wind hatte seine Haare aufgerichtet und seine Wangen gerötet.
Ich erklärte noch einmal, wer ich war.
»Ah, okay.« Er klang eindeutig nicht so, als meinte er dies. »Ich bin Captain Green vom Navy Investigative Service. Wir müssen wirklich mit der Sache vorankommen. Hör zu«, er wandte sich von mir ab und sprach zu jemand anderem. »Wir müssen diese KDs wegschaffen.«
»Entschuldigen Sie? Sie sind vom NIS?«, schaltete ich mich ein, denn das musste sofort geklärt werden. »Ich war der Meinung, dass dieses Gelände nicht der Navy gehört. Wenn es Navy-Gelände ist, dann ist meine Anwesenheit nicht erforderlich. Dann ist das ein Navy-Fall, und die Autopsie sollte ein Forensiker der Navy vornehmen.«
»Ma’am«, sagte er, als wollte ich seine Geduld strapazieren, »dieses Gelände gehört einem Zivilunternehmen und untersteht deshalb nicht der Navy. Aber wir haben ein naheliegendes Interesse, weil offenbar jemand unbefugt bei unseren Schiffen getaucht ist.«
»Haben Sie eine Vermutung, warum jemand das getan haben könnte?« Ich blickte mich um.
»Ein Paar Schatzjäger meinen, sie würden im Wasser hier Kanonenkugeln, alte Schiffsglocken und was weiß ich noch alles finden.«
Wir standen zwischen dem Frachter El Paso und dem U-Boot Exploiter, beide glanzlos und starr im Fluss. Das Wasser sah wie Cappuccino aus, und mir wurde klar, dass die Sicht noch schlechter sein würde, als ich befürchtet hatte. Neben dem U-Boot war eine Tauchplattform. Aber ich sah nichts, was auf das Opfer hindeutete, keine Rettungs- oder Polizeitrupps, die diesen Todesfall bearbeiten sollten. Ich fragte Green danach, während der vom Wasser wehende Wind mir das Gesicht taub werden ließ, und statt einer Antwort bekam ich wieder den Rücken zugedreht.
»Hör mal, ich kann nicht den ganzen Tag auf Stu warten«, sagte er zu einem Mann in einem Overall und einer schmutzigen Skijacke.
»Wir könnten Bo holen, Captain«, lautete die Antwort.
»Absolut zwecklos«, sagte Green, der diese Werftarbeiter gut zu kennen schien. »Bringt nichts, den Kerl herzurufen.«
»Zum Teufel«, sagte ein Mann mit einem langen, krausen Bart. »Wir wissen doch alle, dass er so spät am Vormittag nicht mehr nüchtern ist.«
»Also, wenn da nicht ein Esel den anderen Langohr schimpft«, ließ sich Green vernehmen, und alle lachten.
Der bärtige Mann hatte ein Gesicht wie rohes Hackfleisch. Er beäugte mich verstohlen, während er sich eine Zigarette anzündete, mit seinen groben, bloßen Händen den Wind abhaltend.
»Ich hab seit gestern nichts mehr getrunken. Nicht mal Wasser«, schwor er, worauf seine Kumpel wieder lachten. »Verdammt, hier ist es lausig kalt.« Er schlang die Arme um den Körper. »Ich hätte ’nen dickeren Mantel anziehen sollen.«
»Ich sag dir mal, was hier kalt ist: der da unten«, meinte ein anderer Arbeiter, mit klappernden Zähnen. Er sprach von dem toten Taucher. »Der Kerl ist echt kalt.«
»Der spürt nichts mehr.«
Ich zügelte meinen aufsteigenden Unmut, als ich zu Green sagte: »Ich weiß, Sie sind scharf darauf anzufangen, und ich bin es genauso. Aber ich sehe keine Rettungsmannschaften oder Polizisten. Ich habe auch noch nicht das Boot oder den Flussabschnitt gesehen, wo die Leiche sein soll.«
Ich spürte ein halbes Dutzend Augenpaare auf mich gerichtet und musterte die gegerbten Gesichter dieser Männer, die leicht als Piraten in modernem Gewand hätten durchgehen können. Ich war nicht in ihren Geheimbund aufgenommen und fühlte mich an die frühen Jahre erinnert, als Grobheit und Missachtung mir noch Tränen in die Augen getrieben hatten.
Green antwortete endlich. »Die Polizisten sind drinnen an den Telefonen. Im Hauptgebäude dort drüben, mit dem großen Anker darauf. Die Taucher sind wahrscheinlich auch da drinnen und halten sich warm. Das Rettungsteam ist auf einem Anlegeplatz auf der anderen Flussseite und wartet dort auf Ihre Ankunft. Und es dürfte Sie interessieren, dass an diesem Anleger die Polizei gerade einen Pick-up mit Anhänger gefunden hat, der, glauben sie, dem Verstorbenen gehörte. Wenn Sie mir folgen wollen. Ich zeige Ihnen die Stelle, die Sie interessiert. Soviel ich weiß, haben Sie vor, mit den anderen Tauchern nach unten zu gehen.«
»Das stimmt.« Ich schritt neben ihm die Pier entlang.
»Mir ist völlig unklar, was Sie sich davon erwarten.«
»Ich habe schon lange gelernt, keine Erwartungen zu haben, Captain Green.«
Als wir an den alten, müden Schiffen vorbeikamen, fielen mir die vielen dünnen Drähte auf, die davon ins Wasser führten. »Was ist das?«, fragte ich.
»KDs – Kathodendrähte«, antwortete er. »Sie sind elektrisch geladen, um die Korrosion zu bremsen.«
»Ich hoffe doch, dass jemand sie ausgeschaltet hat.«
»Ein Elektriker ist schon unterwegs. Er wird die ganze Pier abschalten.«
»Da könnte der Taucher also an die KDs geraten sein. Ich bezweifle, dass sie gut zu sehen waren.«
»Das hätte keine Rolle gespielt. Die Spannung ist sehr gering«, sagte er, als wüsste das jeder. »Das ist so wie ein Schlag von einer Neun-Volt-Batterie. Die KDs haben ihn nicht getötet. Das können Sie schon mal von Ihrer Liste streichen.«
Wir standen am Ende des Kais, wo das Heck des teilweise unter Wasser liegenden U-Boots gut zu sehen war. Keine zehn Meter davon entfernt ankerte der dunkelgrüne Aluminiumkahn mit dem langen schwarzen Schlauch, der vom Kompressor wegführte und auf der Passagierseite in einer Ummantelung steckte. Der Boden des Bootes war mit Werkzeugen, Tauchausrüstung und anderen Gegenständen übersät, die, wie ich vermutete, jemand ziemlich nachlässig untersucht hatte. Mir wurde eng ums Herz, denn ich war wütender, als ich nach außen hin zeigen wollte.
»Er ist womöglich einfach ersoffen«, sagte Green gerade. »Beinahe jeder Tauchertod, den ich zu Gesicht bekommen habe, ist durch Ertrinken verursacht worden. Man kann selbst in so seichtem Wasser sterben.«
»Auf jeden Fall finde ich seine Ausrüstung ungewöhnlich.« Ich ignorierte seine Anmaßung in medizinischen Fragen.
Er blickte auf den Kahn, der von der Strömung kaum bewegt wurde. »Eine Hookah, ein Niederdrucktauchgerät. Jaja, das ist hier ungewöhnlich.«
»Lief sie, als das Boot gefunden wurde?«
»Kein Benzin mehr.«
»Was können Sie mir darüber sagen? Eigenbau?«
»Handelsüblich«, sagte er. »Ein Fünf-PS-Kompressor mit Benzinmotor, der die Außenluft durch einen Niederdruckschlauch ansaugt, der mit einem Stufenregler verbunden ist. Er hätte vier, fünf Stunden unten bleiben können. So lange, wie das Benzin reichte.« Er blickte immer noch von mir weg.
»Vier oder fünf Stunden? Wofür? Das würde mir einleuchten, wenn jemand auf Hummer oder Abalonen scharf ist.«
Er schwieg.
»Was ist da unten?«, fragte ich. »Und sagen Sie jetzt nicht, Bürgerkriegsrelikte, weil wir beide wissen, dass die hier nicht zu finden sind.«
»In Wahrheit ist überhaupt nichts da unten.«
»Aber er hat gedacht, da wäre was«, meinte ich.
»Unglücklicherweise hat er sich geirrt. Sehen Sie bloß diese Wolken da. Es wird uns ganz bestimmt erwischen.« Er stellte den Mantelkragen hoch. »Ich nehme an, Sie haben einen Tauchschein.«
»Seit vielen Jahren.«
»Sie werden ihn mir vorzeigen müssen.«
Ich blickte zu dem Kahn und dem nahe gelegenen U-Boot hinüber, während ich mich fragte, wie unkooperativ diese Leute wohl noch sein würden.
»Sie müssen ihn bei sich haben, wenn Sie da runtergehen wollen«, sagte er. »Ich dachte, Sie wissen das.«
»Aha, aber diese Anlage untersteht nicht der Navy.«
»Ich kenne die Bestimmungen. Wem sie untersteht, ist nicht maßgeblich.« Er schaute mich an.
»Verstehe.« Ich starrte zurück. »Und vermutlich brauche ich eine Genehmigung, wenn ich mein Auto hier auf diesem Kai abstellen will, damit ich meine Tauchausrüstung nicht einen halben Kilometer schleppen muss.«
»Sie brauchen in der Tat eine Genehmigung, um auf dem Kai zu parken.«
»Die habe ich aber nicht. Ich habe weder meine offizielle Zulassung zum Rettungstauchen noch mein Tauchbuch dabei. Und auch nicht meine Bescheinigungen, dass ich in Virginia, Maryland und Florida als Ärztin tätig sein darf.«
Ich sprach sehr sanft und leise, und weil er mich nicht aus der Ruhe bringen konnte, wurde er nur umso entschiedener. Er blinzelte ein paarmal, und ich konnte seinen Hass spüren.
»Ich werde Sie jetzt ein letztes Mal bitten, mir die Ausübung meines Berufs zu gestatten«, fuhr ich fort. »Es hat hier einen unnatürlichen Todesfall in meinem Zuständigkeitsbereich gegeben. Wenn Sie nicht kooperieren wollen, rufe ich gern die State Police, den U.S. Marshal oder das FBI an. Die Wahl überlasse ich Ihnen. In zwanzig Minuten kann ich wahrscheinlich jemanden hierherbekommen. Ich habe mein Handy hier in der Tasche.« Ich klopfte darauf.
»Sie wollen tauchen«, – er zuckte mit den Achseln –, »dann tun Sie das. Aber Sie werden eine Verzichtserklärung unterschreiben müssen, womit Sie den Anlagenbetreiber von aller Verantwortung freisprechen, sollte Ihnen ein Unglück zustoßen. Und ich bezweifle ernsthaft, dass es hier Formblätter dafür gibt.«
»Verstehe. Jetzt muss ich etwas unterschreiben, was Sie nicht haben.«
»Stimmt.«
»Na fein«, sagte ich. »Dann werde ich für Sie eine Verzichtserklärung aufsetzen.«
»Das müsste ein Anwalt machen, und es ist Feiertag.«
»Ich bin Anwältin und arbeite an Feiertagen.«
Seine Kiefer verkrampften sich. Ich wusste, er würde sich nicht länger mit Formblättern abgeben. Wir gingen wieder zurück, und mein Magen zog sich vor Unbehagen zusammen. Ich wollte gar nicht tauchen und mochte auch die Leute nicht, die ich an diesem Tag getroffen hatte. Gewiss hatte ich mich schon früher im bürokratischen Stacheldraht verheddert, wenn die Regierung oder große Firmen mit den Fällen zu tun hatten. Aber das hier war anders.
»Sagen Sie mir eines.« Green sprach wieder in seinem verächtlichen Ton. »Tauchen Gerichtsmediziner immer persönlich nach Leichen?«
»Selten.«
»Dann erklären Sie mir, warum Sie es diesmal für nötig halten.«
»Der Schauplatz ist nicht mehr derselbe, wenn die Leiche bewegt worden ist. Ich glaube, die Umstände sind ungewöhnlich genug, um einen Blick darauf zu werfen, solange ich es noch kann. Und im Augenblick betreue ich gerade den Bezirk Tidewater und war zufällig anwesend, als der Anruf kam.«
Er schwieg kurz und raubte mir den letzten Nerv, als er sagte: »Es hat mir wirklich leidgetan, als ich das von Dr. Mants Mutter erfuhr. Wann ist er wieder zurück?«
Ich versuchte, mich an den Anruf von heute Morgen zu erinnern und an den Mann, der sich Young nannte, mit seinem auffälligen Südstaatenakzent. Green klang nicht wie ein Südstaatler, aber das tat ich auch nicht, was noch lange nicht hieß, dass einer von uns die Sprechweise nicht nachahmen konnte.
»Ich bin nicht sicher, wann er zurückkehrt«, erwiderte ich vorsichtig. »Aber ich frage mich, woher Sie ihn kennen.«
»Manchmal überschneiden sich Fälle, wohl oder übel.«
Ich war mir nicht sicher, worauf er anspielte.
»Dr. Mant ist so klug, sich nicht einzumischen«, fuhr Green fort. »Mit solchen Leuten lässt es sich gut arbeiten.«
»In was mischt er sich nicht ein, Captain Green?«
»In die Fälle der Navy zum Beispiel, oder wenn es darum geht, ob dieser oder jener zuständig ist. Es gibt viele verschiedene Arten, sich einzumischen. Und das ist jedes Mal problematisch und kann Schaden anrichten. Zum Beispiel dieser Taucher. Er hat sich wo rumgetrieben, wo er nichts zu suchen hatte, und Sie sehen ja, was mit ihm passiert ist.«
Ich blieb stehen und starrte ihn ungläubig an. »Es muss an meiner Einbildungskraft liegen«, sagte ich, »aber ich glaube, Sie wollen mir drohen.«
»Holen Sie Ihr Zeug. Sie können hier in der Nähe parken, an dem Zaun dort drüben«, sagte er und ging.
2
Green war schon lange in dem Gebäude mit dem Anker verschwunden, und ich saß auf der Pier und bemühte mich, den dicken Taucheranzug über meinen Unterzieher zu streifen. Nicht weit von mir machten einige Rettungstaucher ein Boot mit flachem Boden bereit, das an einem Pfahl vertäut war. Arbeiter vom Schiffsfriedhof liefen neugierig herum, und auf der Tauchplattform prüften zwei Männer in königsblauem Neopren Funkgeräte und schienen sehr gründlich die Tauchausrüstung, einschließlich meiner eigenen, zu inspizieren.
Ich sah, dass die Taucher miteinander redeten, aber ich konnte kein Wort verstehen, als sie Schläuche abschraubten und Bleigürtel anlegten. Von Zeit zu Zeit blickten sie in meine Richtung, und ich war überrascht, als einer von ihnen sich entschloss, die Leiter zu meinem Kai hochzuklettern. Er kam auf mich zu und setzte sich neben mich auf das kalte Pflaster.
»Ist der Platz hier noch frei?« Er war ein hübscher junger Schwarzer mit der Statur eines Olympiaschwimmers.
»Es gibt eine Menge Anwärter darauf, aber ich weiß im Moment nicht, wo sie sind.« Ich mühte mich immer noch mit dem Taucheranzug ab. »Verdammt. Ich hasse diese Dinger.«
»Stellen Sie sich doch einfach vor, Sie würden sich einen Luftschlauch überstülpen.«
»Ja, das hilft ungemein.«
»Ich muss mit Ihnen über die Unterwasserkommunikationsgeräte reden. Haben Sie so was schon mal benutzt?«, fragte er.
Ich blickte in sein ernstes Gesicht: »Sind Sie von der Polizei?«
»Nee, bloß von der guten alten Navy. Und ich weiß nicht, wie das mit Ihnen ist, aber so habe ich mir Silvester garantiert nicht vorgestellt. Ich habe keine Ahnung, warum jemand in diesem Fluss tauchen will, es sei denn, er hat die fixe Idee, dass er eine blinde Kaulquappe in einer Schlammpfütze ist. Oder er hat vielleicht Eisenmangel und glaubt, der ganze Rost da drin könnte ihm helfen.«
»Von dem ganzen Rost kriegen Sie bloß Tetanus.« Ich blickte mich um. »Wer tritt sonst noch von der Navy gegen die Polizei an?«
»Die beiden im Rettungsboot sind von der Polizei. Ki Soo da unten auf der Plattform ist der einzige andere von der Navy, außer unserem beherzten Ermittler von der NIS. Ki ist gut. Er ist mein Kumpel.«
Er gab Ki Soo ein Okay-Zeichen, und der gab ihm ein Okay zurück. Ich fand das alles ziemlich interessant und anders als meine bisherigen Erfahrungen.
»Jetzt hören Sie mal zu.« Mein neuer Bekannter sprach, als arbeite er schon jahrelang mit mir zusammen. »Die Kommunikationsgeräte können problematisch werden, wenn Sie sie noch nie benutzt haben. Die können echt gefährlich werden.« Sein Gesicht blieb ernst.
»Ich bin damit vertraut«, versicherte ich ihm, unbekümmerter, als mir zumute war.
»Na, Sie müssen mehr als nur vertraut damit sein. Sie müssen sie wie einen Freund sehen, denn wie Ihr Tauchgefährte können sie Ihr Leben retten.« Er schwieg kurz. »Die können Sie auch umbringen.«
Ich hatte erst einmal eine Unterwasserkommunikationsausrüstung benutzt und war beunruhigt, dass mein Mundstück mit Absperrventil durch eine fest versiegelte Maske mit einem Mundstück ohne Spülventil ersetzt werden sollte. Ich hatte Angst, dass Wasser in meine Maske dringen könnte und ich sie abreißen müsste, während ich wie verrückt nach der alternativen Luftversorgung oder gar einem Oktopus griff. Aber das würde ich nicht erwähnen, nicht hier.
»Ich schaff das schon«, versicherte ich ihm erneut.
»Großartig. Ich habe gehört, Sie sind ein Profi«, sagte er. »Übrigens, ich heiße Jerod, und ich weiß bereits, wer Sie sind.« Er saß im Schneidersitz da, warf Kiesel ins Wasser und schien von den sich langsam ausdehnenden Kreisen fasziniert zu sein. »Ich hab ’ne Menge toller Sachen über Sie gehört. Und wenn meine Frau rausfindet, dass ich Sie kennengelernt habe, wird sie eifersüchtig werden.«
Mir war nicht klar, warum ein Navy-Taucher irgendetwas über mich gehört haben sollte, über das hinaus, was in den Nachrichten kam, und das war nicht immer freundlich. Aber seine Worte waren Balsam in meiner aufgewühlten Stimmung, und ich wollte ihm das gerade sagen, als er auf seine Uhr schaute, dann auf die Plattform starrte und Ki Soos Blick auffing.
»Dr. Scarpetta.« Jerod stand auf. »Ich glaube, wir sind bereit zu einem Tänzchen. Wie steht’s mit Ihnen?«
»Ich bin so weit fertig.« Ich stand ebenfalls auf. »Was ist der beste Zugang?«
»Der beste, eigentlich der einzige, ist der, seinem Schlauch nach unten zu folgen.«
Wir näherten uns dem Rand des Kais, und er deutete auf den Kahn.
»Ich bin schon einmal unten gewesen, und wenn Sie nicht dem Schlauch folgen, werden Sie ihn nie finden. Mussten Sie schon mal ohne Licht durch einen Abwasserkanal waten?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Nun, da können Sie einen Scheiß sehen. Und das hier ist genauso.«
»Soweit Sie wissen, hat niemand etwas an der Leiche verändert«, sagte ich.
»Außer mir ist niemand in ihre Nähe gekommen.«
Er sah zu, wie ich meine Weste aufhob und eine Lampe in meine Tasche steckte.
»Damit würde ich mich nicht herumplagen. Unter den Bedingungen ist Ihnen eine Taschenlampe nur im Weg.«
Aber ich wollte sie dennoch mitnehmen, weil ich jeden nur möglichen Vorteil nutzen wollte. Jerod und ich stiegen die Leiter zur Tauchplattform hinunter, um die Vorbereitungen abzuschließen. Ich ignorierte das Starren der Leute am Kai, als ich mir Cremespülung ins Haar rieb und die Neoprenhaube überstreifte. Ich schnallte mir ein Messer an die Innenseite des rechten Unterschenkels und griff dann nach beiden Enden des fünfzehn Pfund schweren Bleigürtels, den ich rasch um die Hüfte legte. Ich überprüfte die Sicherheitsventile und streifte die Handschuhe über.
»Bereit«, sagte ich zu Ki Soo.
Er brachte die Kommunikationsgeräte und mein Mundstück.
»Ich schließe Ihren Luftschlauch an die Gesichtsmaske an.« Er sprach akzentfrei. »Soweit ich weiß, haben Sie so ein Gerät schon mal benutzt.«
»Das stimmt«, erwiderte ich.
Er hockte sich neben mich und senkte die Stimme, als wären wir Verschwörer. »Sie, Jerod und ich sind über die Sprechgeräte in ständigem Kontakt.«
Sie sahen wie rote Gasmasken aus und hatten fünf Gurte zum Anlegen. Jerod stellte sich hinter mich und half mir beim Überziehen der Weste und der Tauchflasche, während sein Kumpel weitersprach.
»Wie Sie wissen«, sagte Ki Soo gerade, »atmen Sie normal, und verwenden Sie den Druckknopf am Mundstück zum Sprechen, wenn etwas mitzuteilen ist.« Er führte es vor. »Wir müssen das ordentlich und sicher über Ihr Kopfteil tun und anlegen. Jetzt stopfen wir die herausschauenden Haare rein, und lassen Sie mich noch einmal zur Sicherheit überprüfen, dass es hinten richtig festsitzt.«
Ich hasste die Sprechgeräte am meisten, wenn ich nicht im Wasser war, weil das Atmen so schwerfiel. Ich saugte, so gut ich konnte, Luft ein, während ich durch das Plastik auf die beiden Taucher spähte, denen ich gerade mein Leben anvertraut hatte.
»Zwei Rettungsmänner sind in einem Boot und überwachen uns mit einem Energieumwandler, der ins Wasser gelassen wird. Alles, was Sie sagen, wird von allen gehört, die an der Oberfläche lauschen. Haben Sie verstanden?« Ki Soo sah mich an, und ich wusste, dass ich gerade eine Warnung erhalten hatte.
Ich nickte. Mein Atem klang laut in meinen Ohren.
»Wollen Sie jetzt Ihre Flossen anziehen?«
Ich schüttelte den Kopf und deutete aufs Wasser.
»Dann gehen Sie erst rein, und ich werfe sie Ihnen zu.«
Mit mindestens achtzig Pfund mehr Gewicht als vorher bewegte ich mich vorsichtig an den Rand der Tauchplattform und überprüfte noch einmal den Sitz meiner Maske am Kopfteil. Kathodendrähte hingen wie Welsbarten von den riesigen, schlafenden Schiffen, der Wind kräuselte das Wasser. Ich überwand mich und sprang ins Wasser.
Die Kälte war zuerst ein Schock, und als ich die Taucherflossen anzog, brauchte mein Körper eine Weile, bis er das in meine Gummihaut dringende Wasser erwärmt hatte. Schlimmer noch war, dass ich meine Computerkonsole und meinen Kompass nicht sehen konnte. Nicht einmal die Hand vor den Augen war zu sehen, und erst jetzt verstand ich, warum es sinnlos war, eine Taschenlampe mitzunehmen. Das schwebende Sediment schluckte das Licht wie ein Löschblatt und zwang mich, häufig aufzutauchen, um mich zu orten, als ich auf den Fleck zuschwamm, wo der Schlauch vom Kahn wegführte und im Fluss verschwand.
»Zehn-vier?« Ki Soos Stimme ertönte in dem an meinen Schädelknochen gedrückten Empfangsgerät.
»Zehn-vier«. Ich sprach ins Mundstück und versuchte, mich zu entspannen, während ich knapp unter die Oberfläche paddelte. »Sind Sie am Schlauch?« Diesmal sprach Jerod.
»Ich habe ihn jetzt in den Händen.« Er kam mir seltsam straff vor, und ich achtete darauf, ihn so wenig wie möglich zu verändern.
»Folgen Sie ihm nach unten. Vielleicht zehn Meter. Er sollte direkt über dem Grund schweben.«
Ich begann meinen Abstieg und hielt in Abständen inne, um den Druck in den Ohren auszugleichen, während ich versuchte, nicht in Panik zu geraten. Ich konnte nichts sehen. Mein Herz klopfte und mit aller Willenskraft zwang ich mich, zu entspannen und tief durchzuatmen. Einen Augenblick hielt ich an und schwebte, meine Augen geschlossen, und atmete langsam. Ich folgte weiter dem Schlauch, doch ich bekam es wieder mit der Angst zu tun, als ein dickes, rostiges Kabel plötzlich vor mir auftauchte.
Ich versuchte, darunter durchzutauchen, aber ich konnte nicht sehen, wo es herkam und wo es hinführte, und außerdem trieb ich mehr ab, als mir lieb war, und hätte mehr Gewicht in meinem Gürtel oder in den Taschen meiner Weste brauchen können. Das Kabel erwischte mich von hinten, stieß hart an mein Sperrventil. Ich spürte ein Ziehen an meinem Lungenautomaten, als würde mich jemand von hinten packen, und der gelockerte Tank glitt an meinem Rücken hinab und zog mich mit sich. Ich riss die Klettverschlüsse meiner Weste auf und entledigte mich ihrer rasch, während ich versuchte, mich nur auf das zu konzentrieren, was ich für so einen Fall zu tun gelernt hatte.
»Zehn-vier?«, ertönte Ki Soos Stimme in meiner Maske.
»Technisches Problem«, sagte ich.
Ich bugsierte den Tank zwischen meine Beine, sodass ich auf ihm treiben konnte, als ritte ich im kalten, dunklen All auf einer Rakete. Ich brachte die Gurte wieder an und bekämpfte meine Angst.
»Brauchen Sie Hilfe?«
»Nein. Passen Sie auf die Kabel auf«, sagte ich.
»Man muss hier auf alles Mögliche aufpassen«, hörte ich wieder seine Stimme.
Es kam mir in den Sinn, dass es viele Arten gab, hier unten zu sterben, während ich mit den Armen in die Weste schlüpfte. Ich machte eine Rolle rückwärts und klinkte mich wieder fest ein.
»Zehn-vier?«, ertönte wieder Ki Soos Stimme.
»Zehn-vier. Es gibt Unterbrechungen.«
»Zu viele Interferenzen. All die großen Kähne. Wir sind gleich hinter Ihnen. Sollen wir näher kommen?«
»Noch nicht«, sagte ich.
Sie hielten klug Abstand, weil Sie wussten, dass ich die Leiche sehen wollte, ohne abgelenkt oder gestört zu werden. Wir mussten einander nicht ins Gehege kommen. Langsam ließ ich mich tiefer sinken, und schon beinahe am Grund erkannte ich, dass der Schlauch eingeklemmt sein musste, weshalb er so straff war. Ich war mir nicht sicher, wohin ich mich wenden sollte, und versuchte, etwas weiter nach links zu gelangen, wo mich etwas streifte. Ich drehte mich um, und da hatte ich ihn direkt vor mir, den toten Mann, dessen Körper torkelte und schwankte. Ich schreckte unwillkürlich zurück. Träge schaukelte und schwebte er am Ende seiner Leine, die gummiumkleideten Arme wie ein Schlafwandler ausgestreckt, als ich durch meine Bewegung ihn hinter mir herzog.
Ich ließ ihn nahe herantreiben, und er schwankte und torkelte noch immer, aber nun hatte ich keine Angst mehr, weil ich nicht mehr überrascht war. Es war so, als versuchte er, meine Aufmerksamkeit zu erregen oder mit mir durch die höllische Dunkelheit des Flusses zu tanzen, der sich ihn geholt hatte. Ich hielt mich in neutraler Schwebe, bewegte kaum die Flossen, weil ich nicht den Grund aufwühlen oder mich an rostigem Schrott schneiden wollte.
»Ich hab ihn. Oder vielleicht sollte ich sagen, er hat mich.« Ich drückte auf den Sprechknopf. »Können Sie mich verstehen?«
»Kaum. Wir sind etwa vier Meter über Ihnen und warten.«
»Warten Sie noch ein paar Minuten. Dann geht’s los.«
Ich probierte für alle Fälle ein letztes Mal die Taschenlampe aus, aber sie blieb nutzlos, und mir war klar, dass ich diese Szenerie mit meinen Händen sehen musste. Ich steckte die Lampe wieder in die Weste und hielt die Computerkonsole fast direkt an meine Maske. Ich konnte gerade noch erkennen, dass ich mich in fast zehn Meter Tiefe befand und noch mehr als einen halben Tank Luft hatte. Ich schwebte am Kopf des Toten und konnte durch die Düsternis die vagen Konturen seines Gesichts erkennen und die Haare, die um seine Maske trieben.
Während ich ihn an den Schultern festhielt, befühlte ich seine Brust und ertastete den Schlauch. Er war durch seinen Bleigürtel gesteckt, und ich folgte ihm zu der Stelle, wo er festklemmte. In knapp drei Metern tauchte eine rostige Schiffsschraube vor meinen Augen auf. Ich berührte das muschelverkrustete Metall der Schiffswand und versuchte, mich auf der Stelle zu bewegen, um nicht näher heranzutreiben. Ich wollte nicht unter ein Ungetüm von der Größe eines Spielfelds geraten und mich blind nach draußen tasten müssen, bevor mir die Luft ausging.
Der Schlauch war verhakt, und ich fühlte an ihm entlang, um festzustellen, ob er so geknickt oder eingedrückt war, dass die Luftzufuhr abgeschnitten war, fand aber keine Anzeichen dafür. Tatsächlich stellte ich fest, dass es gar nicht schwer war, ihn von der Schraube zu lösen. Ich konnte keinen Grund erkennen, warum der Taucher sich nicht selbst hätte befreien können, und mich beschlich der Verdacht, dass sein Schlauch sich erst nach seinem Tod verfangen hatte.
»Sein Luftschlauch hat sich verheddert«, meldete ich mich wieder. »An einem der Schiffe. Ich weiß nicht, welchem.«
»Brauchen Sie Hilfe?« Das war Jerod.
»Nein, ich hab ihn. Sie können ihn rausholen.«
Ich spürte, wie der Schlauch sich bewegte.
»Okay. Ich werde ihn hinaufgeleiten«, sagte ich. »Ziehen Sie weiter, aber ganz langsam.«
Ich klammerte mich mit den Armen von hinten an die Leiche und konnte wegen der eingeschränkten Bewegungsfreiheit statt mit den Oberschenkeln nur mit Knöcheln und Knien paddeln.
»Vorsichtig«, sprach ich warnend ins Mikrophon, denn ich konnte pro Sekunde nur dreißig Zentimeter hochsteigen. »Langsam, langsam.«
In Abständen schaute ich nach oben, konnte aber nicht erkennen, wo ich mich befand, bis wir die Wasseroberfläche durchstießen. Dann war auf einmal der Himmel mit schiefergrauen Wolken überzogen, und das Rettungsboot schaukelte in der Nähe. Ich ließ Luft in meine Weste und in die des Toten, dann drehte ich ihn auf den Bauch und löste seinen Bleigürtel, den ich beinahe fallen ließ, so schwer fühlte er sich an. Aber ich schaffte es, ihn den Rettungsmännern zu geben, die Taucheranzüge trugen und zu wissen schienen, was sie in ihrem alten flachen Boot taten.
Jerod, Ki Soo und ich mussten unsere Masken aufbehalten, weil wir noch zur Plattform zu schwimmen hatten. Und so verständigten wir uns über die Sprechgeräte und atmeten die Luft aus den Flaschen ein, während wir die Leiche in einen feinmaschigen Korb bugsierten. Wir schoben ihn direkt ans Boot und halfen dann den Rettungsleuten, ihn hochzuheben.
»Wir müssen ihm die Maske abnehmen«, sagte ich und deutete auf die Rettungsleute.
Sie kamen mir verwirrt vor, und wo auch immer der Energieumwandler sein mochte, bei ihnen war er eindeutig nicht. Sie konnten kein Wort verstehen.
»Brauchen Sie Hilfe beim Abnehmen der Maske?«, schrie einer und langte nach mir.
Ich winkte ab und schüttelte den Kopf. Dann griff ich nach der Bootskante und zog mich so weit nach oben, dass ich den Korb erreichte. Ich nahm dem Toten die Maske ab, leerte das Wasser aus und legte sie neben seinen Kopf mit dem wirren, langen, nassen Haar. Da erkannte ich ihn schließlich, trotz der ovalen Druckstellen um seine Augen. Ich kannte die gerade Nase und den dunklen Bart um seinen vollen Mund. Ich sah den Reporter, der mir gegenüber immer so fair gewesen war.
»Okay?« Einer der Rettungsmänner zuckte mit den Achseln.
Ich signalisierte ihnen okay, obwohl mir klar war, dass sie die Bedeutung meiner Handlung nicht verstanden. Der Grund war rein kosmetischer Natur, denn je länger die Maske Druck auf rasch erschlaffendes Gewebe ausübte, desto geringer war die Chance, dass die Einkerbungen wieder zurückgingen. Für Ermittler und Sanitäter war das nicht von Belang, umso mehr aber für die Angehörigen, die Ted Eddings’ Gesicht noch einmal sehen wollten.
»Bin ich zu verstehen?«, fragte ich dann Ki Soo und Jerod, als wir im Wasser auf und ab tanzten.
»Prima. Was soll mit dem Schlauch geschehen?«, fragte Jerod.
»Schneiden Sie ihn in etwa drei Meter Entfernung von der Leiche durch, und klemmen Sie das Ende ab«, sagte ich. »Versiegeln Sie das und sein Mundstück in einem Plastiksack.«
»Ich habe einen Bergungssack bei mir«, bot Ki Soo an.
»Gut. Nehmen wir den.«
Nachdem wir unser Möglichstes getan hatten, ruhten wir uns einen Augenblick lang aus, wobei wir in der Schwebe blieben und über das schlammige Wasser zu dem Boot mit der Hookah schauten. Als ich mir einen Überblick verschaffte, wo ich gewesen war, stellte ich fest, dass die Schraube, an der sich Eddings’ Schlauch verfangen hatte, zur Exploiter gehörte. Das U-Boot war, wie es aussah, nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden, vielleicht um die Zeit des Koreakriegs, und ich fragte mich, ob es ausgeschlachtet und als Schrott verkauft werden sollte. Ich fragte mich auch, ob Eddings aus einem bestimmten Grund dort getaucht hatte oder ob er nach seinem Tod dorthin getrieben worden ist.
Das Rettungsboot war auf halbem Weg zu dem Anleger auf der anderen Flussseite, wo ein Krankenwagen darauf wartete, den Toten ins Leichenschauhaus zu schaffen. Jerod gab mir ein Okay-Zeichen, und ich signalisierte zurück, obwohl sich alles überhaupt nicht okay anfühlte. Die Luft rauschte aus unseren Rettungswesten, und wir tauchten wieder unter. Das Wasser hatte die Farbe alter Münzen.
Eine Leiter führte aus dem Wasser auf die Tauchplattform, und von da ging eine weitere auf die Pier. Mit zitternden Beinen kletterte ich hoch, denn ich war nicht so stark wie Jerod und Ki Soo, die ihre ganze Ausrüstung trugen, als wiege sie kaum schwerer als ihre Haut. Doch ich entledigte mich allein meiner Weste und meiner Tauchflasche und bat nicht um Hilfe. Ein Polizeiwagen rumpelte zu meinem Auto, und jemand zog Eddings’ Kahn über den Fluss zum Steg. Er würde identifiziert werden müssen, aber für mich gab es da keine Zweifel.
»Na, was glauben Sie?«, fragte plötzlich eine Stimme von oben.
Als ich aufblickte, stand Captain Green mit einem großen, schlanken Mann auf der Pier. Green war jetzt offenbar gnädiger gestimmt, denn er streckte mir eine Hand entgegen. »Hier«, sagte er, »geben Sie mir Ihre Flasche.«
»Ich werde erst nach der Untersuchung Genaueres wissen«, sagte ich, hob erst den Tank und dann die übrige Ausrüstung hoch. »Danke. Das Boot sollte mit dem Schlauch und allem direkt ins Leichenschauhaus gebracht werden«, fügte ich hinzu.
»Was haben Sie damit vor?«, fragte er.
»Die Hookah muss auch zur Autopsie.«
»Sie werden Ihr Zeug sehr gründlich abspülen müssen«, sagte der schlanke Mann, als kenne er sich besser aus als Jacques Cousteau; seine Stimme kam mir bekannt vor. »Da drin ist alles voller Öl und Rost.«
»Wohl wahr.« Ich kletterte auf den Kai.
»Detective Roche«, stellte er sich vor. Er trug Jeans und eine alte Lederjacke. »Ich habe gehört, wie Sie sagten, sein Schlauch habe sich irgendwo verfangen.«
»Ja, aber ich frage mich, wann Sie mich das haben sagen hören.« Ich stand jetzt auf der Pier und konnte mich nicht mit der Idee anfreunden, mein nasses, schmutziges Zeug wieder zum Auto zu tragen.
»Wir haben selbstverständlich die Bergung der Leiche überwacht.« Das war wieder Green. »Detective Roche und ich haben im Gebäude mitgehört.«
Mir fiel Ki Soos Warnung wieder ein, und ich blickte zur Plattform, wo er mit Jerod die Geräte aufräumte.
»Der Schlauch war verhakt«, antwortete ich. »Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wann das geschehen ist. Vielleicht vor, vielleicht auch nach seinem Tod.«
Roche schien das nicht zu interessieren, denn er starrte mich weiter auf eine Art an, die mich befangen machte. Er war sehr jung und beinahe hübsch, mit zarten Gesichtszügen, üppigen Lippen und kurzen, dunklen Locken. Nur seine Augen gefielen mir nicht, ich fand seinen Blick stechend und selbstgefällig. Ich zog mir das Kopfteil ab und fuhr mir mit den Fingern durch mein öliges Haar, und er sah zu, wie ich meinen Taucheranzug öffnete und das Oberteil bis zur Hüfte herabzog. Die letzte Schicht war mein Unterzieher. Wasser war durchgedrungen, und meine Haut kühlte rasch ab. Bald würde mir unerträglich kalt sein. Meine Fingernägel waren bereits blau.
»Einer vom Rettungsteam sagt, dass sein Gesicht ganz rot aussieht«, meinte der Captain, während ich mir die Ärmel des Taucheranzugs um die Hüften band. »Ich frage mich, ob das was zu bedeuten hat.«
»Kälteflecken«, erwiderte ich.
Er sah mich erwartungsvoll an.
»Wenn Leichen Kälte ausgesetzt sind, verfärben sie sich hellrot«, sagte ich und fing schon an zu zittern.
»Ach so. Also heißt es nicht …«
»Nein«, schnitt ich ihm das Wort ab, weil mir viel zu ungemütlich war, als dass ich ihnen weiter zuhören wollte. »Das hat nicht unbedingt etwas zu bedeuten. Sagen Sie, gibt es hier eine Toilette, wo ich mich umziehen kann?« Ich schaute mich um und entdeckte nichts, was danach aussah.
»Dort drüben.« Green deutete auf einen kleinen Bauwagen neben dem Verwaltungsgebäude. »Möchten Sie, dass Detective Roche Sie begleitet und Ihnen alles zeigt?«
»Das ist nicht nötig.«
»Hoffentlich ist nicht zugesperrt«, fügte Green hinzu.
Das wäre mein Glück, dachte ich. Aber dem war nicht so, und drinnen war es schrecklich, nur Toilette und Waschbecken, und nichts schien in letzter Zeit gereinigt worden zu sein. Eine Tür zum Männerklo auf der anderen Seite war durch ein Vorhängeschloss mit einer dicken Kette gesichert, als wäre das eine oder das andere Geschlecht um seine Privatsphäre besorgt.
Es gab keine Heizung. Ich zog mich aus, nur um festzustellen, dass es nicht einmal warmes Wasser gab. Ich säuberte mich notdürftig und zog mir schnell einen Trainingsanzug, Moon-Boots und eine Mütze über. Mittlerweile war es halb zwei, und Lucy befand sich wahrscheinlich schon in Mants Haus. Ich hatte noch nicht mal mit der Tomatensoße angefangen. Ich sehnte mich nach einer langen heißen Dusche oder einem Bad.
Green ließ sich nicht abwimmeln, ging mit zu meinem Auto und half mir, meine Tauchausrüstung im Kofferraum zu verstauen. Mittlerweile war das Boot auf einen Anhänger geladen worden und unterwegs zu meinem Büro in Norfolk. Ich sah weder Jerod noch Ki Soo, und es tat mir leid, dass ich mich nicht von ihnen verabschieden konnte.
»Wann führen Sie die Autopsie durch?«, fragte mich Green.
Ich sah ihn an, er gab das typische Bild eines schwachen Menschen ab, der zu Macht oder Ansehen gekommen war. Er hatte alles Mögliche versucht, um mich einzuschüchtern, und als das zu nichts führte, hatte er beschlossen, Freundschaft zu schließen.
»Jetzt.« Ich ließ den Wagen an und drehte die Heizung auf.
Er sah überrascht aus. »Das Leichenschauhaus ist heute offen?«
»Ich habe es gerade geöffnet«, sagte ich.
Ich hatte die Tür noch nicht zugemacht, als er die Arme auf den Rahmen stützte und zu mir herabstarrte. Er war so dicht vor mir, dass ich die geplatzten Äderchen auf seinen Wangen und Nasenflügeln und die Pigmentveränderungen von der Sonne erkennen konnte.
»Geben Sie mir Ihren Bericht durch?«
»Wenn Todesursache und Todesart klar sind, werde ich das mit Ihnen besprechen«, sagte ich.
»Die Todesart?« Er runzelte die Stirn. »Meinen Sie, es bestehen noch Zweifel an einem Unfalltod?«
»Die können und werden immer da sein, Captain Green. Das gehört zu meinem Job.«
»Nun, wenn Sie ein Messer oder eine Kugel in seinem Rücken finden, rufen Sie mich hoffentlich zuerst an«, sagte er um Ironie bemüht und gab mir seine Karte.
Ich fuhr los, suchte mir die Nummer von Mants Assistenten heraus und hoffte, ihn zu Hause zu erreichen.
»Danny, hier Dr. Scarpetta«, sagte ich.
»Oh, ja, Ma’am«, sagte er überrascht.
Weihnachtslieder erklangen im Hintergrund, und ich hörte erregte Stimmen. Danny Webster war Anfang zwanzig und wohnte noch bei seinen Eltern.
»Tut mir leid, Sie an Silvester zu stören«, sagte ich, »aber wir haben eine Leiche, die unverzüglich obduziert werden muss. Ich bin gerade unterwegs zum Büro.«
»Brauchen Sie mich?« Er klang nicht abgeneigt.
»Wenn Sie mir helfen könnten, wäre ich Ihnen unendlich dankbar. Ein Boot und eine Leiche sind unterwegs.«
»Kein Problem, Dr. Scarpetta«, sagte er fröhlich. »Ich bin gleich da.«
Ich rief bei meiner derzeitigen Unterkunft an, aber Lucy nahm nicht ab, und so gab ich einen Code ein, um den Anrufbeantworter abzuhören. Es waren zwei Nachrichten darauf, beide von Freunden Dr. Mants, die ihr Beileid bekundeten. Mittlerweile fiel Schnee vom bleiernen Himmel, auf der vollen Interstate fuhren die Leute schneller, als gut für sie war. Ich fragte mich, ob meine Nichte aufgehalten worden war und warum sie nicht angerufen hatte. Lucy war dreiundzwanzig und hatte gerade ihren Abschluss an der FBI Academy hinter sich. Ich machte mir immer noch Sorgen um sie, so als ob sie meinen Schutz bräuchte.
Das Bezirksbüro Tidewater befand sich in einem kleinen, überfüllten Anbau auf dem Gelände des Sentara Norfolk General Hospital. Wir mussten uns das Gebäude mit der Gesundheitsbehörde teilen, wozu unglücklicherweise das Büro zur Untersuchung der Fischqualität gehörte. Bei dem Gestank verwesender Leichen und verrottender Fische war der Parkplatz zu jeder Tages- und Jahreszeit kein besonders angenehmer Aufenthaltsort. Dannys uralter Toyota stand schon da, und als ich den Lagerraum aufschloss, war zu meiner Freude auch der Kahn bereits eingetroffen.
Ich zog das Tor hinter mir wieder zu und schaute mich um. Der lange Niederdruckschlauch lag sauber zusammengerollt da, und wie ich es gewünscht hatte, war das eine abgeschnittene Ende mit dem Lungenautomaten daran in Plastik gehüllt. Das andere Ende war noch mit dem kleinen Kompressor verbunden, an den der Ansaugschlauch anschloss. Daneben befanden sich noch eine Gallone Benzin und das zu erwartende Sortiment an Tauch- und Bootsausrüstung, darunter zusätzliche Gewichte, ein Tank mit Pressluft, ein Paddel, ein Rettungsring, eine Taschenlampe, eine Decke und eine Leuchtpistole.
Eddings hatte auch einen zusätzlichen Fünf-PS-Schleppmotor angebracht, den er eindeutig dazu benutzt hatte, in den Sicherheitsbereich einzudringen, wo er gestorben war. Der Fünfunddreißig-PS-Hauptmotor war hochgeklappt und abgeschlossen, sodass der Propeller nicht im Wasser war, und ich erinnerte mich, dass er in dieser Stellung war, als ich den Kahn am Tatort gesehen hatte. Mehr als alles andere interessierte mich aber ein Behälter aus Hartplastik, der offen auf dem Boden stand. In der Schaumstoffauskleidung lagen Kamerazubehör und Schachteln mit Hundert-ASA-Kodakfilmen. Aber ich sah keine Kamera und kein Blitzgerät, und so dachte ich mir, dass sie für immer auf dem Grund des Elizabeth River verloren waren.
Ich ging eine Rampe hoch und schloss eine weitere Tür auf. In dem weiß gekachelten Gang lag Ted Eddings in seinem Sack auf einer Bahre neben dem Röntgenraum. Seine steifen Arme drückten gegen das schwarze Vinyl, als wollte er sich gewaltsam daraus befreien, und Wasser tropfte langsam auf den Boden. Ich wollte gerade nach Danny schauen, als er mit einem Stapel Lappen um die Ecke humpelte. Um sein rechtes Knie trug er eine knallrote Manschette, nach einer Verletzung beim Football hatte sein vorderes Kreuzband geflickt werden müssen.
»Wir sollten ihn schleunigst in den Autopsieraum bringen«, sagte ich. »Sie wissen, wie mir zumute ist, wenn Leichen unbeaufsichtigt im Vorraum bleiben.«
»Ich hatte Angst, jemand könne ausrutschen«, sagte er, während er mit den Lappen das Wasser aufwischte.
»Nun, die Einzigen hier sind heute Sie und ich.« Ich lächelte ihm zu. »Aber danke für die Aufmerksamkeit, und ich will natürlich keinesfalls, dass Sie ausrutschen. Wie geht’s dem Knie?«
»Ich glaube, es wird nie wieder gut. Es sind jetzt schon drei Monate, und ich kann immer noch kaum eine Treppe hinuntergehen.«
»Nur Geduld, machen Sie mit Ihrer Physiotherapie weiter, und dann wird’s schon besser werden«, wiederholte ich das schon oft Gesagte. »Haben Sie ihn schon geröntgt?«
Danny hatte bereits mit Tauchopfern zu tun gehabt. Er wusste, es war höchst unwahrscheinlich, dass wir nach Projektilen oder gebrochenen Knochen suchen würden, aber beim Röntgen könnten ein Pneumothorax oder eine Mittelfellverlagerung sichtbar werden, verursacht durch aus der Lunge ausgetretene Luft infolge eines Barotraumas.
»Ja, Ma’am. Der Film ist im Entwickler.« Er hielt inne, seine Miene verfinsterte sich. »Und Detective Roche von der Polizei Chesapeake ist auf dem Weg hierher. Er will bei der Autopsie dabei sein.«
Auch wenn ich Detectives ansonsten dazu ermunterte, bei Autopsien zuzusehen, wollte ich gerade Roche nicht unbedingt dabeihaben.
»Kennen Sie ihn?«, fragte ich.
»Er war schon mal hier. Machen Sie sich selbst ein Urteil von ihm.«
Er richtete sich auf und bündelte sein Haar wieder zu einem Pferdeschwanz, weil einzelne Strähnen ihm in die Augen hingen. Schlank und grazil sah er wie ein junger Cherokee aus, mit einem strahlenden Grinsen. Ich fragte mich oft, warum er hier arbeiten wollte. Ich half ihm, die Leiche in den Autopsieraum zu rollen. Während er sie wog und vermaß, verschwand ich im Umkleideraum und duschte. Als ich gerade meine Arbeitskleidung anzog, meldete sich Marino über meinen Pager.
»Was gibt’s?«, fragte ich, als ich ihn am Telefon hatte.
»Er ist’s, wie wir geglaubt haben, stimmt’s?«, fragte er.
»Ein vorsichtiges Ja.«
»Obduzierst du ihn jetzt?«
»Ich wollte gerade anfangen«, sagte ich.
»Gib mir fünfzehn Minuten. Ich bin schon fast da.«
»Du kommst her?«, fragte ich erstaunt.
»Ich spreche über Autotelefon. Wir reden später. Ich bin gleich da.«
Ich fragte mich zwar, was das alles sollte, aber