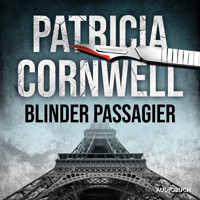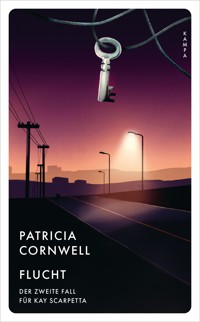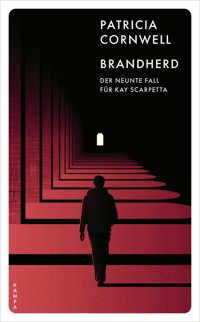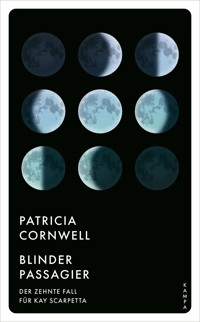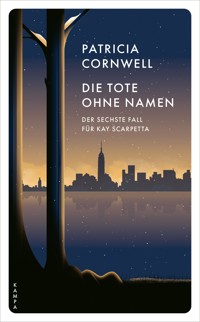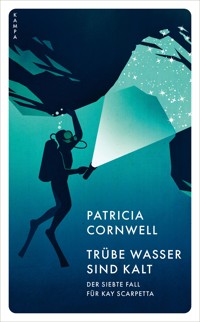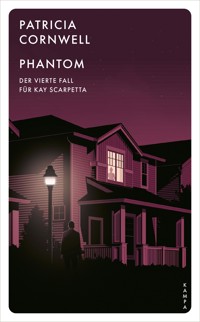
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kay Scarpetta
- Sprache: Deutsch
Seit neun Jahren wartet Ronnie Joe Waddel im Todestrakt auf seine Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl. Während vor dem Staatsgefängnis von Virginia noch die Gegner der Todesstrafe protestieren, obduziert Chief Medical Examiner Dr. Kay Scarpetta zweiundzwanzig Minuten nach seinem Tod Waddels Leiche. Kurz darauf bekommt sie es mit dem grausamen Mord an einem Dreizehnjährigen zu tun - und das Verbrechen trägt Waddels Handschrift. Ist der Mörder von den Toten auferstanden? Oder war seine Hinrichtung womöglich ein Irrtum? Ein auf die Verteidigung von Todeskandidaten spezialisierter Anwalt sitzt Scarpetta bei ihrer Arbeit im Nacken, besonders aber die Angst vor einer weiteren Leiche ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Patricia Cornwell
Phantom
Der vierte Fall für Kay Scarpetta
Aus dem amerikanischen Englisch von Georgia Sommerfeld
Kampa
Der einzigartigen Dr. Marcella Fierro, die Scarpetta so viel gelehrt hat.
Prolog
Noch zwei Wochen bis Weihnachten. Noch vier Tage bis zum Nichts. Ich liege auf meinem Eisenbett, schaue meine nackten, schmutzigen Füße an und die weiße Toilette, deren Sitz fehlt, und es macht mir nichts mehr aus, wenn Kakerlaken durch meine Zelle krabbeln. Ich beobachte sie, so wie sie mich beobachten.
Ich schließe die Augen und atme langsam ein und aus.
Ich erinnere mich, wie ich an heißen Tagen Heu zusammenrechte – für einen Lohn, der nicht mit dem der Weißen zu vergleichen war. Ich träume davon, in einer Pfanne Erdnüsse zu rösten, und von reifen Tomaten, in die ich wie in Äpfel beiße. Ich sehe mich, wie ich am Steuer des Pick-ups sitze und mir der Schweiß über das Gesicht läuft – an einem Ort, der mir keine Zukunft bietet und den ich zu verlassen geschworen habe.
Ich kann nicht aufs Klo gehen, mir die Nase putzen oder rauchen, ohne dass die Wachen es aufzeichnen. Es gibt keine Uhr hier. Ich weiß nie, wie das Wetter ist. Ich öffne die Augen und sehe die kahlen Wände, die jetzt meine Welt sind. Was für Gedanken soll ein Mann kurz vor seinem Tod haben?
In mir ist ein trauriges, trauriges Lied. Ich kenne den Text nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Sie sagen, es passierte im September, als der Himmel aussah wie das Ei einer Wanderdrossel und die Blätter in Flammen standen und zu Boden fielen. Sie sagen, ein wildes Tier geht in der Stadt um. Jetzt gibt es ein schlagendes Herz weniger.
Mich zu töten bedeutet nicht, das Tier zu töten. Die Dunkelheit ist sein Freund, Fleisch und Blut sind sein Festmahl. Wenn du glaubst, die Gefahr ist vorüber, dann irrst du dich. Sei auf der Hut, Bruder!
Eine Sünde führt zur anderen.
Ronnie Joe Waddell
1
An jenem Montag, an dem Ronnie Joe Waddells »Gedanken« in meiner Handtasche steckten, sah ich kein Tageslicht. Es war noch dunkel gewesen, als ich morgens zur Arbeit fuhr, und es war schon wieder dunkel, als ich mich abends auf den Heimweg machte. Regentropfen blitzten im Scheinwerferlicht, und die Nacht war neblig und bitterkalt.
Während ich in meinem Wohnzimmerkamin Feuer machte, stellte ich mir Felder vor, auf denen Tomaten reiften, und einen jungen Schwarzen in der stickigen Fahrerkabine eines Pick-up. Ob er schon damals Mordgedanken hatte? Waddells »Gedanken« waren im Richmond Times-Dispatch abgedruckt worden, und ich hatte den Zeitungsausschnitt ins Büro mitgenommen, um ihn seiner ständig wachsenden Akte beizufügen, doch vor lauter Arbeit vergaß ich es, und so blieb der Ausschnitt in meiner Handtasche. Ich hatte ihn beim Frühstück gelesen und wieder einmal verblüfft vor dem Phänomen gestanden, dass in einem Menschen gleichzeitig Poesie und Grausamkeit wohnen können. Zudem war die Ausdrucksweise für einen so einfachen Mann höchst ungewöhnlich.
In den nächsten Stunden füllte ich Überweisungsformulare aus und schrieb Weihnachtskarten, während leise der Fernseher lief. Wie alle anderen Bürger Virginias konnte auch ich nur aus den Medien erfahren, ob im Zusammenhang mit einer Hinrichtung alle Appelle fehlgeschlagen waren oder der Gouverneur eine Begnadigung aussprach. Die Nachrichten würden darüber entscheiden, ob ich zu Bett gehen durfte oder zum Leichenschauhaus fahren musste.
Es war kurz vor zehn, als das Telefon klingelte. Ich erwartete meinen Stellvertreter oder einen anderen Angehörigen meines Stabes am anderen Ende der Leitung, der wie ich abrufbereit dasaß.
»Hallo«, sagte eine mir unbekannte männliche Stimme. »Ich möchte Kay Scarpetta sprechen, Chief Medical Examiner Dr. Scarpetta.«
»Am Apparat«, sagte ich.
»Oh, sehr gut. Hier spricht Detective Joe Trent vom Henrico County. Ich habe Ihre Nummer aus dem Telefonbuch. Tut mir leid, Sie zu Hause zu stören.« Er klang angespannt. »Wir haben hier einen Fall, bei dem wir Ihre Hilfe brauchen.«
»Worum geht’s denn?« Hoffentlich muss ich nicht aus dem Haus, dachte ich und schaute auf den Bildschirm.
»Heute Abend wurde ein Dreizehnjähriger nach dem Verlassen eines Supermarkts auf der Northside entführt. Ihm wurde in den Kopf geschossen, vielleicht wurde er auch missbraucht.«
»Wo ist die Leiche?«
»Der Junge wurde hinter einem leer stehenden Lebensmittelgeschäft an der Patterson Avenue gefunden. Er ist nicht tot, aber bewusstlos. Die Ärzte wissen nicht, ob er durchkommen wird. Es ist mir klar, dass Sie nicht zuständig sind, er lebt ja noch, aber er hat ein paar wirklich merkwürdige Verletzungen. Sie sehen doch tagein, tagaus alles Mögliche, und da dachte ich, dass Sie vielleicht eine Idee hätten, wo diese Wunden herrühren könnten. Mir ist so was noch nie untergekommen.«
»Beschreiben Sie sie mir!«, bat ich.
»Es geht um zwei Stellen: eine an der Innenseite des rechten Oberschenkels, fast am Ansatz, und die andere an der rechten Schulter. Es fehlen ganze Fleischstücke – rausgeschnitten. Und an den Wundrändern sind Kratzer und Schnitte. Das Opfer liegt hier im Krankenhaus.«
»Haben Sie das entfernte Gewebe gefunden?« Mein Gedächtnis raste auf der Suche nach ähnlichen Fällen.
»Bisher nicht. Aber es sind noch Kollegen dort, die das Gelände absuchen. Allerdings ist es auch möglich, dass die Tat in einem Wagen verübt wurde.«
»In wessen Wagen?«
»In dem des Täters. Der Fundort liegt gut vier Meilen von dem Supermarkt entfernt, in dem der Junge zuletzt gesehen wurde. Ich denke, er stieg zu jemandem ins Auto, wurde vielleicht dazu gezwungen.«
»Haben Sie die Verletzungen fotografiert, bevor die Ärzte mit der Behandlung begannen?«
»Ja. Aber die Ärzte konnten nicht viel machen. Weil so viel Haut fehlt, werden sie welche transplantieren müssen.«
Demnach waren die Wunden nur gereinigt und eine Antibiotikainfusion gelegt worden. Hätten sie sie genäht, wäre eine Begutachtung meinerseits nicht sehr ergiebig gewesen. »Gut, ich werde mir den Jungen ansehen.«
»Großartig! Und wann?«
»Morgen. Je eher, desto besser.«
»Um acht? Ich warte vor der Klinik auf Sie.«
»Okay.«
Als der Nachrichtensprecher auf dem Bildschirm erschien, griff ich zur Fernbedienung und machte den Ton lauter: »… Eugenia? Können Sie uns sagen, ob der Gouverneur sich schon geäußert hat?«
Das Staatsgefängnis von Virginia, an einem felsigen Uferstück des James River am Rande der Innenstadt gelegen, kam ins Bild. Zweihundert Jahre lang hatten dort die Schwerverbrecher gesessen. Jetzt stand seine Schließung bevor. Gegner und Befürworter der Todesstrafe hatten sich mit entsprechend beschrifteten Plakaten vor dem Eingang versammelt. Ihre Gesichter leuchteten im Scheinwerferlicht kalkweiß. Ein Schauder überlief mich, als ich sah, dass einige Leute lachten.
Die Kamera schwenkte auf eine hübsche junge Reporterin in einem roten Mantel. »Wie Sie wissen, Bill«, sagte sie, »wurde gestern eine Direktleitung zwischen dem Büro von Gouverneur Norring und dem Staatsgefängnis eingerichtet. Bislang ist sie ungenutzt geblieben, und das spricht Bände. Würde er eine Begnadigung aussprechen wollen, hätte er es bereits getan.«
»Und wie ist die Stimmung bei Ihnen?«
»Bis jetzt ist alles ruhig. Ich schätze, dass mehrere hundert Menschen hier sind, aber es sieht nicht so aus, als wollten sie Ärger machen. Und auch im Gefängnis ist kein Aufruhr zu erwarten, bis auf ein paar Dutzend Insassen sind ja schon alle in die neue Vollzugsanstalt in Greensville verlegt worden.«
Ich schaltete den Fernseher ab und fuhr kurz danach los. Müdigkeit durchströmte mich wie ein Betäubungsmittel. Ich fühlte mich niedergeschlagen und benommen. Ich hasse Hinrichtungen. Ich hasse es, darauf zu warten, dass jemand stirbt, und ich mein Skalpell in Fleisch senken muss, das noch so warm ist wie meines. Bei einem Chief Medical Examiner könnte man meinen, dass all das Schreckliche, das er im Lauf der Jahre gesehen hat, zu einer Abstumpfung führt, und doch erfüllt es mich immer wieder mit Entsetzen, wozu Menschen fähig sind. Ich verabscheue Klischees, aber ich muss zugeben, dass einige durchaus zutreffen. Eines lautet: Es gibt keine Gerechtigkeit auf der Welt. Nichts wird jemals wiedergutmachen, was Ronnie Joe Waddell getan hat. Er wartete bereits seit neun Jahren auf seine Hinrichtung. Ich hatte sein Opfer nicht auf den Tisch bekommen, denn die Frau war ermordet worden, bevor ich zum Chief Medical Examiner des Staates Virginia berufen wurde und nach Richmond zog. Doch hatte ich mich eingehend mit dem Fall befasst, kannte jedes grauenhafte Detail.
Am Morgen des 4. September vor zehn Jahren meldete Robyn Naismith sich bei Channel 8, wo sie als Moderatorin arbeitete, krank. Sie verließ ihr Haus nur kurz, um sich Grippemedikamente zu besorgen. Am nächsten Tag wurde ihre Leiche nackt und misshandelt im Wohnzimmer gefunden, in sitzender Stellung an den Fernseher gelehnt. Ein blutiger Daumenabdruck, am Medizinschränkchen im Bad hinterlassen, wurde später als der Ronnie Joe Waddells identifiziert.
Als ich auf den Parkplatz einbog, standen bereits mehrere Wagen dort: Fielding, mein Stellvertreter, war da, mein Verwaltungsmann Ben Stevens und meine Assistentin Susan Story. Die Hoftür stand offen, bleiches Licht fiel auf den Asphalt nach draußen. Ein Polizist saß rauchend in seinem Dienstwagen. Als er mich einparken sah, stieg er aus und kam zu mir. Er war ein hochgewachsener, hagerer Mann mit einer weißen Haarmähne. Obwohl ich schon oft mit ihm gesprochen hatte, fiel mir im Moment sein Name nicht ein.
»Können wir die Tür zum Hof offen lassen?«, fragte ich ihn.
»Vorerst bestimmt, Dr. Scarpetta«, sagte er und zog den Reißverschluss seines Nylonanoraks bis zum Kinn hoch.
»Meinen Sie, dass es Randale geben wird?«
»Wir sind für alles gerüstet, Ma’am. Sobald der Wagen sich vor dem Gefängnis in Bewegung setzt, werden wir hier Aufstellung nehmen. Offenbar sind viele mit der Hinrichtung nicht einverstanden. Sie haben sicher von der Petition gelesen, die dem Gouverneur übergeben wurde, und heute habe ich gehört, dass sogar in Kalifornien einige Zartbesaitete in den Hungerstreik getreten sind.«
Ich schaute über den Parkplatz zur Main Street hinüber. Ein Wagen fuhr mit hoher Geschwindigkeit vorbei. Die Reifen zischten über den nassen Asphalt. Unter den Straßenlaternen trieben verschwommene Lichtinseln im Dunst.
»Wenn Sie mich fragen«, fuhr der Officer fort, »ich würde wegen Waddell nicht mal auf meine Kaffeepause verzichten.«
Er legte schützend die Hand um die Flamme seines Feuerzeugs und zündete sich eine Zigarette an. »Nicht nach dem, was er mit dieser Naismith angestellt hat. Ich habe sie oft im Fernsehen gesehen. Mir persönlich sind ja weiße Frauen lieber, aber sie war eine echte Augenweide.«
Ich hatte vor zwei Monaten das Rauchen aufgegeben, und es machte mich immer noch kribbelig, wenn jemand in meiner Gegenwart rauchte.
»Mann, das muss jetzt fast zehn Jahre her sein«, redete er weiter. »War das ein Wirbel damals! Es war einer der schlimmsten Fälle, die wir hier je hatten. Sie sah aus, als hätte ein Grizzly sie in die Mangel genommen …«
»Ich geh rein«, unterbrach ich seinen Redefluss. »Lassen Sie es mich wissen, wenn sie kommen!«
»Klar, Ma’am. Ich werde über Funk benachrichtigt, wenn sie losfahren, und dann sage ich Ihnen gleich Bescheid.« Er verzog sich wieder in seinen Wagen.
Neonröhren beleuchteten die kahlen, weißen Wände des Leichenschauhauses. Der Geruch von Raumspray hing in der Luft. Ich ging an dem kleinen Büro vorbei, wo die Bestattungsinstitute die eingelieferten Leichen registrierten, passierte den Röntgenraum und die Stahltüren, hinter denen der große Kühlraum lag. Der Autopsieraum war hell erleuchtet, die Stahltische glänzten in dem harten Licht. Susan schärfte gerade ein langes Messer, und Fielding etikettierte Röhrchen für Blutproben. Beide sahen so müde und lustlos aus, wie ich mich fühlte.
»Ben sitzt oben in der Bibliothek vor dem Fernseher«, sagte Fielding zu mir. »Er gibt Laut, wenn sich was tut.«
»Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kerl Aids hatte?«, fragte Susan, als sei Waddell schon tot.
»Ich weiß es nicht. Wir werden zwei Paar Handschuhe übereinanderziehen und die übliche Vorsicht walten lassen.«
»Ich hoffe, sie sagen es uns, wenn er infiziert war«, insistierte Susan. »Man kann sich nie darauf verlassen, dass sie es tun – denen ist das egal, schließlich müssen sie ihn nicht obduzieren.«
Susan war in letzter Zeit überängstlich. Sie fürchtete die Röntgenstrahlen und Chemikalien, die zu unserer täglichen Arbeit gehören, und alle möglichen Krankheiten. Ich hatte Verständnis dafür, denn sie war seit Kurzem schwanger.
Ich ging in den Umkleideraum und schlüpfte in einen grünen Chirurgenkittel, zog eine Plastikschürze an, stülpte Booties über meine Schuhe und nahm zwei Pakete Handschuhe aus dem Schrank. Dann inspizierte ich den Instrumentenwagen neben Tisch drei. Alles war mit Waddells Namen, dem heutigen Datum und der Autopsienummer versehen. Die gekennzeichneten Behältnisse würden in den Müll wandern, falls Gouverneur Norring das Todesurteil in letzter Minute noch aufheben sollte. Ronnie Waddell würde aus der Kartei des Leichenschauhauses gelöscht und seine Autopsienummer auf den Nächstkommenden übertragen werden.
Um elf kam Ben Stevens herunter und schüttelte den Kopf. Gemeinsam fixierten wir die Uhr an der Wand. Niemand sprach. Die Minuten tickten dahin.
Und dann ging plötzlich die Tür auf, und der Polizist, der mich auf dem Parkplatz begrüßt hatte, erschien mit einem Funkgerät in der Hand. »Um fünf nach elf wurde er für tot erklärt«, berichtete er. »Sie werden in einer Viertelstunde mit ihm hier sein.«
Der Krankenwagen gab Warnsignale, als er rückwärts in den Hof fuhr. Die Hecktüren öffneten sich, und heraus sprangen so viele Gefängnisbeamte, dass man glauben konnte, sie hätten einen Tobsüchtigen in Schach halten müssen. Vier von ihnen zogen die Bahre heraus, auf der Ronnie Joe Waddells Leiche lag. Wir traten zur Seite. Im Flur setzten sie die Bahre zu Boden, ohne sich die Mühe zu machen, die Beine auszuklappen. Sie schoben sie wie einen Räderschlitten vor sich her. Das Tuch, in das der festgeschnallte Tote gewickelt war, hatte Blutflecken.
»Nasenbluten«, sagte einer der Männer, noch ehe ich fragen konnte.
Ich sah, dass seine Handschuhe blutig waren. »Sie hatten Nasenbluten?«
»Nein. Waddell.«
Ich war verblüfft. »Im Krankenwagen?« Als er in die Ambulanz geschoben wurde, hätte Waddell keinen Blutdruck mehr haben dürfen.
Der Beamte hatte mir seine Aufmerksamkeit bereits entzogen und antwortete nicht. Ich würde warten müssen. Ich ließ die Leiche auf die Rollbahre heben, die auf der Waage bereitstand. Geschäftige Hände lösten die Haltegurte und öffneten das Laken. Die Türen des Autopsieraumes schlossen sich leise, als die Gefängnisbeamten ebenso grußlos verschwanden, wie sie gekommen waren.
Waddell war seit genau zweiundzwanzig Minuten tot. Ich roch seinen Schweiß und das versengte Fleisch. Das rechte Hosenbein war bis über das Knie hochgeschoben, die Brandstellen an der Wade hatte man mit Mullkompressen bedeckt. Er war ein großer, kräftiger Mann. Die Zeitungen hatten ihn als »sanften Riesen« bezeichnet, als den »romantischen Ronnie mit dem seelenvollen Blick«, doch hatten ihm diese großen Hände, die starken Schultern und muskulösen Arme dazu gedient, einem Menschen den Garaus zu machen.
Ich öffnete die Klettverschlüsse seines hellblauen Jeanshemdes und durchforstete, als ich ihn auszog, seine Taschen – eine für gewöhnlich fruchtlose Prozedur, da Todeskandidaten nichts auf den elektrischen Stuhl mitnehmen dürfen. Entsprechend überrascht war ich, als ich ein Kuvert in der Gesäßtasche der Hose fand. Es war zugeklebt, und in großen Druckbuchstaben stand darauf:
STRENGVERTRAULICH: BITTEMITMIRBEGRABEN!
»Machen Sie eine Kopie von dem Umschlag und dem, was immer er enthält, und legen Sie die Originale zu seinen persönlichen Dingen!« Ich gab Fielding den Fund. Er klemmte das Kuvert unter das Autopsieprotokollformular in sein Clipboard und murmelte: »Mein Gott, der hat ja mehr Muskeln als ich!«
»Kaum zu glauben, was?«, verspottete Susan meinen bodybuildenden Stellvertreter.
Wir schafften es zu dritt nur mit Mühe, den Toten mit dem Gesicht nach unten auf den Autopsietisch umzubetten. Er wog einhundertsechzehn Kilo. Seine Füße ragten über den Tisch hinaus. Ich vermaß gerade die Brandstellen an seinem Bein, als der Summer der Tür zum Hof ertönte. Susan ging nachsehen und kam gleich darauf mit Lieutenant Pete Marino zurück. Sein Trenchcoat stand offen, und das Gürtelende schleifte über den Fliesenboden.
Ich diktierte Fielding die Maße der Verbrennung auf der Rückseite der Wade und setzte hinzu: »Die Haut ist trocken, zusammengezogen und blasig.«
Marino zündete sich eine Zigarette an. »Es gibt Theater wegen der Blutung«, sagte er.
»Seine Rektaltemperatur beträgt vierzig Grad«, las Susan vom Thermometer ab. »Um dreiundzwanzig Uhr neunundvierzig.«
»Wissen Sie, warum er blutete?«, fragte Marino mich.
»Einer der Gefängnisbeamten sagte, Waddell habe Nasenbluten gehabt. Los, alle mit anfassen, wir müssen ihn umdrehen!«
»Haben Sie die Stelle an der Innenseite des linken Arms gesehen?« Susan zeigte mir eine Abschürfung.
Ich untersuchte sie unter Zuhilfenahme einer starken Lampe und einer Lupe. »Stammt vielleicht von einem der Gurte.«
»Am rechten Arm ist noch eine.«
Ich sah mir auch diese Stelle an. Dann drehten wir den Leichnam um, und als das geschafft war, schoben wir einen Holzklotz unter seine Schultern. Kopf und Gesicht waren nachlässig rasiert worden. Ich nahm den Y-Einschnitt vor.
Susan sah sich die Zunge an. »Da könnten ein paar Verletzungen sein«, meinte sie.
»Schneiden Sie sie raus«, sagte ich und steckte das Thermometer in die Leber.
»Grundgütiger!«, murmelte Marino und schüttelte sich.
»Jetzt gleich?« Susan hielt das Skalpell schnittbereit.
»Nein. Fotografieren Sie zuerst die Brandstellen am Kopf. Wir müssen sie vermessen. Dann können Sie die Zunge entfernen.«
»Mist!«, schimpfte Susan. »Es ist kein Film da!«
»Tut mir leid«, sagte Fielding, »ich habe vergessen, Bescheid zu sagen, dass keiner mehr da ist. Aber abgesehen davon ist es Ihre Aufgabe, sich regelmäßig zu vergewissern, ob noch Filme in der Schublade sind.«
Susan würdigte ihn keiner Antwort, machte sich ans Vermessen, diktierte ihm die Ergebnisse und widmete sich dann der Zunge. Marino wandte sich schaudernd ab.
»Die Lebertemperatur beträgt vierzig Komma fünf Grad«, gab ich Fielding zu Protokoll und warf einen Blick auf die Uhr an der Wand. Waddell war inzwischen seit einer Stunde tot, aber kaum abgekühlt. Die Hinrichtung durch den elektrischen Stuhl heizt den Körper stark auf. Die Gehirntemperatur von schmächtigeren Männern, die ich auf dem Tisch gehabt hatte, betrug bis zu dreiundvierzig Komma drei Grad. Waddells rechte Wade war heiß unter meiner Hand, der Muskel total verkrampft.
»Eine Verletzung am Zungenrand«, meldete sich Susan.
»Hat er sich vielleicht auf die Zunge gebissen und deshalb geblutet?«, fragte Marino.
Nach einem prüfenden Blick verneinte ich das.
»Wie gesagt, sie machen Theater wegen des Bluts.«
Ich unterbrach meine Arbeit, als mir etwas einfiel: »Sie waren als Zeuge dabei, nicht wahr?«
»Ja, ich hatte Ihnen doch gesagt, dass ich mich gemeldet habe.«
Alle Augen richteten sich auf ihn.
»Da draußen braut sich was zusammen«, sagte er. »Es ist wohl besser, wenn niemand den Laden hier allein verlässt.«
»Was braut sich zusammen?«, fragte Susan ängstlich.
»Schon heute früh versammelten sich religiöse Spinner vor dem Spring-Street-Gefängnis. Irgendwie erfuhren sie dann von der Bluterei, und als der Krankenwagen losfuhr, setzten sie sich in geschlossener Formation hierher in Bewegung.«
»Haben Sie gesehen, wie die Blutung anfing?«, wandte Fielding sich an ihn.
»Das habe ich. Er kriegte zweimal Saft. Beim ersten Mal gab er ein lautes Zischen von sich – wie ein Heizkörper, aus dem Dampf entweicht –, und dann lief Blut unter seiner Maske raus. Ich habe gehört, dass der Stuhl nicht richtig funktioniert haben soll.«
Susan schaltete die Strykersäge an, und niemand wollte es mit dem Lärm der Maschine aufnehmen, deren Zähne sich durch die Schädeldecke fraßen. Ich setzte die Untersuchung der inneren Organe fort. Das Herz einschließlich der Koronargefäße war in hervorragendem Zustand. Erst als die Säge verstummte, konnte ich wieder diktieren.
»Haben Sie das Gewicht?«, fragte Fielding.
»Das Herz wiegt vierhundertsechsundachtzig Gramm, und der linke obere Lappen ist an einer Stelle mit dem Aortenbogen verwachsen.« Nun legte ich den Magen auf das Schneidbrett. »Er ist fast röhrenförmig.«
»Was?« Fielding trat näher heran. »Das ist ja eigenartig. Ein Riese wie der braucht doch mindestens viertausend Kalorien am Tag.«
»Die hat er aber nicht bekommen«, sagte ich. »Zumindest nicht kurz vor der Hinrichtung. Der Magen ist vollkommen leer und sauber.«
»Sie meinen, er hat seine Henkersmahlzeit nicht gegessen?«, fragte Marino.
»Offenbar nicht.«
»Ist Ihnen das schon öfter untergekommen?«
»Nein, höchst selten.«
Um ein Uhr waren wir fertig und folgten den Leuten vom Bestattungsinstitut in den Hof, wo der Leichenwagen wartete. Rote und blaue Lichter blitzten in der Dunkelheit, Funksprüche schwirrten blechern durch die feuchtkalte Luft, Motoren brummten, und hinter dem Maschendrahtzaun, der den Parkplatz umgab, leuchtete ein Flammenring: Eine Mauer aus Männern, Frauen und Kindern stand dort, und der flackernde Schein ihrer Kerzen malte verzerrte Schatten auf ihre Gesichter. Die Angestellten des Bestattungsinstituts schoben Waddell eiligst in den Leichenwagen und knallten die Hecktüren zu. Jemand gab ein Kommando, und dann hagelte es Kerzen. Sie verloschen im Flug und landeten mit einem hölzernen Geräusch auf dem Asphalt.
»Verdammte Idioten!«, rief Marino.
Begleitet vom Aufflackern der Blitzlichter verließ der Leichenwagen den Hof. Ich sah einen Aufnahmewagen von Channel 8 am Straßenrand stehen. Uniformierte Beamte traten an den Zaun und forderten die Demonstranten auf, sich zu entfernen.
»Wir wollen keinen Ärger hier«, sagte ein Officer. »Falls ihr also die Nacht nicht hinter Gittern verbringen wollt …«
»Metzger!«, kreischte eine Frau. Andere nahmen den Schlachtruf auf, Hände griffen in den Zaun und rüttelten an ihm. Marino begleitete mich zu meinem Wagen. Die einzelnen Schreie ordneten sich zu einem rhythmischen Sprechgesang: »Metzger! Metzger! Metzger!«
Ich zog den Autoschlüssel aus der Tasche, der zweimal herunterfiel, bevor ich endlich ins Schloss traf.
»Ich fahre hinter Ihnen her«, sagte Marino.
Obwohl ich die Heizung im Wagen voll aufgedreht hatte, wurde mir nicht warm. Zweimal vergewisserte ich mich, dass Türen und Fenster geschlossen waren. Die Kälte, die ich spürte, hatte jedoch nichts mit der Temperatur zu tun.
Wir tranken Scotch, weil ich keinen Bourbon mehr hatte.
»Ich verstehe nicht, wie man dieses Zeug freiwillig trinken kann«, sagte Marino taktlos.
»Schauen Sie doch nach, vielleicht finden Sie was anderes.«
»Nein, ich steh das jetzt durch.«
Ich wusste nicht recht, wie ich das Thema anschneiden sollte, und Marino war offensichtlich nicht gewillt, es mir leichtzumachen. Sein Gesicht war gerötet, an seiner kahl werdenden Stirn klebten graue Strähnen, und er rauchte eine Zigarette nach der anderen.
»Haben Sie schon mal eine Hinrichtung miterlebt?«, wagte ich einen Vorstoß.
»Bin nie scharf drauf gewesen.«
»Aber diesmal haben Sie sich freiwillig gemeldet.«
»Wenn ich ein bisschen Zitrone und Soda zu diesem Gesöff haben könnte, wäre es nicht mehr ganz so übel.«
»Wenn Sie darauf bestehen, einen guten Scotch zu ruinieren …« Ich stand auf.
Er ließ das Glas über den Küchentisch in meine Richtung schlittern, und ich nahm es mit zum Kühlschrank. »Ich habe Limonensaft, aber keine Zitronen«, teilte ich ihm nach einer Inspektion der Vorräte mit.
»Der tut’s auch.«
Ich ließ Limonensaft in sein Glas tröpfeln und füllte es mit Schweppes auf.
Er nippte an der merkwürdigen Mischung und sagte: »Vielleicht haben Sie es vergessen, aber der Naismith-Fall unterstand damals mir. Mir und Sonny Jones.«
»Da war ich noch nicht hier.«
»Stimmt. Komisch, es kommt mir vor, als wären Sie schon immer hier gewesen. Aber Sie wissen, was passiert ist, oder?«
Als Robyn Naismith umgebracht wurde, war ich stellvertretender Chief Medical Examiner in Dade County, Florida, aber ich hatte den Fall in den Medien verfolgt und später auf einer Tagung Dias von der Leiche gesehen. Die ehemalige Miss Virginia war eine aufsehenerregende Schönheit mit einer herrlichen Altstimme gewesen, redegewandt und charismatisch. Sie wurde nur siebenundzwanzig Jahre alt. Die Verteidigung behauptete, Waddell habe nur etwas stehlen wollen. Es sei Miss Naismiths Pech gewesen, dass sie ihn bei ihrer Rückkehr aus dem Drugstore überraschte. Waddell habe niemals ferngesehen und nicht einmal ihren Namen gekannt. Er sei so high gewesen, dass er nicht wusste, was er tat. Die Geschworenen lehnten den Unzurechnungsfähigkeitsantrag jedoch ab und forderten die Todesstrafe.
»Bis Waddell gefasst wurde, hatte die Öffentlichkeit die Polizei ganz schön unter Druck gesetzt«, erinnerte ich mich.
»Das kann man wohl sagen.« Marino nickte. »Wir hatten diesen fabelhaften Daumenabdruck und Zahnspuren. Drei von unseren Jungs wälzten von morgens bis nachts einschlägiges Material, und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in die verdammte Geschichte steckte. Und dann schnappen wir den Kerl, weil er mit einer abgelaufenen Zulassungsplakette in North Carolina rumfährt!« Seine Miene verfinsterte sich. »Natürlich war Jones nicht dabei. Ein Jammer, dass er nicht mehr erleben konnte, wie Waddell seine Belohnung bekam.«
»Sie geben Waddell die Schuld an Sonnys Tod?«
»Allerdings.«
»Sie beide waren eng befreundet, nicht wahr?«
»Wir waren Kollegen beim Morddezernat, wir gingen zusammen fischen, und wir waren in derselben Bowlingmannschaft.«
»Ich kann mir vorstellen, dass sein Tod Sie hart getroffen hat.«
»Dieser Fall schaffte ihn: immer nur arbeiten, kein Schlaf, nie zu Hause, die Sache mit seiner Frau … Er sagte immer wieder, er könne nicht mehr – und dann steckte er sich eines Tages den Pistolenlauf in den Mund.«
»Eine schlimme Geschichte«, sagte ich sanft, »aber ich bezweifle, dass Waddell dafür verantwortlich war.«
»Ich sehe es aber so, und deshalb hatte ich eine Rechnung mit ihm zu begleichen.«
»Und? Ist sie nun beglichen, nachdem Sie ihn sterben sahen?«
Marino starrte schweigend ins Leere. Seine Kiefermuskeln spielten. Schließlich trank er sein Glas aus und zog an seiner Zigarette.
»Darf ich Ihnen noch einen Drink machen?«, fragte ich.
»Ja, warum nicht?«
Ich fabrizierte wieder die spezielle Mischung und musste an die Ungerechtigkeiten und Verluste denken, die Marino erlitten hatte. Er war im falschen Teil von New Jersey als armer Leute Kind ungeliebt aufgewachsen und hegte ein tiefes Misstrauen gegen jeden Menschen, der es besser getroffen hatte als er. Vor Kurzem hatte ihn nach fünfundzwanzig Jahren Ehe seine Frau verlassen. Er hatte einen Sohn, über den er niemals sprach. Ungeachtet seiner nachweislich ausgezeichneten Arbeit stand er mit seinem Beruf ständig auf Kriegsfuß. Das Schicksal hatte einen mühsamen Weg für ihn vorgesehen, und ich fürchtete, dass er am Ende nicht Weisheit und Frieden zu finden hoffte, sondern Vergeltung und Wiedergutmachung. Marino war immer über irgendetwas wütend.
»Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen, Doc«, sagte er, als ich das Glas vor ihn hinstellte. »Was würden Sie empfinden, wenn man die Mistkerle fasste, die an Marks Tod schuld sind?« Er musste mir ansehen, dass ich darüber nicht nachdenken wollte, aber er ließ nicht locker. »Hätten Sie nicht den Wunsch, die Typen hängen zu sehen? Würden Sie sich nicht freiwillig zu dem Erschießungskommando melden, um selbst abzudrücken?«
Mark starb, als vor der Londoner Victoria Station in einem Papierkorb eine Bombe explodierte. Den Hass, der mit der Trauer einherging, hatte ich nur in den Griff bekommen können, indem ich mir klarmachte, dass ich keine Chance hatte, Rache zu üben.
»Eine Terroristengruppe bestrafen zu wollen ist ein unrealistischer Wunsch, und deshalb befasse ich mich nicht damit.«
Marino sah mich böse an. »Das ist mal wieder eine von Ihren berühmten beschissenen Antworten! Wenn Sie könnten, würden Sie die Kerle unentgeltlich obduzieren – bei lebendigem Leibe – und sich viel Zeit dabei lassen. Habe ich Ihnen je erzählt, was aus Robyn Naismiths Familie wurde?«
Ich schüttelte den Kopf und griff nach meinem Glas.
»Ihr Vater war Arzt im Norden von Virginia. Ein feiner Mensch. Etwa ein halbes Jahr nach dem Prozess stellte man Krebs bei ihm fest, und ein paar Monate später war er tot. Die Mutter zog nach Texas, hatte einen Autounfall und verbringt den Rest ihrer Tage im Rollstuhl. Waddell hat nicht nur Robyn umgebracht, er hat auch ihre Eltern auf dem Gewissen.«
Ich sah davon ab, ihn darauf hinzuweisen, dass er mit dieser Behauptung weit übers Ziel hinausschoss; er hätte es sicherlich als Verteidigung des Mörders aufgefasst. Ich dachte an Waddell, der auf einer Farm aufgewachsen war, und Bilder aus seinen abgedruckten »Gedanken« erschienen vor meinem geistigen Auge. Ich stellte ihn mir vor, wie er auf der Verandatreppe saß und in eine Tomate biss, die nach Sonne schmeckte. Was mochte ihm in den letzten Sekunden seines Lebens durch den Kopf gegangen sein? Ob er gebetet hatte?
Marino drückte mit unnötiger Heftigkeit seine Zigarette aus. »Ich mach mich auf den Weg.«
»Kennen Sie Detective Trent in Henrico County?«, fragte ich.
»Ja. War früher bei K9 und wurde nach seiner Beförderung zum Sergeant vor ein paar Monaten zur Detective Division versetzt. Ein nervöser Typ, aber okay.«
»Er rief an wegen eines Jungen …«
»Eddie Heath?«, unterbrach er mich.
»Ich kenne den Namen nicht.«
»Ein dreizehnjähriger Weißer. Wir arbeiten daran. Lucky’s liegt in meinem Zuständigkeitsbereich.«
»Lucky’s?«
»Der Supermarkt, wo er zuletzt lebend gesehen wurde, hinter der Chamberlayne Avenue, auf der Northside. Was wollte Trent?« Marino runzelte die Stirn. »Hat er erfahren, dass Eddie es nicht schaffen wird, und im Voraus eine Verabredung mit Ihnen getroffen?«
»Er sagte, der Junge habe ungewöhnliche Verletzungen, und bat mich, sie mir anzusehen.«
»Mann, ich hasse es, wenn Kinder dran glauben müssen.« Marino stieß seinen Stuhl zurück und rieb sich die Schläfen. »Was für ein Scheißjob! Jedes Mal, wenn man einen Killer aus dem Weg geräumt hat, kommt der nächste daher.«
Als Marino gegangen war, setzte ich mich im Wohnzimmer an den Kamin und sah dem Holz zu, wie es verbrannte. Eine dumpfe Traurigkeit legte sich auf mich wie ein schwarzes Tuch. Marks Tod hatte eine Narbe auf meiner Seele hinterlassen. Als er noch lebte, war mir gar nicht bewusst gewesen, was für einen großen Raum die Liebe zu ihm in meinem Denken und Fühlen einnahm.
Das letzte Mal trafen wir uns vor seinem Abflug nach London zu einem eiligen Mittagessen in der Innenstadt, bevor er zum Dulles Airport hinausfuhr. Immer wieder schauten wir in dieser halben Stunde auf die Uhr, denn wir hatten uns die Zeit mühsam abgezwackt und konnten sie deshalb überhaupt nicht genießen. Gewitterwolken ballten sich zusammen, und als wir auf die Straße traten, fielen die ersten dicken Regentropfen. Mark hatte sich beim Rasieren geschnitten, und wenn ich mir später sein Gesicht ins Gedächtnis rief, sah ich immer diese kleine Wunde an seinem Kinn – und brach jedes Mal in Tränen aus.
Er starb im Februar, als der Golfkrieg zu Ende ging. Um wenigstens einem Teil der Erinnerung zu entfliehen, verkaufte ich mein Haus und zog in ein anderes Viertel, doch ich erreichte mit diesem Gewaltakt lediglich, dass ich mich entwurzelt fühlte. Das neue Haus einzurichten und den Garten umzugestalten machte mir keine Freude, aber es lenkte mich wenigstens ab. Ich packte meine sehr begrenzte Freizeit randvoll mit Aktivitäten, und wenn ich nachts wieder einmal völlig überdreht wach lag, sah ich Mark lächelnd den Kopf schütteln.
»Was würdest du tun?«, fragte ich ihn dann aufgebracht. »Sag, was würdest du tun, an meiner Stelle, wenn du noch hier wärst?«
Ich stand auf, spülte in der Küche die Gläser aus und ging ins Arbeitszimmer, um den Anrufbeantworter abzuhören. Mehrere Reporter hatten angerufen, meine Mutter und meine Nichte Lucy. Drei weitere Anrufer hatten wortlos wieder aufgelegt. Ich hätte gern eine Geheimnummer gehabt, doch das ging nicht: Die Polizei, Staatsanwälte und die landesweit etwa vierhundert Leichenbeschauer mussten mich auch nach Dienstschluss erreichen können. Aber wenigstens besaß ich ein Gerät, das die Anrufer identifizierte, indem es die Telefonnummer eines jeden auf einem Display anzeigte. Somit konnten obszöne Anmachen oder Drohanrufe zurückverfolgt werden. Ich schaltete dieses Gerät ein und überflog die Nummern, die der Reihe nach auf dem Display erschienen. Dreimal dieselbe! Sie war mir bereits vertraut: Im Lauf der letzten Woche war sie mehrmals aufgetaucht, und nie hatte sich der Anrufer gemeldet. Als ich den Anschluss gewählt hatte, um festzustellen, wer abnahm, schrillte ein Ton an mein Ohr, der nach einem Faxgerät oder einem Computermodem klang. Aus irgendeinem Grund hatte der oder die Unbekannte heute Abend zwischen zwanzig nach zehn und elf dreimal bei mir angerufen, während ich im Leichenschauhaus auf Waddell wartete. Ich verstand es nicht und fand es beunruhigend. Wenn ein technischer Defekt vorlag und ein computergesteuertes Gespräch stets bei mir landete, hätte das doch inzwischen jemandem auffallen müssen. Während der wenigen Stunden, die von der Nacht noch verblieben, wachte ich immer wieder auf. Jedes Geräusch ließ meinen Puls hochschnellen, und die roten Lichter der Alarmanlage an der Wand gegenüber meinem Bett schienen mich drohend anzustarren. Sobald ich wieder einschlief, quälten mich wirre Träume. Um halb sechs hatte ich genug und stand auf.
Es war noch dunkel und fast verkehrsstill, als ich ins Büro fuhr. Wie sich herausstellte, war ich die Erste. Der Hof war noch mit Kerzen übersät. Ich fuhr in den ersten Stock hinauf, machte Kaffee und ging die Unterlagen durch, die Fielding mir hingelegt hatte. Besonders neugierig war ich auf den Inhalt des Kuverts aus Waddells Gesäßtasche. Ich erwartete ein Gedicht, vielleicht weitere »Gedanken« oder einen Brief von einem Priester und war entsprechend verblüfft, dass das, was Waddell als »streng vertraulich« bezeichnet hatte und mit ins Grab nehmen wollte, lediglich Quittungen waren: fünf von Mautstellen und drei von Restaurants – einschließlich einer für ein Brathähnchenmenü bei Shoney’s vor zwei Wochen.
2
Trotz des Barts und der Stirnglatze sah Detective Trent sehr jung aus. Weiße Fäden durchzogen das blonde Haar. Er war groß und schlank, sein mit einem Gürtel zusammengehaltener Trenchcoat wirkte wie frisch gestärkt, und die Schuhe glänzten. Er blinzelte etwas nervös, als wir uns vor dem Henrico Doctor’s Emergency Center begrüßten.
»Wenn es Ihnen recht ist, sprechen wir erst mal hier draußen ein paar Worte«, sagte er. »Hier sind wir ungestört.« Fröstelnd schlang ich die Arme um meinen Oberkörper, während nicht weit von uns mit ohrenbetäubendem Lärm ein Hubschrauber von dem grasbewachsenen Startplatz abhob. Der Mond stand als schmale Sichel am schiefergrauen Himmel, die parkenden Autos waren schmutzig von Streusalz und Winterregen. Der Wind biss mir ins Gesicht, aber es war nicht die Kälte, die mich an diesem trostlosen Morgen frieren ließ: Mir graute vor dem, was mir bevorstand.
»Wenn Sie den Jungen sehen, werden Sie verstehen, weshalb ich Sie hergebeten habe«, sagte der Detective, als das Rotorengeräusch wieder eine Verständigung möglich machte.
»Was wissen Sie über ihn?«, fragte ich.
»Ich habe mit seinen Familienangehörigen gesprochen und mit einigen anderen Leuten, die ihn kennen. Soviel ich daraus entnehmen konnte, ist Eddie Heath ein ganz durchschnittlicher Junge: Er liebt Sport, trägt Zeitungen aus und hatte noch nie Probleme mit der Polizei. Sein Vater arbeitet bei einer Telefongesellschaft, und die Mutter schneidert. Offenbar brauchte sie gestern Abend eine Dose Pilzcremesuppe für den Auflauf, den es zum Abendessen geben sollte, weshalb sie Eddie zu Lucky’s Convenience Store schickte.«
»Wie weit ist der Supermarkt von ihrem Haus entfernt?«, wollte ich wissen.
»Nur ein paar Blocks. Eddie ist schon oft dort gewesen; die Kassiererinnen kennen ihn mit Namen.«
»Wann wurde er zuletzt gesehen?«
»Gegen siebzehn Uhr dreißig. Er war nur kurz im Laden.«
»Da war es schon dunkel.«
»Ja, stimmt.« Trent schaute dem Hubschrauber nach, der sich in der Ferne wie eine weiße Libelle gegen den tristen Himmel abhob. »Gegen zwanzig Uhr dreißig überprüfte ein Streifenbeamter routinemäßig die Rückseiten der Gebäude an der Patterson Avenue und fand den Jungen dort, an einen Müllcontainer gelehnt.«
»Haben Sie Fotos?«
»Nein, Ma’am. Als der Beamte feststellte, dass der Junge noch lebt, holte er schnellstens Hilfe. Aber er hat uns eine ziemlich genaue Beschreibung gegeben: Der Junge war nackt und saß mit ausgestreckten Beinen und gesenktem Kopf da, die Arme hingen seitwärts herab. Neben ihm lag eine kleine Papiertüte, die die besagte Pilzcremesuppe und einen Knusperriegel enthielt. Die Temperatur betrug minus zwei Grad.«
Ein Krankenwagen hielt vor der Notaufnahme, und die Sanitäter zogen eine Trage heraus, auf der ein alter Mann festgeschnallt war. Mit metallischem Klicken klappten die Beine nach unten, und die Männer schoben den Patienten eiligst in das Gebäude. Wir folgten ihnen, bevor die automatischen Glastüren sich wieder schließen konnten. Der Korridor war gleißend hell, es roch steril. Auf Stühlen entlang der Wand saßen Verletzte, die darauf warteten, dass einer der Ärzte Zeit für sie hatte. Tag und Nacht riss hier die Arbeit nicht ab.
»Wo ist seine Kleidung?«, fragte ich. »Wurde eine Kugel gefunden?«
Wir hatten inzwischen den Lift erreicht.
»Seine Sachen liegen in meinem Kofferraum, ich bringe sie gleich anschließend ins Labor. Die Kugel steckt noch in seinem Kopf.«
Die pädiatrische Intensivstation lag am Ende eines gebohnerten Flurs. Auf den Glasscheiben in der hölzernen Flügeltür klebten Dinosaurier-Sticker. Dahinter leuchteten Regenbogen an den himmelblauen Wänden. Acht Zimmer waren im Halbkreis um die Wachstation gruppiert, die mit drei jungen Schwestern besetzt war. Eine saß am Computer, die zweite telefonierte. Die dritte, eine schlanke Brünette, sagte, als Trent den Grund unseres Besuchs erklärt hatte: »Ich bin die Oberschwester. Der behandelnde Arzt ist noch nicht da.«
»Wir wollen nur einen Blick auf seine Verletzungen werfen, dazu brauchen wir ihn nicht. Es wird nicht lange dauern«, erwiderte Trent. »Sind die Eltern noch drin?«
»Ja, sie waren die ganze Nacht hier.« Die Oberschwester führte uns zu Eddies Zimmer, ging hinein und zog die Tür hinter sich zu, ohne sie jedoch zu schließen.
»Nur ein paar Minuten«, hörte ich sie sagen. »Solange die Untersuchung dauert.«
»Was für ein Spezialist ist es denn diesmal?«, fragte der Vater mit unsicherer Stimme.
»Eine Ärztin, die viel über Verletzungen weiß. Sie ist so etwas wie eine Polizeiärztin.« Welch taktvolle Umschreibung für meinen Beruf.
Nach einer Pause sagte der Vater: »Aha. Es geht um Hinweise auf den Täter, ja?«
»Genau. Wie wär’s mit einem Kaffee, oder möchten Sie vielleicht etwas essen?«
Eddies Eltern kamen aus dem Zimmer, beide beträchtlich übergewichtig und mit müdem, verzweifeltem Blick, einfache Leute, deren Welt einzustürzen drohte. Als sie mich flehend ansahen, hätte ich ihnen gern etwas gesagt, das ihre Angst mildern würde, doch die tröstenden Worte blieben mir im Hals stecken. Mit hängenden Schultern gingen sie davon.
Eddie Heaths Kopf war verbunden. Er wurde künstlich beatmet und erhielt verschiedene Tropfinfusionen. Sein Gesicht war milchweiß, die zarten Lider schimmerten bläulich. Die rotblonden Brauen ließen auf seine Haarfarbe schließen. Er wirkte viel jünger als dreizehn. Seine Unterarme waren dünn, sein Körper zeichnete sich klein und schmächtig unter der Decke ab. Nur die überproportional großen Hände, in denen die Infusionsnadeln steckten, entsprachen seinem Alter.
»Dr. Scarpetta muss seine rechte Schulter und den rechten Oberschenkel sehen«, erklärte Trent der Schwester mit gedämpfter Stimme.
Sie holte zwei Paar Handschuhe – eines für sich und eines für mich –, und wir zogen sie an. Der Junge war nackt. In den Hautfalten und unter den Fingernägeln saß Schmutz. Patienten, deren Zustand kritisch ist, werden nicht gründlich gewaschen. Trent verkrampfte sich merklich, als die Schwester die Kompressen von den Wunden entfernte. »Großer Gott!«, murmelte er. »Das sieht ja noch schlimmer aus als gestern Abend. Mein Gott!« Er schüttelte den Kopf und trat einen Schritt zurück.
Wenn mir jemand gesagt hätte, der Junge sei von einem Hai angegriffen worden, hätte ich es geglaubt. Wären da nicht die Wundränder gewesen: Sie zeigten eindeutig, dass das Fleisch aus der Schulter und der Innenseite des Schenkels mit einer glatten Klinge – einem Rasiermesser etwa – herausgeschnitten worden war. Ich öffnete meine Instrumententasche, holte ein Lineal heraus und vermaß die Verletzungen, ohne sie zu berühren. Dann machte ich Fotos.
»Sehen Sie die Kratzer und Schnitte an den Rändern?« Trent war wieder ans Bett getreten und deutete darauf. »Es sieht aus, als habe der Täter ein Muster in die Haut geritzt und das Ganze dann entfernt.«
»Haben Sie am Anus Verletzungen festgestellt?«, fragte ich die Schwester.
»Beim Messen der Rektaltemperatur sind mir keine aufgefallen, und beim Intubieren wurde auch in Mund und Rachen nichts Ungewöhnliches festgestellt«, nahm sie die Beantwortung meiner nächsten Frage vorweg.
»Vielleicht befanden sich Tätowierungen an den fraglichen Stellen«, überlegte ich laut. »Oder Muttermale oder Narben.«
»Ich gehe die Eltern fragen«, erbot sich Trent. Schweißperlen glänzten auf seiner Stirn.
»Sie werden in der Cafeteria sein«, vermutete ich.
»Ich finde sie schon.« Er verschwand.
Ich wandte mich an die Schwester: »Was sagen die Ärzte?«
»Der Zustand des Jungen ist kritisch, und er spricht auf keine Therapiemaßnahme an«, konstatierte sie nüchtern.
»Darf ich sehen, wo die Kugel eindrang?«
Sie lockerte den Rand des Kopfverbandes und schob ihn nach oben, bis das kleine Loch mit dem versengten Rand sichtbar wurde. Der Schusskanal verlief von der rechten Schläfe nach vorn.
»Durch den Stirnlappen?«, fragte ich.
»Ja.«
»Wurde ein Angiogramm gemacht?«
»Aufgrund der Schwellung ist das Gehirn nicht durchblutet. Es besteht keine elektroenzephalitische Aktivität, und als wir kaltes Wasser in die Ohren laufen ließen, wurde keine kalorische Aktivität ausgelöst. Das Gehirn reagierte nicht« Mit gleichgültiger Stimme berichtete sie von weiteren Versuchen, Hirndruck zu erzeugen.
Ich forschte nun nach Verletzungen, die darauf hindeuteten, dass er sich gewehrt hatte. Als ich vorsichtig, um nicht an die Infusionsnadeln zu kommen, seine rechte Hand untersuchte, schlossen sich seine Finger plötzlich um meine. Eine solche Reflexbewegung ist bei Hirntoten nichts Ungewöhnliches und kommt der eines Babys gleich, das einen hingehaltenen Finger festhält. Reflexe funktionieren, ohne einen Denkprozess vorauszusetzen.
In den vielen Stunden, die ich früher in Notoperationsräumen und auf Intensivstationen zubringen musste, hatte ich die Erfahrung gemacht, dass es leichterfiel, Patienten gegenüber neutral zu bleiben, die bereits bewusstlos eingeliefert waren. Doch obwohl dieser Junge hier nie mehr aufwachen würde und das, was seine Persönlichkeit ausmachte, zerstört war, rührte er an mein Herz. Ich legte seine Hand behutsam auf die Decke und drängte die Tränen zurück.
Die Schwester rückte den Verband an seinen Platz, legte frische Kompressen auf die Wunden und deckte den Jungen wieder zu. Ich zog die Handschuhe aus und ließ sie gerade in den Mülleimer fallen, als Trent zurückkam.
»Keine Tätowierungen«, berichtete er atemlos, als sei er von der Cafeteria herübergesprintet. »Keine Muttermale und auch keine Narben.«
Wir bedankten uns bei der Oberschwester und verließen das Emergency Center. Die Sonne spähte zwischen dunklen Wolken hindurch, der Wind trieb winzige Schneeflocken vor sich her, und viele Autos auf der belebten Forest Avenue waren weihnachtlich geschmückt.
»Wie es aussieht, wird der Junge sterben«, sagte ich zu Trent, der neben mir vor dem Eingang stand.
»Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Sie nicht behelligt. Verdammt, ist das kalt!«
»Sie haben genau das Richtige getan. In ein paar Tagen sehen die Wunden ganz anders aus.«
»Angeblich soll es den ganzen Dezember so bleiben: eisig und viel Schnee. Haben Sie Kinder?«
»Nein. Eine Nichte.«
»Ich habe zwei Jungs. Einer ist dreizehn.«
Ich zog meine Autoschlüssel aus der Tasche. »Ich stehe gleich da hinten«, sagte ich.
Trent begleitete mich. Ich sah, dass er meinen grauen Mercedes mit einem so bewundernden Blick betrachtete, als habe er eine schöne Frau vor sich. Dann wandte er sich wieder mir zu.
»Was sagen Sie zu den Verletzungen? Haben Sie so was schon mal gesehen?«
»Es besteht die Möglichkeit, dass wir es mit einem Täter zu tun haben, der zum Kannibalismus neigt«, antwortete ich.
Ich fuhr ins Büro zurück, goss den flüssigen Teer, der sich in der Kaffeekanne abgesetzt hatte, in einen Becher, sah die Post durch und war gerade dabei, einen Stapel Laborberichte abzuzeichnen, als meine Sekretärin Rose hereinkam und einen Zeitungsausschnitt zu denen legte, die sich bereits auf meinem Schreibtisch befanden.
»Sie sehen müde aus«, stellte sie fest. »Am Kaffee sah ich, dass Sie morgens schon mal hier waren. Wo sind Sie denn gewesen?«
»In Henrico County. Ein Junge, der wahrscheinlich auf meinem Tisch landen wird.«
»Eddie Heath?«
Ich starrte sie verblüfft an. »Woher wissen Sie das?«
»Er steht in der Zeitung.«
Ich bemerkte, dass sie eine neue Brille trug, die ihr aristokratisches Gesicht weniger streng erscheinen ließ. »Ihre Brille gefällt mir«, sagte ich. »Besser als diese Benjamin-Franklin-Fassung. Was steht denn über ihn in der Zeitung?«
»Nicht viel. Nur, dass er hinter einem leer stehenden Lebensmittelgeschäft an der Patterson gefunden wurde und dass man auf ihn geschossen hat. Wenn mein Sohn noch so jung wäre, ich ließe ihn unter keinen Umständen Zeitungen austragen.«
»Eddie war nicht beim Zeitungsaustragen, als er entführt wurde.«
»Egal. Ich würde es nicht erlauben – nicht heutzutage! Lassen Sie mich mal überlegen …« Sie legte den Finger an die Nase. »Fielding ist unten und macht eine Autopsie, und Susan ist unterwegs, um einige Gehirne zwecks Begutachtung zur Medizinischen Fakultät der Universität zu bringen. Ansonsten habe ich nichts Wichtiges zu berichten, außer dass der Computer vorhin den Geist aufgegeben hat.«
»Und funktioniert er wieder?«
»Margaret arbeitet daran. Sie müsste es bald geschafft haben.«
»Gut. Sie soll dann gleich etwas für mich raussuchen – unter den Stichworten ›schneiden‹, ›verstümmeln‹, ›Kannibalismus‹ und ›Bisswunden‹. Ja, auch noch unter ›herausgeschnitten‹, ›Haut‹ und ›Fleisch‹. Und für alle Fälle soll sie ferner unter ›Gliedmaßenabtrennung‹ und ›Zerstückelung‹ nachsehen, obwohl das den Kern der Sache nicht treffen dürfte.«
»Für welches Gebiet und für welchen Zeitraum?« Rose blickte von ihren Notizen auf.
»Fürs ganze Staatsgebiet, in den letzten fünf Jahren. Mich interessieren besonders Kinder, aber wir wollen uns nicht auf sie beschränken. Und bitten Sie Margaret, sich auch an die Trauma Registry zu wenden. Ich sprach vor Kurzem auf einer Tagung mit dem Direktor, und er gab sich sehr kooperationsbereit.«
»Also auch Fälle, in denen das Opfer überlebt hat?«
»Wenn möglich, ja, Rose. Wir dürfen keine Möglichkeit ungenutzt lassen, Fälle zu finden, die dem von Eddie Heath ähneln.«
»Ich sage Margaret gleich Bescheid.« Rose verschwand.
Ich begann, die Artikel durchzusehen, die sie mir aus verschiedenen Frühausgaben ausgeschnitten hatte. Es ging hauptsächlich und ausführlich um Ronnie Waddells angebliche Blutung »aus Augen, Nase und Mund«. Die örtliche Sektion von Amnesty International vertrat die Ansicht, dass diese Hinrichtung »genauso unmenschlich« gewesen sei »wie jeder x-beliebige Mord«. Ein Sprecher der American Civil Liberties Union sagte, der elektrische Stuhl habe »möglicherweise nicht richtig funktioniert«, wodurch Waddell habe »schrecklich leiden müssen«. Er verglich den Fall mit jener Hinrichtung in Florida, bei der zum ersten Mal synthetischer Schwamm benutzt wurde, wodurch die Haare des Delinquenten Feuer fingen.
Ich heftete die Zeitungsausschnitte in Waddells Akte und fragte mich, welche Kaninchen sein Anwalt, Nicholas Grueman, wohl diesmal aus dem Hut ziehen würde. Unsere Zusammenstöße waren schon zur Gewohnheit geworden. Mit wahrer Wonne stellte er meine berufliche Kompetenz in Frage und schaffte es immer wieder, dass ich mir unfähig vorkam. Dabei hatte er noch nie durchblicken lassen, dass er sich daran erinnerte, dass ich in Georgetown eine seiner Studentinnen gewesen war. Dies erboste mich am meisten. Er war schuld, dass ich mein Jurastudium im ersten Jahr verabscheute, dass ich meine einzige Zwei schrieb und in der Law Review nicht erwähnt wurde. Ich hatte Nicholas Grueman nie vergessen und konnte mir nicht vorstellen, dass er mich vergessen hatte.
Nicholas Grueman meldete sich am Donnerstag, kurz nachdem ich erfahren hatte, dass Eddie Heath gestorben war.
»Kay Scarpetta?«, kam seine Stimme durch den Draht.
»Ja.« Ich schloss die Augen. An dem Druck hinter ihnen erkannte ich, dass sich mit hoher Geschwindigkeit ein Sturmtief näherte.
»Ich habe mir Mr. Waddells vorläufigen Autopsiebericht angesehen und nun einige Fragen an Sie.«
Ich schwieg.
»Ich spreche von Ronnie Joe Waddell.«
»Womit kann ich Ihnen dienen?«
»Fangen wir mit dem ›fast röhrenförmigen Magen‹ an. Eine recht anschauliche Beschreibung. Ist das Ihre persönliche Ausdrucksweise oder ein offizieller Terminus? Gehe ich recht in der Annahme, dass daraus zu schließen ist, dass Waddell nichts gegessen hatte?«
»Ich kann nicht sagen, seit wann, aber sein Magen war leer und sauber.«
»Befand er sich vielleicht im Hungerstreik?«
»Mir ist nichts dergleichen bekannt.« Ich schaute zu der Uhr an der Wand hinauf, und das Licht stach mir schmerzhaft in die Augen. Ich hörte Grueman umblättern.
»Es heißt hier, dass Sie mehrere Abschürfungen feststellten – an den ›Innenseiten‹ der Oberarme«, sagte Grueman.
»Das ist richtig.«
»Und wo da?«
»Über dem fossa cubitalis.«
Pause. »Soso, über dem fossa cubitalis«, wiederholte er, und ich konnte ihn am Telefon grinsen sehen. »Nun, dann schauen wir mal. Ich habe jetzt meine Handfläche nach oben gedreht und blicke auf die Stelle, an der sich der Arm biegen lässt. Es ist doch richtig, dass dies der fossa cubitalis ist, nicht wahr? Ihre ›Innenseite des Oberarms‹ ist demnach der Teil, den ich in dieser Haltung sehe. Ist das korrekt?«
»Exakt.«
»Das wäre also abgeklärt. Und worauf führen Sie diese Verletzungen zurück?«
»Sie könnten von Fesseln herrühren.«
»Fesseln? Meinen Sie die Gurte des elektrischen Stuhls?«
»Das wäre eine Möglichkeit.«
»Heißt das, dass Sie es nicht mit Sicherheit wissen, Dr. Scarpetta?«
»Es gibt nur sehr wenige Dinge im Leben, die man mit Sicherheit weiß, Mr. Grueman.«
»Es könnte demnach auch sein, dass die Abschürfungen von etwas anderem verursacht wurden, beispielsweise von menschlichen Händen?«
»Nein, die Abschürfungen, die ich fand, deuten nicht auf menschliche Hände hin.«
»Aber sie lassen auf den elektrischen Stuhl schließen, auf die Gurte, mit denen der Delinquent an ihn gefesselt wird?«
»Meiner Meinung nach, ja.«
»Ihrer Meinung nach, Dr. Scarpetta?«
»Ich habe den elektrischen Stuhl nicht untersucht«, erwiderte ich scharf.
Darauf folgte eine lange Pause – eine Taktik, die er schon früher im Hörsaal angewandt hatte, um die dumme Antwort eines Studenten im Raum stehen zu lassen. Ich sah ihn wieder vor mir, wie er mit den Händen auf dem Rücken und ausdruckslosem Gesicht dastand, während ich keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Und auch jetzt, zwanzig Jahre danach, als Chief Medical Examiner des Staates Virginia und im Besitz von so vielen Diplomen, dass ich eine Wand meines Büros damit hätte tapezieren können, fühlte ich mich erniedrigt und von ohnmächtiger Wut gepeinigt.
Als Grueman das Gespräch mit einem schroffen »Auf Wiederhören!« beendete, kam Susan herein.
»Eddie Heath ist gebracht worden.« Sie war bereits in Straßenkleidung. »Die Autopsie hat doch sicher bis morgen Zeit.«
»Nein.« Ich schüttelte den Kopf. »Das hat sie nicht.«
Auf dem Stahltisch sah der Junge noch kleiner aus als in seinem Klinikbett. Man hatte ihn nackt gebracht, alle Infusionsnadeln, der Katheter und die Kompressen waren noch an Ort und Stelle. Er brauchte diese Dinge nicht mehr, aber ich: für die Bestandsaufnahme. Fast eine Stunde lang notierte ich Verletzungen, die von Behandlungsmaßnahmen herrührten, während Susan Fotos machte und Telefongespräche entgegennahm.
Die Türen des Autopsieraumes waren abgeschlossen, und ich hörte, wie draußen immer wieder Leute durch den Flur zum Parkplatz eilten. Es war Feierabend.
Die Wunden an Eddies Schulter und Oberschenkel waren trocken und leuchteten dunkelrot.
»Mein Gott!« Susan starrte sie an. »Mein Gott, was muss das für ein Mensch sein, der so was tut! Schauen Sie sich die kleinen Schnitte an den Rändern an! Es sieht aus, als habe jemand die Haut kreuz und quer eingeritzt und dann das ganze Stück rausgenommen.«
»Das ist genau das, was ich annehme.«
»Sie glauben, jemand hat ein Muster reingeritzt?«
»Ich glaube, jemand hat versucht, etwas zu beseitigen, und als das nicht funktionierte, entfernte er Haut und Fleisch.«
»Und was wollte er beseitigen?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich. »Der Junge hatte keine Tätowierungen, Narben oder Muttermale an diesen Stellen, und deshalb nehme ich an, dass ihm etwas zugefügt wurde, das anschließend entfernt werden musste, weil es einen Hinweis auf den Täter hätte geben können.«
»So was wie Zahnspuren?«
»Ja.«
Der Körper war noch nicht ganz ausgekühlt, als ich die Stellen zu säubern begann, die im Krankenhaus übersehen worden sein konnten oder aus Vorsichtsgründen unberücksichtigt geblieben waren. Ich überprüfte die Achselhöhlen, die Gesäßfalten, den Nabel, schaute in und hinter die Ohren, schnitt Schnipsel von den Fingernägeln, die ich in sterile Tütchen fallen ließ, und durchsuchte die Haare nach Fasern und anderen Fremdkörpern.
»Suchen Sie was Bestimmtes?«, fragte Susan schließlich. Ich spürte ihre Anspannung.
»Getrocknete Samenflüssigkeit, zum Beispiel.«
»In der Achselhöhle?«
»Dort, in jeder Hautfalte, in jeder Körperöffnung – überall.«
»Für gewöhnlich suchen Sie an diesen Stellen aber nicht.«
»Dies ist ja auch kein gewöhnlicher Fall.«