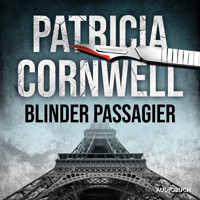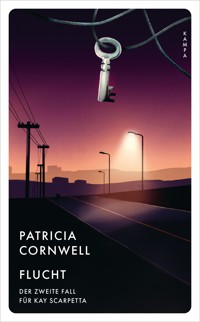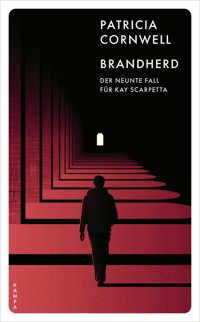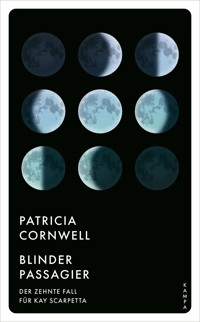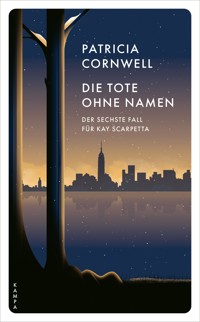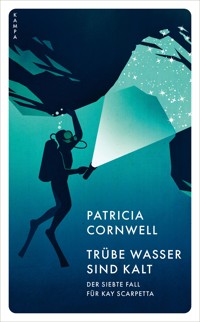12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kay Scarpetta
- Sprache: Deutsch
Der grausame Mord an der elfjährigen Emily Steiner schockiert die Kleinstadt Black Mountain im Westen von North Carolina. Die örtliche Polizei hatte es bislang selten mit Mord oder sexuellem Missbrauch von Kindern zu tun - und noch niemals mit einem Fall, auf den beides zutraf. Die Menschen dort kommen nicht mal auf die Idee, nachts ihre Haustüren abzuschließen. Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta, die in Virginia in einem ähnlichen Fall ermittelt, wird hinzugezogen und steht zunächst vor unlösbaren Rätseln. Was verschweigt Emilys Mutter? Hat der mysteriöse Selbstmord eines Polizisten etwas mit dem Tod des Mädchens zu tun? Wurde das Kind Opfer einer düsteren Familientragödie? Und warum verübt ein Unbekannter einen Mordanschlag auf Scarpettas Nichte Lucy? Dann deuten Spuren an der Leiche auf einen Täter hin, der aus Emilys engstem Umfeld stammen muss. Scarpetta wendet sich an die Body Farm, ein forensisches Labor, das menschliche Verwesungsprozesse erforscht und ihr schon mehrmals dabei geholfen hat, selbst die schwierigsten Fälle aufzuklären.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Patricia Cornwell
Body Farm
Der fünfte Fall für Kay Scarpetta
Aus dem amerikanischen Englisch von Monika Blaich und Klaus Kamberger
Kampa
Für Orrin Hatch, Senator aus Utah und unermüdlicher Kämpfer gegen das Verbrechen
Die mit Schiffen auf dem Meer fuhren
und trieben ihren Handel in großen Wassern;
die des Herrn Werke erfahren haben
und seine Wunder im Meer …
Psalm 107, 3–24
1
Es war der 16. Oktober. Die ersten Sonnenstrahlen vor meinem Fenster trieben Rehe langsam zum dunklen Waldrand zurück. In den Wasserleitungen über und unter mir begann es zu rauschen, und in einem Zimmer nach dem anderen ging das Licht an. Von irgendwoher schrillten Signale und zerrissen die dämmrige Stimmung. Ich war mit dem Krachen von Schüssen schlafen gegangen und auch wieder aufgewacht.
In Quantico, Virginia, hört dieser Lärm nie auf. Die Stadt beherbergt die FBI Academy, die wie eine Insel von Einheiten der Marines umgeben ist. Jeden Monat verbringe ich mehrere Tage im Sicherheitsbereich der Academy. Solange ich es nicht will, kann mich hier niemand erreichen, und es steigt mir auch keiner nach, der im Boardroom, der Kantine, ein paar Bierchen zu viel hatte.
Die Zimmer für neue Agenten und beim FBI hospitierende Polizisten sind spartanisch eingerichtet, doch mir stand eine ganze Suite zur Verfügung mit Fernsehen, Küche, Telefon und einem Badezimmer, das ich mit niemandem teilen musste. Rauchen und Alkohol waren nicht erlaubt, aber ich fragte mich, ob die Agenten und Prozesszeugen, die hier zu ihrem eigenen Schutz isoliert wurden, die Regeln auch nur annähernd so streng befolgten wie ich.
Während das Kaffeewasser heiß wurde, öffnete ich meine Aktentasche und holte einen Ordner heraus, der schon seit meiner Ankunft am Abend zuvor auf mich wartete. Ich hatte noch nicht hineingesehen, weil ich mich vor dem Schlafengehen ungern mit solch einer Sache auseinandersetze. In dieser Beziehung hatte ich mich nämlich verändert.
Seit meinem Medizinstudium war ich es gewohnt, mich jederzeit jedem nur erdenklichen Trauma auszusetzen. Ich hatte rund um die Uhr in der Notaufnahme gearbeitet. Ich hatte bis zum frühen Morgen allein im Leichenschauhaus Autopsien durchgeführt. Schlaf war immer wie ein kurzer Ausflug an einen dunklen, leeren Ort gewesen, an den ich mich hinterher kaum mehr erinnerte. Doch im Laufe der Jahre hatte sich in mir eine unangenehme Wandlung vollzogen. Ich bekam Angst vor dem Arbeiten bis spät in die Nacht. Ich hatte immer häufiger Albträume, in denen schreckliche Bilder aus meinem Leben plötzlich aus den verschiedenen Schichten meines Unterbewusstseins emporschossen.
Emily Steiner war elf gewesen. Ihre gerade erwachende Sexualität hatte ihren schmächtigen Körper wie ein erster rosiger Hauch überzogen, als sie vor zwei Wochen, am Sonntag, dem 1. Oktober, in ihr Tagebuch schrieb:
Ich bin soo glücklich! Es ist schon fast ein Uhr morgens und Mom weiß nicht das ich noch in mein Tagebuch schreibe. Ich liege nämlich im Bett mit der Taschenlampe unter der Decke. Wir waren zum Gemeinschaftsessen in der Kirche und Wren war da! Er hat mich bemerkt! Dann hat er mir ein Fireball-Bonbon gegeben! Ich habe es eingesteckt als er wegsah. Er liegt in meiner Geheimschachtel. Heute Nachmittag haben wir Jugendgruppe. Er will das wir uns davor treffen und das ich es keinem sagen soll!!!
An diesem Nachmittag verließ Emily um halb vier ihr Elternhaus in Black Mountain und machte sich auf den drei Kilometer langen Weg zur Kirche. Andere Kinder erinnerten sich daran, dass sie das Mädchen nach der Gruppenstunde allein hatten weggehen sehen. Das war gegen sechs Uhr abends gewesen, als die Sonne gerade hinter den Hügeln verschwand. Den Gitarrenkasten in der Hand, bog Emily von der Hauptstraße ab und nahm eine Abkürzung um einen kleinen See. Nach Ansicht der Polizei begegnete sie auf diesem Weg dem Mann, der sie ein paar Stunden später umbringen sollte. Vielleicht blieb sie stehen und sprach mit ihm. Vielleicht aber hatte sie es in der hereinbrechenden Dämmerung auch so eilig, nach Hause zu kommen, dass sie ihn gar nicht bemerkte.
In Black Mountain, einer Stadt mit siebentausend Einwohnern im Westen von North Carolina, hatte die örtliche Polizei sehr selten mit Mord oder sexuellem Missbrauch von Kindern zu tun gehabt und noch niemals mit einem Fall, auf den beides zutraf. Kein Mensch hier hatte sich je über einen Temple Brooks Gault aus Albany, Georgia, Gedanken gemacht, obwohl sein Gesicht überall im Land von den Fahndungsplakaten mit den zehn meistgesuchten Verbrechern herablächelte. Notorische Kriminelle und ihre Verbrechen waren kein Thema, mit dem man sich in dieser malerischen kleinen Welt auseinandersetzen musste, einer Welt, aus der Thomas Wolfe und Billy Graham stammten.
Ich begriff nicht, was Gault in diese Gegend gezogen haben mochte, zu einem zarten Kind wie Emily, das nur für seine Mutter und einen Jungen namens Wren lebte. Doch als Gault vor zwei Jahren in Richmond seinen mörderischen Raubzug begonnen hatte, schien die Wahl seiner Opfer ebenso unverständlich. Sie blieb es bis heute. Obwohl ich aus meiner Wohnung in einen sonnendurchfluteten Gang hinaustrat, verdüsterte mir der Gedanke an Gaults blutige Karriere in Richmond diesen Morgen.
Einmal hätten wir ihn fast erwischt, einen Augenblick lang war er zum Greifen nah. Doch dann floh er durch ein Fenster und verschwand. Damals hatte ich keine Waffe bei mir. Es war auch gar nicht meine Aufgabe, durch die Gegend zu rennen und auf Leute zu schießen. Doch ich konnte die Selbstzweifel, die mich seitdem erfüllten, einfach nicht abschütteln. Immer wieder stellte ich mir die Frage, was ich hätte tun können.
Der Wein in der Academy war noch nie ein guter Jahrgang gewesen, und ich bedauerte, am Abend zuvor im Boardroom ein paar Gläser davon getrunken zu haben. Mein Morgenlauf auf der J. Edgar Hoover Road fiel mir schwerer als sonst.
O Gott, dachte ich. Das schaffe ich nie.
Am Straßenrand stellten Marines Segeltuchstühle in Tarnfarben auf und beobachteten die Umgebung mit Fernrohren. Ich spürte ihre unverschämten Blicke, als ich langsam an ihnen vorbeilief, wusste aber, dass sie das goldene Wappen des Department of Justice auf meinem Ringel-T-Shirt sehr wohl zur Kenntnis nahmen. Wahrscheinlich hielten die Soldaten mich für eine Agentin oder für eine hospitierende Polizistin und ließen mich deshalb in Ruhe, aber die Vorstellung, dass meine Nichte genau dieselbe Strecke lief, gefiel mir ganz und gar nicht. Mir wäre es lieber gewesen, wenn Lucy ihr Praktikum anderswo absolviert hätte. Ich hatte bei dieser Entscheidung keinen geringen Einfluss auf sie gehabt, wie überhaupt auf ihr ganzes Leben, was mich nun eher beunruhigte, denn meine Kräfte ließen nach, und ich spürte, dass ich älter wurde.
Gerade rückte das HRT, das Hostage Rescue Team, zum Manöver aus, eine Spezialtruppe des FBI für die Befreiung von Geiseln. Die Rotorblätter der Hubschrauber zerschnitten träge die Luft. Ein Pick-up mit beim Schusstraining durchlöcherten Türen donnerte vorbei. Ihm folgte ein Zug Soldaten. Ich wendete und machte mich auf den zwei Kilometer langen Weg zurück zur Academy, einem Backsteingebäude, das man durchaus auch für ein modernes Hotel hätte halten können, wenn nicht die vielen Antennen auf dem Dach gewesen wären und es nicht mitten in einem waldigen Niemandsland gestanden hätte. Schließlich erreichte ich das Wachhäuschen und hob die Hand zu einem müden Gruß an den Wachhabenden hinter der Glasscheibe. Außer Atem und verschwitzt, wie ich war, überlegte ich gerade, ob ich den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen wollte, als ich spürte, wie hinter mir ein Wagen abbremste.
»Haben Sie vor, sich umzubringen oder so was Ähnliches?«, hörte ich die laute Stimme von Captain Pete Marino. Er saß in seinem silbernen Crown Victoria, die Funkantennen schwangen auf und ab wie Angelruten, und trotz zahlloser Vorträge meinerseits zu diesem Thema war er wieder mal nicht angeschnallt.
»Das kann man einfacher haben«, rief ich ihm durch das offene Beifahrerfenster zu. »Zum Beispiel, indem man ohne Sicherheitsgurt fährt.«
»Man weiß ja nie, wann man mal schnell rausspringen muss.«
»Aus einem Wrack werden Sie kaum mal schnell rausspringen«, sagte ich, »es sei denn, durch die Windschutzscheibe.« Marino war ein erfahrenes Mitglied der Richmonder Mordkommission; Richmond war unser beider Hauptquartier. Er war kürzlich befördert und auf das Revier im schlimmsten Bezirk unserer Stadt versetzt worden. Er war Experte für Gewaltverbrechen und arbeitete schon seit Jahren für das VICAP, ein Forschungsprogramm des FBI zur Ergreifung von Gewaltverbrechern.
Er war jetzt Anfang fünfzig und eine einzige Anhäufung menschlicher Schwächen, vor allem in Form von ungesunder Ernährung und übermäßigem Alkoholkonsum. Sein Gesicht war von diesem harten Leben deutlich gezeichnet und umrahmt von sich lichtendem, grauem Haar. Marino hatte Übergewicht und war aus dem Leim gegangen; auch galt er nicht gerade als besonders liebenswürdig. Ich wusste, er kam zur Lagebesprechung des Falls Steiner, aber ich wunderte mich über das Gepäck auf seinem Rücksitz.
»Bleiben Sie länger?«, fragte ich.
»Benton hat mich für das Street Survival eingeteilt.«
»Sie und wen noch?«, fragte ich. Für dieses Projekt, bei dem das Verhalten in brenzligen Situationen auf der Straße trainiert wird, wurden nämlich keine Einzelpersonen ausgebildet, sondern ganze Einheiten.
»Mich und mein Team aus dem Revier.«
»Nun erzählen Sie mir bloß nicht, dass zu Ihrem neuen Aufgabenbereich auch das Eintreten von Türen gehört.«
»Das ist einer der Vorzüge einer Beförderung: Man steckt mit dem Hintern wieder in einer Uniform und darf hinaus auf die Straße. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten, Doc, da draußen geht’s mittlerweile ganz schön zur Sache.«
»Danke für den Tipp«, sagte ich trocken. »Ziehen Sie sich dicke Sachen an.«
»Wie?« In seiner schwarzen Sonnenbrille spiegelten sich die Wagen, die langsam an uns vorbeirollten.
»Auch Farbgeschosse tun weh.«
»Ich habe nicht vor, mich treffen zu lassen.«
»Ich kenne niemanden, der das vorhat.«
»Wann sind Sie angekommen?«, fragte er.
»Gestern Abend.«
Marino zog ein Päckchen Zigaretten von der Sonnenblende. »Hat man Ihnen viel mitgeteilt?«
»Ich habe mir ein paar Dinge angesehen. Offenbar legt die Kriminalpolizei von North Carolina heute Vormittag den Großteil der Unterlagen zu dem Fall vor.«
»Es war Gault. Er muss es gewesen sein.«
»Gewiss gibt es da Parallelen«, sagte ich vorsichtig.
Er klopfte eine Marlboro aus dem Päckchen und schob sie sich zwischen die Lippen. »Ich schnappe mir diesen verdammten Hurensohn, und wenn ich durch die Hölle muss, um ihn zu finden.«
»Falls Sie ihn in der Hölle finden, lassen Sie ihn einfach dort«, sagte ich. »Gehen Sie mit mir zum Lunch?«
»Solange Sie zahlen, gern.«
»Das tue ich ja immer.« Das war eine Feststellung.
»Und das sollten Sie auch.« Er legte den Gang ein. »Schließlich sind Sie ein verdammter Doktor.«
Ich drehte mich um, überquerte die Fahrbahn und betrat die Sporthalle durch den Hintereingang. Im Umkleideraum blickten mir drei durchtrainierte junge Frauen in verschiedenen Stadien der Nacktheit entgegen.
»Guten Morgen, Ma’am«, tönte es unisono, und damit wusste man gleich, wer sie waren. Die Agenten der Drogenfahndung waren in der ganzen Academy bekannt für ihre notorisch höfliche Art zu grüßen.
Etwas befangen zog ich mir die nass geschwitzten Sachen aus. An den eher männlich-militärischen Umgang hier habe ich mich nie gewöhnen können, wo es Frauen nichts ausmacht, belanglose Reden zu schwingen und sich im Evaskostüm gegenseitig ihre blauen Flecken vorzuführen. Fest in ein Handtuch gewickelt, eilte ich unter die Dusche. Gerade hatte ich das Wasser aufgedreht, als überraschend ein vertrautes grünes Augenpaar um den Plastikvorhang lugte. Die Seife glitt mir aus den Händen, rutschte über den Boden und landete kurz vor den schlammbespritzten Nikes meiner Nichte.
»Lucy, können wir uns unterhalten, nachdem ich hier raus bin?« Mit einem Ruck zog ich den Vorhang zu.
»Hör mal, Len hat mich heute Morgen fast umgebracht«, sagte sie fröhlich, während sie die Seife mit einem Tritt in die Kabine zurückbeförderte. »Es war toll. Wenn wir das nächste Mal die Yellow Brick Road laufen, frage ich ihn, ob du mitkommen kannst.«
»Nein, besten Dank.« Ich massierte mir Shampoo ins Haar. »Ich habe keine Sehnsucht nach Bänderrissen und gebrochenen Knochen.«
»Einmal solltest du sie wirklich laufen, Tante Kay. Das gehört hier einfach dazu.«
»Für mich nicht.«
Lucy schwieg einen Augenblick, dann sagte sie etwas unsicher: »Ich muss dich was fragen.«
Ich spülte das Haar aus, strich es mir aus den Augen, schob den Vorhang zurück und sah hinaus. Meine Nichte stand ein Stück von der Kabine entfernt. Sie war verschwitzt und schmutzig vom Kopf bis zu den Füßen. Ihr graues FBI-T-Shirt zeigte Blutflecken. Mit gerade einundzwanzig Jahren stand sie kurz vor dem Abschluss an der University of Virginia; sie hatte schöne, scharfgeschnittene Züge, und das kurze kastanienbraune Haar war von der Sonne gebleicht. Ich erinnerte mich an die Zeit, als sie ihr Haar noch rot färbte und lang trug, Zahnklammern im Mund hatte und eindeutig zu dick war.
»Sie wollen, dass ich nach dem Examen zurückkomme«, sagte sie. »Mr. Wesley hat den Vorschlag eingereicht, und die Chancen stehen gut, dass die von der Bundesbehörde einwilligen.«
»Und deine Frage?« Ich wusste natürlich, was sie hören wollte, und war wieder einmal furchtbar hin- und hergerissen.
»Ich möchte nur wissen, wie du darüber denkst.«
»Du weißt, dass es einen Einstellungsstopp gibt.« Lucy sah mich scharf an, um an meinem Gesicht abzulesen, was ich ihr nicht sagen wollte.
»Ich kann ohnehin nicht direkt nach dem Collegeabschluss Agentin werden«, sagte sie. »Es geht darum, jetzt in der ERF unterzukommen, vielleicht über eine Ausbildungsbeihilfe. Was ich danach mache«, sie zuckte mit den Schultern, »wer weiß?«
Die ERF, die Engineering Research Facility, war die kürzlich eingerichtete Abteilung des FBI für technische Forschung. Sie war in einem schmucklosen Komplex auf dem Gelände der Academy untergebracht. Die Arbeit dort unterlag der Geheimhaltungspflicht, und es kränkte mich ein bisschen, dass ich als amtliche Leichenbeschauerin des Staates Virginia und beratende Gerichtsmedizinerin bei der Investigative Support Unit des FBI nie Zutritt zu Bereichen erhalten hatte, in denen meine junge Nichte täglich ein und aus ging. Lucy streifte ihre Joggingschuhe und Shorts ab und zog sich Hemd und Sport-BH über den Kopf.
»Wir sprechen später noch über dieses Thema«, sagte ich, während ich aus der Duschkabine trat und Lucy hineinging. »Autsch!«, rief sie, als Wasser über ihre Verletzungen lief. »Nimm reichlich Seife und Wasser. Wie ist das mit deiner Hand passiert?«
»Ich bin eine Böschung runtergerutscht und in der Umzäunung hängen geblieben.«
»Wir sollten lieber etwas Alkohol drauftun.«
»Kommt nicht in Frage.«
»Wann geht dein ERF-Praktikum zu Ende?«
»Ich weiß nicht. Kommt darauf an.«
»Wir treffen uns noch einmal, bevor ich nach Richmond zurückfahre«, versprach ich, ging in den Umkleideraum zurück und föhnte mir das Haar.
Kaum eine Minute später kam Lucy hinter mir hergetrottet. Prüderie war für sie ein Fremdwort; sie war nackt bis auf die Breitling-Uhr, die ich ihr zum Geburtstag geschenkt hatte. »Mist!«, sagte sie leise, während sie sich anzog. »Du wirst nicht glauben, was ich heute alles zu tun habe. Die Festplatte neu formatieren, weil mir der Platz ausgeht, neuen Speicherplatz einbauen, einen ganzen Haufen Dateien austauschen. Ich hoffe nur, dass die Probleme mit der Hardware vorbei sind.« Überzeugend klangen ihre Klagen nicht gerade. Lucy liebte jeden Tag und jede Minute ihrer Arbeit.
»Draußen beim Joggen bin ich Marino begegnet. Er ist diese Woche hier«, sagte ich.
»Frag ihn, ob er Schießübungen machen will.« Sie schleuderte ihre Laufschuhe in den Spind und warf die Tür mit einem begeisterten Knall zu.
»Ich habe das Gefühl, er wird nichts lieber tun«, rief ich ihr nach, als noch ein halbes Dutzend schwarz gekleideter Drogenagentinnen zur Tür hereinkam.
»Guten Morgen, Ma’am.« Als sie ihre Stiefel auszogen, schnellten die Schnürsenkel gegen das Leder.
Bis ich fertig angezogen war und die Trainingstasche in mein Zimmer gebracht hatte, war es Viertel nach neun. Ich war spät dran.
Erst ging es durch zwei Sicherheitstüren drei Treppen abwärts. Im Waffenreinigungsraum nahm ich den Aufzug, der mich ins zwanzig Meter tiefer gelegene Untergeschoss der Academy brachte. Hier begann für mich jeden Tag von neuem der reinste Spießrutenlauf, aber an die Glotzerei hatte ich mich längst gewöhnt. Am langen Eichentisch des Konferenzraums saßen neun Kriminalbeamte, mehrere FBI-Profiler – sie erstellen Persönlichkeitsprofile von Verbrechern – und ein Spezialist des VICAP. Während das Gespräch nach einer kurzen Unterbrechung weiterlief, zog ich mir neben Marino einen Stuhl heran und setzte mich.
»Dieser Kerl kennt sich in forensischer Beweisführung verdammt gut aus.«
»Das tut jeder, der im Knast war.«
»Wichtig hierbei ist, dass er sich dabei äußerst wohlfühlt.«
»Mir drängt sich da der Gedanke auf, dass er in Wirklichkeit nie gesessen hat.«
Ich legte meine Unterlagen zu dem übrigen Fallmaterial, das im Raum die Runde machte, und flüsterte einem der Profiler zu, ich bräuchte eine Fotokopie von Emily Steiners Tagebuch.
»Also, da bin ich anderer Meinung«, sagte Marino. »Dass jemand im Knast war, bedeutet nicht, dass er Angst hat, wieder hineinzuwandern.«
»Die meisten Menschen hätten Angst davor – denken Sie an die Redensart vom gebrannten Kind, das das Feuer scheut.«
»Gault ist nicht wie die meisten Menschen. Er liebt das Feuer.«
Vor mir landete ein Stapel Laserausdrucke vom Haus der Steiners im Ranchostil. An der Rückseite im Erdgeschoss hatte der Täter ein offenes Fenster entdeckt. Durch dieses war er in eine kleine Waschküche mit weißem Linoleumfußboden und Wandfliesen in blauem Schachbrettmuster eingestiegen.
»Wenn man die unmittelbare Umgebung, die Familie und das Opfer selbst betrachtet, kommt man zu dem Schluss, dass Gault immer frecher wird.«
Mein Blick wanderte durch einen mit Teppich ausgelegten Flur ins Elternschlafzimmer. Der Raum war in Pastellfarben gehalten, mit einem Dekor aus winzigen Veilchensträußen und fliegenden Ballons. Ich zählte sechs Kissen auf dem Baldachinbett und noch ein paar mehr auf einem Schrankbord.
»Er zeigt kaum Angriffspunkte.«
Das Schlafzimmer mit der Jungmädcheneinrichtung gehörte Emilys Mutter Denesa. Nach ihrer polizeilichen Aussage war sie gegen zwei Uhr nachts mit vorgehaltener Waffe geweckt worden.
»Vielleicht macht er sich über uns lustig.«
»Das wäre nicht das erste Mal.«
Mrs. Steiner hatte den Eindringling als mittelgroß und kräftig beschrieben. Weil er Handschuhe trug, eine Maske, lange Hosen und eine Jacke, konnte sie über seine Hautfarbe nichts sagen. Er knebelte und fesselte sie mit grell orangefarbenem Gewebeband und sperrte sie in den Schrank. Dann ging er durch den Flur in Emilys Zimmer, zerrte das kleine Mädchen aus dem Bett und verschwand mit ihr in der Dunkelheit des frühen Morgen.
»Ich meine, wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr auf diesen Kerl festlegen. Auf Gault.«
»Sie haben recht. Wir müssen offen bleiben.«
Ich fragte in die Runde: »Das Bett der Mutter ist gemacht?«
Ein Kriminalbeamter mittleren Alters, der zerstreut wirkte und dessen Haut gerötet war, sagte: »Stimmt.« Dabei leuchteten seine klugen grauen Augen auf wie bei einem Insekt, während er mein aschblondes Haar, meine Lippen und das graue Tuch betrachtete, das aus dem offenen Kragen meiner grau-weiß gestreiften Bluse hervorschaute. Mit einem Blick auf meine Hände setzte er dann die Musterung fort, ließ ihn über den goldenen Intaglio-Siegelring gleiten und blieb schließlich an dem Ringfinger hängen, an dem kein Trauring steckte.
Als er bei meiner Brust angelangt war, stellte ich mich kühl und ohne eine Spur von Freundlichkeit vor. »Ich bin Dr. Scarpetta.«
»Max Ferguson, State Bureau of Investigation, Asheville.«
»Und ich bin Lieutenant Hershel Mote von der Black Mountain Police.« Ein Mann in sportlicher khakifarbener Kleidung, alt genug für die Pensionierung, beugte sich über den Tisch und streckte mir eine große, schwielige Hand entgegen. »Ist mir ein Vergnügen, Doc. Habe schon viel von Ihnen gehört.« Auch die anderen stellten sich jetzt reihum vor.
»Offensichtlich«, Ferguson wandte sich an die ganze Runde, »hatte Mrs. Steiner ihr Bett gemacht, bevor die Polizei eintraf.«
»Warum?«, wollte ich wissen.
»Vielleicht aus Schamgefühl«, bot Liz Myre, die einzige Frau unter den Profilern, als Erklärung an. »Ein Fremder war bereits in ihrem Schlafzimmer gewesen. Nun standen die Cops vor der Tür.«
»Was hatte sie an, als die Polizei eintraf?«, fragte ich.
Ferguson überflog einen Bericht. »Einen rosa Morgenmantel und dazu Socken.«
»Hatte sie das im Bett getragen?«, ertönte eine vertraute Stimme hinter mir.
Benton Wesley, Chef der Einheit des FBI, die sich um die Analyse von Gewaltverbrechen und die Erstellung von Mörderprofilen kümmerte, schloss die Tür zum Konferenzraum und sah mich kurz an. Er war hoch gewachsen und gut in Form, mit scharfen Zügen und silbergrauem Haar, trug einen dunklen Einreiher und war mit Papieren und Dia-Karussellen beladen. Keiner sagte ein Wort, als er energisch seinen Stuhl am Kopf des Tisches hervorzog und sich mit einem Montblanc-Füllfederhalter einige Notizen machte. Ohne aufzublicken, wiederholte Wesley: »Wissen wir, ob das ihre Kleidung zum Zeitpunkt des Überfalls war? Oder hat sie den Morgenmantel nach der Tat angezogen?«
»Ich würde es eher ein wallendes Gewand nennen als einen Morgenmantel«, meldete Mote sich zu Wort. »Es war aus Flanell, reichte bis zu den Knöcheln, hatte lange Ärmel und vorn einen durchgehenden Reißverschluss.«
»Drunter trug sie nur einen Slip«, warf Ferguson ein.
»Ich frage lieber nicht, woher Sie das wissen«, sagte Marino.
»Der Slip zeichnete sich ab, von einem BH aber keine Spur. Der Staat bezahlt mich dafür, dass ich genau hinsehe. Um das mal zu Protokoll zu geben«, er sah in die Runde, »die Bundesbehörde bezahlt mich nicht dafür, dass ich Mist liefere.«
»Niemand sollte Sie für Ihren Mist bezahlen, es sei denn, Sie essen vorher Gold«, sagte Marino.
Ferguson zog ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche. »Hat jemand etwas dagegen, wenn ich rauche?«
»Ich.«
»Ich auch.«
»Kay.« Wesley schob einen dicken braunen Umschlag in meine Richtung. »Der Autopsiebericht und noch ein paar Fotos.«
»Laserausdrucke?«, fragte ich. Darauf war ich nämlich gar nicht scharf, weil sie ähnlich wie grob gerasterte Bilder nur auf die Entfernung etwas brachten.
»Nein, der echte Stoff.«
»Gut.«
»Wir suchen doch nach Tätermerkmalen und -strategien, nicht?« Wesley sah in die Runde. Einige nickten. »Und wir haben einen leibhaftigen Verdächtigen. Das heißt, ich nehme an, dass wir das annehmen.«
»Für mich keine Frage«, sagte Marino.
»Erst der Tatort, dann die Viktimologie«, fuhr Wesley fort und vertiefte sich in seine Papiere. »Und am besten lassen wir die Namen von bekannten Verbrechern im Moment mal außen vor.« Er sah uns über seine Lesebrille hinweg der Reihe nach an. »Gibt es eine Karte?«
Ferguson verteilte Fotokopien. »Das Haus des Opfers und die Kirche sind markiert. Und auch der Weg, den Emily unserer Meinung nach um den See genommen hat, als sie nach der Gruppenstunde von der Kirche nach Hause ging.«
Mit ihrer kleinen, zerbrechlichen Gestalt und ihrem schmalen Gesicht hätte man Emily Steiner für acht oder neun halten können. Auf dem neuesten Klassenfoto vom vergangenen Frühjahr hatte sie einen leuchtend grünen geknöpften Pullover an. Ihr flachsblondes Haar war seitlich gescheitelt und wurde von einer Spange in Form eines Papageien gehalten.
Soweit bekannt, waren sonst keine Fotos mehr von ihr gemacht worden – bis zu jenem klaren Morgen des 7. Oktober, einem Samstag, als ein alter Mann am Lake Tomahawk angeln wollte. Als er seinen Klappstuhl auf dem feuchten Boden des Ufers aufstellte, bemerkte er eine kleine pinkfarbene Socke im nahen Gebüsch. Er sah, dass in der Socke ein Fuß steckte.
»Wir folgten diesem Weg hier«, sagte Ferguson, der jetzt Dias vorführte und mit dem Schatten seines Kugelschreibers auf die Leinwand wies, »und da fanden wir die Leiche.«
»Wie ist die Entfernung zur Kirche und zu ihrem Haus?«
»Jeweils etwa anderthalb Kilometer auf der Straße. Luftlinie etwas weniger.«
»Und der Weg am See entlang entspricht der Luftlinie?«
»Ziemlich genau.«
Ferguson fuhr fort. »Sie liegt mit dem Kopf in nördlicher Richtung. Die Socke am linken Fuß ist halb ausgezogen, die am rechten nicht. Wir haben eine Uhr gefunden und eine Halskette. Als sie entführt wurde, trug sie einen Schlafanzug aus blauem Flanell und einen Slip. Beide sind bis heute nicht gefunden worden. Hier ist eine Nahaufnahme der Schädelverletzung am Hinterkopf.«
Der Schatten des Kugelschreibers fuhr weiter. Gedämpfte Schüsse drangen durch die dicken Wände; über uns lag der Schießstand.
Emily Steiners Leiche war nackt. Nach der eingehenden Untersuchung des Leichenbeschauers von Buncombe County stand fest, dass sie sexuell missbraucht worden war. An der Innenseite der Oberschenkel hatte sie große, dunkel glänzende Flecken, im oberen Brustbereich und an den Schultern fehlten an einigen Stellen Fleischstücke. Wie ihre Mutter war sie geknebelt und mit einem grell orangefarbenen Gewebeband gefesselt gewesen. Zu ihrem Tod hatte eine einzige kleinkalibrige Kugel geführt, die in den Hinterkopf eingedrungen war.
Ferguson zeigte ein Dia nach dem anderen. Als er die Bilder vom bleichen Körper des Mädchens im Binsendickicht auf die Leinwand warf, sprach keiner ein Wort. Ich kenne nicht einen Ermittler, der sich je an den Anblick von verstümmelten und ermordeten Kindern gewöhnt hätte.
»Ist uns die Wetterlage vom 1. bis 7. Oktober in Black Mountain bekannt?«, fragte ich.
»Bedeckt. Nachts unter vier Grad, tagsüber gute zehn«, antwortete Ferguson. »Im Großen und Ganzen.«
»Im Großen und Ganzen?« Ich sah ihn an.
»Im Durchschnitt«, sagte er betont, während das Licht wieder anging. »Sie wissen ja, man addiert die Temperaturen und teilt sie durch die Zahl der Tage.«
»Gab es irgendwelche deutlichen Schwankungen, Agent Ferguson?«, fragte ich mit einem Gleichmut, der ganz und gar nicht meinem zunehmenden Missbehagen diesem Mann gegenüber entsprach. »Schon ein Tag mit ungewöhnlich hohen Temperaturen würde den Zustand der Leiche verändern.«
Wesley begann eine neue Seite auf seinem Notizblock. Er hielt inne und sah mich an.
»Dr. Scarpetta, wenn sie kurz nach ihrer Entführung ermordet wurde, wie weit wäre dann die Verwesung fortgeschritten gewesen, als man sie am 7. Oktober fand?«
»Unter den beschriebenen Bedingungen nicht weit«, sagte ich. »Zu rechnen wäre aber auch mit Insektenbefall und anderen Schädigungen post mortem, je nachdem, ob irgendwelche größeren Tiere an sie herankamen.«
»Mit anderen Worten, sie wäre in einer viel schlechteren Verfassung als dieser«, er tippte auf die Fotos, »wenn sie sechs Tage tot gewesen wäre.«
»Ja, die Verwesung wäre weiter fortgeschritten als hier.« Schweißtropfen glitzerten an Wesleys Haaransatz und bildeten feuchte Flecken am Kragen seines gestärkten weißen Hemdes. An Stirn und Hals traten deutlich die Adern hervor.
»Mich überrascht besonders, dass sie nicht von Hunden aufgespürt wurde.«
»Also, mich nicht, Max. In dieser Stadt gibt es keine räudigen Streuner. Wir halten unsere Hunde in Zwingern oder an der Leine.«
Marino gab sich wieder mal der schrecklichen Gewohnheit hin, seinen Styropor-Kaffeebecher zu zerbröseln.
Emilys Körper war so bleich, dass er fast grau wirkte, dazu kam eine grünliche Verfärbung im unteren Quadranten der rechten Gesäßhälfte. Die Fingerspitzen waren trocken, die Haut an den Nägeln wich zurück. Ihr Haar und die Haut an den Füßen zeigten Ablösungen. Nichts deutete auf eine Gegenwehr hin. Ich sah keine Abwehrverletzungen, keine Schnitte, Prellungen oder abgebrochenen Nägel, die auf einen Kampf schließen ließen.
»Die Bäume und die übrige Vegetation dürften sie vor der Sonne geschützt haben«, meinte ich düster. »Und anscheinend haben ihre Wunden nicht stark geblutet, wenn überhaupt. Andernfalls hätten sich mehr Tiere an ihr zu schaffen gemacht.«
»Wir gehen davon aus, dass sie woanders getötet wurde«, warf Wesley ein. »Kein Blut, die fehlende Kleidung, die Lage der Leiche, all das weist darauf hin, dass sie an anderer Stelle missbraucht und erschossen und dann in das Gebüsch geworfen wurde. Können Sie sagen, ob ihr die Fleischstücke post mortem herausgeschnitten wurden?«
»Zur Zeit des Todes oder kurz vorher beziehungsweise kurz nachher«, antwortete ich.
»Um wiederum Bisswunden zu verdecken?«
»Das kann ich aus dem, was mir hier vorliegt, nicht schließen.«
»Gleichen die Verletzungen Ihrer Ansicht nach denen von Eddie Heath?« Wesley meinte damit den dreizehn Jahre alten Jungen, den Temple Gault in Richmond ermordet hatte.
»Ja.« Ich öffnete einen weiteren Umschlag und zog einen Stapel von Autopsiefotos heraus. Sie waren mit Gummiringen zusammengehalten. »In beiden Fällen wurde Haut aus der Schulter und der Innenseite der Oberschenkel herausgeschnitten. Und auch Eddie Heath wurde mit einem Kopfschuss getötet, seine Leiche danach einfach irgendwohin gelegt.«
»Mir fällt auch auf, dass trotz des Geschlechtsunterschieds die Körper des Mädchens und des Jungen sich gleichen. Heath war klein und in der Vorpubertät. Emily Steiner ist sehr klein und kurz vor der Vorpubertät.«
»Auf einen Unterschied müssen wir allerdings achten«, warf ich ein. »An den Wundrändern des Mädchens finden sich weder kreuzweise noch flache Schnitte.«
»Im Fall Heath«, erklärte Marino den Beamten aus North Carolina, »nehmen wir an, dass Gault zuerst versuchte, die Bissstellen durch Wegfräsen mit einem Messer unkenntlich zu machen. Als er merkt, dass das nicht klappt, schneidet er ganze Hautstücke in der Größe meiner Hemdbrusttasche heraus. Bei dem kleinen Mädchen, das er sich dann geschnappt hat, entfernt er wahrscheinlich nur noch die Bissstellen und fertig.«
»Wissen Sie, mir ist gar nicht wohl bei dieser Vermutung. Wir können nicht einfach unterstellen, dass es Gault war.«
»Es ist kaum zwei Jahre her, Liz. Ich bezweifle, dass aus Gault ein neuer Mensch geworden ist oder er plötzlich für das Rote Kreuz arbeitet.«
»Das wissen wir nicht. Ted Bundy zum Beispiel hat sich als Sanitäter beim Rettungsdienst anstellen lassen.«
»Und der Son of Sam erhält im Knast Eingebungen vom lieben Gott.«
»David Berkowitz ist zweifellos der Letzte, mit dem Gott reden würde«, sagte Wesley kategorisch.
»Mir geht es nur darum, dass Gault – wenn er es war – diesmal die Bissstellen gleich herausgeschnitten hat.«
»Ich denke, das stimmt. Wie in allem, werden diese Kerle durch Übung immer besser.«
»Mein Gott, ich hoffe, dieser Kerl wird nirgends mehr besser.« Mote tupfte sich die Oberlippe mit einem Taschentuch ab.
»Sind wir so weit, dass wir ein Profil erstellen können?« Wesley sah in die Runde. »Würden Sie sagen, er ist weiß und männlich?«
»Es ist eine primär weiße Gegend.«
»Ganz und gar.«
»Alter?«
»Er geht logisch vor, ist also älter.«
»Einverstanden. Ich glaube nicht, dass wir es hier mit einem jugendlichen Täter zu tun haben.«
»Für mich ist er in den Zwanzigern. Vielleicht Ende zwanzig.«
»Ich neige zu Ende zwanzig bis Mitte dreißig.«
»Er geht sehr systematisch vor. Die Waffe hat er zum Beispiel selber mitgebracht und sie sich nicht am Tatort gesucht. Und es sieht nicht so aus, als sei es ihm schwergefallen, das Opfer in Schach zu halten.«
»Nach Aussage der Familienmitglieder und Freunde war es sowieso nicht schwer, Emily unter Kontrolle zu behalten. Sie war scheu, und man konnte ihr leicht Furcht einflößen.«
»Außerdem war sie oft krank und ging beim Arzt ein und aus. Sie war es gewohnt, Erwachsenen zu gehorchen. Mit anderen Worten, sie tat mehr oder weniger genau das, was man ihr sagte.«
»Nicht immer.« Wesleys Gesicht war ausdruckslos, als er die Tagebuchseiten des toten Mädchens durchging. »Sie verheimlichte ihrer Mutter, dass sie bis ein Uhr morgens mit der Taschenlampe unter der Bettdecke las. Auch hatte sie scheinbar nicht vor, ihr zu sagen, dass sie an dem Samstagnachmittag früher zu dem Treffen in der Kirche gehen wollte. Wissen wir, ob der Junge, dieser Wren, wie geplant, auch früher dort war?«
»Er tauchte erst zum Treffen um fünf Uhr auf.«
»Hatte Emily Beziehungen zu anderen Jungen?«
»Es waren die typischen Beziehungen einer Elfjährigen. Er liebt mich, er liebt mich nicht.«
»Was ist daran verkehrt?«, fragte Marino, und alle lachten.
Ich reihte die Fotos wie Tarotkarten vor mir auf, und mein Unbehagen wuchs. Die Kugel war in der rechten Scheitel-Schläfen-Region des Schädels eingetreten, hatte die Hirnhaut durchdrungen und einen Zweig der mittleren Hirnhautarterie zerrissen. Aber sie hatte keine Quetschungen, keine Blutungen über oder unter der harten Hirnhaut verursacht. Auch gab es keine vitalen Reaktionen an den Genitalien.
»Wie viele Hotels gibt es in dieser Gegend?«
»Ich glaube, etwa zehn. Dann sind da noch ein paar Bed-and-Breakfast-Häuser und einige Privatzimmer.«
»Haben Sie sich die Gästelisten angesehen?«
»Um die Wahrheit zu sagen, daran haben wir noch nicht gedacht.«
»Wenn Gault in der Stadt ist, muss er irgendwo wohnen.«
Emilys Laborergebnisse waren ebenso verblüffend: Der Natriumspiegel in der Glaskörperflüssigkeit des Auges war auf hundertachtzig gestiegen, der Kaliumgehalt lag bei achtundfünfzig Milliäquivalent pro Liter.
»Wir fangen mit dem Travel-Eze an, Max. Wenn du das übernimmst, nehme ich mir das Acorn und das Apple Blossom vor. Vielleicht auch noch das Mountaineer, obwohl das ein Stück weiter die Straße runter liegt.«
»Am wahrscheinlichsten ist, dass Gault sich ein Quartier gesucht hat, das ihm ein Höchstmaß an Anonymität garantiert. Er wird kein Interesse daran haben, dass irgendwelches Personal sein Kommen und Gehen zur Kenntnis nehmen kann.«
»Na ja, viel Auswahl hat er da nicht. So große Hotels gibt’s hier nicht.«
»Dann kommen wahrscheinlich das Red Rocker oder das Blackberry Inn nicht in Frage.«
»Kaum, aber wir überprüfen sie trotzdem.«
»Was ist mit Asheville? Da muss es doch ein paar größere Hotels geben.«
»Da drüben gibt es alles, seit für die Gäste mit der Wurst nach der Speckseite geworfen wird.«
»Glauben Sie, er hat das Mädchen mit in sein Zimmer genommen und dort umgebracht?«
»Nein. Auf keinen Fall.«
»Man kann so ein kleines Kind nicht als Geisel bei sich haben, ohne dass jemand etwas merkt. Zum Beispiel das Zimmermädchen oder der Zimmerkellner.«
»Deswegen würde es mich wundern, wenn Gault sich ein Hotelzimmer genommen hätte. Die Cops haben gleich nach Emilys Entführung mit der Fahndung begonnen. Und es kam alles in den Nachrichten.«
Die Autopsie hatte Dr. James Jenrette vorgenommen, den man als Leichenbeschauer zum Tatort gerufen hatte. Jenrette war Forensiker am Krankenhaus in Asheville und staatlich vereidigter Gerichtsmediziner für den seltenen Fall, dass in den einsamen Gebirgsausläufern des westlichen North Carolina einmal eine Autopsie vonnöten sein sollte.
Sein Schluss, dass »einige Befunde nicht durch die Schusswunde im Schädel geklärt werden konnten«, reichte mir nicht. Während Benton Wesley sich zu Wort meldete, nahm ich die Brille ab und rieb mir die Nasenwurzel.
»Gibt es hier in der Gegend Ferienhütten oder andere Anwesen, die an Touristen vermietet werden?«
»Ja, Sir«, antwortete Mote. »Jede Menge.« Er wandte sich an Ferguson. »Die sollten wir wohl auch überprüfen, Max. Besorgen Sie sich eine Liste, und schauen Sie nach, wer was gemietet hat.«
Mir wurde bewusst, dass Wesley meine besorgte Stimmung gespürt hatte, als er sagte: »Dr. Scarpetta? Sie sehen aus, als hätten Sie noch etwas hinzuzufügen.«
»Mich verblüfft das Fehlen von jeder vitalen Reaktion auf irgendeine ihrer Verletzungen«, sagte ich. »Und obwohl der Zustand ihrer Leiche darauf hindeutet, dass sie erst wenige Tage tot war, passen ihre Elektrolyten nicht zu ihrem physischen Befund …«
»Ihre was?« Motes Gesicht zeigte Verständnislosigkeit.
»Ihr Natriumspiegel ist hoch, und da der Natriumgehalt nach dem Tod recht stabil bleibt, können wir daraus schließen, dass er zur Todeszeit hoch war.«
»Was bedeutet das?«
»Es kann bedeuten, dass sie stark dehydriert war«, sagte ich. »Im Übrigen war sie für ihr Alter sowieso untergewichtig. Ist etwas über eine mögliche Essstörung bekannt? War sie krank? Litt sie unter Erbrechen? Durchfall? Hat sie entwässernde Mittel genommen?« Ich sah in die Runde.
Als niemand antwortete, sagte Ferguson: »Das erfahre ich von ihrer Mutter. Ich muss sowieso mit ihr sprechen, wenn ich zurück bin.«
»Ihre Kaliumwerte sind ebenfalls erhöht«, fuhr ich fort. »Auch dafür brauchen wir eine Erklärung, weil hier die Tatsache zu beachten ist, dass Kalium im Glaskörper des Auges nach dem Tod signifikant und voraussehbar zunimmt. Es tritt durch die Zellwände aus, die durchlässig werden.«
»Glaskörper?«, fragte Mote.
»Eine Untersuchung der Augenflüssigkeit ist sehr aussagekräftig, weil diese isoliert und geschützt ist und deswegen in geringerem Ausmaß einer Kontamination oder der Zersetzung ausgesetzt ist«, antwortete ich. »Jedenfalls weist Emilys Kaliumspiegel auf eine frühere Todeszeit hin als die anderen Befunde.«
»Wie lange läge sie danach zurück?«, fragte Wesley.
»Sechs oder sieben Tage.«
»Könnte es dafür noch andere Erklärungen geben?«
»Extreme Hitze hätte die Verwesung beschleunigt«, antwortete ich.
»Das kann es aber nicht gewesen sein.«
»Oder es liegt ein Messfehler vor«, fügte ich hinzu.
»Können Sie das herausbekommen?«
Ich nickte.
»Doc Jenrette ist der Meinung, dass die Kugel in Emilys Gehirn den sofortigen Tod bewirkt hat«, verkündete Ferguson. »Für mich klingt sofortiger Tod so, dass keine vitalen Reaktionen mehr vorhanden sind.«
»Das Problem ist«, erklärte ich, »dass ihre Gehirnverletzung nicht zwangsläufig sofort tödlich gewesen sein muss.«
»Wie lange hätte sie mit ihr überleben können?«, wollte Mote wissen.
»Stunden«, gab ich zurück.
»Andere Möglichkeiten?«, fragte Wesley.
»Commotio cerebri, also Gehirnerschütterung. Sie gleicht einem elektrischen Kurzschluss – man bekommt einen Schlag auf den Kopf, der Tod tritt im selben Moment ein, und es ist keine ursächliche Verletzung festzustellen, wenn überhaupt eine.« Ich machte eine Pause. »Es wäre auch möglich, dass dem Opfer alle Verletzungen post mortem zugefügt wurden, auch die Schusswunde.«
Das mussten alle Anwesenden erst einmal verdauen.
Marinos Kaffeebecher war mittlerweile zu einem kleinen Styroporhaufen geworden, sein Aschenbecher angefüllt mit zerfetzten Kaugummipapierchen.
»Gibt es vielleicht Hinweise darauf, dass sie zuerst erstickt wurde?«, fragte er.
Ich verneinte.
Er begann mit seinem Kugelschreiber herumzuknipsen.
»Reden wir noch einmal von ihrer Familie. Was wissen wir von ihrem Vater, außer dass er verstorben ist?«
»Er war Lehrer an der Broad River Christian Academy in Swannanoa.«
»Ging Emily auch dort zur Schule?«
»Nein. Sie besuchte die öffentliche Grundschule in Black Mountain. Ihr Daddy ist vor ungefähr einem Jahr gestorben«, fügte Mote hinzu.
»Das steht in meinen Unterlagen«, sagte ich. »Er hieß mit Vornamen Charles?«
Mote nickte.
»Woran ist er gestorben?«, fragte ich.
»Das weiß ich nicht genau. Aber es war eine natürliche Todesursache.«
»Er hatte ein Herzleiden«, ergänzte Ferguson.
Wesley stand auf und ging an die weiße Schreibtafel.
»Okay.« Er nahm einen schwarzen Marker und fing an zu schreiben. »Fassen wir die Details zusammen. Opfer stammt aus Mittelklassefamilie, weiß, elf Jahre alt, zuletzt von ihren Freunden gesehen am 1. Oktober gegen sechs Uhr abends, als sie sich allein nach einem Treffen in der Kirche auf den Heimweg machte. Sie nahm diesmal eine Abkürzung am Lake Tomahawk entlang, einem kleinen künstlichen See.
Sehen Sie bitte einmal auf die Karte in Ihren Unterlagen. Am nördlichen Ende des Sees finden Sie ein Clubhaus und einen öffentlichen Pool. Beide sind nur in den Sommermonaten geöffnet. Weiter drüben sind Tennisplätze und ein Picknickplatz. Die können das ganze Jahr über benutzt werden. Nach Aussage der Mutter kam Emily um kurz nach halb sieben zu Hause an. Sie ging direkt in ihr Zimmer und übte bis zum Abendessen Gitarre.«
»Hat Mrs. Steiner gesagt, was Emily an jenem Abend gegessen hat?«, fragte ich in die Runde.
»Makkaroni mit Käse und Salat«, sagte Ferguson.
»Wann war das?« Nach dem Autopsiebericht bestand Emilys Mageninhalt lediglich aus einer geringen Menge bräunlicher Flüssigkeit.
»Gegen halb acht, hat sie gesagt.«
»Wäre das um zwei Uhr morgens, zum Zeitpunkt ihrer Entführung, verdaut gewesen?«
»Ja«, sagte ich. »Ihr Magen wäre schon einige Zeit vorher leer gewesen.«
»Es könnte sein, dass sie während ihrer Gefangenschaft nur wenig Nahrung und Wasser bekommen hat.«
»Was möglicherweise zur Dehydrierung und zu dem hohen Natriumgehalt geführt hat?«, fragte mich Wesley.
»Durchaus möglich.«
Er notierte etwas. »Das Haus besitzt keine Alarmanlage, und es gibt auch keinen Hund.«
»Ist bekannt, ob etwas gestohlen wurde?«
»Vielleicht ein paar Kleidungsstücke.«
»Von wem?«
»Möglicherweise von der Mutter. Als sie gefesselt im Schrank steckte, glaubt sie gehört zu haben, wie er Schubladen öffnete.«
»Wenn das zutrifft, war er sehr ordentlich. Sie sagt nämlich auch, dass sie nicht weiß, ob etwas fehlt oder nur verlegt wurde.«
»Welches Fach hat eigentlich der Vater unterrichtet? Wissen wir das?«
»Religion.«
»Die Broad River gehört zu den Lehrstätten, an denen der Fundamentalismus regiert. Die Kinder beginnen den Tag mit frommen Liedern gegen Sünde und Versuchung.«
»Im Ernst?«
»So wahr mir …«
»Mein Gott.«
»Ja, über ihn reden sie auch den ganzen Tag.«
»Vielleicht könnten sie sich mal meines Enkels annehmen.«
»Blödsinn, Hershel, für Ihren Enkel kann keiner was tun, weil Sie ihn bis zum Gehtnichtmehr verwöhnen. Wie viele Kinderfahrräder hat er jetzt? Drei?«
»Ich wüsste gern mehr über Emilys Familie«, meldete ich mich wieder zu Wort. »Sie ist also religiös.«
»Sogar sehr.«
»Weitere Geschwister?«
Lieutenant Mote holte schwer und tief Luft. »Da wird es wirklich traurig. Vor ein paar Jahren hatten sie ein Baby, das an plötzlichem Kindstod gestorben ist.«
»War das auch in Black Mountain?«, fragte ich.
»Nein, Ma’am. Das war, bevor die Steiners hierherzogen. Sie sind aus Kalifornien. Zu uns kommen ja Leute von überall her.«
»Viele Fremde kommen zu uns in die Berge, um sich zur Ruhe zu setzen«, ergänzte Ferguson. »Oder sie machen Ferien, besuchen religiöse Veranstaltungen. Mein Gott, wenn ich für jeden Baptisten einen Nickel kriegte, säße ich nicht hier.«
Ich sah Marino an. Er war knallrot angelaufen, die Wut stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Genau die Gegend, in der ein Gault untertauchen kann. Diese Leute lesen all die groß aufgemachten Geschichten über diesen Hurensohn in Zeitschriften wie People, The National Enquirer oder Parade. Aber es kommt ihnen nicht in den Sinn, dass solch ein Wolf im Schafspelz auch ganz in ihrer Nähe sein könnte. Für sie ist er Frankenstein. Er existiert in Wirklichkeit gar nicht.«
»Nicht zu vergessen, dass man auch einen TV-Film über ihn gedreht hat«, meldete sich Mote wieder zu Wort.
»Wann war das?«, fragte Ferguson finster.
»Letzten Sommer, hat Captain Marino mir gesagt. Der Name des Schauspielers fällt mir nicht ein, aber er hat in vielen von diesen Terminator-Filmen gespielt. Stimmt’s?«
Marino reagierte nicht. In Gedanken brauste er schon mit einem imaginären Polizeiaufgebot durch die Gegend. »Meiner Meinung nach ist der Hurensohn noch hier.« Er schob seinen Stuhl zurück und warf wieder ein Häufchen zerkleinertes Einwickelpapier in den Aschenbecher.
»Möglich ist alles«, sagte Wesley nüchtern.
»Also dann.« Mote räusperte sich. »Wir begrüßen nachdrücklich jede mögliche Hilfestellung von euch, Jungs.«
Wesley sah auf die Uhr. »Pete, machen Sie noch einmal das Licht aus? Wir sollten jetzt die früheren Fälle durchgehen und unseren beiden Besuchern aus North Carolina zeigen, wie Gault seine Zeit in Virginia verbracht hat.«
Während der nächsten Stunden blitzten Horrorbilder durch die Dunkelheit – unzusammenhängende Szenen wie aus meinen allerschlimmsten Träumen. Ferguson und Mote wandten ihre weit aufgerissenen Augen keinen Moment von der Leinwand ab. Sie sagten kein Wort. Ich sah sie nicht einmal blinzeln.
2
Vor den Fenstern des Boardroom sonnten sich pummelige Murmeltiere im Gras, während ich meinen Salat aß und Marino die letzten Reste seines »Chicken Special« auf dem Teller zusammenkratzte.
Der Himmel war blassblau, und den Bäumen sah man schon an, wie flammend rot sie leuchten würden, wenn der Herbst seinen Höhepunkt erreichte.
In gewisser Weise beneidete ich Marino. Was ihm in dieser Woche hier körperlich abverlangt würde, schien mir fast eine Erholung, verglichen mit dem, was mich erwartete und drohend wie ein unersättlicher Raubvogel über mir schwebte.
»Lucy hofft, dass Sie Zeit für ein paar Schießübungen mit ihr haben, solange Sie hier sind«, sagte ich.
»Hängt davon ab, ob sich ihre Manieren gebessert haben.« Marino schob sein Tablett beiseite.
»Komisch, das Gleiche sagt sie immer von Ihnen.«
Er klopfte eine Zigarette aus dem Päckchen. »Was dagegen?«
»Und wenn schon. Sie rauchen ja trotzdem.«
»Sie trauen einem Kollegen nie was Positives zu, Doc.« Die Zigarette wippte beim Sprechen zwischen seinen Lippen. »Ich habe ja wenigstens schon reduziert.« Er betätigte sein Feuerzeug. »Geben Sie zu, Sie denken jede Minute ans Rauchen.«
»Stimmt. Es vergeht keine Minute, in der ich mich nicht frage, wie ich so etwas Unerfreuliches und Unsoziales nur habe tun können.«
»Quatsch. Sie vermissen es höllisch. In diesem Augenblick wären Sie zu gern an meiner Stelle.« Er blies eine Rauchwolke aus und sah aus dem Fenster. »Eines Tages wird der ganze Laden hier wegen dieser rammelnden Murmeltiere einfach wegsacken.«
»Was hat Gault in den Westen von North Carolina getrieben?«, fragte ich.
»Was, zum Teufel, treibt ihn überhaupt irgendwohin?« Marinos Blick wurde hart. »Jede Frage, die man sich über diesen Dreckskerl auch stellen mag, hat immer die gleiche Antwort. Weil er Lust dazu hatte. Und das Steiner-Mädchen wird nicht die Letzte gewesen sein. Irgendein anderes kleines Kind – eine Frau, ein Mann, zum Teufel, ganz egal – wird zur falschen Zeit am falschen Ort sein, wenn es Gault wieder juckt.«
»Und Sie glauben wirklich, er ist noch da?«
Er klopfte die Asche ab. »Ja, das glaube ich wirklich.«
»Wieso?«
»Weil der Spaß erst begonnen hat«, sagte er. In diesem Moment kam Benton Wesley durch die Tür. »Verdammt noch mal, für Gault ist das die großartigste Schau aller Zeiten – er sitzt gemütlich zurückgelehnt da und lacht sich einen Ast, während die Cops aus Black Mountain im Kreis herumrennen und nicht wissen, was, zum Teufel, sie machen sollen. Nebenbei bemerkt, mit Mord haben die höchstens einmal pro Jahr zu tun.«
Ich sah Wesley nach, wie er auf die Salatbar zusteuerte und sich einen Teller zusammenstellte. Schließlich schöpfte er Suppe in eine Schüssel, legte ein paar Cracker auf sein Tablett und warf mehrere Dollar auf einen Pappteller, der bereitstand, wenn die Kasse nicht besetzt war. Er ließ sich nicht anmerken, ob er uns gesehen hatte, aber ich kannte seine Fähigkeit, selbst kleinste Einzelheiten seiner Umgebung wahrzunehmen und dabei auszusehen, als bewege er sich inmitten einer Nebelbank.
»Bei einigen Befunden stelle ich mir die Frage, ob Emily Steiners Leiche nicht eine Zeit lang gekühlt worden ist«, sagte ich zu Marino, während Wesley auf uns zusteuerte. »War sie. Ganz bestimmt sogar. In der Leichenhalle des Krankenhauses.« Marino sah mich schief an.
»Hört sich an, als hätte ich etwas Wichtiges verpasst«, sagte Wesley, zog einen Stuhl hervor und setzte sich.
»Ich denke darüber nach, ob Emily Steiners Leiche gekühlt worden war, bevor sie zum See gebracht wurde«, sagte ich.
»Woraus folgern Sie das?« Ein goldener Manschettenknopf mit dem Department-of-Justice-Wappen schaute aus Wesleys Jackenärmel hervor, als er nach dem Pfefferstreuer griff.
»Ihre Haut war teigig und trocken«, antwortete ich. »Sie war gut erhalten und praktisch ohne Spuren von Insekten oder anderen Tieren.«
»Das schließt die Möglichkeit, dass Gault sich in so einer Touristenfalle von Motel aufgehalten hat, weitgehend aus«, sagte Marino. »Er wird die Leiche wohl kaum in seine Minibar gestopft haben.«
Wesley führte jeden Löffel seiner Muschelsuppe formvollendet und mit exakten Bewegungen zum Mund, ohne einen Tropfen zu verschütten.
»Was hat die Spurensicherung gefunden?«, fragte ich.
»Ihren Schmuck und ihre Socken«, antwortete Wesley. »Und das Gewebeband, das leider entfernt wurde, bevor es auf Fingerabdrücke überprüft worden war. Man hat es im Leichenschauhaus sauber abgeschnitten.«
»Mist«, murmelte Marino.
»Aber das Band ist so ungewöhnlich, dass es noch etwas hergeben könnte. Ich glaube nicht, jemals solch ein grell orangefarbenes Gewebeband gesehen zu haben.« Er sah mich an.
»Ich sicher auch nicht«, sagte ich. »Weiß Ihr Labor schon Näheres darüber?«
»Noch nicht, bis auf die Fettspuren, die darauf hinweisen, dass die Rolle, von der das Band stammt, an den Rändern eingefettet war, wozu auch immer das gut sein mag.«
»Was hat das Labor sonst noch?«, fragte ich.
»Wattetupfer. Erde, auf der ihr Körper lag. Das Laken und den Sack, mit denen sie vom See wegtransportiert wurde«, sagte Wesley.
Mein Frust nahm mit jedem seiner Worte zu. Was war übersehen worden? Welche mikroskopisch kleinen Beweisstücke mochten für immer vernichtet sein? »Ich hätte gern Abzüge der Fotos von der Leiche und Kopien der Berichte und Laborergebnisse, sowie sie eintreffen«, sagte ich.
»Was wir erhalten, geht an Sie weiter«, antwortete Wesley. »Das Labor setzt sich direkt mit Ihnen in Verbindung.«
»Wir brauchen die genaue Todeszeit«, sagte Marino. »Es passt alles nicht zusammen.«
»Die Klärung dieses Punktes ist äußerst wichtig«, pflichtete ihm Wesley bei. »Könnten Sie dem noch nachgehen?«
»Ich werde tun, was ich kann«, sagte ich.
»Ich müsste längst in Hogan’s Alley sein.« Marino stand vom Tisch auf und sah auf die Uhr. »Ich fürchte, sie haben schon ohne mich angefangen.«
»Ich hoffe aber, du ziehst dich noch um«, sagte Wesley zu ihm. »Sweatshirt mit Kapuze.«
»Oje. Dann trifft mich der Hitzschlag.«
»Besser, von dem umgehauen zu werden, als von einem Neun-Millimeter-Farbgeschoss«, sagte Wesley. »Das tut höllisch weh.«
»Aber sonst habt ihr keine Probleme, oder?«
Wir sahen ihm nach. Er knöpfte den Blazer über dem dicken Bauch zu, strich sich das dünne Haar glatt und zog im Gehen die Hose zurecht. Beim Betreten oder Verlassen eines Raumes wirkte Marino immer ein wenig verlegen, wie eine Katze, die sich zuerst rasch noch ein wenig putzt.
Wesley starrte auf den schmutzigen Aschenbecher an Marinos Platz. Dann sah er mich an. Seine Augen erschienen mir ungewohnt dunkel, und sein Mund sah aus, als habe er noch nie gelächelt.
»Sie müssen sich um ihn kümmern«, sagte er.
»Ich wünschte, ich könnte das, Benton.«
»Nur Sie kommen nahe genug an ihn heran, um etwas ausrichten zu können.«
»Das ist beängstigend.«
»Beängstigend ist der rote Kopf, den er während unserer Besprechung bekam. Er verhält sich in keinem Punkt vernünftig. Fette, gebratene Speisen, Zigaretten, Schnaps.« Wesley sah zur Seite. »Seit Doris ihn verlassen hat, geht es mit ihm bergab.«
»In einigem hat er sich gebessert«, sagte ich.
»Kurzlebige Fortschritte.« Er sah mich wieder an. »Im Grunde bringt er sich nach und nach um.«
Eigentlich hatte Marino das sein ganzes Leben lang getan. Und ich wusste nicht, was man dagegen machen konnte.
»Wann fahren Sie zurück nach Richmond?«, erkundigte sich Wesley, und ich fragte mich, was wohl in seinen eigenen vier Wänden vor sich ging und was mit seiner Frau war.
»Das ist noch nicht sicher«, antwortete ich. »Ich hatte gehofft, ein bisschen Zeit mit Lucy verbringen zu können.«
»Hat sie Ihnen gesagt, dass wir sie wiederhaben wollen?«
Ich sah hinaus auf den sonnenbeschienenen Rasen und die Blätter, die im Wind raschelten. »Sie ist ganz begeistert«, sagte ich.
»Aber Sie nicht.«
»Nein.«
»Ich verstehe, Kay. Sie wollen nicht, dass Lucy teilhat an Ihrer beruflichen Wirklichkeit.« Fast unmerklich bekam er einen weicheren Gesichtsausdruck. »Ich sollte erleichtert sein, dass Sie zumindest auf einem Gebiet weder ganz rational noch objektiv sind.«
Ich war auf mehr als einem Gebiet weder ganz rational noch objektiv, und das wusste Wesley nur zu gut.
»Ich weiß nicht einmal genau, was sie da drüben tut«, sagte ich. »Was hätten Sie für ein Gefühl, wenn es eines Ihrer Kinder wäre?«
»Das, was ich immer fühle, wenn es um meine Kinder geht. Ich möchte sie nicht im Polizeidienst sehen und auch nicht beim Militär. Ich möchte nicht, dass sie mit Waffen umgehen können. Und doch möchte ich, dass sie an all diesen Dingen teilhaben.«
»Weil Sie wissen, was in unserer Welt los ist«, sagte ich. Und mein Blick traf den seinen erneut und blieb länger auf ihm ruhen, als es hätte sein sollen.
Er zerknüllte seine Serviette und legte sie auf das Tablett. »Lucy liebt das, was sie tut. Und wir auch.«
»Das höre ich gern.«
»Sie ist außerordentlich gut. Die Software, die sie mit uns zusammen für das VICAP entwickelt, wird alles verändern. Es wird gar nicht mehr so lange dauern, bis wir so weit sind, diese Tiere in Menschengestalt über den ganzen Globus zu verfolgen. Stellen Sie sich mal vor, Gault hätte die kleine Steiner in Australien umgebracht. Glauben Sie, wir wüssten darüber Bescheid?«
»Eher nicht«, sagte ich. »Jedenfalls nicht so bald. Doch wir wissen ja nicht einmal, ob Gault sie getötet hat.«
»Aber mit Sicherheit wissen wir, dass es mehr Opfer geben wird, je länger wir brauchen.« Er griff nach meinem Tablett und stapelte es auf seines.
Wir standen auf.
»Wir sollten mal bei Ihrer Nichte vorbeischauen«, sagte er.
»Ich denke, ich habe da keinen Zutritt.«
»Stimmt. Geben Sie mir ein bisschen Zeit, dann bringe ich das in Ordnung.«
»Ich würde mich sehr darüber freuen.«
»Mal sehen. Jetzt ist es ein Uhr. Treffen wir uns um halb fünf wieder hier?« Wir verließen den Boardroom.
»Übrigens, wie kommt Lucy in Washington zurecht?« Er meinte damit das kümmerliche Studentenwohnheim mit seinen winzigen Betten und den Handtüchern, die zu klein waren, um auch nur das Nötigste zu bedecken. »Es tut mir leid, dass wir ihr dort nichts mit einer privateren Atmosphäre bieten konnten.«
»Macht nichts. Mit Zimmer- und Flurgenossinnen zusammenzuwohnen tut ihr gut, wenn sie auch nicht besonders gut mit ihnen auskommt.«
»Begabte Menschen kommen in Arbeit und Freizeit nicht immer gut mit anderen aus.«
»Das einzige Fach, in dem sie immer durchgefallen ist«, sagte ich.
Die nächsten Stunden verbrachte ich am Telefon und versuchte erfolglos, Dr. Jenrette zu erreichen. Offenbar hatte er sich einen Tag freigenommen und war auf dem Golfplatz.
In meinem Büro in Richmond lief erfreulicherweise alles glatt. Die eingegangenen Fälle erforderten bislang nur äußerliche Untersuchungen und Körperflüssigkeitsanalysen. Gott sei Dank war in der Nacht zuvor kein Mord passiert, und für meine beiden noch anstehenden Gerichtsverhandlungen in dieser Woche war alles vorbereitet.
Ich traf mich mit Wesley wie vereinbart. »Stecken Sie das an.« Er reichte mir einen speziellen Gästepass, den ich neben mein Namensschild ans Jackenrevers klemmte.
»Keine Probleme?«, fragte ich.
»Einigen Aufwand hat es gekostet, aber ich habe es geschafft.«
»Ich bin erleichtert, den Sicherheitscheck bestanden zu haben«, sagte ich ironisch.
»Aber nur knapp.«
»Besten Dank.«
Er schwieg und berührte leicht meinen Rücken, als ich vor ihm durch eine Tür ging.
»Kay, ich muss Ihnen ja nicht sagen, dass nichts von dem, was Sie in der ERF hören oder sehen, nach draußen dringen darf.«
»Ganz richtig, Benton. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen.«
Der Einkaufsbereich vor dem Boardroom wimmelte von Studenten der National Academy in roten Hemden, die sich Auslagen mit allen nur erdenklichen Dingen ansahen, auf denen das Etikett »FBI« prangte. Auf den Treppen begegneten wir gut durchtrainierten Männern und Frauen, die höflich grüßend in ihre Klassen eilten. Was sie anhatten, war farblich genau reglementiert. Nicht ein einziges blaues Hemd war zu sehen, denn seit über einem Jahr hatte es keine neuen Ausbildungsklassen für Agenten mehr gegeben.
Wir gingen durch einen langen Korridor zur Lobby. Hier machte eine Laufschrift über dem Empfang die Gäste darauf aufmerksam, dass ihre Pässe gut erkennbar zu tragen seien. Aus der Ferne rundeten Gewehrschüsse den gelungenen Nachmittag ab.
Die Engineering Research Facility bestand aus drei beigefarbenen Klötzen aus Glas und Beton mit breiten Einfahrtstoren und hohen Maschendrahtzäunen. Die Reihen geparkter Wagen zeugten von der Anwesenheit von Menschen, die ich sonst nie zu Gesicht bekam; die ERF schien ihre Angestellten zu Zeiten zu verschlingen und wieder auszuspeien, in denen wir anderen es nicht bemerkten.
An der Wand neben der Eingangstür blieb Wesley vor einem Modul mit Zahlentastatur und Lesegerät stehen. Er hielt seinen rechten Daumen auf den Scanner. Gleichzeitig forderte ihn ein Display auf, seine persönliche Kennzahl einzugeben. Die biometrische Sperre sprang mit leisem Klicken auf.
»Offensichtlich waren Sie schon mal hier«, bemerkte ich, während er mir die Tür aufhielt.
»Oft genug«, sagte er.
Die Frage war nur, was für besondere Aufträge ihn gerade hierherführten. Wir gingen durch einen Flur mit gedämpftem Licht und einem beigefarbenen Teppichboden, der jedes Geräusch schluckte. Der Gang war doppelt so lang wie ein Football-Feld. Wir kamen an Labors vorbei, wo Wissenschaftler in dunklen Anzügen und Laborkitteln eifrig mit irgendwelchen mysteriösen Dingen beschäftigt waren, die ich auf den ersten Blick auch nicht annähernd hätte einordnen können. Die Männer und Frauen arbeiteten in gläsernen Abteilen an Arbeitstischen, die mit Werkzeug, elektronischen Geräten, Monitoren und mir unbekannten sonstigen Apparaten übersät waren. Hinter einer fensterlosen Doppeltür fraß sich eine Kreissäge durch Holz.
An einem Aufzug wurde erneut Wesleys Daumenabdruck geprüft, bevor wir in die vergeistigte Stille eintreten konnten, in der Lucy ihre Tage verbrachte. Im Wesentlichen glich der erste Stock einer klimatisierten Hirnschale, die ein künstliches Gehirn umschließt. Wände und Teppichboden waren mattgrau, der exakt aufgeteilte Raum erinnerte an einen gläsernen Eiswürfelbehälter. Jede Kabine enthielt zwei Schreibtische aus einem Anbauprogramm mit schnittigen Computern, Laserdruckern und Stapeln von Papieren. Lucy war leicht zu finden. Sie trug als Einzige einen FBI-Overall.
Sie saß mit dem Rücken zu uns und telefonierte über einen Kopfhörer mit Mikrophon. Eine Hand glitt mit einem Stift über ein CAD-Zeichenbrett, die andere tippte etwas auf der Tastatur. Hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich gedacht, sie komponiere.
»Nein, nein«, sagte sie, »ein langer Pfeifton, gefolgt von zwei kurzen, bedeutet wahrscheinlich eine Störung im Monitor oder in der Hauptplatine.«
Als sie uns aus dem Augenwinkel sah, schwang sie mit dem Stuhl herum.
»Ja, es ist ein großer Unterschied zu einem einzelnen kurzen Piepton«, erklärte sie der Person am anderen Ende der Leitung. »Hier handelt es sich um ein Problem in einem System-Board. Hör mal, Dave, kann ich dich zurückrufen?« Halb unter Papieren begraben, bemerkte ich auf ihrem Schreibtisch einen biometrischen Scanner. Auf dem Boden und auf einem Regalbrett häuften sich ehrfurchtgebietende Programmierhandbücher, Schachteln voller Disketten und Tonkassetten, Stapel von Computer- und Softwaremagazinen und eine Reihe blassblau gebundener Publikationen mit dem Department-of-Justice-Wappen.
»Ich dachte, ich zeige Ihrer Tante mal, was Sie so treiben«, sagte Wesley.
Lucy zog das Headset vom Kopf. Ob sie sich freute, uns zu sehen, konnte ich nicht erkennen.
»Im Moment stecke ich bis über die Ohren in Problemen«, sagte sie. »Ein paar unserer 486er-Rechner melden error.« Als Erklärung für mich fügte sie hinzu: »Mithilfe unserer PCs entwickeln wir das Crime Artificial Intelligence Network, kurz CAIN genannt.«
»CAIN?«, fragte ich verwundert. »Als Akronym für ein System zur Verfolgung von Gewaltverbrechern klingt das aber reichlich ironisch.«
»Man könnte es vielleicht als Akt tätiger Reue im Hinblick auf den ersten Mörder der Menschheitsgeschichte bezeichnen«, sagte Wesley. »Oder man hat die Bezeichnung gewählt, weil sie einfach leicht zu behalten ist.«
»Grundsätzlich soll CAIN zu einem vollautomatischen System werden, das die reale Welt möglichst weitgehend nachzeichnet«, fuhr Lucy fort.
»Mit anderen Worten«, sagte ich, »es soll denken und handeln wie wir.«
»Genau.« Sie fing wieder an zu tippen. »Hier haben wir die Verbrechensanalyse, wie du sie kennst.«
Auf dem Monitor erschienen die Fragen des mir wohlbekannten Fünfzehn-Seiten-Formulars, das ich seit Jahren ausfüllte, wenn eine nicht identifizierte Leiche auftauchte oder das Opfer eines Verbrechers, der als Wiederholungstäter in Frage kam.
»Wir haben es ein bisschen komprimiert.« Lucy holte weitere Seiten auf den Bildschirm.
»Das Formular selbst ist nie ein Problem gewesen«, bemerkte ich. »Das Problem liegt eher darin, den Ermittler dazu zu kriegen, das verdammte Ding auszufüllen und weiterzuschicken.«
»Jetzt hat er die Wahl«, sagte Wesley. »Er kann sich entweder ein einfaches Terminal ins Revier stellen, sich davorsetzen und das Formular online ausfüllen. Oder er kann, sollte er der Maschine nicht trauen, echtes Papier benutzen – einen Ausdruck oder das Originalformular, das dann wie gewohnt verschickt oder gefaxt wird.«