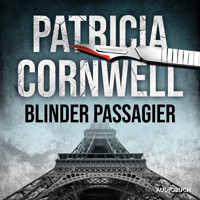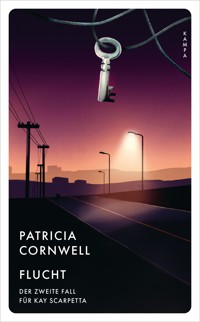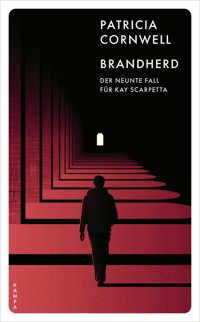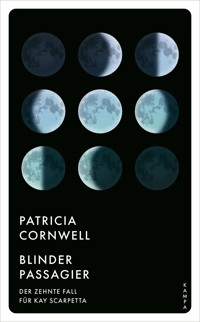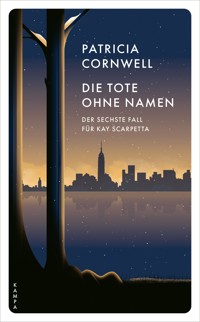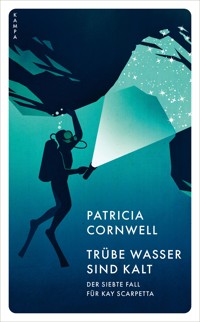Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
1888 ermordete Jack the Ripper im Londoner Stadtteil Whitechapel mindestens fünf Frauen, allesamt Prostituierte aus ärmlichen Verhältnissen. Den Opfern wurden die Bauchdecken aufgeschlitzt, sie wurden ausgeweidet, die Organe teils mitgenommen. Seine Brutalität versetzte nicht nur das Viktorianische England in Angst und Schrecken – bis heute gibt der Fall Anlass zu Spekulationen und beschäftigt Wissenschaftler*innen und Verschwörungstheoretiker*innen gleichermaßen: War der Serienmörder ein Angehöriger des Königshauses? Ein Barbier, ein Arzt oder gar eine Frau? Auch die renommierte Thrillerautorin Patricia Cornwell hat einen Verdacht: Könnte es sich bei dem Mörder um den exzentrischen deutsch-britischen Maler Walter Sickert gehandelt haben? Die ehemalige Forensikerin beleuchtet die Indizien von damals und bedient sich dabei den Methoden moderner Kriminologie. Sie vergleicht die Handschrift des Künstlers mit den berüchtigten Briefen, die der Whitechapel Mörder seinerzeit an die Polizei schickte, analysiert die blutigen Motive seiner Gemälde, beleuchtet seinen familiären Hintergrund, spricht mit Expert*innen und skizziert so ein Persönlichkeitsprofil des mutmaßlichen Täters.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patricia Cornwell
Jack the Ripper
Fall gelöst
Kampa
Für John Grieve von Scotland Yard
Sie hätten ihn geschnappt.
Allgemeine Panik griff um sich, und viele Menschen von leicht erregbarem Temperament erklärten, der Böse sei auf die Erde zurückgekehrt.
H.M., anonymer Missionar aus dem East End, 1888
1Mr. Nemo
Montag, der 6. August 1888, war ein Feiertag in London,und die Stadt verwandelte sich in einen Jahrmarkt voll wunderbarer Dinge, die sich für ein paar Pennys tun ließen, falls man sie erübrigen konnte. In Windsor läuteten den ganzen Tag hindurch die Glocken der Pfarrkirche und der St. George’s Chapel. Auf den Schiffen wurden Flaggen gehisst, und aus den Kanonen dröhnte der königliche Salut zu Ehren des Duke of Edinburgh, der seinen vierundvierzigsten Geburtstag feierte.
Der Kristallpalast bot eine überwältigende Fülle von Veranstaltungen: Orgelkonzerte, Militärkapellen, ein »monumentales Feuerwerk«, ein großes Märchenballett, Bauchredner und die »weltberühmten Minstrel-Shows«. Madame Tussaud’s präsentierte ein Wachsmodell von der öffentlichen Aufbahrung Friedrichs III. und natürlich die Schreckenskammer, die so beliebt war wie eh und je. Andere köstliche Schrecken warteten auf all jene, die sich Theaterkarten leisten konnten und denen der Sinn nach einer Moralität oder einfach einem schönen altmodischen Schauerstück stand. Dr. Jekyll und Mr. Hyde wurde vor ausverkauften Häusern gespielt. In Henry Irvings Lyceum brillierte der berühmte amerikanische Schauspieler Richard Mansfield als Jekyll und Hyde. Auch die Opéra Comique brachte eine Version dieses Stoffes, allerdings mit schlechten Kritiken und skandalumwittert, weil das Theater Robert Louis Stevensons Roman ohne Genehmigung für die Bühne bearbeitet hatte.
An diesem öffentlichen Feiertag gab es Rinder- und Pferdeschauen, »Sondertarife« für Bahnfahrten und auf den Basaren in Covent Garden ein Überangebot an Bestecken aus Sheffield, an Gold, Juwelen und gebrauchten Militäruniformen. Wer in diesem ausgelassenen, aber auch recht rohen Treiben als Soldat auftreten wollte, konnte das für wenig Geld und ohne lästige Fragen tun. Oder man konnte sich als Polyp ausgeben, indem man sich eine echte Polizeiuniform bei Angel’s Theatrical Costumes in Camden Town auslieh – von der Wohnung des blendend aussehenden Walter Richard Sickert ein Spaziergang von nicht viel mehr als drei Kilometern.
Der 28-jährige Sickert hatte seine glücklose Laufbahn als Schauspieler aufgegeben, weil er sich zu den höheren Weihen der Kunst berufen fühlte. Er war Maler und Kupferstecher geworden, der sein Handwerk bei James McNeill Whistler und Edgar Degas gelernt hatte. Dabei war der jugendliche Sickert selbst ein Kunstwerk: schlank, mit einem vom Schwimmen gekräftigten Oberkörper, Nase und Kinn von vollkommener Form, dichte blonde Locken und blaue Augen, die so unergründlich und so durchdringend waren wie seine geheimen Gedanken und sein rascher Verstand. Man hätte ihn sogar schön nennen können, wäre da nicht sein Mund gewesen, der sich zu einem harten, grausam wirkenden Strich zusammenziehen konnte. Seine exakte Größe ist unbekannt, aber von einem Bekannten wurde sie als etwas über dem Durchschnitt beschrieben. Fotografien und mehrere Kleidungsstücke aus seinem Besitz, die in den 1980er-Jahren dem Archiv der Tate Gallery gestiftet wurden, lassen darauf schließen, dass er wahrscheinlich zwischen einem Meter siebzig und einem Meter fünfundsiebzig maß.
Sickert sprach fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch, Latein beherrschte er hinreichend, um es Freunden beizubringen, er konnte etwas Dänisch und chisch und möglicherweise auch ein paar Brocken Spanisch und Portugiesisch. Es hieß, er lese die Klassiker im Original, aber beende nicht alle Bücher, die er angefangen habe. Nicht selten lagen Dutzende von Romanen bei ihm herum, aufgeschlagen auf der letzten Seite, die seine Neugier gefesselt hatte. Geradezu süchtig war Sickert aber nach Zeitungen, Klatschblättern und Zeitschriften.
Bis zu seinem Tod im Jahr 1942 sahen seine Ateliers und Arbeitszimmer aus wie Recyclingcenter für jeden Fetzen Zeitungs- und Zeitschriftenpapier, den Europas Druckerpressen ausgespuckt hatten. Man fragt sich, woher ein viel beschäftigter Mensch die Zeit nahm, vier, fünf, sechs, zehn Zeitungen pro Tag zu lesen, aber Sickert hatte seine Methode. Er kümmerte sich um nichts, was ihn nicht interessierte – egal, ob es um Politik, Wirtschaft, Kriege oder Menschen ging. Nichts spielte für Sickert eine Rolle, wenn es nicht in irgendeiner Weise Sickert betraf.
Mit Vorliebe las er über die neuesten Vergnügungen, die in der Stadt zu erwarten waren, studierte gründlich die Kunstkritiken, wandte sich dann rasch den Kriminalberichten zu und suchte schließlich nach seinem Namen, falls Grund zu der Annahme bestand, dass er in den Blättern auftauchte. Leserbriefe bereiteten ihm ein besonderes Vergnügen, vor allem diejenigen, die er selbst geschrieben und mit einem Pseudonym unterzeichnet hatte. Sickert wusste gar zu gern, was die Leute taten, vor allem in der Privatsphäre ihres durchaus nicht immer so wohlanständigen viktorianischen Lebensalltags. »Schreibt, schreibt, schreibt!«, pflegte er seine Freunde zu bitten. »Berichtet mir in allen Einzelheiten von allem, von den Dingen, die euch amüsiert haben, wie, wann und wo das war, von allem möglichen Klatsch, egal über wen.«
Sickert verachtete die Upperclass, aber er war ein Prominentenjäger. Irgendwie gelang es ihm, sich im Umkreis der Berühmtheiten seiner Zeit zu bewegen: Henry Irving, Ellen Terry, Aubrey Beardsley, Henry James, Max Beerbohm, Oscar Wilde, Monet, Renoir, Pissarro, Rodin, André Gide, Édouard Dujardin, Proust, Parlamentsabgeordnete. Was aber nicht unbedingt hieß, dass er auch viele von ihnen kannte, und niemand – berühmt oder nicht – kannte ihn jemals wirklich, noch nicht einmal seine erste Frau Ellen, die in knapp zwei Wochen vierzig Jahre alt werden würde. An diesem Feiertag dürfte Sickert kaum an den Geburtstag seiner Frau gedacht haben. Andererseits war es äußerst unwahrscheinlich, dass er ihn vergessen hatte. Für sein erstaunliches Gedächtnis erntete er nämlich viel Bewunderung. Sein Leben lang unterhielt er Dinnergäste mit Aufführungen langer Passagen aus Operetten und Theaterstücken, bei denen er sich für seine Rollen kostümierte und sie fehlerlos rezitierte. Sickert hatte sicherlich nicht vergessen, dass Ellen am 18. August Geburtstag hatte, schließlich bot sich damit eine gute Gelegenheit, ihr einen wichtigen Tag zu verderben. Vielleicht würde er ihn »vergessen«. Vielleicht würde er in eine der heimlich angemieteten Bruchbuden verschwinden, die er Ateliers nannte. Vielleicht würde er Ellen in ein romantisches Café in Soho ausführen und sie am Tisch sitzen lassen, während er sich in ein Varieté davonmachte und den Rest des Abends fortbliebe. Ellen liebte Sickert ihr ganzes trauriges Leben lang, trotz seiner Kaltherzigkeit, seiner pathologischen Lügerei, seiner Egozentrik und der Angewohnheit, Tage – oder sogar Wochen – ohne Vorankündigung oder Erklärung zu verschwinden.
Weit mehr als im Theater erwies sich Walter Sickert im Leben als Schauspieler. Er bewegte sich auf der Bühne seiner geheimen, von wilden Phantasien getriebenen Existenz und fühlte sich im tiefen Schatten verlassener Straßen ebenso zu Hause wie im pulsierenden Leben dicht gedrängter Menschenmengen. Glänzend verstand er es, seine Stimme zu verstellen, Theaterschminke zu verwenden und sich zu verkleiden – schon als Junge hatte er die Kunst der Verstellung so perfekt beherrscht, dass er oft von Nachbarn und Familienangehörigen nicht erkannt worden war.
Während seines langen, gefeierten Lebens war er berüchtigt dafür, dass er durch eine Vielzahl verschiedener Bärte und Schnurrbärte ständig sein Aussehen veränderte, für seine bizarre Kleidung, die manchmal ein regelrechtes Kostüm war, und für seine Haartrachten – bis hin zur Rasur des Kopfes. Er sei ein »Proteus«, schrieb sein Freund, der französische Maler Jacques-Émile Blanche. Sickerts »Talent zur Verstellung durch Kleidung, Haartracht und Sprechweise kann sich durchaus mit dem Fregolis[1] messen«, schrieb Blanche. Auf einem Porträt, das Wilson Steer 1890 von Sickert malte, prangt in seinem Gesicht ein verdächtig falsch wirkender Schnurrbart, der aussieht, als hätte er sich einen Eichhörnchenschwanz über den Mund geklebt.
Außerdem hatte er einen Hang, seinen Namen zu ändern. Als Schauspieler wie bei seinen Gemälden, Radierungen, Zeichnungen und in zahlreichen Briefen an Kollegen, Freunde und Zeitungen hat er viele verschiedene Identitäten angenommen: Mr. Nemo (lateinisch für Mr. Nobody, Herr Niemand), ein Bewunderer, ein Whistlerianer, Ihr Kunstkritiker, ein Außenseiter, Walter Sickert, Sickert, Walter R. Sickert, Richard Sickert, W.R. Sickert, W.S., R.S., S., Dick, W. St., Rd. Sickert LL.D. (Doktor der Rechte), R. ST.A.R.A. (Mitglied der Royal Academy) und RD St A.R.A.
Sickert hat keine Memoiren geschrieben, weder ein Tagebuch noch einen Terminkalender geführt, seine Briefe und Kunstwerke hat er nur in den seltensten Fällen datiert, daher lässt sich nur schwer in Erfahrung bringen, wo er sich während bestimmten Tagen, Wochen, Monaten oder sogar Jahren befunden oder was er getan hat. So konnte ich auch keine Aufzeichnungen über seinen Aufenthaltsort und seine Beschäftigungen an diesem 6. August 1888 finden, aber es gibt keinen Grund zu der Annahme, er habe sich nicht in London befunden. Aus Notizen, die er auf Varieté-Skizzen gekritzelt hat, geht hervor, dass er sich noch zwei Tage zuvor, am 4. August, in London aufgehalten hat; außerdem hatte sich Whistler überraschend entschlossen, am 11. August zu heiraten. Zwar gehörte Sickert nicht zum kleinen Kreis der geladenen Gäste, aber es entsprach nicht seiner Art, ein solches Ereignis zu versäumen – selbst wenn er nur heimlich zuschauen konnte.
Der große Maler James McNeill Whistler hatte sich heftig in die »bemerkenswert hübsche« Beatrice Godwin verliebt, die fortan die beherrschende Rolle in seinem Leben spielen und es nachhaltig verändern sollte. Whistler wiederum spielte eine fast ebenso wichtige Rolle in Sickerts Leben und hatte auch dessen Verlauf nachhaltig verändert. »Netter Junge, der Walter«, pflegte Whistler Anfang der 1880er-Jahre zu sagen, als er dem ehrgeizigen und außerordentlich begabten jungen Mann noch mit großem Wohlwollen begegnete. Inzwischen war ihre Freundschaft abgekühlt, aber Sickert dürfte schwerlich vorbereitet gewesen sein auf das, was ihm als erschreckender, völlig unerwarteter und vollständiger Bruch erscheinen musste, den der vergötterte, beneidete und verhasste Meister vollzog. Whistler und seine Braut hatten vor, die Flitterwochen und den Rest des Jahres in Frankreich zuzubringen und sich dort, wenn möglich, dauerhaft niederzulassen.
Die zukünftigen ehelichen Freuden des exzentrischen, genialen und egozentrischen James McNeill Whistler müssen auf dessen ehemaligen Laufburschen und Schüler befremdend gewirkt haben. Eine von Sickerts vielen Rollen war die des unwiderstehlichen Schürzenjägers, doch jenseits der Bühne war er nichts dergleichen. Sickert war von Frauen abhängig und hasste sie. Sie waren geistig minderwertige Geschöpfe und völlig nutzlos, es sei denn, sie sorgten für einen oder ließen sich manipulieren, vor allem in Sachen Kunst oder Geld. Frauen waren gefährlich, denn sie erinnerten an ein bitteres und demütigendes Geheimnis, das Sickert nicht nur mit ins Grab nahm, sondern auch über das Grab hinaus bewahrte, denn eingeäscherte Leichname verraten nichts über körperliche Eigenheiten, selbst wenn sie exhumiert werden. Sickert war mit einer Missbildung des Penis geboren worden, an der er als Kleinkind mehrfach operiert wurde. Nach diesen Eingriffen war er entstellt, wenn nicht verstümmelt und möglicherweise impotent. In jedem Fall war von dem Penis vermutlich nicht mehr genügend für eine Penetration verblieben, und es ist recht wahrscheinlich, dass er sich zum Urinieren hinhocken musste wie eine Frau.
»Nach meiner Theorie über die Verbrechen ist der Täter stark entstellt«, heißt es in einem Brief vom 4. Oktober 1888, der sich bei den Akten zu den Whitechapel-Morden im Archiv der Londoner Stadtverwaltung befindet, »– möglicherweise ist sein privatestes Teil beschädigt – & er rächt sich nun mit diesen Untaten an dem Geschlecht.« Der Brief ist mit violettem Bleistift geschrieben und trägt die rätselhafte Unterschrift »Scotus«. Es könnte das lateinische Wort für Schotte sein. »Scotch« kann »leichter, oberflächlicher Einschnitt« oder »schneiden« bedeuten. Scotus kann auch eine merkwürdige, gelehrte Anspielung auf Johannes Scotus Eriugena sein, einen Theologen und Lehrmeister für Grammatik und Dialektik aus dem neunten Jahrhundert.
Die Vorstellung, dass Whistler verliebt war und eine sexuelle Beziehung zu einer Frau hatte, könnte sehr gut der Auslöser gewesen sein, der Sickert zu einem der gefährlichsten und verstörendsten Mörder aller Zeiten machte. Er begann in die Tat umzusetzen, was er sich sein Leben lang ausgemalt hatte, nicht nur in Gedanken, sondern auch auf Jugendskizzen, die entführte, gefesselte und erdolchte Frauen darstellten.
Die Psychologie eines gewalttätigen, erbarmungslosen Mörders lässt sich nicht durch ein einfaches Schema erklären. Es gibt keine simplen Erklärungen, keine eindeutigen Kausalbeziehungen. Doch der Kompass der menschlichen Natur weist in eine bestimmte Richtung, und Sickerts Gefühle müssen in höchsten Aufruhr geraten sein, als Whistler die Witwe des Architekten und Archäologen Edward Godwin heiratete, der, bevor er Beatrice ehelichte, mit der Schauspielerin Ellen Terry zusammengelebt hatte und der Vater ihrer Kinder war.
Die betörend schöne und sinnliche Ellen Terry war eine der berühmtesten Schauspielerinnen des Viktorianischen Zeitalters, und Sickert war fixiert auf sie. Als Halbwüchsiger hatte er sie und ihren Kollegen Henry Irving verfolgt. Jetzt hatte Whistler Verbindungen nicht nur zu einem, sondern zu beiden Objekten von Sickerts Obsessionen geknüpft, und diese drei Sterne in seinem Universum bildeten eine Konstellation, der er nicht angehörte. Die Sterne scherten sich nicht um ihn. Er war wirklich Mr. Nemo.
Aber im Spätsommer 1888 legte er sich einen neuen Bühnennamen zu, der zu seinen Lebzeiten nie mit ihm in Verbindung gebracht werden sollte, aber schon bald viel bekannter wurde als die Namen Whistler, Irving oder Terry.
Die Umsetzung von Jack the Rippers Gewaltphantasien begann am 6. August 1888, diesem sorglosen Feiertag, als er sein Debüt auf seiner neuen Bühne hatte und die erste jener entsetzlichen Vorstellungen gab, die zu einem der berühmtesten ungelösten Mordfälle aller Zeiten werden sollten. Allgemein und fälschlicherweise wird angenommen, sein abscheuliches Gemetzel habe so plötzlich aufgehört, wie es begonnen habe, und er sei aus dem Nichts gekommen und wieder dorthin verschwunden.
Jahrzehnte sind vergangen, erst fünfzig, dann hundert Jahre, und seine grauenhaften Sexualverbrechen sind mit der Zeit blass und unwirklich geworden. Sie sind zum Stoff für Krimi-Rätsel, Mystery-Wochenenden, Spiele und »Ripper-Walks« verkommen – organisierte Spaziergänge auf den Spuren von Jack the Ripper, die unweigerlich mit einem Bier im Pub Ten Bells enden. Saucy Jack, der freche Jack, wie der Ripper sich manchmal selbst nannte, ist in düsteren Filmen aufgetreten, die berühmte Schauspieler, Spezialeffekte und Fluten von dem präsentierten, wonach der Ripper nach eigenem Bekunden gierte: Blut, Blut, Blut. Heutzutage wecken seine Metzeleien keine Furcht und Wut mehr, nicht einmal Mitleid mit den Opfern, die still vermodern, teilweise in anonymen Gräbern.
2Die Besichtigung
Kurz vor Weihnachten 2001 war ich zu Fuß unterwegszu meinem New Yorker Apartment an der Upper Eastside und wusste, dass ich trotz meines Bemühens, ruhig und gut gelaunt zu wirken, einen niedergeschlagenen und unruhigen Eindruck machte.
Viel von diesem Abend ist mir nicht im Gedächtnis geblieben, nicht einmal der Name des Restaurants, in dem unsere kleine Gruppe gegessen hatte. Vage erinnere ich mich daran, dass Lesley Stahl eine unheimliche Geschichte über die neuesten Recherchen für ihre Sendung 60 Minutes erzählte und dass alle am Tisch über Politik und Wirtschaft sprachen. Ich ließ die üblichen Autorensprüche vom Stapel – die Lasst-den-Kopf-nicht-hängen- und Tut-wozu-ihr-Lust-habt-Ermuti-gungen –, weil ich nicht über mich und die Arbeit sprechen wollte, die, wie ich befürchtete, dabei war, mein Leben zu ruinieren. Mein Herz war schwer, als müsste der Kummer in meiner Brust es jeden Augenblick erdrücken.
Meine Literaturagentin Esther Newberg und ich beschlossen, zu Fuß in unser Viertel zurückzukehren. Ich hatte wenig zu sagen auf dem dunklen Bürgersteig, während wir an den üblichen Verdächtigen vorbeikamen, die ihre Hunde ausführten, und dem endlosen Strom von lauten Menschen, die in ihre Handys sprachen. Von den Taxis und Hupen nahm ich kaum Notiz. Ich stellte mir vor, ein Räuber würde versuchen, uns an die Brieftasche oder die Wäsche zu gehen. Dem würde ich es zeigen, mich ducken, seine Beine umklammern und ihn zu Fall bringen. Ich bin einen Meter fünfundsechzig groß, wiege 55 Kilo und bin schnell auf den Beinen. Ja, er hätte nichts zu lachen. So malte ich mir aus, was ich täte, wenn irgendein psychopathisches Stück Dreck sich von hinten an uns heranschliche und plötzlich …
»Wie geht’s?«, fragte Esther.
»Um die Wahrheit zu sagen …«, begann ich, weil ich Esther selten die Wahrheit sage.
Es gehört nicht zu meinen Gewohnheiten, gegenüber meiner Agentin Esther Newberg oder meiner Verlegerin Phyllis Grann zuzugeben, dass ich mich bei dem, was ich tue, manchmal fürchte oder unwohl fühle. Die beiden Frauen sind die Grundpfeiler meiner beruflichen Existenz und glauben an mich. Als ich ihnen erzählte, ich hätte Recherchen über Jack the Ripper angestellt und wüsste nun, wer er gewesen sei, zweifelten sie nicht einen Augenblick an meinen Worten.
»Mir geht es mies«, bekannte ich und fühlte mich so elend, dass ich hätte heulen mögen.
»Tatsächlich?« Für einen Augenblick unterbrach Esther auf der Lexington Avenue ihren Nichts-hält-mich-auf-Schritt. »Dir geht es mies? Wirklich? Warum?«
»Das Buch macht mich fertig, Esther. Ich weiß nicht, warum um alles in der Welt ich … Dabei habe ich mich nur mit seinen Bildern und seinem Leben beschäftigt, aber eins kam zum andern …«
Sie sagte kein Wort.
Mir fällt es seit jeher leichter, zornig zu werden, als Angst oder Verlusterlebnisse zu zeigen, und ich war im Begriff, mein Leben an Walter Richard Sickert zu verlieren. Er nahm es mir weg. »Ich möchte meine Romane schreiben«, sagte ich. »Ich will nicht über ihn schreiben. Das macht keinen Spaß. Nicht den geringsten.«
»Hör mal«, sagte sie ganz ruhig und nahm ihren Schritt wieder auf.
»Du musst es nicht schreiben. Ich krieg dich aus der Sache wieder raus.«
Sie hätte mich aus der Sache rauskriegen können, aber ich mich selber nie und nimmer. Schließlich kannte ich die Identität eines Mörders und konnte diese Tatsache nicht mehr aus meinem Bewusstsein ausblenden. »Ich hab mich da in die Position einer Richterin manövriert«, erläuterte ich Esther. »Es spielt keine Rolle, dass er tot ist. Hin und wieder fragt mich diese leise Stimme in meinem Inneren: Und was ist, wenn du dich täuschst? Ich würde mir nie verzeihen, wenn ich so etwas über einen Menschen gesagt hätte und dann herausfände, dass es nicht stimmt.«
»Aber du glaubst nicht, dass du dich irrst …«
»Nein, auf keinen Fall.«
Es hatte alles ganz harmlos begonnen, es war, als hätte ich mich aufgemacht, eine idyllische Landstraße zu überqueren, um plötzlich von einem Zementlaster überfahren zu werden. Im Mai 2000 hielt ich mich in London auf, um mich für die Ausgrabungen in Jamestown einzusetzen. Auch meine Freundin Linda Fairstein, die Leiterin der Abteilung für Sexualverbrechen beim New York District Attorney’s Office, war in London und fragte mich, ob ich Lust zu einer Besichtigung von Scotland Yard hätte.
»Im Augenblick nicht«, wollte ich erwidern, aber sogleich dachte ich, dass meine Leser wenig Verständnis dafür hätten, wenn sie wüssten, wie sehr ich es manchmal leid war, noch mehr Polizeireviere zu besichtigen, noch mehr Labors, Leichenhallen, Schießstände, Friedhöfe, Gefängnisse, Tatorte, Strafverfolgungsbehörden oder anatomische Museen.
Auf meinen Reisen, vor allem im Ausland, ist mein erster Zugang zu einer fremden Stadt häufig die Einladung, ihre düstere, gewalttätige Seite kennenzulernen. In Buenos Aires führte man mich stolz durch das Kriminalmuseum, einen Raum voller abgetrennter Köpfe, die in Glasgefäßen mit Formalin aufbewahrt wurden. Nur die berüchtigtsten Verbrecher schafften es in dieses Gruselkabinett, und während sie meinen Blick mit milchigen Augen erwiderten, hatte ich den Eindruck, sie hätten bekommen, was sie verdienten. In Salta an der argentinisch-peruanischen Grenze zeigte man mir 500 Jahre alte Mumien von Inkakindern, die lebendig begraben worden waren, um die Götter gnädig zu stimmen. Vor ein paar Jahren wurde mir in London die VIP-Vergünstigung zuteil, in einem Pestgrab herumstapfen zu dürfen, wo ich bei jedem Schritt auf Menschenknochen trat.
Ich habe sechs Jahre lang in Richmond, Virginia, im Office of the Chief Medical Examiner, dem Institut für Rechtsmedizin, gearbeitet, wo ich Computer programmiert, statistische Analysen erstellt und im Leichenschauhaus ausgeholfen habe. Ich führte Protokoll für die Gerichtspathologen, wog Organe, notierte Schusskanäle und Wundengrößen, inventarisierte die Medikamente von Selbstmordopfern, die ihre Antidepressiva nicht genommen hatten, half vollkommen steife Menschen zu entkleiden, die unseren Bemühungen, ihre Kleidung zu entfernen, starrsinnigen Widerstand entgegensetzten, versah Reagenzgläser mit Etiketten, wischte Blut auf und sah, berührte, roch und schmeckte den Tod sogar, weil sein Gestank mir ganz tief in der Kehle haften blieb.
Ich vergesse weder die Gesichter noch irgendwelche winzigen Details von Menschen, die ermordet wurden. Ich habe so viele gesehen. Vermutlich könnte ich sie nicht zählen, und ich wünschte, ich hätte sie in einem großen Raum zusammenbringen können, bevor es geschah, und sie bitten können, ihre Türen abzuschließen, eine Alarmanlage zu installieren – oder sich wenigstens einen Hund anzuschaffen –, nicht an einer bestimmten Stelle zu parken oder die Finger von den Drogen zu lassen. Noch immer stockt mir der Atem, wenn ich an die verbeulte Dose Deospray in der Tasche des Halbwüchsigen denke, der angeben wollte und beschloss, sich auf der Ladefläche des Pick-up aufrecht hinzustellen. Er hatte nicht bemerkt, dass der Wagen sich anschickte, unter einer Brücke hindurchzufahren. Noch immer kann ich die blinde Zufälligkeit des Schicksals nicht begreifen, das den Mann ereilte, der beim Ausstieg aus einem Flugzeug einen Schirm mit Metallspitze erhielt und vom Blitz erschlagen wurde.
Schon vor langer Zeit verhärtete sich meine lebhafte Neugier für Gewalttaten zu einer klinischen Ritterrüstung, die mich zwar schützt, aber auch so schwer ist, dass ich manchmal nach meinen Besuchen bei den Toten kaum noch gehen kann. Es scheint, als ob die Toten nach meiner Energie verlangten und verzweifelt versuchten, sie aus mir herauszusaugen, wenn sie in ihrem eigenen Blut auf der Straße oder auf einem Edelstahltisch liegen. Die Toten bleiben tot, und ich bin immer aufs Neue betroffen. Morde sind keine Rätselspielchen, und es ist meine Aufgabe, sie mit der Feder zu bekämpfen.
Es wäre ein Verrat an mir selbst und eine Beleidigung für Scotland Yard und für jeden Strafverfolger des christlichen Abendlands gewesen, wenn ich an dem Tag, an dem Linda Fairstein sagte, sie könne eine Besichtigung arrangieren, »müde« gewesen wäre.
»Das ist sehr freundlich von Scotland Yard«, sagte ich also. »Ich bin noch nie dort gewesen.«
Am nächsten Morgen lernte ich den stellvertretenden Polizeipräsidenten John Grieve kennen, den angesehensten Ermittlungsbeamten Großbritanniens und, wie sich herausstellte, Experten in Sachen Jack the Ripper. Der legendenumwobene viktorianische Mörder interessierte mich nur am Rande. Noch nie hatte ich ein Ripper-Buch gelesen. Ich wusste nichts über seine Morde. Weder war mir bekannt, dass seine Opfer Prostituierte gewesen, noch, wie sie ums Leben gekommen waren. Ich stellte ein paar Fragen. Vielleicht konnte ich Scotland Yard in meinem nächsten Scarpetta-Roman verwenden, dachte ich. In diesem Fall brauchte ich konkrete Einzelheiten über die Ripper-Fälle. Wer weiß, vielleicht konnte Scarpetta neue Erkenntnisse über sie liefern.
John Grieve bot mir an, mir die historischen Schauplätze der Ripper-Verbrechen zu zeigen – oder wenigstens das, was nach 112 Jahren noch von ihnen übrig ist. So sagte ich eine Reise nach Irland ab und verbrachte einen regnerischen, eiskalten Morgen mit dem berühmten Mr. Grieve und Inspektor Howard Gosling. Whitechapel und Spitalfields suchten wir auf, Mitre Square und Miller’s Court, wo Mary Kelly durch den Serienmörder, den man The Ripper nannte, das Fleisch buchstäblich von den Knochen geschält worden war.
»Hat schon mal jemand versucht, diese Verbrechen mit modernen gerichtsmedizinischen Methoden aufzuklären?«, fragte ich.
»Nein«, sagte John Grieve und nannte mir einige wenige Personen, gegen die nur einige wenige Verdachtsmomente vorlagen. »Aber es gibt einen interessanten Burschen, den Sie näher unter die Lupe nehmen sollten, wenn Sie sich mit dem Fall beschäftigen wollen. Einen Maler namens Walter Sickert. Er hat ein paar Mordbilder gemalt. Besonders eins: Ein vollständig bekleideter Mann sitzt auf einem Bett mit dem Leichnam einer nackten Prostituierten, die er gerade umgebracht hat. Es heißt The Camden Town Murder (›Der Camden-Town-Mord‹). Ich habe mich immer gefragt, ob da nicht mehr dahintersteckt.«
Es war nicht das erste Mal, dass Sickert mit den Verbrechen von Jack the Ripper in Verbindung gebracht wurde. Die meisten Menschen haben diese Vorstellung lächerlich gefunden.
Ich bekam meine Zweifel über Sickert, als ich ein Buch über seine Kunst durchblätterte. Die erste Abbildung, die ich aufschlug, war ein 1887 entstandenes Gemälde, das die bekannte viktorianische Schauspielerin und Sängerin Ada Lundberg in der Marylebone Music Hall zeigt. Eigentlich singt sie, aber es sieht aus, als ob sie schreit, während die Männer sie gierig und bedrohlich anstarren. Ich bin sicher, dass es für alle Werke Sickerts künstlerische Erklärungen gibt. Aber was ich sehe, wenn ich sie betrachte, ist Morbidität, Gewalt und Hass auf Frauen. Als ich fortfuhr, mich mit Sickert und dem Ripper zu beschäftigen, bemerkte ich beunruhigende Parallelen zwischen ihnen. Einige von Sickerts Bildern weisen unheimliche Ähnlichkeiten zu Leichenschauhaus- oder Tatort-Fotografien der Opfer von Jack the Ripper auf.
Mir fielen finstere Bilder bekleideter Männer auf, reflektiert in Spiegeln düsterer Schlafzimmer, in denen nackte Frauen auf eisernen Bettgestellen sitzen. Ich sah drohende Gewalt und Tod. Ich sah ein argloses Opfer, das keinen Grund hatte, den charmanten, gut aussehenden Mann zu fürchten, der sie gerade in eine Situation gelockt hatte, in der sie äußerst verwundbar war. Ich sah eine diabolisch kreative Intelligenz, und ich sah das Böse. Ich begann, die Tatsachenbeweise, die von der modernen forensischen Wissenschaft und anderen Experten entdeckt worden waren, Schicht um Schicht durch Indizienbeweise zu ergänzen.
Die ganze Zeit setzten die forensischen Wissenschaftler und ich unsere Hoffnungen auf DNA-Analysen. Doch es sollte ein Jahr und mehr als hundert Tests dauern, bis wir die ersten Schatten des 75 bis 114 Jahre alten genetischen Beweismaterials zu sehen begannen, das Walter Sickert und Jack the Ripper hinterließen, als sie Briefmarken und die schen von Briefumschlägen berührten und beleckten. Zellen aus ihren Mundhöhlen gerieten in ihren Speichel und waren in Klebstoff eingeschlossen, bis DNA-Experten die genetischen »Marker« nun mit Pinzetten, sterilem Wasser und Tupfern herauslösten.
Das beste Ergebnis stammte von einem Ripper-Brief, der eine mitochondriale DNA-Sequenz eines einzigen Spenders enthielt. Sie war spezifisch genug, um bei der Suche nach der Person, die die Gummierung auf der Rückseite der Briefmarke berührt und beleckt hatte, 99 Prozent der Bevölkerung ausschließen zu können. Dasselbe DNA-Profil tauchte auch als Bestandteil eines weiteren Ripper-Briefes und zweier Briefe von Walter Sickert auf.
Entsprechungen zu dieser DNA-Sequenz fanden sich auch auf anderen Gegenständen aus Sickerts Besitz, etwa auf Overalls, die er beim Malen trug. Abgesehen von der Ripper-Briefmarke mit nur einem einzigen Spender sind in den DNA-Proben ansonsten die genetischen Profile verschiedener Personen miteinander vermischt (was weder überraschend ist noch diese Proben wertlos macht). Das DNA-Beweismaterial ist das älteste, das je in einem Kriminalfall untersucht worden ist.
Dies ist erst der Anfang. Unsere DNA-Untersuchung und anderen forensischen Analysen sind noch nicht abgeschlossen. Sie können noch Jahre andauern, da die Technologie auf diesem Gebiet rasende Fortschritte macht.
Es gibt darüber hinaus weitere Tatsachenbeweise. Forensische Wissenschaftler sowie Kunst-, Papier- und Schriftexperten haben Folgendes gefunden: einen Ripper-Brief, der auf Künstlerpapier geschrieben wurde; dieselben Wasserzeichen auf Papier von Ripper-Briefen wie auf Papier, das Walter Sickert verwendet hat; Ripper-Briefe, die mit der weichen, Wachsmalstiften ähnlichen Grundierung geschrieben wurden, wie sie für Lithographien verwendet wird; Briefe mit Farbe oder Tinte, die mit einem Pinsel aufgetragen wurde. Eine Prüfung unter dem Mikroskop enthüllte, dass das »getrocknete Blut« auf den Ripper-Briefen in seiner Konsistenz der Öl-Wachs-Mischung ähnelt, die als Ätzgrund für Radierungen benutzt wird. Und unter ultraviolettem Licht schimmerte es milchig weiß, genau wie Ätzgrund. Kunstexperten sagen, dass Skizzen in den Ripper-Briefen professionell wirken und Walter Sickerts Kunstwerken und Technik entsprechen.
Dabei ergab sich eine interessante Nebenbeobachtung: Ein Bluterkennungstest mit dem blutähnlichen Ätzgrund, der auf Ripper-Briefe geschmiert oder gemalt wurde, erbrachte kein eindeutiges Ergebnis – was äußerst ungewöhnlich ist. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen: Es könnte an mikroskopisch kleinen Kupferpartikeln liegen, da diese Art von Kupfer, wie es für Tests verwendet wird, uneindeutige oder falsche »Positiv«-Ergebnisse hervorrufen kann, oder daran, dass der braune Ätzgrund und Blut miteinander vermischt wurden.
Bestimmte Eigentümlichkeiten der Handschrift und Handhaltung, die sich in den höhnischen, gewalttätigen Briefen des Rippers finden, sind auch in denjenigen Briefen verborgen, in denen er seine Handschrift verstellt hat. Dieselben Eigentümlichkeiten lauern auch in Sickerts sprunghafter Handschrift.
Das Papier einiger Briefe, die der Ripper an die Metropolitan Police geschickt hat, ist genau dasselbe wie bei einem seiner Briefe an die City of London Police, auch wenn die Handschrift anders ist. Es ist offensichtlich, dass Sickert Rechtshänder war, aber Filmaufnahmen aus der Zeit, als er über siebzig Jahre alt war, zeigen, dass er ziemlich geschickt mit der linken Hand war. Die Handschriftenexpertin Sally Bower ist der Ansicht, dass in einigen Ripper-Briefen die Handschrift dadurch verstellt wurde, dass eine dige Person mit der Linken schrieb. Offenkundig verfasste der echte Ripper weitaus mehr von den Ripper-Briefen, als ihm bislang zugeschrieben wurden. Ich glaube, dass die Meisten von ihm stammten. Tatsächlich schrieb Walter Sickert die meisten von ihnen. Selbst wenn seine geübte Künstlerhand seine Schrift veränderte, scheinen seine Arroganz und seine charakteristische Ausdrucksweise doch immer unwillkürlich durch.
Zweifellos wird es immer Skeptiker und durch Eigeninteresse voreingenommene Kritiker geben, die sich weigern zu akzeptieren, dass Sickert ein Serienmörder war, ein gestörter, diabolischer Mann, der von Größenwahn und Hass getrieben war. Es wird immer diejenigen geben, die sagen, dass alles nur Zufall sei.
Wie der FBI-Profiler Ed Sulzbach sagt: »Im Leben gibt es nicht wirklich viele Zufälle. Und einen Zufall, der auf einen Zufall folgt, der auf einen Zufall folgt, Zufall zu nennen, ist einfach dumm.«
Fünfzehn Monate nach meiner ersten Begegnung mit John Grieve von Scotland Yard kam ich wieder zu ihm und trug ihm den Fall vor.
»Was hätten Sie getan, wenn Sie damals der zuständige Ermittler gewesen wären und all dies gewusst hätten?«
»Ich hätte Sickert sofort beschatten lassen, um zu versuchen, seine Schlupflöcher zu finden, und wenn wir welche entdeckt hätten, hätten wir Durchsuchungsbefehle bekommen«, antwortete er, als wir in einem indischen Restaurant im East End Kaffee tranken.
»Auch wenn wir nicht mehr Beweise gefunden hätten, als wir jetzt in der Hand haben«, fuhr er fort, »hätten wir den Fall voller Zuversicht dem Staatsanwalt vorlegt.«
3Die Unglücklichen
Es ist schwer vorstellbar, dass Walter Sickert am 6. Au-gust nicht an den Vergnügungen des lange erwarteten Feiertags teilnahm. Kunstliebhaber, die auf ihr Geld sehen mussten, hatten im verwahrlosten East End für einen Penny Gelegenheit, Ausstellungen aller Art zu besuchen, wer bessergestellt war, zahlte einen Shilling für einen Blick auf die Meisterwerke von Corot, Diaz und Rousseau in den prächtigen Galerien auf der New Bond Street.
Die Benutzung der Trambahnen war kostenlos – zumindest derjenigen, die nach Whitechapel fuhren, dem Zentrum der Londoner Textilindustrie. Dort drängte sich die Menge auf den Straßen, sieben Tage in der Woche boten Gemüsehändler, Hausierer und Geldwechsler lautstark ihre Waren und Dienste an, während zerlumpte Kinder die stinkenden Straßen nach Essensresten absuchten und auf eine Gelegenheit warteten, einem Fremden eine Münze abzuluchsen. Whitechapel war die Heimat der »Mülltonnenleute«, wie manch ein braver Viktorianer die armen Teufel nannte, die dort lebten. Für ein paar Farthings (Viertelpennys) bekam der Besucher Straßenakrobatik, Hundedressuren, Monstrositätenschauen oder einen soliden Rausch geboten. Oder Sex mit einer der Prostituierten – oder »Unglücklichen« –, die es dort zu Tausenden gab.
Eine von ihnen war Martha Tabram. Sie war etwa vierzig Jahre alt, lebte getrennt von einem Möbelpacker namens Henry Samuel Tabram, der sie verlassen hatte, weil er ihre Trunksucht nicht mehr ertragen konnte. Anständigerweise hatte er ihr einen wöchentlichen Unterhalt von zwölf Shilling gezahlt, bis ihm zu Ohren gekommen war, dass sie mit einem anderen Mann zusammenlebte, einem Zimmermann namens Henry Turner. Doch auch Turner hatte die Geduld mit Marthas Trinkgewohnheiten verloren und sich gerade zwei oder drei Wochen zuvor von ihr getrennt. Vor zwei Tagen hatte er sie zum letzten Mal lebend gesehen, am Samstagabend, dem 4. August, am selben Abend, an dem Sickert seine Skizzen in Gatti’s Music Hall in der Nähe des Strand angefertigt hatte. Turner gab Martha ein paar Münzen, die sie sofort in Alkohol umsetzte.
Jahrhundertelang glaubten viele Menschen, Frauen würden zu Prostituierten, weil sie an einem genetischen Defekt litten, der sie mit einem übermäßigen Sexualverlangen ausstatte. Man unterschied verschiedene Arten von unmoralischen oder wollüstigen Frauenzimmern, eine schlimmer als die andere. Konkubinen, Mätressen und leichte Mädchen waren verwerflich, aber die schlimmsten Sünderinnen waren die Huren. Eine Hure sei eine Hure, weil sie es so wolle und keine Bereitschaft zeige, »von ihrem verderbten und schändlichen Lebenswandel abzulassen«, klagte Thomas Heywood 1624 in einem Buch zur Geschichte der Frau. »Mit tiefer Entmutigung erfüllt mich die Erinnerung an die Äußerung einer berüchtigten Vertreterin dieses Gewerbes, die sagte: ›Einmal eine Hure, immer eine Hure, ich weiß das aus eigener Erfahrung!‹«
Sexuelle Aktivitäten hatten sich auf die Institution der Ehe zu beschränken und waren von Gott einzig und allein zur Erhaltung der Gattung bestimmt. Das Zentrum des weiblichen Universums war die Gebärmutter, und der monatliche Menstruationszyklus löste heftige Gefühlsstürme aus – wilde Lust, Hysterie und Wahnsinn. Frauen gehörten einer niederen Ordnung an und waren unfähig zu nalem, abstraktem Denken – eine Überzeugung, die ganz gewiss von Walter Sickert geteilt wurde. Unumwunden erklärte er, Frauen verstünden nichts von der Kunst und seien nur an ihr interessiert, wenn sie »ihrer Eitelkeit frommt« oder sie »in jene sozialen Klassen erhebt, an denen ihnen so viel gelegen ist«. Die wenigen Frauen von Talent, so Sickert, »zählen als Männer«.
Seine Ansichten waren nicht ungewöhnlich für die Zeit. Frauen hielt man für eine andere »Rasse«. Empfängnisverhütung galt als Verfehlung gegen Gott und Gesellschaft, und so nahm die Armut mit dem sprunghaften Anstieg der Geburtenrate entsetzliche Ausmaße an. Sexuelles Vergnügen war den Frauen nur gestattet, weil man glaubte, der Orgasmus sei die physiologische Voraussetzung für die Sekretion der Körpersäfte, die für die Empfängnis erforderlich seien. Sich die »Erregung« in ledigem Stand oder durch eigenes Zutun zu verschaffen war widernatürlich und eine ernstliche Gefahr für den Geisteszustand, das Seelenheil und die Gesundheit. Einige Ärzte des 19. Jahrhunderts behandelten Masturbation durch Beschneidung der Klitoris. Die »Erregung« um der »Erregung« willen wurde, besonders bei Frauen, sozial geächtet. Sie war verwerflich und barbarisch.
Christlichen Männern und Frauen waren die Geschichten wohlvertraut. Zur Zeit von Herodot waren die ägyptischen Frauen so widernatürlich und blasphemisch, dass sie Gott verhöhnten, indem sie sich hemmungsloser Lust hingaben und die Wonnen des Fleisches schamlos zur Schau stellten. In jenen primitiven Zeiten galt es als erstrebenswert und nicht als schändlich, seine Lust käuflich zu befriedigen. Maßloser sexueller Appetit war gut, nicht böse. Starb eine schöne junge Frau, nahm niemand daran Anstoß, wenn sich heißblütige Männer an ihrem Leib vergnügten, bis er ein bisschen zu reif wurde und bereit für den Einbalsamierer war. In guter Gesellschaft erzählte man solche Geschichten zwar nicht, doch auch die anständigen Leute wussten, dass die Bibel kein gutes Haar an den Dirnen ließ.
Vergessen war die Lehre, dass nur, wer ohne Sünde sei, den ersten Stein werfen dürfe – was nur allzu deutlich zutage trat, wenn die Schaulustigen zusammenströmten, um zuzusehen, wie jemand öffentlich enthauptet oder gehängt wurde. Entsprechend wurde die Überzeugung, dass die Missetat der Väter an den Kindern heimgesucht werde, verwandelt in die Auffassung, dass die Sünden der Mütter an ihren Kindern bestraft würden. Thomas Heywood schrieb, dass eine Frau, »deren Tugend einmal Schaden erlitten hat, Schimpf und Schande über die Familie bringt«. Das Gift der Sünde, so verspricht Heywood, werde auch die Nachkommen nicht verschonen, »die aus so verderbter Saat sprießen, diese Produkte einer sündigen und ehebrecherischen Vereinigung«.
Zweihundertfünfzig Jahre später war die englische Sprache zwar ein bisschen verständlicher geworden, doch die viktorianischen Ansichten über Frauen und Unmoral hatten sich nicht geändert: Der Geschlechtsverkehr hatte seine einzige Berechtigung in der Zeugung, und die »Erregung« war ein Katalysator für die Empfängnis. Es gehörte zu den ehernen Überzeugungen der Quacksalberei, die durch die Ärzte fortgesetzt wurde, dass eine Frau nur schwanger werden könne, wenn der Zustand der »Erregung« eingetreten sei. Wurde eine vergewaltigte Frau schwanger, hatte sie folglich während des Geschlechtsakts einen Orgasmus gehabt, was ausschloss, dass der Verkehr gegen ihren Willen stattgefunden hatte. Wenn die vergewaltigte Frau dagegen nicht schwanger wurde, konnte sie keinen Orgasmus gehabt haben, mithin konnte ihre Behauptung, ihr sei Gewalt angetan worden, der Wahrheit entsprechen.
Im 19. Jahrhundert kreiste das Denken der Männer unablässig um den weiblichen Orgasmus. Die »Erregung« war so wichtig, dass man sich fragt, wie oft sie wohl vorgetäuscht wurde. Es dürfte ein sehr nützlicher Kunstgriff für die Frauen gewesen sein, konnte die Schuld für Kinderlosigkeit dann doch dem Mann und nicht ihnen angelastet werden. Hatte eine Frau Orgasmusprobleme und gab das ehrlich zu, wurde bei ihr weibliche Impotenz diagnostiziert. Dann war eine gründliche ärztliche Untersuchung erforderlich, wobei die Behandlung meist in einer simplen Manipulation von Klitoris und Brüsten bestand, ein ausreichendes Verfahren, um festzustellen, ob die Patientin impotent war. Wurden die Brustwarzen während der Untersuchung hart, war die Prognose verheißungsvoll, konnte die Patientin gar in den Zustand der »Erregung« versetzt werden, wurde dem erfreuten Ehemann eröffnet, dass seine Frau vollkommen gesund sei.
Trotz der Überzeugung vieler Viktorianer, Prostituierte wollten Prostituierte sein, weil sie unter einem unstillbaren sexuellen Appetit litten, durchstreiften Londons Unglückliche, wie sie von Presse, Polizei und Öffentlichkeit genannt wurden, die kalten, dunklen und verdreckten Straßen nicht, weil sie die »Erregung« suchten. Wenn sie den Weg der Sünde verließen und sich wieder Gott zuwandten, dann würde ihnen das mit Nahrung und Unterkunft gedankt. Gott kümmere sich um die Seinen, versicherten die Soldatinnen der Heilsarmee, wenn sie sich in die Slums des East End wagten, um kleine Kuchen und die Verheißungen des Herrn unter die Leute zu bringen. Unglückliche wie Martha Tabram nahmen den Kuchen dankend an und dann den nächsten Freier.
Ohne männliche Unterstützung hatte eine Frau wenig Möglichkeiten, für sich und ihre Kinder zu sorgen. Eine Stellung – falls sie für eine Frau überhaupt zu finden war – bedeutete zwölf Stunden Arbeit an sechs Tagen in der Woche für den Gegenwert von 25 Cent pro Woche, wenn sie in einem obskuren Betrieb Mäntel nähte, oder, mit einer hörigen Portion Glück, 75 Cent pro Woche, dann musste sie allerdings an sieben Tagen in der Woche vierzehn Stunden lang Streichholzschachteln kleben. Der größte Teil der Löhne floss ohnehin in die Taschen der gierigen Miethaie in den Slums, sodass Mutter und Kinder sich manchmal von dem faulenden Obst und Gemüse ernähren mussten, das sie im Müll an der Straße fanden.
Kein Wunder, dass manch eine verzweifelte Frau angesichts der vielen ausländischen Seeleute, deren Schiffe im nahen Hafen vor Anker gingen, der Soldaten und der männlichen Upperclass-Angehörigen, die sich auf heimlichen Streifzügen befanden, die Gelegenheit ergriff und ihren Körper für ein paar Geldmünzen vermietete, bis er ebenso heruntergekommen war wie die mit Ungeziefer verseuchten Bruchbuden, in denen die Bewohner des East End hausten. Unterernährung, Alkoholismus und körperliche Misshandlung ruinierten eine Frau schnell, und die Unglückliche rutschte in der Hackordnung immer weiter nach unten. Sie suchte die dunkelsten, entlegensten Straßen, Stiegen und Hinterhöfe auf, wo sie und ihre Freier gewöhnlich betrunken zu Boden sanken.
Mit Alkohol konnte man der Gegenwart am leichtesten entfliehen, weshalb eine unverhältnismäßig große Anzahl der »Menschen des Abgrunds«, wie Jack London die Bewohner des East End in seinem Buch The Abyss[2] nannte, Alkoholiker waren. Wahrscheinlich waren die Unglücklichen alle Trinkerinnen. Sie waren vorzeitig von Alter und Krankheit gezeichnet, von Ehemännern und Kindern verstoßen und nicht in der Lage, von christlicher Mildtätigkeit zu profitieren, da diese keinen Alkohol vorsah. Diese beklagenswerten Frauen suchten die Public Houses – Pubs – auf und baten die Männer, ihnen ein paar Drinks zu spendieren. Meist wurde das Geschäftliche anschließend geregelt.
Egal, wie das Wetter war, die Unglücklichen durchstreiften die Dunkelheit wie nachtaktive Tiere, immer auf der Suche nach einem Mann, und mochte er noch so grob und abstoßend sein, dem einige Pennys für ein paar Minuten der Lust zu entlocken war. Vorzugsweise wurde der Geschlechtsakt im Stehen ausgeführt, wobei die Prostituierte, mit dem Rücken zum Freier, ihre vielen Röcke raffte und aus dem Weg schob. Wenn sie Glück hatte, war er zu betrunken, um zu merken, dass sein Penis zwischen die Schenkel und nicht in eine der Körperöffnungen geschoben wurde.
Martha Tabram blieb die Miete schuldig, nachdem Henry Turner sie verlassen hatte. Sechs Wochen zuvor hatte sie das gemeinsame Zimmer in dem Haus Star Place Nr. 4, Commercial Road East, verlassen. Wo sie danach gewohnt hat, ist unklar, aber es steht zu vermuten, dass es verschiedene schäbige Pensionen waren oder dass sie sich, wenn sie die Wahl zwischen einem Bett und einem Rausch hatte, für den Rausch entschied und in Toreingängen döste, ständig von der Polizei davongejagt. Die letzten beiden Nächte, die des 4. und 5. August, verbrachte Martha in einer heruntergekommenen Pension in der Dorset Street, südlich eines Varietés in der Commercial Street.
Am Abend dieses zum Feiertag erklärten 6. August traf Martha um elf Uhr mit Mary Ann Connelly zusammen, die sich für die Arbeit den Namen Pearly Poll zugelegt hatte. Den ganzen Tag hindurch war das Wetter unangenehm gewesen, bedeckt und unbeständig, bei einer Temperatur, die mit elf Grad viel zu kalt für die Jahreszeit war. Auf den Nachmittagsdunst folgte dichter Nebel, der den Neumond verhüllte und bis sieben Uhr am nächsten Morgen anhalten sollte. Doch die beiden Frauen waren an widrige Witterung gewöhnt. Sie fanden es draußen vielleicht ungemütlich, dürften aber kaum gefroren haben, denn die Unglücklichen trugen in der Regel alle Kleidung, die sie besaßen, auf dem Leib. Wer keinen festen Wohnsitz hatte, konnte seine Habseligkeiten nicht in der Absteige lassen, weil sie ihm dort sofort gestohlen worden wären.
Trotz der späten Stunde ging es noch lebhaft zu, und der Alkohol floss in Strömen, denn die Londoner versuchten das, was ihnen vom freien Tag noch geblieben war, möglichst in die Länge zu ziehen. Die meisten Schauspiele und Operetten hatten um 20 Uhr 15 begonnen und waren jetzt zu Ende. Viele Theaterbesucher und andere Abenteurer ließen sich von den nebelverhangenen Straßen nicht abschrecken und machten sich in Mietdroschken oder zu Fuß auf die Suche nach Erfrischungen oder anderen Vergnügungen. Schon unter idealen Bedingungen waren die Sichtverhältnisse im East End schlecht. Es gab nur wenige, weit auseinanderstehende Gaslaternen. Jenseits der kleinen Kreise, die sie beleuchteten, war die Dunkelheit undurchdringlich. Das war die Welt der Unglücklichen, ein endloses Einerlei: Man verschlief den Tag, stand auf und trank, bis man betäubt genug war, um eine weitere Nacht lang seinem abstoßenden und gefährlichen Gewerbe nachgehen zu können.
Der Nebel machte einem nichts aus, es sei denn, der Verschmutzungsgrad war besonders hoch, sodass einem die beißende Luft in Augen und Lungen brannte. Der Nebel hatte wenigstens den Vorteil, dass man das Äußere des Freiers nicht zur Kenntnis nehmen musste und noch nicht einmal sein Gesicht sah. Der Freier war einem sowieso völlig gleichgültig, es sei denn, er zeigte persönliches Interesse an einer Unglücklichen und versorgte sie mit Unterkunft und Essen. Dann zählte er, aber praktisch kein Freier zählte noch, wenn man die Blüte seiner Jahre hinter sich hatte, schmutzig war, schäbige Kleider trug und durch Narben oder Zahnlücken entstellt war. Martha Tabram zog es vor, im Nebel zu verschwinden, es für einen Farthing hinter sich zu bringen, etwas zu trinken und sich dann vielleicht noch einen weiteren Farthing zu verdienen, um in einem Bett schlafen zu können.
Die Ereignisse, die zu ihrem Mord führten, sind gut dokumentiert und gelten als gesichert, wenn man nicht, wie ich, der Meinung ist, dass die Erinnerungen einer trunksüchtigen Prostituierten namens Pearly Poll möglicherweise einiges an Klarheit und Wahrhaftigkeit zu wünschen übrig lassen. Wenn sie bei den Polizeiverhören und der Verhandlung vor dem Coroner zur Feststellung der Todesursache am 23. August nicht direkt gelogen hat, dann war sie vermutlich verwirrt und litt unter alkoholbedingtem Gedächtnisverlust. Pearly Poll hatte schreckliche Angst. Vor der Polizei sagte sie aus, sie sei so außer sich, dass sie am liebsten in die Themse gehen würde.
Während der Verhandlung wurde Pearly Poll mehrere Male daran erinnert, dass sie unter Eid stehe, als sie aussagte, sie und Martha Tabran hätten am 6. August um 22 Uhr begonnen, mit zwei Soldaten in Whitechapel zu trinken. Um 23.45 Uhr hätten sich die beiden Paare getrennt. Pearly Poll berichtete dem Coroner und den Geschworenen, sie sei mit dem »Corporal« den Angel Court hinaufgegangen, während Martha sich mit dem »Gefreiten« in Richtung George Yard davongemacht habe. Beide Soldaten hätten weiße Bänder um ihre Mützen getragen. Pearly Poll erklärte, zum letzten Mal habe sie Martha und den Gefreiten gesehen, als sie auf die verfallenen George Yard Buildings, einen Mietskasernenkomplex in der Commercial Road, zugegangen seien, mitten im dunklen Herzen der East-End-Slums. Laut Pearly Poll ist nichts Außergewöhnliches passiert während der Zeit, die sie in jener Nacht mit Martha verbracht hat. Das Zusammensein mit den Soldaten sei sehr angenehm verlaufen. Es habe keinen Streit und keine Auseinandersetzung gegeben, nichts, was ein Anlass zur Besorgnis für Pearly Poll oder Martha hätte sein müssen, die schon viel gesehen hatten und nicht ohne Grund so lange auf den Straßen Londons überlebt hatten.
Pearly Poll behauptete, sie habe keine Ahnung, was mit Martha nach 23.45 Uhr geschehen sei, noch könne sie sich erinnern, was sie selbst getan habe, nachdem sie sich mit ihrem Corporal zu »unmoralischen Zwecken« verdrückt habe. Als Pearly Poll erfuhr, dass Martha ermordet worden war, machte sie sich vielleicht Sorgen um sich selbst und überlegte sich sorgfältig, was sie den Polypen verriet. Sie traute es den Gesetzeshütern durchaus zu, dass sie sich ihre Geschichte anhörten, um sie dann als »Sündenbock für fünftausend ihres Gewerbes« hinter Gitter zu bringen. Pearly Poll blieb bei ihrer Geschichte: Sie habe sich mit ihrem Freier nach Angel Court begeben, gut anderthalb Kilometer von der Stelle entfernt, wo sie sich von Martha getrennt hatte. Angel Court lag in der City of London und fiel damit nicht mehr in die Zuständigkeit der Metropolitan Police.
Wenn sich eine gewiefte, erfahrene Prostituierte wie Pearly Poll auf diese Weise der Zuständigkeit der Metropolitan Police entzog, nahm das den Polizisten und Ermittlungsbeamten vermutlich jede Lust, den Fall weiter zu verfolgen und sich all den Kompetenzstreitigkeiten auszusetzen, die damit verbunden gewesen wären. Die City of London – besser bekannt als die »Square Mile« – ist eine merkwürdige, widerborstige Einrichtung, die auf das Jahr 1 n. Chr. zurückgeht, als die Römer die erste Siedlung an den Ufern der Themse erbauten. Noch heute ist die City eine selbstständige Stadt mit eigener Verwaltung und eigenen Behörden, die für 6000 Bewohner zuständig sind – eine Zahl, die während der Geschäftszeiten auf mehr als eine Viertelmillion anwächst.
In der Vergangenheit hat die City nie besonders viel Anteil genommen an den Sorgen des größeren Londoner gebiets, es sei denn, diese Probleme hätten sich irgendwie auf die Autonomie oder Lebensqualität der City ausgewirkt. Stets blieb die City eine widerspenstige Oase des Wohlstands inmitten der wachsenden Metropole. Wenn die Menschen von London sprechen, meinen sie immer die große Metropole. Viele Touristen wissen gar nichts von der Existenz der City. Ich weiß nicht, ob Pearly Poll ihren Freier wirklich in die verlassene City führte, um der Metropolitan Police aus dem Weg zu gehen, oder ob sie andere Gründe hatte. Vielleicht ist sie auch gar nicht in die Nähe der City gekommen, sondern hat ihren Job rasch erledigt, den mageren Liebeslohn eingestrichen und sich in den nächsten Pub begeben oder ist in die Dorset Street zurückgekehrt, um sich ein Bett zu suchen.
Zwei Stunden und fünfzehn Minuten nachdem Pearly Poll nach eigenem Bekunden Martha zum letzten Mal gesehen hatte, befand sich Police Constable 226 Barrett von der Metropolitan Police Division H auf einer Routinestreife in der Wentworth Street, die die Commercial Street kreuzte und an der Nordseite der George Yard Buildings vorbeiführte. Um zwei Uhr nachts bemerkte Barrett einen Soldaten. Er schien zu einem der Wachregimenter der Foot Guards zu gehören, die weiße Bänder um ihre Mützen trugen. Barrett schätzte, dass der Soldat, ein Gefreiter, 22 bis 26 Jahre alt und einen Meter fünfundsiebzig bis einen Meter fünfundachtzig groß war. Der junge Mann in seiner sauberen Uniform war von heller Hautfarbe, trug einen kleinen, dunklen Schnurrbart, der an den Enden hochgezwirbelt war, und hatte keine Orden, abgesehen von einem Good Conduct Badge, einer Spange, die für gute Führung verliehen wurde. Der Soldat erklärte Constable Barrett, er »warte auf einen Kumpel, der mit einem Mädel mitgegangen ist«.
Zur gleichen Zeit, da dieses kurze Gespräch stattfand, kamen Mr. und Mrs. Mahoney, wohnhaft in den George Yard Buildings, an dem Treppenabsatz vorbei, auf dem Marthas Leichnam später entdeckt wurde. Sie hörten nichts Besonderes und sahen niemanden. Martha war noch nicht ermordet worden. Vielleicht stand sie in der Nähe in einer dunklen Ecke und wartete darauf, dass der Polizist seine Streife fortsetzte, damit sie ihr Geschäft mit dem Soldaten fortsetzen konnte. Vielleicht hatte der Soldat auch überhaupt nichts mit Martha zu tun und sorgte einfach nur für Verwirrung. Fest steht jedenfalls, dass Police Constable Barretts Aufmerksamkeit von einem Soldaten erregt wurde, der sich um zwei Uhr nachts allein vor den George Yard Buildings herumtrieb und sich – ob auf Befragen des Constable oder nicht – bemüßigt fühlte, seine Anwesenheit an diesem Ort zu erklären.
Die Identität dieses Soldaten oder irgendwelcher Soldaten, die in der Nacht des 6. August und am frühen Morgen des 7. mit Pearly Poll und Martha zu tun hatten, wurde nie geklärt. Pearly Poll, Barrett und andere Zeugen, die Martha auf der Straße bemerkt hatten, waren außerstande, irgendeinen der Soldaten im Wachraum des Tower of London oder in den Wellington-Kasernen eindeutig zu identifizieren. Jeder Mann, der auch nur eine entfernte Ähnlichkeit aufwies, hatte ein überzeugendes Alibi. Man durchsuchte die Sachen der Soldaten, förderte aber keine Beweise zutage, vor allem keine Blutflecken, und Marthas Mörder musste sehr blutig gewesen sein.
Wie Chefinspektor Donald Swanson von Scotland Yards Central Investigation Department (CID), der zentralen Ermittlungsabteilung, in seinem Sonderbericht einräumte, gab es keinen Grund für die Annahme, dass Martha Tabram mit jemand anders zusammen gewesen sei als dem Soldaten, mit dem sie vor Mitternacht davongegangen sei. Allerdings sei es aufgrund des »verstrichenen Zeitraums« möglich, dass sie noch einen weiteren Freier gehabt habe. Es hätten mehrere sein können. Das Rätsel des »Gefreiten«, der um 23 Uhr 45 mit Martha gesehen wurde, und des »Gefreiten«, den P.C. Barrett um zwei Uhr erblickte, machte Scotland Yard ziemlich zu schaffen, weil die Nähe zur Tatzeit und zum Tatort sehr auffällig war. Vielleicht hat er es getan. Und vielleicht war er wirklich ein Soldat.
Vielleicht war er aber auch ein Mörder, der sich als Soldat verkleidet hatte. Was für ein brillanter Einfall wäre das gewesen! Am Abend des Feiertags waren viele Soldaten unterwegs, und das »Aufreißen« von Prostituierten war durchaus kein ungewöhnlicher Zeitvertreib für Militärangehörige. Die Vermutung, Jack the Ripper habe sich eine Uniform angezogen und einen Schnurrbart angeklebt, um seinen ersten Mord zu begehen, mag etwas weit hergeholt erscheinen, andererseits war es keinesfalls das letzte Mal, dass ein geheimnisvoller Mann in Uniform im Zusammenhang mit einem Mord im Londoner East End eine Rolle spielte.
Walter Sickert kannte sich mit Uniformen aus, und während des Ersten Weltkriegs, als er Schlachtengemälde malte, gab er zu, dass ihn französische Uniformen besonders »entzückten«. »Heute habe ich meine belgischen Uniformen bekommen«, schrieb er 1914. »Die Feldmütze der Artilleristen mit einer kleinen goldenen Quaste ist das fescheste Ding der Welt.« In seiner Jugend hatte Sickert häufig Männer in Uniformen und Rüstungen skizziert. Mr. Nemo, der Schauspieler, feierte seinen größten Erfolg bei der Kritik 1880, als er in Shakespeares Heinrich V. einen französischen Soldaten spielte. Irgendwann zwischen 1887 und 1889 malte Sickert ein Bild mit dem Titel It all Comes From Sticking to a Soldier (»Das kommt davon, wenn man mit einem Soldaten geht«): Man sieht den Nachtklubstar Ada Lundberg inmitten einer Gruppe von lüsternen Männern singen.
Sein Leben lang blieb Sickert diesem Interesse an militärischen Accessoires treu. Im Krieg bat er das Rote Kreuz wiederholt um Uniformen von Soldaten, die verkrüppelt oder gefallen waren. Er brauche sie, erklärte er, um damit Modelle für seine militärischen Skizzen und Gemälde zu bekleiden. Einmal sei Sickerts Atelier mit Uniformen und Gewehren vollgestopft gewesen, berichtete ein Bekannter.
»Ich arbeite am Porträt eines lieben Toten, eines Obersten …«, schrieb er. Er bat einen anderen Freund, ihm behilflich zu sein, »einige Uniformen von Belgiern im Lazarett auszuleihen. Es widerstrebt einem, aus dem Unglück anderer Kapital zu schlagen.« Es widerstrebte ihm nicht wirklich. Mehr als einmal gestand er seine »rein egoistische Lebensführung« ein und bekannte: »Ich lebe ausschließlich für meine Arbeit oder – wie einige Menschen es auszudrücken belieben – für mich selbst.«
Es ist schon überraschend, dass auf die Möglichkeit, der Ripper könnte sich verkleidet haben, nicht häufiger hingewiesen wurde und dass ein solches Szenario nicht in Betracht gezogen wurde, würde es doch erklären, warum er nach seinen Verbrechen so spurlos verschwinden konnte. Ein verkleideter Ripper würde auch die Vielzahl unterschiedlicher Zeugenbeschreibungen der Männer, die angeblich zuletzt mit den Opfern gesehen wurden, plausibel machen. Dass Gewalttäter Verkleidungen tragen, ist nicht ungewöhnlich. Unter verurteilten Serientätern, sogar Sexualmördern, gibt es eine ganze Reihe, die sich als Polizisten, Soldaten, Handwerker, Lieferanten, Sanitäter und sogar Clowns verkleidet haben. Eine Verkleidung ist ein einfaches und wirksames Mittel, um sich Zugang zu verschaffen, das Opfer zu ködern, ohne dass es Widerstand leistet oder Verdacht schöpft, und ungeschoren mit Raub, Vergewaltigung und Mord davonzukommen. Verkleidungen gestatten dem Täter, an den Ort des Verbrechens zurückzukehren und das Schauspiel der Ermittlungen zu beobachten oder die Beerdigung des Opfers zu besuchen.
Einem Psychopathen ist jedes Mittel recht, sein grausiges Vorhaben in die Tat umzusetzen. Vertrauen zu erwecken, bevor man den Mord begeht, gehört zum Drehbuch des Psychopathen, und das verlangt schauspielerische Fähigkeiten, egal, ob der Täter jemals auf einer Bühne gestanden hat oder nicht. Wer einmal die Opfer eines Psychopathen gesehen hat, lebendig oder tot, hat Schwierigkeiten, einen solchen Täter als Menschen zu bezeichnen. Wer Jack the Ripper verstehen will, muss Psychopathen verstehen, aber verstehen heißt nicht unbedingt auch akzeptieren. Was diese Menschen tun, ist allen Phantasien und Gefühlen, die die meisten von uns je gehabt haben, völlig fremd. Wir alle besitzen die Fähigkeit zum Bösen, aber Psychopathen sind nicht wie wir alle.
Psychiater verstehen unter Psychopathie eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, die bei Männern öfter anzutreffen ist als bei Frauen und bei den männlichen Kindern eines Vaters, der an dieser Störung leidet, statistisch betrachtet fünfmal so häufig auftritt wie in der Normalbevölkerung. Laut dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders gehören zu den Symptomen der Psychopathie: Stehlen, Lügen, Drogenmissbrauch, finanzielle Unverantwortlichkeit, die Unfähigkeit, Langeweile auszuhalten, Grausamkeit, von zu Hause Fortlaufen, Promiskuität, Gewaltbereitschaft, Mangel an Gewissensbissen.
Untereinander weisen Psychopathen ebenso viele Unterschiede auf wie Nichtpsychopathen. Psychopathen können promisk sein und lügen, aber sich finanziell verantwortlich verhalten. Sie mögen streitlustig und promisk sein, aber nicht stehlen. Vielleicht quälen sie Tiere, neigen aber nicht zu Alkohol- oder Drogenmissbrauch. Oder sie quälen Menschen, aber keine Tiere. Sie begehen mehrere Morde, sind aber nicht promisk. Die antisozialen Verhaltensweisen lassen sich endlos kombinieren. Doch ein ganz besonderer und entscheidender Wesenszug ist allen Psychopathen eigen: Sie kennen keine Reue, keine Schuldgefühle, kein Gewissen.
Monate bevor ich den Serienkiller John Royster während seines Mordprozesses im Winter 1997 in New York City tatsächlich zu Gesicht bekam, hatte ich schon von ihm gehört und gelesen. Ich war schockiert, was für einen höflichen und freundlichen Eindruck er machte. Sein angenehmes Äußeres, die saubere Kleidung, seine schmächtige Gestalt, die Zahnklammer – all das bestürzte mich, während ihm die Handschellen abgenommen und er an den Tisch der Verteidigung geführt wurde. Wäre ich Royster beim Joggen im Central Park begegnet und hätte er mir sein klammerversilbertes Lächeln zugeworfen, ich hätte nicht den leisesten Hauch von Furcht verspürt.
In der Zeit vom 4. bis zum 11. Juni 1996 zerstörte John Royster das Leben von vier Frauen, indem er sie von hinten packte, zu Boden riss und ihren Kopf wiederholt mit aller Gewalt auf Beton- oder Kopfsteinpflaster schlug, bis er sie für tot hielt. Er war kaltblütig genug, um vor jedem Überfall Rucksack und Mantel abzulegen. Wenn seine Opfer blutend am Boden lagen, bis zur Unkenntlichkeit entstellt, vergewaltigte er sie, wenn er konnte. Seelenruhig hob er anschließend seine Sachen auf und verließ den Tatort. Den Kopf einer Frau zu Brei zu schlagen war sexuell erregend für ihn, und er gestand der Polizei, dass er keine Reue verspüre.
Ende der 1880er-Jahre wurde diese Form der antisozialen Persönlichkeitsstörung – eine sehr blasse Bezeichnung – als »moralischer Irrsinn« diagnostiziert, ein Begriff, der ironischerweise unlängst vor Gericht als Argument der Verteidigung verwendet wurde. In einem kriminologischen Buch aus dem Jahr 1893 wird der Psychopath, wie wir ihn heute nennen würden, als »reiner Mörder« definiert. Diese Menschen seien »ehrlich«, erläutert der Autor Arthur McDonald, weil sie nicht Diebe »von Natur aus« seien, und viele seien überdies »von keuschem Wesen«. Doch alle seien unfähig, »den geringsten Abscheu« über ihre grausame Tat zu empfinden. In der Regel würden reine Mörder »Spuren ihrer mörderischen Neigung« schon in der Kindheit erkennen lassen.
Psychopathen können Männer oder Frauen, Kinder oder Erwachsene sein. Nicht immer sind sie gewalttätig, aber stets gefährlich, weil sie keine Regeln anerkennen und ihnen kein Leben etwas gilt, außer dem eigenen. Psychopathen haben irgendeinen Faktor X an sich, der den meisten von uns fremd oder sogar unverständlich ist, und zu dem Zeitpunkt, da ich diese Zeilen schreibe, kann niemand mit Sicherheit sagen, ob dieser Faktor X durch genetische oder pathologische (etwa ein Schädel-Hirn-Trauma) Ursachen hervorgerufen wird oder auf eine Verderbtheit höherer Art zurückzuführen ist, die jenseits unserer begrenzten Vorstellungskraft liegt. Neuere Untersuchungen des kriminellen Gehirns lassen darauf schließen, dass die graue Substanz des Psychopathen möglicherweise ungewöhnliche Eigenschaften aufweist. Eine Studie an inhaftierten Mördern hat ergeben, dass 80 Prozent von ihnen als Kinder missbraucht wurden und dass 50 Prozent dieser Straftäter über Stirnlappenanomalien verfügten.
Der Stirnlappen ist die Kontrollinstanz für zivilisiertes menschliches Verhalten und liegt, wie der Name verrät, im vordersten Teil des Gehirns. Schädigungen, etwa durch Tumoren oder Kopfverletzungen, können völlig normale Menschen in unbeherrschte, aggressive und gewalttätige Geschöpfe verwandeln. In der Zeit nach 1900 wurde hochgradig antisoziales Verhalten durch die berüchtigte präfrontale Lobotomie behandelt, bei der man mithilfe eines eispickelähnlichen Instruments, das man durch den Knochen der Augenhöhle trieb, die Verbindungen zwischen Stirnhirn und dem übrigen Gehirn durchtrennte.
Das psychopathische Gehirn kann jedoch nicht allein durch traumatische Kindheitserlebnisse und Hirnläsionen erklärt werden. Untersuchungen mit der Positronenemissionstomographie (PET), die uns Bilder des lebendigen und arbeitenden Gehirns liefern, zeigen, dass es im vorderen Stirnlappen eines Psychopathen deutlich weniger neuronale Aktivität gibt als bei einer »normalen« Person. Das legt die Vermutung nahe, dass die Hemmungen und Sperren, die die meisten von uns von Gewaltakten und dem Ausleben unserer mörderischen Impulse abhalten, im Stirnlappen des psychopathischen Gehirns nicht vorhanden sind. Gedanken und Situationen, die die meisten Menschen innehalten lassen, Betroffenheit und Furcht auslösen und zur Unterdrückung grausamer, gewalttätiger oder illegaler Impulse führen würden, hinterlassen keine Spuren im psychopathischen Stirnlappen. Die Versuchung, zu stehlen, zu vergewaltigen, jemanden zu überfallen, zu lügen oder irgendetwas anderes zu tun, was andere verletzen, schädigen oder demütigen könnte, ist für den Psychopathen nichts Besonderes.
25 Prozent aller Straftäter und bis zu vier Prozent der Gesamtbevölkerung sind psychopathisch. Heute stuft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die »dissoziale Persönlichkeitsstörung«, die antisoziale Persönlichkeitsstörung oder die Soziopathie, als Krankheit ein. Egal, wie wir sie nennen, Psychopathen lassen keine normalen menschlichen Gefühle erkennen und stellen einen kleinen Prozentsatz von Menschen, der für einen großen Prozentsatz von Verbrechen verantwortlich ist. Diese Menschen sind außerordentlich gerissen und führen Doppelleben, sodass selbst nahestehende Freunde und Angehörige meist keine Ahnung haben, dass sich hinter der liebenswürdigen Maske ein Ungeheuer verbirgt, das sich – wie Jack the Ripper – erst unmittelbar vor dem Angriff zu erkennen gibt.
Psychopathen sind unfähig, Liebe zu empfinden. Wenn sie etwas zeigen, was Reue, Kummer oder Trauer zu sein scheint, geschieht es aus reiner Berechnung und entspringt den eigenen Bedürfnissen, nicht aber echter Rücksichtnahme auf die Interessen anderer. Oft sind Psychopathen attraktiv, charismatisch und überdurchschnittlich intelligent. Sie sind triebhaft, aber wohlorganisiert in der Ausführung ihrer Pläne und Verbrechen. Es gibt keine Heilung für sie. Sie können nicht resozialisiert oder »vor kriminellem Unglück bewahrt« werden, wie Francis Galton, der Vater der Fingerabdruck-Klassifikation, 1883 schrieb.
Vor dem Kontakt hat der Psychopath sein Opfer häufig schon einige Zeit verfolgt und es zum Objekt seiner Gewaltphantasien gemacht. Unter Umständen spielt er die Tat in Gedanken immer wieder durch, um seine Vorgehensweise zu üben und die Tat so sorgfältig zu planen, dass Erfolg und Entkommen gesichert sind. Die Proben können sich über Jahre hinziehen, bevor es wirklich zur Premiere kommt, aber noch so viel Übung und strategische Überlegungen können nicht garantieren, dass die Vorstellung auch wirklich fehlerlos über die Bühne gehen wird. Fehler geschehen nun einmal, besonders bei Premieren. Als Jack the Ripper seinen ersten Mord beging, unterlief ihm jedenfalls ein amateurhafter Fehler.
4Von unbekannt
Als Martha Tabram ihren Mörder auf den dunklen Trep-penabsatz im ersten Stock der George Yard Buildings Nr. 37 führte, überließ er ihr unachtsamerweise die Initiative und riskierte damit, dass sein Plan nicht richtig klappte.
Ihr eigenes Revier war möglicherweise nicht der Schauplatz, den er für sein blutiges Vorhaben vorgesehen hatte. Vielleicht geschah auch etwas anderes, womit er nicht gerechnet hatte – eine Beleidigung, eine höhnische Bemerkung. Prostituierte, besonders wenn sie altgedient sind und betrunken, zeichnen sich nicht gerade durch besonderes Feingefühl aus. Es hätte schon genügt, dass Martha ihm zwischen die Beine griff und fragte: »Wo ist er denn, Süßer?« In einem seiner Briefe hat Sickert den Ausdruck »impotente Wut« verwendet. Über einen zeitlichen Abstand von mehr als hundert Jahren kann ich nicht rekonstruieren, was damals in dem stockfinsteren, stinkenden Treppenhaus wirklich geschah, aber der Täter wurde wütend. Er verlor die Beherrschung.