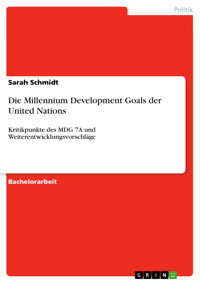Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ey, ich heiß nicht mehr Elvis, ich heiß jetzt Pogo", sagte er. Der Punk, der eben noch Rocker war, ist blamiert. Alle treten sie hier auf: der Jesus-Freak, die für Männer unsichtbare Frau, der Motorradfahrer aus der Vorstadt, die notorische Schorf-Abkratzerin, die Frau, die immer für eine Faschistin gehalten wird oder die blöde Thekenbekanntschaft. In den hier versammelten Storys geht es um die zweite große Liebe, schlechten Sex, um das merkwürdige Verhältnis zu Vögeln, und draußen "ist Neukölln". In "Bad Dates" zeigt sich bei vielen schnellen, hochkomischen Dates ein Panorama unseres Alltags. Wer bei diesen Geschichten nicht lacht, der hatte kein Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah Schmidt
Bad Dates
Geschichten
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
zuvorderst möchte ich Sie gerne beglückwünschen zu dem Buch, das Sie hier in den Händen halten. Denn es ist ein gutes Buch. Falls dieses Vorwort tatsächlich das erste ist, das Sie in diesem Buch lesen, kann ich Sie auch gleich beruhigen. Die Geschichten in diesem Buch sind sehr viel besser als das Vorwort. Von daher würde ich Ihnen auch am liebsten raten, dieses Vorwort einfach zu überblättern und direkt in die wunderbaren Geschichten einzutauchen. Das Vorwort können Sie hinterher ja immer noch lesen. Ich verspreche Ihnen, Sie verpassen nichts.
Da ich Sarah Schmidt schon ziemlich lange kenne und schätze, ist dieser Text womöglich ohnehin ein wenig persönlicher geraten, als es vielleicht angezeigt wäre. Zum ersten Mal begegnet bin ich Sarah 1991 bei einer Veranstaltung der KPD/RZ (Kreuzberger Patriotische Demokraten/Realistisches Zentrum), einer ambitionierten Regionalpartei, welche sich für ein Rauchverbot in Einbahnstraßen einsetzte, die Zeppelinindustrie in Kreuzberg ankurbeln wollte und schon damals forderte, den 4. November wegen Klimaanpassung abzuschaffen. Eine der vielen Stationen ihres sehr bewegten Lebens.
1994 dann stieß sie zum Frühschoppen. Von nun an schrieb sie Monat für Monat mindestens eine der Geschichten ihres Lebens auf. Zu den großen Stärken dieser Erzählstücke zählt, dass Sarah eigentlich nie dem Erlebten sehr viel hinzufügen musste. Die Erlebnisse waren in den allermeisten Fällen schon Geschichte genug. Hieraus nun erwuchs über die Jahre ein kleiner Schatz, von dem Sie nun einen erheblichen Anteil in den Händen halten. Ein Schatz, der weit mehr ist, als nur eine Sammlung von Texten. In seiner Gesamtheit spiegelt er die geglückte, dynamische Symbiose einer zunächst jungen, dann immer noch jungen und schließlich mitteljungen Frau mit den Widrigkeiten des Lebens wider. Mit Widrigkeiten sind hier gemeint: die Welt an sich, andere Menschen (darunter auch viele Männer) und der ganze Rest, der ja auch immer noch dazukommt.
Natürlich kann man dieses Buch auch als Westberliner Biographie in Episoden sehen. Oder in Dates und Daten. Zumeist schlimmen Daten, wie der Titel verspricht. Aber dies sei nun wirklich jedem selbst überlassen. So wie ich Sie jetzt leichten Herzens Sarahs Geschichten überlasse. Denn ich weiß, da sind Sie in guten Händen.
Berlin, im Juli 2007
Horst Evers
Der Pottkopf
Meine kleine Schwester Sandra war zwölf, als sie ihr erstes richtiges Date hatte. Thomas steckte ihr in der Schule eines jener kleinen Zettelchen zu, mit denen Teenager alles Wichtige besprechen. Willst du mit mir gehen? Ja. Nein. Vielleicht.
Sandra war nicht beliebt und gutaussehend. Thomas war es ebenfalls nicht. Wir waren Mädchen, die aus einer Kleinstadt nach Berlin verfrachtet worden waren, Mädchen, die für die arroganten Klassenkameraden die falsche Jeansmarke trugen und den falschen Dialekt sprachen. Zudem war Sandra von einer starken Kurzsichtigkeit betroffen, die unsere Mutter mit einem hässlichen Kassenbrillengestell für ausreichend gewürdigt befand.
Thomas hingegen war ein armer Junge, dessen Vater einmal im Monat einen Kochtopf nahm, seine fünf Kinder antreten ließ, und ihnen nacheinander befahl, den Topf auf den Kopf zu setzen, um ihnen dann mit einer stumpfen Schere alle Haare, die unter dem Rand hervorschauten, abzuschneiden. Um diese Erniedrigung perfekt zu machen, nannte sie ganz Berlin-Schmargendorf nur Familie Pottkopf.
Aus heutiger Sicht empfinde ich eine gewisse Bewunderung für den, natürlich trinkenden, Vater Pottkopf. Mit seinem perversen Tick hatte er eine meisterhafte Verhütungsmethode für seine Kinder erfunden. Hätte er sich mit unserer Mutter und ihren Kassengestellen zusammengetan, die ganze Sache größer aufgezogen, sie hätten ganz Wilmersdorf ausrotten können. Nie wieder wäre dort eine Romanze zustande gekommen. Nicht die schlechteste Vorstellung.
Doch weder unsere Mutter noch der Vater von Thomas hatten mit Sandras Verzweiflung gerechnet. Sie hatte bislang keinerlei Erfahrungen mit Jungen und war mehr als begierig, endlich auch irgendwas mit ihnen zu machen. Was auch immer ihr da vorschwebte, es würde ihr vielleicht eine gewisse Achtung der anderen Mädchen einbringen. Also kreuzte sie auf dem kleinen Zettel ›Vielleicht‹ an. Ein Anfang.
In den darauffolgenden Tagen schrieb der Pottkopf Liebesbriefe, in denen er Komplimente machte, die Sandra nie zuvor gehört hatte. Er war begabt und geübt im Lügen. Sie sei so hübsch, schrieb er und ihr Lächeln so wunderbar, klug sei sie und wunderschön. Er verzierte die Briefe mit Herzen und Blumengirlanden und schrieb, er möchte sich unbedingt einmal mit ihr alleine treffen. Sie schwebte, solange sie alleine war, im Liebeshimmel und in ihren Träumen wurde der Pottkopf immer hübscher. An den langen Abenden im Bett, als sie noch nicht wusste, was sie mit ihren Händen anfangen könnte außer in der Nase zu bohren, malte sie sich eine glanzvolle Zukunft aus. Sobald allerdings eine ihrer angeblichen Freundinnen anwesend war, von denen sie wusste, dass die hinter ihrem Rücken über sie lästerten, tat sie, als sei alles wie immer. Sie machte mit bei kleinen fiesen und großen gemeinen Scherzen über Familie Pottkopf und sah Thomas nicht an.
Nach einer Woche dieser heimlichen Spiele antwortete sie ihm, sie sei bereit für ein Treffen. Allerdings, das war ihre Bedingung, es musste an einem absolut einsamen Ort sein, an dem niemand die beiden zufällig sehen könnte. Ansonsten wäre auch das letzte Häufchen Achtung, das ihr die Schmargendorfer Schülergemeinde entgegenbrachte, verloren und sie würde sich umbringen müssen. Das sollte ihr nicht schwer fallen. Schließlich war sie zwölf: In diesem Alter ist Selbstmord nichts wirklich Endgültiges. Immerhin ist man bei der eigenen Beerdigung anwesend und kann zusehen wie alle zusammenbrechen vor Schuld und Schmerz und Trauer. Viele werden erst am Grab merken, wie sehr sie Sandra geliebt haben und erkennen, welch besonders hell leuchtender Stern sie für die Menschheit gewesen war. Dies ist der Moment, in dem man in aller Regel hinter einem Gebüsch auftaucht und sich von allen umarmen und küssen lässt und Entschuldigungen huldvoll entgegen nimmt. So etwa ist Selbstmord mit zwölf.
Es ist nicht einfach, in einer eingemauerten Stadt einen wirklich einsamen Ort zu finden. Thomas dachte nach und schlug dann den stillgelegten S-Bahnhof Hohenzollerndamm vor. Viele gingen dort vorbei, doch niemand betrat den Bahnsteig mit seinen dunklen Ecken, dicken Säulen und dem Bahnwärterhäuschen mit kaputten Scheiben. Nur Tauben, Katzen, Ratten und Hunde traf man hier beim Stelldichein. Manchmal vielleicht – wenn man dem Geruch glauben durfte – wurde der Bahnhof von Obdachlosen zur Pinkelpause genutzt. Ansonsten ein perfekter Ort. Sandra sagte zu. In zwei Tagen, abends um sieben, sollte ihr erstes Rendezvous stattfinden. Was wohl passieren würde? Wie würde es sein mit Zunge zu küssen? Ob sie vielleicht kotzen müsste, wenn sie die Spucke vom Pottkopf in ihrem Mund hätte? Vermutlich.
Doch am nächsten Morgen wurden diese Gedanken in den Hintergrund geschoben, denn Sandra bekam ihre Periode. Ihre allererste.
Heute feiern Familien Freudenfeste aus diesem Anlass. Bei uns war das nicht so. Als ich elf war, fand ich im Wäscheschrank zwischen den Schlabberunterhosen versteckt – schon damals waren diese nicht modern, jedoch die einzigen, die unsere Mutter bereit war zu kaufen –, eine Packung Hygienebinden, ohne Seitenflügel oder Klebestreifen. Daneben lag eine merkwürdige Plastikunterhose, mit Gummizug an den Beinöffnungen und Druckknöpfen im Schritt.
Genauso erging es Sandra an ihrem elften Geburtstag und ich klärte sie so auf, wie unsere ältere Schwester es mit mir zuvor getan hat. Man verliert literweise Blut, hat Krämpfe, entsorgt unauffällig die blutigen Wattebinden und trägt ansonsten auf keinen Fall diese Plastikunterhose, denn das ist einfach unter jeder Würde.
Sandra betete seitdem jeden Abend zu Gott, mit Versprechungen, dass sie ihr Leben unter seine Obhut stellen wird, wenn er sie dafür mit der Mensis verschont. Doch Gott ist ein Mann und so war es kein Wunder, dass ER beschloss, dieses Ereignis nur einen Tag vor ihrer ersten Verabredung geschehen zu lassen. Sandra war pragmatisch, befolgte meine Ratschläge und entschied über diesen neuen grauenvollen Aspekt in ihrem Leben auch später noch nachdenken zu können. Nach morgen, dem Tag aller Tage.
Dann war es endlich soweit, sie war schrecklich aufgeregt und dachte nach dem Aufwachen morgens um halb sechs lange darüber nach, was sie abends anziehen würde. Womit würde sie nicht überkandidelt aussehen, aber trotzdem unwiderstehlich gut? Die Antwort lag auf der Hand – sie brauchte etwas aus meinem Schrank. Denn fast alles was ich trug, war für sie cool und sexy. Das war es nicht wirklich, nur in den Augen einer jüngeren Schwester. Sie schlich in mein Zimmer – Verboten! – und wühlte in meinem Schrank. Sie wusste, was sie suchte: Meine Schlaghose aus Cord, mit Streifen in den Farben des Regenbogens – Anfassen bei Androhung von ewigen Höllenqualen verboten!
Am frühen Abend schlichen Thomas und Sandra Hand in Hand mit klopfenden Herzen auf den verwaisten Bahnhof. Sie in meiner coolsten Hose, er mit seinen wie immer schlechtsitzenden Hosen und einem karierten Hemd. Und abgesehen von der Taubenscheiße, dem Müll, dem Pissegestank und einem Hund, der in feuchten Ecken herumschnüffelte, waren sie tatsächlich alleine.
Thomas zeigte auf eine Bank. »Hier vielleicht?« Diese Bank war genauso gut wie jede andere, doch Sandra wollte, aus Angst und in der Hoffnung, durch ein wenig gewonnene Zeit wieder normal atmen zu können, noch weiter und zeigte auf eine Winterstreukiste am Ende des Bahnsteigs. Pottkopf war einverstanden, er wäre mit ihr noch stundenlang weitergelaufen, wenn am Ende des Weges tatsächlich die Erlaubnis stand, sie anfassen zu dürfen.
Sie schlenderten weiter und Sandra versuchte auf ungewohnt hohen Absätzen sexy die Hüften zu schwingen. Und dann geschah es. Durch eine unglückliche Schwenkung fiel aus der Schlabberunterhose durchs Schlaghosenbein eine dicke und ziemlich blutige Binde direkt vor Pottkopfs Füße.
Sterben, bitte sofort sterben! Wo ist der nächste Zug, vor den sie sich werfen könnte. Sandra hasste die DDR in diesem Moment aus tiefstem Herzen. Wegen der kam auf dem verdammten Bahnhof seit über zwanzig Jahren kein einziger Zug und es war mehr als unwahrscheinlich, dass sich dies in den nächsten Minuten ändern würde. Also suchte sie ihr Heil im Angriff.
»Guck mal, da hat eine ihre Binde einfach weggeworfen. Ist ja eklig.«
Das war nicht schlecht. Wirklich. Und vielleicht hätte es sogar funktioniert, wenn nicht in diesem Moment der Hund hergekommen wäre, schwanzwedelnd und vom Blutgeruch angezogen, und zuerst begeistert an der Binde und dann an Sandra geschnüffelt hätte. Er fand die Quelle des Blutes ohne Umwege und er mochte ihren Geruch. Zweifelsfrei, denn als nächstes hängte er sich an ihr Schienbein und versuchte es zu ficken.
So stand sie da, einen geilen Hund am Bein, eine blutige Binde vor ihren Füßen. Ihr größtes Geheimnis lag zwischen ihr und dem Pottkopf. Er aber drehte sich ohne ein weiteres Wort um und verschwand.
Ich habe Hausstaub
Von Zeit zu Zeit bekomme ich gern Hausbesuch von Handwerkern. Die mag ich. Nur in einer Hinsicht ist meine Sympathie eingeschränkt. Länger als zwei Stunden halte ich sie nicht aus.
Nach zwei Stunden werden auch die freundlichsten Handwerker wie Fisch, der stinkt und raus muss aus der Wohnung. Solange sie sich aber an diese Zeitvorgabe halten, kommen wir gut miteinander aus.
Da gibt es etwa den Klempner, der mir den Ursprung des schönen Wortes »Bauarbeiterdekolleté« zeigt, indem er auf allen vieren kniend seinen Hintern, der von einer schlechtsitzenden, rutschenden Jeans bedeckt ist, in die Höhe reckt.
Es gibt den Ofensetzer, der immer staubig ist und viel Dreck macht, diesen aber jedes Mal vollständig mit aus meiner Wohnung nimmt, zum Dank, weil ich mir ausführlich die Erzählungen über seine Erfahrungen mit Frauen anhöre. Man kann diese zwar in einem Satz zusammenfassen, der lautet: Mit den Frauen und ihm, das klappt nicht. Man kann diese Erkenntnis allerdings auch lang und breit mit mehreren Fallbeispielen erläutern. So macht er es.
Ich höre mir alles an, schüttle immer wieder mal mitleidig den Kopf oder zucke ratlos mit den Schultern, wenn er mich um eine Analyse bittet.
Zum Dank entsorgt er meinen Dreck beim Nachbarn, der ihm scheinbar nie zuhört.
Auch den Elektriker mag ich. Der zeigte mir einst stolz, wie er ohne Schutz an eine stromtragendes, unisoliertes Lampenkabel fassen kann, fast ohne zu zucken. Abhärtung sei das. Ich machte die geforderten bewundernden Geräusche, er im Gegenzug seine Arbeit gut und sehr schnell.
Eine besondere Leidenschaft hege ich für Gerüstbauer. Leider bleiben die zwar draußen, doch ich kann sie beobachten und oft reicht mir das schon.
Zur Zeit nun habe ich fünf sächsische Maler im Haus. Mein Treppenhaus wird neu gestrichen, die alte, längst mit schwarzer Ölfarbe übermalte Jugendstilmalerei wird nachgebildet. Zudem werden alle Wohnungsfenster und Balkontüren neu lackiert. Dabei, das habe ich bei den Nachbarn beobachtet, halten sich die Maler deutlich länger als zwei Stunden in den Wohnungen auf. Mist!
Ich muss mir etwas ausdenken, das ist klar wie Kloßbrühe. Doch bevor die Gedankenbrühe überhaupt warm hat werden können, klingelt schon ein Maler bei mir. Zur Terminvereinbarung vermutlich. Da ich noch gar nicht fertig mit dem Überlegen bin, hoffe ich, während ich langsam zur Tür schlurfe, auf einen Geistesblitz.
»Guten Tag, wir möchten auch Ihre Fenster neu machen. Wäre es Ihnen übermorgen recht?«
»Ja. Das würde gehen«, antworte ich, während ich verzweifelt auf eine Idee wartete. »Wie lange wird das denn dauern?«
»Ja, also zuerst schleifen wir die alte Farbe ab, das dauert etwa einen Tag.«
»In der Wohnung?«
»Ja, schon.«
Und dann ist sie da, die gute Idee, die auch sofort aus meinem Mund herauspurzelt: »Das ist schwierig«, sage ich freundlich bedauernd, »ich habe nämlich eine schlimme Stauballergie.«
Ha! Also, wenn das nicht genial ist! Stauballergie! Ich huste, um noch glaubhafter zu sein.
Der Sachse schaut mich an: »Sie haben keine Teppiche.«
Was ist das denn jetzt für eine Erwiderung? Hat er mich sofort als Unterschicht identifiziert? Ich bin ein wenig beleidigt, glaube jedoch, dass er mich vielleicht einfach nicht gehört hat, sondern, während ich gesprochen habe, meinen Wohnungsflur betrachtete. Und da liegt ja tatsächlich kein Teppich.
»Stimmt, hier habe ich keinen Teppich«, entgegne ich, ohne zu wissen, wohin dieses interessante Gespräch führen wird.
»Meine Schwester«, sagt er, »die hat auch eine Staub- und Milbenallergie, deswegen haben die in der ganzen Wohnung Korkboden. Ich kenn mich damit aus. Böse Sache, diese Allergien. Bekommen ja immer mehr Menschen. Dann werden wir Ihre Fenster eben schon zum Schleifen aushängen und in der leeren Wohnung oben abschleifen. Ist ja warm gerade. Ok. Also dann bis übermorgen.«
»Ja, bis dann. Danke.« Ich schließe die Tür.
Ich habe mein Ziel erreicht. Das ist gut.
Doch der Maler kennt sich genau aus mit Stauballergien. Das ist schlecht. Sehr schlecht.
Was für eine Katastrophe das ist, wird mir klar, als ich meine Wohnung unter dem Gesichtspunkt einer Allergikerin betrachte.
Denn mit Staub stehe ich nicht grade auf Kriegsfuß. Wir haben uns miteinander arrangiert. Solange er nicht übertreibt, darf er bei mir wohnen. Doch jetzt bin ich ja Allergikerin. Ich hätte einfach sagen sollen, ich möchte nicht, dass bei mir geschliffen wird. Punkt. Hätte gar keine Erklärung abgeben sollen. Dann wäre ich halt die Schrulle aus dem dritten Stock, na und? Damit hätte ich durchaus leben können.
Jetzt ist es zu spät. Ich muss meine Identität als Staubgegnerin glaubhaft aufbauen und dazu gibt es nur einen Weg. Putzen. Und zwar nicht einfach so, wie immer, nein, aus einem völlig anderen Blickwinkel. Ich beginne sofort, denn bis übermorgen, auch das wird mir immer klarer, sind es nur noch zwei Tage. Einer davon ist sogar schon halb vorbei. Ich mache mich also rasch ans Werk. Putze, wische, sauge, reibe hier und dort und entdecke dabei Wohnungsteile, die ich bislang noch gar nicht gekannt habe. Herrje, ist meine Wohnung groß. Riesig. Ein Palast.
Nach Mitternacht bin ich fertig. In jeder Hinsicht. Ein Rundgang noch, eine letzte Überprüfung, dann falle ich ins Bett.
Am nächsten Morgen scheint die Sonne. Die blöde Kuh. Was am Abend durchaus befriedigend ausgesehen hat, ist bei Licht betrachtet unannehmbar. Ich beginne von vorn, höre währenddessen auf die Maler im Hausflur und achte darauf, in regelmäßigen Abständen so zu husten, wie es sich für eine Allergikerin gehört. Dann, am Spätnachmittag vor dem drohenden Malermorgen, bin ich zufrieden, überall ist es sauber.
Doch dann sehe ich meine Aschenbecher. Au weia. Ich rauche ja. Das geht ja gar nicht. Das machen diese Bronchialmimosen doch nie im Leben. Fast hätte ich dieses entscheidende Indiz übersehen. Schnell verstecke ich sämtliche Aschenbecher, öffne alle Fenster, und hoffe auf nächtlichen Wind.
Am frühen Morgen stehen sie vor der Tür. »Frisch ist es bei Ihnen!« sagen sie anklagend und beginnen mit ihrer Arbeit. Gut, ich habe sie nicht lange in der Wohnung, in der Hinsicht habe ich alles richtig gemacht, aber was für einen Preis zahle ich? Ich bin von der ganzen Putzerei völlig erschöpft, ich muss laufend hüsteln, ich darf nicht rauchen und bin mir trotzdem nicht sicher, ob sie mir glauben.
Was ich auch nicht bedacht habe, ist, dass die ganze aufwendige Malerei im Treppenhaus Wochen dauern wird und die Maler von Montag bis Freitag in der leeren Wohnung über mir wohnen.
Ich muss mir also meine Zigaretten heimlich kaufen und sie in einer Brötchentüte verstecken. Was das alleine kostet, denn ich esse gar keine Brötchen. Ich kaufe die nur, weil beim Bäcker ein Zigarettenautomat hängt.
Außerdem bin ich nun dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen zu husten, was jetzt schon ein Tick geworden ist, von dem ich nicht mehr runterkomme.
Die Wohnung muss ich weiter sauber halten, denn die Maler kommen natürlich am nächsten Tag und am übernächsten auch, um die ausgehängten und lackierten Fenster wieder einzuhängen. Die ganze Zeit sitze ich in Habachtstellung in meiner Wohnung, jederzeit bereit, meine zweite Identität als Allergikerin wieder aufzunehmen.
Dann, beim abschließenden Kontrollrundgang spricht mich der Chefmaler an: Er würde eine Sache echt nicht verstehen. Es ist klar: Er hat mich durchschaut, als Schein-Allergikerin enttarnt und wird mich jetzt bloßstellen. Ich merke, wie ich vorauseilend rot werde. Doch er sagt: »Frau Schmidt, warum liegt bei Ihnen eigentlich überall Geld rum?«
Hilfe! Sind selbst Münzen allergisch bedenklich? Habe ich mich bei Wikipedia etwa nicht ausreichend informiert? Lügt Wikipedia?