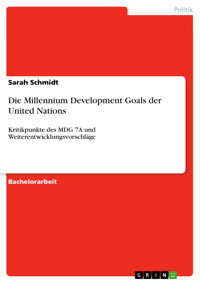Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Bis vor kurzem, als hier noch nicht diese widerliche und verlogene Freundlichkeit vorherrschte, war das Schönste im Berliner Alltag die Herausforderung: Wer ist fieser? Der Verkäufer oder der Kunde? Das war spannender und fairer Wettkampf und glücklich war ich, wenn beispielsweise der Busfahrer beim Fahrscheinverkauf aus Versehen ein bisschen netter war als ich und darum verloren hatte. Die Anerkennung, die dann aus seinen Augen blitzte, dieses ,Respekt, junge Frau!', machte mich glücklich." Der Tabakhändler wird von Videokameras auf Freundlichkeit getrimmt, im Bus beschimpfen sich Jugendliche, wie verflucht man Nichtraucher, wie verhält man sich, wenn man mit der eigenen Zukunft telefoniert, wie begegnet man Friedrich Merz, wer rettet die Kartoffel Linda? Sarah Schmidt erhellt erneut unseren Alltag und seinen Wahnsinn!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah Schmidt
Bitte nicht freundlich
Geschichten
Es war nicht alles schlecht
Man kann sagen was man will, aber in der DDR war wirklich nicht alles schlecht. Zum Beispiel der Bau der Mauer. Was waren meine Eltern darüber froh. Denn endlich war unsere Oma eingesperrt.
Sie war, ohne Frage, eine böse Frau. Meinen Vater gab sie als kleines Kind zu sadistischen Tanten. Kurz darauf heiratete sie ein wahres Arschloch und war von da an glücklich und zufrieden.
Einige Jahre später war sie auch diesen Mann wieder los. Kurz nach dem Krieg stand ihm eine Gerichtsverhandlung bevor, offenbar war er Exhibitionist und hatte sich den Schulmädchen von gegenüber gezeigt. Am Abend vor seiner Verhandlung eröffnete er meiner Oma, dass er gleich seinen Kopf in den Gasofen stecken werde. Für solche Gespräche habe sie jetzt keine Zeit, sie müsse arbeiten gehen, erwiderte sie und hatte im nächsten Monat eine außergewöhnlich hohe Gasrechnung zu beklagen. So eine Frau war also meine Oma.
Unerklärlicherweise fühlte sich mein Vater ihr trotzdem verpflichtet und besuchte sie regelmäßig. Bis eben die Mauer gebaut wurde.
So ein Glück! Sie konnte nicht mehr raus. Zumindest solange, bis meine Oma 65 wurde und das Rentenalter erreichte. Merkwürdigerweise gestattete die DDR ausgerechnet Rentnern längere Aufenthalte außerhalb der Republik. Eine ganz und gar unverständliche Regelung. Wo doch jeder weiß, dass gerade die Rentner die schlimmste Generation sind. Heimtückisch, hinterlistig, gewalttätig, übellaunig, rabiat und verschlagen sind die meisten. Vielleicht war genau dies der Grund, warum die DDR die über 65-jährigen nicht ständig im Lande haben wollte. So gesehen eigentlich verständlich.
Von nun an wurden wir also von Oma besucht. Vier Wochen lang, jedes Jahr. Auf ihren ersten Besuch freute ich mich, ich kannte sie, durch mein Glück der späten Geburt nach dem Mauerbau, bislang nur aus Erzählungen und konnte mir nicht vorstellen, dass meine Oma tatsächlich nicht nett sei.
Sie kam, sah mich, zog an meinen Zöpfen, grummelte etwas von schlecht gekämmt und zeigte sogleich, wofür sie ihren unentbehrlichen Gehstock tatsächlich brauchte. Zum In-die-Ferse-stoßen. Oder in die Hüfte. Zum Auf-den-Hintern-hauen. Oder auf den Hinterkopf. Dazu drehte sie ihren Stock blitzschnell um und benutzte ihn wie einen Golfschläger.
»Na«, sagte sie, als ich meinen ersten von vielen Stößen bekam, »dann lauf mal in mein Zimmer, ich habe euch etwas mitgebracht.« Während ich meine schmerzende Ferse massierte, kramte sie eine Plastiktüte aus ihrem Koffer und überreichte sie mir und meiner ebenfalls angetretenen Schwester.
Wir schauten in die Überraschungstüte, und konnten unser Glück kaum fassen. Sie war bis obenhin mit Bonbons gefüllt. Ich wähnte mich im Paradies. Bis ich einen probierte. Ein eklig-seifiger Geschmack breitete sich in meinem Mund aus und blieb dort für Stunden. Es war mit Abstand die enttäuschendste Süßigkeit meines Lebens. Ost-Bonbons. Die meine Oma ein ganzes Jahr lang gesammelt hatte. Was den sowieso schon schlechten Geschmack nicht verbessert hatte.
Während der nächsten vier Wochen mussten wir ständig diese Drops lutschen. Morgens, mittags abends, immer. Es waren rund 1000 Stück. Nimm dir doch zwei, sagte Oma. Nein, danke, ich bin satt. Unsere Eltern zwangen uns ebenfalls, sie zu essen. Beziehungsweise sie in den Mund zu nehmen und dort zu lassen, solange Oma in der Nähe war. »Die hat Oma aus der DDR mitgebracht, da gibt es nichts anderes«, sagten sie. »Wenn ihr sie nicht esst, ist Oma traurig.«
Na und, dachten wir, sie ist ja auch eine böse Frau, warum soll sie nicht traurig sein. Aber die Traurigkeit unserer Oma drückte sich vor allem durch noch mehr Hiebe mit ihrem Gehstock aus. Also waren wir weise und beugten uns dem Ostdiktat. Nach vier Wochen war sie endlich fort, den Rest der Bonbons durften wir wegwerfen.
Das war mein einziger Eindruck von der DDR – die war eklig und bösartig wie unsere Oma. Jedenfalls solange, bis meine Eltern meinten, ich wäre jetzt alt genug, um Oma an ihrem Geburtstag zu besuchen. Lange Zeit fuhr nur mein armer Vater zu ihr, und wenn er zurück war, sah er alt und müde aus. Sehr alt und sehr müde. Meine Mutter redete sich jahrelang damit heraus, dass wir zu klein seien, um mitzukommen, und vor allem zu klein, als dass sie uns alleine lassen könnte. Als ich elf Jahre alt war, ließ mein Vater diese Erklärung nicht mehr gelten. Oma wird 70 und wir besuchen sie. Basta!
Ich hatte Angst. Große Angst. Tagelang wurden wir von unseren Eltern über die DDR »aufgeklärt«. Die DDR gehört dem Russen. Der Russe war dieser böse, alte, hässliche und betrunkene Mann, den wir aus dem Fernsehen kannten. Der Russe schießt gerne. Und man kommt sehr schnell ins Gefängnis und niemals raus. Wir sollen uns also, in unserem eigenen Interesse, benehmen. Und nicht mit den anwesenden Nachbarn sprechen, die seien bei der Stasi, das gibt nur Ärger. Und bloß den Personalausweis nicht aus der Hand legen, denn dann könnten nicht mal sie uns mehr retten.
Ich habe ihnen alles geglaubt. Kurz darauf standen wir mit schweißnassen Händen am Grenzübergang Friedrichstraße, trauten uns nicht Pieps zu sagen, legten die Ohren frei, ließen eine Körperkontrolle über uns ergehen und waren drüben. In Ostberlin. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Während unser Westberlin strahlte, war hier alles grau und roch nach feuchter Oma.
In der Ostseestraße angekommen, wurden wir begrüßt, Oma haute uns freundlich, aber kräftig ihren Stock in die Fersen und dann mussten wir essen. »Das hat sich Oma vom Munde abgespart«, flüsterten unsere Eltern und genauso sah es auch aus. Fette Wurst, fettes Fleisch von unbekannten Tieren und braun-graue Torten wollten verzehrt werden. Außerdem natürlich die fünf Kilo Bonbons, die sie uns diesmal hier in Weißensee übergab. Während sich die Erwachsenen in den nächsten Stunden zumindest betrinken konnten, blieb mir nichts als zu warten und zu hoffen, dass wir bald wieder nach drüben konnten.
Spät, sehr spät am Abend durften wir endlich gehen, und erst nachdem wir wieder in Wilmersdorf waren, fühlte ich mich frei. Bis zum nächsten Geburtstag von Oma.
In den folgenden Jahren steigerte sich Oma in eine immer ausuferndere Bösartigkeit hinein, sie schlug und beschimpfte ganz wahllos und kam in ein Heim.
Dann kam der Herbst ’89. Wir sahen im Fernsehen, was sich im Osten anbahnte. Dass die DDR einmal ganz verschwinden würde, so viel Fantasie besaß niemand von uns. Aber es schien klar, dass es bald weitere Reiseerleichterungen für die DDR-Bürger geben würde. Also auch für unsere Oma.
Doch ein einziges Mal in ihrem Leben zeigte sie sich von ihrer netten Seite, die gute Alte. Sie starb im Oktober 1989. Eben noch rechtzeitig, sodass ich mich am 9. November wirklich freuen konnte. Aber die 25 Jahre relative Sicherheit, die uns die Mauer vor Oma geboten hatte, sind auch nicht zu unterschätzen.
Im Bus
Ich vermeide es nach Möglichkeit, viel Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Wenn ich nämlich nicht so besonders viel von diesen anderen mitbekomme, kann ich mir die Illusion bewahren, ich wäre eigentlich, im tiefen Grunde meines Herzens, ein Menschenfreund. Zu häufige tatsächliche Begegnungen zerstören sehr nachhaltig dieses Selbstbild.
Darum benutze ich in aller Regel auch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Doch nicht immer funktioniert das. Manchmal muss ich sogar Bus fahren. Das Fahren mit dem Bus ist viel schlimmer als mit der U- oder S-Bahn, denn im Bus lassen Menschen gewöhnlicherweise jede Erziehung vermissen, sie riechen streng oder süßlich, sie tragen furchtbare Kleidung und Rucksäcke, sie benehmen sich insgesamt einfach schlecht.
Und auch dieses Mal war es so. Zwar konnte ich noch einen der letzten Sitzplätze ergattern, doch der befand sich direkt hinter einer Gruppe Jugendlicher, die alle noch nie Sex hatten und darum ihre Hormone mit Hilfe von Rüpeleien, gegenseitigen Schlägen, dem exzessiven Gebrauch von iPod und Handy sowie verbalen Ausfällen regulieren mussten.
Es waren fünf Jungs und ein Mädchen, die dort auf diese Art ihre Jugend verschwendeten und mich in meinem Erwachsensein belästigten. Gott, dachte ich, hört das denn nie auf? Warum wachsen immer noch so viele Jugendliche heran und alle sind gleich in ihrer tumben, verblödeten Art. Und wann hat es eigentlich angefangen, dass Jungs viel zu große Füße haben, die in noch riesigeren Turnschuhbooten stecken? Das war doch früher nicht so!
Ich drehte meinen Kopf zur anderen Seite, um nicht mehr mit anhören und -sehen zu müssen, wie doof die waren. Was ich dort sah, war allerdings um keinen Deut besser als die Jugendlichen. Zwei alte Schachteln unterhielten sich auf besonders langweilige Art und Weise. Und dann sag ich – und er sagt – und ich sag noch. Diese Art von ermüdendem Gespräch führten sie. Eigentlich waren die beiden in meinem Alter, nein, wahrscheinlich waren sie sogar jünger, deutlich jünger, aber ihr Ideal war diese weibliche Unscheinbarkeit, bei der man nicht sagen kann, ob ihre Trägerin 35 oder doch 55 Jahre alt ist. Mithilfe von schlechter Schminke, praktischer Frisur und C & A-Kleidung verwandelt man sich schnell in eine frustrierte Idiotin.
Also dann lieber die Kinder.
Die waren mittlerweile dabei, das Mädchen zu beleidigen. »Ey, du bist doch eine Hure!«, sagte einer. »Voll genau«, fügte ein anderer hinzu. »Und deine Schwester ist auch eine verdammte Hure, die war erst mit Ali zusammen und danach mit Benni«, setzte der dritte zu, und der vierte war besonders originell, denn er sagte: »Also ist deine Mutter auch eine verdammte Hure!« Alle grinsten das junge Ding herausfordernd an.
Die schluckte, dachte kurz nach, warf ihr Haar nach hinten und sagte dann: »Na und? Dafür klauen eure Mütter alle bei KiK!«
Einer murmelte: »Gar nicht wahr«, dann schwiegen alle ehrfürchtig für einen sehr langen Moment, während sie ganz lässig weiter in ihr Handy tippte.
Und ich wusste wieder, dass ich, alleine wegen dieser kleinen Szene, eben doch eine Menschenfreundin bin und dass man sich um die Jugend wirklich keine Sorgen machen braucht. Zumindest nicht um die Mädchen.
Arbeit nach der Arbeit
Nach einer Lesung am Abend ist man in der Regel viel zu aufgedreht, um einfach nach Hause gehen zu können. Bleibt also, nicht nach Hause zu gehen und sich mit Hilfe von Alkohol in den Zustand zu versetzen, der Stunden später dafür sorgen wird, dass man ins Bett und dort in einen schlafähnlichen Zustand fallen kann. Das hört sich nach einer relativ leicht zu bewältigenden Aufgabe an, doch tatsächlich erfordert es jahrelanges Training, um genau den Punkt zu erreichen, an dem man sich müde genug getrunken hat, ohne die Schwelle zur Übelkeit zu überschreiten.
Natürlich muss man zusätzlich darauf achten, in der Nähe des eigenen Zuhauses zu trinken, sonst kann die ganze Mühe, die man sich vorher gegeben hat, durch eine einzige Taxifahrt zunichte gemacht werden. Denn der winzig kleine Unterschied zwischen »Ich kann schlafen« und »Ich muss mich übergeben« kann durch mehrfaches scharfes Bremsen, verbunden mit ruckartigem Anfahren völlig zunichte gemacht werden. Da ich ein kommunikativer Mensch bin, brauche ich bei dieser Arbeit nach der Arbeit Begleitung. Dafür habe ich meinen Mann, und mit dem geht es in die Stammtrinkhalle um die Ecke. Man ist immer willkommen, die Gin Tonics sind gut eingeschenkt und preiswert und ich kann mich schön vom eigenen Ego ablenken, weil sich dort die Crème de la Crème des Kreuzberger Adels betrinkt und dabei gesehen werden möchte. Also setzen wir uns und sehen.
Guck mal, da sitzt der andere Schriftsteller, der immer ganz viel kiffen muss, um schlafen zu können. So schlaff, wie er rüber winkt, ist er schon fast fertig mit seiner Nacharbeit. Ich werde ein bisschen neidisch, von diesem Zustand bin ich noch weit entfernt.
Na Prost und einen großen Schluck nehmen, sonst werden wir hier ja nie fertig. An der anderen Tresenseite lehnt ein frisch verliebtes Lesbenpaar und knutscht. Obwohl, wenn man genauer hinsieht, wirken sie gar nicht richtig verliebt, eher als ob sie sich gegenseitig beeindrucken wollen. Immerhin, wieder zwei, die heute Nacht nicht alleine schlafen müssen. Ist doch zumindest bis zu dem Punkt in ein paar Stunden, wenn sie sich im grauen Morgenlicht gegenüber liegen und in die Augen gucken müssen, auch nicht schlecht. Nur gut, dass wir uns haben und uns morgens genauso schön wie abends finden und wirklich richtig verliebt sind. Einen Schluck auf die Liebe, mein Schatz. Ach, besser zwei, die Liebe ist doch groß genug. Können wir noch mal das Gleiche haben? Danke.
Der Polaroidfotograf bietet seine Dienste an, nein danke, heute nicht, die Blumenfrau kommt mit welken Sträußen vorbei, dann der Feuerzeugverkäufer, zehn Stück kosten einen Euro, das ist so billig, die nehmen wir, obwohl wir wissen, dass die eine Hälfte morgen leer ist und die anderen fünf Feuerzeuge auf magische Art und Weise innerhalb der nächsten halben Stunde verschwinden werden. Nö, heute keine Motz, keine Hinz und Kunz und keine Zitty, Tagesspiegel oder Titanic. Gut, das hätten wir dann auch hinter uns gebracht, Mann, habe ich einen Durst. Holger, können wir noch zwei Gläser haben? Ja, natürlich volle.
Sag mal, weißt du, was »Clash of the Tittens« bedeuten soll? Hab ich eben an der Toilettentür gelesen. Soll das der Plural vom Plural von Titte sein? Oder heißt Tittens womöglich etwas ganz anderes auf Englisch? Ist hier irgendein native english speaker im Raum? Wie, ich soll nicht so brüllen? Hört mich doch sonst keiner. Na, du bist aber empfindlich heute. Nein, ich will mich nicht streiten. Du? Na los, dann lieber noch mehr knutschen.
Was macht eigentlich das Lesbenpaar? Och, Jacken anziehen. Aber nur die eine, das tut mir leid, dann hat es wohl doch nicht richtig geklappt mit dem Beeindrucken. Traurig, oder?
Hey, hey, was ist denn da los? Warum fliegen hier Barhocker durch die Gegend? War doch eben noch so friedlich. Der da war das. Na, der sieht gar nicht gut aus. Was grölt er? Wir sind alle blöde Wichser und er bringt uns um? Na bitte, wenn er meint. Vorher schnell noch einen Gin. Der geht aufs Haus? Super, ich weiß schon, warum das hier meine Lieblingskneipe ist. Ist der Idiot jetzt weg? Ah, die starke Elvira hat ihn einfach hochgehoben und rausgetragen. Sehr lässig, diese Frau. Aber was hatte der Typ denn? Holger, was hatte der Barhockerschmeißer für ein Problem? Zuviel Ketamin? Aha. Kenn ich nicht. Muss ich morgen mal bei Wikipedia nachlesen. Wenn ich dran denke.
Ey, du Penner, Finger weg. Ich habe gesagt Finger weg, sonst gibt’s gleich richtig Ärger. Nein, nicht du, Schatz, du lässt deine Finger schön da, wo sie sind, ich meine den Kerl da, im weißen Flauschtrainingsanzug, der hat eben versucht, deine Jacke zu klauen. Ja, genau du, du Arschloch. Meinst du, ich bin blöde? Ach, du verstehst mich nicht? Von wegen, brauchst hier gar nicht so auf Unschuldslamm machen. Ja, okay, wir sind alle Rassisten und Kartoffeln, aber die Jacke lässt du trotzdem in Ruhe. Komm, mach nich so ’ne Welle, erwischt ist erwischt, und hör bloß auf, in diesem blöden Türkendeutsch zu quasseln, ich kenn dich seit zehn Jahren, du warst mit meinem Sohn in einer Klasse und hattest immer eine Eins in Deutsch. Ja, ja, dein Pech, und natürlich sind alle Deutschen Nazis und Huren, und trotzdem fliegst du raus und nicht ich. Ätsch.