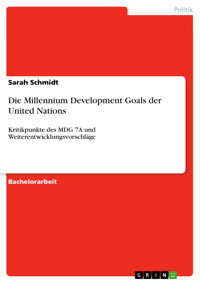Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nina Krone wohnt im letzten unsanierten Mietshaus der Gegend, klar, dass man hier noch mit Kohle heizt. Und keiner der Nachbarn ist unter 50 Jahre alt … Ihre Nachbarin Frau Scholz trägt ihr Leiden an der Welt demonstrativ vor sich her, besonders beim Kohleschleppen. Eines Tages kann Nina es nicht mehr ertragen und beginnt, der alten Dame jeden Tag einen Eimer Kohle vor die Tür zu stellen. Doch auch Nina hat ihr Päckchen zu tragen: Ihre Arbeit frustriert sie, ihr Chef wird immer seltsamer, sie steckt in einer Sinnkrise. Zu allem Überfluss konfrontiert ihr Sohn Rafi sie mit der Nachricht, dass er und sein Freund zusammen mit einem lesbischen Pärchen ein Kind bekommen möchten. Ihre Tochter Ella wiederum wirkt so diszipliniert und nur auf ihr berufliches Fortkommen fixiert, geradezu unheimlich … Ein wunderbarer, witziger Roman über eine Freundschaft zwischen den Generationen und eine Familie, die aus den Fugen gerät.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah Schmidt
Eine Tonne für Frau Scholz
Gerüchten zufolgeist der Besitzer des Hauses, in dem wir wohnen, ein älterer Herr, der in einer anderen Stadt lebt. Genaueres weiß niemand und darum hoffen wir, dass er uns einfach vergessen hat, vielleicht ist er auch dement, das wäre herrlich. Das Haus steht wie ein mürbe gewordener Fels zwischen anderen mit frisch gestrichenen Fassaden und ausgebauten Dachgeschoss-Eigentumswohnungen. Es ist schon lange keine Schönheit mehr, die Hausverwaltung bleibt untätig, überall platzt der Putz ab, das Erdgeschoss ist feucht, an den Wänden blühen Schimmelblasen, die Keller riechenmuffig, und wir heizen noch mit unseren Kachelöfen.
Das ist in der Stadt so selten geworden, dass die vergangenen drei Kohlenlieferungen von Journalisten begleitet wurden, zuerst kamen servile Japaner, dann schweigsame Schweden, in diesem Jahr agile Italiener. Sie schreiben für Magazine in aller Welt Reportagen, die mit pittoresken Fotos bebildert sind. Die Journalisten bestaunten uns, als wären wir vom Aussterben bedrohte Tiere. Mit einer Mischung aus Bewunderung und Mitleid schauten sie in den Hinterhof, der hässlich, eng und lichtlos ist. Zwei Kastanien, die sich gegenseitig stützen, sechs Mülltonnen, ein Fahrradständer, eine Teppichklopfstange und an der Brandmauer hängt ein altes Schild, auf dem »Das Spielen auf dem Hof ist verboten!« zu lesen ist. Es fehlen nur dreckige Kinder in Schürzen und mit nackten Füßen, die einen Leierkastenmann mit einem Äffchen oder einen Scherenschleifer mit Kaiser-Wilhelm-Schnauzbart umringen, um das nostalgische Bild zu komplettieren.
Nur wohnen hier keine Kinder. Hier lebt stattdessen die Kriegsgeneration, obwohl unsere Nachbarn, wenn man es nachrechnet, allenfalls in der Hitlerjugend gewesen sein können; sie wirken wie Überbleibsel einer fernen Welt, in der Trümmerfrauen und Russlandheimkehrer das Stadtbild dominierten. Zwei Frauen tragen immer Kittel, die eine ist in der Wohnung, in der sie heute noch lebt, geboren. Unvorstellbar. Ihre Ehemänner schlüpfen nur im Winter in Kittel. Manchmal denke ich, die vier werden vom Fremdenverkehrsamt bezahlt, diese längst vergessene Tracht vorzuführen, doch zu uns verirren sich keine Touristen, die das goutieren könnten. Beide Paare wirken so alt, dass ich nicht schätzen kann, ob sie siebzig oder neunzig sind. Ich bin sicher, dass sie in ihren Wohnungen so gut wie keinen Müll haben. Alles kann noch für irgendetwas benutzt werden und so wird aus einer löchrigen Unterhose ein Lappen, erst für die Küchenflächen, danach fürs Klo, dann für den Fußboden, und wenn sie sogar dazu nicht mehr taugt, legt man sie im Winter zwischen die Doppelfenster zu den anderen aussortierten Fetzen, damit der Ostwind nicht so in die Stube hinein pfeift.
Wir grüßen uns unverbindlich freundlich, manchmal führen wir ein kleines Gespräch, über ein Ärgernis: das Treppenhaus wurde diese Woche nicht geputzt, oder die Müllabfuhr hat die Tonnen auf dem Gehweg stehen lassen, statt sie in den Hof zu bringen. Und warum stand der Krankenwagen gestern vor der Tür? Um einen der Alten abzuholen. Doch die kommen stets nach einigen Tagen zurück, dann erkundigt man sich, und es war das Herz oder der Kreislauf oder das offene Bein, und dann tragen sie für einige Zeit eine Sauerstoffpatrone auf dem Arm oder humpeln auf Krücken und haben ein blaues Auge. Nach kurzer Zeit vergessen sie, was passiert war und alles ist wie zuvor.
Auch Frau Scholz wohnt im Haus, in der Wohnung unter unserer. Sie ist im gleichen Alter wie die Veteranen, sie trägt kurz geschnittene graue Haare, in ihrem ausrasierten Nacken stauchen sich zwei Speckfalten, und sie riecht ein bisschen, aber nicht nach Urin, eher nach Mittagessen von gestern. In der Regel bemüht sie sich, mich zu übersehen, nicht mal das allgemein übliche kurze Lächeln bringt ihr altes Gesicht zustande. Meist trägt sie einen Eimer, im Sommer mit Müll, im Winter entweder mit Asche oder Briketts gefüllt. Sie schleppt an allem gleich schwer, und ihr Rücken ist gebeugt, egal, ob der Eimer gefüllt oder leer ist. Auf jedem Absatz verschnauft sie und nimmt die nächsten zwölf Stufen erst in Augenschein und dann in Angriff. Zwei-, dreimal hatte ich ihr Hilfe angeboten, jedes Mal hatte sie mürrisch den Kopf geschüttelt. Dann eben nicht.
Alles an ihr ist eine Anklage. Ihr Aussehen, ihr Geruch, ihr Gang, ihr Gesichtsausdruck. Eine Anklage gegen das Leben an sich. Anstatt laut darauf zu schimpfen, hat sie sich für die weibliche Klageform entschieden, den stillen giftigen Vorwurf. Den finde ich noch unerträglicher. »Ach, es geht schon«, scheint sie ständig zu sagen, obwohl sie »Nein, gar nichts geht, alles ist grässlich ungerecht«, meint. Sie fällt einem sofort auf die Nerven.
»Hallo, Frau Scholz.«
»Ja.«
»Ist wieder ganz schön kalt, was!«
»—«
Okay, das war eine dämliche Feststellung, aber nicht dämlicher als alles andere, was im Hausflur gesprochen wurde: Das Wetterist toll oder schlimm, der Regen war lange überfällig oder soll endlich aufhören, was ist das nur für ein Sommer, die Blumen haben dieses Jahr Blattläuse, und das Eis auf dem Gehweg wird nicht mehr weggemacht, wie gefährlich ist das, und die Kastanien sind schon im Mai voll von Miniermotten, und ich muss dann mal weiter, morgen kommt der Schornsteinfeger, und die Tomaten auf dem Balkon sind dieses Jahr besonders blühfreudig. Na dann, auf Wiedersehen, bitte schließen Sie den Keller ab, man hört doch so viel von Einbrechern. Ja, ja, selber.
Der erste Raureif in diesem Jahr hatte sich über Nacht auf die Dächer gelegt. Ich saß auf meinem Stuhl am Schreibtisch, obwohl ich nichts zu schreiben hatte, ich saß dort einfach gerne. Ich legte die Beine auf die kühle Tischplatte, sah, wie die bleiche Sonne die Kälte von den Schindeln zu vertreiben versuchte, und beobachtete meinen Mann, der mit einer Biene kämpfte. Er lehnte sich mit aller Kraft gegen die Balkontür, um einer werdenden Bienenkönigin, die für ihren Staat ein Winterquartier in dem kleinen Spalt zwischen den Holztüren suchte und die immer wütender wieder und wieder an die Scheibe flog, den Eintritt zu verwehren. Ich hörte den Aufprall ihres Körpers auf dem Glas und sah, wie Fritz sich jedes Mal fester von innen dagegen stemmte, als wäre die Biene ein ernst zunehmender Angreifer, fast gleich stark. So lächerlich und absurd es einem Fremden erscheinen könnte, wie sich ein Mann in seinen späten Vierzigern einer kleinen Biene entgegenstellte: Es war immerhin nicht irgendeine Tür, die er da verteidigte, es war unsere gemeinsame Tür, in unserer gemeinsamen Wohnung, dem Mittelpunkt unseres gemeinsamen Lebens. Ich blickte auf, Fritz rüttelte noch ein letztes Mal an der Tür, die Biene war weitergeflogen, und Fritz verschwand zufrieden summend in die Küche, wo er die Spülmaschine ausräumte.
Erst lachte ich über ihn, dann wurde ich von großer Zärtlichkeit und Dankbarkeit ergriffen. Mann hält Tür zu. Ist es das, was übrig bleibt, nach einer langen Zeit des Zusammenlebens?
Fritz und ich sind acht Jahre verheiratet, seit zwölf Jahren wohnen wir zusammen. Warum wir geheiratet haben, weiß ich nicht genau, es lag nicht an den Steuern, dazu verdienten wir zu wenig, es war nicht wegen der Romantik, ich hatte nie von einer Märchenhochzeit geträumt, auch als Kind nicht. Vielleicht, weil man in unserem Alter sonst nicht so oft feiert und eine Hochzeit ein guter Anlass dafür war. Es gab keinen Antrag, kein Niederknien, keine Rosen, kein Überraschungsabendessen, das in solchen Fällen immer ein Dinner ist, ein Candle-Light-Dinner, keinen Ring, der in der Schokoladen-Mousse versteckt war, keine mit Freunden heimlich einstudierte Tanz-Choreografie, wie ich sie mir manchmal auf YouTube ansehe. Das alles wäre ein Grund zum Neinsagen gewesen. Ich kann mich nicht einmal an den Moment erinnern, in dem wir uns dazu entschieden hatten. Als die Heirat beschlossen war, hatte ich darüber nachgedacht, meinen Nachnamen zu ändern, aber der von Fritz ist auch nicht schöner, origineller oder erhaltenswerter als meiner, und mir fiel keine Situation ein, in der ein gemeinsamer Name von Vorteil wäre, außer eine Szene im Krieg: Er säße schon in einemUNO-Flüchtlingslager und ich müsste vor den Toren um Einlass betteln. Ein solch überraschender Krieg kam mir aber unwahrscheinlich vor, und wenn, dann würde mir schon etwas anderes einfallen, ich könnte lügen, Geld oder Sex anbieten, um zu ihm zu kommen. So sind wir halt einfach verheiratet, meine Kinder und ich tragen den einen Namen, Fritz den anderen.
Ich habe den Eindruck, als würde ich Fritz nicht besonders gut kennen. Immer sehe ich nur mich in seinen Augen, und vielleicht geht es ihm genauso, er kann es nur besser verbergen. Natürlich weiß ich um seine Gewohnheiten, seine Vorlieben, also etwa, dass er sich morgens immer einen Toast mit Nutella schmiert, den er aber nur zur Hälfte isst, welche Geräusche er vor dem Einschlafen von sich gibt, dass er seinen linken Socken zuerst anzieht, aber ich gebe mir zu wenig Mühe, daraus seine Persönlichkeit zusammenzusetzen, ich liebe ihn einfach so. Mir genügen die kleinen Einzelteile, die ich sehe. Wenn wir uns streiten, fasst er in einem Rundumschlag meinen Charakter zusammen, will mir erklären, warum ich so und nicht anders argumentieren kann, dass er mich durchschaut und versteht, sich aber trotzdem darüber ärgert. Ich finde mich in diesen Analysen wieder und bleibe erstaunt über seine Fähigkeit, die einzelnen Aspekte zu einem Ganzen zu verbinden. Ich könnte das nicht, zum Glück stellt er mir auch niemals idiotische Fragen wie: Was liebst du an mir besonders? Was kannst du nicht leiden? Ich mache das. Manchmal frage ich ihn sogar, was er gerade denkt, und er antwortet mir ernsthaft. Das reicht, um ihn zu lieben, alles andere ist ein Geschenk. Etwa, dass er mich zum Lachen bringen kann, und wie er mit den Kindern umgeht, und dass er Bücher liest, viel gnadenloser als ich, er kann nach dreißig, vierzig Seiten aufhören, wenn ihm etwas nicht gefällt, ich muss jedes Buch zu Ende lesen, immer bekommt es noch eine Chance und noch eine, vielleicht ist das alles Absicht, eine Finte des Autors, und wenn ich erst über die Mitte eines Buches hinaus bin, dann wird mich die Idee vom Hocker hauen. Fritz liegt fast immer richtig mit seinem rigorosen Beiseiteschieben.
Er hat einen schönen Körper, obwohl er Sport verabscheut, und wenn er nackt ist, stößt mich nichts ab. Die Hüften sind weicher, der Rücken haariger als früher, doch er passt noch ziemlich gut in diesen Körper hinein.
Wir sind in der Stadt geboren, das ist immer ein Pluspunkt. »Oh, ein Eingeborener, so etwas gibt es doch gar nicht«, sagen die Leute dann, nachdem sie sich zuvor vergewissert haben, dass wir sie richtig verstanden hatten. »Wo kommst du her?«, fragen sie, und wenn man es sagt, wird nachgefragt: »Ich meine, wo bist du geboren?« Von allen. Immer.
Wir sind eher Intellektuelle als Angestellte, haben in den Achtzigerjahren Häuser besetzt oder Besetzer unterstützt, waren gegen Thatcher und Kohl und für Punkrock, wir lesen, gehen ins Theater und früher zu Konzerten von Madonna, Björk und den Fugees, wir sind Feministen und -Innen, wir haben mit ziemlich vielen Menschen geschlafen, sind in den Neunzigern in Clubs tanzen gegangen; die Zeit ist uns zu spießig und brand eins zu doof, wir wohnen zwischen Schwulen, Vegetariern, spanischen Hippies und Schauspielern, wir glauben nicht an die Rentenversicherung und wissen, dass in den kommenden Jahren alles zusammenbrechenwird, der Kapitalismus, der Sozialstaat, die Weltwirtschaft, der Euro,und wenn wir alt sind, werden wir zahnlos auf der Straße sitzen, weil es bald keine Krankenversicherung mehr gibt, die wir bezahlen können, und die Zustände in verlotterten Altersheimen um 2010 herum werden nur noch paradiesische Vergangenheit sein.
Darum macht mich alles so wütend. Weil wir trotzdem so klein geworden sind. Es ist mir unerträglich, genau wie mein Lamentieren darüber. Ich drehe mich im Kreis, weil ich alles weiß, davon wird es kein bisschen besser, aber ich kann nicht anders, als ständigzu überlegen, was eigentlich falsch gelaufen ist. Ist überhaupt irgendetwas falsch gelaufen?
Ziemlich viele Abende verbringen wir einfach vor dem Fernseher. Was nicht schlimm ist, wir kennen alles, was draußen los ist, und sind müde davon. Sorgen macht mir die Zufriedenheit, mit der ich auch nach dem dritten oder sechsten Abend, den wir zu Hause verbracht haben, ins Bett gehe, anstatt nervös zu werden, unruhig, nörgelig. Sich in der Nacht zu verlieren, ist so unwichtig geworden, furchtbar. Weil man zu viele Arten von Ekstase kennt und – was ich früher niemals geglaubt hätte – sich jeder Rausch abnutzt und schal wird, weil die Drogen nicht mehr wirken. Als Fritz und ich das letzte Mal gekokst haben, sind wir eine Stunde später schlafen gegangen. Schlafen! Das Kokain war nicht schuld daran, wir waren es, in denen nichts mehr drin ist, was aufgeputscht werden könnte.
Eine echte, gute Droge für Leute über vierzig, die müsste gefunden werden. Eine, die mich rücksichtslos überrennt, die Spaß macht und die Menschen nicht wie Crystal Meth oder Tilidin in gefühllose Hardcore-Zombies verwandelt. Damals, das Ecstasy, das hat uns noch mal fünf, sechs Jahre geschenkt, in denen wir uns hingeben konnten: der Musik, den wunderbaren, liebenswerten Menschen um uns herum, die man alle umarmen wollte, oder den Farben der Ampeln. Hast du schon mal ein schöneres Grün gesehen? Und das Rot, schau mal, toll, oder?
Vorbei. Heute feiert der eine Teil unserer Bekannten bald silberneHochzeit oder, wenn sie nicht verheiratet sind, den 20. Jahrestag, der andere Teil hat es nicht geschafft oder gewollt, Beziehungenzu führen, die länger als drei, vier Jahre dauern. Sowohl in der einen als auch der anderen Gruppe sind nur wenige übrig geblieben, die nicht neurotisch oder langweilig sind.
Die Paare bestätigen alles, was gegen das Zusammenwohnen spricht. Ihre Wohnungen sind furchtbar, ihre Kleidung kann ich nur ablehnen, und dieses Eingerichtetsein im eigenen Leben finde ich abstoßend. Bei den Beziehungslosen sind die Frauen in der Überzahl. Frauen über vierzig, die nicht mit einem anderen Menschen zusammenleben müssen, sind schwer zu ertragen. IhreVerzweiflunglässt sie schlecht riechen. Dass die meisten sich tatsächlich mit Zumba oder Esoterik im weitesten Sinne beschäftigen, also mit Engeln, Feen, Katzenpsychologie, Sternenkonstellationen und Buddhismus, lässt mich an ihrem Verstand zweifeln. Die vereinsamten Männer sind nicht besser, wir kennen nur weniger, weil die direkt auf den ersten Blick zu fett, zu schmierig, zu dumm wirken. Zwischen diesen Polen leben die Schwulen – bei denen sind auch die Älteren akzeptabel –, ein paar Frauen mit Humor und wir. Nicht einsam, nicht zufrieden, zu verheiratet für die einen und zu arrogant für die anderen.
Meine Eltern gaben sich am Ende jeden Tages drei Küsse. Nie zwei oder vier oder überhaupt keinen, nein, immer drei. Küss, Küss, Küss. Immer auf den Mund. Schmatz, Schmatz, Schmatz. Und gute Nacht, meine Liebe. Egal, was den Tag über passiert war, Streit oder Vorwürfe, egal, ob sie gefeiert hatten, den Kaufvertrag für ein Haus unterschrieben, ein neues Kind geboren wurde, egal, womit die vergangenen vierundzwanzig Stunden gefüllt waren, jeder einzelne Tag wurde mit drei Küssen weggewischt und vergessen. Der nächste war ein neuer Tag, und auch diesen machten sie abends mit Küssen ungeschehen. Einmal oder viele Male – das weiß ich nicht mehr genau, weil sich meine Erinnerungen vermischen mit Fantasien, wie alles auch hätte sein können, mit Erzählungen und mit Fotos aus alten Alben, mit gelesenen Büchern und den Geschichten anderer Familien, so lange, bis ich nicht mehr unterscheiden kann, was meines ist und was nicht – offenbarte mir meine Mutter, diese dumme Küsserei sei das alleinige Geheimnis eines glücklichen Zusammenlebens. Man müsse abends ohne Groll schlafen gehen, gleichgültig, wie der Tag verlaufen war, das wäre im Großen und Ganzen schon alles, was es zur Ehe zu sagen gebe. Höchstens noch, dass der Mann wichtiger ist als die Kinder, die kommen und gehen, nur der Mann bleibt. Wenn alles gut geht. Alles andere könne man nicht beeinflussen, das müsse man geschehen lassen, und fertig ist das Leben.
Ich küsse meinen Mann nicht. Jedenfalls nicht nach Plan. Mal schlafen wir küssend ein, manchmal vergessen wir es, mal sind wir zu müde oder zu wütend aufeinander. Eine kleine Unplanbarkeit in meinem Leben, die mich von meiner Mutter unterscheidet, obwohl das egal ist, sie liegt seit fünf Jahren auf dem Friedhof und ist, genau wie mein Vater, nur noch tot. Vielleicht hätte ich auf sie hören sollen: Küssen ist Glück, so einfach kann alles sein. Ich wünschte, meine Mutter wäre vielschichtiger gewesen, komplizierter und undurchschaubarer, ich versuche, ihr im Nachhinein Tiefe zu verleihen, es gelingt mir nicht. Früher oder später komme ich darauf, dass alles, was ich in sie hineininterpretiere, falsch ist, und übrig bleibt eine ziemlich einfältige Person, deren außergewöhnlichster Charakterzug darin bestand, ihren Mann sehr viel mehr zu lieben als ihre Kinder.
Das Erste, was ich nach dem Aufwachen sah, war der alte zerfledderte Teddy, der auf meinem Nachttisch sitzt. Es ist kein besonderer Teddy, und normalerweise nahm ich ihn überhaupt nicht mehr wahr, so wie man nichts von dem sieht, was immer am gleichen Ort steht. So könnte ich, würde ich gefragt werden, auch kaum beschreiben, was auf den Bildern, die in der Wohnung hängen, zu sehen ist. Das ständig Vorhandene verschwindet in eine Zwischenwelt. Doch an diesem Morgen sah ich den Bären. Genau genommen war er nicht mal mein eigener, sondern der meiner großen Schwester Nanette. Sie hatte ihn mir zu meinem dreißigsten Geburtstag mitgebracht. Ich war damals sehr gerührt von diesem Geschenk, es war, als hätte sie dadurch die Konkurrenz, die seit unserer Kindheit immer zwischen uns stand, nun, da wir beide längst erwachsen waren, aufgegeben. Ab jetzt ist es egal, wer die Ältere und wer die Jüngere ist, wir sind Schwestern, die sich mögen, alles andere ist Vergangenheit und der Teddy ein Friedensangebot, das ich angenommen habe.
Mein eigener Kinder-Bär ist seit Jahren verschwunden. Er war ein Siebzigerjahre-Kunstfaserteddy, hellblau und weiß und leicht entflammbar, aus dem Versandhauskatalog.
Meine Mutter hatte sich eines Nachmittags neben mich gesetzt, den ganz neuen und schweren Katalog auf den Tisch gelegt, die Seiten mit den Puppen und Teddys aufgeschlagen und gefragt, welchen ich mir wünsche. Ich zeigte auf einen Steiff-Bären, einen flauschigen mit bravem Bärengesicht, der wurde abgelehnt. Auch die Barbie, die ich viel lieber haben wollte, und auch die Puppe mit den goldenen Polyesterhaaren und Klappaugen, die Pipi machen konnte, gefielen ihr nicht. Dann blieb nicht mehr viel übrig, sie zeigte mit ihren schönen Fingern auf den blau-weißen: »Der ist hübsch.«
Na gut. Mir war es egal, ich bewunderte ihre Hände, die neben meinen lagen, blaue Flüsse schlängelten sich unter ihren glatten Handrücken entlang, die Haut darüber war durchscheinend und gespannt, die Fingernägel kurz geschnitten. Mit meinem Zeigefinger verfolgte ich die mäandernden Flüsse, sie teilten sich, verliefen in immer zarter werdenden Linien, ich drückte leicht, um einen Stausee zu bilden, und staunte, wie schnell er wieder verschwand, sobald ich losließ. »Solche Hände will ich später auch haben«, sagte ich. Sie stand auf, wischte die Hände an ihrem Rock ab und meinte, das solle ich mir lieber nicht wünschen, ihre Hände seien hässlich.
Sobald der neue Katalog im Haus war, gehörte der alte mir. Ich wühlte mich durch die sechshundert Seiten auf der Suche nach meinem zukünftigen Leben als Erwachsene. Würde ich auch solche Kleider tragen oder diesen Schmuck oder solche Unterwäsche, und was war nur dieser dunkle Fleck, den man unter den weißen oder fleischfarbenen Unterhosen der Katalogfrauen nicht richtig sehen, doch mehr als ahnen konnte? Konnte man das nicht mal genauer fotografieren? Unter meinem Bauch fand ich nichts Dunkles.
Ich schnitt aus, was mir gefiel, und klebte meine Zukunft auf DIN-A4-Blätter, die ich in einem Ordner sammelte: Diese Couch und diese Schrankwand, in deren offenen Fächern goldverzierte Vasen und Elefanten aus Porzellan und hohe Kerzenständer standen, in meinem Schrank hingen glitzernde Kleider neben weißen Kostümen und meinen Kindern würde ich natürlich die Pipi-Puppe und die Barbie kaufen, die würden sich nicht entscheiden müssen.
Mit vierzehn oder fünfzehn verbrannte ich die Hefter gemeinsam mit meinem Teddy, Glanzbildern und dem Grundschul-Poesiealbum. Es erschien alles so albern.
Der Teddy von Nanette ist mit Holzwolle ausgestopft, eine Pfote von einem längst gestorbenen Hund zerkaut, und seine Fußsohlen sind mit alten blau-weiß gestreiften Stoffresten geflickt.
Als ich an diesem Morgen den verblichenen Stoff sah, begann ichzu weinen. Ich weinte nicht oft. Ich sah meine Mutter, die diesen Stoff auf die Teddyfüße genäht hatte, der Fernseher war nebenbei gelaufen, es war ihre letzte Arbeit an diesem Tag gewesen, bevor es wieder hieß: Kuss, Kuss, Kuss. Ich weinte, weil das alles war, was von ihrem Leben übrig war, außer Erinnerungen, alles, was ich noch anfassen konnte, was greifbar existierte – ein paar Nadelstiche über alter Holzwolle. Und wenn ich sterben würde, hätten Rafi und Ella zu diesem Stoffbären keinerlei Verbindung, sie interessierten sich nicht für ihre Familiengeschichte, zumindest fragten sie mich nie etwas, und so wussten sie nichts darüber und würden ihn wegschmeißen oder an eine Kirche verschenken, zusammen mit den anderen Kisten voller Kram ihrer Mutter, und dann wäre von meiner Mutter gar nichts mehr auf der Welt. Das brachte mich zum Weinen. Es gibt nicht viel, das unangenehmer ist, als einen Tag mit Tränen zu beginnen. Vielleicht, jeden Abend mit drei Küssen zu beenden.
Seit meine Mutter tot ist und die Kinder erwachsen sind, wird nicht mehr so viel an mir herumgenörgelt, das habe ich selbst übernommen. Ich schimpfe häufig mit mir, und, um mich davon abzulenken, ärgere ich mich über das Verhalten von anderen. In unserem Haus habe ich dazu viele Gelegenheiten. Jedes Mal, bevor ich die Wohnungstür öffnen kann, drücke ich mein Ohr an das Holz, um zu hören, ob jemand im Hausflur ist. Wenn ich Stimmen höre, warte ich so lange, bis sie verstummen. Das ist bescheuert, sage ich mir dabei, unwürdig, wenn ich wie ein neugieriges altes Weib Gespräche belausche, ich sollte einfach losgehen, allen einen schönen Tag wünschen und an ihnen vorbeilaufen.
Kann ich aber nicht, denn die meisten Unterhaltungen, die ich belausche, möchte ich nicht unkommentiert lassen. So wird der Briefträger mehrmals pro Woche abgefangen, obwohl doch wirklich jeder weiß, unter welchem Zeitdruck die stehen. Wir haben keine Briefkästen, sondern Schlitze in den Türen, durch die er die Post schiebt, und ich glaube, dass Briefträger unser Haus schon deswegen fürchten. Mehrere Nachbarn warten nur darauf, das entsprechende Geräusch zu hören, um die Tür aufzureißen und zu nörgeln.
»Bitte knicken Sie die Briefe nicht.«
»Aber anders passen sie nicht durch den Schlitz.«
»Dann legen Sie sie doch auf die Fußmatte.«
»Das darf ich nicht.«
»Ach so, stimmt, das haben Sie letzte Woche ja schon gesagt. Ist doch ein Ding, dass wir immer noch keine Briefkästen haben. Wir bitten die Hausverwaltung schon seit Jahren darum, aber nichts passiert.«
Schweigen und Füßescharren des Briefträgers.
»Ist wieder ganz schön kalt geworden«, sagen die Nachbarn im Winter zu ihm und im Sommer: »Ist wieder ganz schön heiß.« Im Winter sagen sie noch: »Na, dann ziehen Sie sich mal warm an, mein Mann hat im U-Bahnfernsehen gesehen, dass es heute Nacht minus 14 Grad werden sollen.« Und so weiter und so weiter, bis der Postler sich endlich traut, »Ich muss weiter« zu sagen.
Ist er weg, wird mit anderen darüber getratscht, dass die Post immer später kommt, dass aber sie selbst es sind, die mit ihrem überflüssigen Gequatsche zur Verspätung beitragen, darauf kommt niemand von ihnen.
Vor ein paar Tagen stand ich wie üblich lauschend an der Tür, ich war auf dem Weg zur Arbeit, und hörte fassungslos zu, wie eine Nachbarin dem Mann von der Hausreinigung etwas über ihre bröckelnden Backenzähne erzählte. Ich warte immer darauf, dass eines der Opfer mal sagt: »Das interessiert mich nicht. Halten Sie den Mund, machen Sie die Tür zu, bringen Sie sich um, aber seien Sie gefälligst still dabei.« Macht aber nie einer. Und das bringt mich wiederum zu dem Gedanken, ob eventuell beide Seiten diese Artder Unterhaltung genießen und ich die Doofe bin, die einfach nicht zu normaler Interaktion mit Menschen fähig ist und stattdessen hinter der Tür so lange lauscht, bis kein Mensch mehr zu hören ist.
Aus dieser Überlegung heraus beschloss ich, etwas zu ändern. Jede große Veränderung beginnt mit dem ersten Schritt, dieser Kalenderspruch schoss durch meinen Kopf. Nur: Was sollte ich anders machen? Ich würde den Nachbarn nicht sagen, was ich von ihnen denke, das macht man vielleicht mit zwanzig. Obwohl die Vorstellung in den Flur zu stürmen und laut »Können Sie endlich mal die Fresse halten, man kann doch nicht über Jahre ständig über das Wetter und Krankheiten reden« zu schreien, mir durchaus verlockend erschien, aber dazu war ich viel zu vernünftig. Es würde nichts ändern, nur wäre es danach für mich noch komplizierter, die Wohnung zu verlassen.
Dann fiel mir Frau Scholz ein. Frau Scholz, die sich wenig am Hausgeplapper beteiligte, die nicht jeden zweiten Satz mit »Und mein Mann sagt immer …«, begann und die mich trotzdem mit ihrem vorwurfsvollen Stillsein und ihrer ablehnenden Haltung furchtbar nervte. Ich würde ihr, so sah mein kaum durchdachter Beschluss aus, ab sofort das Kohlentragen abnehmen. Der würde ich es zeigen. Oder so. Mir egal, ob das von ihr erwünscht war oder nicht.
Ich fing sogleich an und stellte nun jedes Mal, wenn ich in unseren Keller ging, einen meiner Eimer, gefüllt mit Briketts, vor ihre Wohnungstür. Am Morgen stand er leer im Hof neben den Mülltonnen. Ich nahm ihn, füllte ihn mit Kohlen und stieg die Treppe hoch, aber am vierten Tag riss Frau Scholz, als ich auf ihrem Treppenabsatz angekommen war, unvermittelt ihre Tür auf und blaffte mich an.
»Sie müssen das nicht machen. Ich kann das alleine.«
»Ich weiß«, sagte ich, setzte den vollen Eimer ab, lief weiter und fand mich dabei ziemlich lässig.
Beim Abendessen erzählte ich Fritz davon.
»Warum bringst du ausgerechnet der Kohlen? Die ist doch echt schlimm, die Olle.«
»Weil sie mir auf die Nerven geht, mit ihrem zur Schau getragenen schweren Leben. Weil ich ein guter Mensch sein will. Ach, echt keine Ahnung, ich will es einfach.«
Am darauffolgenden Morgen fand ich keinen Eimer im Hof. Stattdessen stand Frau Scholz im Keller. Ihre alte Strickjacke war fest um den Körper gezogen, ihre Hände unter den Achseln versteckt. Sie muss schon eine ganze Weile hier gestanden haben, denn ich kam eine gute halbe Stunde später als gewöhnlich nach unten.
»Ich hab’ auf Sie gewartet. Was soll das mit den Briketts?«, fragte sie mit vorwurfsvoller Stimme.
»Nichts. Sie brauchen sich nicht zu bedanken.«
»Hatte ich auch nicht vor. Wenn Sie unbedingt Kohlen tragen wollen, wenn Sie das glücklich macht, dann bitte sehr.«
Jetzt schwang ein generöser Ton mit, und ich versuchte, mit leiser Ironie zu kontern:
»Da bin ich aber froh, dass Sie mir das erlauben.«
»Sie nehmen dann aber gefälligst meine eigenen. Ihre Großzügigkeit habe ich nicht nötig. Ich will nichts geschenkt bekommen.« Sie hielt mir einen Schlüssel hin. »Hier, die Nummer Sieben.« Sie wies auf einen der Keller.
»Einverstanden, dann also ab sofort Ihre Briketts.« Ich nahm den Schlüssel, schaute zu dem Holzverschlag.
»Na, nun schließen Sie mal auf.« Sie stand mit verschränkten Armen neben mir, um anzudeuten, dass die Umsetzung kaum ohne ihr Zutun gelingen könnte. Zumindest nicht in meinem Fall. Ich steckte den Schlüssel in das Vorhängeschloss und musste feststellen, dass sie recht hatte. Ich bekam das Schloss nicht auf.
»Sie müssen den Schlüssel erst halb rumdrehen, und dann einen schnellen Ruck, nur so funktioniert es.«
»Ihr Schloss ist total verrostet.«
»Na und, ist doch meine Sache.«
»Ja, natürlich.«
»Und schnüffeln Sie hier nicht in meinen Kartons.«
»Nee, Frau Scholz, mache ich nicht.«
Ich ging in den halbdunklen Kellerraum, packte einen Eimer voll, ging in unseren Verschlag und füllte den zweiten. »Wollen wir?«, fragte ich sie, die unschlüssig im Gang stand und mir zusah.
»Ich will erst mal meinen Schlüssel zurück bekommen. Ich leg’ ihn am besten unter meinen Fußabtreter«, sagte sie.
»Oder Sie geben ihn mir. Fände ich praktischer. Unter der Fußmatte kann er auch von der Putzfirma gefunden werden, beim Wischen.«
»Ich gebe Ihnen doch nicht einfach meinen Schlüssel. Was glauben Sie, wer Sie sind. Ich kenne Sie doch überhaupt nicht.«
»Frau Scholz, ich bin Ihre Nachbarin. Aber es ist auch egal, dann legen Sie ihn eben unter die Matte.«
»Sag’ ich ja. Und nun gehen Sie, ich habe hier noch zu tun.«
»Gut, dann bis zum nächsten Mal.«
»Ja.«
Als Fritz zu uns zog, Ella war damals vierzehn und Rafi elf Jahre alt, freuten sich beide, doch noch ein paar Jahre lang eine echte Familie sein zu können, Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Endlich jemanden zu haben, den sie Papa nennen dürfen. Es war ihre Idee, sie fragten ihn, ganzoffiziellund aufregend naiv, ob es ihn stören würde, und wirkten dabei wie Kleinkinder, dabei waren sie schon Teenager. Fritz sah mich an, ich zuckte mit den Schultern, warum nicht, und dann stimmte er zu. In den ersten Wochen fühlten wir alle uns fremd mit diesem großen Wort, doch schnell wurde es alltäglich und war nichts mehr, worüber wir nachdachten. Ihr richtiger Vater besteht darauf, von den Kindern mit seinem Vornamen angesprochen zu werden. Er ist nicht besonders wichtig in unserem Leben. Es gab keinen Streit um die Sorge für die Kinder, als wir uns ein paar Monate nach Rafis Geburt trennten. Ich hatte die Kinder und wechselnde Freunde, erst mit Fritz änderte sich das.
Ella ist mir im Laufe der Jahre durch das Leben, das sie führt, fremd geworden. Groß und schön ist sie, seit der Pubertät immer ein wenig zu mager, nicht essgestört dünn, obwohl sie, weil es damals in ihrer Klasse Mode war, ein paar Mal versucht hat, ihr Essen auszukotzen, aber heute wirkt sie nicht zerbrechlich, eher drahtig.
Ihr Atem riecht immer nach frischer Pfefferminze. Geruch oder Geruchlosigkeit spielen eine außerordentlich wichtige Rolle bei ihr. Als sie mit fünfzehn auf dem Höhepunkt der Pubertät war und mich täglich für meine Existenz beschimpfte, weil sie alles an mir widerlich und peinlich fand, war ihr gemeinster Vorwurf, wenn ihr nichts anderes mehr einfiel: »Du stinkst!« Volltreffer. Sofort hatte ich das Gefühl, sie hätte recht, sah und roch mich kurz aus ihrer Perspektive und wurde in meine eigene Pubertät versetzt, erinnerte mich an das unangenehme Gefühl, wenn Jungs sagten: »Oh, es riecht nach Fisch«, sobald Mädchen den Raum betraten. Stimmt das? Bin ich das?
Ich schickte Ella dann auf ihr Zimmer, zum Nachdenken, etwas Besseres fiel mir nicht ein. Und im nächsten, unbeobachteten Moment schnüffelte ich an meinen Achseln und beugte mich zu meinem Schritt. Ich roch nicht, zumindest stank ich nicht, mein Fehler war nur, dass ich nicht wie sie täglich mit Achsel- und Intimdeo, mit starkem Parfüm, duftendem Shampoo, vanillesüßer Gesichtscreme und kokoslastiger Hautlotion hantierte. Sie konnte mich einfach nicht riechen – sich selbst natürlich auch nicht. Geblieben ist ihre panische Angst vor Mundgeruch.
Ella arbeitet, seit sie sechzehn ist. Während des Abiturs machte sie ein Praktikum imARD-Hauptstadtstudio, danach bewarb sie sich für einen der wenigen Plätze im vierjährigen Studiengang Kamera an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam und wurde im ersten Anlauf genommen. Das hatte niemand erwartet. In den Wochen zwischen Bewerbung und Zusage bereiteten wir sie auf eine Absage vor, versuchten, ihr weiszumachen, dass die vielleicht sogar ein Vorteil sein könnte; wir bemühten uns, andere Perspektiven zu eröffnen, ein freiwilliges soziales Jahr, vielleicht im Ausland, Erfahrungen sammeln oder auch einfach mal einen Sommer nichts tun, chillen, nachdenken, das würde ihr gut tun. Ella wollte von all dem nichts wissen, sie versteifte sich so darauf, angenommen werden zu müssen, dass wir von Tag zu Tag mehr Angst vor dem entscheidenden Brief bekamen. Als er endlich eintraf, wurde mir schlecht, Ella blieb überzeugt von einer Zusage, ganz ruhig war sie, als sie den Briefumschlag öffnete und die Bestätigung in den Händen hielt. »Hab’ ich doch gewusst.« Keine Überraschung, kein Jauchzen oder Schreien, keine Freudentränen, aber als wir am Abend den Erfolg feierten, trank sie so viel, dass ich später ihren Kopf halten musste, während sie sich über der Kloschüssel übergab.
Ihre erste Kamera bekam sie von Fritz geschenkt, und wir haben noch ihre Aufnahmen von damals, die »Weihnachtsdokumentation ’97«, in der sie unser Abendessen so aufgenommen hat, dass es keinen Zweifel daran gibt, wie widerlich sie alles fand.
»Rafi, setz dich auf den Stuhl und nimm alle deine Geschenke in den Arm.«
Ein Bild für den weihnachtlichen Konsumwahn, das nur durch Rafis Strahlen ein bisschen gestört wurde.
Der Rest des Films besteht aus zusammengeschnittenen Szenen, in denen sie das Dahinsiechen der Weihnachtstanne zeigt. Am zweiten Januar stand sie früh am Morgen vor allen anderen auf, nahm die Kugeln, Kerzen und das Lametta ab und hängte stattdessen Müll in die Zweige. Leere Zigarettenschachteln, zerknüllte Zeitungen, einen halb gegessenen und dann vergessenen Apfel, aus dem Abfall gefischte Joghurtbecher. Das war nur der Anfang. Danach standen wir fast jeden Morgen vor einem neu geschmückten Baum, mal hingen Tampons drin, die sie vorher in rote Farbe getaucht hatte, mal aus Zeitschriften ausgeschnittene Bilder von Kriegstoten aus aller Welt, einmal hatte sie Kondome gekauft und mit Mehlpampe gefüllt. Bis Ende Januar musste der Baum im Wohnzimmer stehen bleiben, erst dann galt er für Ella als Baumleiche.
Sie nahm alles auf – wie sie sich schminkte, wie ich morgens nach dem Aufstehen aussah, wie Fritz in der Badewanne liegend seine Fußnägel schnitt und wie sie Rafi dazu brachte, einen Tobsuchtsanfall zu bekommen, indem sie seine mühsam aufgebaute Matchbox-Autobahn kaputt trat. Nachdem sie die gewünschte Aufnahmehatte, setzte sie sich zu ihm, tröstete ihn und baute die Bahn stundenlang wieder zusammen.
Denn meistens war Ella die Beschützerin von Rafi. Sie hatte diese Rolle von ihrer Oma übernommen. Meine Mutter hat ihr früher Geschichten erzählt, abenteuerliche Geschichten über meinen Onkel, ihren kleinen Bruder Klaus, und Ella saß mit großen staunenden Augen und offenem Mund neben ihr, wenn sie hörte, wie meine Mutter Klaus vor den brutalen Eltern beschützte, wie sie ihn aus den brennenden Ruinen von Danzig befreite und kurz darauf vor dem Erschießen durch »den Russen« gerettet hatte. Nur seinen tödlichen Unfall mit der Straßenbahn konnte sie nicht verhindern und fühlte sich lebenslang dafür verantwortlich.
Ella spielte seitdem gerne die bessere Mutter, die meine angeblich viel zu unaufmerksame Erziehung von Rafi ausgleichen wollte. Sie führte als Jugendliche pädagogische Streitgespräche mit mir, versuchte, mich zu überzeugen, dass ich mich mehr um den Kleinen kümmern müsste, horchte mich, wenn ich von Elternabenden nach Hause kam, aus, erinnerte mich an seine Termine beim Kinderarzt und überprüfte, ob ich die Geburtstage von Rafi gebührend vorbereitete. Das war unnötig, ich war Rafi keine schlechtere Mutter als ihr, aber sie gefiel sich in der Rolle und sah sich jedes Mal, wenn ich in ihren Augen versagte, weil ich vergessen hatte ihm ein neues Schulheft zu kaufen oder seine Sportsachen nicht gewaschen waren, bestätigt: Ohne sie würde unsere Familie im Chaos versinken.
Meine Mutter wiederum war der Meinung, Ella sei die Gefährdete in unserer Familie, viel zu freizügig sei meine Erziehung. Meine Mutter und meine Tochter waren, wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven, beide überzeugt, dass ich so ziemlich alles falsch machte.
Für Ellas Abschlussfilm an der Uni bekam sie eine Auszeichnung. Aber das erfolgreiche Studium und dessen Exklusivität verschafften ihr danach keinen einzigen gut bezahlten oder auch nur sicheren Job.
Mittlerweile ist sie sechsundzwanzig, und seit über einem Jahr als Mädchen für alles, oder, wie sie es nennt: »Assistentin der Geschäftsleitung«, in einer Filmproduktionsfirma, die keinerlei Relevanz besitzt, beschäftigt. Ich sehe keinen Unterschied zu ihren vorherigen Praktikumsstellen, der Lohn ist lächerlich, ihr Arbeitspensum enorm. Sie nimmt alles furchtbar ernst, ist gradlinig und diszipliniert. Warum lässt sie sich nicht entmutigen, und wieso kommt sie eigentlich nie auf die Idee, dass es nicht an ihr, sondern an der Branchenphilosophie liegt, wenn sie, nach einer weiteren erfolgreichen Projektbetreuung, nicht aufsteigt, wie es ihr in Aussicht gestellt worden war, sondern genau auf der untergeordneten Position sitzen bleibt, die sie auch zuvor innegehabt hatte?
Die Firma kalkuliert mit jungen, sehr gut ausgebildeten Frauen, die an Aufstieg glauben. Sind sie nach einigen Jahren ausgebrannt, stehen andere motivierte Einsteigerinnen Schlange, die ihre Stelle übernehmen wollen. Die beiden, natürlich männlichen Geschäftsführer sind smart genug, Ella jedes Mal erneut Hoffnung zu machenund daran gut zu verdienen. Sie wird nicht müde, immer und immer wieder beginnt sie von vorn, überzeugt, dass sie diesmal alles richtig machen würde und es keine andere Möglichkeit gäbe, als irgendwann Erfolg zu haben.