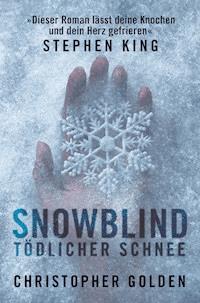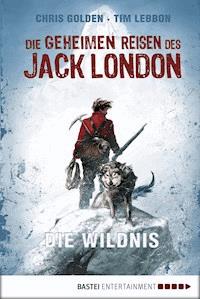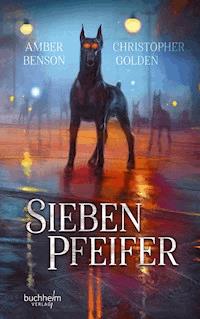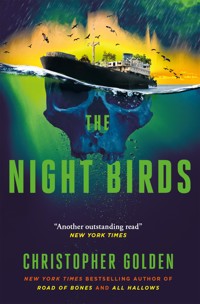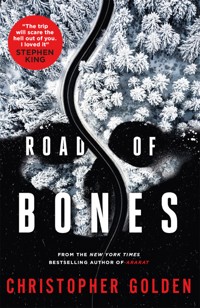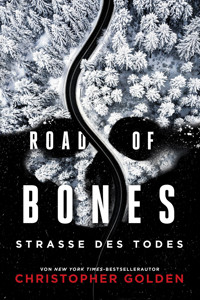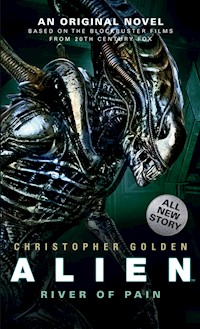Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Meisterwerk von Mike Mignola und Christopher Golden! Als Lord Henry Baltimore auf einem der höllischen Schlachtfelder des ersten Weltkriegs den Zorn eines Vampirs heraufbeschwört, verändert sich die Welt für immer. Eine extrem ansteckende Seuche wurde entfesselt – eine Seuche, die selbst der Tod nicht beenden kann. Jetzt ein einsamer Soldat im Kampf gegen die Dunkelheit, lädt Baltimore drei alte Freunde zu einem Treffen in ein einsames Wirtshaus – Männer, deren Reisen und fantastische Erfahrungen sie an jenes Böse glauben lassen, das die Seele der Menschheit verschlingt. Während die Männer auf ihren alten Freund warten, erzählen sie sich ihre Erlebnisse von Schrecken und Horror und stellen Überlegungen an, über ihren Anteil in Baltimores zeitlosen Kampf. Noch vor die Nacht dem Morgen weicht, werden sie wissen, was zu tun ist um die Seuche zu besiegen – und die Kreatur, die Baltimore als seinen Erzfeind betrachtet – endgültig. Mit zahlreichen Illustrationen von Mike Mignola.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BALTIMORE
oder
DER STANDHAFTE ZINNSOLDATUND DER VAMPIR
Ein illustrierter Roman
MIKE MIGNOLA
und
CHRISTOPHER GOLDEN
Mit Illustrationen von Mike Mignola
Aus dem Amerikanischenund Dänischen übertragen vonChristian Langhagen
Impressum: Die deutsche Ausgabe vonBALTIMORE, ODER, DER STANDHAFTE ZINNSOLDAT UND DER VAMPIRwird herausgegeben vonCross Cult, Teinacher Str. 72, 71634 Ludwigsburg.Herausgeber: Andreas Mergenthaler; verantwortlicher Redakteur: Markus RhodeÜbersetzung: Christian Langhagen; Lektorat: Katrin Aust; Satz: Rowan Rüster;Druck: CPI Moravia Books s.r.o., CZ-69123 Pohořelice.
Originalausgabe:BALTIMORE, OR, THE STEADFAST TIN SOLDIER AND THE VAMPIREAll rights reserved.Copyright © 2007/2008 by Mike Mignola & Christopher GoldenIllustrations: Mike Mignola
This translation is published by arrangement with The Bantam Dell Publishing Group, a division of Random House, Inc.
ISBN 978-3-96658-065-6eISBN: 978-3-96658-066-3
Februar 2020
Printed in the EU
Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Roman mit oder diskutierenSie mit anderen Lesern im Cross Cult Forum aufwww.cross-cult.de
Für Bram Stoker, Mary Shelley, Herman Melville,Hans Christian Andersen und meine Frau Christine.— M.M.
Für Maurene Golden, Denis Golden, Brian & Mary Golden,Gerry Golden, Terry & Dinae Golden und George& Elaine Sacco. Und im Gedenken an Richard Goldenund meinen Vater, James Laurence Golden Jr.Deine nie nachlassende Unterstützung und deinEnthusiasmus waren so unendlich wichtig für mich.Diese Widmung ist längst überfällig.— C.G.
Inhalt
PRÄLUDIUM: REQUIEM
DER ANKÖMMLING: KYRIE
DIE GESCHICHTE DES CHIRURGEN: OFFERTORIO
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
DIE GESCHICHTE DES SEEMANNS: SANCTUS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
DIE GESCHICHTE DES SOLDATEN: AGNUS DEI
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
DIE GESCHICHTE DES ERLÖSERS: BENEDICTUS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
CRESCENDO: LUX ET AETERNUM
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
FINALE: LIBERA ME
KODA
DER STANDHAFTE ZINNSOLDAT
IN EINER KALTEN HERBSTNACHT frei von Sternenlicht, unter einem finstren Himmelszelt, dem selbst der Mond den Rücken kehrt, hält Captain Henry Baltimore sein Gewehr fest umklammert und starrt über den finsteren Abgrund des Schlachtfelds hinweg, und er weiß in seinem Herzen, dass dies die marternden Fegefeuer der Hölle sind und dass die Verdammnis nur wenige Schritte entfernt auf ihn wartet.
Er hält inne, kniet nieder, lauscht, aber der klamme Herbstwind trägt lediglich den Gestank von Tod und Verderben herüber. Baltimore gestikuliert in Richtung der Männer, die sich hinter ihm durch die Finsternis arbeiten, und bewegt sich dann gebückt auf eine kleine Anhöhe zu. Erde, die das Kriegsgetöse aufgeworfen hat … oder ein Haufen aufgetürmter Leichen.
Hinter der Anhöhe sinkt Baltimore auf die Knie. Ein unschuldiger Lehmhaufen, der beim Ausheben eines Grabens entstanden ist. Aber diese Tatsache vermag ihm keine Erleichterung zu verschaffen. Allerdings wird dieser winzige Hügel ihnen bessere Deckung bieten, als es Leichen gekonnt hätten. Kugeln durchdringen verwesendes Fleisch weit leichter als harte Erde.
Im Dickicht der Nacht würde nur ein Wahnsinniger den Versuch wagen, das zerklüftete Niemandsland zu überqueren, das seine Kompanie von den Hessen trennt. Die verbrannte Tundra ist zerfurcht von feuchten, matschigen Gräben und übersät mit den Körpern der Toten. Stacheldraht schlängelt sich in gewundenen Reihen quer über das Feld.
Und doch erweisen sie sich als Wahnsinnige. Der Kompanieführer hat bestimmt, dass irgendjemand jenen verfluchten Boden in der Finsternis überqueren und den Kampf bis an die Schwelle des Feindes tragen soll. Ein Befehl, aus Verzweiflung geboren. Ohne eine Wendung des Schicksals – durch Götter oder Menschen – wird das erste Morgenlicht sie in höchst misslicher Lage wiederfinden.
Die Mission ist Captain Baltimore übertragen worden.
Er hat seinen Zug weggeführt von der Sicherheit des Kompanielagers, hinaus aus dem Wald, der nun in so weiter Ferne zu liegen scheint, fünfzig Meter hinein ins Niemandsland. Und bis zur nächsten brauchbaren Deckung müssen sie noch mindestens das Vierfache dieser Wegstrecke zurücklegen. Die Hessen kampieren in den dichten Wäldern auf der anderen Seite des Schlachtfelds.
Baltimore weiß, dass er hier genau am Rande der Welt steht. Wie sonst wäre das Grauen zu erklären, das in seiner Brust umherkriecht und sich um seine Seele windet? Er muss vor der Pforte zur Hölle stehen, denn er kann sich kein Stück Boden vorstellen, das ferner der Heimat liegt, ferner der Familie und ferner jeden Trostes. Und doch ist dies die Natur des Krieges. Ein Soldat zu werden, Blut zu vergießen und menschliche Seelen im Namen von Glaube und Vaterland zu tilgen, heißt, in so weite Ferne zu reisen, dass dein Zuhause eine so entfernte und geheiligte Erinnerung wird wie die Unschuld.
Er sehnt sich nach beidem, als ihm endlich klar wird – erst hier und jetzt –, dass er es für immer verloren hat.
Als Knabe war er an verregneten Tagen in seinem Zimmer geblieben und hatte mit seinen Zinnsoldaten gespielt, hatte sie zu Feinden erklärt und sie einander auf dem Schlachtfeld seiner Bettdecke umbringen lassen. Doch Zinnsoldaten bluten nicht. Sie wandern zurück in ihre Kiste und leben weiter, bis zur nächsten Schlacht an einem anderen Tag.
Soldaten aus Fleisch und Blut enden auch in einer Kiste, aber die ist aus schwerem Kiefernholz. Baltimore hat viel zu oft mit angesehen, wie Soldaten bluten und schließlich in diese Holzkisten gebettet werden. Furcht pulsiert nun in seinen Adern, er kann sich kaum rühren. Der Tod wartet auf dieser verwüsteten Ebene, und Baltimore verspürt nicht den Wunsch, ihm zu begegnen. Seine Knochen schmerzen. Eine schmerzhafte Kälte kriecht in seine Knochen, die mehr vom Schrecken und der Trauer herrührt denn von der Novemberluft, und er muss um Atem ringen.
Er hebt eine Hand und gibt seinen Männern den Marschbefehl, erst denen zur Linken und dann denen zur Rechten. In zwei Reihen hasten sie vorwärts, seine Position zu beiden Seiten flankierend. Ihre Bewegungen sind flüsternd leise, sodass sie kaum die Finsternis aufwühlen, und doch kommen sie ihm viel zu laut vor. Während sie sich nähern, kann er das behutsame Auftreten ihrer Stiefel auf dem harten Grund hören und das kehlige Grunzen grimmiger Männer, die des Tötens überdrüssig sind.
Ihre Gestalten schälen sich aus dem Schwarz. Figuren, auf deren Kopf die flachen Helme der alliierten Truppen sitzen, das Gewehr stets im Anschlag. Ihm am nächsten ist Sergeant Tomlin, der sein Gewehr im Arm wiegt wie ein Neugeborenes.
Die Wolken am Nachthimmel hängen tief und üppig, sodass nur der leiseste Anflug von Licht vom Himmel dringt. Tomlins Augen funkeln in der Finsternis, und jetzt, da er nahe herangekommen ist, sieht Baltimore die Anspannung in den Gesichtszügen seines Untergebenen. Seine Haut kribbelt vor Angst, und in seinem Brustkorb hämmert sein Herz so schnell, dass es schmerzt. Baltimore war nie ein Feigling. Und doch zögert er jetzt, ausgerechnet hier, am denkbar ungünstigsten Ort für ein derartiges Innehalten.
Da ihm keine andere Wahl bleibt, nickt er, hebt seine Hand und bedeutet seinen Männern erneut vorzustoßen.
Umrisse, so schwarz wie Ebenholz, preschen vor und verteilen sich auf dem Feld. Baltimore und Sergeant Tomlin trennen sich und umkreisen jeder für sich den Hügel aus feuchter Erde, und selbst auf diese Entfernung ist der Sergeant kaum mehr als ein dunkler, sich bewegender Schatten. Baltimore umklammert sein Gewehr so fest, dass seine Finger schmerzen. Seine Beine scheinen eigenen Befehlen zu gehorchen, wie sie ihn über die aufgerissene Erde tragen. Er stolpert beinahe über einen toten Soldaten, dessen Körper so verbrannt ist, dass unmöglich zu erkennen ist, ob er Freund oder Feind war. Das Gesicht des Toten ist zerlaufen wie geschmolzenes Kerzenwachs.
»Mein Gott«, dringt Baltimores Flüstern ans Ohr der Nacht.
Tomlin hastet nach links, um zu seiner Abteilung aufzuschließen, und Baltimore reißt sich vom Anblick des toten Mannes los, um zur Abteilung auf der rechten Flanke zu stoßen. Leises Grunzen und das Schaben von Drillichen und Baumwolluniformen ertönt von weiter vorne, wo sich Tomlins Zug sammelt, doch die Nacht hat sie alle verschluckt.
In gebückter Haltung stiehlt sich Baltimore über das zerstörte Areal, seine Männer dicht hinter ihm. Er hebt eine Hand. Seine Augen suchen nach Norwich, dem Corporal mit dem Drahtschneider, und finden den Mann unmittelbar neben sich. Die Griffe des Werkzeuges ragen aus seinem Rucksack.
Jeder für sich erreichen sie den Stacheldraht – ein verwobenes, mannshohes Durcheinander. Baltimore sinkt auf ein Knie. Seine nächste Geste gilt Corporal Norwich. Der Mann drückt dem Private neben sich sein Gewehr in die Hand und lässt den Drahtschneider aus seinem Rucksack gleiten. So rasch und so geräuschlos wie möglich macht er sich am Stacheldraht zu schaffen. Weiter vorne wird Tomlins Abteilung ebenso verfahren.
Baltimore richtet sich auf und blickt forschend zur anderen Seite des Schlachtfeldes. Die dem offenen Areal nächstgelegenen Bäume sind Schattenstreifen vor dem tieferen Schwarz des Waldes.
Norwich ist schon auf halbem Wege durch die fast zwei Meter dorniger Maschen. Dort, wo er die Barriere durchtrennt hat, ist der Draht zurückgewichen wie das Fleisch um eine Wunde.
Der Corporal durchtrennt ein weiteres Stück, das zurückschnellt und seine Wange peitscht. Fleisch wird aufgerissen. Norwich stöhnt laut auf und lässt die Drahtschere fallen. Er drückt mit einer Hand auf seine Wange, aber weder schreit noch flucht er. Baltimore stürmt auf die Öffnung im Stacheldraht zu. Er gibt dem Private, der Norwichs Gewehr hält, einen Wink, und die beiden Männer ziehen Norwich an seinen Beinen zurück.
Die Augen des Corporals sind von Schmerz und einem brodelnden, merkwürdig unbestimmten Zorn erfüllt. Blut malt schwarze Schlieren auf sein Gesicht und Kinn und sickert durch die Finger, die er auf seine Wunde gedrückt hält.
Baltimore nickt Norwich anerkennend zu, dass er es geschafft hat, die Stille zu wahren. Dann lässt er den Private, der ihm geholfen hat, Norwich aus dem Stacheldraht zu zerren, mit einem stummen Blick wissen, dass es nun an ihm ist, den Schneider aufzuheben und mit der Aufgabe fortzufahren. Der Private zögert einen Augenblick lang, als hoffe er, dass der Befehl einem anderen Soldaten gegolten habe. Dann klettert er zögerlich in den Stacheldraht vor und hebt die Drahtschere auf.
Ein in Schatten gehüllter Schemen kommt näher und tritt zwischen dem Pulk wartender Soldaten hervor. Der Mann nimmt seinen flachen Blechhelm ab und Baltimore erkennt in ihm den Sanitäter Stockton. Der greift in einen Beutel, den er sich über die Schulter geworfen hat, und zieht einen kleinen Kasten hervor. So geschwind, wie der hagere Private Strang um Strang kappt und eine Bresche in die Drahtwinden schlägt, reinigt Stockton Norwichs Wunde und schmiert eine gerinnungsfördernde Paste auf sie. Mehr kann jetzt nicht für den Verwundeten getan werden. Die Position der klaffenden Wunde macht eine Bandage hinderlich beim Kampfeinsatz.
Stockton besieht sich die Wunde ein letztes Mal, doch in der Dunkelheit ist es letztlich unmöglich, einen genaueren Blick zu erhaschen. Der Sanitäter zeigt Captain Baltimore den erhobenen Daumen und geht in die Hocke, um sich zu den anderen Soldaten zu gesellen, die auf den Marschbefehl warten. Eine schwarze Silhouette im Flügelhelm übergibt ihm sein Gewehr.
Der hagere Private kehrt gebückt aus dem Drahtungetüm zurück. Er hat Norwichs Aufgabe zu Ende gebracht. Sie haben jetzt einen Pfad.
Mit schmerzverzerrtem Gesicht steht Norwich auf, angelt sich die Drahtschere und steckt sie wieder in seinen Rucksack. Er und der Private sehen ihren Captain erwartungsvoll an. Baltimore nickt und signalisiert seinen Männern, sich in Bewegung zu setzen. Private Macintosh bildet die Spitze. Baltimore hätte den Umriss des hünenhaften Rohlings unmöglich mit jemand anderem verwechseln können. Der Captain reiht sich an fünfter Stelle ins Glied ein, während sie sich schnellen Schrittes durch die Schneise im Stacheldraht vorarbeiten.
Auf der anderen Seite verteilen sie sich und bilden entlang des Drahtes eine Reihe. Baltimore studiert das zerlöcherte und vernarbte Schlachtfeld, das vor ihm ruht. Wind kommt auf. Als die Kälte durch seine Uniform bis direkt auf den Knochen schneidet, erzittert er.
Weniger als zehn Fuß vor ihm gähnt ein breiter Graben, der wie eine Wunde klafft, die man in die Welt geschlagen hat. Gegen die Schwärze in diesem Abgrund wirkt die Nacht hell. Zu seiner Linken wird sich Tomlins Abteilung inzwischen auch durchgearbeitet und verteilt haben, sodass das Platoon wieder vereint ist. Sie werden auf seinen Befehl warten, als gäbe es denn eine andere Wahl außer dem Weg voran … in den Graben hinab und auf der anderen Seite wieder hoch.
Baltimore hebt seine Hand, um das Vorrücken zu befehlen.
In schneller Abfolge durchdringen drei bellende Geräusche die Nacht, gefolgt von einem seltsamen Pfeifen, das sein Ende findet, als ein Trio von Leuchtgeschossen in gleißender Helligkeit über dem Schlachtfeld explodiert und die ganze Szenerie in ein grelles weißes Licht taucht, sodass man jeder Leiche und jedes Grabens und jeder Grassode im Erdboden ansichtig werden kann.
Das Platoon sitzt zwischen Stacheldraht und Graben wie auf dem Präsentierteller, ohne jede Deckung.
Grauen und Furcht, die durch seine Venen rasen, erstarren zu massivem Eis wie auch Baltimore selbst. Seine Beine stehen fest verwurzelt an Ort und Stelle, einem seiner geliebten Zinnsoldaten gleich, dessen Füße an den Sockel geschweißt sind. Er hat versagt und sein Land im Stich gelassen wie auch die Männer, die ihm folgen. Sein Blick folgt den Leuchtgeschossen, die sich zum höchsten Punkt ihrer Flugbahn erheben und dort oben einen Moment lang wie Engel in der Luft zu stehen scheinen.
Zehn oder zwanzig Fuß zu seiner Rechten flucht einer seiner Männer. Die Stimme klingt, als dringe sie aus eintausend Meilen Entfernung an sein Ohr. Und so groß mag die Distanz zwischen ihnen auch sein, zwischen ihnen allen, denn im Augenblick des Todes steht jeder Mann für sich alleine.
In dieser Flut aus weißem Licht senkt Baltimore den Blick, selbst als der Graben vor ihm zum Leben erwacht. Die Hessen, die dort gekauert haben, rappeln sich mit gezückten Waffen auf und recken die Läufe ihrer Maschinengewehre hoch, um ihre Ziele aufs Korn zu nehmen.
Ein Zinnsoldat kann sich nicht bewegen.
Er steht bereit, das Gewehr in der Hand, doch es wird der Hand des Kindes bedürfen, um ihn in das Duell mit seinem Feind zu entsenden. Eine schwere Wolldecke in zwei Blautönen dient als Schlachtfeld. Ihre Knitterfalten geraten zu Hügeln, auf denen dem Zug der Zinnsoldaten der Angriff befohlen werden muss.
Der Krieg hält inne. Er atmet eine leichte Frühlingsbrise, die durch das Zimmer huscht.
Der Junge ist fürs Erste gegangen. Verbündete und Feinde stehen im Moment gefangen da. Die große Macht, die sie alle bewegt, hat sie inmitten dieser Szenerie fallen lassen und nacktes Entsetzen ergreift von dem Zinnsoldaten Besitz. Wie gelähmt kann er nur darauf warten, dass die Schlacht wieder zum Leben erwacht. Sobald der Junge zurückkehrt, wird sein Schicksal entschieden werden. Mag sein, dass er überlebt, mag sein, dass nicht. Doch die Ungewissheit nagt an ihm.
Das Schlafzimmerfenster steht einen Spaltweit offen. Drum tanzt und wirbelt die Frühlingsluft in den Raum hinein. Das Sonnenlicht skizziert ein längliches Rechteck auf den Boden, das von einem Quartett aus Fensterkreuzen zerschnitten wird. Die Brise trägt Kinderlachen mit sich. Der Junge ist draußen und spielt mit seinesgleichen, während auf dieser blaugestreiften Wolldecke das Schicksal zweier Zinnarmeen erstarrt seiner Erfüllung harrt.
Wenn der Junge doch nur hereinkäme, wenn Henry mit ihnen spielen würde und sein Lachen mit ins Zimmer brächte, dann, so weiß der Zinnsoldat, wäre alles wieder gut. Wäre der Junge hier im Zimmer, so würden hier Wärme und Fröhlichkeit einkehren. Und das Gefühl von Sicherheit. Doch in diesem versteinerten Augenblick kann alles geschehen.
Ausnahmslos alles.
Ein Zinnsoldat kann sich nicht bewegen.
Ein neues Geräusch dringt in den Raum. Barsches, hochmütiges Gelächter, das keiner kindlichen Belustigung entstammt. Es kommt nicht von dem grünen Frühlingstag draußen vor dem Fenster, sondern von dem Regal hoch an der Wand. Aus einer Holzkiste, in deren bemalte Seiten grinsende Gesichter von Hofnarren geschnitzt sind. Ein Kurbelgriff ragt unbewegt aus einer Seite der Kiste hervor.
Doch in der Kiste rührt sich etwas.
Der Springteufel wälzt sich in seiner Holzkiste und es macht laut »Klopf-klopf-klopf«, als sein hölzerner Kopf gegen die Wände schlägt. Misstönende, fröhliche Musik blökt drei Noten, doch die Kurbel bleibt unbewegt. Das Gelächter erklingt erneut – ein raues, bellendes Stakkato –, und der Soldat weiß, dass es etwas gibt, vor dem er sich mehr fürchten muss als davor, sein Leben zu verlieren, den Krieg zu verlieren …
Das Gewehrfeuer zerreißt die Luft – ein raues, bellendes Stakkato. Das Platoon manifestiert sich als schwarze Silhouetten, die aus dem grellen weißen Hintergrund herausstechen. Die Funken aus den Läufen regnen vom Himmel herab. Fast sehen sie aus wie Engelsflügel, wie sie auf der herbstlichen Brise dahintreiben. Ihr Flackern gleicht seinen Rhythmus dem Feuer der Maschinengewehre an und verwandelt das Abschlachten von Baltimores Männern in ein grauenhaftes Zoetrop – ein Grand Guignol aus Schatten und Licht.
Schreie, beseelt von Schmerz und Tod, erheben sich um ihn herum. Baltimore dreht sich nach links und sieht, wie Sergeant Tomlin und noch ein weiterer Mann zurücktaumeln, wie Marionetten, deren Gliedmaße von den Kugeln zum Tanzen gebracht werden. Man treibt sie in den Stacheldraht, den sicheren Tod. Ihr Fleisch reißt bei jeder Bewegung. Sie bluten. Sie sterben.
Rechts steht der hagere Private kerzengerade, ganz als stünde er stramm. Nur fehlt die obere Hälfte seines Schädels, und ein Loch klafft dort, wo seine Nase sein sollte. Eine Eintrittswunde. Längst tot, umklammert er noch immer sein Gewehr und marschiert drei Schritte vorwärts, bevor er in den Graben stürzt, hinunter zu den Hessen, die ihn ermordet haben.
Der Zinnsoldat kann sich nicht bewegen.
Baltimore realisiert nicht, dass er getroffen worden ist, bis er spürt, wie ihm heißes Blut am Oberschenkel hinabläuft und sein linkes Bein nachgibt. Während er vorwärtsstolpert, hebt er nicht einmal das Gewehr, um zu versuchen, seinem Sturz Einhalt zu gebieten. Die Waffe bleibt von seinen Händen umklammert, ein nutzloses Stück Metall.
Wieder dröhnt Trommelfeuer aus dem Schützengraben. Und während er sich im Niedersinken um die eigene Achse dreht, sieht er die zur Tarnung mit Dreck geschwärzten Gesichter der hessischen Soldaten, wie sie ihre Waffen laden und ihre schweren Gewehre mit Munition füttern. Während die Funken verglühen, sieht er, wie zwei Männer seines Platoons zu seiner Position vordringen. Stockton und der Hüne Macintosh formieren sich um ihren Captain. Sie erwidern das Feuer, doch die zehn Kugeln in den Magazinen ihrer Gewehre werden nicht genügen.
Baltimore fällt.
Der Zinnsoldat kann nichts sehen, aber das kratzende, angedeutete Lachen dieses Dings in der geschnitzten Kiste, des abscheulichen Springteufels, das kann er hören. Das Geräusch könnte auch einer schrecklichen Maschine entweichen, in einer Fabrik Satans. Er weiß, dass der Springteufel dort oben auf seinem Regal in der Kiste belustigt innehält und nur auf seine Gelegenheit wartet, auszubrechen.
Was das Wesen dann tun wird, das weiß der Zinnsoldat nicht. Aber er fürchtet schon jetzt jenen Augenblick, da er jenes misstönende, schrille Geräusch hören wird, wenn sich die entsetzliche Kurbel in Bewegung setzt. Denn dann wird er wissen, dass der Springteufel befreit wird.
Fürs Erste ist das Lachen entsetzlich genug.
Und dann verstummt es.
Zeit vergeht, obschon der Soldat nicht weiß, wie viel. Er fühlt, wie seine Kameraden unnachgiebig auf ihn eindrängen, überall um ihn herum drücken Zinnarme und -beine von oben und unten auf ihn ein.
Aber ja, doch, sie sind wieder in ihrer Kiste. Der Junge hat sie eingesammelt und verstaut, bis es ihn erneut nach Krieg gelüstet. Für den Jungen verhält es sich so einfach, so unschuldig.
Wieder in der Kiste zu weilen, ist tröstlich. Erstickend, ja, denn dort drinnen liegt er verdreht, auf dem Rücken, die Beine steil in die Höhe und all die anderen Zinnsoldaten über ihm; ihre Gewehre stoßen in seinen Leib. Aber in der Kiste ist es sicher. Hier drinnen gibt es keine Feinde. Die zwei Armeen sind nun eine. Brüder aus Zinn.
Er fühlt sich sicher. Freude gar durchströmt ihn.
Vielmehr würde sie es, wäre die Nacht nicht so kalt und wäre da nicht der pulsierende Schmerz, den die Wunde in seinem Oberschenkel verursacht, und wäre da nicht der Gestank nach Blut und Moder.
Es fängt an zu regnen.
In der Kiste … zu regnen …
Die Kälte weckt ihn. Kühle Tränen bilden ein Rinnsal auf seinem Gesicht, und Baltimore bemerkt, wie sich sein Brustkorb hebt und senkt. Er kann atmen, was bedeutet, dass er noch nicht tot ist. Der metallische Geruch von Blut hängt in der Luft; der Regen kann ihn nicht wegwaschen.
Zitternd öffnen sich seine Augenlider. Er lässt seinen Blick umherschweifen und versucht herauszufinden, wo er ist und wie er dort hingekommen ist. Andere Gerüche dringen ihm nun in die Nase – der satte Duft feuchter Erde, das schwere Bouquet ungewaschener Körper. Schmerz pocht in seinem linken Bein, als stieße irgendwer ein Bajonett tief in sein Fleisch.
Vielleicht ist es das, mehr noch als der eisige Regen, was ihn geweckt hat.
Baltimore fällt das Atmen schwer. In seiner jetzigen Lage sind seine Beine erhöht, während sein Kopf zurückhängt. Seine Gedanken erwachen langsam zum Leben, als habe er zu viel Whisky getrunken und sei mitten in der Nacht zu Sinnen gekommen, noch nicht gänzlich nüchtern. Sein Kopf fühlt sich betäubt an, sein Geist benebelt.
Wieso fällt ihm das Atmen so schwer?
Die Finsternis dauert an, also war er nicht lange genug bewusstlos, als dass der Morgen angebrochen wäre. Und doch wird Baltimore, während er versucht, die Desorientierung abzuschütteln, die ihn wieder ins Vergessen hinabzuziehen droht, klar, dass die Finsternis nicht mehr ganz so allumfassend ist, wie sie es gewesen ist. Dunkle Schemen lasten schwer auf ihm. Etwas Kaltes, Feuchtes, Rohes berührt sein Gesicht. Er liegt auf einer Reihe kleiner Bodenwellen und Erhöhungen, die sich anfühlen wie ein Steinhaufen.
So verwirrt sein Verstand auch ist, dringt doch die Wahrheit an die Oberfläche und ein Seufzer der Verzweiflung entweicht seinen Lippen.
Er liegt mit den Toten in einem Graben, und seine Kleidung ist durchnässt von Blut und dem eisigen Regen. Die Steine unter ihm sind die hervorstehenden Ellenbogen und Knie der Soldaten, die ihm in den Tod gefolgt sind. Er dreht sich ein wenig und zwingt seinen Kopf dazu, sich zu erheben. Zur Belohnung explodiert Schmerz in seinem verletzten Bein. Immerhin kann er jetzt sehen, dass die Last auf seiner Brust, die ihm das Atmen so erschwert, ein Gesicht hat. In der schwermütigen Finsternis der stürmischen Nacht kann er die Schnittwunde auf Corporal Norwichs Wange klaffen sehen. Der tote Mann starrt ihn an, mit seinen ins Leere blickenden, trüben Augen.
Pein sticht wieder in sein Bein, und er fragt sich, welches Ausmaß seine Verletzungen haben mögen. Baltimore blinzelt und dreht sich wieder ein wenig, findet einen Halt in dem Totenmeer. Schwindelgefühl folgt auf seine Mühen und er lässt es kurz gut sein, um das Gefühl vergehen zu lassen. Er hat sehr viel Blut verloren.
Er ringt mit dem Drang, um Hilfe zu schreien. Es ist unmöglich zu sagen, ob auf dem Schlachtfeld noch irgendwer lebt, aber wenn, werden es höchstwahrscheinlich Hessen sein und keine alliierten Soldaten. Und selbst wenn ihn sein eigenes Bataillon hört – wenn sie jemanden losschicken, der versuchen soll ihn zu holen, werden die Hessen auch ihn niedermähen.
Bilder seiner Männer, wie sie abgeschlachtet werden, blitzen in seinem Verstand auf, und die Schuld wiegt so schwer, dass sie droht, ihn noch tiefer in das Loch zu drücken. Er war wie versteinert, unfähig zu jeder Hilfe.
Nicht, dass das von Bedeutung wäre. Ein weiteres Gewehr hätte sie nicht gerettet, diese Männer, deren Blut den Boden tränkt. Jetzt wünschte er, ach, wäre er doch nur versteinert geblieben, um dem Schmerz zu entgehen wie auch der schneidenden Wahrheit seines eigenen Versagens.
Kalt. Baltimore ist so unfassbar kalt. Eine schläfrige Starre übermannt ihn. Die Stille ist besser. Sicherer. Er hat schon zu viel Blut verloren, da ist er sich sicher. Der Tod wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Und doch will er nicht in dem Schützengraben sterben.
Er beruhigt seinen rasselnden Atem und versucht, einen klaren Kopf zu bekommen. Baltimore stützt sich an den Toten zu beiden Seiten ab und drückt sich in die Höhe. Getrocknetes Blut bröckelt von seiner Uniform. Schmerz rast durch sein Bein und er neigt sich zur Seite. Sein Kopf ruht auf dem Rücken eines toten Soldaten.
Er kommt wieder zu Atem. Muss seine Augen zwingen, geöffnet zu bleiben. Sein Mund fühlt sich trocken an, und er kann spüren, wie die Bewusstlosigkeit an ihm zerrt, aber er lässt seinen linken Arm zwischen zwei Leichen emporgleiten. Einer von ihnen ist der tote Norwich. Die Leiche des Corporals wird von Baltimore beiseitegeschoben.
Er kann nun den Himmel sehen. Eiskalter Regen spritzt auf sein Gesicht und hilft ihm, bei Bewusstsein zu bleiben. Frische Luft füllt seine Lungen, kalt und belebend. Der nächtliche Himmel ist voller schwerer Wolken, aber es gibt Lücken, hinter denen er schummrige Sterne ausmachen kann, und im Osten wird der Horizont langsam heller.
Wenn er sich nur aus diesem Wirrwarr aus toten Männern befreien könnte, würde er friedlich auf der verwüsteten Erde liegen. Wenn er sich dann nicht rührt, wird der Schmerz vielleicht nicht so schlimm sein, und er kann seine Augen schließen, um sich jenem ewigen Schlaf zu überantworten.
Er fragt sich, ob er lange genug leben wird, um Zeuge des Sonnenaufgangs zu werden, und hofft, er wird.
Die Toten scheinen auf ihn einzudringen, als wollten sie ihn nicht freigeben. Sein Puls rast und Baltimore setzt sich in Bewegung. Er zieht sein gutes Bein unter sich, stützt sich wieder an den Toten ab und stößt sich aufwärts. Der Schmerz treibt einen Schrei seinen Hals hinauf, aber er presst die Zähne fest aufeinander und lässt nur ein leichtes Stöhnen hören. Er kann sein linkes Bein unterhalb des Knies nicht mehr fühlen, aber auf der Rückseite seines Oberschenkels fühlt er warmes, frisches Blut hinabsickern, und das bereitet ihm Sorgen.
Dank seiner Hände Arbeit gelingt es dem leidenden Leib mit Ach und Krach, sich hochzuwinden. Er stößt sich hinauf, durch Beine und Arme hindurch, und sein Körper zittert ob der Anstrengung. Seine Gedanken verschwimmen, aber Baltimore bleibt gerade so weit bei Bewusstsein, dass er es vermeiden kann, in die Gesichter der Toten zu blicken. Je mehr er sie berührt, desto mehr spürt er ihre Geister, die ihn umgeben. Gespenster, die anklagend gerade eben am Rande seiner Wahrnehmung schweben.
»Es tut mir leid«, flüstert er.
Der Schmerz in seinem Bein trifft ihn wie Hammerschläge, sie zermalmen ihn, als Baltimore nach den Wänden des Schützengrabens greift und sich den Berg an Leichen zunutze macht, um sich hochzuarbeiten. Er entsteigt dem Graben mithilfe einer Leiter aus toten Soldaten. Seinen toten Soldaten.
Er versucht den Schmerz, der ihn blendet, wegzublinzeln, und glaubt zunächst, es sei der Regen, der seinen Blick verklärt. Dann fegt ihn dunkles Vergessen von den Füßen, direkt in seine klamme Umarmung …
… und wieder weckt ihn der kalte Regen.
Einen Augenblick lang liegt er dort, unfähig sich zu bewegen, und fragt sich, ob die Hessen gesehen haben, wie er herausgeklettert ist. Er hat keinen von ihnen etwas rufen oder flüstern hören und auch kein Fußgetrappel, also geht er davon aus, dass er nicht bemerkt worden ist … oder ganz alleine ist.
Der Wall aus Stacheldraht zeichnet sich zu seiner Linken ab. Männer aus seinem Platoon haben sich in dem Draht verheddert, manche wie gekreuzigt, mit gespreizten Armen und Beinen und von Einschüssen durchsiebt. Einem der Männer ist die Kehle durchgeschnitten worden, vielleicht um seinem Elend ein Ende zu bereiten, oder vielleicht auch nur, um seine Sterbensschreie verstummen zu lassen.
Baltimore atmet tief ein und versucht sich umzudrehen. Schwärze schwimmt am Rande seines Blickfeldes und als er die Augen wieder aufschlägt, hat sich der Horizont geringfügig aufgehellt. Das Morgengrauen kommt mit jeder Ohnmacht näher.
Er lehnt sich zurück, um den Horizont im Osten anzusehen und auf die Sonne zu warten. Darauf zu warten, zu sterben.
Doch … da ist etwas am Himmel.
Er blinzelt wieder. Seine Gedanken sind schwammig, wie in Watte gepackt. Der Nebel wird dichter. Seine Augenlider flattern, aber er versucht sie geöffnet zu halten, den Himmel zu beobachten, während er sich fragt, ob die Schemen dort bloße Halluzination sind oder Flecken, die seine Augen trüben, doch sie dauern an. Und sie bewegen sich. Sie fliegen.
Drachen. Es sind Drachen, wie der, den er als Junge besessen hat, bloß mit kürzeren Schwänzen.
Die Drachen kreisen und lassen sich treiben und gleiten dahin und bald schon sinken sie tiefer, flattern über das Schlachtfeld … über die Toten. Der eisige Regen rinnt an seinem Gesicht und seinem Nacken hinab und füllt seine Augenhöhlen, und er muss ihn immer wieder fortblinzeln. Ein merkwürdiger Friede ergreift von ihm Besitz.
Als er abermals das Bewusstsein erlangt, starrt Baltimore hinauf in den Himmel. Die Gewitterwolken sind noch immer schwarz, doch in den Lücken zwischen ihnen sind die Sterne fast verschwunden. Den Horizont prägt nun ein reiches, dunkles Indigoblau, das den Morgen ankündigt.
Doch noch ist es nicht so weit.
Ein schlagendes Geräusch dringt über das in Mitleidenschaft gezogene Feld an sein Ohr, und jäh erinnert er sich an die Drachen.
Er lässt seinen Kopf nach rechts rollen. Im Schützengraben bewegt sich etwas. Mehr als nur ein einzelnes Etwas. Schwarze Flügel recken sich empor und werden vom Regen benetzt. Von dort kommt das Geräusch aneinanderschlagenden Leders. Also keine Vögel.
Etwas anderes.
Der Schmerz scheint fast vollständig aus seinem Bein gewichen zu sein, zusammen mit jedweder anderen Empfindung. Die Taubheit dort scheint sich auszubreiten. Er spürt selbst die Kälte nicht mehr.
Wieder das Geräusch … Er rollt seinen Kopf nach links. Eine der Kreaturen lässt sich auf dem Draht zwischen zwei der toten Soldaten nieder. Ihre zeltartigen Flügel scheinen zu groß zu sein für ihren Körper. Sie beugt ihren Kopf zu einem der Soldaten vor. Ihr Gewicht lässt sie auf dem Draht auf und ab tanzen, als ihr Kopf nach vorn schnellt und den Leichnam aus der Nähe taxiert.
Das hier wirkt wie der seltsamste aller Träume.
Baltimore seufzt kaum hörbar.
Die Kreatur zuckt zurück, dreht sich um und starrt ihn unverwandt an. Im Schein der Morgendämmerung schimmern ihre Augen in einem grässlichen, leuchtenden Purpurrot. Ohren und Schnauze erinnern ihn an eine Fledermaus, doch dieses Wesen ist enorm groß und Furcht einflössend. Sein schlüpfriges, rotes Maul besitzt lange, silberne Nadeln anstatt Zähnen – alle nass von Blut.
Sie fressen die Toten.
Baltimore blinzelt von Neuem und zwingt sich, bei Bewusstsein zu bleiben, und als er das tut, sieht er, wie die Kreatur ihre Schnauze vorstreckt und ein gutes Stück Fleisch aus dem Hals des Privates packt, den alle Männer Topper genannt haben. Baltimore hat seinen wirklichen Namen nie gekannt. Die Kreatur reißt ihren Kopf ruckartig zurück, und ein Streifen Haut löst sich mitsamt des Brockens blutigen Fleisches. Sie wirft den Kopf zurück und schlingt ihre Beute hinunter.
»Mein Gott«, flüstert er.
Die Kreatur zuckt erneut zusammen und dreht sich um. Der Stacheldraht schwankt unter ihrem Gewicht hin und her. Sie neigt ihren Kopf und starrt ihn an, und die Neugier in ihren purpurroten Augen lässt ihn schaudern. Diese Dinger dort in den Schützengräben und auch andernorts auf dem Schlachtfeld scheren sich nicht um ihn, so hingerissen sind sie davon, sich an den Leichen zu laben, die einst sein Platoon waren. Aber dieses Wesen hier ist ihm am nächsten, und er ist ihm mehr als nur aufgefallen.
Es hopst von dem Draht herunter.
Alle Verschwommenheit weicht schlagartig aus Baltimores Geist. Er zittert und atmet stoßweise aus. Er schafft es, sein rechtes Bein anzuwinkeln, aber er besitzt nicht die Stärke, sich fortzubewegen. Sein Gesicht errötet ob der Hitze seines Entsetzens, und er starrt an seinem Körper hinab und sieht zu, wie dieses Ding mit gefalteten Flügeln und ruckartigen, scharrenden Bewegungen über den durchnässten, aufgewühlten Boden auf ihn zukriecht.
Wenn er schreit, lenkt er die Aufmerksamkeit der anderen Wesen auf sich.
Wenn diese Kreatur seine Kehle aufreißt, wäre das bedeutungslos.
Aber wenn er es schafft, sie umzubringen …
Seine Finger zucken, als besäßen sie einen eigenen Verstand und verlangten nach einem Gewehr. Er könnte es auf seine Brust legen, um so zu zielen. Fast kann er spüren, wie er den Abzug drückt und der Rückstoß mit der ersten Salve einsetzt. Aber er hat kein Gewehr.
Das Wesen zieht sich mit diesem grotesken Humpeln über den Boden und breitet seine Flügel aus. Der Regeln prasselt auf sie hernieder und ist dabei fast schon obszön laut. Baltimore begegnet dem Blick der Kreatur und atmet nun kürzer und in rascherer Folge. Seine rechte Hand zittert so sehr, dass die Fingerspitzen auf die Erde trommeln.
Das Ding kriecht auf ihn zu, ist nur noch Zentimeter von seiner linken Seite entfernt, von seiner Hüfte, und plötzlich ist er sich sicher, dass sie sich so langsam bewegt, um sich länger an seiner Furcht ergötzen zu können. Die Kreatur hebt eine krallenbewehrte Klaue und greift nach ihm. Sie berührt ihn.
Baltimore kann hören, wie den Toten im Schützengraben und überall um ihn herum das Fleisch von den Knochen gerissen wird, kann hören, wie der Regen auf den Boden prasselt, und die Flügel der Wesen, und doch kann er nur in diese Giftaugen starren, die ein unheiliges Feuer erleuchtet.
Es kriecht nun auf ihn, und seine Flügel liebkosen den Zinnsoldaten fast. Die Klauen ruhen auf ihm, und der klamme Leib ist über ihn ausgebreitet, so intim, wie sich nur Liebende begegnen. Dann offenbart es seine Zahnreihe und er sieht das Blut, welches das Maul der Kreatur besudelt, und die Fleischstückchen, die auf diesen Nadeln gefangen sind. Es kommt langsam näher, und sein Körper drückt gegen Baltimores Rippen.
Der Mann begegnet dem Blick der Kreatur und versteht nun, während er in die Augen des Wesens sieht, dass es sich hierbei um kein Tier handelt, sondern um ein Geschöpf von absoluter Bosheit und verschlagenem Bewusstsein.
Baltimore schreit.
Wie von Sinnen und mit weit aufgerissenen Augen wirft er seinen Kopf herum und sucht nach einer Waffe. Am Rande des Schützengrabens liegt ein Gewehr, das einem toten Soldaten aus der Hand gefallen ist. Kalte Regentropfen glitzern auf dem Bajonett.
Mit dem letzten bisschen Stärke – vielleicht auch dem letzten bisschen Leben, das noch in ihm weilt – zwingt er sich, nach der Klinge zu greifen. Die Krallen der Kreatur graben sich in sein Fleisch, schneiden durch seine Uniform, und sie schmiegt sich an ihn, selbst als er das Bajonett in die Finger bekommt. Sein verwundetes Bein kommt in Bewegung, und frisches Blut sprudelt aus ihm hervor, doch Schmerz hat er längst aus seinem Empfindungsspektrum gestrichen.
Die Kreatur faucht.
Er streckt seine linke Hand vor, greift nach ihrer Kehle und hätte ihr das Bajonett in die Brust gerammt, wäre sein Angreifer nicht in genau dem Augenblick vorgestürmt. Das monströse Gebiss rast auf ihn zu, die glühenden Augen sind auf seine Kehle gerichtet. Baltimore reißt die Klinge in die Höhe und zerschlitzt das grässliche Maul bis hinauf zur Augenbraue.
Die Kreatur fällt von ihm herunter und windet sich flügelschlagend am Boden.
Sie schreit, so wie kein Tier schreien könnte.
Dann erhebt sie sich, zitternd vor Wut, und Blut strömt aus der Schnittwunde in ihrem Gesicht.
Ihre Augen sind nicht länger purpurrote Leuchtfeuer, sondern matt und seelenlos – so grau und flach wie Steine. Und doch kann Baltimore den lodernden Hass in diesem Wesen spüren, und er versengt ihn.
Dem Teufel ist der Appetit vergangen. Nur der Zorn bleibt, und das Funkeln seiner Intelligenz, die nun erwacht ist.
Die Kreatur wischt mit ihren Klauen über ihr verwundetes Gesicht und schnippt Tropfen ihres eigenen Blutes über das Schlachtfeld. Ein steifes Grinsen zieht seine zerschnittenen Lippen von einer Reihe flacher, spitzer Zähne zurück, und nun nähert sich das Wesen wieder Baltimore. Es ergreift und beugt sein verwundetes Bein, hebt es an und Baltimore ringt nach Luft, denn er ist sich sicher, dass diese Kiefer gleich in sein Fleisch fahren werden.
Stattdessen atmet sie mit einem ganz leisen Knurren in die offene Wunde über seinem Knie. Ihr Atem erscheint als Nebel, in demselben Purpurrot, das ihre Augen gefärbt hat, so sehr stinkend, wie es selbst die Toten nicht vermögen, und mit einer feuchten, fauligen Hitze.
Baltimore hält das Bajonett fest umklammert, aber er spürt, wie die letzte Stärke ihn verlässt. Finsternis brandet nun am Rande seines Sichtfeldes auf. Wenn er jetzt das Bewusstsein verliert, ist er mit Gewissheit des Todes.
Die Kreatur wirft ihre Flügel zurück und heult die Gewitterwolken an, als gelte ihr Flehen einem Urgott aus altvorderen Tagen.
Der Boden unter Baltimore gerät in Bewegung. Er spürt das Erbeben, während er den Leichenfresser taxiert. Die Kreatur dreht sich um und faucht ihn an, Blut sickert aus der Wunde in ihrem Gesicht und tränkt die durstige Erde, gemeinsam mit dem Regen.
Die anderen Geschöpfe kriechen über das verwüstete Schlachtfeld und versammeln sich um Baltimore. Eines erhebt sich in die Lüfte und kreist um die anderen.
Er kann nicht schreien. Die Furcht martert ihn, aber er bringt nicht mal mehr die Stärke auf, ihretwegen zu zittern. Seine Augenlider sind schwer und sein Kopf fällt zur Seite, als er versucht, das schwarze Vergessen zurückzudrängen, das seine Gedanken erstickt.
Zu viel Schmerz. Zu hoher Blutverlust. Der Tod ist seinetwegen gekommen, und er wird seine befreiende Umarmung begrüßen.
Die Kreatur grinst, als sie sich über ihn beugt und ihr Blut auf Baltimores Brust und Gesicht tröpfeln lässt. Dann breitet sie ihre Flügel wie ein Leichentuch aus und schnellt in den Himmel empor, fliegt in die Nacht, so schwarz wie ein Schatten. Ihre Schwingen schlagen mit gelangweilter Eleganz, und sie steigt höher und höher.
Stumm folgt ihr auch der Rest ihrer Art in die Lüfte, ihr, der Ersten, auf den Fersen bleibend – ihre weiten Lederschwingen schlagen und dünne Schwänze hängen hinten an ihren Leibern. Sie schlagen den Weg nach Westen ein und verschwinden in den schwarzgrauen Wolken.
Augenblicke später erscheint die Sonne am östlichen Horizont und wirft ein helles, goldenes Licht auf die höllische Kriegslandschaft. Sie verleiht den Wolken morgendliche Silhouetten, die wie Heiligenscheine anmuten, und zeichnet die Leichen nach, wie sie gefangen sind im Stacheldraht und den Boden übersäen.
Er sieht nichts mehr außer Schwärze, die den Morgen verdeckt, und schließlich erliegt er ihrer Umarmung. Als er in die Bewusstlosigkeit hinübergleitet, fühlt sich Captain Baltimore so, als würde er fliegen.
Reglos und frei von jeder Empfindung liegt er, der wieder zum Zinnsoldaten geworden ist, auf dem Haufen, zu dem sich seine Brüder auftürmen, und fühlt, wie ihn die willkommene Finsternis endlich verschlingt.
DEMETRIUS AISCHROS war dem Kanal fast vierzig Meilen lang gefolgt, den ganzen Weg vom Ozean hierher, und hatte jeden seiner Schritte verflucht. An jenem Hafen, wo er sein Schiff zurückgelassen hatte – denn ein so ausladendes Handelsgefährt wie seines hatte zu viel Tiefgang, als dass es den Kanal hätte befahren können – hatte die Luft süß geschmeckt. Und selbst in dem Küstenstädtchen hatten die Blumen wild und in großer Farbenpracht gewuchert. Auf den nur eine kurze Wegstrecke entfernten, im Inland gelegenen Bauernhöfen hatte das Korn hoch und gesund gestanden, und mit dem Segen der Erntegeister tanzte das Lüftchen flüsternd über die Felder.
Jetzt aber, da er dem breiten Pfad entlang des Kanals folgte, setzte er seine Stiefel auf wildes Gestrüpp, Unkraut und zerbrochenes Glas. Vor einer Meile hatte er seinen Schritt über den ersten toten Vogel gelenkt, und der Anblick der Kadaver wurde mit jedem zurückgelegten Meter vertrauter. Am anderen Kanalufer zeichnete sich ein bedrohlich anmutendes Feldlager voller in Lumpen gehüllter, verdreckter Männer ab, deren weit aufgerissene Augen in seine Richtung blitzten. Aus Schutt und Trümmern, die vorbeifahrende Schiffe über Bord geworfen hatten, hatten sie ihre Zuflucht errichtet. Tatsächlich bestand der Großteil ihrer Baracke aus der verrottenden Hülle eines Fischkutters.
Auf gleicher Höhe mit ihnen erkannte Aischros, was ihren Blick bestimmte: Hunger. Er starrte zurück und ließ sie das unbarmherzige Lodern in seinen Augen sehen, damit kein Missverständnis aufkam, wer hier der Jäger war und wer die Beute. Seinen schweren Wollmantel beiseitezuschieben, damit ihnen sein Dolch auffiel, war gar nicht nötig. Der Handelskapitän hatte sich seinen Seesack über die Schulter geworfen und die dunkle Mütze tief in die Augen gezogen, um diese vor der Sonne zu schützen. Sein bloßer Anblick sollte ihnen schon verraten, dass er bewaffnet und kampfbereit war. Die Spannweite seiner Schultern und die Narben auf seinem Gesicht waren ebenso unmissverständlich.
Zudem, kam es ihm in den Sinn, wäre gewiss niemand närrisch genug, die Stadt unbewaffnet zu betreten.
Aischros ließ seinen Blick wieder zu dem braunen Strom des Kanals wandern. Ein Gestank, weit übler als jedes Abwasser, erhob sich von dort. Tod und Verfall, Kot und Rost, der üble Geruch trug all die verderbten Noten mit sich, und doch klang noch etwas anderes an – ein natürliches, giftiges Aroma, nicht unähnlich dem Gas, das die Sümpfe in Crossley ausatmeten, jener Ort, den er nie wiederzusehen hoffte.
Obschon der Himmel von klarem Blau war und die Frühlingsbrise kühl und erfrischend, brannte die Sonne unerbittlich und garte den Seemann, wie auch das fast stehende Wasser, sodass der Wind nicht genügte, um den grässlichen Gestank fortzutragen.
Wenn er erstmal in der Stadt angelangt war, würde es nur noch schlimmer werden.
Sie ragte vor ihm auf wie ein Monolith, Blöcke aus grauem und schwarzem Stein, in denen nur die kleinsten Fenster sichtbar waren, hoch oben in den Mauern. Die Gebäude drängten sich aneinander, Rücken an Rücken, verschwörerisch von ihm abgewandt, so als heckten sie etwas gegen ihn aus. Der Eindruck beunruhigte Aischros. Selbst auf diese Entfernung wirkte die Stadt wie eine gewaltige Festung, mit Schatten zwischen den Gebäuden, die so eng standen, dass schon ihr Anblick genügte, damit ihm ein Anflug von Klaustrophobie wie ein Spinnchen das Rückgrat entlanglief.
Vor ihm beschrieb der Kanal eine sanfte Linkskurve und verschwand unter einem Torbogen, der gleichzeitig den Unterbau des Gebäudes darüber darstellte. Vor langer Zeit war er einmal eine Brücke gewesen, doch nunmehr gänzlich eingeschlossen, war es, als habe ihn sich die Stadt einverleibt. Beim Näherkommen bemerkte Aischros, wie ein kleines Fenster über dem Torbogen geöffnet wurde und kleine Hände einen Kübel hinaushielten, um seinen Inhalt ins Wasser zu schütten. Aus dieser Entfernung hatte er nicht ausmachen können, ob es sich dabei um Essensreste oder Exkremente handelte, und die Unwissenheit war ihm in diesem Fall ganz recht.
Schweiß lief ihm über den Rücken. Jetzt, da die Sonne so brutal vom Himmel sengte, hätte er seinen Mantel ablegen sollen, doch er behielt ihn an. Die unangenehm feuchte Dunkelheit des gebogenen Tunnels vor ihm ließ nicht gerade auf Wärme schließen.
Während er dem ausgetretenen Pfad am Rande des Kanals folgte, trotteten zwei fette Ratten aus der Finsternis hervor. Aischros runzelte missbilligend die Stirn. Er fragte sich, wieso die Nager aus den Eingeweiden der Stadt aufgetaucht waren. Sie stürzten zielstrebig nach rechts in ein von Gras gesäumtes Gestrüpp, und während sein Blick ihnen folgte, fielen ihm erstmals seltsam geformte Gegenstände auf, die aus dieser armseligen Zuflucht herausragten.
Er lenkte seine Schritte in ihre Richtung, und mit jeder Fußlänge wurden die Umrisse deutlicher. Aischros wünschte sich, dem sei nicht so. Was sich aus dem Busch vorstreckte, waren menschliche Gebeine – ein Fuß trug noch einen dunklen Schuh, der andere war nackt und kreidebleich. Steif. Tot.
Der Leichnam zuckte, als die Ratten anfingen an ihm zu nagen, von ihrer Fürsorge sprichwörtlich bewegt.
Ein lauter Ruf drang aus dem Tunnel. »Verdammt, Nick, nicht so schnell! Lass mich doch wenigstens rankommen!«
Ein Junge tauchte aus den Schatten unter dem Bogen auf. Er war in abgetragene Kleidung gehüllt, die zerfetzt war und dreckig, und sein Haar stand ungezähmt in schwarzen Büscheln von seinem Kopf ab. Dort, wo der Pfad in den dunklen Tunnel überging, wurde er zu einem steinernen Vorsprung, und der Junge hielt einen Schritt dahinter auf dem groben, ertragsarmen Boden, der die Stadt umgab, an und sah sich um.
»Rasch jetzt, du faule Sau«, rief er in den Tunnel zurück. »Die Ratten kriegen all die guten Happen, wenn du dich nicht beeilst.«
Ein zweiter Junge kam aus dem Tunnel, doppelt so schmutzig und halb so groß. Er konnte nicht älter sein als sieben oder acht, und sein dickes blondes Haar war mit Dreck verklumpt. Obwohl der Größere nun den Ratten nachsetzte und, ohne zu zögern, auf den Leichnam zusteuerte, sah sich der kleine blonde Junge argwöhnisch um. Sein drohender Blick fiel sofort auf Aischros, doch der Schiffer machte keine Anstalten, stehen zu bleiben.
»Nick«, murmelte der Kleine, und seine Stimme wurde vom Wind verstärkt über den Kai getragen.
Aber der ältere Plünderer antwortete nicht. Mit seinen Schuhen scheuchte er die Ratten von dem Toten weg und trat kräftig nach einer, ehe er neben der Leiche niederkauerte. Er sah einmal zur Stadtmauer, die hoch über ihm aufragte, und Aischros begriff, dass man den Toten aus einem der engen Fenster geworfen hatte. Ob ihn der Aufprall getötet hatte oder ob er schon vorher tot gewesen war, war nicht von Bedeutung – jedenfalls nicht mehr, da nun diese eben erst flügge gewordenen Geier eingeflogen waren, um den Toten um jedwede Habe zu erleichtern, die ihnen wertvoll erschien.
»Nick!«, schnappte der jüngere Knabe.
Diesmal sah der Ältere konzentriert auf. In der Sekunde, da er Aischros erspäht hatte, grinste er und trat von der Leiche weg, mit einer Tabakdose in seiner Hand.
Er machte ein leises Geräusch – vielleicht ein Wort, wohl eher ein Knurren, ganz bestimmt eine Warnung. Er ließ die Dose in seine Tasche gleiten, und als seine Hand wieder herauskam, blitzte ein Messer auf, das er umklammert hielt. Der andere Junge fing an zu zischeln, aber keiner der Plünderer rührte sich. Was den Kapitän anbelangte, er marschierte unverdrossen weiter, ausdruckslos, während er ihre dunklen Augenhöhlen studierte. Abgesehen von dem Dreck, der Streifen auf ihre Gesichter malte, waren sie leichenblass. Das kränkliche Weiß ihrer Haut erinnerte ihn an ein paar sonderbare Fische, die seine Netze aus der Adria geholt hatten – Geschöpfe, von ihrer Neugier aus sonnenlosen Tiefen emporgetrieben.
Er war dem Duo nun so nah, dass er sehen konnte, dass ihre Augen von einem leblosen und lichtlosen Schwarz waren und ihre Gesichtszüge ausgemergelt und von einem urwüchsigen Hohn verzerrt. Ihr Erscheinungsbild ähnelte auf unheimliche Weise den Ratten, denen sie aus den Schatten heraus gefolgt waren.
Unter der Krempe seines dunklen Hutes kniff Aischros die Augen zusammen und funkelte sie an, ohne mit der Wimper zu zucken. Gewalt und Narben, von denen die Knaben manche gesehen hätten, wäre ihr Blick über seine Hände gewandert, hatten sein Leben bestimmt. Und Furcht vor Ratten war ihm fremd – ganz egal, ob sie auf zwei oder vier Beinen daherkamen.
Er kam unbeirrt näher, und dem Jungen mit dem Messer verging das flegelhafte Grinsen. Er wich ein paar Schritte zurück in den Schatten, dort, wo Kaimauer und Brücke verschmolzen. Der Leichnam, den er ausgeraubt hatte, war längst vergessen. Seine Augen blickten unruhig und scheu, und er hielt das Messer vor sich ausgestreckt, als Talisman und auch um sich zur Not verteidigen zu können.
Der jüngere Knabe zischte und starrte Aischros vom Tunnelrand an. Er zuckte unter jedem Schritt des näher kommenden Fremden zusammen und hechtete dann schließlich, als der Seemann auf zwanzig Fuß herangekommen war, die Kaimauer hinauf und gesellte sich zu seinem Gefährten. Aischros schenkte ihnen keine weitere Beachtung, aber behielt ihre Position im Auge, falls sie doch noch spontan ihren Mut entdeckten.
Er verlagerte das Gewicht seines Seesacks und legte den Kopf in den Nacken, um die gigantische Masse der Stadt zu betrachten, die vor ihm aufragte. Aus diesem Blickwinkel kam sie ihm fast vor wie ein einziges Gebilde aus Schatten und Stein und gedrängten Fenstern. Das grelle Sonnenlicht und der blaue Himmel verliehen den Mauern keine Farbe. Selbst das schmückende Mauerwerk, verblichen, abgetragen und von Zeit und Verderben zermürbt, erweckte lediglich den Eindruck eines riesigen Grabes.
Der Tunnel lag vor ihm, aufgerissen wie ein gähnender Schlund. Die offene See war zwar sein Zuhause, aber Aischros missfiel die Vorstellung, in diesem gewölbten Durchlass eingepfercht zu sein mit dem trüben, schmierigen Wasser. Wann immer es ihm möglich war, machte er einen Bogen um Flüsse und Seen, und der Kanal bildete da keine Ausnahme. Ihm so nah zu sein, in der Finsternis …
Er blickte erneut zur Sonne hoch, berechnete, wo sie am Himmel stand, und wusste, dass ihm keine Wahl blieb. Er hatte bereits den ausgemachten Zeitpunkt verpasst, so wie er in dem Brief vermerkt war, den er vor neunzehn Tagen erhalten hatte. Um 12 Uhr mittags, so lautete die Anweisung, doch die Sonne hatte schon den Scheitelpunkt ihres Himmelsbogens überschritten, und er die Stadt noch nicht einmal betreten. Es blieb keine Zeit mehr, um einen anderen Weg hinein zu suchen.
Ein Schauer überkam ihn, trotz der Sonne.
Aus dem Augenwinkel bemerkte er einen Schatten, der über den Kanal huschte und einen Augenblick später auch auf ihn fiel. Aischros drehte sich um und blickte auf einen Schleppkahn, der auf dem Kanal langsam zu ihm aufholte. Holzkisten stapelten sich auf ihm, aber in seiner Mitte war unter einem dicken Segeltuch irgendetwas aufgehäuft worden – vielleicht frischer Erdboden oder Dünger. Der Bootsführer stand auf dem Haufen und beförderte sein Schiff mit einer Stange vorwärts. Aischros beobachtete, wie er sie aus dem Wasser zog und wieder hinabstieß, mit der Stange dann auf die linke Seite des Kahns ging, nur um sie dort wieder einzutauchen und so im fauligen Wasser zu navigieren.