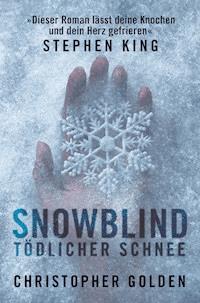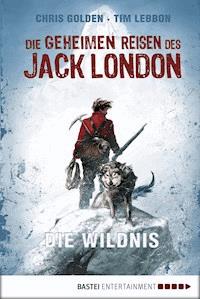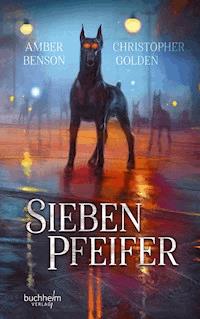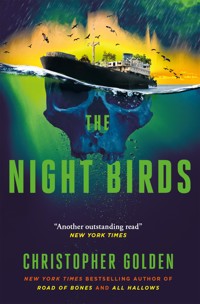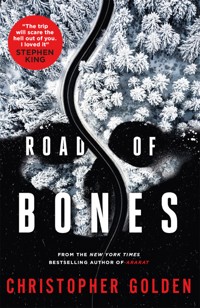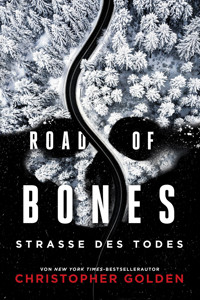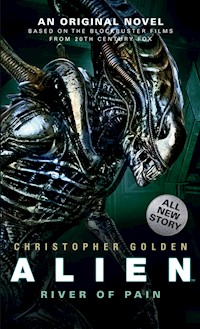Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Buchheim Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Ebenen der Realität verschieben sich, als ein uralter Mythos auf furchtbare Weise lebendig wird. David und Janine, die nach einem quälenden Verlust wieder zueinander finden, müssen sich den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen und den brüchig gewordenen Glauben an sich und ihre Welt wiederfinden. Intelligenter Horror mit emotionalem Tiefgang von Christopher Golden, einem der vielseitigsten Autoren des Genres. Unter der ISBN 9783946330035 ist das E-Book inklusive der Illustrationen von John Howe erhältlich, der für seine Visualisierungen der Werke J.R.R. Tolkiens und sein Mitwirken an Peter Jacksons Film-Trilogie Der Herr der Ringe bekannt ist. Zeitschrift Geek!: Mit diesem opulent gestalteten Werk … hat [Christopher Golden] neue Wege beschritten und einem alten Mythos neues Leben eingehaucht. Dieser düstere und spannungsgeladene Horrorroman mit seinem packenden Showdown ist eine Hommage an das Leben, an die Liebe und an den Glauben und vor allem an die Kräfte, die in einem selbst schlummern. In jeder Hinsicht grandios! Tim Lemke, VIRUS: Christopher Goldens Roman "Der Fährmann" ... ist ein klassischer und reinrassiger Horror-Roman der alten Schule, der an den frühen Stephen King erinnert. Die Charaktere sind glaubwürdig und komplex, der Eintritt des Übernatürlichen in die reale Welt schleichend und furchteinflößend, und die teils heftigen, aber nie selbstzweckhaft blutigen Schockmomente wohldosiert und gut gesetzt... Die geprägte Hard-Cover-Ausgabe inklusive Lesebändchen und schwarzem Buchschnitt ist, gerade für einen Kleinverlag, außergewöhnlich hochwertig und vorbildlich. Dazu sind die atmosphärischen Illustrationen von John Howe ("Der Herr der Ringe") echte Hingucker. Kurzum: Ein Horror-Roman, wie er sein soll!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Christopher Golden
Der Fährmann
illustriert von:John Howe
aus dem Amerikanischen von:Bernhard Kleinschmidt
Deutsche Erstausgabe
eISBN: 978-3-946330-03-5© 2017 Buchheim Verlag, Olaf Buchheim, GrimmaAlle Rechte vorbehalten
Umschlagzeichnung und Illustrationen: John HoweLayout, Design: Jenö GellinekÜbersetzung: Bernhard KleinschmidtLektorat: Claudia PietschmannSatz im VerlagDruck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
www.buchheim-verlag.de
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
The Ferryman
Copyright © by Christopher Golden, 2002Published in agreement with the author, c/o BARORINTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A.
Für meine Kinder.
Schwimmt!
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
EPILOG
DANKSAGUNG DES AUTORS
AUTOR
ILLUSTRATOR
ÜBERSETZER
Es ist kein Traum.
Am Ufer eines breiten, tosenden Flusses drehte Janine Hartschorn sich fieberhaft im Kreis. Sie hielt Ausschau nach einem Orientierungspunkt, nach irgendetwas, woran sie sich erinnern konnte, um festzustellen, wo sie sich befand und wie sie hierhergekommen war. Da sie nichts entdeckte, wäre sie froh gewesen, wenigstens einen Pfad zu finden, der von dem rauschenden Wasser wegführte, einen Pfad irgendwohin, egal an welchen Ort.
Doch Janine konnte nicht das Geringste sehen.
Ein dichter, feuchter Nebel hüllte sie ein und streckte seine Finger durch die Bäume bis über den Fluss. Wenn sie direkt nach oben blickte, sah sie ein paar Lücken in den Schwaden, versuchte jedoch, ihnen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Hätte sie das getan, dann hätte sie an die Sterne denken müssen. Der Nachthimmel kam ihr hier irgendwie näher vor, wo auch immer hier sein mochte, und die Sterne, die Löcher in die Dunkelheit bohrten, waren wie scharlachrote Tränen im Antlitz der Nacht.
Oder Wunden.
Vielleicht waren es auch Wunden.
Etwas streifte Janine im Nebel. Sie schrak zusammen, drehte sich rasch um und spähte tiefer in den feuchten Schleier, der sie einhüllte, aber es war nichts zu sehen. Ein Zweig vielleicht. Womöglich war es nur ein Zweig gewesen, den der Wind an ihren Körper gedrückt hatte.
Allerdings wehte kein Wind.
Janines Atemzüge wurden schneller und zugleich immer flacher. Ihr Blick zuckte panisch hin und her, um jeden wirbelnden Nebelfetzen zu beäugen. Irgendwo dort hinten, in der Wolke, die über dem sumpfigen, unter ihren Füßen schmatzenden Boden lag, war jemand, der sie beobachtete. Mit einem Mal war Janine wieder sieben Jahre alt. Ihr älterer Bruder und seine Freunde hatten sie in den Wald hinter ihrem Elternhaus geführt und dort alleingelassen wie die Eltern von Hänsel und Gretel. Kichernd hatten die Jungen hinter Bäumen gehockt, während Janine in den sonnenlosen Wald hineingerufen hatte.
Nun rief sie wieder. »Hallo? Wer ist da?«
Natürlich kam keine Antwort. Wer auch immer dort war, würde seine Gegenwart nicht verraten. Der Nebel besaß eine Struktur, barg Schatten innerhalb anderer Schatten, und Janine glaubte, darin Gestalten zu sehen und zu wissen, dass sie nicht nur von einem, sondern von vielen Menschen beobachtet wurde. Es waren Menschen, die sie kannte. Die wussten, dass jeder Schritt vorwärts sie in Gefahr bringen würde, und die sie trotzdem antrieben.
Janine traute diesen Schemen und Schatten nicht.
»Es tut mir leid«, sagte sie, ohne zu wissen warum. »Ich kann nicht hierbleiben. Kann nicht bei euch sein. Ich muss … muss weiter.«
Ihre Füße waren so tief im Morast versunken, dass sie nur mühsam weiterkam. Wieder fühlte sie sich wie ein Kind, das gegen seinen Willen festgehalten wurde, aber zu nichts anderem fähig war, als wimmernd zu strampeln, um sich zu befreien.
»Bitte«, flüsterte sie.
Wie schmelzendes Eis rannen Tränen an ihren Wangen herab und brannten auf der Haut. Die spottenden Phantome verstärkten ihre Einsamkeit nur. Sie fühlte sich noch mehr allein.
Als sie den rechten Fuß aus dem saugenden Schlamm riss, blieb ihre Sandale stecken. Der andere Fuß löste sich leichter, doch nun trug sie nur noch einen Schuh.
Orientiere dich, Janine, ermahnte sie sich. Und dann fort von hier.
Sie zwang sich, langsamer zu atmen, und durch die langen, stockenden Atemzüge beruhigte sich ihr Körper.
Das Wasser. Sie musste weg vom Wasser.
Das, was ihr auf den Fersen war, was sie in diesem grässlichen, klaustrophobischen Gelände verfolgte, kam übers Wasser. Rückzug war ihre einzige Chance. Sie drehte sich um und ging blindlings in den Nebel hinein.
Hinter ihr wurden die Geräusche des Flusses leiser, und als der Wald sich um sie herum verdichtete, raschelten die Blätter der Bäume im Wind. Die schwankenden Zweige schienen ihr den Weg zu versperren, wie Wachen, die sie warnend zur Umkehr aufforderten. Doch Janine kehrte nicht um.
Das Kribbeln auf ihrer Haut ließ langsam nach und die Furcht wich aus ihrem Herzen. Selbst der Nebel um sie herum wurde scheinbar dünner und die durch die Bäume wehende Luft roch frisch. Erst jetzt bemerkte Janine, was für ein übler Gestank vom Fluss aufgestiegen war.
Endlich kam ihr der Boden unter ihren Füßen, von denen der eine nackt, der andere noch von braunem Leder geschützt war, fester vor. Mit einem gewaltigen Seufzer der Erleichterung blickte sie nach unten und sah, dass sie trotz des Nebels einem Pfad gefolgt war, der durch den Wald lief. Auch wenn er über Steine und Wurzeln führte, kam er ihr bekannt vor.
Irgendwo ganz tief in ihrer Erinnerung erkannte das Kind, das sie einmal gewesen war, dass dies der Pfad nach Hause war.
Ich hatte mich verirrt, dachte sie. Jetzt will ich wieder heim.
Lächelnd und mit einem Kopfschütteln beschleunigte Janine ihre Schritte, ohne auf die Gefahren für ihren nackten Fuß zu achten, die auf dem Pfad lauern konnten. Ein verstauchter Zeh oder ein verdrehter Knöchel war ein angemessener Preis für ein wenig mehr Geschwindigkeit, für eine einzige Minute, die sie weniger in diesem dunklen, trostlosen Wald verbringen musste.
Ihr Lächeln schwand. Da stimmte etwas nicht.
Der Fluss.
Er ist nicht mehr hinter mir.
Irgendwie waren die Geräusche des Flusses woandershin gewandert und befanden sich nun zu ihrer Linken. Dort rauschte das Wasser an Felsen vorbei und plätscherte an das sumpfige Ufer. Wieder atmete Janine rascher, während ihr Herz viel zu schnell klopfte. Kopfschüttelnd wich sie einen Schritt zurück und warf einen Blick in die Richtung, aus der sie gekommen war. Sie wusste, dass es töricht gewesen wäre, umzukehren. Schließlich war dort der Fluss … und das, was sie verfolgte.
Was an ihr zog.
Genau, dachte sie. Das war das Gefühl, das sie nicht hatte benennen können. Die bange Ahnung, die sie erfüllte, bezog sich nicht nur auf die Gegenwart von irgendetwas, sondern auf eine magnetische Kraft, die an ihren Gliedern zu zerren schien, während sie sich bewegte. Sie spürte, wie etwas vom Wasser her an ihr zog – sie hineinzog. Janine hatte keine andere Wahl und mühte sich weiter. Sie war kaum vier Meter im Nebel gegangen, als ihr nackter Fuß weiche, feuchte Erde berührte, die sich zwischen ihre Zehen presste. Der feste Boden war wieder in Morast übergegangen.
Der Pfad hat eine Biegung gemacht, sonst nichts. Er wird bald wieder eine machen. Irgendwann muss er vom Fluss wegführen.
Doch als sie weiterging, versank ihr rechtes Bein bis zum Knie in blutwarmem Wasser. Sie taumelte und wäre beinahe mit dem Gesicht voraus in den Fluss gestürzt.
Der Pfad hat eine Biegung gemacht, sonst nichts.
Janine hielt den Atem an, wich einen Schritt zurück … und obwohl das eigentlich unmöglich war, stand sie nun tiefer im Wasser als noch vor einem Moment. Hektisch drehte sie sich um und suchte im Nebel nach dem Ufer, doch nun rauschte der Fluss um sie herum, und sie spürte, wie er an ihr zog. Die Strömung hatte bereits ihre Taille erreicht; sie liebkoste ihre Haut und strich an ihren Beinen entlang. Es fühlte sich an, als ob am Grund etwas an ihr zerrte und Janine schlug auf das Wasser um sich herum.
Münzen klirrten in der Tasche ihres Rocks, der sich um ihren Körper blähte. Sie runzelte die Stirn.
Auf dem Wasser erschien ein Licht. Erst winzig und dann immer größer werdend bewegte es sich über die urplötzlich ruhige Oberfläche des Flusses auf sie zu.
»Nein«, flüsterte Janine.
Ein Schritt zurück ließ sie nur tiefer sinken. Sie spürte, wie sie herumgewirbelt wurde und wieder in Richtung des Lichtes blickte. Es schien hin und her zu schwingen, während es näher kam. Metall stieß klirrend an Holz.
Es war ein Boot, schmaler als ein Ruderboot und etwa so lang wie ein Kanu. Am Bug hing eine flackernde Laterne. Kein Segel, keine Ruder; nicht einmal ein Steuer war zu erkennen. Die dunkle Gestalt, die vorne in dem winzigen Nachen stand, tat nichts, um es anzutreiben oder seinen Kurs zu lenken.
Janine biss sich so fest auf die Unterlippe, dass Blut hervorquoll. Ein kupferner Geschmack breitete sich in ihrem Mund aus. Jeder Schritt, egal in welche Richtung, würde sie nur tiefer in den Fluss tragen. Sie konnte ihm nicht entfliehen.
Der sie holen kam, war der Fährmann.
Woher sie das wusste, war ihr ein Rätsel, doch sie bezweifelte es nicht. Auf der gekräuselten Oberfläche des Flusses ragte die unausweichliche Tatsache vor ihr auf. Im lichter werdenden Nebel sah sie nun, dass er in ein scharlachrotes Gewand mit Kapuze gekleidet war und eine goldene Schärpe um die schmale Taille trug. Seine Gesichtszüge waren von der Kapuze verborgen, und dennoch stellte Janine sich darunter etwas Entsetzliches vor – eine groteske Visage mit brennenden Augen in Knochenhöhlen.
Die Laterne stieß klappernd an das hölzerne Boot, ihr Licht huschte insektengleich über den dahinströmenden Fluss. Erstarrt stand Janine da und sah den Fährmann näherkommen. Wie aus Granit gehauen, stand er am Bug seines Bootes. Dann hob er die schmalen Hände und schlug mit dürren, spitzen Fingern die Kapuze zurück, die sein Gesicht verborgen hatte.
Janine schnappte nach Luft.
Die Haut des Fährmanns war bleich marmoriert und bildete einen starken Kontrast zu seinen Augen, Kugeln aus dunkelstem Indigo, die in seinem hageren Gesicht brannten, als wäre jede der beiden Pupillen eine katastrophale Finsternis. Dunkle Haare hingen ihm bis auf die Schultern. Sein üppiger Bart war eine Hand breit unter dem Kinn mit einem Metallring zusammengefasst.
Es war nicht die groteske Gestalt, die Janine befürchtet hatte. Aber dennoch furchtbar.
Die Fähre kam direkt vor ihr zum Stillstand wie eine Insel im Fluss und trieb nicht weiter, sondern hielt inne, als würde sie knapp über dem Wasser schweben.
Als das aschfahle Wesen den Blick auf Janine richtete, ahnte sie zum ersten Mal, dass des Fährmanns Verlangen, ihn zu begleiten, womöglich nicht das Ende aller Dinge, sondern ein Anfang war. Doch noch während ihr dieser Gedanke kam, spürte sie, wie eine neue, magnetische Kraft von hinten an ihr zog. Etwas anderes hatte sie ergriffen, etwas mit ungeheurer Energie.
Angestrengt spähte sie über den Fluss, um das Ufer zu sehen, von dem der Fährmann gekommen war, doch sie erkannte nichts.
Das dünne, schreckliche Wesen streckte ihr die nach oben gewandte rechte Hand entgegen. Es blickte auf sie herab und stellte eine einzige Forderung – in einem Tonfall, der mit der Strömung dahin zu plätschern schien.
»Die Münzen.«
Janine schüttelte den Kopf. Jedes Zögern war von ihr gewichen.
»Nein«, sagte sie, zuerst kaum mehr als ein Flüstern, dann kraftvoller: »Nein!«
Der Blick des Fährmanns verengte sich, bis die feurigen Ränder rund um seine schwarzen Pupillen verschwanden und nur noch tiefe Finsternis übrigblieb.
»Die Münzen!«, wiederholte er, der Tonfall drängender.
Janine spürte, wie ihr übel wurde. Magensäure stieg in ihre Kehle. Sie schluckte und trat einen Schritt zurück … ohne tiefer im Fluss zu versinken.
Beim nächsten Schritt ahnte sie, dass sie sich dem Ufer näherte, obgleich sie es nicht wagte, dem Fährmann den Rücken zuzuwenden.
»Die Münzen?« Jetzt fragend, begleitet von einer Miene, die Belustigung ausdrücken mochte.
Janine schob die Hand in die Tasche ihres nassen Rocks und zog drei Silbermünzen hervor. Mit einer kraftvollen Bewegung schleuderte sie sie über den Fluss wie Kieselsteine. Doch die Münzen hüpften nicht, sondern durchschnitten die Wasseroberfläche und versanken.
Abrupt änderte sich die Miene des Fährmanns. Wilde Wut überzog seine steinernen Züge, und seine Augen weiteten sich, bis zwei Sonnen hinter den dunklen Pupillen aufflammten. Sie loderten, als wollten sie Janine verbrennen.
Sie rannte los. Mit ungeheurer Anstrengung sprang sie aus dem Wasser ans schlammige Ufer.
Als etwas von hinten nach ihr griff, drehte sie sich ein letztes Mal um.
Der Fährmann hatte sich nicht bewegt. Er stand noch immer am Bug des Bootes und starrte sie drohend an. Im Arm hielt er ein schreiendes, in ein weißes Tuch gehülltes Bündel, das er an seine schlanke Gestalt drückte.
Janine strauchelte. Sie fiel mit dem Gesicht in den saugenden Morast, der ihr in Nase und Mund drang. Sie konnte nicht mehr atmen. Sehen konnte sie ebenfalls nichts mehr. Der Nebel und der Schlamm, der ihre Augen bedeckte, hatten sie blind gemacht. Nach Luft ringend, versuchte sie, den Mund zu öffnen.
Ihre Brust brannte, sehnte sich nach Sauerstoff und ihre Lunge fühlte sich an, als wolle sie im nächsten Moment platzen.
Ich werde sterben, dachte Janine.
Dann einfach: Nein.
Sie keuchte. Luft. Oh Gott, Luft.
Flatternd gingen ihre Lider auf.
Ein Arzt, Krankenschwestern, Maschinen, keimfreies Weiß.
Und: Alles wird gut, Miss Hartschorn. Entspannen Sie sich jetzt einfach, alles wird gut.
Das Baby? Was ist mit dem Baby? Das war ihre Stimme, ihre raue, krächzende Stimme.
Die traurigen Gesichter der Krankenschwestern.
Der Arzt wendet den Blick ab.
Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan.
David Bairstow befand sich im Krieg.
Durch die offenen Fenster wehte ein warmer Windhauch herein, doch in der Luft hielt sich stur der Geruch von Kreide. Die Uhr zählte mit einer trotzigen Beharrlichkeit die Sekunden, aber David bemühte sich, nicht einmal einen kurzen Blick darauf zu werfen. Zum einen hätte er damit ein schlechtes Beispiel abgegeben, zum anderen – schlimmer noch! – wäre ihm das womöglich als Kapitulation ausgelegt worden.
Mit dem Rücken zur Tafel stand er vor seinen Schülern im Klassenzimmer. Die Hände hatte er lässig in die Hosentaschen geschoben, den Kopf herausfordernd schief gelegt und die Augenbrauen hochgezogen.
»Na, wer meldet sich?«, drängte er.
Die Reaktion war nicht gerade überwältigend. David seufzte und rückte seine Krawatte zurecht, die er nur trug, weil es seiner Meinung nach nicht fair gewesen wäre, sich keine umzubinden, wenn die Jungs von St. Matthew’s keine andere Wahl hatten. Er ließ den Blick über die zweiundvierzig Gesichter vor sich schweifen und hoffte, auf eines zu stoßen – wenigstens eines –, das ihm wach und interessiert vorkam.
Nichts.
David Bairstow befand sich im Krieg.
Der Feind waren allerdings nicht seine Schüler. Vielmehr stand er einer körperlosen Kreatur gegenüber, die unter verschiedenen Namen bekannt war: Motivationsknick, Frühlingsfieber, Durchhänger. Es war Ende April. Alle hatten sich bereits an irgendeinem College beworben und waren entweder angenommen worden oder standen auf der Warteliste. Was sie in den letzten beiden Monaten ihrer schulischen Laufbahn taten, hatte keinen Einfluss mehr auf das Schicksal, das sie im Herbst erwartete. Egal, mit welchem Wort man diesen Zustand umschrieb, es handelte sich um nichts anderes als Apathie.
David verzog den Mund zu einem schmalen Lächeln. »Ihr seid wirklich unglaublich«, sagte er und tat nicht mehr so, als hätte sich an der Einstellung der Klasse nichts geändert.
Immerhin handelte es sich um den Leistungskurs Englisch. Die jungen Leute im Raum waren die hellsten, die St. Matthew’s zu bieten hatte. Und doch wirkten sie überheblich, vor allem die Cleveren. Ihre Haltung drückte aus, dass sie sich um nichts mehr einen Dreck scherten als darum, sich mit dem gerade noch vorhandenen Schwung zum Schulabschluss tragen zu lassen.
Nach Davids Auffassung genügte das jedoch nicht. Seine Aufgabe bestand nicht darin, seine Schüler ins College zu bugsieren, sondern ihnen etwas beizubringen. Manche seiner Kollegen hätten sich der allgemeinen Gleichgültigkeit ebenfalls hingegeben, doch David war anders gebaut. Er liebte es zu unterrichten. Einer der Gründe, weshalb er sich so darum bemüht hatte, die Leistungskurse zu leiten, war der Wunsch, Schüler zu haben, die tatsächlich etwas lernen wollten. Aber jedes Jahr im Frühling … musste er drastische Maßnahmen ergreifen.
»Also, dann hört jetzt mal gut zu, Leute«, sagte David mit lauterer Stimme.
Ein paar Schüler erwachten aus der Benommenheit, die sich eingestellt hatte. Christy McCann war sogar so anständig, betreten dreinzublicken, weil ihre Augenlider herabgesunken waren. Dafür regte sich Brad Flecca, wie David bemerkte, überhaupt nicht. Mit geschlossenen Augen saß er zusammengesackt auf seinem Stuhl, ein wenig Speichel im Mundwinkel.
Am liebsten hätte David ihn aus dem Fenster geworfen. Allerdings erinnerte er sich durchaus an sein eigenes letztes Schuljahr an St. Matthew’s. Mit erschreckender Klarheit konnte er sich ins Gedächtnis rufen, wie er selbst in jenen letzten Wochen durch die Flure gegangen war. Wie der König der Welt hatte er sich gefühlt und alles, was ihn davon abhalten wollte, hatte ihn gelangweilt.
Deshalb würde er auch keinen Schüler umbringen. Zumindest nicht heute.
»Zum letzten Mal«, verkündete er. »Kann mir jemand … und ich meine irgendjemand … etwas über die Dichotomie zwischen Sprache und Struktur in der Darstellung der Rollen von Protagonist und Antagonist in Moby Dick sagen?«
Inzwischen hörten alle zu, mit Ausnahme von Brad Flecca natürlich. Eine Antwort kam jedoch trotzdem nicht.
»Hat irgendjemand Moby Dick überhaupt gelesen?«
So rasch, dass er richtig erschrak, schossen alle bis auf etwa ein halbes Dutzend Hände in die Höhe. David schüttelte den Kopf und lachte, was wiederum mehrere seiner Schüler überraschte.
»Was ist so lustig, Mr. Bairstow?«, fragte Christy.
»Ach, ihr könnt sprechen!«, erwiderte David.
Er musterte das Mädchen, wobei er zu ignorieren versuchte, wie süß sie in ihrer Schuluniform aussah. Ältere Schülerinnen zu unterrichten, vor allem die aufgeweckteren, war ein ständiger Kampf. Aber er war dreiunddreißig und kannte den Unterschied zwischen Bewunderung und Begierde bestens.
»Hebt doch noch mal die Hände«, sagte er.
Die Hände schossen in die Höhe. Wieder schüttelte er den Kopf.
»Ich möchte euch allen herzlich danken«, sagte David zu seiner Klasse. »Schließlich habt ihr das Jahresende fest im Blick. Es baut mich richtig auf, zu sehen, dass ihr so viel Respekt vor mir habt, mich höflich anzulügen.«
Ein trockenes Kichern in der Runde, wenngleich ihm nur sehr wenige Schüler in die Augen sahen. Christy hingegen blickte beleidigt drein, weil er ihr so etwas unterstellt hatte, und Gordon Libertini, der bei der Abschlussfeier wahrscheinlich die Rede halten würde, ebenfalls.
»Reden wir mal Klartext«, fuhr David fort. »Melville war ein ziemlich großer Schriftsteller. Moby Dick jedoch ist schwerfällig und quälend langweilig. Meint ihr, mein Gehirn ist so anders strukturiert als eures, dass mir das nicht klar wäre? Also los, wer hat das Buch wirklich gelesen?«
Christy. Gordon. Ein halbes Dutzend weitere.
»Alle Achtung!«, lobte er die wenigen Getreuen. Dann blickte er sich im Klassenzimmer um. »Was die Übrigen angeht … nichts, was ich sage, wird euch dazu bringen, das Buch zu lesen. Deshalb werde ich meine Frage selbst beantworten. Ich werde euch erzählen, was mich an Moby Dick hinsichtlich Handlung und Struktur am meisten fasziniert.«
David sah Gordon an. »Wer ist der Protagonist des Romans?«
Christys Hand schoss nach oben, doch er hatte die Frage eindeutig an Gordon gerichtet, dessen Tonfall erkennen ließ, dass es sich um eine beleidigend simple Aufgabe handelte.
»Ahab.«
David nickte bedächtig. »Und wer ist der Held?«
Ganz hinten in der Klasse hob Ashley Garbarino die Hand. »Ist das nicht dasselbe?«, fragte sie, ohne aufgerufen worden zu sein.
»Ist es das?«, fragte David.
»Ich hab’s kapiert!«, sagte Christy rasch.
Mit einem weichen, stolzen Lächeln nickte David ihr zu. »Ja, Christy? Nur zu!«
»So, wie die Handlung strukturiert ist, ist Ahab der Protagonist, und der Wal ist der Antagonist. Aber wenn man das einbezieht, was Sie vorher gesagt haben … über die Sprache? Melville beschreibt Ahab immer als einen finsteren Teufel, der übers Deck stürmt und seinen Leuten Furcht und Schrecken einjagt. Und der Wal ist so etwas wie eine reine, weiße, unschuldige Kreatur. Fast wie ein Engel oder so. Das heißt, obwohl die beiden diese Funktion haben …«
»In ihrer herkömmlichen Rolle«, soufflierte David.
»Genau«, erwiderte Christy rasch. »Obwohl sie in ihrer herkömmlichen Rolle diese Funktion haben, verrät uns die Sprache, dass das gar nicht stimmt. In Wirklichkeit ist Ahab der Schurke und Moby Dick der Held.«
David setzte ein breites Lächeln auf. »Bravo!«, sagte er und applaudierte kurz.
Er freute sich zwar über sich und über die Intuition, die Christy an den Tag gelegt hatte, doch er bemerkte, dass die Klasse ihm schon wieder entglitt.
Wer konnte es den jungen Leuten übelnehmen? Schließlich erwartete man von ihnen, über ein klassisches literarisches Werk zu diskutieren, dessen Dichte und archaische Sprache die Lektüre ausgesprochen mühsam machten, wenn man nicht gerade ein begeisterter Literaturwissenschaftler war.
David klatschte laut in die Hände. »Na schön. Ist allen klar, was Christy gerade über Moby Dick gesagt hat? Das kommt nämlich in der Abschlussprüfung dran.«
Allgemeines Stöhnen.
David ging um seinen Tisch herum und griff nach dem Wagen, auf dem ein Fernseher und ein Videorekorder standen, die er sich im Medienraum besorgt hatte.
»Das ist jedoch nicht alles. Ihr werdet alle wenigstens einen oberflächlichen Blick auf Moby Dick werfen, um seine Essenz und Struktur zu eruieren. Und es wird noch besser. Darüber hinaus werde ich euch ein modernes Beispiel für genau den Punkt vorstellen, den Christy gerade so treffend formuliert hat. Wir werden uns in den nächsten Unterrichtsstunden einen Film anschauen, in dem die herkömmliche Struktur von Protagonist und Antagonist sowie deren Beziehung zwar existiert, in dem ihr allerdings feststellen werdet, dass der Regisseur und der Kameramann bewusst die filmischen Mittel eingesetzt haben – Musik, Kameraperspektive, Beleuchtung und so weiter –, um diese herkömmlichen Rollen zu unterminieren und uns eine ganz andere Vorstellung davon zu vermitteln, wer der Held und wer der Schurke ist.«
David wandte sich zur Klasse. Selbst Brad Flecca war jetzt wach und starrte ihn mit erstauntem Gesichtsausdruck an, der in seiner kindlichen Aufrichtigkeit beinahe absurd wirkte.
In einem einzigen Schuljahr war David im Galopp durch die griechische und römische Mythologie gestürmt, vorbei an Poe, Shakespeare, Robert Frost, James Baldwin, Raymond Chandler und John Irving, mit dem Ziel, seinen Schülern etwas über das Wesen von Geschichten zu vermitteln. Dies war jedoch das erste Mal, dass er ein anderes Erzählmedium einsetzte.
Olivia Costa hob die Hand.
»Ja, Olivia?«
»Wie heißt der Film denn?«
Grinsend kostete David die Frage aus. »Blade Runner.«
Im Lehrerzimmer kratzte Lydia Beal ihren Joghurtbecher aus und schüttelte erstaunt den Kopf. »Echt und ehrlich, David, ich weiß nicht, wie du damit jedes Jahr ungestraft durchkommst.«
Die beiden saßen an einem der runden Tische in dem Raum, in dem der Lehrkörper sich während der Freistunden und in der Mittagspause versammelte. Wie das alte, aus Granit errichtete Gebäude bot er den Anblick einer nichtssagenden grauen Schachtel. An einer Wand befanden sich drei Fenster, an der Wand gegenüber waren katholische Plakate mit schulischen Themen angebracht. Dort standen außerdem ein Fernseher und ein Videorekorder, eine Mikrowelle, die Kaffeemaschine und der Kühlschrank.
Als der Timer der Mikrowelle ein lautes Ping von sich gab, erhob sich David, um sein Popcorn herauszunehmen. Der Geruch erfüllte den ganzen Raum, reich an Butter und Salz. Für David war allein dieser Duft schon das halbe Vergnügen.
»Womit komme ich durch?«, fragte er, während er sich wieder setzte.
»Mit diesem Film«, antwortete Lydia und kniff die Augen zusammen. »Jedes Jahr.«
»Also hör mal, Blade Runner ist ein Klassiker!« David schob sich eine Portion Mikrowellenpopcorn in den Mund, um sein Grinsen zu tarnen.
Lydia verdrehte die Augen.
Neben den beiden befand sich nur noch Ralph Weiss im Raum, ein groß gewachsener, gut fünfzigjähriger Mann mit schütterem Haar, dicken Brillengläsern und einem gewaltigen Bauch. Er war ein übereifriger Kerl mit einschüchternder Statur, der seine Schüler schulmeisterte und meinte, das wäre dasselbe, wie sie zu unterrichten.
Weiss hatte eine Zeitschrift über amerikanische Militärgeschichte studiert, wahrscheinlich um daraus etwas im Unterricht vorzulesen, horchte bei Lydias Bemerkungen jedoch auf. Er konnte das Gespräch unmöglich überhören, und ebenso unmöglich war es für ihn, seine Meinung für sich zu behalten. Nun schob er sich die Lesebrille auf den Schädel, auf dem seine ergrauten, einst rostroten Haare schon erheblich zurückgewichen waren, und kratzte sich zerstreut den Bart.
»Miss Beal hat recht, Mr. Bairstow«, sagte Weiss in gestelztem Ton. »Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Kinder bis zu dem Zeitpunkt zu unterrichten, an dem das Schuljahr endet.«
»Ich unterrichte sie durchaus, Ralph«, erwiderte David barsch.
Weiss zuckte zusammen. Er gab sich gern altmodisch, wenn auch nur, wenn es ihm in den Kram passte. Zu seinen Marotten gehörte es, sich gegenüber jedem – und erst recht jedem, der jünger war als er – einer förmlichen Anrede zu befleißigen. Besonderen Wert darauf legte er im Umgang mit David, was nach dessen Vermutung wohl damit zu tun hatte, dass Weiss vor vielen Jahren sein eigener Geschichtslehrer gewesen war.
Obwohl David keineswegs die Absicht hatte, irgendwelchen Ärger zu machen, ertrug er die herablassende Art des älteren Kollegen nur schwer. Allerdings war er gezwungen, sich auf Nadelstiche zu beschränken. Zum Beispiel, indem er ihn Ralph nannte, was seine Wirkung nie verfehlte.
»In Wahrheit, Mr. Bairstow, vergeuden Sie wertvolle Unterrichtszeit, indem Sie diese Kinder zwingen, sich einen Science-Fiction-Film anzusehen, der absolut nichts mit dem Englischunterricht zu tun hat. Darüber hinaus enthält dieser Film Gewalt und Nacktszenen, ganz zu schweigen von vulgären Ausdrücken. Ich habe keine Ahnung, weshalb Schwester Mary das zulässt, aber ich vermute, wenn man beim Erzbistum davon wüsste, wäre man empört.«
Lydia Beal sog scharf die Luft ein, wodurch ein leises Pfeifen entstand. »Mr. Weiss, vielleicht sollten Sie das lieber mit …«
»Lass nur, Lydia«, unterbrach David sie. »Ist schon in Ordnung.«
Als er ihr einen Blick zuwarf, sah er Besorgnis in ihren Augen. Offenbar hatte sie Angst, er würde zu heftig reagieren. Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem feinen Lächeln. Wer ihn gut kannte, hätte gewusst, dass darin keinerlei Humor lag, nicht einmal eine Spur von Heiterkeit. Zwar war David Bairstow stolz darauf, ein guter Kerl zu sein, doch dazu gehörte auch, bei einer Auseinandersetzung nicht klein beizugeben. Niemals!
»Wissen Sie, Ralph«, sagte er, »womöglich haben Sie recht. Vielleicht sollte ich wirklich jeden Morgen vor meine Schüler treten und ihnen den Gefallen tun, Moby Dick vorzulesen, als wären sie noch in der Grundschule.«
Auf der Stirn von Weiss, den Davids Worte sichtlich empörten, zeigten sich Zornesfalten, begleitet von mehreren Schweißtropfen. David fiel auf, dass einer dieser Tropfen auf beinahe surreale Weise durch die dicke Lesebrille vergrößert wurde, die auf dem kolossalen Schädel saß.
»Mr. Bairstow«, sagte Weiss im selben vorwurfsvollen Ton, den er schon verwendet hatte, als David sein Schüler gewesen war.
»Mis-ter Weiss«, konterte David freundlich. »Ich sage Ihnen nicht, wie Sie Geschichte unterrichten sollen – obwohl das weiß Gott jemand tun sollte –, und deshalb würde ich es begrüßen, wenn Sie mir nicht erklären würden, wie ich Englisch unterrichten soll.«
Vor Zorn regelrecht fauchend, erhob sich Weiss. Sein Stuhl scharrte über den Boden und wäre um ein Haar umgestürzt; nur durch ein Wunder blieb er stehen. Weiss grabschte seine Bücher und die Zeitschrift, in der er gelesen hatte, vom Tisch, klappte seine Brille zusammen und schob sie in die Tasche. Dann überwand er den Abstand zwischen sich und David mit zwei langen Schritten.
Die Tür des Lehrerzimmers ging auf, und Annette Muscari kam mit einigen weiteren Kollegen herein. Weil alle vergnügt miteinander plauderten, nahmen sie die im Raum herrschende Spannung zuerst wohl gar nicht wahr.
David warf ihnen nur einen kurzen Blick zu, wusste jedoch schon in diesem Moment, dass sie gemerkt hatten, was los war, denn sie verstummten sogleich.
»Sie, Mr. Bairstow!«, legte Weiss los, während er sich mit finsterem Blick vor David aufbaute, »Sie sind ein Schandfleck auf dem Antlitz der katholischen Pädagogik. Eine Peinlichkeit für diese Schule und für das Erzbistum.«
David nickte langsam. »Mag sein, Ralph. Aber falls es so sein sollte, haben wir beide mehr gemein, als mir bisher bewusst war.«
Weiss öffnete den Mund, wohl um etwas Scharfes zu erwidern, doch heraus kam nur sein feuriger Atem, der stank, als hätte er fauliges Fleisch gegessen. Mit immer röter werdendem Gesicht spitzte er die Lippen, während auf seiner Stirn weitere Schweißtropfen perlten.
Dann gab er ein Stöhnen von sich, drehte sich auf dem Absatz um und verließ den Raum. Dabei schlug er die Tür hinter sich zu wie ein bockiger Teenager.
»Heilige Scheiße«, murmelte Lydia.
David kicherte. »Pass auf, was du sagst! Wir sind in einer katholischen Schule, Lydia.«
Lachend legte sie die Arme auf den Tisch und vergrub den Kopf darin. Sogleich kam Annette mit einem faszinierten Funkeln in den Augen herbei. Die anderen Kollegen, darunter Clark Weaver, ein sanftmütiger Mann, der noch länger als Weiss an der Schule war, hielten Abstand und unterhielten sich in gedämpftem Tonfall. Wahrscheinlich stellten sie Vermutungen darüber an, was geschehen war, aber keiner von ihnen war gut genug mit David befreundet, um sich einfach bei ihm zu erkundigen.
Außer Annette natürlich. David und sie hatten im selben Jahr angefangen und rasch Freundschaft geschlossen. Annette – niedlich, klapperdürr und ein klein wenig maskulin – war lesbisch, doch zwischen ihr und der Schulverwaltung bestand ein unausgesprochenes Abkommen, dieses Thema zu ignorieren, weshalb sich bisher trotz der Positionierung des Erzbistums zur Homosexualität nie ein Problem ergeben hatte. Schließlich war auch Schwester Mary nicht unbedingt immer derselben Meinung wie der Kardinal.
Gott sei Dank, dachte David.
»Was war denn da los?«, fragte Annette boshaft, während sie einen Stuhl heranzog. »Ich glaube nicht, dass ich Ralphie schon mal derart stinkig gesehen habe.«
»Du hattest ihn auch nicht als Lehrer«, rief David ihr in Erinnerung.
»Stimmt«, gab sie zu. Ihre grünen Augen funkelten und die blonde Pagenfrisur verlieh ihr ein beinahe elfenhaftes Aussehen.
David schob die Hand in die Tüte mit Mikrowellenpopcorn, das inzwischen so weit abgekühlt war, dass die sogenannte Butter sich darauf in eine dünne Fettschicht verwandelt hatte. Nicht, dass ihn das davon abgehalten hätte, das Zeug zu futtern.
Annette packte ihn am Handgelenk. »Sag schon, Dave!«, befahl sie. Ihr Blick zuckte zu Lydia hinüber. »Was ist passiert?«
»Blade Runner«, erwiderte Lydia in ruhigem Ton, als würden die beiden Wörter zur Erklärung völlig ausreichen.
Merkwürdigerweise taten sie das auch.
Annette brach in Gelächter aus. Die an dem Tisch vor der Fensterwand sitzenden Kollegen drehten sich zu ihnen um. Als David ihre Blicke auffing, hob er leicht die Achseln. Mr. Weaver, der gerade eine Banane aus einer braunen Papiertüte zog, kicherte vor sich hin, was ihn aus Davids Sicht noch sympathischer machte.
»Ich kann kaum glauben, dass Schwester Mary dich jedes Jahr ungestraft damit durchkommen lässt«, erwiderte Annette.
»Das habe ich vorhin auch gesagt«, bemerkte Lydia.
David hob eine Augenbraue. Ob Annette sich der Ironie ihrer Frage wohl bewusst war? Schließlich ließ Schwester Mary sie mit ganz anderen Dingen durchkommen.
»Hört mal, es ist ein völlig legitimes Lehrmittel«, sagte er. »Natürlich enthält der Film einige fragwürdige Szenen, aber ich zeige ihn ja erst im letzten Schuljahr. Vor siebzehn- bis achtzehnjährigen amerikanischen Jugendlichen, die bestimmt schon Schlimmeres gesehen haben. Im ersten Jahr hat Schwester Mary mich anschließend in ihr Büro zitiert und mir die Leviten gelesen. Daraufhin habe ich erklärt, worauf es mir ankommt und was ich über das Erzählen von Geschichten vermitteln will. Sie hat darüber nachgedacht und mir zugestimmt.«
Lydia schlug die Hand vor den Mund. Ihre Augen weiteten sich zu einem schockierten Ausdruck, der bei den meisten Menschen nervig gewirkt hätte, an der vernünftigen, fünfundvierzigjährigen geschiedenen Kollegin jedoch geradezu liebenswert aussah.
»Willst du damit etwa sagen, dass Schwester Mary den Film gesehen hat?«, fragte sie.
Clark Weaver räusperte sich lautstark, womit er die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich zog. »Sie ist sogar ein ziemlicher Filmfan«, erklärte er. »Ich möchte wetten, sie hat eine größere DVD-Sammlung als die meisten Schüler.«
»Man lernt doch täglich etwas dazu«, sagte Annette ein wenig ehrfürchtig.
David seufzte. »Außer im Unterricht von Ralph Weiss.«
»Übrigens war das ein guter Konter«, sagte Annette, während sie aufstand und zum Regal ging, um ihren Imbiss zu holen.
»Ach, du hättest hören sollen, wie die beiden sich beharkt haben, bevor du reingekommen bist«, sagte Lydia und erhob sich ebenfalls. »Übrigens, wir sind gleich mit der Pausenaufsicht dran, David.«
Er warf einen Blick auf seine Uhr. Es blieben noch ein paar Minuten Zeit, aber Lydia wollte wahrscheinlich erst die Toilette aufsuchen. Zwar gab es auch gleich neben dem Lehrerzimmer ein WC, doch das benutzte Lydia nie.
David lächelte ihr freundlich zu. »Wir treffen uns unten, ja?«
Nachdem Lydia gegangen war, setzte Annette sich auf den frei gewordenen Stuhl. Selbst wenn sie aß, tat sie das ausgesprochen sittsam, was zusammen mit ihren schmalen Lippen und ihren leicht spitzen Ohren zu ihrem ätherischen Aussehen beitrug. Deshalb hatte David ihr einen Spitznamen gegeben, den nur er und eine weitere Person verwendeten.
»Na, was läuft bei dir so, Elfchen?«, fragte er.
Als Annette diesen Ausdruck hörte, lächelte sie warm. »Nichts Besonderes. Wir treffen uns doch heute Abend, oder?«
Die beiden hatten geplant, zum Abendessen ins North End zu gehen, um Annettes Geburtstag vorzufeiern, der eigentlich erst in einer Woche war.
»Auf jeden Fall«, sagte David.
Annette biss von ihrem Sandwich mit Erdnussbutter ab und wandte sich David so abrupt zu, dass der Kaffeebecher in ihrer Hand leicht überschwappte.
»David«, murmelte sie mit vollem Mund, »ich war nicht sicher, ob ich es dir erzählen soll oder nicht, falls du es überhaupt wissen willst, meine ich.«
Er verstand, was sie sagte, wenn auch nur vage.
Annette kaute rasch und schluckte. »Gestern Abend hat Janine mich angerufen«, sagte sie mit ernster Miene.
Janine. Die einzige weitere Person auf der Welt, die für Annette den Spitznamen Elfchen verwendete. Was nun kam, war keine gute Nachricht. Das erkannte David daran, dass das Funkeln aus Annettes Augen verschwunden war.
David hatte schon viele gute Freunde gehabt, aber irgendwie waren sie ihm alle wieder entglitten. Selbst jene, die ihm am wichtigsten waren, gehörten nicht mehr richtig zu seinem Leben. Die meisten seiner Freunde aus der Highschool und dem College waren mittlerweile verheiratet und hatten Kinder, weshalb ihr Alltag zu kompliziert war, um mit einem alten Kumpel einfach mal ins Kino oder in die Kneipe zu gehen. Nur Vince Piselli meldete sich regelmäßig, aber der war geschieden und wollte offenbar die Besäufnisse aus der Collegezeit wiederaufleben lassen.
Aus diesem Grund war Annette beinahe automatisch zu Davids bester Freundin geworden. Er bewunderte sie mehr als praktisch jede andere Frau, die er je kennengelernt hatte, was vielleicht daran lag, dass sie lesbisch war und sich daher zwischen den beiden keine sexuelle Spannung entwickeln konnte. Es gab nur zwei Frauen, die ihm ebenso vertraut waren. Die eine war seine in Kalifornien lebende Schwester, mit der er mindestens zweimal pro Woche telefonierte. Die andere war Janine Hartschorn, die er um ein Haar geheiratet hatte.
Als David und Annette an die Schule gekommen waren, war Janine dort bereits seit einem Jahr als Mathematiklehrerin tätig gewesen. Die drei waren rasch nahezu unzertrennlich geworden, und wenig später hatten David und Janine sich ineinander verliebt. Vierzehn Monate lang hatte alles fantastisch ausgesehen, und sie hatten sich eine gemeinsame Zukunft ausgemalt. Dann holte die Vergangenheit sie in Form von Janines Ex ein, der ihr nicht lange nach dem Studium zum ersten Mal das Herz gebrochen hatte.
David erinnerte sich noch an die Worte, mit denen sie ihm klargemacht hatte, dass das Beste in seinem Leben nun verloren war. Ich liebe dich, hatte sie mit bebender Stimme gesagt. Aber wenn ich ihm jetzt keine Chance gebe, um zu sehen, was ich daraus machen kann, werde ich es mein Leben lang bereuen und letztendlich dich dafür verantwortlich machen. Dann sind wir beide unglücklich.
Mit Bedauern erinnerte er sich an seine Reaktion, an die bitteren Worte, die er noch immer am liebsten zurückgenommen hätte. Na klar, hatte er gesagt. Wenigstens ist so bloß einer von uns unglücklich.
»Was ist passiert?«, fragte er nun zögernd.
»Sie hat das Baby verloren.«
Ein stechender Schmerz schoss in sein Herz, und er schloss für einen Moment die Augen. Dieses Arschloch hatte Janine geschwängert und sie dann verlassen. Das hatte Annette ihm bereits berichtet und sogar vorgeschlagen, er solle Janine anrufen. Aber er hatte gedacht, wenn sie mit ihm sprechen wollte, würde sie sich schon von allein melden.
Aber jetzt …
»Wie?«
Annette biss sich auf die Lippe. Sie beugte sich zu ihm und warf einen raschen Blick auf die Kollegen am anderen Tisch. Als sie weitersprach, war ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern, vertraulich und schmerzerfüllt. »Bist du sicher, dass du das alles hören willst?«
David nickte.
»Also, bei ungefähr einer von zehn Erstgeburten tritt bei der Mutter eine sogenannte Präeklampsie auf. Dabei steigt der Blutdruck extrem an, was ziemlich gefährlich ist. Bei Janine war es jedoch schlimmer, denn es gab ein weiteres Problem – irgendein Syndrom, mir fällt nicht mal mehr der Name ein. Jedenfalls läuft dabei die Leber auf Hochtouren und greift praktisch die roten Blutkörperchen und die Blutplättchen an, die zerstört werden.«
Annette schüttelte den Kopf, bevor sie fortfuhr. »Wenn nun die Anzahl der Blutplättchen stark sinkt, erschwert das die Blutgerinnung. Deshalb kann man keinen Kaiserschnitt mehr machen, um das Kind zu holen, sonst würde die Mutter verbluten. Auch eine natürliche Geburt ist gefährlich, und wenn der Zustand der Mutter kritisch wird, dann gilt das auch für das Kind. Janine ist beinahe gestorben, hat es jedoch überstanden. Das Baby nicht. Jetzt hat man sie auf irgendwelche Antidepressiva und so Zeug gesetzt. Sie hat sich ziemlich schlimm angehört.«
»Mein Gott«, flüsterte David und senkte den Blick. Er konnte nicht begreifen, wie es mit Janine so weit gekommen war. Erst recht konnte er sich nicht vorstellen, wie verzweifelt sie gewesen sein musste.
Tieftraurig sah er sie an. »Annette? Meinst du … meinst du, es ist ihr unangenehm, wenn ich sie besuche?«
Annette streckte die Hand aus und verschränkte ihre Finger mit seinen. »Nein. Ich finde, das ist eine tolle Idee.«
Er dachte eine Weile darüber nach, widerstrebend, doch zugleich von Liebe und Mitgefühl für Janine erfüllt. Was vergangen war, war vergangen, aber das bedeutete nicht, dass sie ihm nicht mehr wichtig war, vor allem jetzt, da sie dringend Unterstützung brauchte.
»Ich fahre morgen Nachmittag hin«, beschloss er, dann sah er rasch auf seine Armbanduhr. »Jetzt muss ich aber los. Wir treffen uns nach dem Unterricht.«
Annette nickte ihm zu. »Alles klar.«
Als David seinen Stuhl zurückschob und aufstand, flog die Tür des Lehrerzimmers auf und Lydia Beal kam herein, einen schockierten Ausdruck im Gesicht.
»Ralph Weiss hatte in der Cafeteria gerade einen Herzinfarkt«, sagte sie mit gepresster Stimme. »Er ist tot.«
Es war kein Schlaf. Zumindest nicht im eigentlichen Sinne, nicht so, dass er jene Erfrischung von Leib und Seele gebracht hätte, der man sich sonst jede Nacht überließ. Was ihm fehlte, war der süße Trost der Träume, der Rückzug in ein wohliges Vergessen.
Seit Janine im Krankenhaus das Bewusstsein wiedererlangt und die Verzweiflung auf den Gesichtern der Menschen gesehen hatte, die sich um sie kümmerten, hatte sie keinen einzigen Augenblick jenes kostbaren Schlafs erlebt, den sie einmal für selbstverständlich gehalten hatte. Natürlich schlief sie, doch es war ein seichter Schlaf, ständig gestört von den Stimmen, Geräuschen und Turbulenzen der Welt, die sie umgab. Dennoch zog sie sich immer wieder in diesen unbefriedigenden Dämmerzustand zurück, wenn auch nur, um den Tränen zu entkommen.
Denn wenn sie wach war, weinte sie.
Als Depression wurde dies vom medizinischen Personal bezeichnet. Ein Arzt hatte ihr ein Medikament namens Zoloft verschrieben, das ihre Stimmung aufhellen sollte. Janine nahm die Pillen, die man ihr gab, und der Wirkstoff schien ihre Gedanken tatsächlich zu dämpfen und eine leichte Betäubung hervorzurufen. Von der Bürde, die sie trug, konnte sie das jedoch nicht befreien. Wenn es sich wirklich um eine Depression gehandelt hätte, so wäre die Wirkung des Medikaments vermutlich eine andere gewesen. Doch es war keine Depression, absolut nicht.
Es war Trauer.
Bis in die Knochen dringende, das Herz zerreißende, die Seele verdorrende Trauer.
Weshalb wissen die das eigentlich nicht?, hatte sie anfangs gedacht.
Doch langsam begriff sie die Wahrheit. Natürlich wusste man es, doch man wich dieser Tatsache wortreich aus, weil es dafür keine Pillen gab.
Selbst die Therapeutin oder Psychiaterin, die man in Janines Zimmer geschickt hatte, um mit ihr zu sprechen, schien diese Wahrheit zu kennen. Sie sprach zwar über den Prozess des Trauerns, doch es waren nüchterne Bemerkungen über seelische Qualen, unterfüttert von Statistiken und Analogien wie aus einer wissenschaftlichen Tabelle. Ihre Genesungsprognosen waren kaum sinnvoller als ein Knochenorakel oder der Blick in eine Kristallkugel.
Gerede. Alles Gerede.
Gegen Trauer gab es kein Heilmittel.
Janines Körper hatte sich rascher erholt. Obwohl sie ein schweres physisches Trauma durchlitten hatte, freuten sich die Krankenschwestern offenbar darüber, dass sie keine Anzeichen für Spätfolgen entdeckten. Kein Schlaganfall, kein Hirnschaden, keine Notwendigkeit für eine Leber- oder Nierentransplantation.
Die Ärzte sah Janine nicht besonders oft. Man sagte ihr, sie solle sich ausruhen. Alles, was sie jetzt angeblich brauchte, war Ruhe.
Darüber lachte sie, doch niemand schien den Scherz zu verstehen. Ebenso wenig begriff man, dass die Zeiten, in denen Janine die Augen geschlossen hatte, eher einer Trance ähnelten als echtem Schlaf. Von Ruhe konnte überhaupt keine Rede sein.
Allerdings hörte sie wenigstens auf, zu weinen. Am Ende des dritten Tages nach dem Augenblick, in dem ihr eigener Körper ihr Kind getötet hatte, waren ihr die Tränen ausgegangen. Sie hatte sogar begonnen, einige enge Freundinnen anzurufen. Die hatte sie während ihrer katastrophalen zweiten Beziehung mit Spencer schwer vernachlässigt, doch es waren gute Freundinnen. Keine von ihnen erinnerte Janine daran, dass sie sie gewarnt hatten; keine einzige äußerte, was für eine dämliche Ziege sie gewesen sei, noch einmal auf diesen Typen hereinzufallen.
Nicht, dass sie den Hinweis nötig gehabt hätte.
In ihrem Kopf ertönte eine gnadenlose Stimme, die sie ständig zu begleiten schien und unerbittlich Kritik an ihr übte, weil sie sich von Spencer Hahn erneut in den Abgrund hatte ziehen lassen.
Und natürlich war da noch ihre Mutter.
Mutter.
Als Janine am Freitagmorgen, vier Tage, nachdem sie beinahe gestorben war, in dem gewohnten Dämmerzustand dalag, nicht tief genug darin versunken, um zu träumen, aber auch nicht ganz wach, nahm ihr Unterbewusstsein eine Veränderung wahr. Das leise Aneinanderreiben von Beinen, die in Feinstrumpfhosen steckten, das Klappern der Jalousie, die hochgezogen wurde, eine leichte Gewichtsverlagerung, als sich jemand aufs Bettende setzte.
Träge öffnete sie die Augenlider und blinzelte, einmal, zweimal, ein drittes Mal. Am Bettende saß Ruth Vale, ihre Mutter, in einem dunklen Kostüm, das zu ihrem Beruf als Managerin einer Werbeagentur passte, aber auch als Trauerkleidung hätte dienen können.
»Mom?«, krächzte Janine und reckte matt die Glieder. »Ich habe dich nicht so früh erwartet.«
Früher waren Ruths Haare so rabenschwarz gewesen wie die von Janine, doch seit sie ergraut waren, ließ sie sie kastanienbraun färben und trug sie praktisch immer zu einem strengen Zopf geflochten. Eine passende Frisur zu dem einen Machtanspruch verkörpernden Kostüm.
»Von früh kann keine Rede sein, Nina«, stellte ihre Mutter richtig. Ihre haselnussbraunen Augen waren von missbilligenden Fältchen umgeben. »Es ist gleich zehn. Du hast doch gesagt, dass diese lesbische Freundin von dir dich heute Nachmittag abholt, oder?«
Ach ja, dachte Janine. Heute ist der Tag, an dem man mich nach Hause schickt. Bei dieser Vorstellung fühlte sie sich noch leerer, und sie war dankbar, dass Annette ihr Gesellschaft leisten würde.
»Sie heißt Annette, Mom«, erwiderte Janine so erschöpft, als würde ihre Mutter das Leben aus ihr heraussaugen. »Ja, sie holt mich ab.«
»Gut«, sagte ihre Mutter mit einem winzigen Nicken, wie um etwas auf einer inneren Checkliste abzuhaken. Sie erhob sich und bürstete sich irgendwelche imaginären Flusen vom Rock, bevor sie ihn glattstrich. »Ich habe heute noch ein Meeting, deshalb muss ich leider gleich zum Flughafen.«
Janine runzelte die Stirn. Ihre Mutter war in den vergangenen Tagen genauso unfähig wie die Ärzte und Krankenschwestern gewesen, ihr Trost zu spenden, wenn nicht gar noch unfähiger. Dennoch war ihre Anwesenheit etwas gewesen, woran Janine sich festhalten konnte.
»Zur Beerdigung bin ich natürlich wieder da«, fügte Ruth Vale eilig hinzu, als wolle sie sich für etwas entschuldigen, ohne recht zu wissen, wofür. »Larry kommt ebenfalls.«
Larry.
Der leibliche Vater von Janine, von Beruf Apotheker, war früh gestorben. Zwei Jahre später, als Janine gerade zehn gewesen war, hatte ihre Mutter Larry Vale geheiratet, der wie sie in Manhattan bei einer Werbeagentur arbeitete.
»Ich hab dir doch gesagt, dass ich noch nicht weiß, ob ich eine … eine Abschiedszeremonie veranstalten werde.«
Ruth seufzte. »Wie du meinst.«
Sie beugte sich übers Bett, um Janine einen Kuss auf die Stirn zu geben – wie damals, wenn sie als Kind krank gewesen war. Am liebsten hätte Janine ihre Mutter angeschrien, weil sie so feige war. Weil sie zu viel Angst vor dem Schmerz ihrer Tochter hatte, um einen Teil der Bürde zu tragen.
Dann war sie fort.
Dort, wo Janine das Baby gehalten hätte, spürte sie ein Gewicht auf ihrem Körper wie ein Phantomglied. Ihre Brüste schmerzten von der Milch, mit der sie nie jemanden stillen würde. In dem grauen Licht, das durch die nüchternen Fenster drang, saß sie in ihrem sterilen Krankenbett und hob die Arme, als würde sie das Kind wiegen. David Hartschorn hätte es geheißen.
Sie hatte ihm den Namen David geben wollen.
Am Freitagnachmittag, zwei Tage nach dem unerwarteten Tod von Ralph Weiss, saß David am Tisch seines Klassenzimmers und starrte aus dem Fenster. Die Glocke hatte erst vor wenigen Minuten geläutet, doch seine Schüler hatten sich rasch aus dem Staub gemacht, und nun war er ganz allein.
Im Augenblick war es gut, allein zu sein.
Das Vergnügen, das er sonst empfand, wenn er die Schüler auf ihre letzten Tage an St. Matthew’s zumarschieren sah, hatte sich verflüchtigt – wie ein Rausch nach zu viel Bier. Seine Augen brannten, und der Kopf tat ihm weh, als hätte er einen echten Kater.
Vor dem Fenster des Klassenzimmers stand eine hohe Eiche, auf deren Ästen sich ein Schwarm Sperlinge tummelte. David sah zu, wie die Vögel nervös umherhüpften und sich Warnungen zupfiffen, als wären sie auf Wache. Beinahe lächerlich ängstlich. Sein ganzes Leben lang hatte David sich ebenso gefühlt und sich immer Sorgen gemacht, wohin die nächste Schicksalswendung ihn wohl führen würde. Immer war er von Ängsten beherrscht worden, statt sich auf seinen Instinkt zu verlassen.
Diese Erkenntnis schmerzte ihn, doch er konnte ihr nicht entkommen. Ein Windstoß fuhr ins Klassenzimmer, so stark, dass die Papiere auf dem Tisch raschelten. David legte sein Federmäppchen darauf, um sie zu beschweren. Auf dem Mäppchen stand in goldenen Lettern sein Name: DAVID J. BAIRSTOW. In seiner Kindheit war er manchmal Dave oder gar Davey genannt worden, aber meist doch David. Außer von seinem Großvater, der ihn immer nur Junge gerufen hatte. Seine Mutter hatte ihm gesagt, der Alte sei enttäuscht gewesen, weil man David nicht nach ihm benannt hatte, doch dies hatte er schon damals nicht geglaubt.
Als Kind war David von den Hätscheleien seiner Eltern fast erstickt worden. Sein Vater James war Buchhalter gewesen, seine Mutter Rita Hausfrau. Ein gutes Leben, keine Frage. Auch ohne die Augen zu schließen, konnte er sich problemlos Momentaufnahmen aus seiner Kindheit ins Gedächtnis rufen. Die Bäume im Vorgarten, auf die er und seine kleine Schwester Amy so gern geklettert waren. Von einem war er als Siebenjähriger heruntergefallen und hätte sich dabei fast die Unterlippe durchgebissen. Der winzige Hügel hinten im Garten, auf dem sie im Winter Schlitten gefahren waren, um anschließend im Haus die eisigen Füße vor die Heizungsschlitze zu halten. Die Wochenenden oder ganzen Wochen, die sie mit ihren Eltern auf Cape Cod oder an der Küste von Maine verbracht hatten, weil ihr Vater meinte: »Zum Teufel mit den Kosten, man muss sich auch mal Zeit für die Familie nehmen, nicht nur für die Kunden.«
Bei zu vielen dieser Ausflüge an die Küste von Maine hatten sie allerdings bei seinem Großvater Edgar Bairstow in dessen Alterssitz in Kennebunk übernachtet. Der Alte war siebenundvierzig Jahre lang bei der Feuerwehr gewesen, bevor er in Rente ging, um sich seinem Whiskey und Zigarren zu widmen. Außerdem las er die Todesanzeigen, um festzustellen, wer nicht mehr zur wöchentlichen Pokerrunde erscheinen würde.
Einige der Familienangehörigen hatte sein Großvater mit der ganzen Liebe überschüttet, die ihm zur Verfügung stand. Amy hatte vor seiner ruppigen Art und dem groben Umgang immer Angst gehabt, doch er liebte sie abgöttisch.
David hingegen hatte er gehasst.
Der wiederum hatte lange gebraucht, um keine Entschuldigungen für seinen Großvater mehr zu suchen. Der Alte war schon drei Jahre tot, und David hatte bereits das College abgeschlossen, als er endlich die Wahrheit akzeptierte. Sein Großvater hatte von Anfang an eine Abneigung gegen ihn empfunden und daraus nie ein Geheimnis gemacht.
Das zu wissen, machte David traurig, aber auch zornig. Welches Recht, dachte er immer wieder, hatte ein alter Mann eigentlich, das Leben und das Selbstbild eines kleinen Jungen mit so viel Verwirrung und Zweifel zu belasten? Wenn er auf sein Leben zurückblickte und sich an die Momente erinnerte, in denen er Grund gehabt hatte, sich zu freuen, waren allzu viele durch den Hohn und Spott seines Großvaters verdüstert worden.
Womöglich hatte Edgar Bairstow gemeint, das Interesse seines Enkels an Büchern und die Unsportlichkeit seien eine Art Verrat. Jedenfalls erinnerte sich David deutlich daran, wie seine Mutter ihm augenrollend erzählt hatte, sein Großvater sei überglücklich, dass David für den Tanzball in der achten Klasse eine Partnerin gefunden habe. Er habe ihn nämlich für schwul gehalten.
In den Sommerferien zwischen Davids erstem und zweitem Studienjahr war sein Großvater dann gestorben, und er war insgeheim froh darüber gewesen. Da ihn dieses Gefühl überraschte und verstörte, behielt er es für sich. Aber sobald sein Großvater tot war, hasste David ihn mehr als je zuvor.
Er hasste ihn, weil er ihn noch immer liebte. Trotz allem hatte er sich sein Leben lang nach der Zuneigung dieses Menschen gesehnt, wodurch eine Art Liebe in ihm entstanden war. Schließlich war Edgar Bairstow sein Großvater gewesen, und selbst nach dessen Tod wünschte David sich seinen Segen.
Das verstärkte seinen Hass noch mehr. Es war ein endloser Kreislauf aus Schuldgefühlen und Trauer, eine zu deutlich sichtbare Falle, um darin stecken zu bleiben, weshalb er seine Gedanken nur selten in diese Richtung schweifen ließ.
Heute, nach dem plötzlichen Tod von Ralph Weiss, konnte er nicht anders.
Irgendwo im Flur knallte eine Tür zu, und als er aufblickte, sah er Melvin Halliwell, einen der Hausmeister, mit einem uralten Blecheimer und einem Besen vorübertrotten. Aus seiner Träumerei geweckt, griff David in die oberste Schublade seines Schreibtisches und zog das Buch heraus, das er sich morgens in der Schulbibliothek besorgt hatte.
Sein Highschool-Jahrbuch.
Am Vorabend hatte er zu Hause danach gesucht, es jedoch nicht gefunden. Als es ihm am Morgen immer noch im Kopf herumspukte, war er in die Bibliothek gegangen. Dort verwahrte man die Jahrbücher sämtlicher Abschlussklassen seit der Gründung der Schule.
Vor dem Unterricht hatte David keine Zeit gehabt, sich das Buch anzuschauen, weshalb er es in die Schublade gelegt hatte. Nun betrachtete er den mit blauem Leinen bezogenen Einband und das eingeprägte Bild eines Mustangs – das Schulmaskottchen.
Überrascht darüber, dass seine Finger zögerten, zwang er sich, das Buch zu öffnen. Die ersten Seiten blätterte er rasch durch, um zum Verzeichnis der Schüler zu gelangen, zu den aufgereihten Fotografien aus den Achtzigern, die ihm nun albern vorkamen. An einige Gesichter erinnerte er sich kaum, freute sich jedoch darüber, wie viele Namen seiner Klassenkameraden ihm sofort einfielen, noch bevor er die Bildunterschrift gelesen hatte. Lisa Farrelly. Colin McCann. Chris Franzini. Nicole Rice.
Als er das Foto von Maggie Russell sah, überkam ihn Traurigkeit.
Offenbar konnte er heute nur an den Tod denken. Sonst vergingen oft Monate, ohne dass er auch nur ein einziges Mal an Maggie Russell dachte, aber wenn er es tat, vermisste er sie noch immer. Sie war nun schon seit über fünfzehn Jahren tot, aber immer, wenn sie ihm in den Sinn kam, erinnerte er sich an ihr Lächeln.
David Bairstow wollte nicht sterben.
Was für ein törichter Gedanke, dachte er, denn schließlich wollte niemand sterben. Doch während er sich an jene ihm einst vertrauten Menschen erinnerte, die nicht mehr am Leben waren, fragte er sich unwillkürlich, wo sie sich jetzt wohl befanden.
Wohin auch er eines Tages gehen würde.
Am liebsten wäre er allerdings nirgendwohin gegangen.
Widerstrebend kam er zu dem Schluss, dass er dem eigentlichen Grund, weshalb er sich das Jahrbuch besorgt hatte, nicht mehr ausweichen konnte. Dennoch schob er es noch einen Moment auf, um einen Blick aus dem Fenster zu werfen.
Die Sperlinge waren verschwunden.
David blätterte zu den Seiten zurück, auf denen die Lehrer abgebildet waren, und fand rasch das Porträt von Ralph Weiss. Der hatte damals bestimmt fünfzehn Kilo weniger gewogen, und obwohl er immer wegen irgendetwas gekränkt gewesen war, zeigte er auf dem Bild ein warmes, ungekünsteltes Lächeln.
Nun, da Ralph Weiss tot war, musste David schmerzlich erkennen, wie viel einfacher es gewesen wäre und wie viel weniger Energie es ihn gekostet hätte, wenn er den Mann so akzeptiert hätte, wie er war. Als Lehrer hatte Ralph Weiss keine besondere Kompetenz gehabt, doch abgesehen davon war er ein ebenso wohlwollender wie einsamer Mensch gewesen.
»Mussten Sie uns denn wirklich einfach so verlassen, Mr. Weiss?«, sagte er zu dem fünfzehn Jahre alten Foto und blätterte kopfschüttelnd das Jahrbuch noch einmal durch. Einige Minuten später – er wusste nicht recht, wie viel Zeit genau vergangen war – klopfte es an der Tür.
David blickte auf und sah Annette auf der Schwelle stehen.
»Ach, Elfchen!«
»Ich wüsste gern, was du dir gerade für Gedanken machst«, sagte sie mit besorgt gefurchter Stirn.
»Ziemlich düstere, fürchte ich«, gestand er.
»Ich wollte bloß tschüss sagen. Wir sehen uns doch morgen bei der Beerdigung, oder?«
»Klar«, sagte er. »Sollen wir anschließend was essen gehen?«
Annette strich sich eine widerspenstige Haarsträhne hinter ihr spitzes Ohr. »Eventuell. Janine ist ab heute Nachmittag sozusagen auf sich selbst gestellt, und ich möchte so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen.«
David hob die Augenbrauen. »Ist sie etwa schon zu Hause?«
»Noch nicht, aber bald. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus, um sie abzuholen.«
Er schwieg. Direkt vor dem Fenster landete ein Sperling und spähte herein, als hätten Davids forschende Blicke den Schwarm zuvor in die Flucht gejagt, und nun wäre ein einzelner Vogel ausgesandt worden, um festzustellen, ob die Gefahr vorüber war.
»Tust du mir einen Gefallen?«, fragte David.
»Aber gern.«
»Frag sie, ob sie morgen noch ein wenig mehr Gesellschaft haben möchte. Vielleicht fahre ich dann mit dir hin. Wenn sie das will.«
Annette lächelte, wenn auch ein wenig traurig. »Ich frage sie, aber sie hat bestimmt nichts dagegen. Im Gegenteil.«
David nickte. Er freute sich über seinen Einfall und darüber, wie Annette reagiert hatte. Sie kam, setzte sich auf seinen Schoß und sah ihm direkt in die Augen.
»Du bist ein total lieber Kerl, Bairstow. Lass dir bloß von niemandem was anderes weismachen.«
»Danke, Elfchen.« Er gab ihr einen kurzen, freundschaftlichen Kuss, und überlegte belustigt, was Melvin, der Hausmeister, wohl denken würde, wenn er Mr. Bairstow mit der süßen blonden Mathematiklehrerin auf dem Schoß erblickte.
Das gute Gefühl, das diese Vorstellung in ihm auslöste, verflüchtigte sich jedoch rasch, weil er wieder an Janine denken musste und an das Kind, das sie verloren hatte. Wie er war auch sie mit dem Tod konfrontiert worden, wenngleich ihr Verlust wesentlich tragischer und persönlicher war als der Tod eines Kollegen. Auf einmal war der Tod allgegenwärtig.
Ja, man konnte ihm nicht entkommen, das wusste David, doch er hoffte, sich bald wieder der Illusion hingeben zu können, dass dem nicht so war. Schließlich verbrachten die meisten Menschen ihr Leben mit dieser Illusion. Die einzige Möglichkeit, gegen die bedrohliche Unabwendbarkeit des Todes anzugehen, war zu leben.
Einfach nur zu leben.
Als Annette in die Einfahrt des Hauses einbog, in dem Janine wohnte, war es schon nach 16.00 Uhr. Die Schatten waren bereits lang geworden, doch durch die Bäume, die ihre Äste über die Winthrop Street ausbreiteten, strömte noch Sonnenlicht. Janine hatte die Seitenscheibe ein Stück weit heruntergelassen und genoss die Gerüche, die der leichte Wind ihr zutrug. In der Woche, die sie im Krankenhaus zugebracht hatte, schien sich die ganze Welt verändert zu haben. Nun war der Frühling angebrochen.
So gut sie konnte, versuchte sie, sich an der Hoffnung festzuklammern, die immer mit dieser Jahreszeit verbunden war.
Annette fuhr auf den kleinen Parkplatz neben dem weitläufigen, alten Gebäude. »Wieder zu Hause«, sagte sie und lächelte ihre Freundin liebevoll an, bevor sie den Motor abstellte.
»Ja«, sagte Janine, »zu Hause.«
Zu ihrer großen Überraschung schwangen diese zwei Worte in ihr nach. Eigentlich war das gar nicht ihr Zuhause. Ihr Vater stammte zwar aus Medford, wo sie jetzt wohnte, aber Janine war in Elmsford nördlich von New York aufgewachsen. Dort war sie zu Hause. Nicht im Haus ihres Stiefvaters in Scarsdale und in ihrer derzeitigen Wohnung eigentlich auch nicht. Dennoch hatte die Gegend um Boston sie seit ihrer Studienzeit freundlich aufgenommen. Hier empfand sie eine Geborgenheit, die ihr New York nach dem Tod ihres Vaters nie hatte bieten können.
In der Hand den Becher Cappuccino, den ihre fürsorgliche Freundin bei Starbucks besorgt hatte, stieg Janine aus Annettes altem Saab und blickte zu dem weiß angestrichenen Haus hinauf. Früher waren darin die Praxen von zwei Brüdern untergebracht gewesen, einem Zahnarzt und einem Allgemeinmediziner. Dass die beiden sich ein Gebäude geteilt hatten, fand Janine großartig. So etwas tat man in New England eben. Das Haus befand sich immer noch im Besitz der Familie, war jedoch in Wohnungen umgewandelt worden, eine auf jeder der drei Etagen. Dahinter stand eine riesige, aus den frühen Tagen des Anwesens stammende Scheune, in der Dr. Feehan, ihr Vermieter, als Kind gespielt hatte. Darüber konnte er zahllose Geschichten erzählen.
Während Janine das Haus betrachtete, wurde ihr am ganzen Körper warm, und sie spürte, wie ihr ein Lächeln aufs Gesicht trat. Ihr Herz war schwer von dem, was sie verloren hatte, und dieser Schmerz würde sie nicht so bald verlassen, falls überhaupt irgendwann. Dennoch hatte sie zum ersten Mal den Eindruck, dass in ihrem Herzen Raum für andere Gefühle, andere Emotionen war. Zu Hause zu sein, war wenigstens etwas, woran sie sich festhalten konnte. In so vieler anderer Hinsicht hatte sie das Gefühl dahinzutreiben. Je weiter ihre Schwangerschaft fortgeschritten war, umso mehr hatte sie sich als Mutter gefühlt. Nun, ohne das Baby, war sie nicht sicher, was sie eigentlich war und wie ihr Leben nun verlaufen sollte.
»Kommst du, Janine?«
Annette war an der Haustür stehen geblieben und hatte sich nach ihr umgedreht. Janine nickte und folgte ihr in den Flur. Gemeinsam stiegen sie die Treppe hoch.
Janines Wohnung befand sich im ersten Stock. Sie bestand aus zwei Schlafzimmern, einer kleinen, aber brauchbaren Küche und einem wunderschönen Wohnzimmer mit hohen Fenstern, durch die den ganzen Tag aus drei verschiedenen Richtungen die Sonne fiel. Als Janine den Schlüssel umdrehte und die Tür aufstieß, spürte sie, wie Erleichterung sie durchströmte.
Das Sonnenlicht spiegelte sich auf dem Parkett, und durch die offenen Fenster drang die Frühlingsluft herein.
Sie ließ die kleine Reisetasche, die sie aus dem Krankenhaus mitgebracht hatte, auf den Boden plumpsen und wanderte einfach eine Weile umher. Alle ihre Pflanzen waren gegossen worden, was ihr irgendwie wichtig vorkam. In der Ecke des Wohnzimmers, von der aus man die Bäume und die Scheune im Garten sah, wartete ihr Notenständer auf sie. Daneben lag aufgeklappt auf einem antiken Bänkchen ihr Geigenkasten mit dem Instrument darin.
Zu Hause, dachte sie wieder.
Annette hatte wohl gespürt, dass Janine einige Momente für sich allein haben wollte, denn sie war in die Küche gegangen. Dort klapperte sie herum, was Janine nach kurzer Zeit gleichermaßen neugierig und besorgt werden ließ.
»He, was machst du denn da drin?«, rief sie.
»Das Abendessen. Jedenfalls gleich.«
Janine hob erschrocken die Augenbrauen. Spöttisch grinsend, hastete sie in die Küche, wo Annette kniend in einem Schrank voller Töpfe und Pfannen kramte.
»Lass das sofort bleiben!«, befahl Janine. »Nicht, dass ich deine Hilfe nicht schätzen würde, aber machen wir uns nichts vor – in der Küche bist du eine Gefahr für dich und andere.«
Annette drehte sich um und setzte sich mit dem Hintern auf den Linoleumboden. Sie warf Janine einen bösen Blick zu. »Hör mal, diese blöde Vorstellung, dass Lesben nicht kochen können, ist schlicht und einfach unwahr.«
»In deinem Falle nicht«, sagte Janine unverblümt.