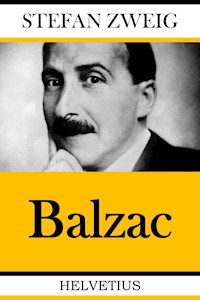
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Honoré de Balzac (1799-1850) war ein französischer Schriftsteller. In den Literaturgeschichten wird er, obwohl er eigentlich zur Generation der Romantiker zählt, mit dem 17 Jahre älteren Stendhal und dem 22 Jahre jüngeren Flaubert als Dreigestirn der großen Realisten gesehen. Sein Hauptwerk ist der 88 Titel umfassende, aber unvollendete Romanzyklus "La Comédie humaine" (dt.: Die menschliche Komödie), dessen Romane und Erzählungen ein Gesamtbild der Gesellschaft im Frankreich seiner Zeit zu zeichnen versuchen. Balzacs Erzählweise gilt in der Literaturgeschichte als prototypisch für den traditionellen Roman "à la Balzac", d. h. einen Roman mit interessanten, nicht eben Durchschnittstypen verkörpernden Protagonisten, einer interessanten und mehr oder minder zielstrebigen Handlung sowie einem eindeutigen Vorherrschen der auktorialen Erzählsituation. Mit seiner relativ ungeschminkten Darstellung der gesellschaftlichen Realität prägte Balzac Generationen nicht nur französischer Autoren und bereitete den Naturalismus vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Balzac
Titel SeiteErstes BuchZweites BuchDrittes BuchViertes BuchFünftes BuchSechstes BuchStefan Zweig
Balzac
Roman seines Lebens
Erstausgabe: Stefan Zweig: Balzac. Roman seines Lebens. Stockholm. 1946.
Neuausgabe: 2019 Helvetius Verlag, Saillon.
Erstes Buch
Jugend und erste Anfänge
Erstes KapitelTragödie einer Kindheit
Ein Mann von dem Genie Balzacs, der kraft einer überschwenglichen Phantasie einen vollkommenen zweiten Kosmos neben den irdischen zu stellen vermag, wird nur selten fähig sein, bei belanglosen Episoden seiner privaten Existenz sich immer streng an die nüchterne Wahrheit zu halten; alles wird sich bei ihm der souveränen umformenden Willkür seines Willens unterordnen. Diese selbstherrliche Transformierung vieler seiner Lebensepisoden setzt charakteristischerweise schon bei der – sonst unveränderlichen – Grundtatsache einer bürgerlichen Existenz ein: bei seinem Namen. Eines Tages, etwa in seinem dreißigsten Jahr, entdeckt Balzac der Welt, daß er nicht Honoré Balzac, sondern Honoré de Balzac heiße, und mehr noch, er behauptet, nach Fug und Recht von je zur Führung dieser Adelspartikel befugt gewesen zu sein. Während sein eigener Vater nur zum Spaß und im allerengsten Familienkreise von der Möglichkeit geflunkert hatte, der altgallischen Ritterfamilie der Balzac d’Entrague vielleicht entfernt verwandt zu sein, erhebt der phantasiemächtige Sohn diese windige Vermutung herausfordernd zur unbestreitbaren Tatsache. Er unterzeichnet seine Briefe, seine Bücher mit »de« Balzac, er läßt sogar das Wappen der d’Entragues auf seine Reisekalesche nach Wien aufmontieren. Verspottet wegen dieser eitlen Selbstadelung von den unfreundlichen Kollegen, antwortet er frank und frech den Journalen, sein Vater hätte diese adelige Herkunft längst vor seiner Geburt schon in amtlichen Dokumenten festgestellt; das Adelsprädikat in seinem Geburtsschein wäre darum nicht minder gültig als jenes Montaignes oder Montesquieus.
Leider besteht nun in unserer unfreundlichen Welt eine gehässig-nachspürende Feindschaft der dürren Dokumente gegen die blühendsten Legenden der Dichter; peinlicherweise ist jene von Balzac triumphierend zitierte Geburtsurkunde in den Archiven der Stadt Tours erhalten, aber bei seinem Namen kein Buchstabe von jenem aristokratischen »de« zu finden. Der Amtsschreiber von Tours verzeichnet unter dem Datum des 21. Mai 1799 kalt und klar:
Heute, am zweiten Prärial des siebenten Jahres der Französischen Republik, erschien vor mir, Pierre-Jacques Duvivier, unterzeichnetem Standesbeamten, der Bürger Bernard-François Balzac, Eigentümer, wohnhaft am hiesigen Orte, rue de l’Armée d’Italie, Sektion du Chardonnet Nr. 25, um die Geburt eines Sohnes anzumelden. Der besagte Balzac erklärte, daß das Kind den Namen Honoré Balzac erhält, und daß es gestern morgen um elf Uhr geboren wurde, im Hause des Anmeldenden.
Ebensowenig tun die andern Dokumente, weder die Todesanzeige des Vaters noch die Vermählungsanzeige der ersten Tochter, dieses Adelstitels Erwähnung, der sich demnach mit all seinen genealogischen Exkursen als glattes Wunschprodukt des großen Romanciers erweist.
Aber behalten die Dokumente auch buchstabenmäßig recht gegen Balzac, so hat doch sein Wille – sein schöpferischer glühender Wille – glorreich recht behalten gegen die kalten Papiere; immer siegt trotz aller nachträglichen Berichtigungen Dichtung über die Geschichte. Obwohl kein französischer König ihm oder einem seiner Ahnen je einen Adelsbrief unterzeichnet hatte, nennt die Nachwelt auf die Frage nach dem Namen des größten französischen Epikers dennoch, ihm gehorsam: Honoré de Balzac, und nicht etwa Honoré Balzac oder gar Honoré Balssa.
Denn Balssa, nicht Balzac und schon gar nicht de Balzac lautet der richtige Familienname seiner proletarischen Ahnen; sie besitzen keine Schlösser und führen keinerlei Wappenschild, das der dichterische Nachfahr an die Karosse malen kann; sie reiten nicht aus in blinkendem Harnisch und fechten keine romantischen Turniere, sondern sie treiben tagtäglich die Kühe zur Tränke und roden in hartem Schweiße die Erde des Languedoc. In einer armseligen Steinhütte des Weilers La Nougayrié bei Cannezac ist Balzacs Vater, Bernard-François, als einer der vielen dort ansässigen Balssas am 22. Juni 1746 geboren. Und die einzige Notorietät, die sich jemals einer dieser Balssas erworben hat, war eine äußerst bedenkliche; im selben Jahre 1819, da Honoré die Universität verläßt, wird der vierundfünfzigjährige Bruder seines Vaters verhaftet unter dem Verdacht, ein schwangeres Dorfmädchen ermordet zu haben, und nach einem aufsehenerregenden Prozeß im nächsten Jahre guillotiniert. Vielleicht bot gerade das Verlangen, sich weitmöglichst von diesem anrüchigen Vatersbruder zu distanzieren, Balzac den ersten Anstoß, sich zu nobilitieren und sich eine andere Herkunft zu erfinden.
Bernard-François, Balzacs Vater, wird als ältestes von elf Kindern von seinem Vater, einem ganz gewöhnlichen Landarbeiter, zum geistlichen Berufe bestimmt; der Dorfpfarrer lehrt ihn lesen und schreiben und sogar etwas Latein. Aber der kräftige, vitale und ehrgeizige Junge zeigt wenig Neigung, sich eine Tonsur scheren und das Keuschheitsgelübde abnötigen zu lassen. Eine Zeitlang treibt er sich noch im heimischen Weiler herum, teils als Schreiber bei einem Notar aushelfend, teils zugreifend im Weinberg und hinter dem Pflug; aber mit zwanzig Jahren bricht er aus, um nicht wieder zurückzukehren. Mit jener zähen, unnachgiebigen Stoßkraft der Provinzialen, die sein Sohn in seinen Romanen in den großartigsten Varianten geschildert hat, bohrt er sich in Paris ein, zuerst unsichtbar und unter der Oberfläche als eben nur einer der unzähligen jungen Leute, die in Paris Karriere machen wollen, ohne selbst zu wissen, auf welche Weise und in welchem Beruf. Daß er – wie er später als arrivierte Provinzgröße behauptet – unter Ludwig xvi. Sekretär im Conseil du Roi oder gar Avocat du Roi gewesen sei, ist längst als Gaskonade des erzählfreudigen alten Herren durch die Tatsache entlarvt, daß keiner der Almanachs du Roi weder einen Balzac noch Balssa in ähnlichem Amte erwähnt. Erst die Revolution schwemmt diesen Proletariersohn wie so viele hoch, und er fungiert – eine Stellung, von der sich der spätere Armeekommissar hütet, viel zu erzählen – als Beamter in dem Pariser revolutionären Stadtrat. Dort scheint er sich Verbindungen geschaffen zu haben, und mit dem leidenschaftlichen Instinkt für Geld, den er seinem Sohne vererben wird, sucht er sich in der Kriegszeit die Abteilung der Armee aus, wo man am besten verdient: Verpflegung und Kriegslieferung. Von der Verpflegungsbranche einer Armee führen wiederum unweigerlich goldene Fäden hinüber zu Geldleihern und Bankiers. Eines Tages schaltet nach dreißig Jahren dunkler Berufe und Geschäfte Bernard-François noch einmal um und taucht als erster Sekretär im Bankhaus Daniel Doumerc in Paris auf.
Mit fünfzig Jahren ist Vater Balzac endlich die große Transformation gelungen – wie oft hat sein Sohn sie geschildert! –, die aus einem unruhigen, ehrgeizigen Habenichts endlich den wohlanständigen Bürger, das biedere oder bieder gewordene Mitglied der guten »Gesellschaft« macht. Jetzt erst, mit etwas erworbenem Kapital und einer gesicherten Stellung, kann er den nächsten notwendigen Schritt tun, um aus einem Kleinbürger ein Großbürger (und später aus dem Großbürger – letzte, ersehnteste Stufe – ein Rentier) zu werden: er wird heiraten, und zwar ein vermögendes Mädchen heiraten und aus guter bürgerlicher Familie. Mit einundfünfzig Jahren ein vollgesunder, stattlicher Mann, dazu ein gewandter Schwadroneur und geübter Herzensbrecher, richtet er seine Blicke auf die Tochter eines seiner Vorgesetzten in der Bank. Anne Charlotte Sallambier ist zwar um zwei- unddreißig Jahre jünger und hat etwas romantische Neigungen, aber als wohlerzogene, fromme Bürgerstochter unterwirft sie sich gehorsam dem Rate der Eltern, die den zwar bedeutend älteren, aber mit gutem Geldsinn begabten Balzac für eine solide Partie erklären. Kaum verheiratet, hält es Vater Balzac schon unter seiner Würde und auch zu wenig einträglich, bloßer Angestellter zu bleiben; unter einem Napoleon scheint ihm der Krieg eine viel raschere und ergiebigere Erwerbsquelle. So läßt er seine alten Verbindungen wieder spielen und übersiedelt, gesichert durch die Mitgift seiner Frau, als Verpflegungsleiter der 22. Division nach Tours.
Zu diesem Zeitpunkt, da ihnen der erste Sohn Honoré (am 20. Mai 1799) geboren wird, sind die Balzacs bereits vermögende Leute und werden als respektable Mitbürger in die Haute Bourgeoisie von Tours aufgenommen. Die Belieferungen Bernard-François’ scheinen gute Einkünfte abzuwerfen, denn die Familie, die unablässig gleichzeitig sparte und spekulierte, beginnt jetzt stattlich aufzutreten. Unmittelbar nach der Geburt Honorés übersiedeln sie aus der engen Rue de l’Armée d’Italie in ein eigenes Haus; sie gönnen sich bis 1814, solange die goldene Zeit der Napoleonischen Kriegszüge andauert, den Kleinstadtluxus eines Wagens und reichlicher Dienerschaft; die beste Gesellschaft, ja sogar die Aristokratie verkehrt ständig im Hause des Häuslersohnes und ehemaligen Mitglieds des blutroten Stadtrats: der Senator Clément de Ris, dessen mysteriöse Entführung Balzac später in der Ténébreuse Affaire [›Dunklen Affäre‹] ausführlich schildern wird, sowie der Baron von Pommereul und Monsieur de Margonne, die späterhin dem Dichter in seinen schwersten Zeiten Unterstand und Hilfe bieten werden. Sogar zu städtischer Wirksamkeit wird Vater Balzac herangezogen, er verwaltet das Hospital, und seine Meinung wird in allen Entscheidungen geachtet; trotz seiner niederen Herkunft und unergründeten Vergangenheit ist er in dieser Zeit der raschen Karrieren und der totalen Umschichtung eine untadelige Respektsperson geworden.
Diese Beliebtheit des Père Balzac ist nach allen Richtungen verständlich. Ein heiterer, massiver, jovialer Mann, zufrieden mit sich, seinen Erfolgen und mit der ganzen Welt. Seine Sprache zeichnet sich nicht durch aristokratischen Akzent aus, er flucht lustig wie ein Kanonier und spart nicht mit gepfefferten Anekdoten – manche der Contes drolatiques [›Tolldreisten Geschichten‹] mag er seinem Sohn übermittelt haben –, aber er ist ein prachtvoller Erzähler, gern freilich die Wahrheit mit aufschneiderischen Rodomontaden vermengend, dabei gutmütig und jovial und zu geschickt, um sich in so wandelbaren Zeiten für Kaiser oder König oder Republik festzulegen. Ohne solide Schulbildung, zeigt er doch nach rechts und links Interesse und lernt und liest kreuz und quer sich eine Art Universalbildung zusammen. Er verfaßt sogar ein paar Broschüren, wie ›Mémoire sur le moyen de prévenir les vols et les assasinats‹ [›Abhandlung über die Mittel, Diebstähle und Morde zu verhüten‹] und ›Mémoire sur le scandaleux désordre causé par les filles trompées et abandonnées‹ [›Abhandlung über die skandalöse Verwirrung, verursacht durch die betrogenen und verlassenen Mädchen‹] – Werke, die man natürlich ebensowenig mit denen seines großen Sohnes vergleichen darf wie Vater Goethes italienisches Tagebuch mit Johann Wolfgangs »Italienischer Reise«. Erzgesund und voll unbekümmerter Lebenslust, ist er fest entschlossen, hundert Jahre alt zu werden. Nach seinem sechzigsten Jahr fügt er seinen ehelichen vier Kindern noch einige uneheliche bei und wird als Achtzigjähriger noch vom bösen Leumund der Kleinstadt der Schwängerung eines Mädchens bezichtigt. Nie hat ein Arzt sein Haus betreten, und dieser Wille, alle andern zu überleben, wird noch bestärkt durch den Umstand, daß er eine Lebensrente bei der sogenannten Tontine Lafarge besitzt, bei der mit dem Tod jedes Teilnehmers sich die Rente für die Übriggebliebenen erhöht. Die gleiche dämonische Kraft, die der Sohn an die tausendfältige Gestaltung von Leben setzt, setzt dieser Vater einzig an die Erhaltung seines eigenen Lebens; schon hat er die Partner überholt, schon ist seine Rente auf achttausend Francs gestiegen, da fällt der Dreiundachtzigjährige einem törichten Unfall zum Opfer. Sonst hätte Bernard-François genau wie Honoré durch Konzentration des Willens das Unmögliche wahrgemacht.
Wie vom Vater die Vitalität und die Lust am Fabulieren, so erbt Honoré de Balzac von seiner Mutter die Sensibilität. Zweiunddreißig Jahre jünger als ihr Mann und keineswegs unglücklich verheiratet, hat sie die schlimme Eigenschaft, sich ständig unglücklich zu fühlen. Während ihr Gatte heiter und unbekümmert dahinlebt, durch die Zänkereien und eingebildeten Krankheiten seiner Frau keineswegs in seiner unerschütterlichen Laune gestört, stellt Anne Charlotte Balzac den leidigen Typus der immer Gekränkten in sämtlichen spiegelnden Farben der Hysterie dar. Von allen im Hause fühlt sie sich nicht genug geliebt, genug geachtet, genug gewürdigt; unablässig beschwert sie sich, daß ihr ihre Kinder nicht genug für die großartige Aufopferung danken; bis an ihr Lebensende wird sie nicht ablassen, mit ihren »wohlgemeinten« Ratschlägen und weinerlichen Tadeleien den schon weltberühmten Sohn zu peinigen. Dabei ist sie keineswegs eine Frau ohne Intelligenz und Bildung. Als junges Mädchen zur Gesellschafterin der Tochter jenes Bankiers Doumerc bestimmt, hat sie aus diesem Umgang gewisse romantische Neigungen mitgebracht; sie schwärmt in jenen Jahren von schöner Literatur und wird sich späterhin eine Vorliebe für Swedenborg und andere mystische Schriften bewahren. Aber diese leisen idealistischen Anflüge sind bald überschattet von der ererbten Angst um das Geld; aus einer typischen Pariser Kleinbürgerfamilie stammend, die harpagonhaft mit Kurzwarenhandel Sou für Sou ihren Sparstrumpf füllte, bringt sie all die muffigen, engherzigen Instinkte der unteren Bourgeoisie in den jungen Haushalt; vor allem einen kleinkrämerischen Geiz, der aber gleichzeitig immer happig nach guten Anlagen und einträglichen Spekulationen schielt. Für die Kinder sorgen heißt für sie: sie lehren, daß Geldausgeben ein Verbrechen, Geldverdienen die Tugend der Tugenden sei, daß man von Anfang an sie dazu anhalten müsse, sich eine solide »Position« – oder bei den Töchtern eine gute Heirat – zu machen; keine Freiheit ihnen lassen, ständig ihnen auf die Finger passen. Aber eben mit dieser zudringlichen, wachsamen Besorgtheit, mit diesem morosen Eifer um ihr angebliches Wohl wirkt sie trotz all ihrer »guten Absichten« lähmend auf die ganze Familie; noch nach Jahren, als längst erwachsener Mann, wird Balzac sich erinnern, daß er als Kind jedesmal erschrak, sobald er nur ihre Stimme hörte.
Was Balzac unter dieser immer verdrießlichen und in sich gehemmten Mutter gelitten, die jeden Zärtlichkeitsversuch der impetuosen und gutmütig-leidenschaftlichen Kinder kalt abwehrte, kann man aus dem Schrei in seinem Brief ermessen: »Ich habe niemals eine Mutter gehabt.« Welches der geheimnisvolle Grund gewesen ist – vielleicht eine übertragene Abwehr gegen ihren Gatten –, der Anne Charlotte Balzac instinkthaft von ihren beiden erstgeborenen Kindern Honoré und Laure weghielt, während sie dann die beiden jüngeren, Laurence und Henri, verhätschelte, wird heute kaum noch aufzudecken sein. Aber gewiß ist, daß ein gleichgültigeres, liebloseres Verhalten einer Mutter gegen ihr Kind kaum zu erdenken ist als das ihre. Kaum daß sie ihren Sohn geboren hat, als Wöchnerin noch, schafft sie ihn wie einen Aussätzigen aus dem Haus. Der Säugling wird einer Amme überantwortet, der Frau eines Gendarmen; dort bleibt er bis zu seinem vierten Jahr; auch dann darf er nicht heim zu Vater, Mutter und Geschwistern in das doch geräumige und wohlsituierte Haus, sondern wird in Halbpension zu einer fremden Familie gegeben; nur einmal in der Woche, am Sonntag, darf er die Seinen, als wären sie ganz entfernte Verwandte, besuchen. Kein Spiel mit den jüngeren Geschwistern ist ihm gegönnt, keine Spielzeuge und Geschenke werden erlaubt. Er kennt keine Mutter, die, wenn er krank ist, an seinem Bette wacht, nie hat er ihre Stimme ein weiches Wort sagen hören, und wenn er zärtlich andrängt an ihr Knie und wünscht, sie zu umarmen, scheucht ein strenges Wort eine solche Vertraulichkeit als unziemlich fort. Und kaum daß er die kleinen Beine richtig rühren kann, mit sieben Jahren, stößt sie den Unerwünschten in ein Internat nach Vendôme; nur weit fort soll er sein, an einem andern Ort, in einer andern Stadt. Wie dann Balzac nach sieben Jahren unerträglicher Zucht wieder ins Elternhaus zurückkehrt, macht sie ihm – nach seinen eigenen Worten – »das Leben so schwer«, daß er mit achtzehn Jahren von selbst diesem unerträglichen Milieu den Rücken kehrt.
Niemals trotz aller natürlichen Gutmütigkeit hat der erwachsene Mann die Zurücksetzung vergessen können, die er von der sonderbaren Mutter erfahren; noch nach Jahren, da er die Peinigerin seiner Kindheit nun seinerseits zu sich ins Haus genommen, kann der Dreiundvierzigjährige, schon mit weißen Strähnen im Haar, nicht vergessen, was sie einst dem Sechsjährigen, dem Zehnjährigen, dem zärtlichen, liebebedürftigen Kinde durch ihre Abneigung angetan, und er schreit in ohnmächtiger Revolte Frau von Hanska das fürchterliche Geständnis entgegen:
Wenn Sie wüßten, was für eine Frau meine Mutter ist: ein Ungeheuer und eine Ungeheuerlichkeit zugleich. Augenblicklich ist sie im Begriff, meine Schwester unter die Erde zu bringen, nachdem schon meine arme Laurence und meine Großmutter an ihr zugrunde gegangen sind. Sie haßt mich aus vielen Gründen. Sie haßte mich schon, ehe ich geboren war. Ich war schon nahe daran, mit ihr zu brechen; es wäre fast eine Notwendigkeit. Aber ich leide lieber weiter. Es ist eine Wunde, die nicht heilen kann. Wir glaubten, sie sei verrückt, und konsultierten einen Arzt, der seit dreiunddreißig Jahren mit ihr befreundet ist. Aber er sagte uns: »Ach nein, sie ist nicht verrückt. Sie ist nur böse« … Meine Mutter ist die Ursache allen Übels in meinem Leben.
Diese Worte sind die nach Jahren offen ausbrechende Antwort auf die tausend heimlichen Qualen, die er in seinem empfindlichsten Alter gerade von jenem Wesen erfahren, das ihm nach dem Gesetz der Natur das nächste hätte sein müssen. Seine Mutter allein hat es verschuldet, daß er – nach seinem eigenen Wort – »die grauenhafteste Kindheit erlitten, die je einem Menschen auf Erden beschieden war«.
Von den sechs Jahren, die Balzac in dem geistigen Zuchthaus des Oratorianerinternats in Vendôme verbringt, haben wir zweierlei Berichte; den amtlich nüchternen des Schulregisters und den dichterisch großartigen in seinem Louis Lambert. Die Schulväter vermerken nur kalt:
Nr. 460. Honoré Balzac, alt acht Jahre und einen Monat. Hat die Pocken gehabt, ohne nachwirkende Schädigungen. Charakter vollblütig, erhitzt sich leicht und ist gelegentlich Hitzefiebern unterworfen. Eintritt in das Pensionat am 20. Juni 1807, Austritt: am 22. August 1813. Briefe sind zu senden an Monsieur Balzac, den Vater, in Tours.
Seinen Mitschülern ist er einzig als ein »dicker, pausbackiger Junge mit einem roten Gesicht« in Erinnerung geblieben; was sie zu berichten wissen, gilt der äußeren Erscheinung oder ein paar anzweifelbaren Anekdoten. Um so erschütternder enthüllen die biographischen Blätter des Louis Lambert das tragische Innenleben des genialen und um seiner Genialität willen doppelt gepeinigten Knaben.
Für diese Selbstdarstellung seiner Entwicklungsjahre hat Balzac die Form des Doppelporträts gewählt; er schildert in den zwei Freunden der Schulbank sich selbst als den Poète, Louis Lambert als »Pythagore«, den Philosophen; er hat – ähnlich wie der junge Goethe in der Gestalt des Faust und des Mephistopheles – eine Spaltung seiner Persönlichkeit vorgenommen. Er teilt die beiden Grundformen seines Genies, die schöpferische, die Gestalten des Daseins nachbildete, und die ordnende, welche die geheimen Gesetze in großen Zusammenhängen des Daseins aufzeigen wollte, zwei verschiedenen Wesen zu. In Wirklichkeit war er beidemal selbst Louis Lambert, und zumindest die äußeren Erlebnisse dieser scheinbar ersonnenen Figur sind seine eigenen gewesen: von den vielen Spiegelungen seiner selbst – Raphael in Peau de Chagrin [›Das Chagrinleder‹], d’Arthez in Illusions perdues [›Verlorene Illusionen‹], General Montereau in L’Histoire des Treizes [›Die Geschichte der Dreizehn‹] – ist keine so vollkommen und keine so fühlbar durchlebt wie die Schicksale des unter die spartanische Zucht dieser geistlichen Schule verstoßenen Kindes.
Inmitten der Stadt Vendôme an dem Flüßchen Loir gelegen, bietet schon äußerlich dies Institut mit seinen düsteren Türmen und mächtigen Mauern eher den Eindruck eines Gefängnisses als einer Erziehungsanstalt. Die zwei- bis dreihundert Zöglinge werden vom ersten Tage an in klösterlich strenge Zucht genommen; es gibt keine Ferien, und die Eltern dürfen ihre Kinder nur ausnahmsweise besuchen; in all diesen Jahren ist Balzac fast niemals zu Hause gewesen, und um die Ähnlichkeit mit seiner eigenen Vergangenheit stärker zu akzentuieren, macht er Louis Lambert zu einem Kind, das weder Vater noch Mutter hat, zu einer Waise. Der Pensionspreis, der nicht nur Lehrgeld, sondern auch Verpflegung und Kleidung in sich schließt, ist ein verhältnismäßig geringer, und es wird an den Kindern ungebührlich gespart; diejenigen – und Balzac gehört dank der Gleichgültigkeit seiner Mutter zu den Benachteiligten –, denen die Eltern nicht Handschuhe und wärmere Unterkleidung schicken, schleichen im Winter mit erfrorenen Händen und Frostbeulen an den Füßen herum. Besonders empfindlich im körperlichen wie im geistigen Sinne, leidet Balzac-Lambert vom ersten Augenblick mehr als alle seine bäurischen Kameraden:
Gewöhnt an die Landluft, an die Freiheit einer dem Zufall überlassenen Erziehung, an die Fürsorge eines Greises, der ihn zärtlich liebte, an das Denken im Sonnenschein, wurde es ihm überaus schwer, sich der Regel der Schule zu beugen, in der Reihe zu marschieren, in den vier Wänden eines Saales zu leben, wo achtzig junge Leute schweigend auf Holzbänken saßen, jeder vor seinem Pult. Seine Sinne waren von einer Vollkommenheit, die sie außerordentlich zart machte, und alles an ihm litt unter dem gemeinsamen Leben. Die Ausdünstungen, welche die Luft verdarben, gemischt mit dem Geruch eines immer schmutzigen Klassenzimmers, in dem die Überreste unserer Vesperbrote herumlagen, griffen seinen Geruchssinn an, diesen Sinn, der mehr als alle anderen mit dem Zerebralsystem in Verbindung steht und dessen Schädigung unmerkliche Erschütterungen der Denkorgane verursachen muß. Abgesehen von diesen Ursachen der Luftverderbnis befanden sich in unsern Schulsälen Verschläge, wo jeder seine kleinen Schätze aufhob: die für die Festtage geschlachteten Tauben oder die Speisen, die man aus dem Refektorium entwendet hatte. Außerdem befand sich in unsern Sälen auch noch ein ungeheurer Stein, auf dem jederzeit zwei Eimer voll Wasser standen, eine Art Schwemme, an der wir uns jeden Morgen in Gegenwart des Lehrers der Reihe nach Gesicht und Hände waschen mußten. Von da begaben wir uns an einen Tisch, wo Frauen uns kämmten und puderten. Unser Schlafraum, der nur einmal am Tage, bevor wir aufstanden, gereinigt wurde, blieb immer unsauber. Und trotz der Menge von Fenstern und der Höhe der Tür war die Luft darin unaufhörlich verdorben durch die Ausdünstungen des Wasch- und Frisierplatzes, des Verschlages, der tausend Beschäftigungen jedes Schülers, abgesehen von unsern achtzig zusammengepferchten Körpern … Die Entbehrung der reinen und duftenden Landluft, in der er bisher gelebt hatte, die Änderung seiner Gewohnheiten, die Disziplin, all dies machte Lambert traurig. Den Kopf stets in die linke Hand gestützt und den Ellbogen auf sein Pult gelehnt, brachte er die Unterrichtsstunden damit zu, die grünen Bäume im Hof und die Wolken am Himmel zu betrachten; er schien seine Aufgabe zu lernen; aber der Lehrer, der seine Feder ruhen und die Seite weiß bleiben sah, rief ihm zu: »Lambert, du tust ja nichts!«
(Louis Lambert)
Unbewußt spüren die Lehrer in diesem Knaben einen Widerstand; sie merken nicht, daß etwas Außerordentliches in ihm wirkt, sondern nur, daß er nicht ordentlich, nicht im normalen Sinne liest und lernt. Sie halten ihn für stumpf oder träge, für störrisch oder verträumt, weil er nicht den gleichen Trott einhält mit den andern – bald hinter ihnen zurück, bald mit einem Sprung ihnen voraus. Jedenfalls fällt auf keinen die Fuchtel härter als auf ihn. Unablässig wird er bestraft. Für ihn gibt es nicht die Muße der Erholungsstunden, er wird mit einem Strafpensum nach dem andern bedacht, wird so oft in den Karzer gesteckt, daß ihm einmal innerhalb zweier Jahre keine ganzen sechs freien Tage bleiben. Öfter und grausamer muß dieser größte Genius seiner Zeit die ultima ratio der strengen Padres erfahren, die körperliche Züchtigung:
Dieser schwache und zugleich so starke Knabe … erduldete alle Möglichkeiten des Leidens an Körper und Seele. Wie ein Sklave auf die Bank vor sein Pult gefesselt, geschlagen von der Fuchtel, geschlagen von Krankheit, in all seinen Sinnen verletzt, in einen Schraubstock von Widerwärtigkeiten gepreßt, wurde er gezwungen, seine äußere Hülle den tausend Tyranneien des Instituts preiszugeben …
Unter all unseren physischen Leiden war das heftigste sicherlich das durch jenen etwa zwei Finger dicken Lederriemen verursachte, der mit aller Kraft, mit allem Zorn des Lehrers auf unsere Hände niedersauste. Um diese klassische Züchtigung zu empfangen, ließ sich der Schuldige inmitten des Saales auf die Knie nieder. Es galt, von der Bank aufzustehen, sich nahe beim Katheder hinzuknien und die neugierigen, oft spöttischen Blicke der Kameraden zu ertragen. Zarten Seelen machten diese Vorbereitungen die Qual zu einer doppelten, wie früher der Weg vom Gerichtsgebäude zum Schafott, den die Verurteilten zurücklegen mußten. Je nach ihrem Charakter schrien die einen und vergossen heiße Tränen vor und nach der Züchtigung; die andern ertrugen die Schmerzen mit stoischer Miene; aber in Erwartung der Fuchtel konnten auch die Stärksten kaum eine krampfhafte Verzerrung des Gesichts unterdrücken. Louis Lambert wurde mit Rutenstrafen überhäuft und verdankte dies einer Fähigkeit seiner Natur, von deren Existenz er lange nichts wußte. Wenn er durch das »Du tust ja nichts!« des Lehrers gewaltsam aus einer Träumerei gerissen wurde, so geschah es oft, ihm selber anfangs unbewußt, daß er diesem Menschen einen Blick voll wilder Verachtung zuschleuderte, der mit Gedanken geladen war wie eine Leidener Flasche mit Elektrizität. Dieser Blickwechsel verursachte dem Lehrer zweifellos eine unangenehme Empfindung, und gekränkt durch den stillschweigenden Spott, der darin lag, wollte er dem Schüler das Augenblitzen austreiben. Als der Pater zum ersten Male diesen verächtlichen Strahl gewahr wurde, der ihn wie ein Blitz traf, tat erfolgenden Ausspruch, der mir im Gedächtnis geblieben ist: »Wenn du mich weiter so ansiehst, Lambert, so wirst du die Rute bekommen!«
(Louis Lambert)
Kein einziger unter den strengen Padres erkennt in all diesen Jahren Balzacs Geheimnis. Sie sehen nur einen Schüler, der hinter den andern in Latein oder in Vokabelkenntnis zurückbleibt, und ahnen nicht sein ungeheuerliches Voraussehen. Sie halten ihn für unachtsam, für gleichgültig, ohne zu bemerken, daß ihn die Schule langweilt und ermüdet, weil die Aufgaben, die sie stellt, ihm längst zu leicht sind, daß seine scheinbare Trägheit nur eine Erschöpfung ist von einer »congestion d’idées« [Ideenandrang]. Keinem kommt in den Sinn, daß dieser pausbackige kleine Junge mit seiner geistigen Flugkraft längst in andern Räumen lebt als in dem stickigen Schulraum, daß dieser eine unter all denen, die an ihrem Sitzplatz sitzen und an ihrem Schlafplatz schlafen, ein unsichtbares Doppelleben führt.
Diese andere Welt, in der der Zwölfjährige, der Dreizehnjährige lebt, sind die Bücher. Der Bibliothekar der polytechnischen Hochschule, der ihm Privatstunden in Mathematik erteilt – Balzac ist deshalb doch sein Leben der schlechteste Rechner der Literatur geblieben –, erlaubt dem Knaben, sich nach Belieben Bücher in das Internat mitzunehmen, ohne das Übermaß zu ahnen, mit dem der Leidenschaftliche von dieser Verstattung Gebrauch macht. Diese Bücher sind für Balzac eine Rettung, sie machen alle Qualen und Erniedrigungen der Schulzeit hinfällig. »Ohne die Bücher aus der Bibliothek, die wir lasen und die das Leben in unserem Gehirn aufrechterhielten, hätte dieses System unserer Existenz zu einer völligen Verrohung geführt.« Das wirkliche Leben in Hof und Schule wird zu einem trüben Dämmerzustand, die Bücher zu seiner eigentlichen Existenz.
»Von diesem Augenblick an«, berichtet er von seinem Spiegelbild Louis Lambert, »war es bei ihm eine Art Heißhunger geworden, den er nicht zu stillen vermochte. Er verschlang Bücher jeglicher Art, er nährte sich ohne Unterschied von religiösen, geschichtlichen, philosophischen und naturwissenschaftlichen Werken« – das ungeheure Fundament der Balzacschen Universalkenntnisse wird in diesen heimlichen Lesestunden des Schulknaben gelegt, tausend Einzeltatsachen, unlösbar aneinanderzementiert dank eines dämonisch wachen und geschwinden Gedächtnisses. Nichts erläutert vielleicht besser das einmalige Wunder der Balzacschen Apperzeptionsfähigkeit als die Schilderung der heimlichen Leseorgien Louis Lamberts:
Die Einsaugung von Gedanken durch das Lesen war bei ihm zu einem merkwürdigen Phänomen geworden. Sein Auge umfaßte sieben bis acht Zeilen auf einmal, und sein Geist begriff deren Sinn mit einer seinem Blick entsprechenden Geschwindigkeit. Oft ließ in einem Satz ein einziges Wort ihn dessen Sinn erfassen. Sein Gedächtnis war ein Wunder. Er erinnerte sich mit derselben Treue der Gedanken, die er durch Lektüre erworben hatte, wie derer, die Reflexion oder Unterhaltung ihm eingegeben hatten. Kurz, er besaß alle Arten von Gedächtnis: für Orte, für Namen, für Worte, für Dinge und für Gesichter. Nicht allein, daß er sich an Dinge nach Belieben erinnern konnte, sondern er sah sie in seinem Innern in derselben Situation, Beleuchtung, Farbe wie in dem Augenblick, als er sie bemerkt hatte. Die gleiche Fähigkeit hatte er in bezug auf die unfaßbarsten Vorgänge des Begriffsvermögens. Er erinnerte sich – seinem Ausdruck nach – nicht nur der Schichtung der Gedanken in dem Buche, dem er sie entnommen hatte, sondern auch der Zustände seiner eigenen Seele an weit zurückliegenden Zeitpunkten. Sein Gedächtnis besaß also die unerhörte Eigenart, ihm die Fortschritte und das ganze Leben seines Geistes wieder vor Augen führen zu können: von seinen frühesten Gedanken an bis zu dem, der sich ihm zuletzt erschlossen hatte, vom verworrensten bis zum klarsten. Sein Gehirn, jung an den komplizierten Mechanismus der Konzentration der menschlichen Kräfte gewöhnt, sog aus diesem reichen Lager eine Fülle von Bildern in bewundernswerter Deutlichkeit und Frische, die während seiner klaren Betrachtungen seine Nahrung bildeten. Im Alter von zwölf Jahren hatte sich seine Phantasie – durch die fortwährende Übung seiner Fähigkeiten angespornt – in hohem Grade entwickelt; sie erlaubte es ihm, von Dingen, die er nur durch Lektüre wahrgenommen hatte, so genaue Vorstellungen zu haben, daß ihr Bild in seiner Seele nicht lebendiger hätte sein können, wenn er sie wirklich gesehen hätte; sei es nun, daß er mit Analogieschlüssen arbeitete, sei es, daß er mit einer Art von zweitem Gesicht begabt war, mit dem er die Natur umfaßte.
»Als ich die Beschreibung der Schlacht bei Austerlitz las«, sagte er mir eines Tages, »habe ich alles geschehen sehn. Die Salven der Kanonen, die Schreie der Kämpfenden hallten in meinen Ohren wider und rührten mein Inneres auf; ich roch das Pulver, ich hörte das Getrappel der Pferde und die Stimmen der Menschen; ich bewunderte die Ebene, wo die bewaffneten Völker zusammenstießen, als ob ich auf der Höhe von Santon gewesen wäre. Dies Schauspiel schien mir schrecklich wie eine Stelle aus der Apokalypse.«
Wenn er so mit allen seinen Kräften bei der Lektüre war, so verlor er gleichsam das Bewußtsein seines physischen Lebens und existierte nur noch durch das alles vermögende Spiel seiner inneren Organe, deren Leistungsfähigkeit unverhältnismäßig ausgedehnt war: er ließ seinem Ausdruck nach »den Raum hinter sich!«
(Louis Lambert)
Und dann sitzt nach solchen ekstatischen und die Seele lustvoll erschöpfenden Flügen ins Unbegrenzte der unausgeschlafene Knabe in seinem verhaßten Klosterkleid neben den Bauernjungen, deren stumpfe Gehirne mühsam, als gingen sie hinter dem Pflug, dem Vortrag des Lehrers nachstapfen; noch erregt von den schwierigsten Problemen soll er achtsam sein auf mensa, mensae und die Regeln der Grammatik. Vertrauend auf die Überlegenheit seines Gehirns, das eine Buchseite nur anzustreifen braucht, um sie auswendig zu wissen, versäumt er zuzuhören und träumt die Ideen jener andern Bücher nach. Meist bekommt diese Verachtung der Realität sehr schlimm.
Unser Gedächtnis war so gut, daß wir niemals unsere Aufgaben lernten. Es genügte uns, die französischen und lateinischen Stücke oder die grammatischen Absätze von unseren Kameraden aufsagen zu hören, um sie selber zu können. Aber als der Lehrer unglücklicherweise auf die Idee kam, die Reihenfolge zu ändern und uns zuerst zu fragen, da wußten wir oft nicht einmal, worin die Aufgabe bestand. Die Strafarbeit ereilte uns trotz der geschicktesten Entschuldigungen. Wir warteten mit der Erledigung unserer Aufgaben immer bis zum letzten Augenblick. Hatten wir ein Buch, das wir fertig lesen wollten, hatten wir uns in Träumerei verloren, so war die Aufgabe vergessen: neue Quelle von Strafarbeit!
(Louis Lambert)
Der geniale Knabe wird immer härter gezüchtigt, schließlich bleibt ihm selbst die »culotte de bois«, der mittelalterliche Block, in den Shakespeares Lear den wackeren Kent schließen läßt, nicht erspart. Erst als er mit seinen Nerven zusammenbricht – die Krankheit ist nie genannt worden, die ihn von der Klosterschule erlöst –, darf das frühreife Genie das Zuchthaus seiner Kindheit verlassen, wo er »gelitten hat, überall wo der Schmerz ihn nur treffen konnte, seelisch und körperlich«.
Dieser endgültigen Erlösung aus der geistigen Sklaverei geht in Balzacs »histoire intellectuelle« seines Louis Lambert eine Episode voraus, die wahrscheinlich nicht ganz erfunden ist. Balzac läßt sein anderes Ich, seinen imaginären Louis Lambert, im zwölften Jahre ein großes philosophisches System über die psychophysischen Zusammenhänge, einen »Traité de la Volonté« [eine Abhandlung über den Willen] verfassen, dessen Manuskript von Kameraden, die neidisch sind auf seine »verschlossene aristokratische Haltung«, ihm boshaft entrissen wird. Der strengste unter den Lehrern, die Geißel seiner Jugend, der »terrible père Haugolt« [der schreckliche Vater Haugolt], hört den Tumult, nimmt das Manuskript an sich und gibt den »Traité de la Volonté« als wertloses Papier an Krämer weiter, »ohne zu wissen, welche bedeutenden geistigen Schätze er vor sich hatte, deren zu früh geborene Früchte dann unter den Händen der Unwissenden verkamen«. Die Szene ist zu erschütternd wahrhaftig geschildert mit all der ohnmächtigen Wut des beleidigten Knaben, als daß sie völlig erfunden sein könnte. Aber hat Balzac nur Ähnliches vielleicht mit einem literarischen Versuch erlebt, oder hat er wirklich im Oratorianerkolleg sich schon selbst an einem »Traité de la Volonté« versucht, dessen Ideen und Grundzüge er in ausführlicher Weise a posteriori auseinandersetzt? War seine Frühreife wirklich schon dermaßen produktiv in jenen Jahren, daß sie sich an ein Werk dieser Art wagen konnte? Ist es Balzac, der reale, der wirkliche Knabe Balzac, der ein solches Werk verfaßt hat, oder nur der erdichtete, der imaginäre Seelenbruder Louis Lambert?
Diese Frage wird nie ganz entschieden werden. Gewiß ist, daß Balzac in seiner Jugend – immer haben ja die zentralen Ideen eines Denkers ihren Mittelpunkt in den Entwicklungsjahren – an einen solchen »Traité de la Volonté« gedacht hat, ehe er die hundertfältige Triebrichtung und Gesetzmäßigkeit des Willens in seiner Comédie humaine [›Menschlichen Komödie‹] in Gestalten veranschaulichte. Es ist zu auffällig, daß er ebenso wie seinen Louis Lambert auch den Helden seines ersten Romanes La Peau de Chagrin [›Das Chagrinleder‹] an einem »Traité de la Volonté« arbeiten läßt; der Plan, die »Grundgesetze, deren Formulierung vielleicht einmal meinen Ruhm bilden wird«, zu finden, muß unbedingt der Zentralgedanke, die »idée mère« seiner Jugend gewesen sein, und darüber, daß Balzac die ersten Anregungen über die Zusammenhänge des Seelischen und Körperlichen durch ein geheimnisvolles »fluide étheré« [ätherisches Fluidum] schon in seinen Schuljahren empfangen hat, besitzen wir mehr als Vermutungen. Einer seiner Lehrer, Dessaignes, wie so viele jener Zeit ganz im Bann der – damals noch mißverstandenen – Anregungen Mesmers und Galls, die ihre Spuren im Werke Balzacs allenthalben hinterlassen haben, war Verfasser von »Études de l’homme moral fondées sur les rapports de ses facultés avec son organisme« [›Studium des sittlichen Menschen über die Beziehungen zwischen seinen Begabungen und seinem Organismus‹]. Zweifeilos hat er in den Schulstunden diese Ideen übermittelt und in dem einzigen genialen Knaben seiner Klasse den Ehrgeiz erweckt, selbst ein solcher »chimiste de la volonté« [Chemiker des Willens] zu werden. Der damals aktuelle Gedanke einer motorischen Universalsubstanz entsprach völlig dem unbewußten Drang seiner Natur zu einer Methode; zeitlebens von der Fülle der seelischen Phänomene bedrängt, hat Balzac schon lange vor der Comédie humaine sich bemüht, dieses großartige Chaos in eine äußere Ordnung zu verwandeln und sie thematisch oder gesetzmäßig zu gliedern, um derart die Bedingtheiten der seelischen Natur ebenso übersichtlich festzulegen wie die der unbeseelten Organismen. Ob aber Balzac sich schon zu einer so unwahrscheinlich frühen Epoche an eine Niederschrift seiner Anschauungen gewagt hat oder ob dies nur nachträgliche Unterstellung des späteren Dichters ist, das wird kaum noch jemals zu belegen sein; daß keinesfalls aber die uns vorliegenden – etwas konfusen – Axiome aus Louis Lamberts »Traité de la Volonté« diejenigen des Zwölfjährigen waren, beweist schon der Umstand, daß sie in der ersten Fassung des Louis Lambert (1832) noch gar nicht enthalten waren und erst für die späteren Auflagen ziemlich improvisatorisch eingeschaltet wurden.
Nach jenem plötzlichen Austritt aus dem Oratorianerseminar sieht der Vierzehnjährige eigentlich zum erstenmal seit seiner Geburt sein Elternhaus. Vater und Mutter, die ihn in der Zwischenzeit nur bei gelegentlichen Besuchen wie irgendeinen entfernten Verwandten empfangen haben, finden ihn äußerlich und innerlich völlig verändert. Statt des pausbackigen, erzgesunden, gutmütigen Jungen kommt aus der geistlichen Zucht ein hagerer, nervöser Knabe mit großen verschreckten Augen zurück. Er kommt zurück wie jemand, dem etwas Furchtbares und Unsagbares zugestoßen ist; die Schwester vergleicht später sein Gehaben dem eines Somnambulen, der mit fremden Blicken durch den Tag tappt. Er hört kaum, wenn man ihn etwas fragt, sitzt träumerisch herum; er verärgert die Mutter durch seine Verschlossenheit, die eine heimliche Überlegenheit verbirgt. Aber nach einiger Zeit bricht – wie in allen seinen Lebenskrisen – die ererbte Vitalität sieghaft durch. Der Knabe wird wieder aufgeräumt und gesprächig, der Mutter sogar zu sehr; zur Ergänzung seiner Studien wird er in das Gymnasium von Tours und, als Ende 1814 die Familie von Tours nach Paris übersiedelt, dort in das Internat Lepître geschickt. Dieser Monsieur Lepître war während der Revolution als Citoyen Lepître mit Balzacs Vater, dem damaligen Mitglied des radikalen Stadtrats, befreundet gewesen und hat insofern eine historische Rolle gespielt, als er bei dem Befreiungsversuch Marie Antoinettes aus der Conciergerie einer der Haupthelfer war. Jetzt ist er nichts mehr als ein braver Institutsvorstand, der junge Burschen durch das Examen zu befördern hat. Auch in diesem Internat verfolgt den liebebedürftigen Knaben das bedrückende Gefühl des Ausgesetztseins und Verlassenseins. Und so läßt er Raphael, die andere Spiegelgestalt seiner Jugend, in La Peau de Chagrin erzählen:
Die Leiden, die ich im Schoß der Familie erfahren hatte, auf der Schule, dem Internat, sie erneuerten sich jetzt in veränderter Form während meines Aufenthaltes in der Pension Lepître. Mein Vater hatte mir keinerlei Geld mitgegeben. Meine Eltern waren völlig befriedigt bei dem Gedanken, daß ich ernährt, bekleidet, mit Latein und Griechisch vollgestopft war. Ich habe während meines Lebens im Internat etwa tausend Kameraden kennengelernt, aber ich kann mich nicht erinnern, auch nur bei einem ein derartiges Beispiel der Gleichgültigkeit seiner Eltern angetroffen zu haben.
Auch hier bewährt sich, offenbar infolge einer inneren Gegenwehr, Balzac nicht als guter »Schüler«. Ärgerlich senden ihn die Eltern in ein anderes Institut. Auch da ergeht es ihm nicht besser; in Latein ist er von etwa fünfunddreißig Schülern der zweiunddreißigste, ein Resultat, das die Mutter immer mehr in dem Verdacht bestärkt, daß Honoré ein »raté«, ein mißratener Junge sei. So schreibt sie dem schon Siebzehnjährigen in jenem weinerlich sich selbst bemitleidenden Ton, der noch den Fünfzigjährigen zur Verzweiflung bringen wird, die gloriose Epistel:
Mein lieber Honoré, ich kann keine Worte finden, die stark genug wären, um dir den Schmerz zu schildern, den du mir verursachst. Du machst mich tatsächlich unglücklich, mich, die ich alles für meine Kinder tue und eigentlich erwarten müßte, daß sie mich glücklich machen!
Der gute, verehrungswürdige Monsieur Gancer hat mir mitgeteilt, daß du beim Übersetzen auf den 32. Platz heruntergerückt bist!!! Er hat mir gesagt, daß du vor einigen Tagen wiederum etwas sehr Ungezogenes getan hast. Und so ist mir das ganze Vergnügen, das ich mir für morgen versprochen hatte, genommen …
Eigentlich hätten wir uns am Morgen gegen acht Uhr treffen sollen: wir hätten zusammen zu Mittag und zu Abend gegessen, wir hätten so hübsch zusammen geplaudert und uns allerhand erzählt. Dein Mangel an Fleiß, deine Leichtfertigkeit, deine Versehen verurteilen mich nun dazu, dich deiner gerechten Bestrafung zu überlassen. Wie leer ist mein Herz nun! Wie lang wird mir die Reise erscheinen! Ich verheimliche deinem Vater den schlechten Platz, den du bekommen hast, denn sicherlich wirst du am Montag nicht ausgehen dürfen, obwohl dieser Ausgang nur für nützliche Zwecke bestimmt ist und keineswegs für dein Vergnügen. Der Tanzlehrer wird morgen kommen, um viereinhalb Uhr. Ich werde dich holen lassen und nach der Stunde zurückbringen lassen. Ich würde die Pflichten, die mir die Liebe für meine Kinder auferlegt, verletzen, wenn ich anders mit dir verführe.
Trotz aller dieser schlimmen Voraussagen beendet aber der Verfemte krumm oder gerade seine Studien. Am 4. November 1816 kann er sich an der Universität als Student der Rechte immatrikulieren lassen.
Dieser 4. November 1816 sollte von Rechts wegen das Ende der Fronzeit und das Morgenrot der Freiheit für den jungen Menschen sein. Er sollte jetzt wie alle andern unabhängig seinen Studien nachgehen und die freie Zeit zu Muße oder eigenen Neigungen auswerten dürfen. Aber die Eltern Balzacs sind anderer Meinung. Ein junger Mensch soll keine Freiheit, keine Stunde überflüssige Zeit haben. Er soll verdienen. Genug, wenn er ab und zu die Kurse an der Universität hört und nachts die Pandekten studieren darf; bei Tag soll er außerdem noch einen Beruf haben. Nur keine Zeit für die Karriere versäumen! Nur keinen unnötigen Sou ausgeben! So hat der Student Balzac gleichzeitig als Schreiber bei dem Advokaten Guyonnet de Merville zu roboten – dem ersten übrigens seiner Vorgesetzten, den er willig anerkennt und den er unter dem Namen Derville dankbar verewigt hat, weil er mit Intelligenz die Qualität seines Schreibers erkannte und großzügig dem um vieles Jüngeren seine Freundschaft gewährte. Zwei Jahre später wird Balzac an einen Notar Passez, mit dem die Familie Balzac befreundet ist, weitergegeben; damit ist seine bürgerliche Zukunft scheinbar völlig gesichert. Am 4. Januar besteht der endlich »normal« gewordene junge Mann das Baccalauréat; bald wird er als Associé des braven Notars fungieren, und wenn Maître Passez altert oder stirbt, die Kanzlei übernehmen, dann heiraten, selbstverständlich reich heiraten, und in eine gute Familie, und so endlich seiner mißtrauischen Mutter, den gesamten Balzacs und Sallambiers sowie der übrigen Verwandtschaft Ehre machen; seine Biographie könnte als die eines andern Monsieur Bouvard oder Pécuchet nur von Flaubert geschrieben werden als Musterbeispiel einer gutbürgerlichen, normalen Karriere. Da schlägt endlich die seit Jahren niedergehaltene und erstickte Flamme der Revolte in Balzac hoch; im Frühjahr 1819 springt er eines Tages plötzlich vom Schreibbock des Notars und läßt die angefangenen staubigen Akten liegen. Er hat genug für immer von dieser Existenz, die ihm noch keinen freien und glücklichen Tag geschenkt. Entschlossen reckt er – zum erstenmal – gegen die Familie den Nacken hoch und erklärt unvermittelt, er wolle kein Advokat, kein Notar, kein Richter, kein Beamter werden. Er wolle überhaupt keinen bürgerlichen Beruf! Er sei entschlossen, ein Schriftsteller zu werden und durch seine künftigen Meisterwerke unabhängig, reich und berühmt.
Zweites KapitelVerfrühte Frage an das Schicksal
Meine Leiden haben mich alt gemacht … Sie können sich gar nicht vorstellen, was für ein Leben ich bis zu meinem zweiundzwanzigsten Jahre geführt habe.
Brief an die Herzogin von Abrantès, 1828.
Die plötzliche Ankündigung des Zwanzigjährigen, daß er Schriftsteller, Dichter und jedenfalls ein frei schaffender Mensch statt Notar oder Advokat werden wolle, wirkt auf die ahnungslose Familie wie ein Donnerschlag. Eine gesicherte Karriere aufgeben? Ein Balzac, ein Enkel der hochgeachteten Sallambiers, ein so verdächtiges Gewerbe betreiben wie das eines Schriftstellers? Wo sind da Garantien, wo Sicherungen für ein gesittetes verläßliches Einkommen? Literatur, Poesie, solchen überflüssigen Luxus kann sich ein Vicomte de Chateaubriand leisten, der irgendwo in der Bretagne ein schönes Schloß besitzt, oder ein Herr de Lamartine und allenfalls der Sohn des Generals Hugo, aber keinesfalls ein kleiner Bürgerssohn. Und dann – hat dieser ungeratene Junge jemals die mindeste Spur einer Begabung gezeigt? Hat man je von ihm einen schönen Aufsatz gelesen, hat er je im Provinzblatt Gedichte veröffentlicht? Niemals! In allen Schulen ist er auf der Schandbank gesessen, im Latein der Zweiunddreißigste gewesen, nicht zu reden von der Mathematik, die doch für jeden ordentlichen Kaufmann die wichtigste Wissenschaft zu sein hat.
Überdies kommt diese Ankündigung noch im ungeschicktesten Augenblick, denn Vater Balzac befindet sich gerade jetzt in unübersichtlichen Finanzverhältnissen. Mit dem blutigen Weinstock des Krieges hat die Restauration auch diesen kleinen Blutsaugern des Krieges die Wurzeln ausgerodet, an denen sie die gesegneten Napoleonsjahre hindurch schmarotzt haben. Für Armeelieferanten und Heeresprofiteure ist eine dürre Zeit gekommen; auch Vater Balzac ist das fette Gehalt von achttausend Francs auf eine magere Pension gekürzt worden, und außerdem hat er in der Liquidation des Bankhauses Doumerc und bei anderen Spekulationen reichlich Haare gelassen. Noch kann man die Familie getrost vermögend nennen, und wie es sich zeigen wird, stecken immerhin ein paar Zehntausender im Sparstrumpf; aber für die Kleinbourgeoisie ist es oberstes Gesetz, gültiger als alle des Staates, daß jede Reduktion des Einkommens sofort durch verdoppelte Sparsamkeit wettgemacht werden müsse. Die Familie Balzac hat beschlossen, die Pariser Wohnung aufzugeben und in einen billigen Wohnort zu ziehen, nach Villeparisis – damals etwa zwanzig Kilometer von der Hauptstadt –, wo man unauffälliger die Ausgaben einschränken kann. Und just in diesem Augenblick kommt der einfältige Junge, von dem man sich schon für immer entlastet glaubte, und will nicht nur Dichter werden, sondern verlangt obendrein, die Familie solle ihm diese Nichtstuerei finanzieren.
Ausgeschlossen! erklärt die Familie darum und ruft zur Unterstützung Freunde und Verwandte herbei, die sich selbstverständlich einhellig gegen das anmaßende Hirngespinst dieses Taugenichts aussprechen. Vater Balzac zeigt sich noch am gleichmütigsten. Er liebt keine Familienszenen und knurrt schließlich ein gutmütiges »Warum nicht?« Selbst ein alter Abenteurer und Spekulant, der Dutzende Male seinen Beruf gewechselt und erst spät ins Behaglich-Bürgerliche umgeschwenkt hat, kann er wenig Brio aufbringen, um sich über die Extravaganz seines sonderbaren Sprößlings zu echauffieren. Auf Balzacs Seite steht ferner, allerdings heimlich, Laure, seine Lieblingsschwester; sie hat eine romantische Neigung für Poesie, und der Gedanke, einen berühmten Bruder zu haben, schmeichelt ihrer Eitelkeit. Was aber die romantische Tochter als Ehre erträumt, empfindet die kleinbürgerlich erzogene Mutter als bittere Schande. Wie bestehen können vor der Verwandtschaft, wenn sie das Ungeheuerliche erfährt, daß ein Sohn der Madame Balzac, der geborenen Sallambier, Bücher- oder Zeitungsschreiber geworden sei? Mit dem ganzen Abscheu der Bourgeoisie vor einer »unsoliden« Existenz stürzt sie sich in den Kampf. Niemals und niemals! Man wird diesem faulenzerischen Jungen, der schon auf der Schule nichts taugte, solche brotlosen Narreteien nicht durchgehen lassen, um so mehr, da man doch die Taxen und Sporteln für sein juristisches Studium mit baren Franken bezahlt hat. Schluß ein für allemal mit diesem absurden Projekt!
Aber zum erstenmal stößt die Mutter Balzac auf eine Gegenkraft, die sie in dem gutmütig-lässigen Kinde nie geahnt –, auf die unbeugsame und durch nichts zu erschütternde Willenskraft Honoré de Balzacs, auf eine Willenskraft, die nun, da jene Napoleons gebrochen, mit keiner in Europa zu vergleichen ist. Was Balzac will, das wird Wirklichkeit, und wo er zu etwas entschlossen ist, da macht er auch das Unmögliche möglich. Weder Tränen noch Verlockungen, noch Beschwörungen, noch hysterische Anfälle können ihn umstimmen – er will ein großer Dichter werden und kein Notar; die Welt ist Zeuge, daß er es geworden ist. Nach harten tagelangen Kämpfen kommt es zu einem sehr bürgerlichen Kompromiß; das große Experiment wird auf eine solide Basis gestellt. Honoré soll seinen Willen haben; er soll probieren dürfen, ein großer, ein berühmter Schriftsteller zu werden. Wie er dies durchsetze, sei ihm überlassen. Die Familie ihrerseits beteiligt sich an diesem unsicheren Unternehmen mit einem genau begrenzten Kapital; zwei Jahre Zuschuß will sie bestenfalls in das höchst zweifelhafte Talent Honorés investieren, für das leider niemand anders Bürgschaft leistet. Ist Honoré in diesen zwei Jahren nicht ein großer und berühmter Schriftsteller geworden, so muß er wieder in die Notariatsstube zurück – oder man zieht die Hand von dem verlorenen Sohne ab. Auf sauberem Papier wird zwischen Vater und Kind ein sonderbarer Kontrakt abgeschlossen, demzufolge nach genauer Kalkulation auf Grundlage des Existenzminimums die Eltern sich verpflichten, bis Herbst 1821 ihrem Sohne je 120 Francs im Monat, also vier Francs pro Tag Subsidien zu leisten für seinen Konquistadorenzug in die Unsterblichkeit – immerhin das beste Geschäft, das trotz all seiner ergiebigen Heereslieferungen und Finanzspekulationen Vater Balzac zu verzeichnen hat.
Die eigenwillige Mutter hat zum erstenmal einem stärkeren Willen nachgeben müssen – man kann ahnen, mit welcher Verzweiflung, denn sie ist ihrer ganzen Lebensrichtung nach ehrlich überzeugt, daß ihr Sohn sich durch eine starrsinnige Phantasterei das Leben verdirbt. Das Wichtigste ist nun für sie, vor den ehrenwerten Sallambiers die Schande zu verbergen, daß Honoré den soliden Beruf verlassen hat und auf so absurde Weise sich selbständig machen will. Um seine Abreise nach Paris zu kaschieren, teilt sie den Verwandten mit, er habe sich aus Gesundheitsgründen nach dem Süden zu einem Vetter begeben; vielleicht vergeht diese absurde Berufswahl wie eine flüchtige Laune, vielleicht überlegt sich der ungeratene Sohn seine Narrheit noch, und niemand hat dann von dieser unglückseligen Eskapade erfahren, die seinen soliden Beruf beeinträchtigen und damit Heirat und Notariatsklientel endgültig verderben kann. Auf jeden Fall macht sie in der Stille ihren Plan. Da man diesen starrköpfigen Jungen nicht mit Güte und nicht mit Bitten von diesem skandalösen Metier abbringen konnte, muß sie es jetzt mit List und Zähigkeit versuchen. Man wird ihn aushungern. Er soll sehen, wie bequem er es zu Hause hatte und wie warm in der wohlgeheizten Notariatskanzlei; wenn ihm in Paris tüchtig der Magen knurrt, werden bald die großsprecherischen Pläne kapitulieren. Wenn die Finger ihm in seiner Mansarde erfrieren, wird er bald die dumme Schreiberei lassen. Unter dem Vorwand, für sein Wohlergehen mütterlich zu sorgen, begleitet sie ihn nach Paris, um ihm dort ein Zimmer zu nehmen; in Wirklichkeit wählt sie dem künftigen Dichter wohlbedacht die schlechteste, armseligste und unbehaglichste Stube, die selbst im proletarischen Paris zu finden ist, um ihn mürbe zu bekommen.
Jenes Haus Nr. 9 Rue Lesdignières ist längst niedergerissen, und das ist bedauerlich. Denn Paris hat trotz Napoleons Grab kein großartigeres Denkmal leidenschaftlicher Aufopferung als diese jämmerliche Dachkammer, deren Beschreibung in Peau de Chagrin zu finden ist. Eine schwarze stinkende Stiege führte fünf Treppen hoch zu einer verfallenen Eingangstür aus einigen roh zusammengezimmerten Planken. Stieß man sie auf, so tappte man in eine niedere dunkle Dachluke, eisig im Winter, glühendheiß im Sommer. Selbst um den kläglichen Preis von fünf Francs im Monat – drei Sous am Tag – hatte die Wirtin niemanden gefunden, der in dieser Spelunke häusen wollte; gerade »dieses Loch, würdig der Bleikammern von Venedig«, wählt die Mutter, um dem künftigen Schriftsteller das Metier zu verleiden.
Es konnte nichts Abscheulicheres geben – schreibt Balzac noch nach Jahren –, als dieses Mansardenzimmer mit seinen gelben, schmutzigen Wänden, das nach Elend roch …
Die Decke senkte sich dauernd, und die losen Ziegel ließen den Himmel durchscheinen … Mein Logis kostete mich drei Sous am Tage, verbrannte für drei Sous Öl des Nachts, ich machte mir selber das Zimmer, ich trug Flanellhemden, weil ich die zwei Sous für Wäsche täglich nicht ausgeben konnte. Ich heizte mit Kohle; das Stück kostete, wenn ich die Summe durch die Tage des Jahres dividierte, nicht mehr als etwa zwei Sous … Alle diese Ausgaben zusammen machten nicht mehr als achtzehn Sous aus; damit blieben mir zwei Sous für unvorhergesehene Ausgaben. Ich erinnere mich nicht, während dieser langen Periode der Mühsal im Pont des Arts jemals Geld für mein Wasser ausgegeben zu haben. Ich holte es mir selbst des Morgens vom Brunnen auf der Place St.-Michel … Während der ersten zehn Monate meiner mönchischen Einsamkeit lebte ich so in Armut und Zurückgezogenheit; ich war zugleich mein eigener Herr und mein eigener Diener, ich lebte mit unbeschreiblicher Leidenschaft das Leben eines Diogenes.
(La Peau de Chagrin – Das Chagrinleder)
In berechnender Vorsorge tut Mutter Balzac nicht das mindeste, um die Gefängniszelle behaglicher und wohnlicher zu machen; je rascher den Sohn das Unbehagen wieder in einen normalen Beruf zurücktreibt, um so besser. So wird Balzac nur das Allerunumgänglichste zur Einrichtung der Dachkammer aus den Abfällen der Familieneinrichtung zugeteilt – ein flaches, hartes Bett, »das einem elenden Schragen glich«, ein kleiner Eichentisch mit zerschlissenem Leder überspannt und zwei alte Stühle. Das ist alles: ein Bett zum Schlafen, ein Tisch zum Arbeiten und die dazu notwendige Sitzgelegenheit. Schon Honorés sehnlichster Wunsch, ein kleines Piano sich mieten zu dürfen, wird nicht bewilligt; nach wenigen Tagen muß er schon nach Hause betteln um »weiße baumwollene Strümpfe, graue Zwirnstrümpfe und ein Handtuch«. Kaum hat er aber, um seine düsteren Wände etwas freundlicher zu machen, sich eine »gravure« [Kupferstich] und eine »glace carrée et dorée« [viereckiger und vergoldeter Spiegel] angeschafft, da mahnt bereits die Mutter Balzac ihre Tochter Laure, sie solle ihren Bruder wegen seiner »Verschwendung« rüffeln.
Aber bei Balzac ist die Phantasie tausendfach stärker als die Realität, sein Blick kann das Unscheinbarste beleben, das Häßliche erheben. Selbst dem trüben Ausblick seiner Gefängniszelle über die grauen Dächer von Paris vermag er Tröstung abzugewinnen.
Ich erinnere mich, wie fröhlich ich mir mein Brot in die Milch brockte, vor meinem Fenster sitzend und die Luft einatmend; meine Augen schweiften über eine Landschaft von braunen, hellgrauen und roten Dächern aus Schiefer oder Ziegeln, bedeckt mit gelblichem oder grünem Moos. Anfangs schien mir diese Aussicht einförmig, aber bald entdeckte ich eigentümliche Schönheiten: jetzt den im Strahlenglanz aufleuchtenden Abend, in dem schlecht geschlossene Fensterläden die schwarzen Tiefen dieser eigentümlichen Landschaft markierten, dann wieder den blassen Schein der Straßenlaternen, die unten ihre gelblichen Reflexe durch den Nebel warfen und anklagend mit ihrem schwachen Licht auf den Straßen die Wellen der zusammengedrückten Dächer wiedergaben, ein Nebelmeer der Architektur; zuweilen tauchten inmitten dieser trübseligen Öde seltsame Gestalten auf. Unter den Blumen irgendeines Dachgartens sah ich das scharfe hakenförmige Profil einer alten Frau, die ihre Kapuzinerkresse sprengte, im Rahmen eines morschen Dachfensters ein junges Mädchen bei der Toilette, das glaubte unbeobachtet zu sein; ich sah nur ihre schöne Stirn und ihre langen Flechten, die sie mit anmutigen weißen Armen ins Licht hob. Ich bewunderte die vergänglichen Gewächse in den Dachrinnen, armselige Gräser, die vielleicht ein Sturmwind hier heraufgetragen hatte. Ich studierte die Moose, ihre Farben, die der Regen belebte und die in der Sonne sich in trockenen Samt verwandelten, braun, mit launischen Reflexen. Endlich die poetischen und flüchtigen Eindrücke des Tages, die Trauer des Nebels, das plötzliche Aufbrechen der Sonne, das Schweigen und die Magie der Nacht, die Mysterien des Sonnenaufganges, den Rauch der Schornsteine – alle Ereignisse dieser eigentümlichen Natur wurden mir vertraut und unterhielten mich. Ich liebte mein Gefängnis. Ich war freiwillig dort. Diese Savannen von Paris, gebildet von den wie eine Ebene ausgestreckten gleichförmigen Dächern über dem Abgrund des Lebens darunter – sie gingen in meine Seele ein und vermischten sich mit meinen Phantasien.
(La Peau de Chagrin)
Und wenn er an einem schönen Tag sein Zimmer verläßt, um – das einzige Vergnügen, das er sich erlauben darf, weil es nichts kostet – den Boulevard Bourdon gegen den Faubourg St-Antoine entlangzuschlendern und etwas frische Luft in die Lungen zu ziehen, so wird ihm diese kurze Promenade zu Ansporn und Erlebnis.
Eine einzige Leidenschaft riß mich aus meinen Studien heraus – aber gehörte sie nicht eigentlich zu ihnen? Ich begann das Treiben des Faubourg zu beobachten, seine Bewohner, seine Charaktere. Ebenso schlecht gekleidet wie die Arbeiter der Gegend, gleichgültig gegen jeden äußeren Anstand, traf ich mich mit ihnen, ohne daß sie irgendwelche Zurückhaltung beobachtet hätten. Ich konnte mich unter ihre Gruppen mischen, ich sah sie ihre Einkäufe abschließen, ich hörte ihre Debatten zu der Zeit, da sie von der Arbeit kamen. Ganz intuitiv war mir diese Beobachtung bereits geworden, ich drang in die Seelen ein, ohne das Äußere zu vernachlässigen, oder erfaßte vielmehr diese äußeren Züge so gut, daß meine Beobachtung sogleich darüber hinausging; sie gab mir die Fähigkeit, das Leben des betreffenden Individuums mitzuleben, so wie es es führte, sie erlaubte mir, mich an seine Stelle zu setzen, so wie jener Derwisch aus Tausendundeiner Nacht die Gestalt und die Seele der Menschen annahm, über die er seine Zauberformel aussprach …
Ich verstand mich mit diesen Leuten, ich vermählte mich mit ihrem Leben, ich fühlte ihre Lumpen auf meinen Schultern, meine Füße liefen in ihren durchlöcherten Schuhen; ihre Wünsche, ihre Nöte gingen durch meine Seele oder meine Seele ging in die ihre über. Es war eine Art Wachtraum. Ich ereiferte mich mit ihnen über die Betriebsleiter, von denen sie tyrannisiert wurden, oder über die häßlichen Kniffe, mit denen man sie zwang, mehrere Male wiederzukommen, ohne ihnen ihr Geld auszuzahlen. Meine eigenen Gewohnheiten aufzugeben, ein anderer zu werden in einer Art Trunkenheit meiner moralischen Kräfte, und dieses Spiel nach Belieben zu spielen: das war meine Unterhaltung. Wem verdanke ich diese Gabe? Ist es eine Art von Zweitem Gesicht? Ist es eine der Eigenschaften, deren Mißbrauch an den Wahnsinn angrenzen kann? Ich habe niemals den Ursachen dieses Vermögens nachgeforscht; ich besaß diese Fähigkeit, und ich bediente mich ihrer –, das war alles. Wichtig war nur, daß ich seit jener Zeit die Elemente jener zusammengesetzten Masse, die man »das Volk« nennt, in ihre Teile zerlegt hatte, daß ich sie analysiert hatte und ihre guten und schlechten Eigenschaften zu unterscheiden vermochte. Ich wußte wohl, wozu dieser Faubourg mir nützlich war, dieses Seminar der Revolutionen, mit seinen Helden, seinen Erfindern, seinen praktischen Weisen, seinen Schuften, Verbrechern, seinen Tugenden und Lastern, alle zusammengedrängt durch das Elend, gedämpft durch die Not, ertränkt in Wein und verbraucht durch den Branntwein. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Abenteuer in dieser Stadt der Schmerzen unbeachtet sich abspielen, welche schnell vergessenen Dramen! Was für schreckliche und was für schöne Dinge man da sieht! Die Phantasie reicht nie an die Wirklichkeit heran, die sich da verbirgt und die niemand entdeckt; man muß zu tief hinabsteigen, um diese bewundernswerten Szenen zu finden, Tragödien oder Komödien, Meisterwerke, die der Zufall gebiert. (Facino Cane)
Die Bücher in seinem Zimmer, die Menschen auf der Straße und ein Auge, das alles durchdringt, Gedanken und Geschehnis, das ist genug, um eine Welt aufzubauen; vom Augenblick, da Balzac zu arbeiten beginnt, gibt es nichts Wirkliches um ihn als die eigene Schöpfung.
Die ersten paar Tage der teuer erkauften Freiheit verwendet Balzac, um die Stätte, die triste Stätte seiner künftigen Unsterblichkeit, bereitzumachen für die Arbeit. Er verschmäht nicht, eigenhändig die fleckigen Wände zu kalken und zu tapezieren. Er stellt seine paar mitgebrachten Bücher auf, holt sich andere aus der Bibliothek, er schichtet die weißen Blätter für das eigene kommende Meisterwerk, er schneidet sich Federn zurecht, er kauft eine Kerze, der als Leuchter eine leere Flasche zubestimmt ist, er besorgt sich Öl für die Lampe, welche die nächtliche Sonne in der unendlichen Wüste seiner Arbeit sein soll.
Alles ist jetzt bereit. Nur eines fehlt noch, eine nicht unbeträchtliche Kleinigkeit – nämlich der zukünftige Dichter weiß noch gar nicht, was er eigentlich dichten soll. Er hat diesen erstaunlichen Entschluß, sich in eine Höhle einzugraben und sie nicht früher zu verlassen, ehe nicht ein Meisterwerk vollendet ist, aus einem bloßen Instinkt gefaßt. Nun, da er beginnen soll, hat er keinen bestimmten Arbeitsplan oder vielmehr, er tastet an hundert vagen und unausgegorenen Plänen herum. Der Ein- undzwanzigjährige hat keine klare Idee, was er eigentlich ist und werden will – ein Philosoph, ein Poet, ein Romanschriftsteller, ein Dramatiker oder ein Mann der Wissenschaft. Er spürt nichts als eine Kraft in sich, ohne zu wissen, wohin sie zu wenden.
Ich fühlte in mir den Glauben, ich hätte einen Gedanken auszudrücken, ein System aufzubauen, eine Wissenschaft darzulegen.
Aber welchem Gedanken, welchem System, welcher Dichtungsart sich zuerst hingeben? Der innere Pol ist noch nicht gefunden, unruhig zittert die Magnetnadel des Willens hin und her. Er blättert in den mitgebrachten Manuskripten. Alle sind Fragmente, keines vollendet, und keines scheint ihm der richtige Ansatz für den Sprung in die Unsterblichkeit. Da sind ein paar Hefte ›Notes sur l’immortalité de l’âme‹ [›Bemerkungen über die Unsterblichkeit der Seele‹], ›Notes sur la philosophie et la religion‹ [›Bemerkungen zur Philosophie und zur Religion‹], teils Notizen aus Kolleg und Lektüre, teils eigene Konzepte, in denen nur die eine Bemerkung überrascht: »Nach meiner Tragödie werde ich das wieder aufnehmen.« Da sind verstreute Verse, der Beginn eines gereimten Epos »Saint Louis«, Vorstudien zu einer Tragödie »Sylla« und zu einer Komödie »Les deux Philosophes« [›Die beiden Philosophen‹]. Eine Zeitlang plant er einen Roman ›Coqsigrue‹, einen Briefroman ›Sténie ou les Erreurs philosophiques‹ [›Sténie oder Die Irrtümer der Philosophie‹] und einen anderen »dans le genre antique« [in der antiken Art] namens ›Stella‹; zwischendurch schiebt sich ein Entwurf zu einer komischen Oper ›Le Corsaire‹ [›Der Korsar‹]: immer unsicherer wird bei dieser enttäuschenden Übersicht Balzac, womit er jetzt beginnen soll. Wird es ein philosophisches System, ein Vorstadtopernlibretto, ein romantisches Epos oder ein Roman sein, der den Namen Balzac in die Welt trägt? Zunächst aber nur überhaupt etwas schreiben, irgend etwas zu Ende bringen, was ihn berühmt und von der Familie unabhängig macht! Mit dem ihm eigenen Furor durchwühlt und durchliest er ganze Reihen von Bänden, teils um einen Stoff ausfindig zu machen und gleichzeitig, um von anderen die handwerkliche Technik zu erlernen.
Ich tat nichts als studieren und meinen Stil formen, bis ich glaubte, ich würde den Verstand verlieren,
schreibt er seiner Schwester Laure. Allmählich jedoch beginnt die Zeit zu drängen. Zwei Monate sind mit Suchen oder Versuchen vertan, und die Rente ist unbarmherzig begrenzt. So wird der Plan des philosophischen Werkes aufgeschoben, vermutlich weil es zu umständlich und zuwenig einträglich wäre; für einen Roman fühlt er die Kräfte noch nicht zureichend. Bleibt das Drama – selbstverständlich muß es ein historisches, ein neoklassisches sein, wie sie Schiller, Alfieri, Marie Joseph Chénier in die Mode gebracht haben, ein Drama für die Comédie Française; abermals holt und durchackert er aus dem Lesekabinett Dutzende von Büchern. Ein Königreich für einen Stoff!
Endlich fällt die Wahl. Am 6. September 1819 berichtet er der Schwester:
Ich habe endlich bei dem Thema »Cromwell« haltgemacht, und ich habe es gewählt, weil es der schönste Stoff der ganzen modernen Geschichte ist. Seitdem ich dieses Thema angepackt und überdacht habe, bin ich bis zur Besinnungslosigkeit darüber hergestürzt. Die Einfälle häufen sich in meinem Kopfe, aber ich werde immer wieder aufgehalten durch meine geringe Begabung für die Verskunst …
Zittre aber, liebe Schwester; ich brauche mindestens noch sieben bis acht Monate, um das Stück in Verse zu bringen, um meine Erfindungen auszugestalten, und dann, um sie auszufeilen … Ach, wenn du wüßtest, wie es bei solchen Werken Schwierigkeiten regnet! Der große Racine, und das sollte dir ein genügendes Bild geben, brachte zwei Jahre mit dem Ausfeilen seiner »Phaedra« zu, die jeden Dichter zur Verzweiflung bringt. Aber zwei ganze Jahre! Zwei Jahre – stell dir das vor: zwei Jahre!
Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Ohne Genie bin ich verloren! –
also muß er Genie haben. Zum erstenmal hat sich Balzac eine Aufgabe gestellt und seinen unbezwinglichen Willen ins Spiel geworfen. Wo dieser Wille wirkt, gibt es keinen Widerstand. Balzac weiß, er wird Cromwell vollenden, weil er ihn vollenden will und weil er ihn vollenden muß.
Ich bin entschlossen, mit dem »Cromwell« zu Ende zu kommen, und wenn ich bersten müßte. Ich muß etwas fertigstellen, bevor Mama kommt und von mir Rechenschaft über meine Zeit verlangt.
Balzac wirft sich in die Arbeit mit jener monomanischen Energie, von der er einmal sagte, daß selbst die erbittertsten seiner Feinde sie ihm nicht streitig machen könnten. Zum erstenmal verhängt er über sich jene mönchische und sogar trappistische Klausur, die er während aller intensiven Arbeitsepochen seines Lebens sich zur ehernen Regel gesetzt hat. Tag und Nacht sitzt er am Schreibtisch, oft verläßt er eine halbe Woche nicht die Mansarde, und auch dann nur, um sich Brot, etwas Obst und frischen Kaffee zu kaufen, dieses unentbehrliche Stimulans seiner ermüdeten Nerven. Allmählich kommt der Winter, und die Finger, seit je empfindlich gegen die Kälte, drohen zu erstarren in der zugigen ungeheizten Dachkammer. Aber Balzacs fanatischer Wille gibt nicht nach. Er weicht nicht vom Schreibtisch, die Füße zugedeckt mit einer alten Wolldecke des Vaters, die Brust geschützt mit einer Flanellweste. Von der Schwester erbettelt er »irgendeinen uralten Schal«, damit er die Schultern bei der Arbeit einwickeln kann, von der Mutter eine Kappe, die sie ihm stricken soll, und nur um das teuere Brennholz zu sparen, bleibt er ganze Tage im Bett, um weiterzuschreiben an seiner göttlichen Tragödie. Alle diese Widrigkeiten vermögen seinen Willen nicht zu brechen, und einzig die Angst vor den Ausgaben für das teure Brennöl läßt ihn zittern, weil er bei dem frühen Einbruch der Dunkelheit schon um drei Uhr nachmittags die Lampe entzünden muß. Sonst wäre Tag und Nacht ihm gleichgültig: sie dienen beide nur der Arbeit.
Während all dieser Zeit keine Freunde, keine Frauen, keine Restaurants, keine Kaffeehäuser, keine einzige Entspannung inmitten dieser ungeheuren Anspannung. An Frauen wagt sich der Zwanzigjährige aus einer lange anhaltenden Timidität nicht heran. Er hat in all den Internaten nur unter Burschen gelebt und weiß sich ungeschickt. Er kann nicht tanzen, hat nicht gelernt, sich in guter Gesellschaft zu bewegen, er weiß sich dank der häuslichen Sparsamkeit schlecht gekleidet. Dazu kommt, daß Balzac gerade in diesem Übergangsalter unvorteilhaft wirkt; ebenso durch seine physische Erscheinung wie durch seine Vernachlässigung. Ein Bekannter aus jenen Jahren nennt ihn sogar auffallend häßlich:
Balzac war damals von besonderer und sehr auffallender Häßlichkeit, trotz seiner kleinen, von Geist funkelnden Augen. Eine dicke, untersetzte Gestalt, schwarze unordentliche Haare, eine knochige Figur, großer Mund, schadhafte Zähne.
Da er überdies jeden Sou dreimal umwenden muß, ehe er ihn aus den Fingern lassen darf, fehlen schon die primitivsten Vorbedingungen für Bekanntschaften. An den Kaffeehäusern, wo die jungen Journalisten und Schriftsteller beisammensitzen, und gar an den Restaurants darf er höchstens von außen sein hungriges Gesicht in den Scheiben spiegeln; von all den Vergnügungen, den Freuden, den Prächten der Millionenstadt ist dem freiwilligen Mönch der Rue Lesdignières in all diesen Monaten auch nicht die flüchtigste erreichbar.
Ein einziger Mann nimmt sich ab und zu des Vereinsamten an, der »petit père Dablin« [der kleine Vater Dablin]. Als alter Freund der Familie hat dieser wackere Bürger, seines Zeichens ein Quincailler, ein Eisenwarenhändler en gros, es sich zur Pflicht gemacht, sich ein wenig um den armen Aspiranten der Dichtkunst zu kümmern. Allmählich entwickelt sich daraus eine rührend vorsorgliche Freundschaft des älteren Herrn für den verlassenen Jungen, eine Freundschaft, die dann über Balzacs ganzes Leben andauert. Obwohl nichts als ein kleiner Händler der Vorstadt, hat dieser wackere Mann eine rührende Ehrfurcht vor der Dichtkunst; die Comédie Française ist sein Tempel, in den er manchmal, wenn die nüchternen Geschäfte der Quincaillerie beendet sind, den jungen Poeten mitnimmt, und diese Abende mit einem ausgiebigen Essen vor der Pracht der Racineschen Verse sind die einzige erfrischende körperliche und geistige Nahrung seines dankbaren Gastes. Le petit père Dablin steigt jede Woche mutig die fünf Stockwerke zur Mansarde hinauf, um nach seinem Schützling zu sehen, er nimmt mit dem schlechten Schüler des Collège Vendôme noch einmal lateinische Aufgaben durch, um sich selbst zu bilden. In ihm erkennt Balzac, der bisher in der eigenen Familie nur die Sparwut und subalterne Ambition des Kleinbürgertums gekannt hat – er wird sie mit brennendem Griffel verewigen in seinen Romanen – das heimliche Ethos, das oft in solchen unbekannten Figuren des Mittelstandes reiner waltet als in den professionellen Schreiern und Schreibern der Literatur. Und wie er später in seinem César Birotteau das Hohelied des kleinen rechtlichen Bürgers anstimmt, fügt er dankbar eine Strophe zum Ruhm dieses seines ersten Helfers ein, der mit seinem
ganz innerlichen Empfindungsvermögen, das phrasenlos und ohne Übertreibung war,
alle Not seiner jugendlichen Unsicherheiten verstanden und gelindert hat. In der transponierten Gestalt des gütigen, bescheidenen und unscheinbaren Notars Pillerault ist uns die liebenswerte Figur dieses »petit père Dablin« nahegeblieben, dieses Mannes, der trotz des engen Horizonts seines Bürgerberufs aus einer Intuition des Herzens Balzacs Genie zehn Jahre früher geahnt und erkannt hat, als Paris, die Literatur und die Welt ihn sich zu entdecken entschlossen.
Dieser einzige Mensch, der sich um ihn kümmert, kann ab und zu Balzacs ungeheure Verlassenheit äußerlich entlasten; aber die verhängnisvolle Qual der inneren Unsicherheit kann er dem unbelehrten, dem unerfahrenen Dichter nicht abnehmen. Balzac schreibt und schreibt mit pochenden Schläfen, mit fiebrigen Händen in einem einzigen Rausch der Ungeduld: sein Cromwell muß um jeden Preis in einigen Wochen vollendet sein. Aber dazwischen kommen jene jedem Anfänger, der ohne Freunde und Berater schafft, so furchtbaren wachen Augenblicke, in denen er an sich, an seinen Fähigkeiten, an seinem eigenen, erst werdenden Werke zu zweifeln beginnt. Unablässig fragt sich Balzac: »Habe ich auch genug Talent?« und er fleht die Schwester in einem Briefe an, ihn nicht mit einem mitleidigen Lob irrezumachen:
Bei der schwesterlichen Liebe, die du für mich hast, beschwöre ich dich: sage mir nie, wenn du über eine meiner Arbeiten mit mir sprichst: Das ist gut! Du sollst mich nur auf meine Fehler hinweisen; dein Loben behalte für dich.
Dieser glühende junge Mensch will doch nichts Mittelmäßiges, nichts Gewöhnliches schaffen.
Zum Teufel mit der Mittelmäßigkeit! – ruft er aus. – Man muß ein Grétry werden, ein Racine!
In manchen Augenblicken freilich, noch umnebelt von der feurigen Wolke des Schaffens, scheint ihm sein Cromwell großartig, und er verkündet stolz:
Meine Tragödie soll das Brevier der Könige und Völker werden. Ich will mit einem Meisterwerk debütieren oder mir den Hals brechen.
Dann kommt wieder ein Moment des Verzagens:
All meine Kümmernisse stammen daher, daß ich einsehe, wie wenig Talent ich besitze.
Ist nicht sein ganzer Fleiß vielleicht vergeblich? Denn was gilt Fleiß allein in der Kunst …
Alle Arbeit der Welt kann einem nicht ein Körnchen Genie ersetzen.
Je mehr sich der Cromwell der Fertigstellung nähert, um so qualvoller wird für den Einsamen die Frage, ob die Tragödie unter seinen Händen ein Meisterwerk wird oder eine Niete.
Verhängnisvollerweise hat Balzacs Cromwell





























