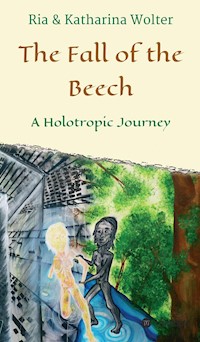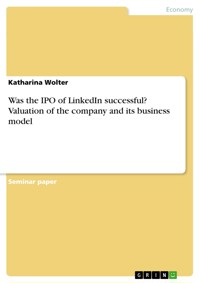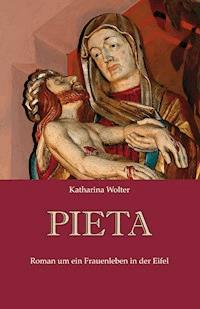Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bauernbrot und Matzen sind in Katharina Wolters Erinnerung Symbole für die beiden Kulturen, die in ihrem Eifeldorf noch in den 20er und 30er Jahren das Leben bestimmten. Das Bauernbrot steht für die christliche Mehrheit, der Matzen, das ungesäuerte Passahbrot, für die jüdische Minderheit. Das Dorfleben der durchweg sehr gläubigen Menschen wird geprägt von der Kirche und der Synagoge, von den Regeln und Verboten der jeweiligen Religion. Eingebunden in diese traditionellen Werte und in ein Geflecht von verwandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Beziehungen wachsen auch Julia und Josef als Nachbarskinder auf. Das jüdische Mädchen und der christliche Junge werden heimlich ein Paar, gegen die Sitten- und Moralvorstellungen beider Seiten und gegen die Rassengesetze des Nationalsozialismus, dessen Barbarei schließlich auch die Juden aus dem Eifeldorf ins KZ bringt. Die Herzen der Liebenden aber wollen zusammenkommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 1995 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-797-8 Titelgrafik: Regina Melsheimer
Katharina Wolter
Bauernbrot und Matzen
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Dieses Buch ist gewidmet den Menschen meiner Heimat. Mein Dank gilt allen, die mir dazu Anregungen und Hilfe gaben.
Vorwort
Im Land zwischen Elz und Endert liegt das Zentrum meiner Geschichte. Es ist eine Landschaft, die von der Mosel und diesen beiden Bachtälern an drei Seiten umgrenzt, westlich zur Eifel hin ansteigend offen ist. Die Zeit ist nicht stehen geblieben in diesem Landstrich und allen angrenzenden Gebieten, die vor knapp dreißig Jahren noch vorwiegend von bäuerlichen Familienbetrieben geprägt waren. Der älteren Generation wird es sicherlich nicht schwerfallen, sich in diesen Roman mit seinen Menschen und deren Schicksal, ihren Sitten und Gebräuchen, hineinzufinden und vielleicht ein Stück ihres eigenen Lebens wiederzuerkennen. Er ist der Versuch, einen Teil unserer Heimatgeschichte in Erzählform festzuhalten und auch, den jüngeren Leuten ihre Vorfahren etwas näher zu bringen.
»Ich weiß nicht, wie es früher hier war.« Diesen Satz hörte ich kürzlich von einem jungen Mann, der als Computerexperte in einer Großstadt arbeitet, dessen Großeltern noch einen schönen, alten Bauernhof hier bewirtschafteten. Und es wollte mir scheinen, als klänge ein leises Bedauern in seiner Stimme mit.
Es geht mir nicht in erster Linie darum, in Nostalgie oder Heimattümelei zu schwelgen, denn die Neuzeit hat uns Fortschritt und Weltoffenheit gelehrt. Auch manch überflüssiger, alter Zopf ist bis auf wenige Reste abgeschnitten; zum Beispiel ist der althergebrachte Standesdünkel für die jungen Leute kaum noch von Bedeutung. Aber wenn wir uns auf unsere eigene, in vielen Lebensbereichen wertvolle alte Kultur besinnen, zu der auch die jüdischen Mitbürger ihren Beitrag leisteten, kann es eine innere Bereicherung sein. Wie es hier aussah, wie die Menschen unter den wechselnden Regierungen und Herrschern sich mit harter Arbeit und viel Lebensmut ihren Lebensunterhalt erwarben, wie sie liebten, lebten und starben, wie sie sich mit Andersgläubigen, Behinderten und Fremdarbeitern zu arrangieren verstanden, oder auch nicht, können Sie in diesem Buche lesen.
Katharina Wolter
***
Die Figuren in diesem Roman sind von mir frei erfunden. Sie entsprechen nicht wirklichen, lebenden Personen. K. Wolter
Welche Hof
Es ist ein Sommersonntagnachmittag, Apollonia sitzt auf der grobgezimmerten Holzbank hinter der Scheune. Sie lehnt ihren Rücken an die sonnenheiße Mauer. Das nimmt die Schmerzen weg, das tut gut, einmal so still sitzen und das vom vielen Schaffen und Bücken malträtierte Kreuz wohlig an den heißen Schiefer drücken. Wie gut, daß es den Sonntag gibt, und extra gut ist der Sonntagnachmittag. Der Sonntagmorgen hat keine freie Minute, fast noch früher als an Werktagen muß sie da aus den Federn, melken, Schweine und Kühe füttern, Kinder waschen und ankleiden, sich selber sonntäglich anziehen. Dann richtet sie noch das Mittagessen vor. Öhm Dunn (Onkel Anton), der inzwischen aus der Frühmesse heimgekommen ist, muß nun darauf achten, während Apollonia mit den beiden Kindern den Weg zur Pfarrkirche einschlägt, dem Glockengeläute zustrebt, um mit der ganzen Gemeinde das Hochamt zu feiern. Auch der Heimweg ist gut und schön, falls das Wetter so warm und klar ist wie heute. Gemeinsam gehen mit Nachbarn oder anderen Dorfleuten, die sich heute, aus der verschwitzten Alltagskluft geschält, im sorgsam gehüteten Sonntagsstaat mit blankgewichsten Sonntagsschuhen, gestärkt durch Evangelium und Predigt, gemeinsames Beten und Singen samt Weihrauchduft, in gelösterer Stimmung einander zuwenden und grüßen, als es in schweren Nagelschuhen an arbeitsgeschwängerten Werktagen möglich ist. Oft ist es für Loni die einzige Möglichkeit, einmal unter Menschen zu kommen. Nun aber ruht sie sich aus, schließt die Augen, und der Duft von frischem Heu und blühendem Holunder vermischt sich mit den Kinderstimmen da irgendwo hinter den Haselnußhecken zu einem angenehmen Dämmerzustand in ihrem Kopf. Und auf dem kargen Bänklein, welches, von blühenden Taubnesseln und einem uralten Fliederbusch umwuchert, gerade zwei Leuten Platz bietet, sitzt auf einmal Peter neben ihr, drückt ihre Finger und sagt ihr ins Ohr:
»Loni, ich han dich so gern.«
Immer ist das so mit ihr, sobald sie ein wenig einschlummert und die Träume kommen. Erst wenn sie erwacht, fällt es ihr ein: Peter ist tot, ich bin allein, Peter liegt in Flandern, ich lebe hier in der Eifel in Peters Elternhaus mit unseren beiden Kindern, Josef und Annchen.
Im Haus wohnt auch noch Anton Welch, der Bruder ihres verstorbenen Schwiegervaters, unverheiratet, Mitbesitzer des Hofes, Öhm Dunn genannt. Ohne ihn hätte sie nach dem Krieg kaum weiterwirtschaften können. In den Hof hineingeboren, inmitten von sieben Geschwistern aufgewachsen, hat er diesen nie verlassen, hat in der Familie seines verheirateten Bruders als Schwager und Onkel dessen Felder, Vieh und Kinder mitbetreut, er gehört einfach zum Haus. Als sein Neffe Peter in den Krieg mußte, ging Apollonia mit ihrem zweiten Kind schwanger. Zu schwer wurden ihr die Futtereimer, die sie zu den Schweinetrögen schleppte, und Öhm Dunn nahm sie ihr ab. Er umgab sie mit Fürsorglichkeit und Treue, verrichtete neben der vielen Feldarbeit noch die schwersten Haus- und Stallarbeiten die das Leben des Ungeborenen gefährden konnten. Als eines Abends die Wehen einsetzten, rief er die Lena, Apollonias Schwägerin, die ein paar Häuser weiter wohnte, zu ihr. Flugs spannte er das Pferd vor die kleine Kutsche, jagte zum drei Kilometer entfernten Wohnort der Hebamme und holte sie ab. Bald war Loni von Helferinnen umgeben, sie wollte tapfer sein, unterdrückte lange ihr Stöhnen, um Josefchen nicht zu wecken, brach aber nach einigen langen Stunden das krampfhafte Schweigen, und ihre jammernden Rufe und Schreie nach Peter durchdrangen alle Räume und Kammern des alten Hauses. Hilflos rannte Dunn draußen in Hof und Garten hin und her, kam ins Haus, stieg ein paarmal die Treppe auf und nieder, lauschte an der Türe, hinter der sich für ihn etwas scheinbar Schreckliches abspielte. Seine Lippen murmelten Gebete. Aus der Kammer nebenan ertönte das Rufen und Weinen des kleinen Jungen. Öhm Dunn ging hin und hob ihn aus dem Bett, wickelte ihn in eine Decke und trug ihn ins Haus seiner Tante, wo er zu seinen Vettern unter das Federbett kroch. Dunn ging wieder nach Hause; dort hatte das Jammern aufgehört, aus der Küche ertönte das fröhliche Schwatzen der Frauen, die Kaffee kochten und eine Brühe für die Wöchnerin zubereiteten. Lena rief:
»Et hat alles gut jange, dat Kindje is da!«
»Un bat is et?« fragte Dunn.
»Et is e Mädche!« sagten sie.
»Gott sei Dank!« murmelte er, stieg leise die Holztreppe hoch, öffnete eine Spaltbreit die Türe, sah Loni ruhig und erschöpft daliegen. Neben ihr auf dem Kissen ein weißes Bündel, an einer Stelle lugte ein winziges Händchen hervor, welches sich sachte bewegte. Loni sah das treue Gesicht an der Türe und sagte:
»Dunn, mir han e Mädche, – dou muß mir helfe, et großziehen bis seine Vadter haamkimmt, – un – Dankeschön für alles, Öhm Dunn.« Der schluckte vor Verlegenheit:
»Et is nix zu danken, net dat ich wüßt, net dat et der Red wert is. Gonacht, Loni, schlaf gut.«
All dieses geht Apollonia durch den Kopf. Es ist heute fast nur Gutes das ihr in den Sinn kommt, bedingt durch den friedlichen Nachmittag an dem sie ausruhen darf. Der herbe Schmerz ist heute nicht mehr so heftig wie er es einmal war damals, als der Briefträger das Schreiben mit der Todesbotschaft ins Haus brachte. Heute ist es die Liebe, die sie heraushebt aus ihrem harten Leben, die läßt die Vergangenheit zur Gegenwart werden, Peter lebt für sie, für andere mag er tot sein. Mit ihm bespricht sie alles, und er versteht alles was sie sagt. Sie wird aus dem Schlaf gerissen als zwei Kinderarme ihre Knie umspannen, ein blonder ›Struwwelkopp‹ drückt sich in ihren Schoß:
»Modter, Modter!«
»Anntje, mein Anntje.« Sie zieht das Kind auf die Knie und fragt:
»Habt ihr schön jespielt?«
»Ja, mit Jupp und Julche, dat Julche war die Modter, un der Jupp war de Vadter, un ich war dat Kind, mir han in der Heck e Häusje jebaut, die hatten Gemüs aus Unkrautblätter jekocht, dat hat fies jeschmeckt. Modter, mach mir e Bottersteck met Schelee, ich han Hunger.«
»Ja ja, mein Levje, ich jien eweil in die Küch und kochen Kaffi, dann trinken mir all zusammen Kaffi, dann kriegt mein Kind e Weißbrotstück mit Butter und Bremeleschelee (Brombeergelee), dat schmackt dir, mmm, dat schmackt!«
»Au ja!« schreit Annchen, rennt zur Hecke in der die anderen Kinder noch hocken: »Kummt Kaffitrinke! Et jet Weißbrot un Bremeleschelee!« Aus der dichten Haselnußhecke tauchen nacheinander vier Gesichter auf. Josef, der ältere Bruder, kräftig, blond und blauäugig, an der Hand zieht er Julia nach sich, ein Nachbarskind, vom Typ her das genaue Gegenteil, sehr zierlich, mit peschschwarzem, krausem Haar und großen, dunklen Augen. Es folgen Benni und Max, Julias Brüder, zwei aufgeweckte Buben, pfiffige Gesichter mit schwarzen Knopfaugen. Sie sind immer gleich gekleidet und sehen in ihren großkarierten Sweatern aus feinster englischer Wolle wie Zwillinge aus. Aber Max ist ein Jahr älter als Benni, der ist so alt wie Josef. Max sagt ganz streng:
»Julche du gehst mit nach Hause, de Mama will net, daß de jeden Tag mit an Welche Tisch sitzt, Kinder sollen daheim essen.«
»Nix da! Et Julche jeht mit mir!« Josef sagt das kurzerhand, läuft mit der Kleinen an der Hand über die Wiese dem Hause zu, und Annchen hampelt hinterher.
»Laß se doch«, meint Benni, »gehn wir heim Kaffeetrinke, de Mama hat vom Schawwes noch en halbe Kuche, davon kriegt se dann nix mehr.« Einträchtig trotten die beiden einer hohen, saubergeschnittenen Gartenhecke zu, die die Grenze zum Nachbargrundstück bildet. Sie schlüpfen durch eine Lücke in den Garten ihrer Eltern, der sich, mit den besten Gemüsen, duftenden Kräutern und Blumen bepflanzt, bis zum Hause ihres Vaters Jakob Wolf erstreckt. Der führt mit Sara seiner Frau, ein wohlbestelltes, frommes, jüdisches Haus. Die zwei Buben stürmen durch die Hintertüre hinein in den langen dämmrigen Flur, der in eine große, gemütliche, von Kaffeeduft erfüllte Wohnküche mündet.
»Seid doch net so wild,« ruft Mama Sara, »wascht euch die Händ, bevor ihr euch an de Tisch setzt!«
Vater Jakob unterstützt die Worte der Mutter mit einem einzigen strengen, aber wohlwollenden Blick. Kurz darauf sitzen Benni und Max zwischen Mama und Tante Malchen (Amalie), die zu Besuch ist, am Tisch. Sara fragt:
»Wo bleibt‘s Julche?«
»Der Josef hat se wieder mitgeschleppt.«
»Wer ist das denn?« will die Tante wissen, darauf sagt Sara:
«Es is der Nachbarsjung. ‘S is e braver Jung, sind brave Leut, die Welche Leut.«
»So, so«, meint Tante Malchen spitz, »‘s sind aber Christeleut« und jetzt spuckt sie auf den Boden: »Gojim![1]«
»Maal, – sei ruhig!« sagt Jakob Wolf bedächtig, aber mit Nachdruck, »red net so e dumm Zeug vor de Kinder, wir wissen selber mit wem se spielen dürfen, brave Leut sind de Welche Leut.«
***
[1] jüd. Bezeichnung des Nichtjuden
Hummeshof
Ein Haus weiter wohnt die Familie Rupert. Sie bewirtschaftet einen etwas größeren Bauernhof als Apollonia und Öhm Dunn. Werner Rupert, der junge Hummesbauer, stammt aus dem Schwabenland. Er ist ein ›Zugezogener‹, ein wenig ein Fremder geblieben auch nach einer Reihe von Jahren, die er in dem Eifeldorf lebt. Dina, die einzige Tochter des alten Hummesbauern, deren Bruder im Krieg gefallen ist, hat den Fremden geheiratet, gegen den Willen ihrer Eltern. Irgendwann war er als Soldat in den Hof einquartiert worden und hatte sich in die schöne Bauerntochter verliebt. Den Soldaten gefiel es gut auf dem Hummeshof. Sie wurden gut bewirtet, und der Bauer saß abends mit ihnen in der warmen Stube, erzählte von ›Siebzig – Einundsiebzig‹, wo er als blutjunger Rekrut die erstaunlichsten Heldentaten begangen haben mußte, wenn man ihm Glauben schenken wollte. Der ihm am lautesten Beifall zollte, war Werner Rupert, der schneidige Unteroffizier. Das gefiel dem Bauern, zumal ihm auch die stolze Erscheinung des jungen Mannes imponierte.
»Der hat Gardemaß, der ist mindestens einsachtundneunzig«, sagte er, und Dina dachte:
»Ja, der sieht prima aus, so einen find ich hier in der ganze Gegend net.«
Sie merkte sehr gut, daß sie ihm gefiel; er folgte ihr auf Schritt und Tritt, sobald sie das Haus verließ und sich in den Ställen zu schaffen machte, seine dunklen Augen verschlangen sie förmlich. Jedoch sie war zurückhaltend, wie sich das für ein christliche Jungfrau nun mal gehört. Er aber dachte sich eine List aus. Eines abends, als Dina beim Kühemelken war, sie hatte den fast vollen Melkeimer zwischen die Knie geklemmt, schlich er sich von hinten an sie heran, packte ihren Kopf mit zwei Händen, bog ihn nach hinten und küßte sie, solange er wollte. Sie war machtlos. Normalerweise wäre sie verpflichtet gewesen, den fremden Soldaten zu ohrfeigen, aber sie mußte doch den Milcheimer festhalten, so ohne weiteres verschüttet eine Eifelerin keinen Eimer Milch, da nahm sie doch lieber den Kuß in Kauf, der außerdem gar nicht so übel schmeckte. Im Gegenteil, als er sie endlich losließ, erhob sie sich, brachte schnell den Eimer in Sicherheit, umschlang nun ihrerseits den Hals des Unteroffiziers, um das Küssen weiterzuüben. Sie war am Ende verliebt bis über beide Ohren. War das ein schöner Mann! – Und so groß und stark! Er hob sie hoch wie eine Feder, so daß sie mit dem Kopf an die Kuhstalldecke stieß.
»Au«, schrie sie lachend und zappelte in seinen ausgestreckten Armen wie eine Puppe, »dou Flapbes[2], laß mich erunner!«
Er ließ sie sachte an seinen Uniformknöpfen heruntergleiten, sie war auf einmal ganz wehrlos, überließ sich seinen Liebkosungen.
Als dann draußen jemand »Dina!« rief, machte sie sich los, ergriff den Milcheimer und rannte ins Haus. Am Tage darauf kam der Marschbefehl. Die Kompanie rückte aus, singend marschierten sie zum Dörfchen hinaus; und es war wie immer und zu allen Zeiten, wenn von den Mächtigen ein Krieg angezettelt war, die Mädchen standen und winkten, konnten ihre Jungs nicht festhalten.
»Dina, ich schreibe dir!« schrie Werner, der neben der Kompanie ging und so lange winkte, bis er um die Ecke verschunden war; und der frisch-fröhliche Gesang aus hundert Kehlen verklang im fernen Morgengrauen. Von der Front kamen bald Briefe für Dina, lange, romantische Liebesbriefe, die ihr großen Eindruck machten. Liebesbeteuerungen, Versprechungen, die kein Mensch halten kann, aber Dina glaubte daran.
»Bee schien der schreiwe kann und wat für en jelehrte Handschrift der hat«, sagte Dina zu ihrer Mutter.
»Ei, dann laß mich emol gucke«, sagte die, schaute in den Brief und war perplex.
»Dat is ja –, ei Dunnerwedder, dat is ja en Liebesbrief, laß den aber nur net dein Vadter sehn!«
»Wat darf ich net sehn, hä? Wat hat dir Weiwer widder für Jeheimnisse vor mir?« Der ›Humme‹ war unbemerkt hereingekommen.
»Nix, joarnix«, sagte Dina schnell und hielt den Brief hinter sich.
»Her damit!« sagte ihr Vater, bog ihren Arm nach vorne und entriß ihr den Brief. Auch ihm verschlug es die Sprache, ihm, dem Eifeler, dem außer einem ›ech han dech jär‹ nichts weiter eingefallen war, als er um seine Ami freite.
»Ei, wat is dat denn für en foule Schmus? Un dou schäms dich net? Un wer hat dat jeschriwwe?«
»Der Werner Rupert, der Unneroffizier, Vadter, dou konnts en doch so gut leiden«, stotterte Dina eingeschüchtert.
»Der Kerl is och in Ordnung, aber er is doch keine Bouer! Unser Karl is jefallen, wir brauchen einen, der eppes von der Bourearbeit versteht! Willste uns im Stich lasse? Schlag dir den Fremde aus em Kopp! Un so en Brief kimmt mir net mehr in et Haus! Dat du et weißt!« Und bei den letzten, grimmig hevorgestoßenen Worten hatte der Hummesvadter die Ofentüre geöffnet, und der Brief mit den heißen Liebesworten brannte lichterloh. Das Mädchen rannte in sein Zimmer, wo es sich aufs Bett warf und in ein schmerzendes, trotziges Schluchzen ausbrach. Vorerst war sie ganz ratlos und verzweifelt; dann aber, als der Vater dem Briefträger den nächsten Brief von Werner einfach aus der Hand nahm und verbrannte, faßte sie einen Entschluß und schrieb nachts heimlich an ihren Schatz, bat ihn, seine Briefe in Zukunft an ihre Freundin zu adressieren, im doppelten Umschlag natürlich, denn die brauche ja nicht alles zu lesen. »Dort kann ich sie dann unbemerkt abholen«, schrieb sie, »denn mein Vater hat mir verboten, Dir zu schreiben. Er sagt, Du hast kein Land und Du bist kein Bauer, und aus uns zweien kann nichts werden. Aber mir ist es egal, was er sagt. Ich liebe Dich, ich werde zu Dir halten, was auch geschieht. In treuer Liebe, Deine Dina.«
Von dem Tag an brachte der Postjohann keine Liebesbriefe mehr zu Hummese, aber spätabends, wenn alle schliefen, schlich Dina zum Haus ihrer Freundin, um die heißersehnten, grauen Feldpostbriefe dort abzuholen. Sie steckte sie in die Schürzentasche, lief mit klopfendem Herzen heim in ihre Kammer, um sie heimlich zu lesen und zu verstecken.
Nach dem Krieg, an einem naßkalten, frühdunklen Herbst- abend, trat ein großer, dunkler Mann in verschlissenem Soldatenmantel in die Stube des Hummeshofes. Es war Werner Rupert. Er grüßte bescheiden und freundlich, erkundigte sich besorgt nach dem Befinden des Bauern, der neben dem Ofen im Sorgenstuhl saß. Des Hummesbauern rechtes Bein war geschient und hochgelagert. Er knurrte den ihm wohlbekannten ›Fremden‹ an:
»Ich han et Bein jebrochen, verdammt viel Pein, et will un will net heilen.«
»O, das tut mir aber leid«, sagte Werner, »wie konnte das denn passieren?«
»Ech sein beim Äppelpflücke vom Baum jefallen, da war en Ast durchjebroch, un schon han ich unne jeläje, un dat Bein war kabott. Un dat eweil im Herbst, wo die meiste Arbeit is, die Weiwer sein am Krombiere ausmache (Kartoffeln ausgraben), aber et is keiner da, der ihne hilft, die Säck aufladen. Uns Karl is im Krieg jefallen, unser bester Knecht is auch jefallen; un der Kleinknecht is vorige Woch fortjelaufen, dem Lauser war et zuviel Arbeit bei uns, – un ich kann nix mache. Et Dunnerkeil soll dreinschlagen!« Der Hummesbauer fluchte abscheulich um dann wieder zu jammmern: »Oje, oje, wat dut mir mei Bein so weh!«
»Wenn es weiter nichts ist, ich helfe euch gerne eine Weile aus, wenn es euch recht ist. Ich kenne mich ein wenig in der Landwirtschaft aus, mußte als Junge oft bei den Bauern arbeiten ehe ich zum Klempner in die Lehre ging«, sagte Werner.
Ami, Dinas Mutter, war eingetreten. Froh begrüßte sie den ausgedienten Soldaten, der arg verhungert und müde dastand.
»Setz dich erst emal, tu den nasse Mantel aus, setz dich doch, ich bring dir gleich eppes zu essen, nä, nä, is dat en Überraschung! Dat Dina wird Augen machen! Et is noch im Stall am Melken.« Werner, der am liebsten gleich in den Stall gelaufen wäre, setzte sich schüchtern an den Tisch und trank dankbar den heißen Malzkaffee, aß eine Schüssel Bratkartoffeln leer und fühlte sich wunderbar, zumal nebenan in der Küche das Klappern der Milcheimer erklang und bald darauf das Singen der Zentrifuge; das eintönige Geleier war für Werner himmlische Musik. Dina! Endlich trat sie in die Stube, stand wie angewurzelt, brachte kein anderes Wort heraus wie:
»Gonówend[3].« Angstvoll blickte sie von Werner zum Vater, dann hilfesuchend zur Mutter, wiederum zum Vater. Der aber lehnte sich wehleidig in den Sorgenstuhl zurück, stöhnte nur leise:
»Oje, oje, wat soll dat nou jän?« Er war hilflos und geschlagen, getraute sich nicht, Werner fortzuschicken, die Arbeit und der Hof gingen ihm über alles. – Erst jetzt reichten sich die so lange Getrennten die Hände, trauten sich, ein paar belanglose Worte miteinander zu wechseln. Er sagte zu ihr:
»Ich helfe euch schaffen, ich hab gehört, ihr könnt einen Mann gebrauchen«, und sie sagte nur:
»Dat is gut.«
Und so kam es, daß er blieb, bleiben durfte, sich durch Fleiß und Hilfsbereitschaft unentbehrlich machte. Auf dem Kartoffelacker reichten sich Dina und Werner die Hände, kippten die schweren Säcke auf ihre Arme und lüpften sie mit »Hauruck!« auf den Wagen. Sie liebten sich heimlich, versteckten sich hinter Gattern und Strohballen, denn der Alte war wieder mißtrauisch und unausstehlich geworden. Sein Bein war einigermaßen geheilt, und er humpelte am Stock durch Haus und Hof, konnte aber noch nichts arbeiten. Werner erlernte rasch alle Feldarbeiten, er ging hinter dem Pflug her, ließ sich von einem älteren Bauern aus der Nachbarschaft zeigen, wie man die Felder für die Saat zurechtmacht. Als die Herbstbestellung beendet war, freuten sich die Frauen und Mädchen, daß sie nun endlich daheim in der warmen Stube sitzen und sich mit Nähen oder Stricken beschäftigen durften.
Eines späten Nachmittags saß Dina hinter der Nähmaschine, als Werner hereinkam. Froh und verliebt blitzten ihre Augen ihn an, jetzt, wo keiner es sah. Er aber schaute sie nicht einmal an, sein Gesicht war verschlossen, düster nach innen gekehrt sein Blick, sein Nacken gebeugt und der Kopf eigentümlich zwischen den Schultern eingezogen. Dina fragte erschrocken:
»Werner, wat haste? Biste bös? Biste krank? Komm setz dich an un trink Kaffi.«
Er hockte an dem Tisch, schlang die Brote in sich hinein wie ausgehungert, blickte nicht rechts noch links, stumm. Dina fröstelte, mit einem Male war er ihr fremd, weit weg von ihr. Und sooft sie ihn auch fragte, ob sie ihn irgendwie geärgert habe, ob der Vater ihn ausgeschimpft habe, Werner reagierte auf nichts. Schließlich legte sie die Arme um ihn, wollte ihn liebhalten, er aber schob sie fort, rannte zur Türe hinaus.
Das Mädchen wußte nicht ein noch aus; die folgenden Tage wurden zum Trauerspiel, außer ein paar kurzen, fast verletzenden Antworten hörte sie keinen Ton aus seinem Munde. Nun erwachte auch in ihr der Trotz. Was bildete der sich ein? War sie nicht ein besonders hübsches, fleißiges Mädchen, eine Hummestochter, die einmal den stattlichen Hof erbte?! Manch einer schaute sich die Augen nach ihr aus, aber sie hatte nur Augen für den Fremden. Ärger und Verdruß hatte sie haufenweise in Kauf genommen wegen ihm, der Vater war kein bißchen liebevoll zu ihr so wie früher, als er sie immer »mein Moodje« genannt hatte. Im Gegenteil, er war mißtrauisch, eifersüchtig und grob. Und ihre gute Mutter ging oft mit verweintem, sorgenvollem Gesicht. Die mochte den Werner ganz gut leiden, wagte aber nicht, gegen ihren jähzornigen Mann anzugehen; ungeschriebene Gesetze bestimmten das Leben der Frauen auf so einem Hof.
Nun ließ Dina ihrerseits den »Dickkopp« Werner links liegen, ging, ohne ihm einen Blick zu schenken, stumm an ihm vorbei, aber das Herz tat ihr verdammt weh dabei. Nach einer Woche verbissenen Schweigens hielten sie es beide nicht mehr aus, und als sie sich in der Dämmerung zwischen Scheune und Schuppen begegneten, hielt er sie fest. Ohne ein Wort zu sagen, drückte er sie heftig an sich. Eigentlich wollte sie sich wehren, aber die schmerzliche Sehnsucht nach ihm war zu groß; sie küßten sich, und das Glück war größer als je zuvor.
»Werner, wat war denn mit dir los? Wat haste denn für en Kummer jehat? Dou wars eso fies, et war mir so arg«, sagte Dina und drückte ihr Gesicht an seine Brust.
»Nix hatt ich, gar nix. – Es tut mir so leid, ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Verzeih mir.«
Es folgten schöne Wochen, ja Monate. Dina dachte schon gar nicht mehr an die böse Zeit; sie war vielmehr damit beschäftigt, ihre Mutter zu beschwatzen, sie möge beim Vater ein gutes Wort für ihre Heirat mit Werner einlegen, als dieser eines Tages wiederum, mit demselben bösen Gesicht wie damals, in sich gekehrt und abweisend am Tisch saß und vornübergebeugt sein Essen verschlang wie ein Verhungernder. Aber diesmal blieb er nicht stumm auf ihre Fragen und Bitten hin. Jäh erregt, mit laut belfernder Stimme, brüllte er sie an, stieß Schmähungen gegen sie und ihre ganze Familie aus.
»Eweil is alles aus! Dou has keine Grund und kein Recht, mich so anzubrülle, wir zwei sind noch net verheirat!« schrie sie und lief heulend in ihre Kammer. Ihre Liebe zu ihm schien hoffnungslos, ja, sie sollte ihr später einmal zum Verhängnis werden!
Tags darauf arbeitete Dina im Garten. Das Frühjahr kündigte sich an mit den hellen Fanfaren des Märzwindes, fliegendem weißem Wolkengekräusel am lichtblauen Firmament. Wie gerne hatte sie diese Zeit immer gehabt, wenn die ersten Beete umgegraben, Salat gesät und dicke Bohnen in die frisch aufgezogenen Furchen gesteckt wurden. Jedoch nun war ihr alle Lust an der Arbeit vergällt. Zu allem Überfluß flog eine der Amseln, die sie den Winter hindurch mit angefaulten Äpfeln gefüttert hatte, zum Gipfel des noch unbelaubten Nußbaums hinauf, setzte sich auf den allerhöchsten Ast und fing an, in den süßesten Tönen den Frühling und die Liebe zu preisen. Da hockte sich das Mädchen auf den umgelegten Stamm am Gartenrand und weinte gottserbärmlich. Dina merkte nicht, daß nebenan die Nachbarin Apollonia in ihren Garten gekommen war. Die kam heran und fragte betroffen:
»Mein Gott, Kend, borim[4] heulste esu?« Dina war es peinlich, daß jemand ihren Kummer sah, und sie wollte nicht mit der Sprache heraus.
»Nix is, Tant Loni. Dat heißt, – ich han schon eppes, aber et darf et keiner wissen.«
»Wat darf keiner wissen? Dat dou den Werner gern hast, weiß doch jeder, dat is doch net schlimm. Haste Ärger mit deinem Vadter deswegen, oder is wat passiert – müßt ihr heirode? Dat wär auch net schlimm.« Dina schüttelte den Kopf:
»Dat is et net, ich han mir nix vorzuwerfen; aber et is alles anders jekommen wie ich mir dat vorjestellt han. Er is ja manchmal so en böse Wazz[5], schwätzt wochenlang nix. Jestern hat er mich dermaßen anjebrüllt un is janz aus der Roll jefallen, un ich han ihn so arg gern. Ich wollt nur ihn heirode, keinen anneren. Der Vadter hat mir en janze Reih von prima Jungen jenannt, die mich heirode wollen. Ach hätt ich ihn nie kennenjelernt, wie gut könnt ich dran sein!« Das große starke Mädchen zitterte auf einmal wie Espenlaub, zu lange hatte sie alles in sich hineingefressen.
»No, no, no«, sagte Loni begütigend und klopfte ihr liebevoll auf den Rücken, »dat is aber schlimm, Dina, ich versteh et allerdings net, er is immer so freundlich un behilflich, wenn ich ihn um eppes frage, ich konnt ihn immer gut leiden, da stimmt irgendwat net mit ihm, ich weiß och net, wat. Überleg et dir noch emal, noch is et früh jenuch; er is kein Mann für dich.« Dina wurde ruhiger, sie putzte sich energisch die Nase und die Tränen ab. Loni hatte recht, sie würde Schluß machen mit Werner.
Als der in den nächsten Tagen bemerkte, daß Dina ihn nicht mehr mit ihren traurigen, flehenden Blicken verfolgte, sondern recht fröhlich mit anderen Mädchen und Burschen plauderte, schlug seine verbissene Stimmung so schnell ins Gegenteil um, wie sie gekommen war. Er hofierte die verblüffte Dina ohne Unterlaß, nahm ihr alle schweren Arbeiten ab, erlernte ihr zuliebe sogar das Melken, brachte kleine Geschenke, kurzum, sie hatte außer ihrer Mutter keinen besseren Menschen erlebt. So erfolgte die Versöhnung ohne Umschweife und Dina gewöhnte sich mit der Zeit an seine Gemütsschwankungen, denn die Zerknirschung nach jedem seiner Koller war echt, auch seine Versprechungen und Liebesbeteuerrungen. Das Mädchen war leichtgläubig und mitleidig; sie konnte den Heimatlosen, dessen Familie sich angeblich nicht um ihn scherte, nicht alleine lassen.
»Er hat nur mich!« war der ausschlaggebende Gedanke, der sie dazu antrieb, die Heirat bei ihren Eltern durchzusetzen.
»Wenn wir erst einmal verheiratet sind«, dachte sie damals, »wird alles anders, wird alles gut.« Aber das war ein großer Irrtum.
Jetzt sind sie schon sechs Jahre ein Paar, nichts ist besser geworden, es ist noch immer eine sehr problematische Ehe. Dina bemüht sich recht und schlecht, ihren Mann glücklich zu machen, was ihr nur selten gelingt. Dazu kommt, daß sie nicht für ihn allein dasein kann; sie verteilt ihre Liebe und Fürsorge auf Werner, ihre gemeinsamen drei Kinder und ihre kranken Eltern. Der heimliche Kummer wird von der allgegenwärtigen, nie endenwollenden Arbeit verdrängt. Mutter Ami hütet die Enkelkinder, mehr schlecht als recht, denn Amis Kräfte lassen nach. Aber Dina muß mit auf den Acker. Sie ist schon zufrieden, wenn ihre Mutter für ein paar Stunden das Allerkleinste bewacht, während die junge Frau die zwei größeren Kinder auf den Pferdewagen hebt und mit in die Krombiere nimmt. Hinterm Wald erstreckt sich eine große Feldflur. Stoppelfelder wechseln in bunter Reihenfolge mit Runkelrüben- und Kartoffeläckern. Darum ist die Flur abwechslungsreich und lebendig, jeden Tag neu bevölkert von Menschen und Tieren: da sind Frauen, Männer, Jugendliche, Kinder, Hunde, Kuh-, Ochsen- und Pferdegespanne, ein buntes Gemisch von Arbeit, Gespräch und Spiel. Die größeren Kinder müssen ab und zu ›aafschloon‹ helfen. Das heißt, die ausgegrabenen Kartoffelstauden so lange auf die Erde schlagen, bis alle Knollen abfallen und am Ende sauber daliegen.
Drüben auf dem Feld arbeiten Öhm Dunn und Loni mit ihren Kindern. Josef steht schon mit der Hacke in der Hand neben dem Öhm und gräbt Kartoffeln aus, versucht mit dem Älteren Schritt zu halten. Der erklärt ihm immer wieder geduldig, wie die Arbeit am besten zu handhaben ist.
»Dou bist en tüchtije Jung, kanns schon gut schaffe.« Dunn sagt es, spuckt in die Hände und läßt seinen Koascht[6] ins feuchte, krümelige Erdreich sausen. Es ist auf die Dauer keine leichte Arbeit, das Kartoffelausgraben, birgt aber einen stillen Genuß in sich. Nämlich dann, wenn nach jedem Schlag die hellen Knollen zahlreich aus dem dunkelbraunen Boden hervorquellen. Der Gräber scharrt sie hinter sich, um Platz zu schaffen für die nächste Reihe. Anna hilft der Mutter ›aafschloon‹. Hildegard, ein fünfzehnjähriges Nachbarmädchen, hilft Loni Kartoffeln auflesen, sie arbeitet im Tagelohn. Mit flinken Fingern sortieren die Frauen die Knollen aus, meist in drei Sorten: ›Dicke‹, ›Setzkrombiere‹ und ›Klaane‹. Letztere sind Wutzekrombiere[7] und bilden einen nicht unwichtigen Bestandteil der Ernte, weil sie, gekocht, als gutes Schweinefutter dringend gebraucht werden. Daher kommt wohl das Sprichwort: »Me moß osem Herrgott och für die klaan Krombiere dankbar sein.«
»Modter, darf ich?« fragt Anna und deutet hinüber zur Dina, die gerade den dreijährigen Karl auf den Arm nimmt und tröstet, der ist hingefallen und hatt sich das Knie an einem Stein aufgeschlagen; nun schreit er wie am Spieß.
»Was bringste auch alleweil die Kinder mit, die halten einen doch nur von der Arbeit ab!« schimpft Werner. Dina ist entsetzt über soviel Herzlosigkeit.
»Wo soll ich se denn hintun?« fragt sie bedrückt, »die Mutter packt sie doch net mehr allein.« Doch ihr tüchtiger Mann ist schon wieder bei der Arbeit, er hält es für überflüssig, sich mit diesem ›Weiberkram‹ zu befassen. Erleichtert begrüßt sie Annchen, die gerne ›Kinder verwahrt‹, den Kleinen an sich drückt und ihm ›e Kußje‹ gibt, worauf er sofort lacht und zufrieden mit dem größeren Mädchen zum moosigen Waldrand trottet. Dort gibt es herrliche Spiele zu spielen mit einer Anzahl weiterer kleiner Gesellen, die da wie die Waldschratte herumtollen, und die etwas größeren müssen die kleineren verwahren.
»Barb, Barb, ich will bei Barb!« kreischt Karlchen und rennt hinter seiner fünfjährigen Schwester Barbara her. Die aber will im Moment gar nichts von ihm wissen, weil sie ein rechter Rouschdebäidel[8] ist und gerade in einer Herde Jungens dahintollt – mit aufgelöstem Haar und zerissenen Strümpfen über Stock und Stein, durchs niedere Gestrüpp einer abgeholzten Waldschneise. ›Räuber und Schandarm‹ nennen sie das Spiel, und dafür ist Karlchen noch entschieden zu klein. Anna fängt ihn ein und zieht den Widerstrebenden zum Waldrand zu- rück.
»Komm, mein Jungelche, wir bauen e Häusje, dann bin ich die Modter un dou bis mein Kind.«
»Nä, nä, ich will de Vadter sein, ich heiroden dich.« Anna muß lachen, sie ist schließlich schon zehn und kann sich den Knirps nicht als Freier vorstellen.
»Los, mach voran, dat Essen of de Desch, ich han Hunger!« ruft der kleine Mann und klopft gebieterisch auf den abgesägten Baumstumpf der als Tisch herhalten muß. Karlchen gefällt sich als ›Vadter‹.
»Nu awer mal langsam, dou kleiner Tyrann, sag erst mal schön bitte, dann kriegste auch eppes.«
»Wat denn, wat denn? Jib et mir!«
»Erst bitte sagen.«
»Bitte, bitte, lev Annche, jib et mir!«
»Da haste eppes, du Schmuslabbes,« sagt das Mädchen und gibt ihm eine leuchtendgelbe, weiche Herbstbirne, die er sofort verspeist. Barbara stürmt heran und schreit:
»Mir auch en Birn! Will auch en Birn!«
»Ich han kein mehr«, sagt Anna, »un üwerhaupt kannste jetzt emal auf et Karlche aufpassen, anstatt wie en Jung durch de Besch (Wald) zu strolchen, guck emal, wie dou aussiehst!« Reumütig nimmt Bärbel ihr Brüderchen an die Hand, und Anna muß zurück auf den Acker; ein großes mit Stück Kartoffeln liegt ausgegraben da, das fleißige Kind kennt seine Aufgabe und ›schlägt ab‹.
Drüben ist die Hummesmutter mit dem ›Kaffikorb‹ eingetroffen. Schnaufend stellt sie den schweren Korb neben das Kartoffelstrohfeuer und den großen, eisernen Kaffeekessel in die Glut, um den Malzkaffee noch mal heißzumachen. Dina kommt und fragt nach ›em Kind‹, damit ist immer das kleinste gemeint.
»Et war janz brav seit heut Mittag, aber eweil schreit et. De Vadter sitzt solang an der Wiege, bis du kommst. Geh heim, ich helfen so lang Krombiere raffe bis du wieder zurück bist.« Dina entfernt sich eilenden Schritts, dreht sich nicht mehr um, denn sie erträgt das böse Gesicht ihres Mannes nicht mehr, der mißbilligend den Kopf schüttelt, weil sie heimgeht.
»Kannste dem Kind nicht die Flasche geben, Schwiegermutter?« fragt er verärgert.
»Nä, dat is noch zu klein, dat is noch net abjewöhnt, davon verstehste nix. Laß dat Dina in Ruh, dat braucht Zeit für sein Kind!« sagt die Hummesmutter, dann ruft sie die Tagelöhner und Kinder herbei zur Kaffeepause. Alle lagern sich auf Säcken und Kartoffelstroh. Ami schneidet riesige Scheiben vom selbstgebackenen Bauernbrot ab, die sich jeder selber schmieren kann, entweder mit Butter, Quark oder Kwetscheschmeer (Zwetschenmus). Es ist eine fröhliche Runde, man frotzelt sich gegenseitig, die alte Zilli erzählt gern ›Steckelche‹, die Kinder lauschen und schmatzen ihre ›Schmeer‹. Sie schmiegen sich an ihren Vater, der nun endlich wieder einmal guter Laune ist, das muß man ausnutzen. Dina aber ist inzwischen nach Hause gehetzt.
»Et is aber auch eso weit vom Falkenrod bis heim, dat sind mindestens zwei Kilometer«, denkt sie, »dat arm Kind!« Schon im Hof hört sie es weinen. Sie hastet in die Küche, trinkt einen Schäpper[9] voll Brunnenwasser, bindet die Arbeitsschürze ab; und während sie das Kleid aufknöpft, tritt sie in die Kammer, hebt die kleine Maria aus der Wiege, legt sie an die Brust und sitzt dann erschöpft auf dem Bettrand. Der Großvater humpelt in die Küche wie befreit; er hat die Kinder gern, aber am liebsten, wenn sie ›brav‹ sind, das heißt wenn sie schlafen oder lachen. Ein schreiendes Kind, das sich nicht beruhigen läßt, nicht mit Singen, nicht mit Schaukeln, und schon gar nicht mit Knurren, ist für ihn schlimmer als ein bockiges Pferd. Mit so einem wurde er immer fertig.
Liebevoll schaut Dina auf das kleine Mädchen, das sich nun endlich satt trinken kann, bis ihm vor lauter Müdigkeit die Augen zufallen. Rasch legt sie das Kind trocken und bettet es in seine Kissen.
»Vadter, ich muß eweil gehen. Sei so gut un schäl noch en Eimer Krombiere für heut Abend, wir han viel Leut. Dat Kind schläft eweil zwei Stunden. Wenn et schreit, gib ihm die Schlupp (Schnuller).« Dina trinkt eine Tasse Milch und macht sich eine Stulle, die sie unterwegs zum Acker ißt. Dort ist man schon wieder feste am Schaffen, Mutter Ami steht gebückt in der Reihe der Kartoffelleserinnen. Werner bindet die vollen Säcke zu, die, in der Mitte des Feldes aufgestellt, eine stattliche Reihe bilden. Wie Dina an ihm vorbeigeht, greift er nach ihrer Hand und hält sie fest. Sie spürt sofort, seine Stimmung ist umgeschlagen, er fragt nach der Kleinen, ist wieder der nette Kerl. Erleichtert atmet sie auf und gibt mit innerem Widerstreben einige halbwegs freundliche, ausgleichende Worte von sich, sie will den Frieden nicht aufs Spiel setzen. Rasch tritt sie in die Reihe der Frauen, lacht und sagt:
»Wenn mir flott mache, dann könnte mer in einer Stunn fertig sein! Modter, dou kanns ruhig heimgehn.«
***
[2] leicht närricher Mensch
[3] guten Abend
[4] warum
[5] extrem bösartiger, dickköpfiger Mensch
[6] langstielige Hacke mit vier gebogenen Zähnen
[7] kleine Schweinekartoffeln
[8] Wildfang, jungenhaftes Mädchen
[9] emailliertes Litermaß
Schneiderhennes-Paulchen
Auf Welche Feld laden Öhm Dunn und Loni schon die Säcke auf. Josef steht auf dem Wagen und hilft, so gut er kann. Jedesmal, wenn Loni und Dunn mit ›Hauruck‹ einen schweren Sack ›lüften‹, zieht er seinerseits am zugebundenen Ende desselben und erleichtert so den beiden, die nicht mehr besonders stark sind, das Aufladen.
Die Sonne ist schon hinter dem Wald untergegangen, bläulicher Dunst liegt über den Feldern, auf denen noch vereinzelt die Kartoffelfeuer glimmen, als die hochbeladenen Wagen, von Pferden, Ochsen oder Fahrkühen gezogen, einer nach dem anderen ins Dorf hineinfahren. Vor manchen Häusern stehen ›Rutschen‹, hölzerne Rutschbahnen, die, an die Wagen eingehängt, bis in ein Kellerfenster führen; man kann die Kartoffelsäcke darauf auskippen und die erdigen Knollen rollen direkt bis in den Keller.
Im Welche Hof geht das nicht so einfach, denn der Kartoffelkeller liegt nicht an der Dorfstraße, sondern hinten in der Scheune, alle Säcke müssen dahinein getragen werden. Ja, wäre doch Peter nur heimgekommen, – er fehlt an allen Ecken und Enden.
Da stolpert jemand durch die Hofeinfahrt, ein großer starker Bursche, es ist ›Schneiderhennes – Paulche‹, der Fünfzehnjährige mit dem Verstand eines Fünfjährigen.
»Tant Loni, ich helfen dir, Paul is stark, Paul is brave Jung!« ruft er, hebt einen schweren Sack auf seinen breiten Rücken, so leicht und schnell, als sei der nur mit Stroh vollgestopft, und läuft damit in den Keller.
»Langsam, Paulche, langsam!« ruft Loni besorgt, »gleich geht dir wieder die Luft aus.« Aber der Junge ist nicht mehr zu bremsen, er fühlt sich ja so stark, trägt und schnauft, lacht und rennt, ruht nicht eher, bis alle Kartoffeln im Keller sind.
»Krombiere, Krombiere, so en große Huppe!« schreit Paul und klatscht in die Hände. »Lonilonche, ich äßen bei euch, gell, ich kriejen och en Rahmschmeer?«
»Nadierlich, Paulche«, sagt Loni, geht in die Küche, stellt einen Topf Suppe auf den Herd und beauftragt Anna darauf zu achten und inzwischen schon den Tisch zu decken, während sie den Melkeimer ergreift und in den Kuhstall geht. Paul aber stolpert mit einem Ballen Stroh unterm Arm in den Stall.
»Ich streuen schon de Küh«, sagt er voller Eifer.
»Hör off damit, Paul, dou machs mir nur dat Vieh unruhig, dann kann ich doch net melken, jeh so lang in die Küch, bis ich fertig bin, dann essen mir.« Der Junge verzieht sich, und während die warme, weiße Milch in den Eimer ›struuzt‹, hat Loni etwas Zeit zu denken. Ihr kommen die untragbaren Verhältnisse in den Sinn, in denen Paul aufwuchs und heute noch lebt. Sein Vater fiel auch in Frankreich, kurz vor der Geburt des Kindes kam die Todesnachricht. Die hochschwangere Kätti saß da als hätte sie der Schlag getroffen. Sie redete drei Wochen lang kein einziges Wort, bis in einer sturmdurchtosten Herbstnacht ein gräßlicher Schrei ihrer Stimme zum Durchbruch verhalf. Kätti lag im Hof und krümmte sich in den Wehen. Sie hatte den Abtritt (das Klosett) aufsuchen müssen und wollte zurück ins Haus. Ganz plötzlich wurde sie von einem so heftigen Schmerz umgeworfen, daß sie sich nicht mehr aufrappeln konnte. Hilflos hockte sie am Boden, Sturmböen jagten und peitschten eiskalten Regen auf sie herab. Im Haus schliefen die alten Schwiegereltern und hörten sie nicht; das Heulen des Sturmes, der an den Fensterläden rüttelte, übertönte das Jammern der Kreißenden. Der Nachbar Jörg, der in der Nacht seine Laterne angezündet hatte und auf dem Wege zu einer kranken Kuh war, hörte schließlich Kättis Schreie, fand sie und holte endlich Hilfe herbei. Man trug die Frau ins Bett, wärmte sie mit heißen Ziegelsteinen, während Jörg eilends sein Pferd anspannte, um vom Nachbardorf die Hebamme zu holen. Sie kam und tat ihr Bestes, aber die Geburt des Kindes wurde zum Drama. Zwei Tage wand sich Kätti in den Wehen, die auf und abwallten; die Kräfte ließen nach, manchmal schlummerte sie erschöpft für ein paar Minuten ein, um mit noch ensetzlicherem Schreien aufzufahren.
»Et hilft nu nix mehr, der Doktor muß her«, sagte die Amme.
»Wat dat für e Jeld kost!« zeterte die Schwiegermutter, »ich han sieben Kinner of de Welt jebracht, un all ohne Dokter. Nä, nä, wat sein mir doch für jeschlagene, arme Leut! Unser armer Juchem is doot im Krieg, un dat Lumpemensch, wat keine Penning mitjebracht hat, kann noch net emal e Kind richtig of de Welt bringe!«
»Seid ruhig, Bas Grit, schämt euch!« sagte resolut die Hebamme, trat vor die Haustüre und befahl den Mannsleuten, den Doktor zu rufen. Ein junger Bursche rannte in die Kreisstadt, um nach zwei Stunden mit diesem auf dem Motorrad zurückzukommen. Der Arzt untersuchte die arme Kätti, die ihn fiebernd mit verglasten Augen anstarrte, und sagte anschließend:
»Das Kind ist sehr groß und fast zu schwer, um durch ihr schmales Becken zu treten. Für einen Kaiserschnitt ist es zu spät, wir müssen es noch mal versuchen.«
Und so wurde Paulchen mittels einer ›Zangengeburt‹ ins Leben gezerrt. Seine Mutter starb nach einigen Tagen an einer Lungenentzündung, die sie sich in der eiskalten Sturmnacht zugezogen hatte. Paulchen aber überlebte alles: die ersten Tage, die er – leicht bläulich – ohne Regung dalag, keine von seinen Tanten und Nachbarinnen hätte noch einen Pfifferling für sein Überleben gegeben, die folgenden Wochen, in denen er so langsam erwachte, leise grunzte und mit dem kleinen Mäulchen Saugbewegungen machte. Flink schob ihm die Großmutter jedesmal den Sauger der Milchflasche hinein, und er trank immer wieder und immer mehr, so daß nach einigen Monaten die Milch der einzigen Ziege der Schneidersleute nicht mehr ausreichte.
Von da an brachte Loni jeden Tag ein Maß Kuhmilch ins Schneiderhaus, auch Haferflocken und Äpfel. Paulchen war, kaum ein Jahr alt, schon ein kräftiges Kerlchen, rutschte über den Stubenboden, richtete sich an einem Stuhl auf und lachte die Loni an. Der kleine Junge hatte besonders dichtes, strohblondes Kraushaar, das ihm verstrubbelt um den Kopf stand. Seine hellblauen Augen, samt Rotbäckchen und Rotznase strahlten um die Wette.
»Dou bis ja e rósendes Kerlche!« rief Loni und hob ihn hoch, »und eso schwer wie Blei, wenn dat et Kätti noch sehen könnt, – aber eweile wäschen ich dich emal, du Dreckspatz.« Die Bas Grit humpelte zur Türe herein und trug ein paar Scheite Holz zum Herd, setzte Wasser auf, und Loni sah, wieviel Mühe ihr die kleinste Arbeit machte. Sie wurde immer hinfälliger und konnte das Kind kaum noch hochheben.
»Der Hennes muß mir immer lüften helfe, zu zweit kriegen mir den schwere Brocke dann in et Bettche«, sagte die Großmutter schnaufend.
Und schon nach einem Jahr tat sie ihren letzten Schnaufer. Müde gearbeitet und ausgemergelt lag die kleine Frau auf dem Schaaf[10] und lächelte ein bißchen, weil ihr nun wahr und wahrhaftig das Kreuz nicht mehr weh tat, und sie durfte liegenbleiben, mußte nicht mehr aufstehen um den täglichen Mangel zu verwalten. Wer zählt die Säcke mit Gras, die sie in ihrem Leben auf diesem schmalen Rücken heimgeschleppt, nachdem sie die Wegränder mit einer Sichel abgeerntet hatte! Damals war es eine Kuh, für die sie das Futter beschaffen mußte, denn für fünf Kinder hätte eine Geiß nicht genug Milch gegeben.
Nun, wo seine Grit tot war, hauste der alte Schneiderhennes alleine mit dem Kind. Er verdiente nicht mehr viel ›auf der Nadel‹, lebte recht und schlecht von Krombiere, die auf seinem winzigen Acker wuchsen, den Öhm Dunn bebaute. Und in seinem Gärtchen hinterm Haus gediehen Gemüse und Salat, stand ein alter, windschiefer Zwetschbaum und einige Beerensträucher. Der Schneider hatte seinen Stolz, er wollte keine milden Gaben. Er liebte das Kind und gab es nicht her, als die öffentliche Fürsorge sich seiner annehmen wollte. Er kochte und brutzelte nun für den Kleinen, machte Hausarbeit, die er nie getan; die sollten nicht sagen können, das Kind sei verwahrlost. Seine auswärts lebenden, verheirateten Kinder, zwei lebten noch von denen, kümmerten sich wenig um den Vater, und so blieb dieses der Nachbarschaft überlassen. Die Bas Grit hatte nur zu gerne milde Gaben in Empfang genommen und sie meistens vor ihrem Mann verheimlicht, aber jetzt mußten sich Loni und die anderen hilfsbereiten Frauen wer weiß was ausdenken, damit er ihre Hilfe ab und zu annahm, ohne gekränkt zu sein. Sie brachten Schlachtsuppe, Obst, Gemüse oder frischgebackenes Brot, hatten gleichzeitig ein paar Kleidungsstücke unter den Arm geklemmt und baten den Schneider, um des Himmels willen die Jacken und Hosen fein auszubessern.
»Die gut Sonntagsbux krieg ich net so schön hin wie dou«, beteuerten sie und legten ihre Gaben so ganz nebenbei auf die Bank.
So wuchs Paulchen auf, aller Frauen Kind, aber auch vieler Leute Prügelknabe. Je älter er wurde, desto ungebärdiger war er oft, und der Großvater war zu schwach ihn zu bändigen. Wurde irgendwo im Dorf ein Streich ausgeheckt, fiel der Verdacht zuerst auf Paulchen; egal, wer es war, er bekam die ›Wix‹. Heulend und lachend lief er dann meistens zur Loni, seiner Jett[11]. Die merkte als erste, daß mit der geistigen Entwicklung des Kindes irgend etwas nicht stimmte. Eines Tages nahm sie Paulchen kurzerhand mit in die Stadt, um ihn ärztlich untersuchen zu lassen. Der alte Doktor, dem Apollonia Welch vertraute, befaßte sich lange mit dem nunmehr Vierjährigen, stellte ihm Fragen, untersuchte seine Augen und Ohren, dann sagte er:
»Das Kind ist im allgemeinen gesund und körperlich gut entwickelt; es ist wahrscheinlich sein Gehirn, das irgendwann einen Schaden erlitten haben muß. Ich bin kein Facharzt, liebe Frau Welch. Sie müßten nach Andernach in die Klinik, um weitere Untersuchungen zu ermöglichen, aber ob das dem Kleinen viel hilft, bezweifle ich.« Loni fiel ein, unter welchen Umständen Paul geboren wurde, und das erzählte sie nun dem Doktor.
»Es kann sein, daß bei so einer schweren, langwierigen Geburt, die Sauerstoffversorgung des Gehirns für eine kurze Zeit unterbunden ist, und dann ist der Schaden nicht mehr zu reparieren«, sprach der Arzt. Traurig ging Loni mit dem Kind an der Hand durch die kleine Stadt, die ihr sonst so gut gefiel. Sie gingen an der Mosel entlang, überall spielten fröhliche, gesunde Kinder und Paulchen schrie außer sich:
»Ou, bat gruß Wasse! Tant Loni, kucke john! Ou, Wasse, Wasse, kucke john!« – Die Spaziergänger drehten sich schon nach ihnen um und machten große Augen. Loni sagte nur:
»Komm Paulche, mir jien haam.«
Sie zog den widerstrebenden Jungen, der unbedingt an die Mosel wollte, an der Hand die Gassen aufwärts bis in den kleinen Bäckerladen, kaufte ein paar ›Zuckerweck‹ und begab sich mit ihm auf den weiten Heimweg, der durch ein enges Bachtal aufwärts zur Eifel führte. Das Kind schmatzte vergnügt seine Wecken, lief zu einem am Weg liegenden Brunnen und ließ sich Wasser ins Mäulchen laufen, bis sein Durst gelöscht war. Loni aber hatte nur ein Wort im Kopf: »– nicht mehr zu reparieren.« An einem Bildstock mit der Schmerzhaften Muttergottes machten sie Rast und Loni betete kummervoll:
»Lev Muttergottes, wat soll aus dem arme Paulche werden, wenn der alt Hennes emal stirbt? Dann moß dou helfen.« Und so ähnlich denkt sie auch heute noch, wo sie unter der ›Braun‹ sitzt und mit beiden Händen den prallen Euter der Kuh melkt. Die Milch kommt so leicht und in dicken Strahlen, daß der weiße Schaum fast über den Eimerrand quillt. Paul, der inzwischen aus der Küche zurückgekommen ist, hat einen großen, emaillierten ›Schäpper‹ in der Hand. Und Loni hält ihm den Eimer hin so wie sie es immer getan hat; denn für Paul ist es wie verbrieftes Recht, das graumelierte Litermaß so lange in den Milcheimer zu tauchen, bis es voll ist, um es dann an den Mund zu setzen und in riesigen Schlucken leerzutrinken. Loni hört ihn schmatzen und weggehen. Sie weiß, daß er nun den Kindern drinnen stolz seinen weißen Schnurrbart aus Milchschaum vorführt.
»Putz ihn doch ab!« ruft Anna jedesmal, aber er tut es nicht.
»Ich sein en grußer Mann, han en Schnorres bie de Kaiser Wellem!« ruft er und schlägt sich mit den Fäusten an seinen mächtigen Brustkasten. Nach dem Abendessen drückt Loni ihm ein Töpfchen Kartoffelsuppe in die Hand:
»Paulche, jieh eweil heim, deinem Großvadter wird et lang, jeh flott, dat die Supp net kalt wird, sag ihm aber, ich hätt zuviel jekocht, un se wär zu schad zum Wegschütten.« Und das große Kind mit der Hünengestalt trägt behutsam das Töpfchen heim:
»Guck emal hier, Großje, gut Supp, et Lonilonche hat widder zuviel jekocht, eß, Großje, ich han keine Troppe verschütt.« Schneiderhennes liegt wieder einmal mit seiner chronischen Bronchitis fiebernd im Bett, hustet sich fast die Seele aus dem Leib. Dankbar ißt er die warme Suppe und murmelt:
»Damit nix verkommt, die is gut mit Speck jeschmälzt.«
***
[10] Totenbett, ein auf Stroh gebetteter Verstorbener liegt ›of em Schaaf‹; Das Stroh wurde später verbrannt
[11] Patin
Hummes-Dina
Im Hummeshaus gehen die Lichter aus. Die Tiere in den Ställen liegen im sauberen, warmen Stroh; alle satt, käuen sie zufrieden vor sich hin. Im Haus geht die junge Bäuerin als letzte zu Bett, nicht ohne noch einmal ihre schlafenden Kinder zuzudecken, die sich immer freistrampeln. Dina ist todmüde, freut sich auf ihr Bett, läßt sich hineinfallen und will nichts mehr als endlich Ruhe, – schlafen, schlafen, schlafen. –
Werners Hand tastet sich zu ihr herüber und streichelt ihre Schulter, immer wieder, immerzu; sie erschrickt fast, kann aber vor Erschöpfung nicht reagieren und schlummert ein um nach einer Weile aufzuwachen, weil das Streicheln heftiger geworden, ja fast in Kneifen ausgeartet ist. Die Frau verschließt sich innerlich:
»Nein, nein, ich kann net, ich will net, ich sein zu müd«, denkt sie, »un vierzehn Tag haste mir keinen freundlichen Blick jegönnt, kein gutes Wort, nur jeschimpft un kritisiert, nix konnt ich dir recht mache, un jetzt soll ich wieder parat sein für dich un lieb sein. – Nä, nä, ich will net!« schreit ihr Inneres, sie wagt es aber nicht laut zu sagen.
Und ihr Widerstand weicht der Angst. – Wenn sie nicht nachgibt, wird der Unfrieden größer als zuvor, und die Kinder hätten nicht zuletzt darunter zu leiden. Sie wendet sich pflichtbewußt ihrem Manne zu. Werner ist glücklich, er glaubt, es sei alles in bester Ordnung so.
Die fragwürdige ›Belohnung‹ folgt auf dem Fuße; in den darauffolgenden Wochen kann sich Dina einigermaßen frei und fröhlich fühlen, kann über dieses und jenes reden, ohne sich vor jedem Wort zu überlegen, ob ihr Mann es nicht eventuell falsch auffassen könnte.
»Warum kann dat net immer so sein?« fragt sie sich, wer weiß wie oft, und ihre Liebe zu ihm blüht wieder auf, erwärmt ihre Tage und Nächte. Ihr einziges Bestreben ist es, alle zufrieden zu stellen, alle Arbeiten und Pflichten getreulich zu erfüllen. Ihre Mutter unterstützt sie mit den wenigen Kräften die ihr noch zur Verfügung stehen, kocht und flickt, verwahrt die Kinder, wenn Dina im Stall oder bei schlechtem Wetter im Garten und auf den Feldern arbeitet. Karlchen ist dem Großvater ›sei Jungelche‹. Sobald der neben dem Herd in seinem Sessel sitzt, klettert der Kleine auf seinen Schoß und fragt:
»Grußvadter, dut dir heut et Bein weh?« Wenn der dann sagt: »Net eso arg«, bettelt Karlchen:
»Dann sing, Grußvadter, dann reiden mir!«
Und der Hummespitter räuspert sich, singt dann mit forscher Stimme, während er seinen Enkel auf dem noch gesunden Knie reiten läßt: »Wer will unter die Soldaten, der muß haben ein Gewehr, der muß haben ein Gewehr! Das muß er mit Pulver laden und mit einer Kugel schwer. Büblein wirst du ein Rekrut, merk die dieses Liedchen gut: Hopp-hopp-hopp, hopp-hopp-hopp! Pferdchen lauf, lauf Galopp! Pferdchen immer, immer, immer lauf Galo-hopp, hopp-hopp-hopp, lauf Galopp, lauf Galopp!«
An und für sich ist es ein helles Pläsier, wenn die zwei so lustig hoppeln und singen. Als jedoch eines Tages das Kind besonders laut mitplärrt: »Der muß haben ein Gewehr, das muß er mit Pulver laden und mit einer Kugel schwer«, wird es Ami zu dumm. Streng sagt sie:
»Pitter, ich kann dat net mehr höhren! Datselbe Leedche haste domals immer mit unserm Karl jesunge, bie der noch klein war. Merkste dann net, dat mit dene Leedcher un Späßjer uns Junge von klein auf für en Krieg begeistert werden solle? Wenn ich so eppes höre! Mit Pulver lade, mit einer Kugel schwer! Un mit so einer ›Kugel schwer‹ is unser Karl totjeschossen worden. Tot. Un kimmt nie mehr haam!« Ami hält sich die Schürze vors Gesicht und geht weinend aus der Küche, während Pitter betroffen und nachdenklich dasitzt.
»Karlche, die Grußmodter hat Recht, mir han jenuch jeridden eweil; ich verzellen dir lieber e schön Steckelche.«
Dina merkt es anfangs kaum, welche Mühe es der Mutter macht die oft ungebärdigen Kinder zu versorgen, bis sie eines Tages dazukommt, wie die Großmutter, ganz außer Atem und mit Schweißperlen auf der Stirne, versucht, dem Karlchen Hose und Strümpfe anzuziehen, der keine Lust hat, der ihr immer wieder entwischt und mit flatterndem Hemdchen und nacketem Hintern barfuß durch Stube und Küche fegt. Die Großmutter preßt die Hand aufs Herz und japst:
»Karlche, komm her, dou erkälst dich, – Karlche, nou komm doch!«
Wer aber nicht kommt, gar nicht daran denkt, seiner Großmutter zu gehorchen, ist Karl. Der flutscht an Dina vorbei in den kalten Hof, saust durch Regen- und Jauchepfützen, daß es nur so spritzt. Dina fängt sich den Knirps, der strampelt und brüllt, trägt ihn ins Warme, gibt dem Widerspenstigen ein paar Klapse auf den Dokes[12], wäscht ihn und zieht ihn an. Mutter Ami aber sitzt da und ›scheneert‹ (geniert) sich, weil sie so schwach ist.
»Et tut mir leid, Dina, aber ich packen die Kinner net mehr, ich krieg so schlecht Luft; ich glaub, ich han die Gripp.«
»Leg dich ins Bett, Modter, ich bleiben heut emal daheim, die Mannsleut können die zwei letzten Wagen Kohlraben allein heimholen. Geh un leg dich nieder, ich bring dir en heiße Stein für in et Bett.« Dankbar geht Mutter Ami ins Bett, und Dina bringt ihr heiße Milch mit Honig.
»Dat ich dir aber auch jar net mehr so richtig helfen kann –«, sagt die alte, kranke Frau.
»Ich kochen uns en gut Tass Bunnekaffi, dann wird et dir besser«, sagt Dina und geht in die Küche. Dort greift sie nach Kaffeemühle und Kaffeebüchse und muß feststellen, daß in der alten Blechdose keine einzige Bohne mehr zu finden ist. Rasch setzt sie den Wasserkessel aufs Herdfeuer, rafft in der Speisekammer ein halbes Dutzend Eier in die Schürze, läuft zur Türe hinaus und über die Straße zu dem Laden, über dessen Eingangstüre ein Schild mit der Aufschrift ›Kolonialwaren und Metzgerei. Jakob Wolf‹ hängt. Sara Wolf hört die Ladentürklingel und eilt aus der Küche in den Laden. Vollschlank, aber beweglich, ein freundliches Gesicht, große, dunkle Augen, schwarzes, sorgfältig in Wellen frisiertes Haar, unter dem echt goldene Ohrringe hervorblitzen, das ist Sara. Weiße Zahnreihen zwischen vollen roten Lippen lächeln Dina an:
»Schönen guten Morgen, was darf’s denn sein, bitte schön?«
»E viertel Pund Bunnekaffi,« sagt Dina, rafft die Eier aus der Schürze, legt sie auf den Ladentisch, »ich glaub, et reicht net, wat kosten die Eier?«
»Elf Pfennig das Stück, da haste jetzt sechsundsechzig; es bleiben noch siebzehn Pfennig Rest, die bringste en andermal.«
»Ja, danke«, sagt Dina, »ich muß meiner Modter en Tass Kaffi kochen, die gefällt mir heut gar net, so schwach wie die is.«
»Das han ich schon lang gemerkt, Dina, die muß sich mehr schonen«, sagt Sara, »aber wart emal!« ruft sie der jungen Frau nach, die schon zur Türe hinaus will, »der Jakob hat geschlacht, ich geb dir was mit fürs Ami.«
Schon bald ist Sara aus dem Schlachthaus zurück, trägt eine verdeckte Schüssel und drückt sie Dina in die Hände mit den Worten:
»Koch ihr emal en gut Brüh, hier sind frische Rindsknoche und e bissele Boose (jidd. Fleisch). Und Dina bedankt sich erfreut, denn soviel Mitgefühl und Herzlichkeit trifft sie bei den wenigsten an. Wenn sie da zum Beispiel an ihre Tante Paula denkt, – brrr; der alte Besen hat immerzu nur abfällige Redenarten parat. Alle Leute außer ihr sind Faulenzer, das heißt, aus ihrer Sicht.
Mutter Ami erschrickt jedesmal, wenn sie ihre Schwägerin aufs Haus zusteuern sieht. Paula betrachtet das Hummeshaus immer noch als ihr Elternhaus, und sie hat ihrer Ansicht nach ältere Rechte als die Ami, die ihr den Lieblingsbruder gestohlen hat und sich in dem großen Haus breitmacht. Obwohl Paula längst ihr Erbteil an Land und Haus erhalten hat, gönnt sie ihrer Schwägerin nichts.
Amis junge Ehejahre mit dem Hummespitter haben unter dem Schatten von Paula gestanden, die lange unverheiratet daheim wohnen blieb, und ganz selbstverständich die Führung des gesamten Haushaltes weiterhin für sich beanspruchte. Da mußte sich das junge Glück freilich auf die Schlafkammer beschränken. In Küche, Stube, Garten, Hof und Stallungen durfte die junge Bäuerin nur Handlangerdienste leisten. Selbst die Freude an ihrem ersten Kind gönnte Paula ihr nicht. Sie hieß die Ami mit aufs Feld gehen wärend sie, die Kinderlose daheim blieb und das süße, kleine Dinachen versorgte und kuschelte. Amie war sehr geduldig und friedliebend, konnte aber nicht umhin, an einem Abend, als sie mit Pitter zu Bett ging, angesichts der leeren Wiege in Tränen auszubrechen.
»Wat is denn Amiche, wat haste denn mei Mädche?« fragte Pitter, und Ami schluchzte:
»Dat Paula, dat Paula, – guck emal in die Weech (Wiege)! Un et is immer noch mein Kind! Mein Kind is dat, aber et Paula vergönnt et mir net, dich auch net, alles net; un dat ich überhaupt hier sein, is em en Dorn im Aug.«
Pitter fragte verwundert:
»Uns Paula? Aber Amiche, dat verstien ich net, et meint et bestimmt net bös. Ich sein immer gut mit unserm Paula zurechtjekommen.« Er wichte ihr die Tränen ab und gab ihr einen herzhaften Kuß:
»So, Ami, nu beruhig dich, ich jien dir dein Dinache holen.« Leise schlich er in das Schlafzimmer seiner Schwester. Dort lag sie mit dem Kind im Arm. Ihre dicken blonden Zöpfe waren aufgelöst, und ein zufriedenes Lächeln verschönte das herbe Gesicht.
»Die Gute«, dachte er, »sie ist schon über dreißig, et wär gut wenn sie einen Mann und selber Kinder hätt.«
Er beugte sich über sie und wollte ihr sachte das schlafende Kind aus dem Arm nehmen, da quäkte dieses ein wenig, und Paula erwachte. Entsetzt starrte sie auf den Mann im Halbdunkel und schrie auf.
»Um Gottes Willen, Paula, schrei net eso, ich