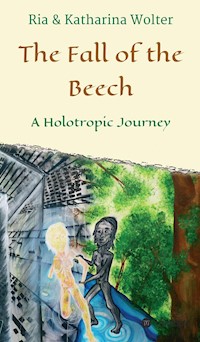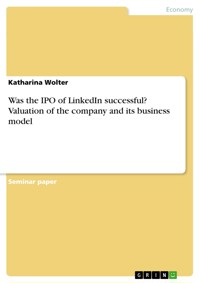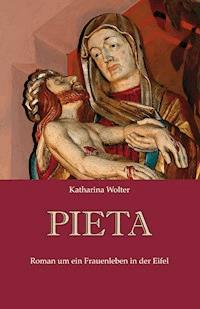Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Fenster zur Straße ist die Verbindung des querschnittgelähmten Jakob Krechel zur Außenwelt, zum wirklichen Leben, zu seinem Dorf. Nach einem Unfall, der ihn in den 20er Jahren aus dem Arbeitsleben als Bauer herausreißt, verfällt er zunächst in tiefe Depression. Erst als er sich selbst die Aufgabe gibt, als Dorfchronist alles niederzuschreiben, was er von seinem Fenster aus beobachtet, findet er wieder Lebensmut und sogar Lebensfreude. Von nun an notiert Jakob Krechel Tag für Tag die Geschehnisse vor seinem Fenster, hält die Wetterverhältnisse genauso fest wie die bäuerlichen Arbeiten im Dorf, registriert die Saattermine und schreibt die Erntemengen auf. Seine Auflistungen werden schließlich eine anerkannte Hilfe für die Bauern, sein Rat und seine Auskunft sind gefragt, und er selbst fühlt sich schließlich trotz seiner Behinderung über Jahrzehnte als respektiertes Mitglied der Dorfgemeinschaft. Katharina Wolter gelingt es die Veränderung der Lebensverhältnisse im Eifeldorf von den 20er Jahren bis in unsere Zeit darzustellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 1997 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-798-5 Umschlagsaquarell: Anna Mees
Katharina Wolter
Das Fenster zur Straße
Ein Eifeldorf im Wandel der Zeit
Rhein-Mosel-Verlag
Die Figuren in diesem Roman sind von mir frei erfunden. Sie entsprechen nicht wirklichen Personen. Katharina Wolter
Inhaltsverzeichnis
Der Mann am FensterSchulwegHummes BärbelMarianne und MichaelLehrersfamilie FriedrichsWelche AnnaLenchenDie SiedlungFlurbereinigungFestgetümmelAufwärts – abwärts – anderwärts S.Jakobs AugensternGeorgWeihnachtliche ÜberraschungenWie nebenbei ein regionaler Bestsseller entstehtUnd es bewegt sich doch etwasDer Besuch der alten DameAbendstern und Morgenröte
Der Mann am Fenster
Mehr als sein halbes Leben verbringt der Krechels Jakob hinter den Fensterscheiben und den beiseite geschobenen Scheibengardinen seines Schlafkammerfensters, das aus dem zu ebener Erde gelegenen Raum unmittelbar auf die Dorfstraße hinausgeht. Just an der Stelle, wo Krechels Haus steht, bildet die Straße einen Winkel von neunzig Grad, und das besagte Fenster ist so vorwitzig gelegen, daß es als Ausblick über beide Schenkel dieses Winkels dienen kann, und zwar von einem Ende des Dorfes bis zum andern.
Nun ist aber der Mann am Fenster keineswegs freiwillig oder aus purer Neugierde und Tagedieberei dahin gekommen. Die Geschichte ist recht dramatisch und liegt schon viele Jahre zurück.
Sie beginnt an einem schönen Herbsttag, als der Jakob Krechel gerade drei »Mannen« Birnen, ›Alexander Lukas‹ gepflückt hatte. Nachdem er sie liebevoll betrachtet und begutachtet hatte, ließ er noch einen letzten Blick von unten nach oben über die ganze, grünbraungolden belaubte Höhe, bis zu dem in den dunstig, blaßblauen Herbsthimmel ragenden Wipfel des alten Birnbaumriesen schweifen.
Und ganz links oben hingen noch drei dicke Birnen.
»Die lo holen ech mir noch«, dachte Jakob, und er kletterte erneut die steile Pflückleiter hinauf.
Wirze Heinrich, der ein paar Äcker weiter sein Stoppelfeld umpflügte, schaute zufällig hinüber und dachte bei sich: »Ei Dunnerekeil, wat klimmt der Jakob awer hoch! Der Baam is doch leer jeplückt. – Ei verdammt noch emal! Eweil turnt der Schoute of dene oberste Sprossen erum!«
Heinrich sah nicht die drei Birnen, aber mit wachsendem Schrecken, wie der Jakob sich weit nach links hinüberbeugte, ins Leere griff und dann mit einem gräßlichen Aufschrei in die Tiefe stürzte.
Heinrich riß seinem Pferd so heftig an den Zügeln, daß es laut wieherte, weil er ihm den Kopf herum zerrte.
»Hüh!« schrie er, »bleiv stohn!« Dann rannte er quer über die frischgepflügten, holprigen Schollen, stand endlich japsend vor dem lang dahingestreckten Jakob. Der grinste ihn mit schmerzverzerrtem Munde an, hatte noch Galgenhumor:
»Dat elo jet mir en däier Birn«, – dabei versuchte er die rechte Hand, die er um eine zerquetschte Birne krallte, anzuheben, was ihm aber nicht gelang. Hein wollte gerade einen leichtscherzhaften Tadel aussprechen, aber der blieb ihm im Halse stecken; Jakob war mit einem Male totenblaß und drehte die Augäpfel nach oben.
»Mein Gott! Jäb, dou wirs mir doch net aafbaue?!« Heinrich rüttelte seinen Nachbarn, was aber nur ein leises Stöhnen aus dessen Munde fahren ließ. Da rannte Heinrich hinunter ins Wiesentälchen, welches etwa hundert Meter abwärts gelegen ist, schöpfte seinen alten Filzhut voll Wasser aus dem Seiferbächlein, hastete zurück, um wenigstens noch die Hälfte des kostbaren Nasses dem Jakob über den Kopf zu schütten. Der kam zu sich und murmelte:
»Autsch! – Meine Reck, – ech jelawen – ech han – et Kreuz kabott«. Heinrich rollte sein Arbeitsjöppchen zusammen und legte es dem Verletzten vorsichtig unter den Kopf, deckte ihn mit einer Pferdedecke zu und sagte: »Ech hollen Hilf!«
Jakob nickte unmerklich: »Holl de Fuchs.« Das ist Jakobs Fuchsstute, die ausgespannt, mit dem Halfter an den bis zur Hälfte mit frischgepflückten Äpfeln gefüllten Kastenwagen angebunden, friedlich an einem aufgeschütteten Haufen Klee kaute.
Hein band »Fuchs« los und schwang sich auf den Rücken des hochbeinigen Pferdes, eines ehemaligen »Komißgauls«, der den Krieg als Reitpferd eines Kavallerieoffiziers überstanden hatte, später von Jakob Krechel billig ersteigert und zum Ackergaul dressiert worden war. Hein zog dem Pferd den dicken Pflügerstock über die Hinterhand und brüllte:
»Eweil zeig wat de kannst! Et jeht um Läwwe un Duut!« Roß und Reiter stoben querfeldein über die Äcker, daß es die braune Eifelerde in die Luft wirbelte.
Es wurden in der Tat »däiere Biere« (teure Birnen) für den Krechels Jakob und seine Familie. Denn wie die meisten kleinen Eifelbauern war er noch nicht einmal in einer Krankenkasse. Arztkosten, Krankenhausaufenthalt, alles mußte vorerst aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Sie verkauften die beste Kuh samt Kalb, die zwei fetten Schweine, von denen eins eigentlich für die Hausschlachtung vorgesehen war, aber es langte nicht. Sie mußten sich Geld auf der Sparkasse leihen.
Das alles hätten sie gerne in Kauf genommen, wenn Jakob gesund geworden wäre. Aber er kam als Invalide nach Hause. Beide Beine waren ihm gelähmt. Vorerst setzten sie ihn in den hochlehnigen »Nachtstuhl« seines Großvaters, der viele Jahre auf dem Speicher gestanden, nun aber für den Bauern, der ihn mit finsteren Blicken maß, viel zu früh ans Fenster seiner Schlafkammer gestellt war.
Da saß er nun von morgens bis abends, starrte auf die Dorfstraße, sah die Leute mit geschulterten Hacken zur Feldarbeit eilen, sah sehnsüchtig den Pferdefuhrwerken und den Ochsengespannen nach, fluchte und haderte mit seinem Schicksal.
Bäbchen, seine Frau, hatte nichts mehr zu lachen die ganze Zeit. Sie war eher zierlich, als groß und stark, was sie jetzt hätte sein müssen, um ihren Mann zu pflegen. Früher, zu Beginn ihrer beider Liebe, war es gerade ihre schmale, graziöse Erscheinung, kaum mittelgroß – ihr feines Gesicht war das eines verträumten Kindes dessen Köpfchen die Last der dunkelbraunen Haarpracht kaum trug – die ihn verzauberte, und alle Beschützergefühle in dem großen, starken Manne erweckte.
Wie oft hatte er sein Bäbchen hoch in die Luft gehoben, auf seinen Armen gewiegt, sie in den ersten, glücklichsten Jahren jeden Abend ins Bett getragen.
Drei Kinder hatte sie geboren, alle drei zu schwer für das schmale Becken der Frau. Jedesmal hatte es sie fast das Leben gekostet, aber Bäbchen war eine liebevolle Mutter. Sie stillte jedes Kind über ein Jahr lang, ihre kleinen Brüste spendeten einen erstaunlichen Reichtum an Milch, so daß die zwei Buben und als letztes das Mädchen aufs prächtigste gediehen. Jakob war noch stolzer auf seine kleine, tapfere Frau, als anfangs und nahm ihr alle schwere Arbeit ab.
Aber jetzt! – Jetzt konnte er nichts mehr für sie tun, und sie war zu schwach, um dem großen, schweren Mann die nötigen Pflegedienste zu leisten.
Früh morgens kam sein Schwager Alois, noch bevor der auf’s Feld hinaus fuhr, um den Gelähmten gemeinsam mit Ignaz, Jakobs Ältestem, aus dem Bett zu heben, anzuziehen und ihn in den Lehnstuhl am Fenster zu setzen.
Bäbchen aber tat ihrem Mann alles Liebe was in ihren Kräften stand; kochte seine Leibgerichte, wusch seinen immer noch straffen hellhäutigen Körper mit duftender Seife, die sie extra aus der Apotheke mitbringen ließ, pflegte mit besonderer Sorgfalt sein schönes Gesicht, barbierte ihn täglich, kämmte und bürstete sein volles, gelocktes, rotblondes Haar so lange, bis es ihm in glänzenden Wellen um Kopf und Schläfen lag.
»Dou bist immer noch der schönste Mann im janze Kirchspiel«, sagte sie zärtlich und küßte ihn sanft auf die glattrasierten Wangen.
»Un bofür jeste mir dann keine richtije Kuß mehr?« fragte er bitter. Er griff nach ihren Haaren, zog sie mit seinen immer noch kräftigen Fäusten an sich heran und küßte sie ziemlich brutal auf den Mund. Aber er spürte ihr geheimes Widerstreben. Da stieß er sie von sich, daß sie taumelte.
»Weil ech keine richtije Mann mehr für dich sein!« schrie er böse und verbittert.
Bäbchen stand drei Schritte von ihm entfernt, kehrte ihm den schmalen Rücken zu, und er sah ihre feinen Schulterblätter von unterdrücktem Weinen zucken.
»Bäbche, mei lev Bäbche«, flehte er, »dou darfs net heulen, et dot mir leid, dat ech eso fies gejen dich jewest sein! Gelt, früher haste doch nie Ursach jehat, wejen mir zu kräichen?« Sie legte schon wieder die Arme um ihn.
»Nä, Jäbche, dat braucht ech och net. Dou warst immer so en leewe, gude Mann, und dat biste och heut noch für mich. Et is nur – et tut mir eso schrecklich leid für dich.«
Solche und ähnliche Szenen spielten sich im ersten Jahr nach dem verhängnisvollen Unfall fast täglich ab.
Ein Glück, daß es Lenchen gab. Das war die fünfzehnjährige Tochter, die sich in der Pflege ihres Vaters mit der Mutter abwechselte. Wenn er gar zu grantig war, und Bäbchen mit erschrockenen Kinderaugen ganz verängstigt aus der Kammer kam, ging Lena, die einen Kopf größer als Bäbchen und sehr kräftig war, zum Jakob hinein und rief freundlich-resolut: »Vadter eweil biste awer mal friedlich, die Modter kann doch nix dafür, dat dou eso krank bes! Kann ich eppes für dich mache?«
»Nä«, knurrte er böse, »dat kannste net! Jank eraus! Mir kann keiner helfen.«
»Ich jien net eraus, ich helfen dir eweile vom Pott.« Sie umfaßte ihn von hinten mit geübtem Griff, hob den mittlerweile etwas leichter gewordenen Mann hoch, und zog mit der Linken die Bettpfanne unter ihm weg.
Er jammerte selbstmitleidig: »Dat ech so eppes erläwe moß, dat mei Kind mir den Hinnere aafbotze moß! – Nä, nä, nä!«
»Ruhig, Vadter! Sei froh dat de mich hast!«
»Dat sein ech ja och, dou bist ja e gut Mädche«, gab Jakob zu, als sie ihn versorgt, eine Decke über die Knie gelegt, und ihm ein Glas Viez hingestellt hatte.
Lächelnd ging Lena aus dem Zimmer, drehte sich aber in der Türe nochmal kurz um und drohte mit dem Finger: »Nou sei schön lev, wenn dein Bäbche kimmt!«
Jakob trank ein paar Schlucke von dem wirklich guten, selbstgekelterten, in einem großen Holzfaß gereiften Apfelwein, lehnte sich behaglich in den Lehnstuhl zurück, schloß die Augen, und er dachte auf einmal:
»Eijentlich dürft ech jarnet klagen – so gut wie mein Leut all zu mir sein.« Er spürte zum ersten Male wieder ein wenig Frieden in seinem gemarterten Herzen und Hirn, ein kleines Gefühl von Leben, Dankbarkeit und Lebenswillen. Nach einem tiefen, befreienden Atemzug öffnete er die Augen und blickte wie gewohnt auf die Dorfstraße.
Aber es war nicht der gewohnte, angewiderte Blick dem alles verleidet war. Verwundert schaute Jakob hinaus, denn er sah auf einmal, es war gerade Feierabend; Viehherden trotteten am Fenster vorbei, dahinter die dazugehörenden Hütebuben oder -mädchen. Die stießen, sobald sie sich ihren Gehöften näherten, langgezogene Rufe aus: »Stalldüür off! Stalldüür off!«
Dann läutete die Abendglocke. Die spielenden Kinder horchten auf und liefen heimzu. Jakob aber faltete zum ersten Male nach langer Trostlosgkeit die Hände zum Gebet:
»Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft ...«
Draußen rumpelten die ersten Fuhrwerke, hoch mit Kartoffelsäcken beladen, ins Dorf. Es war »Krombiereausmacher«. Obendrauf saßen Frauen und Kinder. Gut gelaunt winkten sie dem Jakob zu, denn es war Feierabend. Jakob winkte zurück und rief: »Dir hat awer got jeschafft!«
Er kannte ja alle. Er wußte genau, wer die dicksten Kartoffeln und Runkeln hatte, das schönste Vieh, oder auch das hungrigste, ungepflegteste.
Aber so richtig bewußt hatte er das Leben auf der Straße bis zum heutigen Abend nicht wahrgenommen; zu sehr hatte ihm sein Unglück im Wege gestanden.
»Ei Dunnerwetter, wat hat dat Hummese Dina für e staats Mädche!« staunte er, als die halbwüchsige Bärbel vorbeiflanierte, der ein paar Jungens hinterherstrichen. Von jetzt an war es Jakob kein bißchen mehr langweilig.
Als am selbigen Abend auch noch der Schöffe zu ihm kam, der für ihn den Unfallsbericht an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft geschrieben, einen Antrag auf Vergütung gestellt hatte, und ihm jetzt mitteilte, daß Jakob den größten Teil der Unkosten erstattet bekäme, dazu eine kleine, monatliche Rente, war dieser Tag der glücklichste, seit diesem verflixten Leitersturz.
Gleich am anderen Morgen sagte er zu Lenchen:
»Jank ins Konsum, un kaaf mir e dick Schreibheft un zwien Bleistifte, ech will en Beschäftijung han.«
Lena rannte in die Küche zum Bäbchen, umfaßte sie, tanzte mit ihr rundum und schrie: »Modterche, Moderche! Der Vadter hat et jepackt!«
Dann lief sie ins Konsum, war bald zurück, und stürmte mit dem Schreibzeug bewaffnet in ihres Vaters Kammer. Sie schob einen Tisch vor seinen Lehnstuhl, knallte ein paar Schreibhefte darauf, dann die Bleistifte, einen dicken Radiergummi und einen Bleistiftspitzer. Jakob fühlt sich von ihrem Ungestüm überrumpelt: »Nou äwer mal langsam, Mädche, dou mächs mich ja janz durchenanner.«
»Dou wirst net durchenanner Vadterche, eso kloar im Kopp wie heut warste schon lang net mehr!« Und Jakob steckte einen der Bleistifte in den Spitzer, drehte den knallroten Stift einige Male rund, so daß ein dünner Hobelspan auf die Tischplatte fiel.
»Dat is aber e fein Dinge«, sagte er, »so einen wollt ech als Kind immer han, aber mein Modter hat mir keinen jekauft, die hat jesagt, dofür han ech kein Jeld, und dan hatse mich jelehrt, die Bleistifte mit nem Küchemesserche zu spitzen.«
Jakob klappte den steifen Deckel des Schreibheftes auf und schrieb in seiner exakten Sütterlinschrift auf die erste Seite:
»Heute ist der zehnte Oktober neunzehnhundertfünfundzwanzig. Heute vor einem Jahr fiel ich, Jakob Krechel, von einem sehr hohen Birnbaum namens Alexander Lukas, der im Kuracker steht. Bin seither lahm. Kann nichts mehr arbeiten. Sitze den ganzen Tag am Fenster im Sorgenstuhl und gucke auf die Straße. Da gibt es manches zu sehen, was ich aufschreiben will. Dann ist es mir nicht mehr so langweilig. Vielleicht bin ich dann nicht mehr so arg verdrießlich.«
Als drei Wochen vergangen waren, hatte Jakob schon viele Seiten der Kladde mit seinen Aufzeichnungen gefüllt. Viel Platz nahmen die Wetterbeobachtungen ein. Ein Landwirt lebt das ganze Jahr mit dem Wetter, weil seine Existenz größtenteils davon abhängt.
Und weil er jetzt nicht mehr so düster vor sich hinstarrte, sondern jeden, der vorbeiging oder fuhr, freundlich grüßte, hielt so manch einer für ein paar Minuten vor dem Fenster an, besprach mit dem Jakob, der ja immer Zeit hatte, seine Feldarbeit, die Beschaffenheit des Bodens, oder den Stand der Saaten und Früchte.
Mit einem Male fühlte sich der Behinderte nicht mehr ausgeschlossen, ja, seine Interessen, die früher hauptsächlich seinem eigenen Betrieb und der vielen dazugehörigen Arbeit gegolten hatten, umfaßten jetzt fast das ganze Dorf. Eifrig studierte er die Bauernzeitung, informierte sich über die Preise, wußte bald Bescheid über alle Neuerungen und Möglichkeiten, die es im landwirtschaftlichen Bereich gab.
»Da muß ech emol de Krechels Jakob frage«, dieser Satz wurde mit der Zeit zum Sprichwort im Dorf. Oder auch, ab und zu etwas spöttisch, wenn einer gar zu dumme Fragen stellte: »Jank, un frag de Krechels Jäb, der weiß alles.«
So waren aber zu allen Zeiten die Eifeler, wenn ihnen einer von den Artgenossen zu gescheit und überlegen war, brauchte er für geheimen Neid und Spott nicht zu sorgen. Es sei denn, er hätte studiert, wäre Pastor, Lehrer oder etwa Amtsbügermeister geworden, dann war er anerkannt und kam samt seiner Verwandschaft zu großen Ehren.
Jedoch auch Jakob wurde von den meisten sehr geschätzt und oft um Rat gefragt. Manch Schlendrian machte sich nicht einmal mehr die Mühe, auf dem Kalender einzutragen, wann er die Sau zum »Bier« (Eber), oder eine Kuh zum Stier geführt hatte, der Krechels Jäb schrieb ja alles auf, hatte sogar schon ausgerechnet und notiert, wann dem betreffenden Tier »die Zeit aus« war.
So war das Leben für den gelähmten Bauern wieder erträglich geworden. Und wenn Gustav, sein Zweitältester, der eine kaufmännische Lehre in einem großen Weinhandel an der Mosel machte, abends auf seinem Fahrrad sitzend heimkam, jedesmal dicht unterm Fenster her fuhr, fröhlich winkte und rief: »Goden Owend, Vadter!« – dann wurde Jakob das Herz warm, wenn er den »staatsen Jungen« sah, der das gleiche rötlichblonde Wellenhaar hatte wie er. Und jeden Abend, als Schlußpunkt unter den jeweiligen Tagesbericht schrieb Jakob:
»Mein Gustav ist heimgekommen und hat mir gewinkt. Feierabend!«
Bald darauf brachte ihm Lena das Abendessen. Danach kamen Schwager Nikla und Sohn Ignaz, um ihn zu betten. Dankbar konnte er nun die Liebesdienste annehmen. Es ging recht munter zu. Sie machten ihre Späße, frozzelten sich gegenseitig, hatten oft etwas zu lachen, wenn der Nikla seine »Schnetz riß« (Scherze, Schnurren erzählen).
Später dann, nachdem die beiden mit »Gonacht« gegangen waren und Jakob wohlgebettet lag, kam auch Bäbchen, um sich neben ihn ins breite Bauernbett zu legen. Und das war der schönste Augenblick des ganzen Tages. Denn mittlerweile liebte er die behutsamen Zärtlichkeiten seiner kleinen Frau. Ihrer beider Liebe war umso inniger geworden, als die Leidenschaft nicht mehr zu ihrem Recht kommen konnte.
Sie kam jetzt viel früher ins Bett als sonst, gleich nach dem Abendessen, damit sie lange mit ihm reden konnte. Ihre Tochter übernahm derweil gerne die letzten Arbeiten in der Küche.
Bäbchen kuschelte sich an ihren Mann und hörte gespannt zu, wenn er ihr, und nur ihr, seine Aufzeichnungen vorlas. Es kam ihr alles so interessant vor, weil sie bisher kaum einmal aus dem Fenster hinausgeschaut hatte. Sie war sehr wenig unter die Leute gegangen, denn ihre eigene Familie hatte ihr vollauf genügt.
Jetzt erfuhr sie, wie viele Kinder morgens in die Schule trabten, wer am Sonntag regelmäßig in die Kirche ging, oder auch wer nicht hineinging, welche Freiereien sich anbahnten, und, daß der Hummesbauer heute sechs schwerbeladene Wagen mit Kartoffeln vom Falkenrod heimgefahren hatte.
»Dat is die neu Sort Krumbiere, die ›Ackersegen‹. Die tragen so schwer viel aus«, meinte Jakob.
»Schön dick sein se ja«, sagte Bäbchen daraufhin, »awer se schmecken net eso besonders gut, die kochen sich zo Matsch.«
»Dann kochste einfach Krombieresopp davon, un sonst han mir jo die ›Industrie‹, dat sein immer noch die besten Eßkrombiere. Aber wat janz anneres jaht mir durch de Kopp. Dat Wolfs Julche laaft dem Welche Josef hinnerher, – wenn dat emal gut jeht – ich fürchten, dat jibt noch e Malör.« Und Bäbchen erschrickt:
»En Christejung un e Judemädche! – Die dürfen doch net mitenanner jehn!«
»Vielleicht is et ja nur so en Kinderei, sag nu ja keinem wat davon.«
»Mach dir kein Sorje, Jäbche, ech schwätzen net mit annere Leut dadrüber, wat wir zwei miteinanner verzellt han.«
»Dat weiß ich jo, Bäbche. Dou bist dat beste Fraache wat et jet. Komm her, jof mir en Kuß, dann wollen mir schlafe. Ech sein eso müd.«
Zehn Jahre später war der Stapel der vollgeschriebenen Tagebücher zu einer stattlichen Höhe angewachsen. Sie bargen das Dorfleben der zwanziger und frühen dreißiger Jahre, enthielten aber wenig Politik, weil Jakob Krechel sich hierfür nie groß interessiert hatte. Jedoch nach Hitlers Machtergreifung war diese auch im kleinsten Dorf präsent. Da gab es plötzlich Aufmärsche in braunen Uniformen. Fackelzüge, die nicht am Sankt Mertesabend, sondern mitten im Sommer, zur sogenannten Sonnenwendfeier abgehalten wurden. Die Bauernzeitung hatte eine ganz neue Tonart anschlagen; der deutsche Bauer wurde mit aller Gewalt hochgelobt. Jakob verstand das nicht so recht.
Er war zwar immer gerne Landwirt gewesen, hatte die Arbeit auf seinen Äckern in der freien Natur jeder anderen vorgezogen, aber daß er etwas besonderes sein sollte? Die ganze Plackerei, wenig Bargeld, nur soviel Ertrag, daß man die Familie bescheiden ernähren konnte.
»Nä, nä, dat well mir net in de Kopp«, sagte er zum Ignaz, und legte die Zeitung beiseite.
»Dat sein üwerhaupt kein Gude, Vadter. Die Braune. Eweil han se die PX (Christus- Jugendgruppe) verbode. Auf em Sportplatz war vorig Woch e groß Sportfest. All Schullekinder aus em janze Kirchspiel, un die Lehrer waren da. Von alle sechs Dörfer. Do mußten sich all die Junge, die in der PX waren, dat sein die, die sonst in dene Prozessione immer mit dem Kaplan mit der PX-Fahn herumjezogen waren, mitte of dem Sportplatz offstellen, in einer Reih. Un dann hat der Dümmeser Lehrer, dat is en janz scharfe Hund, der hat die arme Junge anjebrüllt:
»Ihr PX-Schweine! Ihr Verräter! Ihr habt die deutsche Jugend verraten!«
Jakob meinte kopfschüttelnd: »Dat sein doch alles ordenliche Jungen gewest. Wieso sein dat auf einmal Verräter?«
»So is dat heutzutage, Vadter, wer net mit denen marschieren will, der hat nix mehr zu lachen. Un dat fängt schon in der Schul an. Jedenfalls durften die ehemalije PX-Junge net beim Sportfest mitmachen. Der Männtjes Karl hat an dem Morjen neben dem Sportplatz seine Hafer jesät. Der hat den Schulmeister brüllen jehört.«
Mit der Zeit bekam der Mann am Fenster immer weniger Lesestoff. Das Trierer Bistumsblatt, der sogenannte ›Paulinus‹ war verboten worden. Dann so nach und nach alle christlichen Missionszeitschriften, die in den Dörfern sehr beliebt gewesen waren.
Willmse Fritz brachte ihm eines Tages ein Werbeexemplar des Koblenzer »Nationalblatt«. Jakob studierte es sorgfältig. Es gefiel ihm überhaupt nicht. Sein einfacher, geradliniger Sinn verabscheute zu offensichtliche Propaganda für das »neue Deutschtum« ebenso, wie die menschenverachtende Hetze gegen Juden oder Andersdenkende.
Als Fritz ihn am anderen Tag fragt, ob er et »Nationalblatt« abonnieren wolle, antwortete der Krechels Bauer kurzerhand: »Nä, dat Dreckblatt läsen ech net!« Willmse Fritz, der immer schon ein gemeines Mundwerk gehabt hatte, der aber nun, da er im Dorf eine wichtige Funktion in der NSDAP innehatte, seine Machtgelüste an den Dorfleuten ausließ, sagte hämisch-drohend: »Dou beleidigst unsern Führer! Hol dich in Acht dou Krüppel! Sonst kimmste woannester hin. Mit so einem wie dou machen se heut kurze Prozess.«
Daraufhin warf Jakob das Nationalblatt im hohen Bogen auf die Straße, schloß dem Fritz das Fenster vor der Nase, und zog die Gardinen vor. Und der Krechels Jakob hatte die Lacher auf seiner Seite. Der Vorfall war nicht unbemerkt geblieben.
Im Dorf lebten seit jeher einige jüdische Familien. Bisher waren der Leo Hirsch oder der Jakob Wolf gerne am Fenster des Gelähmten stehengebliebe, für ein Schwätzchen. Jedoch er bemerkte, daß in der letzten Zeit der Leo nur scheu grüßte und eilends vorüber ging. Auch der Wolf und seine Frau Sara ließen sich nicht mehr sehen.
»He, Leo!« rief der Krechel eines Tages als dieser wiederum nicht vor dem Fenster haltmachte, »Wat is eijentlich los mit dir? Bist dou bös mit mir? Han ich dir eppes jedon?«
Fast erschrocken blieb der Jude Leo stehn, und nachdem er sich ängstlich umgesehen hatte sagte er leise: »Nä, nä, Jakob, dat darfste net denken, dou bist e braver Mann. Aber ich will dir kein Scherereie mache. Es reicht, wenn ich un mein Leut de Zoress am Hals han.« Noch bevor Jakob antworten konnte, hatte sich Leo mit eiligen Schritten entfernt. Der Gelähmte rief seinem ehemaligen Schulfreund noch nach: »Leo, woart doch emol, komm her, sagen ich dir!« Aber der drehte sich nicht mehr um.
Durch die Tagebücher marschierten die singenden Kompanien der deutschen Wehrmacht, als sie nach dem Kriegsausbruch ins Dorf einquartiert wurden und die Straße bevölker- ten. Jetzt waren es auf einmal fremde Gesichter, die zum Jakob aufblickten. Als nach dem ersten Kriegswinter der Frankreich- Feldzug begann und die deutschen Soldaten abzogen, ging das dörfliche Leben seinen gewohnten Gang. Die Feldarbeit fing an, jedoch größtenteils ohne die jungen Bauern und ohne Pferdegespanne. Die waren im Krieg. Polnische Kriegsgefangene trieben Ochsengespanne an.
Als aber an einem trüben Apriltage des dritten Kriegsjahres zwei Lastwagen auf der Straße hielten, SS-Männer in blanken, schwarzen Stiefeln mit schneidenden Befehlsstimmen die Szene beherrschten, alte und gebrechliche Menschen aus dem Wolfschen Hause getrieben und wie Vieh verladen wurden, hielt es den Jakob nicht mehr in seinem Stuhl gefesselt. Er stützte sich auf die Fensterbank, schrie und tobte: »Dir Verbrecher! Loaßt die arme Leut en Ruh!«
Als er aber mit der Faust gegen die Scheibe klopfte und »Heh, Heh!« schrie, verlor er das Gleichgewicht und kippte jählings in seinen Stuhl zurück. Dort hockte er nun wimmernd und fluchend. Er hatte sich das Steißbein verletzt. Ohnmächtig mußte er zusehen, wie seine alten Bekannten und Nachbarsleute gewaltsam verschleppt wurden. Er sah sie nie wieder.
Ganze Seiten seiner Hefte füllten sich mit Wut und Trauer. Trauer über sein Vaterland, das von Faschisten verführt und mißbraucht war. Trauer über all die Dorfjungen und die vielen Männer, welche an den Fronten einen sinnlosen Tod sterben mußten. Mitleid mit den Müttern, Witwen und Kindern, die in schwarzen Kleidern über die Dorfstraße den Totenmessen zustrebten. Auch Gustav befand sich seit langem an der Ostfront, während Ignaz noch für die Landwirtschaft ›reklamiert‹ war.
Jedoch es kam der Tag, an dem Jakob Krechel in eines der aus schlechtem, grauen Kriegspapier gefertigten Hefte schreiben konnte:
»Jetzt ist der Krieg bald zu Ende. Ich höre Kanonendonner. Die Amerikaner sind im Anmarsch. Möge der Herrgott unser Dorf beschützen!«
Am nächsten Morgen in aller Frühe erzitterte das alte Bauernhaus vom Kellerboden bis zum Dachfirst. Bäbchen rüttelte ihren noch fest schlafenden Mann und rief ängstlich:
»Jakob, Jakob, wach off! Jakob wat ist dat?« Aber der wußte im ersten Moment keine Antwort. Und in all dem Getöse sahen sie beide plötzlich, wie sich draußen riesige Schatten durch die Dämmerung des Märzmorgens an ihrem Fenster vorbeischoben.
»Der Ami!« murmelte Jakob, »un eweile sein ech net an der Finster für zu gucken.«
»Vielleicht is et auch besser«, meinte Bäbchen voller Furcht, »am End täten se dich totschießen.«
»Dat jelawen ech net, die Amerikaner schießen net of Zivilpersone«, beruhigt Jakob seine Frau. Es sollte sich aber für dieses Dorf später einmal als Irrtum erweisen.
Heute saß Jakob früher als gewöhnlich am Fenster und beobachtete die Fremden, bestaunte die praktischen Uniformen und die schwere Ausrüstung der Sieger. Wenn sie auch im Allgemeinen den Dorfleuten nichts zuleide taten, traten sie doch als die Sieger auf. Betraten ohne anzuklopfen, mit gezogenen Machinenpistolen die Häuser, trieben die Leute hinaus und »nahmen Quartier«. Die erschrockenen Menschen zogen mit Sack und Pack in ein noch nicht beschlagnamtes Nachbarhaus, oder in die Futterküche des eigenen Gehöftes.
Einer der Offiziere war ein nach den USA emigrierter, deutscher Jude. Als er den Jakob Krechel in seinem Krankenstuhl sitzen sah, durften der und seine Familie im Hause bleiben. Jedoch es dauerte nicht lange, da kam ein halbes Dutzend Familien aus dem Dorf. Sie hatten die Anweisung bekommen im Haus Nummer fünfundachzig zu wohnen. Das war Krechels Haus. Bald waren alle Stuben und Kammern mit Menschen, und ihren Habseligkeiten vollgestopft.
Auch in Jakobs Zimmer logierten vier ältere Männer. Die zwei gebrechlichsten lagen nachts in Bäbchens Bett, die anderen auf Strohsäcken am Fußboden. Bäbchen kam nur tagsüber ins Zimmer, nachts mußte sie irgendwo bei den Frauen schlafen.
Da hatte der Gelähmte den ganzen Tag Ansprache. Er kam nicht mehr zum Schreiben, und hätte es doch gar zu gerne getan. Aber der Mauers Großvater und der Schreinich Jusep hatten noch »Siebzig-einundsiebzig« mitgemacht. Aufgewühlt durch die Ereignisse, redeten sie von nichts anderem. Jakob aber dachte bei sich: »Wenn alles erum is, dann schreiwen ich dat aber all off.«
Die ersten drei Jahre nach Kriegsende änderte sich nicht viel an der Lebensweise in den Dörfern. Saat und Ernte bestimmten die Jahresabläufe, wie sie es seit hunderten von Jahren taten. Als ein besonderes Ereignis konnte der Mann am Fenster jedesmal registrieren, wenn einer der Dörfler aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte. Sie kamen von der Landstraße her. In abgerissenen Kleidungsstücken, mit einem glücklichen Lächeln in den abgezehrten Gesichtern. Und aus den tiefliegenden Augen kam ein Leuchten.
»Endlich sein ech wieder dehaam!«
Als dann eines Tages auch endlich der Gustav aus Rußland zurückkam, räumte ihm sein Vater eine ganze Seite im Tagebuch ein:
»Heute, am siebenundzwanzigsten August neunzehnhundertachtundvierzig, ist unser jüngster Sohn, Gustav Krechel, nach vierjähriger Gefangenschaft aus dem weiten Rußland zurück in die Eifel gekommen, und in sein Vaterhaus heimgekehrt. Lieber Herrgott, wir danken dir! Amen, Alleluja!«
Doch vorher hatte die Begrüßung stattgefunden. Gustav hatte dem alten Mann die Hände geschüttelt.
»Tach Vadter, bie jeht et dir dann noch?«
»Goot, Jung, goot, – eweile jaht et mir goot!« Er kam ins Stocken, weil es ihm die Sprache verschlug. Und dem Heimkehrer rannen die Freudentränen über seine mageren stoppeligen Backen, auf denen sie zwei helle Streifen hinterließen.
Dann hob er seine Mutter ans Herz und drückte sie so heftig an sich, daß die kleine Frau nach Luft schnappte.
»Jung, laß mich los«, japste sie. Gustav hielt Bäbchen mit beiden Armen von sich gestreckt, sie war federleicht. Er sah auf einmal wie blaß eingefallen und verhärmt das zarte Gesicht seiner ehemals bildhübschen Mama war.
Zu hart war ihr das lange Warten auf ihren Jungen und das Leben überhaupt gewesen. Still und klaglos hatte sie ihre Pflichten erfüllt. Der Kranke im Haus war ja Jakob, nicht Bäbchen. Und darum hatten Lena und Ignaz nicht bemerkt, wie ihre Mutter immer mehr zusammenschrumpfte. Auf den Geschwistern lastete neben ihrem Anteil an der Krankenpflege die schwere Feldarbeit.
Als nun ihr Nesthäkchen Gustav endlich wieder zu Hause war, legte sich die kleine Mutter einfach ins Bett und stand nicht mehr auf, weil die letzte Kraft sie mit einem Male verlassen hatte. Es war, als hätte sie die ganze Zeit nur noch für diesen Augenblick gelebt und sich aufrecht gehalten.
Ihr Mann aber war zum zweiten Male in seinem Leben gelähmt. Seinen Händen entglitten Bleistift und Papier, er wollte nicht länger am Fenster sitzen. Er blieb im Bett liegen um Bäbchen nahe zu sein. Und wenn er sie streichelte, lächelte sie dankbar und flüsterte: »Jäbche, dou has eweil Händ eso fein wie en Häär«, sie wollte noch etwas hinzufügen, aber ein Hustenanfall schüttelte sie plötzlich.
Dann brachte sie mühsam hervor: »Sei mir net bös – et tut mir so leid für dich – ech muß dich bal verloße –«.
»Bäbche, sag so eppes net! Dou wirs widder jesund! Bat soll ich dann ohne dich anfange? Bäbche, mäi lev Herzje, loß mech net ellaan!«
»Jäbche, sei net eso verdreeßlich, in Jedanken bleiwen ech immer bei dir – un – denk dou och immer an mich, un denk dran, dat ech dich jäärhan, egal ob ech hier of der Welt, oder in der annere Welt sein. – Un, tu wieder schreiwe, dann wird dir die Zeit net eso lang, bis dou lo owe bei mich kimms.«
Obwohl der Arzt zweimal wöchentlich zum Bäbchen kam, konnte er ihr nicht mehr viel helfen. Ihr Herz war sehr schwach. Eines frühen Morgens im Advent hörte es auf zu schlagen. Als Jakob aufwachte und »Gode Morje mei Levje, haste gut jeschlaf«, sagte, lag sie ganz still, mit einem Kinderlächeln im Gesicht. Es war das erste Mal seit sie sich kannten, daß sie ihm nicht anwortete. Jakob knipste das Licht an und sah, daß sie es nun nie mehr tun würde. Bäbchen wurde mit dem ersten Schnee begraben.
Sechs Wochen später lag Jakob noch immer im Bett und starrte auf das leere Bett neben dem seinen. Er streichelte Bäbchens Kissen und flüsterte ihren Namen. In der folgenden Nacht hatte er einen Traum; seine Frau lag wie früher neben ihm und lächelte ihm zu. »Jakob«, sagte sie, »Jakob, bat haste mir versproch?! Stand off! Fenk wieder an zu schreiwe!«
Als am Morgen Lenchen in die Kammer trat, sagte er: »Ruf mir de Ignaz un de Gustav, ech well offstohn.«
»Ja Vadter, dat is gut, et wird aber och höchste Zeit, dat dou dich aus em Bett machst«, freute sich die Tochter und eilte hinaus, ihren Brüdern die gute Nachricht zu überbringen.
Kaum saß Jakob in seinem Stuhl am Fenster, griff er nach dem Schreibzeug. Unsicher und zittrig reihte er die Buchstaben hintereinander:
»Heute Nacht war mein Bäbchen hier und hat gesagt, ich soll aufstehen und schreiben, aber mir fällt nichts ein.«
Jakob starrte auf die verschneite Dorfstraße. Es gab außer Schnee nicht viel zu sehen, die Schulkinder waren schon vor einer halben Stunde vorbeigestapft. Nur ganz oben am Ende des Dorfes sah er zwei Männer Schnee schaufeln. Er setzte seinen Brille auf und erkannte die beiden: Männtjes Matthes und Lauxe Alois. »Dat lohnt sich net, für offzuschreiwe, Schnieschäppe is wirklich nix Besonderes.« Seufzend schrieb er auf’s Papier:
»Schnee, nix als wie Schnee!« – Plötzlich kam er in Fahrt. »Schnee liegt nun auch auf meinem Bäbchen seinem Grab, welches ich noch nicht mal besuchen kann. – Aber das macht ja nichts, denn sie hat gesagt, daß sie im Geiste immer bei mir bleibt. Das ist besser, als so ein Grab besuchen.«
Von jetzt an unterhielt sich der Witmann jeden Tag mit seiner geliebten Frau – auf dem Papier. Er erinnerte sich mit ihr gemeinsam an den Tag, wo sie sich näher kennenlernten, an die folgenden Begegnungen, als sie sich ineinander verliebten. Und der Behinderte hatte ein glückliches Leben, jetzt, da er sich ganz intensiv an vieles erinnerte und es zu Papier brachte.
Es war eine Liebesgeschichte ersten Ranges, die da entstand. Niemand durfte hineinschauen. Es war sein Geheimnis. Wer hätte einem Eifelbauern solche innigen Worte und Gefühle zugetraut? Und Lena respektierte sein Geheimnis, um so mehr, als sie froh war, daß der Vater die verzweifelte Trauer überwunden hatte. Die Dorfbewohner freuten sich ebenfalls sehr, als sie den Krechel wieder am Fenster sitzen sahen. Sie winkten ihm zu, riefen »Gode Morje!« und »Goden Dach!«
Sobald es Frühjahr wurde, öffnete die Sonne mit ihren ersten, warmen Strahlen dem Jakob das Fenster, und die Leute blieben vor ihm stehen wie vordem. Hier war einer, der hatte immer Zeit für sie. Sie brachten ihre kleinen und großen Sorgen zu ihm, und Jakob hörte zu, gab ein gutes Wort, einen Rat, wenn er ihn wußte, oder, wenn es angebracht war, machte er einen Witz zur Aufmunterung oder zur Mahnung, je nach dem mit wem er es zu tun hatte.
Die Jahre gingen ins Land. Die Dorfstraße wurde aufgebrochen, Wasserleitung und Kanal gelegt, und obenauf legten sie ein schönes, sauberes Pflaster aus Mayener Basalt. Das Klappern der Pferdehufe klang jetzt lauter, und scheppernder die eisenbereiften Räder der Ackerwagen, aber es war mit der Zeit immer seltener zu hören.
Eines Tages sah und hörte Jakob Krechel den ersten Traktor vorüber tuckern. Wer jetzt noch etwas gelten wollte, mußte einen Traktor haben. Dazu kamen ein sogenannter »Plattwagen« mit dicken Gummireifen und die passenden Ackergeräte. Das alles kostete mehr Geld, als vorerst aus dem Land herausgewirtschaftet werden konnte, und die Männer waren gezwungen, eine Nebenbeschäftigung anzunehmen.
Auch Ignaz arbeitete »auf dem Bau«. Wer zu Hause bleiben mußte, war Lena. Denn sie hatte ihrer Mutter versprochen, immer für den kranken Vater zu sorgen.
Während Gustav bei einer Koblenzer Bank eine gute Stellung gefunden und bald darauf eine Familie gegründet hatte, wurde aus »Lenchen« ein altes Mädchen.
Sie war glücklich, wenn Gustavs Kinder zu Besuch kamen, und tat ihnen alles zu Liebe. Die gute »Tante Leni« war für den kleinen Gerhard und sein Schwesterchen Babsi das Idol. Aber keiner sah, wie Lenchen den Wunsch nach eigenen Kinder tief in sich begraben mußte. Welcher Bursche heiratete schon ein spätes Bauernmädchen ohne Charme, welches darüber hinaus auch noch in erster Linie für seinen gelähmten Vater da sein mußte?
Magdalena Krechel besaß äußerlich rein gar nichts von der Grazie ihrer zierlichen Mutter, die mit ihren kleinen Füßen so leicht aufgetreten war, als schwebe sie dahin. Aber Lena behielt ein Leben lang ein »chen« als Anhängsel an ihrem Namen, das ihr Bäbchen dort zärtlich drangehangen hatte, als das kleine Mädchen das Licht der Welt erblickte.
Im Grunde genommen paßte es auch zu ihrer immer noch kindlichen Seele. Ihr Körper aber war groß, stark, vierschrötig und robust. Dabei konnte man ihr Gesicht nicht als unschön bezeichnen; hellhäutig, rotwangig mit frischen Lippen und klugen, warmen Braunaugen. Ignaz sah sich nicht nach einer Frau um. Die Fürsorge seiner friedlichen, liebevollen Schwester genügte ihm vollständig.
Er arbeitete den Hof in die Höhe, baute einen riesigen, modernen Schweinestall, Ferkelzucht und Schweinemast brachten momentan gutes Geld. Während das Schweinefüttern bislang immer Frauenarbeit war, übernahm Ignaz jetzt die Fütterung der Mastschweine. Lena betreute die Sauen mit den Ferkelchen, die von den anderen Schweinen getrennt in einem kleineren Stall in ihren sauberen Boxen lagen.
So ein Wurf neugeborener Schweinchen war etwas sehr niedliches. Wenn jedes von ihnen seine Zitze bei der Muttersau gefunden hatte, und alle lagen eifrig und friedlich nuckelnd in einer dichtgedrängten Reihe, konnte Lena sich nicht satt sehen. Am liebsten war es ihr aber, wenn Gerdchen und Babsi dabei standen. Die preßten die Gesichter ans Gatter und lugten durch die Ritzen.
»O wie goldig«, flüsterte das kleine Stadtmädchen ein ums andere Mal. Es durfte nicht laut plappern, weil es sonst die friedlich daliegende Sau aufgeschreckt hätte. In dem Falle konnte es geschehen, daß diese aufsprang um ihre Kinder zu verteidigen, aber dabei großen Schaden anrichtete, wenn sie auf den Ferkelchen herumtrampelte.
Wenn Ignaz die Mastschweine fütterte, erhob sich ein fürchterliches Gekreische in dem großen Stall. Er schob eine Schubkarre mit Getreideschrot und Kraftfutter durch den Mittelgang und gab den kreischenden Borstentieren mit der Schippe ihre Rationen. Wasser floß aus der Leitung unmittelbar in die langen Tröge. Es brauchten keine schweren Futtereimer mehr geschleppt zu werden.
Jakob wunderte sich, wenn zur Fütterungzeit das infernalische Gekreische durch das offene Fenster bis in seine Kammer drang.
»Wie viel Wuzze haste eijentlich?« fragte er seinen tüchtigen Sohn.
»Siewenundreißich, ohne die acht Ferkelssäu«, gab der zur Antwort.
»Ei Dunnerwedder, dann biste ja en Großbouer! Dein Modter un ich, mir waren im Herbst froh, wenn mir drei Wuzze fett hatten, eins für zu schlachte, und zwei für zu verkaafe.«
»Vadter, dat is net esu wie dou denks. Der Stall is noch net janz bezahlt, und dat Kraftfoder kost och viel Jeld. Aber ich sein zufriedde. Wenn die nächste zwanzich Säu fortjiehn (verkauft werden), kaafen ich Dir en Rollstuhl. Dat versprechen ich dir. Dann kannste im Frühjahr erraus in et Grüne foahre.«
Jakob Krechel geniert sich: »All die Joahr han ech nix mehr jeschafft, ech will euch kein Unkoste machen.«
Da sagte Ignaz gutgelaunt: »Schwätz doch net eso en Quatsch, Vadter. Wofür verdienen ich dann dat Jeld, wenn ich et net für mein nächste Leut ausjeben darf? Ich han doch kein Fraa un kein Kinder zu versorjen.«
»Un borim heirodste net? Dou wirst doch bal en alte Kerl!«
»Laß gut sein, Jäbche, ich han kein Lust für zu heirode, mir jeht et doch auch so janz gut.«
Jakob dachte für sich: »Och gut, jeder soll so leben, wie et ihm am besten behagt«, und er erwähnte das Thema ›Heirat‹ nie mehr bei seinem Sohne.
Der Schulweg
Auf der geteerten Landstraße, die vom Moseltal aufwärts in die Eifel führt, trotten an einem schwülen Frühsommertag zwei halberwachsene Kinder heimzu. Ein fünfzehnjähriges Mädchen und ein vierzehnjähriger Junge. Die schweren Schultaschen hängen an Lederriemen über die eine Schulter geworfen, ein Umstand, der die Kinder ein wenig schief nach einer Seite gebeugt zu gehen nötigt, müde und verdrossen.
Früh um halb sechs schon aus den Federn, dann zum überfüllten Bus in der Dorfmitte. Der fährt über mehrere Dörfer und bis hinunter zur Bahnstation im Tale, wo die Schüler eine dreiviertel Stunde auf den Zug warten, der sie in die Kreistadt bringt, wo das Gymnasium hoch über der Stadt auf einem Berg thront und nur im Laufschritt rechtzeitig zum Schulbeginn zu erreichen ist.
Fünf Stunden Unterricht, die schlauchen ganz schön. Danach in der Stadt, im von Schülern überfüllten Buchladen, ein paar Hefte und andere Schreibutensilien gekauft, auf dem Weg zum Bahnhof ein bißchen gebummelt, und der Zug fährt ihnen vor der Nase fort. Das ist weiter kein Beinbruch, falls man noch ein paar Groschen Geld in der Tasche hat, wartet man im Bahnhofslokal anderthalb Stunden auf den nächste Zug, während man ein Cola oder Limo trinkt. Aber Geld haben die zwei nicht, der Mißmut steigt und steigert sich, als der Anschlußbus in K. dann selbstredend auch schon lange fort ist.
So trotten die beiden die steile Chaussee hoch. Kempers Eva, ein hochaufgeschossenes, dünnes Mädchen, und Welche Peter, der um einen Kopf kleiner, sein noch kindlich wirkendes, dickbackiges Schuljungengesicht häufig mit treuem Dackelblick von schräg unten auf das seiner heimlich verehrten, blonden Eva richtet. Sie sind die ganze Zeit darauf bedacht, einen vorbeifahrenden PKW zu stoppen, aber es ist wie verhext heute, alle kommen aus der entgegengesetzten Richtung, nur zwei Fahrzeuge überholen sie und halten trotz der penetrant ausgestreckten linken Arme mit den hochgestellten Daumen nicht an.
»Scheiße!« ruft Peter, ein Wort, das ihm seine Mutter mindestens hundert Mal ohne wesentlichen Erfolg verboten hat. Dieses Wort, in jeder gesitteten Familie bis dato streng verpönt, ist jetzt groß in Mode bei den Jugendlichen, und sie gebrauchen es ausgiebig; bei jedem Frust, bei jedem kleinsten Anlaß, der sie »anödet«.
Es ist ein schöner Junitag, wolkenlos blau der Himmel, der sich im hohen Bogen vom Hunsrück über das mit Reben bestückte Tal, bis zu den Rändern der Voreifel spannt. Die zwei durchwandern ein schattiges Waldstück, um anschließend der hitzigen Sonne noch mehr ausgeliefert zu sein. Eva, die sonst voller Entzücken den jubilierenden Waldvögeln oder den aus den Fluren aufsteigenden Feldlerchen lauscht, verspürt heute keine Lust dazu. Sie hat Durst, die Zunge klebt ihr am Gaumen. Sie will nur eins: daheim am Hofbrunnen den Pumpenschwengel bedienen, das klar-kalte Wasser auf der Haut spüren, das sie sich über Gesicht und Glieder laufen läßt, und mit beiden Händen einen Becher bildend, das köstliche Naß in sich hineinschlürfen.
Es ist heute nicht das erste und nicht das letzte Mal, daß sie auf diese mühsame, unbequeme Weise ihren Schulweg absolvieren, oft erst spätnachmittags nach Hause kommen. Aber sie gehen diese Wege mit zäher Entschlossenheit, acht lange Jahre, denn sie wollen »eppes werden«. Und sie sind nicht die einzigen aus dem Dorf, denn die anderen hatten ja heute rechtzeitig Bahn und Busse erreicht.
Welche Peter trifft daheim auf eine verschlossene Haustüre, der Schlüssel liegt aber auf einem kleinen Sims darüber. In der Küche liegt ein Zettel auf dem Tisch: Essen steht im Backofen, wir sind in die Rummele, komm nach und bring den Kaffeekorb mit.«
»Scheiße!« brummt der Junge dieses Mal noch mehr angeödet, denn es ist schon vier Uhr durch, da bleibt ihm aber keine Minute Zeit zum ausruhen. Er trinkt fast einen Liter Brunnenwasser, öffnet dann den Backofen aus dem ihm der Geruch des verbrutzelten Mittagessens säuerlich entgegenkommt.
»Brrr, soure Bunne un fett Fleisch!« Wütend knallt er die Backofentüre zu. Auf der Herdplatte steht ein großer Kessel Malzkaffe, den er in zwei emaillierte Blechkannen umfüllt. Dann schnappt er sich den mit Butterbroten gefüllten Korb und begibt sich auf den Weg »in die Rummele«, zum Rübenacker. Dort trifft er auf den Rest der Familie; die Mutter mit drei Geschwistern, die über die heiße Ackerkrume gebeugt, die langen Reihen der kleinen Runkelrüben vereinzeln. Als Peter schnaufend seine Last abstellt und sich daneben auf die Erde sinken läßt, in den Korb greift und sich »en Botterbreck« herausangelt, sind seine Geschwister keinesfalls nett zu ihm.
»So spät kumme, noch nix jeschafft, un sich als erster üwer den Brotkorv hermache!« Jedoch seine Mutter Anna ist gut und freundlich.
»Loßt den Jung in Ruh, der is bestimmt schun weit zu Fuß jange heut!«
»Ja, ja, dat kennt man, mit seinem liebe Evche in der Stadt erum trendele un den Zug vepassen!« spottet Ursula, Peters um ein Jahr ältere Schwester, die in die gleiche Schule geht wie er. Knallrot im Gesicht vor Verlegenheit und Wut zischt er durch die Zähne: »Halt dou nur die Schnüss!« und wirft ihr eine Handvoll Erde über den Kopf. Sie plärrt laut drauf los und versucht mit beiden Händen, den Grund aus ihrem schwarzgekrausten Haar zu kämmen. Die schönen, neuen Dauerwellen! Die »Großen« Josef und Marianne halten sich »draus«, aber die Mama steht da, stützt beide Hände in ihr schmerzendes Kreuz und jammert ein bißchen: »Wenn der Papa net dabei ist, seid ihr net zu genießen!«
Kempers Eva geht es bedeutend besser als Peter, sie wird von ihrer Mutter Christine fürsorglich empfangen.
»Dou arm Mädche, wat biste eso verhitzt. Ruh dich aus, ich bring dir eppes Gutes zu essen.«
»Mama, ich han keine Hunger, ich han zu viel Wasser jetrunk.«
»Dann wart e bisje, ich han en feine Schokoladenpudding mit Vanillesoß, in einer Viertelstund kannste den essen.«
»Gut Mama«, sagt das Mädchen, und sie streckt sich erst einmal auf dem Kanapee aus. Eva ist das dritte Kind von Müller Arnold und Christine, seiner Frau. Da sind noch zwei ältere Brüder, Johannes und Franz, und eine jüngere Schwester, die zehnjährige Margret, die noch mit Puppen spielt. Johannes ist schon in Mainz auf der Uni, er will Ingenieur werden. Franz steht kurz vor dem Abitur. Vorerst ist der Arnold noch Manns genug, um seinen ständig wachsenden Müllereibetrieb zu leiten, sowie die meiste Arbeit selber zu machen. Jedoch hofft er sehnlichst, daß einmal einer seiner Söhne sein Lebenswerk fortführen wird.
»Sie sollen zuerst emal ihre Ausbildung machen«, sagen Arnold und Christine, »et soll ihnen net so ergehen wie uns, wir mußte in erster Linie für uns Eltern schaffen, un durften net lernen wat mir wollten.« Das ist aber jetzt die Einstellung der meisten Eltern. Es hat sich da eine umwälzende Veränderung vollzogen. Früher waren auf dem Lande die Kinder für die Eltern da, und nicht umgekehrt. Und so ist dieser Generation die Verantwortung und Fürsorge von beiden Seiten aufgebürdet: die für ihre Eltern und die für ihre Kinder.
Hummes Bärbel
Da ist zum Beispiel der Hummeshof, den Dinas älteste Tochter Barbara und ihr Mann Klaus übernommen haben. Sie haben zwei Kinder, der elfjährige Matthias pilgert auch schon jeden Morgen zum Gymnasium in die Kreisstadt. Zu ihm sagt heute keiner mehr: »Dou muß daheim bleiwe un Bauer werden, mir brauchen dich!«