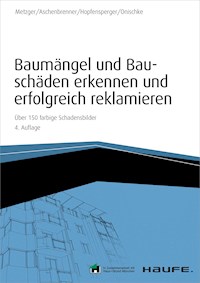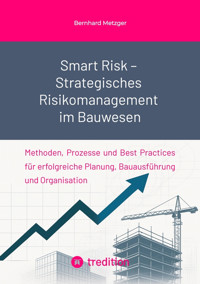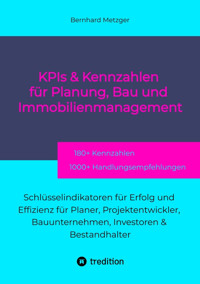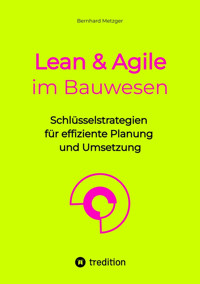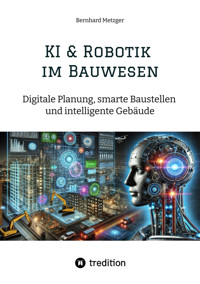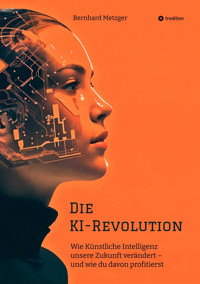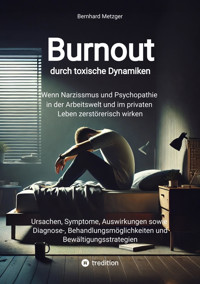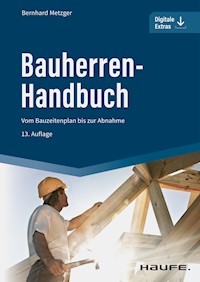Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumVorwort zur 4. Auflage1 Ansprüche bei Baumängeln und deren erfolgreiche Durchsetzung1.1 Baumängel können zu Bauschäden führen1.2 Die Ansprüche bei Mängeln1.2.1 Wann ist die Werkleistung mangelhaft?1.2.1.1 Entspricht die erbrachte Leistung den Erwartungen des Bauherrn?1.2.1.2 Der Unternehmer haftet für den Eintritt des Erfolgs1.2.1.3 Haftet der Auftragnehmer auch für Verschleiß?1.2.2 Die Abnahme als zeitliche Zäsur1.2.2.1 Wann muss abgenommen werden?1.2.2.2 Wann besteht eine Verpflichtung zur Abnahme?1.2.2.3 Abnahme, obschon noch Mängel vorhanden sind?1.2.2.4 Rückhalt des Werklohns1.2.2.5 Wenn die Abnahme trotz Mängel ohne Vorbehalt erfolgt1.2.2.6 Wie läuft eine Abnahme ab?1.2.2.7 Ablauf der förmlichen Abnahme1.2.2.8 Können auch Teile der Werkleistung abgenommen werden?1.2.2.9 Muss auch die Architektenleistung abgenommen werden?1.2.3 Für Bauwerksmängel muss nicht immer nur der Unternehmer verantwortlich sein1.2.3.1 Wenn ein Baumangel von mehreren verursacht wurde1.2.3.2 Wenn mehrere ausführende Unternehmer einen Mangel verursacht haben1.2.3.3 Wenn den Auftraggeber an der mangelhaften Leistung eine Mitschuld trifft1.2.3.4 Zwei Varianten des Mitverschuldens1.2.3.5 Der Bauherr/Auftraggeber muss es nicht selbst gewesen sein1.2.3.6 Baubeteiligte als Erfüllungsgehilfen des Bauherrn1.2.3.7 Welche Folgen hat ein mitwirkendes Verschulden des Auftraggebers oder dessen Erfüllungsgehilfen?1.2.4 Die Mängelansprüche im Einzelnen1.2.4.1 Das Recht des Unternehmers zur zweiten Andienung1.2.4.2 Wenn die Frist zur Nacherfüllung erfolglos abgelaufen ist1.2.4.3 Anrechnung von Gebrauchsvorteilen1.2.4.4 Schadensersatz1.2.5 Wenn bereits im Zuge der Ausführung Mängel auftauchen1.2.5.1 Regelung beim BGB-Vertrag1.2.5.2 Regelung beim VOB-Vertrag1.2.6 Haftungsbeschränkungen für Auftragnehmer1.3 Was bei Wohnungseigentum beachtet werden muss1.3.1 Mängel, für die noch der Bauträger geradestehen muss1.3.2 Der Anspruch auf Instandsetzung1.4 Mängelansprüche beim vermieteten Objekt1.5 Vorsicht vor der Verjährungsfalle1.5.1 Was bedeutet Verjährung?1.5.2 Wann verjähren Mängelansprüche?1.5.3 Wann beginnt die Verjährungsfrist zu laufen?1.5.4 Mit Ablauf der Regelfrist muss noch nicht Schluss sein1.5.5 Abweichende Vertragsklauseln sind meist nicht wirksam1.6 Sicherung von Mängelansprüchen1.6.1 Gesetzliche Absicherung der vertragsgemäßen Erfüllung1.6.2 Der Sicherheitseinbehalt1.6.3 Vereinbarung von weiteren Sicherheiten1.7 Recht haben und Recht bekommen1.7.1 Das Problem der Beweislast1.7.2 Beweissicherung1.8 Möglichkeiten der außergerichtlichen Einigung1.9 Der Gang vor das Gericht2 Schadensbilder (technisch)Einleitung2.1 Die häufigsten Mängel und Schäden an Fassaden2.1.1 Verputzte Fassaden2.1.2 Wärmedämmverbundsysteme2.1.2.1 Dämmstoffe2.1.2.2 Befestigung2.1.2.3 Oberputz2.1.3 Der Einsatz von WDVS2.1.4 Der Außenputz2.1.5 Schädliche Risse2.1.6 Schäden durch Putzanschlüsse2.2 Schäden und Mängel an Steil- und Flachdächern2.2.1 Steildächer2.2.1.1 Dachstuhl2.2.1.2 Dachaufbau2.2.2 Flachdächer2.2.2.1 Abdichtung2.2.2.2 Wärmedämmung2.2.2.3 Dachkonstruktion2.2.2.4 Undichtigkeiten2.2.2.5 Sanierung2.2.2.6 Gealterte PVC-Abdichtung2.2.2.7 Umkehrdach2.2.3 Spenglerarbeiten2.3 Die häufigsten Schäden an Bodenkonstruktionen2.3.1 Schadensursachen2.3.2 Messmethoden2.3.2.1 Feuchtigkeitsmessung mit Aktiv-Elektroden2.3.2.2 Feuchtigkeitsmessung mit Tiefen-Elektroden2.3.2.3 Feuchtigkeitsmessung mit der CM-Methode2.3.3 Weitere Ausführungsmängel2.3.4 Schäden am Estrich2.3.4.1 Estricharten2.3.4.2 Mindestdicke, Fugenausbildung, Feldgröße und Ausgleichsschicht2.3.5 Fliesen- und Plattenbeläge2.3.5.1 Belastbarkeit der Fliesen2.3.5.2 Verlegeverfahren2.3.5.3 Verlegefehler2.3.6 Parkettbeläge2.3.6.1 Parkettarten2.3.6.2 Eigenschaften2.3.6.3 Häufige Schadensbilder2.3.7 Laminatbeläge2.3.7.1 Beanspruchungsklassen2.3.7.2 Beurteilung von Fehlern2.3.8 Teppichbeläge2.3.8.1 Die Herstellungsverfahren2.3.8.2 Vorder- und Rückseite2.3.8.3 Klebeverfahren2.4 Die häufigsten Schäden an Fenstern2.4.1 Fensterrahmen2.4.2 Verglasung2.4.2.1 Glasarten2.4.2.2 Sonstige Fensterbestandteile2.4.3 Fenstermontage2.4.3.1 Schaden bei festverglasten Elementen2.5 Die häufigsten Schadensursachen an Dränagen2.6 Schimmelpilze und Bakterien in Gebäuden2.6.1 Grundlagen für das Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien in Innenräumen2.6.2 Bauphysikalische Grundlagen2.6.2.1 Tauwasserausfall auf Bauteiloberflächen2.6.2.2 Durchfeuchtungen der Bauteile2.6.3 Ursachen für das Auftreten von Schimmel in Wohnräumen2.6.4 Prüf- und Messverfahren für die Bestimmung von Schimmelpilz2.6.5 Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelpilzbefall2.6.5.1 Bauseitige Maßnahmen2.6.5.2 Nutzerbedingte Maßnahmen2.6.6 Vorgehen bei Schimmelpilzwachstum in Innenräumen2.7 Die häufigsten Ursachen für unzureichenden Schallschutz2.7.1 Schallschutz für Decken2.7.2 Schallschutz für Wände2.7.3 Trittschallschutz2.7.4 Schallschutz für Treppen und Treppenpodeste2.7.5 Schallschutz für Armaturen2.7.6 Mindestluftschalldämmung von Außenbauteilen2.7.7 Schallschutz von Fenstern2.7.8 Schallschutz von Türelementen2.7.9 Prüf- und Messverfahren bei Schallschutzproblemen2.8 Die häufigsten Schäden im Bereich der Haustechnik2.8.1 Sanitärinstallation2.8.2 Heizungsinstallation2.8.3 Elektroinstallation3 Bauschadensfälle3.1 Die Bauschadensfälle im Überblick3.2 Flachdächer: Flachdach mit Titanzinkeindeckung3.2.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.2.2 Grundlagen zur Korrosion3.2.2.1 Feuchtigkeit3.2.2.2 Belüftung/Sauerstoff3.2.3 Schadensursachen3.2.3.1 Falzdichtungsmaßnahmen3.2.3.2 Unterkonstruktion/Trennlage3.2.4 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.2.5 Instandsetzung3.2.6 Sanierungskosten3.2.7 Hinweise zur Schadensvermeidung3.2.8 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter3.3 Flachdächer: Undichtigkeiten infolge von Rissbildung in der Foliendeckung3.3.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.3.2 Schadensursachen3.3.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.3.4 Instandsetzung3.3.5 Kostenschätzung3.3.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.3.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter3.4 Balkone: Wassereintritt durch nicht fachgerechten Anschluss3.4.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.4.2 Schadensursachen3.4.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.4.4 Instandsetzung3.4.5 Kostenschätzung3.4.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.4.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter, Literatur3.5 Balkone: Krakeleerissbildung in der Beschichtung3.5.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.5.2 Schadensursachen3.5.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.5.4 Instandsetzung3.5.5 Kostenschätzung3.5.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.5.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter3.6 Holzbau: Schimmel an der Untersichtschalung3.6.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.6.2 Schadensursachen3.6.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.6.4 Instandsetzung3.6.5 Kostenschätzung3.6.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.6.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter3.7 Außenputze: kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung3.7.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.7.2 Schadensursachen3.7.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.7.4 Instandsetzung3.7.5 Kostenschätzung3.7.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.7.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter3.8 Außenputze: WDVS mit Kunstharzoberputz, Blasenbildungen3.8.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.8.2 Schadensursachen3.8.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.8.4 Instandsetzung3.8.5 Kostenschätzung3.8.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.8.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter, Literatur3.9 Außenputze: Algenbildung auf WDVS3.9.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.9.2 Schadensursachen3.9.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.9.4 Instandsetzung3.9.5 Kostenschätzung3.9.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.9.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter, Literatur3.10 Verblechungen und Metallarbeiten: Putzabplatzungen3.10.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.10.2 Schadensursachen3.10.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.10.4 Instandsetzung3.10.5 Kostenschätzung3.10.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.10.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter3.11 Fenster und Außentüren: Wassereintritt am Fenster und im Fußbodenbereich3.11.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.11.2 Schadensursachen3.11.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.11.4 Instandsetzung3.11.5 Kostenschätzung3.11.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.11.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter3.12 Estriche: Calciumsulfat-Estrich in Hotelbädern3.12.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.12.2 Schadensursachen3.12.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.12.4 Instandsetzung3.12.5 Kostenschätzung3.12.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.12.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter3.13 Estrich auf Dämmschicht: Verformung im Wand-Bodenrand-Bereich3.13.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.13.2 Schadensursachen3.13.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.13.4 Instandsetzung3.13.5 Kostenschätzung3.13.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.13.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter3.14 Beläge und Bekleidungen: unzulässige Toleranzen der Setzstufen3.14.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.14.2 Schadensursachen3.14.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.14.4 Instandsetzung3.14.5 Kostenschätzung3.14.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.14.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter3.15 Parkett und Holzwerkstoffe: klaffende Fugen und Hohlstellen3.15.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.15.2 Schadensursachen3.15.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.15.4 Instandsetzung3.15.5 Kostenschätzung3.15.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.15.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter und Literatur3.16 Parkett und Holzwerkstoffe: Aufwölbung und Hohlstellen3.16.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.16.2 Schadensursachen3.16.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.16.4 Instandsetzung3.16.5 Kostenschätzung3.16.6 Hinweise zur Schadensbegrenzung3.16.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter, Literatur3.17 Wasserschaden: defekte Steckverbindung in einem Ausstellungsraum3.17.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.17.2 Schadensursachen3.17.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.17.4 Instandsetzung3.17.5 Kostenschätzung3.17.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.17.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter, Literatur3.18 Beläge und Bekleidungen: irreversible Fleckenbildung durch Wassereinbruch3.18.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.18.2 Schadensursachen3.18.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.18.4 Instandsetzung3.18.5 Kostenschätzung3.18.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.18.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter, Literatur3.19 Beläge und Bekleidungen: großflächige Ablösung des Terrassenbelags3.19.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.19.2 Schadensursachen3.19.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.19.4 Kostenschätzung3.19.5 Instandsetzung3.19.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.19.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter, Literatur3.20 Beläge und Bekleidungen: Ablösungen im Kalkputz3.20.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.20.2 Schadensursachen3.20.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.20.4 Instandsetzung3.20.5 Kostenschätzung3.20.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.20.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter, Literatur3.21 Beläge und Bekleidungen: nicht fachgerechter Bodenaufbau3.21.1 Tatsachenfeststellung durch Bodenöffnungen3.21.2 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.21.3 Schadensursachen3.21.4 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.21.5 Kostenschätzung3.21.6 Instandsetzung3.21.7 Hinweise zur Schadensvermeidung3.21.8 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter, Literatur3.22 Schallschutz: unzureichende Luftschalldämmung einer Wohnungstrennwand3.22.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.22.2 Schadensursachen3.22.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.22.4 Instandsetzung3.22.5 Kostenschätzung3.22.6 Hinweise zur Schadensvermeidung3.22.7 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter3.23 Wärmeschutz: Luftundichtheit im Traufbereich3.23.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.23.2 Schadensursachen3.23.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.23.4 Kostenschätzung3.23.5 Hinweise zur Schadensvermeidung3.23.6 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter3.24 Wärmeschutz: kalte Raumecke mit Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung3.24.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadensursachen3.24.2 Schadensursachen3.24.3 Welche Sanierungsschritte sind erforderlich?3.24.4 Kostenschätzung3.24.5 Hinweise zur Schadensvermeidung3.24.6 DIN-Normen, Richtlinien, Merkblätter4 Die wichtigsten Änderungen der EnEV 20144.1 § 16 EnEV: Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen4.1.1 Energieausweis bei Neubauten4.1.2 Energieausweis bei Verkauf4.1.3 Vorlage des Energieausweises bei Vermietung und Verpachtung4.1.4 Form4.1.5 Gestaltung des neuen Energieausweises4.1.6 Modernisierungsempfehlungen4.1.7 Ordnungswidrigkeit bei Verstoß gegen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Energieausweis4.1.8 Ausstellerpflichten4.1.9 Registriernummer4.1.10 Pflichten des Eigentümers in Immobilienanzeigen4.2 EnEV und Bauträgervertrag4.3 Neue Anforderungen für Neubauten4.4 Neue Anforderungen für Bauten im BestandAbkürzungsverzeichnisArbeitshilfenverzeichnisStichwortverzeichnisArbeitshilfen online
[1]
Hinweis zum Urheberrecht
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:ISBN: 978-3-648-05523-6Bestell-Nr.: 06259-0004ePUB:ISBN: 978-3-648-05524-3Bestell-Nr.: 06259-0100ePDF:ISBN: 978-3-648-05525-0Bestell-Nr.: 06259-0150
Aschenbrenner, Hopfensperger, Metzger, OnischkeBaumängel und Bauschäden erkennen und erfolgreich reklamieren4. aktualisierte und erweiterte Auflage 2015
© 2015, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg [email protected]: Jasmin Jallad
Lektorat: Cornelia Rüping, 81245 München Satz: Reemers Publishing Services GmbH, 47799 Krefeld Umschlag: RED GmbH, 82152 KraillingDruck: fgb • freiburger graphische betriebe, 79108 Freiburg
Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.
Vorwort zur 4. Auflage
Der DEKRA-Bauschadensbericht 2010 hat es erneut deutlich gemacht: Schäden durch Baumängel in Milliardenhöhe. Ein Vergleich mit den Vorjahren zeigt, dass die Tendenz steigend ist. Allein in den Jahren 2003 bis 2007 hat die Anzahl der Mängel um 102 % zugenommen. Im Bewertungszeitraum wurden durchschnittlich 32 Mängel pro Projekt ermittelt. Knapp 56 % der Mängel wurden bereits vor der Schlussbegehung festgestellt. Der bautechnische Anteil lag mit rund 37 % der Mängel in der Auswertung vorne.[2]
Müssen Mängel im Nachhinein beseitigt werden, führt dies zu ungeplanten Mehrkosten, was die vielfach knapp kalkulierte Finanzierung erheblich ins Wanken bringen kann. Dies auch dann, wenn gegen den ausführenden Unternehmer noch unverjährte Ansprüche bestehen. Der Anspruch allein bringt dem Auftraggeber oder Bauherrn erst einmal nichts. Kommt der Verantwortliche seiner Beseitigungspflicht nicht oder nicht in gehörigem Umfang nach, muss oftmals ein zeit- und nervenaufreibendes gerichtliches Verfahren eingeleitet werden, das weitere Gelder verschlingt.
Je früher ein Baumangel erkannt wird, desto schneller kann für seine Beseitigung gesorgt werden. Zu einem daraus resultierenden Bauschaden muss es dann gar nicht erst kommen. Mit der Darstellung häufig auftretender Schadensbilder und fundierten technischen Informationen zu den Mangelursachen soll dieses Buch dazu beitragen, dass auch dem technisch nicht versierten Laien eine Möglichkeit an die Hand gegeben wird, Mängel frühzeitig zu identifizieren und Folgeschäden entgegenzuwirken. Kapitel 3 stellt zur Illustration 23 Bauschadensfälle und Sanierungsvorschläge vor, wobei auch ein grober Kostenüberblick gegeben wird.
Die erfolgreiche Durchsetzung von Mängelansprüchen setzt gewisse rechtliche Grundkenntnisse voraus. Wer für einen konkreten Mangel letztlich eintrittspflichtig ist, lässt sich nicht immer ohne Weiteres eindeutig beantworten. Ist der Schuldige gefunden, müssen bestimmte Vorgehensweisen eingehalten werden, damit ein dem Grunde nach bestehender Anspruch nicht verloren geht. Das Gesetz, und in ihrem Anwendungsbereich insbesondere die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B[3]), räumt dem Auftraggeber von Bauleistungen umfangreiche Rechte ein, die, zielgerichtet geltend gemacht, für rasche Abhilfe sorgen können. Im ersten Kapitel dieses Buches wird im Einzelnen dargestellt, welche konkreten Ansprüche bei Baumängeln bestehen und wie diese erfolgreich geltend gemacht werden können. Darin werden auch Besonderheiten beschrieben, die bei Mängeln am Gemeinschaftseigentum einer Eigentumswohnanlage beachtet werden müssen. Der Sicherung von Mängelansprüchen und vor allem auch der Sicherung von Beweisen sind weitere Ausführungen gewidmet.
Seit der 3. Auflage des Buches haben sich eine Reihe gesetzlicher Änderungen und Neuerungen ergeben, die, ebenso wie die aktuelle Rechtsprechung, mit eingearbeitet wurden. Die VOB/B, soweit sie gegenüber Verbrauchern verwendet wird, ist nicht mehr privilegiert. Verträge mit Verbrauchern unter Einbeziehung der VOB/B dürften damit die Ausnahme von der Regel sein.
In Kapitel 4 werden die wichtigsten Änderungen der Energieeinsparverordnung 2014 dargestellt, sie ist zum 1.5.2014 in Kraft getreten.
Ziel der Verfasser ist es weiterhin, aus langjähriger Praxiserfahrung heraus den wirtschaftlichsten und erfolgversprechendsten Weg aufzuzeigen, wie sich ein im wesentlichen mangelfreies Bauwerk erhalten lässt, ohne einen kostenträchtigen Baumängelprozess führen zu müssen.[4]
Die Autoren
Oktober 2014
Zu diesem eBook stellen wir Ihnen Arbeitshilfen online zur Verfügung. Den Link sowie den Buchcode erhalten Sie am Ende des eBooks.
1 Ansprüche bei Baumängeln und deren erfolgreiche Durchsetzung
Dass ein Bauwerk gänzlich mangelfrei errichtet oder eine sonstige Bauwerksleistung vollkommen fehlerfrei ausgeführt wird, dürfte eher die Ausnahme sein. Mängel am neu erstellten Haus oder an der ausgeführten Leistung, so ärgerlich sie für die Beteiligten auch sein mögen, kommen leider immer wieder vor.
Die Regelungen des Werkvertragsrechts des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und, sofern sie zur Vertragsgrundlage gemacht wurden, die besonderen Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) greifen immer dann, wenn Werkleistungen – in den hier behandelten Fällen speziell Bauwerksleistungen – Gegenstand der vertraglichen Vereinbarung sind. Hierunter fallen nicht nur typische Werkverträge, also etwa die Beauftragung von Renovierungsleistungen oder Modernisierungsmaßnahmen an einem Gebäude, sondern beispielsweise auch die schlüsselfertige Erstellung eines Hauses durch einen Generalunternehmer oder Schlüsselfertigbauer bzw. der Kauf einer bereits erstellten oder noch zu erstellenden Immobilie von einem Bauträger.
Die VOB/B, auf die im Folgenden in den einzelnen Kapiteln gesondert eingegangen wird, stellt, sofern sie wirksam vereinbart wurde, in Form von standardisierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) spezielle Regelungen für die Abwicklung von Verträgen über Bauleistungen auf. Diese Regelungen gehen dann den sonstigen Regelungen des Werkvertragsrechts des ansonsten einschlägigen BGB[5] vor bzw. modifizieren diese. Bei der VOB/B handelt es sich, dies sei an dieser Stelle nochmals betont, um AGB, die, um wirksam zu sein, auch einer AGB-rechtlichen Kontrolle standhalten müssen. Im unternehmerischen Verkehr ist die VOB/B insoweit privilegiert, als sie bei inhaltlich unveränderter Einbeziehung als ausgewogen angesehen wird und damit einer Inhaltskontrolle entzogen ist. Anders ist dies, wenn der Unternehmer oder Auftragnehmer die VOB/B in einen Vertrag mit einem Verbraucher einbezieht. Dann findet in jedem Fall eine Inhaltskontrolle statt. Der Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) empfiehlt deshalb die Anwendung der VOB/B nur noch gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
Damit sind wir beim Begriff der „Bauwerksleistung“. Auch die Bauwerksleistung ist – wie der Name schon andeutet – Werkleistung. Warum also diese Differenzierung? Mängelansprüche, wie sie Inhalt der weiteren Ausführungen sind, verjähren unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um Bauwerksmängel oder um Mängel sonstiger werkvertraglicher Leistungen handelt. Für Erstere gilt eine – mangels abweichender, wirksamer vertraglicher Vereinbarung – grundsätzliche Verjährungsfrist von fünf Jahren, im Fall der letztgenannten Alternative eine solche von zwei Jahren. Hierauf wird in Kapitel 1.5[6] noch im Einzelnen eingegangen.
Von Bauwerksarbeiten spricht man nicht nur dann, wenn es um die Errichtung eines neuen Gebäudes geht. Als solche werden vielmehr auch Erneuerungs- und Umbauarbeiten an einem bereits erstellten Gebäude angesehen, sofern sie für dessen Bestand, Konstruktion, Erhaltung und Benutzbarkeit von wesentlicher Bedeutung sind und die eingebauten Teile mit dem Gebäude fest verbunden werden.
Beispiel
Pflasterung der Terrasse oder des Hofs
Errichtung eines Wintergartens auf dem Flachdach
Anbringung eines Maschendrahtzauns an einbetonierten Pfosten
Einbau eines Kachelofens mit entsprechender Planung
Verlegung eines Betonsteinpflasters
Einbau einer Alarmanlage
Schutzbehandlung der Fassade
In Abgrenzung hierzu liegen sonstige Werkleistungen beispielsweise dann vor, wenn
Anstricharbeiten zum Zweck der Verschönerung der Fassade,
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!