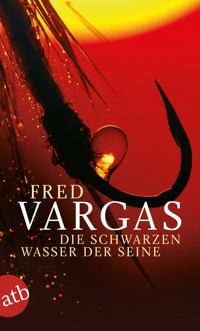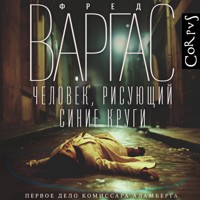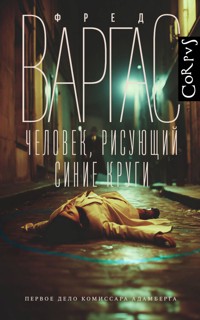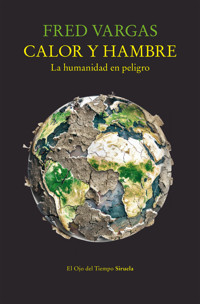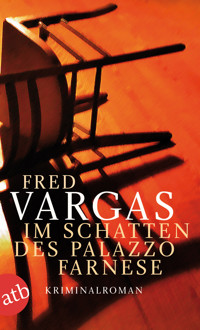10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Adamsberg ermittelt
- Sprache: Deutsch
Nachts kommen die Wölfe – und ein perfider Mörder ... Der zweite Fall für den legendären Kommissar Adamsberg!
Im Nationalpark Mercantour in den französischen Seealpen ist die Natur wild und ungezähmt, genau wie die Wölfe, die hier in Freiheit leben. Das gefällt nicht allen. Als nachts immer mehr Schafe gerissen werden, rebellieren die Landwirte – und bald kursiert ein gruseliges Gerücht. Sind die Schafe nicht einem Raubtier, sondern dem sagenumwobenen Wolfsmenschen zum Opfer gefallen? Dann findet man die Bäuerin Suzanne grausam ermordet im Schafgehege und Aberglaube wird zu Panik. Zusammen mit Suzannes Sohn sucht die Dorfbewohnerin Camille auf eigene Faust nach dem Schuldigen. Doch der scheint immer einen Schritt voraus und so entschließt sich Camille schweren Herzens, einen Mann aus ihrer Vergangenheit um Hilfe zu bitten: Kommissar Adamsberg, den verschrobenen und doch genialen Ermittler, der seine ganz eigenen Theorien zum Monster von Mercantour hat ...
»Fred Vargas' Krimis sind etwas Besonderes – eigenwillig, mit geradezu genialem Plot und viel französischem Esprit!« Bestsellerautorin Sophie Bonnet
»Lässig, klug, anarchisch und manchmal ziemlich abgedreht – die Krimis von Fred Vargas sind sehr französisch und zum Niederknien gut.« Bestsellerautor Cay Rademacher
»Fred Vargas erschafft nicht nur Figuren, sondern echte Charaktere. Sie kennt die Abgründe, die Sehnsüchte und die Geheimnisse der Menschen – und Commissaire Adamsberg ist für mich einer der spannendsten Ermittler in der zeitgenössischen Literatur.« Bestsellerautor Alexander Oetker
Wenn Ihnen die Krimis um Kommissar Adamsberg gefallen, lesen Sie auch die Evangelisten-Reihe unserer internationalen Bestseller-Autorin Fred Vargas!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Im Nationalpark Mercantour in den französischen Seealpen ist die Natur wild und ungezähmt, genau wie die Wölfe, die hier in Freiheit leben. Das gefällt nicht allen. Als nachts immer mehr Schafe gerissen werden, rebellieren die Landwirte – und bald kursiert ein gruseliges Gerücht. Sind die Schafe nicht einem Raubtier, sondern dem sagenumwobenen Wolfsmenschen zum Opfer gefallen? Dann findet man die Bäuerin Suzanne grausam ermordet im Schafgehege, und Aberglaube wird zu Panik. Zusammen mit Suzannes Sohn sucht die Dorfbewohnerin Camille auf eigene Faust nach dem Schuldigen. Doch der scheint immer einen Schritt voraus, und so entschließt sich Camille schweren Herzens, einen Mann aus ihrer Vergangenheit um Hilfe zu bitten: Kommissar Adamsberg, den verschrobenen und doch genialen Ermittler, der seine ganz eigenen Theorien zum Monster von Mercantour hat …
Lesen Sie auch die anderen unabhängig voneinander lesbaren Kriminalromane um Jean-Baptiste Adamsberg!
Autorin
Fred Vargas, geboren 1957, ist ausgebildete Archäologin und hat Geschichte studiert. Sie ist heute die bedeutendste französische Kriminalautorin mit internationalem Renommee. 2004 erhielt sie für »Fliehe weit und schnell« den Deutschen Krimipreis, 2012 den Europäischen Krimipreis für ihr Gesamtwerk und 2016 den Deutschen Krimipreis in der Kategorie International für »Das barmherzige Fallbeil«.
Von Fred Vargas bei Blanvalet bereits erschienen
Bei Einbruch der Nacht · Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord · Die Nacht des Zorns · Das barmherzige Fallbeil · Der Zorn der Einsiedlerin
Besuchen Sie uns auch aufwww.instagram.com/blanvalet.verlag undwww.facebook.com/blanvalet.
Fred Vargas
Bei Einbruch der Nacht
Kommissar Adamsberg ermittelt
Der 2. Fall
Aus dem Französischen von Tobias Scheffel
Die Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel »L’Homme à l’envers« bei Éditions Viviane Hamy, Paris. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen. © Copyright der Originalausgabe Fred Vargas and Viviane Hamy, Paris, 1999. A. d. Französischen von Tobias Scheffel © Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2000, 2008 (für die deutsche Übersetzung © Copyright dieser Ausgabe 2022 by Blanvalet, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: www.buerosued.de Covermotive: mauritius images / Hemis. fr / Michel Cavalier; www.buerosued.de JaB · Herstellung: DM Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-641-28950-8V004www.blanvalet.de
Am Dienstag gab es in Ventebrune in den Alpen vier Schafe mit durchgebissener Kehle. Am Donnerstag neun in Pierrefort. »Die Wölfe«, sagte ein Alter. »Sie steigen zu uns ins Tal herunter.«
Der andere leerte sein Glas und hob die Hand. »Ein Wolf, Pierrot, ein Wolf. Ein Tier, wie du noch nie eins gesehen hast. Es steigt zu uns ins Tal herunter.«
1
Zwei Männer kauerten im Gestrüpp.
»Willst du mir vielleicht meine Arbeit erklären?«, flüsterte der erste.
»Ich will gar nichts«, antwortete sein Begleiter, ein großer Kerl mit langen blonden Haaren, der Lawrence hieß.
Ohne eine Bewegung beobachteten die beiden Männer mit den Ferngläsern in der Hand ein Wolfspaar. Es war zehn Uhr morgens, und die Sonne brannte ihnen auf den Rücken.
»Der Wolf da ist Marcus«, nahm Lawrence das Gespräch wieder auf. »Er ist zurückgekommen.«
Der andere schüttelte den Kopf. Es war ein Mann aus der Gegend, klein, dunkle Haut, ein bisschen bockig. Er überwachte die Wölfe des Mercantour-Massivs * seit sechs Jahren. Er hieß Jean.
»Das ist Sibellius«, murmelte er.
»Sibellius ist wesentlich größer. Der hat nicht diese gelbe Strähne am Hals.«
Verunsichert stellte Jean Mercier erneut sein Fernglas scharf und sah den Wolfsrüden, der dreihundert Meter östlich von ihrem Versteck um den ihm vertrauten Felsen strich und manchmal den Fang in den Wind hob, prüfend an. Sie waren sehr nah, zu nah, es wäre besser, sich etwas zurückzuziehen, aber Lawrence wollte um jeden Preis filmen.
Deshalb war er da: um die Wölfe zu filmen und dann seine Reportage in Kanada loszuwerden. Aber seit sechs Monaten schob er seine Rückkehr immer wieder unter obskuren Vorwänden hinaus. Um die Wahrheit zu sagen: Der Kanadier setzte sich langsam fest. Jean Mercier wusste, warum. Lawrence Donald Johnstone, ein namhafter Spezialist für kanadische Grizzlybären, war einer Handvoll europäischer Wölfe verfallen. Und er konnte sich nicht dazu durchringen, das zu sagen. Na ja, ohnehin redete der Kanadier so wenig wie möglich.
»Sie ist im Frühling zurückgekommen«, murmelte Lawrence. »Hat ihre Familie gegründet. Aber ich erkenn sie nicht wieder.«
»Das ist Proserpina«, flüsterte Jean Mercier, »die Tochter von Janus und Juno, dritte Generation.«
»Mit Marcus.«
»Mit Marcus.« Mercier sah es endlich ein. »Und das Gute an der Sache ist, dass es ganz neue Welpen gibt.«
»Gut.«
»Sehr gut.«
»Wie viele?«
»Zu früh, um das zu sagen.«
Jean Mercier kritzelte ein paar Notizen in sein am Gürtel befestigtes Notizbuch, trank aus seiner Feldflasche und nahm seine Position wieder ein, ohne auch nur den kleinsten Zweig knacken zu lassen. Lawrence legte das Fernglas hin und wischte sich über das Gesicht. Er griff nach der Kamera, richtete sie auf Marcus und begann lächelnd zu filmen. Er hatte fünfzehn Jahre seines Lebens unter Grizzlybären, Karibus und kanadischen Wölfen verbracht, hatte allein die riesigen Nationalparks durchzogen, während er beobachtete, Notizen machte, filmte und manchmal den Ältesten unter seinen wilden Begleitern half. Nicht gerade lustige Kerle. Ein altes Grizzlyweibchen, Joan, das mit gesenkter Stirn zu ihm gekommen war, um sich den Pelz kratzen zu lassen. Lawrence hatte nicht gedacht, dass das arme, beengte, verwüstete und domestizierte Europa ihm irgendetwas ansatzweise Lohnendes zu bieten hätte. Er hatte diesen Reportageauftrag im Mercantour-Massiv unter Vorbehalten und nur deshalb angenommen, weil es Sachen gibt, die man nicht ablehnen kann.
Und so saß er nun schließlich schon ewig in diesem Winkel des Gebirges und schob seine Rückkehr vor sich her. Deutlich gesagt, er trödelte herum. Er trödelte wegen der europäischen Wölfe und ihres grauen erbärmlichen Fells, dieser armen, keuchenden Verwandten der hellen Polarwölfe mit buschigem Fell, die seiner Vorstellung nach all seine Zärtlichkeit verdienten. Er trödelte wegen der dichten Wolken von Insekten, der Ströme von Schweiß, wegen des verkohlten Strauchwerks, der knisternden Hitze dieser mediterranen Welt. »Warte, du hast nicht alles gesehen«, sagte Jean Mercier in etwas belehrendem Ton, mit diesem stolzen Ausdruck des Kenners, des Hitzigen, des Überlebenden des Sonnenabenteuers. »Wir haben erst Juni.«
Und schließlich trödelte er wegen Camille.
Hier sagten sie, er »setze sich fest«.
»Das ist kein Vorwurf«, hatte ihm Jean Mercier mit einer gewissen Würde gesagt, »aber besser, du weißt es: Du setzt dich fest.«
»Nun, jetzt weiß ich es«, hatte Lawrence erwidert.
Lawrence stoppte die Kamera, legte sie vorsichtig auf seinen Rucksack, deckte sie mit einem weißen Tuch zu. Der junge Marcus war gerade in Richtung Norden verschwunden.
»Er ist los, um vor der großen Hitze zu jagen«, bemerkte Jean.
Lawrence besprühte sich das Gesicht, befeuchtete seine Mütze, trank zehn Schlucke. Meine Güte, diese Sonne. Noch nie so eine Hölle erlebt.
»Drei Welpen mindestens«, murmelte Jean.
»Ich koche«, sagte Lawrence und verzog das Gesicht, während er sich mit der Hand über den Rücken fuhr.
»Wart’s ab. Du hast noch nicht alles gesehen.«
2
Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg schüttete die Nudeln ins Sieb, ließ sie zerstreut abtropfen und beförderte alles auf seinen Teller – mit Käse und Tomaten, das würde heute Abend reichen müssen. Er war wegen der Vernehmung eines jungen Idioten, die sich bis elf Uhr hingezogen hatte, spät nach Hause gekommen. Denn Adamsberg war langsam, er mochte es nicht, die Dinge und die Menschen anzutreiben, so blöd sie auch sein mochten. Vor allem aber hasste er es, sich selbst anzutreiben. Der Fernseher lief auf Zimmerlautstärke, Kriege, Kriege und wieder Kriege. Er kramte geräuschvoll im Durcheinander der Besteckschublade, fand eine Gabel und stellte sich vor den Apparat.
»… kam es in einem bislang verschont gebliebenen Kanton des Departements Alpes-Maritimes erneut zu Angriffen durch Wölfe des Mercantour. Es ist die Rede von einem Tier von außergewöhnlicher Größe. Legende oder Wirklichkeit? Vor Ort …«
Ganz langsam näherte sich Adamsberg mit dem Teller in der Hand auf Zehenspitzen dem Fernseher, wie um den Moderator nicht zu erschrecken. Eine unbedachte Bewegung, und der Typ würde aus dem Fernseher fliehen, ohne die fabelhafte Geschichte von den Wölfen zu Ende zu erzählen, die er gerade begonnen hatte. Adamsberg stellte den Apparat lauter und ging wieder ein Stück zurück. Er mochte Wölfe, so wie man Alpträume mag. Seine ganze Kindheit in den Pyrenäen war eingehüllt in die Stimmen der Alten, die das Epos von den letzten Wölfen Frankreichs erzählten. Und als er mit neun Jahren nachts durch das Gebirge gezogen war, als sein Vater ihn auf die Bergpfade geschickt hatte, um Anmachholz zu holen, ohne Widerrede, da hatte er zu sehen geglaubt, wie ihre gelben Augen ihn den ganzen Weg über verfolgten. »Wie glühende Holzstückchen, Bürschchen, wie glühende Holzstückchen leuchten die Wolfsaugen in der Nacht.«
Und wenn er heute dorthin in seine Berge zurückkehrte, nahm er nachts dieselben Pfade. Wie deprimierend der Mensch doch ist, er klammert sich immer an das Schlimmste.
Er hatte sehr wohl gehört, dass einige Wölfe aus den Abruzzen wieder die Alpen überquert hatten, schon vor ein paar Jahren. Eine Bande von Verantwortungslosen gewissermaßen. Beschwipste Trunkenbolde. Sympathischer Streifzug, symbolische Rückkehr, herzlich willkommen, ihr drei Kerle aus den Abruzzen mit eurem schütteren Pelz. Salut, Kameraden. Er glaubte zu wissen, dass ein paar Typen dort oben im Geröll des Mercantour sie seitdem wie einen Schatz hätschelten. Und dass ihnen von Zeit zu Zeit ein Lamm vor die Zähne kam. Aber es war das erste Mal, dass er Bilder davon sah. Wie, was – diese plötzliche Bestialität sollte das Werk der wackeren Burschen aus den Abruzzen sein? Während er schweigend weiteraß, sah Adamsberg auf dem Bildschirm ein zerfetztes Schaf, er sah blutverschmierten Boden, das verzerrte Gesicht eines Schafzüchters, das blutbefleckte Fell eines Schafes, das zerrissen auf dem Gras einer Weide lag. Die Kamera fuhr genüsslich die Wunden ab, und der Journalist spitzte seine Fragen zu, schürte das Feuer der dörflichen Wut. Zwischen diesen Bildern tauchten Wolfsschnauzen auf dem Bildschirm auf, hochgezogene Lefzen, aus alten Dokumentarfilmen eingeblendet und eher vom Balkan als aus den Alpen stammend. Man hätte glauben können, das gesamte Hinterland von Nizza ginge plötzlich vor dem Atem der wilden Meute in die Knie, während alte Schäfer stolze Gesichter reckten, um das Tier herauszufordern und ihm direkt in die Augen zu sehen. »Wie glühende Holzstückchen, Bürschchen, wie glühende Holzstückchen.«
Blieben die Fakten: etwa dreißig im Massiv erfasste Wölfe, wenn man die jungen, verstreuten nicht mitzählte, etwa zehn an der Zahl, dazu die streunenden Hunde, die kaum weniger gefährlich waren. Hunderte von Schafen mit zerbissener Kehle im Lauf der vergangenen Saison in einem Umkreis von zehn Kilometern um den Mercantour-Nationalpark. In Paris redete man nicht davon, weil einem Geschichten von Wölfen und Schafen in Paris ziemlich egal sind, und Adamsberg hörte die Zahlen mit Verblüffung. Mit zwei neuen Überfällen im Kanton von Auniers war die Sache wieder in die Schlagzeilen gerückt.
Auf dem Bildschirm erschien ein bedächtiger, sehr professioneller Tierarzt, der mit dem Finger auf eine Wunde zeigte. Nein, da sei kein Zweifel möglich, hier die Bissspur der oberen Reißzähne, der vierte vordere Backenzahn rechts, sehen Sie, und da, davor, der rechte Eckzahn, sehen Sie dort und hier und darunter, hier. Und der Abstand zwischen den beiden, sehen Sie. Das ist der Kiefer eines großen Mitglieds der Familie der Canidae.
»Würden Sie sagen, ein Wolf, Doktor?«
»Oder ein sehr großer Hund.«
»Oder ein sehr großer Wolf?«
Dann erneut das verstockte Gesicht eines Schafzüchters. Vier Jahre schlugen sich diese Drecksviecher jetzt schon mit dem Segen der Leute aus der Hauptstadt den Wanst voll, noch nie hatte man derartige Verletzungen gesehen. Noch nie. Fangzähne, groß wie eine Hand. Der Schafzüchter streckte den Arm aus und deutete auf die Linie der Berge am Horizont. Da oben streicht er herum. Ein Tier, wie man es noch nie gesehen hat. Sollen sie doch lachen in Paris, sollen sie doch lachen. Es wird ihnen schon vergehen, wenn sie’s erst mal sehen.
Fasziniert aß Adamsberg im Stehen seinen Teller mit kalten Nudeln leer. Der Moderator wechselte zum nächsten Thema. Die Kriege.
Langsam setzte sich der Kommissar, stellte seinen Teller auf den Boden. Meine Güte, die Wölfe vom Mercantour. Die kleine, unschuldige Meute vom Anfang hatte sich ganz schön vergrößert. Sie weitete ihr Jagdrevier Kanton für Kanton aus. Sie drang über das Departement Alpes-Maritimes hinaus. Wie viele von den vierzig Wölfen mochten wohl angreifen? Rudel? Paare? Ein Einzelgänger? Ja, so war das in den Geschichten. Ein heimtückischer, grausamer Einzelgänger, der sich nachts den Dörfern näherte, das Hinterteil tief geduckt über seinen grauen Läufen. Ein mächtiges Tier. Das Tier vom Mercantour. Und die Kinder in den Häusern. Adamsberg schloss die Augen. »Wie glühende Holzstückchen, Bürschchen, wie glühende Holzstückchen leuchten die Wolfsaugen in der Nacht.«
3
Lawrence Donald Johnstone stieg erst Freitag gegen elf Uhr abends wieder ins Dorf hinunter.
Zwischen eins und vier machten die Männer des Mercantour-Nationalparks im Schatten von Baracken aus Trockenmauerwerk, die man hier und da an den Hängen fand, eine lange Pause, während der sie lasen oder dösten. Lawrence hatte sich unweit des neuen Reviers von Marcus einen leerstehenden Schafstall angeeignet, dessen Boden er von uraltem und eigentlich geruchlosem Mist befreit hatte. Es ging ums Prinzip. Der große Kanadier, der es eher gewohnt war, seinen nackten Oberkörper mit Schneeklumpen zu waschen als sich, klebrig von altem Schweiß, in Schafsscheiße zu wälzen, fand die Franzosen schmuddelig. Paris, das er rasch wieder verlassen hatte, hatte ihm schwere Schwaden von Pisse und Schweiß entgegengehaucht, üble Gerüche von Knoblauch und Wein. Aber in Paris war er Camille begegnet, und so war Paris entschuldigt. Auch dieser überhitzte Mercantour und das Dorf Saint-Victor-du-Mont waren entschuldigt, wo er sich vorläufig mit ihr niedergelassen hatte. Aber trotzdem waren sie schmuddelig, vor allem die Männer. Er konnte sich nicht an schwarze Fingernägel, klebriges Haar oder unförmige, vor Schmutz grau gewordene Unterhemden gewöhnen.
In seinem gesäuberten alten Schafstall legte sich Lawrence jeden Nachmittag auf ein großes Leintuch, das er auf dem gestampften Boden ausbreitete. Er ordnete seine Notizen, sah die Aufnahmen vom Vormittag durch, bereitete die Beobachtungen des Abends vor. In den letzten Wochen jagte ein alter, völlig erschöpfter Wolf, ein etwa fünfzehn Jahre alter Einzelgänger, der ehrwürdige Augustus, am Mont Mounier. Er kam nur frühmorgens hervor, wenn es noch kühl war, und Lawrence wollte ihn nicht verpassen. Denn der greise Vater versuchte eher zu überleben als zu jagen. Seine schwindenden Kräfte ließen ihn selbst die einfachste Beute verlieren. Lawrence fragte sich, wie lange der Alte wohl noch durchhielt und wie das enden würde. Und wie lange er, Lawrence, noch durchhielt, bis er für den alten Augustus etwas Fleisch wildern und damit die Gesetze des Naturparks brechen würde, die vorschrieben, dass die Tiere sich allein durchschlagen oder krepieren sollten wie zu Anbeginn der Welt. Wenn Lawrence dem Alten einen Hasen brächte, würde das den Planeten doch wohl nicht aus dem Gleichgewicht bringen, oder? Wie dem auch sei, wenn schon, dann müsste er es tun, ohne den französischen Kollegen auch nur ein Sterbenswörtchen zu sagen. Die Kollegen waren der festen Ansicht, dass Hilfe die Tiere verweichlichen und die Gesetze der Natur zerrütten würde. Sicher, aber Augustus war schon verweichlicht, und die Gesetze der Natur waren schon zerrüttet. Was würde das also ändern?
Nachdem er Brot, Wasser und Wurst verschlungen hatte, streckte sich Lawrence auf dem Boden im Kühlen aus, die Hände im Nacken verschränkt, und dachte an Camille, dachte an ihren Körper und an ihr Lächeln. Camille war sauber, Camille duftete, und vor allem verfügte Camille über eine unbegreifliche Anmut, die einem Hände, Bauch und Lippen erzittern ließ. Niemals hätte Lawrence sich vorstellen können, für ein so braunes Mädchen mit glatten schwarzen Haaren, das Kleopatra ähnelte, erzittern zu können. Immerhin, dachte er, Kleopatra ist jetzt zweitausend Jahre tot, aber sie bleibt noch immer der Archetypus jener stolzen braunen Mädchen mit gerader Nase, zartem Hals, reinem Teint. Ja, ganz schön stark, diese alte Kleopatra. Im Grunde wusste er nichts über sie und nicht sehr viel über Camille, außer dass sie keine Königin war und ihr Leben mal mit Musik, mal mit Klempnerarbeiten bestritt.
Dann musste er sich von diesen Bildern lösen, die ihn daran hinderten, sich auszuruhen, und er konzentrierte sich auf den Lärm der Insekten. Diese Viecher schafften ganz schön was weg. Neulich hatte ihm Jean Mercier am Fuß der Berge seine erste Zikade gezeigt. Dick wie ein Fingernagel, viel Lärm um fast nichts. Lawrence mochte die Stille.
Heute Morgen hatte er Jean Mercier gekränkt. Aber im Ernst, es war wirklich Marcus.
Marcus mit der gelben Strähne am Hals. Vielversprechend, dieser Wolf. Kräftig, guter Spürsinn, gefräßig. Lawrence hatte ihn im Verdacht, im vergangenen Herbst eine ordentliche Zahl Lämmer im Kanton von Trévaux gefressen zu haben. Die klare Arbeit eines Räubers, überall im Gras Blut um die zu Dutzenden zerrissenen Felle, eine Tat, die die Leute vom Nationalpark verzweifeln ließ. Die Verluste waren ersetzt worden, aber die Gemüter der Schafzüchter erhitzten sich, sie besorgten sich Schutzhunde, und im letzten Winter wäre es beinahe zur allgemeinen Treibjagd gekommen. Seit Ende Februar, seit die Wintermeute sich zerstreut hatte, hatten sich die Wogen wieder geglättet. Ruhe.
Lawrence stand aufseiten der Wölfe. Er war der Ansicht, dass die Tiere dem armseligen Frankreich Ehre erwiesen hatten, indem sie wagemutig, wie würdevolle Schatten aus der Vergangenheit, die Alpen überquerten. Es kam überhaupt nicht in Frage, sie von kleinen, hitzigen Männern massakrieren zu lassen. Aber wie jeder nomadische Jäger war der Kanadier ein vorsichtiger Mann. Im Dorf redete er nicht von den Wölfen, er blieb stumm und folgte darin dem Prinzip seines Vaters: »Wenn du frei bleiben willst, halt’s Maul.« Seit fünf Tagen war Lawrence nicht wieder nach Saint-Victor-du-Mont hinabgestiegen. Er hatte Camille gesagt, dass er dem ehrwürdigen Augustus bis Donnerstag mit der Infrarotkamera auf seinen hoffnungslosen nächtlichen Jagden folgen würde. Aber am Donnerstag hatten die wiederholten Misserfolge des greisen Wolfs Lawrences Widerstand gebrochen, und er hatte seine Beobachtungsaktion um einen Tag verlängert, um etwas zu fressen für ihn zu finden. Er hatte zwei Wildkaninchen aus ihrem Bau gefangen, ihnen mit einem Schnitt die Kehle durchtrennt und die Kadaver auf einer der Fährten von Augustus ausgelegt. Im Schutz des Gebüschs, eingewickelt in ein Wachstuch, das seinen Menschengeruch verbergen sollte, hatte Lawrence besorgt auf das Auftauchen des mageren Tieres gewartet.
Jetzt durchquerte er, erleichtert pfeifend, das wie ausgestorben daliegende Saint-Victor. Der Alte war erschienen, und der Alte hatte gefressen.
Camille ging ziemlich spät schlafen. Als Lawrence die Tür aufstieß, sah er sie über die Tasten ihres Synthesizers gebeugt, die Kopfhörer über den Ohren, mit gerunzelter Stirn, geöffneten Lippen, während sich ihre Hände, manchmal zögernd, von einer Note zur nächsten bewegten. Nie war Camille so schön, wie wenn sie sich konzentrierte, sei es bei der Arbeit, sei es bei der Liebe. Lawrence legte seinen Rucksack ab, setzte sich an den Tisch und beobachtete sie ein paar Minuten. Abgekapselt unter ihren Kopfhörern, für äußere Geräusche unempfänglich, kritzelte sie auf Notenpapier. Lawrence wusste, dass sie bis November den Soundtrack für einen romantischen Fernseh-Zwölfteiler abliefern musste, ein wahres Desaster, hatte sie gesagt. Und sehr viel Arbeit, wenn er es richtig verstanden hatte. Lawrence verbreitete sich ungern über Details der Arbeit. Man machte die Arbeit und fertig. Das war das Wichtigste.
Er stellte sich hinter sie, betrachtete ihren Nacken unter den kurzen Haaren und küsste sie rasch, Camille nie bei der Arbeit stören, und sei es nach fünftägiger Abwesenheit, er verstand das besser als jeder andere. Sie arbeitete noch zwanzig Minuten, bevor sie ihre Kopfhörer absetzte und zu ihm an den Tisch kam. Lawrence ließ gerade die Bilder von Augustus ablaufen, wie er die Wildkaninchen verschlang, und hielt ihr die Kamera hin.
»Das ist der Alte, der sich den Bauch vollschlägt«, sagte er.
»Siehst du, es geht noch nicht mit ihm zu Ende«, sagte Camille, während sie ihr Auge an das Okular drückte.
»Ich hab ihm das Fleisch besorgt«, antwortete Lawrence und verzog das Gesicht.
Camille legte ihre Hand auf das blonde Haar des Kanadiers, während sie weiter mit einem Auge durch den Sucher sah.
»Lawrence«, sagte sie, »es hat Aufruhr gegeben. Mach dich bereit, sie zu verteidigen.«
Lawrence fragte sie, wie es seine Art war – mit einer einfachen Bewegung des Kinns.
»Dienstag haben sie in Ventebrune vier Schafe mit durchgeschnittener Kehle gefunden und heute Morgen neun weitere zerrissen in Pierrefort.«
»God«, flüsterte Lawrence. »Jesus Christ. Bullshit.«
»Das ist das erste Mal, dass sie sich so weit runter wagen.«
»Werden eben mehr.«
»Ich hab’s von Julien erfahren. Es kam in den Nachrichten, es wird zum landesweiten Thema. Die Schafzüchter haben gesagt, dass sie den Wölfen aus Italien die Gier auf Fleisch schon austreiben würden.«
»God«, wiederholte Lawrence. »Bullshit.«
Er sah auf seine Uhr, schaltete die Kamera aus und machte besorgt einen winzigen Fernseher an, der in einer Ecke auf einer Kiste stand.
»Es kommt noch schlimmer«, fügte Camille hinzu.
Lawrence wandte ihr mit erhobenem Kinn das Gesicht zu.
»Sie sagen, diesmal sei es kein Tier wie die anderen.«
»Kein Tier wie die anderen?«
»Anders. Größer. Eine Naturgewalt, ein riesiger Kiefer. Eben nicht normal. Mit einem Wort: ein Ungeheuer.«
»Ach was.«
»So sagen sie.«
Lawrence schüttelte bestürzt sein blondes Haar.
»Dein Land ist ein verdammt zurückgebliebenes Land alter Arschlöcher«, sagte er nach kurzem Schweigen.
Der Kanadier schaltete von einem Sender zum nächsten, bis er auf eine Nachrichtensendung stieß. Camille setzte sich auf den Boden, schlug ihre Stiefel übereinander und lehnte sich an Lawrences Beine, während sie an den Lippen nagte. Alle Wölfe kämen jetzt dran, auch der alte Augustus.
4
Lawrence verbrachte das Wochenende damit, die regionalen Zeitungen zu sammeln, die Nachrichten abzuwarten und ins Café unten im Dorf hinunterzugehen.
»Geh nicht«, riet Camille. »Sie werden dir Ärger machen.«
»Why?«, fragte Lawrence mit diesem schmollenden Gesichtsausdruck, den er an sich hatte, wenn er besorgt war. »Es sind ihre Wölfe.«
»Es sind nicht ihre Wölfe. Es sind die Wölfe der Pariser, Maskottchen, die ihnen ihre Herden wegfressen.«
»Bin kein Pariser.«
»Du beschäftigst dich mit Wölfen.«
»Ich beschäftige mich mit Grizzlys. Das ist meine Arbeit, Grizzlys.«
»Und Augustus?«
»Was anderes. Respekt vor den Alten, Ehrerbietung gegenüber den Schwachen. Er hat nur noch mich.«
Lawrence war wenig begabt zum Reden und zog es vor, sich durch Zeichen, Lächeln oder Grimassen verständlich zu machen, so routiniert, wie es Jäger oder Taucher tun, die gezwungen sind, sich stumm zu verständigen. Seine Sätze zu beginnen wie auch zu beenden verursachte ihm Qualen, und er lieferte zumeist nur verstümmelte Mittelteile, die mehr oder minder unhörbar waren – in der deutlichen Hoffnung, jemand anderes möge diese Fron für ihn beenden. Sei es, dass er die arktische Einsamkeit gesucht hatte, um dem Geschwätz der Menschen zu entgehen, sei es, dass die unermüdlichen Reisen in die arktischen Weiten ihm die Freude am Wort genommen und ihm die Stimme geraubt hatten, jedenfalls redete er mit gesenktem Kopf, geschützt von seiner blonden Mähne, und so selten wie möglich.
Camille, die mit großer Freigebigkeit Worte verschwendete, hatte Mühe gehabt, sich an diese sparsame Kommunikation zu gewöhnen. Sie hatte Mühe, zugleich aber auch Erleichterung verspürt. In den letzten Jahren hatte sie viel zu viel geredet, auch noch ohne jeden Anlass, und das hatte sie selbst angeekelt. So boten das Schweigen und das Lächeln des großen Kanadiers ihr eine unerwartete Rast, eine Ruhephase, die sie von ihren alten Gewohnheiten reinigte, deren zwei nervigste unbestritten das Argumentieren und das Überzeugen waren. Es war für Camille unmöglich, die so unterhaltsame Welt der Worte aufzugeben, aber zumindest hatte sie das ganze fabelhafte Hirnareal eingemottet, das sie früher in den Dienst der Überzeugung anderer gestellt hatte. Es gammelte endgültig in einem Winkel ihres Kopfes vor sich hin, ein erschöpftes, stillgelegtes Ungeheuer, dessen Räderwerk der Argumente und dessen glänzende Metaphern immer mehr verrotteten. Dank einem Kerl, der aus lauter stummen Gesten bestand, der seinen Weg ging, ohne irgendjemanden um seine Meinung zu fragen, und der um keinen Preis wünschte, dass man ihm gegenüber Kommentare über das Leben abgab, atmete Camille tief durch und befreite ihren Geist, so wie man einen Dachboden von angehäuftem Gerümpel leert.
Sie brachte eine Folge von Noten zu Papier.
»Wenn dir die Wölfe egal sind, warum willst du dann runtergehen?«, nahm sie das Gespräch wieder auf.
Lawrence lief in dem kleinen, dunklen Zimmer mit den geschlossenen Holzläden auf und ab. Die Hände im Rücken, ging er von einer Ecke in die andere, ließ unter seinem Gewicht ein paar Fliesen wackeln und streifte mit seinem Haar den Hauptbalken. Diese Hütten im Süden waren nicht für Kanadier seines Formats vorgesehen. Mit der linken Hand suchte Camille einen Rhythmus auf ihren Tasten.
»Rauskriegen, welcher es ist«, sagte Lawrence. »Welcher Wolf.«
Camille wandte sich von den Tasten ab und drehte sich zu ihm herum.
»Welcher es ist? Denkst du dasselbe wie sie? Dass es nur ein einziger ist?«
»Jagen oft allein. Man müsste die Wunden sehen.«
»Wo sind die Schafe?«
»Im Kühlraum, der Fleischer hat sie eingesammelt.«
»Will er sie verkaufen?«
Lawrence schüttelte lächelnd den Kopf.
»Nein. ›Die toten Tiere werden nicht gegessen‹, hat er gesagt. Es ist für das Gutachten.«
Camille legte einen Finger an ihre Lippen und überlegte. Sie hatte noch nicht darüber nachgedacht, dass das Tier identifiziert werden könnte. Sie glaubte nicht an das Gerücht von einem Riesenungeheuer. Es waren Wölfe und Schluss. Aber für Lawrence hatten die Angriffe möglicherweise ein Gesicht, eine Schnauze, einen Namen.
»Wer von ihnen ist es? Weißt du es?«
Lawrence hob seine schweren Schultern und breitete die Arme aus.
»Die Wunden«, wiederholte er.
»Was sagen die?«
»Größe. Geschlecht. Mit ziemlich viel Glück.«
»An welchen denkst du?«
Lawrence rieb sich mit den Händen übers Gesicht.
»An den großen Sibellius«, stieß er durch die zusammengebissenen Zähne hervor, als mache er sich einer Denunziation schuldig. »Hat sich sein Revier abspenstig machen lassen. Von Marcus, einem jungen Angeber. Muss übel sein. Hab den Typen seit Wochen nicht gesehen. Sibellius ist ein harter Knochen, ein wirklich harter. God. Tough guy. Hat sich womöglich ein neues Revier erobert.«
Camille stand auf und legte ihre Arme um Lawrences Schultern.
»Was kannst du tun, wenn er es ist?«
»Eine Spritze, in den Laster schmeißen. In die Abruzzen bringen.«
»Und die Italiener?«
»Nicht zu vergleichen. Die sind stolz auf ihre Tiere.«
Camille stellte sich auf die Zehenspitzen, um Lawrences Lippen zu berühren. Lawrence beugte die Knie, schlang seine Arme um ihre Taille. Warum sich mit diesem verdammten Wolf rumärgern, wenn er sein ganzes Leben mit Camille in diesem Raum verbringen konnte?
»Ich geh runter«, sagte er.
Im Café wurde zunächst ziemlich heftig gestritten, bevor man schließlich einwilligte, Lawrence in den Kühlraum zu führen. Der »Trapper«, wie man ihn hier nannte – denn wer in den kanadischen Wäldern herumläuft, ist zwangsläufig ein »Trapper« –, galt inzwischen auf unbestimmte Weise als Verräter. Sie sagten es nicht. Sie riskierten es nicht. Denn sie spürten, dass sie ihn brauchen würden, ihn, seine Kenntnisse und auch seine Stärke. Ein solches Kaliber war in einem so kleinen Dorf nicht zu unterschätzen. Vor allem ein Bursche, der mit Grizzlys von gleich zu gleich redete. Da sind Wölfe doch nur ein Witz. Sie wussten nicht mehr so recht, auf welcher Seite man den Trapper einordnen, ob man mit ihm reden oder nicht mit ihm reden sollte. Was in Wahrheit keinen großen Unterschied gemacht hätte, denn der Trapper selbst redete nicht.
Mit ruhigen Gesten betastete Lawrence unter den Blicken von Sylvain, dem Fleischer, und Gerrot, dem Schreiner, die getöteten Tiere. Einem fehlte ein Huf, dem anderen der obere Teil der Schulter.
»Nicht klar, die Abdrücke«, murmelte er. »Haben sich bewegt.«
Mit einer Handbewegung bedeutete er dem Schreiner, dass er ein Metermaß brauche. Gerrot legte es ihm ebenso wortlos in die offene Hand. Lawrence maß, dachte nach, maß erneut. Dann richtete er sich auf und gab dem Fleischer ein Zeichen, der die Tiere in den Kühlraum zurückbrachte, die schwere weiße Türe zuschlug und den Hebel umlegte.
»Ergebnis?«, fragte er.
»Derselbe Angreifer. Scheint so.«
»Großes Tier?«
»Schöner Rüde. Mindestens so groß.«
Am Abend standen noch etwa fünfzehn Dorfbewohner in kleinen Gruppen auf dem Platz um den Brunnen. Man zögerte, schlafen zu gehen. In gewisser Weise, auch wenn keiner es aussprach, hielt man bereits Wache. Man hielt Waffenwache, die Männer mochten das. Lawrence ging zu Gerrot, dem Schreiner, der allein auf einer Steinbank saß und zu träumen schien, während er die Spitzen seiner groben Schuhe betrachtete. Vielleicht sah er auch nur auf die Spitzen seiner groben Schuhe, ohne zu träumen. Der Schreiner war ein vernünftiger Mann, nicht sehr kriegerisch und nicht sehr gesprächig, und Lawrence hatte Respekt vor ihm.
»Gehst du morgen wieder in die Berge?«, begann Gerrot.
Lawrence nickte.
»Suchst du nach den Tieren?«
»Ja, mit den anderen. Die müssen schon angefangen haben.«
»Kennst du das Tier? Hast du eine Vorstellung?«
Lawrence verzog das Gesicht.
»Vielleicht ein Neuer.«
»Warum? Was stört dich?«
»Die Größe.«
»Groß?«
»Viel zu groß. Der Kieferbogen ist sehr entwickelt.«
Gerrot stützte die Ellbogen auf die Knie, kniff die Augen zusammen und musterte den Kanadier.
»Verdammt, dann ist es wahr, was sie sagen?«, murmelte er. »Dass das kein normales Tier ist?«
»Außergewöhnlich«, antwortete Lawrence im selben Ton.
»Vielleicht hast du schlecht gemessen, Trapper. Es gibt nichts, was sich so verändert wie Maße.«
»Ja. Die Zähne sind gerutscht. Abgerutscht. Haben den Abdruck womöglich länger gemacht.«
»Siehst du.«
Die Männer schwiegen eine ganze Weile lang.
»Aber trotzdem groß«, begann Lawrence schließlich wieder.
»Bald wird’s was geben«, sagte der Schreiner und ließ den Blick über den Platz und die Männer mit den Fäusten in der Tasche gleiten.
»Sag’s ihnen nicht.«
»Sie sagen’s sich selbst schon genug. Was wäre dir am liebsten?«
»Ihn vor ihnen zu fassen zu kriegen.«
»Verstehe.«
Am Montag schnürte Lawrence im Morgengrauen seinen Rucksack zu und brach wieder in den Mercantour auf. Marcus und Proserpina bei ihrer jungen Liebe überwachen, Sibellius ausfindig machen, die Bewegungen des Rudels überprüfen, kontrollieren, wer da war und wer fehlte, den Alten ernähren und dann Elektra suchen, ein kleines Weibchen, das seit acht Tagen nicht mehr gesehen worden war. Er würde Sibellius’ Fährte in Richtung Südosten verfolgen, bis in die Nähe des Dorfes Pierrefort, wo der letzte Angriff stattgefunden hatte.
5
Lawrence folgte Sibellius’ Fährte zwei Tage lang, ohne das Tier zu finden. Er rastete nur dann im Schatten eines Schafstalls, wenn diese Dreckssonne allzu sehr brannte. Gleichzeitig suchte er zwanzig Quadratkilometer Gelände nach Resten gerissener Schafe ab. Nie wäre Lawrence seiner Leidenschaft für die großen kanadischen Bären untreu geworden, aber er musste einräumen, dass sich dieser Haufen magerer europäischer Wölfe in sechs Monaten ziemlich tief in ihn eingegraben hatte.
Als er gerade vorsichtig einen schmalen Pfad an einem Steilhang entlangging, entdeckte er Elektra, die verletzt tief unten in der Schlucht lag. Lawrence wog seine Chancen ab, den Teil des mit dichtem Gestrüpp bedeckten Abhangs zu erreichen, wo die Wölfin lag, und kam zu dem Ergebnis, dass er es allein schaffen könnte. Alle Aufseher des Nationalparks durchstreiften das Gelände, und er hätte zu lange auf die Hilfe eines Kollegen warten müssen. Er brauchte über eine Stunde, um das Tier zu erreichen, Griff für Griff sicherte er sich unter der höllisch brennenden Sonne ab. Die Wölfin war derart geschwächt, dass er ihr nicht einmal das Maul zubinden musste, um sie abzutasten. Eine gebrochene Pfote, zwei Tage nichts gefressen. Er legte sie auf ein Tuch, das er um seine Schulter knotete. Selbst in abgemagertem Zustand wog das Tier seine dreißig Kilo, ein Federgewicht für einen Wolf, eine Last für einen Menschen, der einen Steilhang hinaufklettert. Als er den Pfad erreicht hatte, erlaubte sich Lawrence eine halbe Stunde Rast, er legte sich im Schatten auf den Rücken, eine Hand auf dem Fell der Wölfin, um ihr klarzumachen, dass sie hier nicht allein einfach so krepieren würde wie zu Anbeginn der Welt.
Um acht Uhr abends brachte er die Wölfin in die Pflegestation.
»Gibt’s unten Ärger?«, fragte der Tierarzt, als er Elektra auf einen Tisch legte.
»Zusammenhang?«
»In Zusammenhang mit den gerissenen Schafen.«
Lawrence schüttelte missbilligend den Kopf.
»Müssen ihn kriegen, bevor sie hier raufkommen. Sie würden alles verwüsten.«
»Gehst du wieder los?«, fragte der Tierarzt, als er sah, wie Lawrence Brot, eine Wurst und eine Flasche einpackte.
»Hab zu tun.«
Ja, für den Alten auf die Jagd gehen. Das konnte ein Weilchen dauern. Manchmal klappte es nicht, genau wie bei dem Veteranen.
Er ließ eine Nachricht für Jean Mercier da. Sie würden sich heute Abend nicht begegnen, er würde in seinem Schafstall schlafen.
Camille rief ihn am nächsten Tag an, kurz vor zehn Uhr, als er seinen Kontrollgang in Richtung Norden fortsetzte. An ihrer gehetzten Stimme merkte Lawrence, dass sich etwas zusammenbraute.
»Es ist schon wieder passiert«, sagte Camille. »Ein Gemetzel in Les Écarts, bei Suzanne Rosselin.«
»In Saint-Victor?«, fragte Lawrence und schrie fast dabei.
»Bei Suzanne Rosselin«, wiederholte Camille, »im Dorf. Der Wolf hat fünf getötet und drei verletzt.«
»An Ort und Stelle gefressen?«
»Nein, er hat Stücke herausgerissen wie bei den anderen. Er scheint nicht aus Hunger anzugreifen. Hast du Sibellius gesehen?«
»Keine Fährte.«
»Du solltest herunterkommen. Hier sind zwei Gendarmen aufgekreuzt, aber Gerrot sagt, sie sind nicht in der Lage, die Tiere korrekt zu untersuchen. Und der Tierarzt ist kilometerweit entfernt, zum Fohlen. Alle brüllen, alle schreien rum. Verdammt, komm runter, Lawrence.«
»In zwei Stunden in Les Écarts.«
Suzanne Rosselin leitete die Schäferei Les Écarts, im Westen des Dorfes, allein, und zwar mit eiserner Hand, hieß es. Die derbe, ja männliche Art der großen, kräftigen Frau hatte dazu geführt, dass sie im ganzen Kanton respektiert und gefürchtet wurde, aber außerhalb ihres Guts suchten die Leute wenig Kontakt zu ihr. Man fand sie zu brutal, zu grobschlächtig. Und hässlich. Man erzählte, ein durchreisender Italiener habe sie vor dreißig Jahren verführt, und sie habe ihm ohne Zustimmung ihres Vaters folgen wollen. Verführt mit Haut und Haaren, so sagte man im Dorf. Aber das Leben hatte ihr nicht die Zeit gelassen, gegen ihren Vater aufzubegehren, weil der Italiener schon wieder in seinem heimatlichen Stiefel verschwunden und ihre Eltern im selben Jahr gestorben waren. Manche sagten, dass der Verrat, die Schande und das Fehlen eines Mannes Suzanne hart gemacht hätten. Und dass das Schicksal sie aus Rache zu einem Mannweib gemacht habe. Andere versicherten, das sei nicht wahr, sie sei schon immer maskulin gewesen. Es lag wohl mit an all diesen Gründen, dass Camille sie mochte. Suzannes bis ins Extreme getriebene Fuhrknechtsprache hatte etwas Bewundernswertes. Dank ihrer Mutter hielt Camille Grobheit für eine Lebenskunst, und die Professionalität von Suzanne beeindruckte sie.
Etwa einmal pro Woche stieg sie zur Schäferei hinauf, um die Kiste mit Lebensmitteln zu bezahlen, die Suzanne ihr packte. Sobald man das Gelände von Les Écarts betrat, war Schluss mit giftigen Kommentaren und Spott: Die fünf Männer und Frauen, die dort arbeiteten, hätten sich für Suzanne Rosselin in Stücke reißen lassen.
Camille folgte dem steinigen Weg, der zwischen den Terrassen steil bis zum Haus hinaufführte, einem schmalen, hohen Steingebäude mit einer niedrigen Tür und winzigen asymmetrischen Fensteröffnungen. Sie dachte sich, dass das vergammelte Dach nur noch dank der stillen Solidarität der Ziegel hielt, die sich aus reinem Korpsgeist aneinanderklammerten. Das Haus war verlassen, und sie ging zu dem langen Schafstall, der sich fünfhundert Meter weiter oben quer zum Hang erstreckte. Man hörte Suzanne Rosselin schon von Weitem herumschreien. Camille blinzelte in der Sonne und erkannte die blauen Hemden zweier Gendarmen sowie den Fleischer Sylvain, der hin und her rannte. Sobald es um Fleisch ging, musste er dabei sein.
Und dann stand da, priesterlich, gerade, aufrecht an die Mauer des Schafstalls gelehnt, der »Wacher«. Sie hatte noch keine Gelegenheit gehabt, den alten Schäfer von Suzanne, der immer inmitten seiner Schafe zu finden war, von Nahem zu sehen. Es hieß, er schlafe in dem alten Gebäude, umgeben von seinen Tieren, aber das schockierte niemanden. Man nannte ihn den »Wacher«, das heißt den »Wächter«, den »Hüter«, wie Camille schließlich verstanden hatte, seinen richtigen Namen kannte sie nicht. Da stand er, mager und starr, mit stolzem Blick, etwas langen weißen Haaren, die Fäuste um einen in den Boden gerammten Stock geballt, und war im wirklichen Wortsinne ein würdevoller Greis, sodass Camille nicht wusste, ob sie ihn wohl ansprechen durfte.
Neben Suzanne stand genauso aufrecht, so als wolle er dem Wacher in nichts nachstehen, der junge Soliman. Wenn man die beiden so sah, wie zwei unbewegliche Leibwächter rechts und links neben Suzanne, hätte man glauben können, dass sie nur auf ein Zeichen von ihr warteten, um mit einem Stockschlag eine imaginäre Horde heranstürmender Angreifer zu vertreiben. Aber das schien nur so. Der Wacher stand in seiner normalen Haltung, und Soliman richtete sich angesichts der etwas dramatischen Umstände ganz einfach nach ihm aus. Suzanne verhandelte mit den Gendarmen, es wurden Protokolle aufgenommen. Die toten Schafe waren an einen kühleren Ort geschafft worden, in die Dunkelheit des Schafstalls.
Als Camille vor ihr stand, legte Suzanne ihr eine kräftige Pranke auf die Schulter und schüttelte sie.
»Jetzt wär der Moment, wo dein Trapper hier sein sollte«, sagte sie. »Damit er uns was sagt. Er ist bestimmt schlauer als diese beiden Arschlöcher, die kriegen’s einfach nicht auf die Reihe.«
Der Fleischer Sylvain schien etwas sagen zu wollen.
»Halt’s Maul, Sylvain«, unterbrach ihn Suzanne. »Du bist genauso bescheuert wie die anderen. Ich nehm’s dir nicht krumm, bist entschuldigt, ist ja nicht dein Job.«
Niemand fühlte sich beleidigt, und die beiden Gendarmen füllten weiter apathisch die Formulare aus.
»Ich hab ihm Bescheid gesagt«, sagte Camille. »Er kommt runter.«
»Hast du danach noch ’ne Minute Zeit? In den Latrinen ist was undicht, das müsstest du mir reparieren.«
»Ich hab mein Werkzeug nicht dabei, Suzanne. Später.«
»Schau dir inzwischen mal das da drinnen an, meine Liebe«, sagte Suzanne und wies mit ihrem dicken Daumen in Richtung Schafstall. »Wirklich das Blutopfer eines Wilden.«
Bevor Camille durch die niedrige Tür ging, grüßte sie respektvoll und etwas eingeschüchtert den Wacher und schüttelte Soliman die Hand. Im Gegensatz zu dem Wacher kannte Camille Soliman, der Suzanne wie ein Schatten überallhin folgte und ihr bei allen Arbeiten half, gut, und sie kannte auch seine Geschichte.
Es war sogar die erste Geschichte gewesen, die man ihr bei ihrer Ankunft erzählt hatte, so als sei es das Allerwichtigste: Ein Schwarzer im Dorf – davon hatte man sich dreiundzwanzig Jahre danach mit Ach und Krach erholt. Der junge Afrikaner war wie im Märchen als kleines Baby in einem Feigenkorb vor der Kirchentür ausgesetzt worden. Niemand in Saint-Victor oder in der Umgebung hatte je irgendeinen Schwarzen gesehen, und man vermutete, das Baby sei in der Stadt gemacht worden, vielleicht in Nizza, wo man sich alles Mögliche vorstellen konnte, einschließlich schwarzer Babys. Aber nun lag es vor dem Portal der Kirche Notre-Dame in Saint-Victor und schrie wie am Spieß. Im Morgengrauen hatte sich das halbe Dorf bestürzt um den Korb und das pechschwarze Kind versammelt. Dann hatten sich, zögernd noch, Frauenarme nach ihm ausgestreckt, um es hochzuheben, es dann in den Armen zu wiegen und zu beruhigen. Lucie, die das Café am Platz führte, hatte als Erste gewagt, ihm einen Kuss auf die rotzverschmierte Wange zu geben. Aber nichts hatte den Kleinen, der vor Brüllen schier erstickte, beruhigen können. »Es hat Hunger, das Kind«, hatte eine Alte gesagt, »Es hat geschissen« ein anderer. Dann hatte sich die massige Suzanne mit athletischen Schritten genähert, hatte die Reihen durchbrochen, sich den Kleinen geschnappt und ihn auf ihrem Arm gehalten. Das Kind hatte augenblicklich aufgehört zu brüllen und seinen Kopf an Suzannes großen Busen fallen lassen. In diesem Augenblick hatte jeder – wie in einem Märchen, in dem die Prinzessinnen alle dicke Suzannen sind – es für eine ausgemachte Sache gehalten, dass das kleine Kind von nun an der Herrin von Les Écarts gehörte. Suzanne hatte ihren Zeigefinger in den gierigen Mund gesteckt und gebrüllt – Lucie würde sich noch ihr ganzes Leben daran erinnern:
»Durchsucht den Korb, ihr Arschlöcher! Da liegt garantiert ein Zettel!«
Dort hatte tatsächlich ein Zettel gelegen. Der Pfarrer hatte sich auf die Stufen vor der Kirche gestellt, würdevoll einen Arm ausgestreckt, um Ruhe einkehren zu lassen, und mit lauter Stimme vorzulesen begonnen: Biteschon, beschaftigen ihm …
»Red deutlicher, du Arschloch!«, hatte Suzanne lauthals gerufen und das Baby geschüttelt. »Man versteht kein Wort!«
Daran würde sich Lucie noch ihr ganzes Leben erinnern. Suzanne Rosselin hatte vor nichts und niemandem Respekt.
»Biteschon«, hatte der Pfarrer folgsam wiederholt, »beschaftigen ihm, beschaftigen gut. Er heist Soliman Melchior SambaDIAWARAsagen sie ihm seine Mutter gut und sein Fater böse wie Sumfhölle. Beschaftigen ihm, lieben ihm, biteschon.«
Suzanne hatte sich an den Pfarrer gedrückt, um über seine Schulter mitzulesen. Dann hatte sie ihm den vollgepissten Zettel weggenommen und ihn in eine Tasche ihres Sackkleids gestopft.
»Soliman Melchior Dingsbums?«, hatte Germain, der Straßenwärter, lachend gefragt. »Was denn noch alles? Was soll der Scheiß? Kann der nicht Gérard heißen wie alle? Was glaubt die Mutter, wo sie herkommt? Hält sich wohl für was Besonderes?«
Hier und da wurde gelacht, aber nicht viel. Das musste man den Leuten von Saint-Victor schon lassen, hatte Lucie hinzugefügt, es waren nicht alles Arschlöcher, sie konnten sich beherrschen, wenn es nötig war. Nicht wie in Pierrefort, wo Menschliches nicht viel zählte.
Einstweilen lag der kleine schwarze Kopf des Babys noch immer in der Armbeuge der großen Frau. Wie alt mochte es sein? Einen Monat, wenn’s hochkam. Und wen mochte es? Suzanne. So ist das Leben.
»Gut«, hatte Suzanne gesagt und ihr Völkchen von der Kirchentreppe aus gemustert. »Wenn jemand nach ihm sucht, so ist er auf Les Écarts.«
Und damit war die Angelegenheit erledigt.
Niemand hatte je nach dem kleinen Soliman Melchior Samba Diawara gesucht. Und manchmal fragte man sich, was auf Les Écarts geschehen wäre, wenn die leibliche Mutter auf den Gedanken gekommen wäre, ihn zurückzuholen. Denn Suzanne Rosselin hatte seit diesem entscheidenden Moment – den man im Dorf »den Tag auf der Kirchentreppe« nannte – entschieden Zuneigung zu dem Kleinen gefasst, und es wurde allgemein daran gezweifelt, dass sie ihn kampflos zurückgegeben hätte. Nach zwei Jahren hatte der Notar sie dazu gebracht, den Papierkram für das Kind zu erledigen. Nicht, den Kleinen zu adoptieren, dazu hatte sie kein Recht, aber die Vormundschaft zu legalisieren.
Auf diese Weise war der kleine Soliman zum Sohn Rosselin geworden. Suzanne hatte ihn wie einen Jungen aus der Gegend aufwachsen lassen, ihn dabei aber heimlich wie einen afrikanischen König erzogen, weil sie unterschwellig davon überzeugt war, dass ihr Kleiner ein unehelicher, aus dem Weg geräumter Prinz eines mächtigen Königreichs sei. So schön, wie er geworden war – schön wie ein Gott –, wäre das auch das Mindeste. Daher wusste der junge Soliman Melchior mit dreiundzwanzig Jahren genauso viel über Tomatenstecklinge, Olivenpressen, Kichererbsenschösslinge und das Ausbringen von Jauche wie über die Sitten und Gebräuche des großen Schwarzen Kontinents. Alles, was er über Schafe wusste, hatte der Wacher ihm beigebracht. Und alles, was er über Afrika wusste, alles Glück und Unglück, alle Sagen und Legenden des Kontinents hatte er aus den Büchern, die ihm Suzanne gewissenhaft vorgelesen hatte – eine Tätigkeit, über der sie selbst zu einer fachkundigen Afrikanistin geworden war.
Noch heute achtete Suzanne im Fernsehen auf jeden ernsthaften Dokumentarfilm, der geeignet schien, den Jungen zu bilden: die Reparatur eines Tanklastwagens auf einer Piste in Ghana, grüne Meerkatzen aus Tansania, Polygamie in Mali, Diktaturen, Bürgerkriege, Staatsstreiche, Aufstieg und Glanz des Königreichs Benin.
»Sol«, rief sie, »beweg deinen Hintern! Im Fernsehen kommt was über dein Land.«
Suzanne hatte sich nie entscheiden können, aus welchem Land Soliman nun stammte, und so ging sie aus praktischen Gründen davon aus, dass ganz Schwarzafrika ihm gehören würde. Und es kam überhaupt nicht in Frage, dass Soliman auch nur einen einzigen Dokumentarfilm verpasste. Mit siebzehn hatte der junge Mann ein einziges Mal versucht aufzubegehren.
»Ich hab mit diesen Typen nichts zu schaffen«, hatte er angesichts einer Reportage über Warzenschweinjagden gejammert.
Und zum ersten und letzten Mal hatte Suzanne ihm eine Backpfeife verpasst.
»Red nicht so über deine Herkunft!«, hatte sie befohlen.
Und da Soliman den Tränen nahe war, hatte sie versucht, es ihm sanfter zu erklären, während sie ihre dicke Hand auf die zarte Schulter des Kleinen drückte.
»Wir scheißen auf das Vaterland, Sol. Man wird geboren, wo man eben geboren wird. Aber versuch nicht, deine Vorfahren zu leugnen, das bringt dich in eine blöde Situation. Verleugnen ist nicht gut. Verleugnen, abstreiten, drauf spucken, das ist was für die Frustrierten, die Kraftprotze, die Typen, die glauben wollen, dass sie sich ganz allein erschaffen haben. Arschlöcher halt. Du hast Les Écarts und dann noch ganz Afrika. Nimm das alles, und du bist doppelt so viel.«
Soliman führte Camille in den Schafstall und deutete auf die blutigen Tiere, die aufgereiht auf dem Boden lagen. Camille sah sie aus sicherer Entfernung an.
»Was sagt Suzanne?«, fragte sie.
»Suzanne ist gegen die Wölfe. Sie sagt, dass da nichts Gutes bei rauskommt. Dass dieses Tier aus Lust am Töten angreift.«
»Ist sie für die Treibjagd?«
»Sie ist auch gegen die Treibjagden. Sie sagt, dass man ihn nicht schnappen wird, dass er woanders ist.«
»Und der Wacher?«
»Der Wacher ist trübsinnig.«
»Ist er für die Treibjagd?«
»Ich weiß es nicht. Seitdem er die Schafe gefunden hat, hat er keinen Ton gesagt.«
»Und du, Soliman?«
In diesem Augenblick betrat Lawrence den Stall. Er rieb sich die Augen, um sie an die plötzliche Dunkelheit zu gewöhnen. Der alte Raum stank stark nach fettiger Wolle und alter Pisse, er fand die Franzosen schmuddelig. Könnten mal sauber machen. Ihm folgte Suzanne, die Lawrences Ansicht nach ebenfalls stank, sowie in respektvollem Abstand die beiden Gendarmen und der Fleischer, den Suzanne erfolglos wegzuschicken versucht hatte. »Ich hab den Kühlraum, ich nehm die Schafe mit«, hatte er erwidert.
»Nichts da«, hatte Suzanne geantwortet. »Der Wacher wird sie hier auf Les Écarts begraben, mit dem gebotenen Respekt vor den Tapferen, die auf dem Felde der Ehre gefallen sind.«
Das hatte Sylvain die Sprache verschlagen, aber er war ihr trotzdem gefolgt. Der Wacher war an der Türe stehen geblieben. Er wachte.
Lawrence grüßte Soliman und kniete sich dann neben die zerrissenen Kadaver. Er drehte sie um, untersuchte die Wunden und durchwühlte die blutgetränkte Wolle auf der Suche nach dem deutlichsten Abdruck. Er zog ein noch ganz junges Weibchen zu sich heran und untersuchte die Bissspur an der Kehle.
»Sol, nimm die Lampe vom Haken«, sagte Suzanne. »Mach ihm Licht.«
Unter dem gelblichen Lichtbündel beugte sich Lawrence über die Wunde.
»Der Reißzahn ist kaum eingedrungen«, murmelte er. »Dafür aber der Eckzahn.«