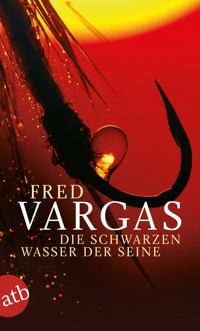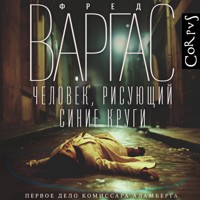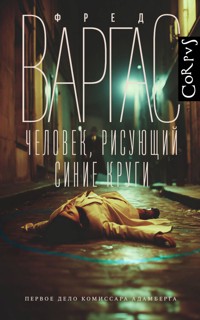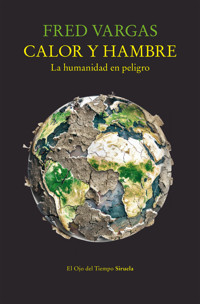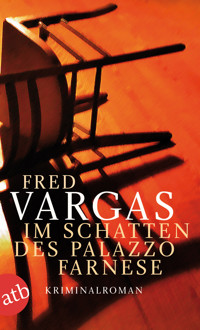10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Adamsberg ermittelt
- Sprache: Deutsch
Dieser Fall geht Kommissar Adamsberg unter die Haut wie nie zuvor!
Kommissar Adamsberg, der an einem DNA-Lehrgang in Québec teilnehmen soll, erfährt durch einen Zeitungsartikel von dem furchtbaren Verbrechen an einem Mädchen, das mit einem Dreizack ermordet wurde. Der Fall ruft alten Schrecken in ihm wach: Vor dreißig Jahren wurde sein Bruder Raphaël zu Unrecht eines ähnlichen Verbrechens bezichtigt. Der Mann, den Adamsberg für den eigentlichen Täter hielt, ist längst tot. Hat er einen Nachahmer gefunden? Ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt, in dem Adamsberg selbst zum Verdächtigen wird …
Wenn Ihnen die Krimis um Kommissar Adamsberg gefallen, lesen Sie auch die Evangelisten-Reihe unserer internationalen Bestseller-Autorin Fred Vargas!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alle unabhängig voneinander lesbaren Bände der Kommissar-Adamsberg-Reihe
Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord
Bei Einbruch der Nacht
Fliehe weit und schnell
Der vierzehnte Stein
Die dritte Jungfrau
Der verbotene Ort
Die Nacht des Zorns
Das barmherzige Fallbeil
Der Zorn der Einsiedlerin
Jenseits des Grabes
Autorin
Fred Vargas, geboren 1957, ist ausgebildete Archäologin und hat Geschichte studiert. Sie ist heute die bedeutendste französische Kriminalautorin mit internationalem Renommee. 2004 erhielt sie für »Fliehe weit und schnell« den Deutschen Krimipreis, 2012 den Europäischen Krimipreis für ihr Gesamtwerk und 2016 den Deutschen Krimipreis in der Kategorie International für »Das barmherzige Fallbeil«.
Fred Vargas
Der vierzehnte Stein
Kommissar Adamsberg ermittelt
Aus dem Französischen von Julia Schoch
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »Sous les vents de Neptune« bei Éditions Viviane Hamy, Paris.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© Copyright der Originalausgabe Fred Vargas und Éditions Viviane Hamy, Paris, 2004.
Taschenbuchausgabe 2024 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe
© Deutsche Erstveröffentlichung Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2005, 2008.
Übersetzung: Julia Schoch
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
KW · Herstellung: sam
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31677-8V002
www.blanvalet.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
Für Jo Vargas, meine Zwillingsschwester
1
An die schwarze Kellerwand gelehnt, betrachtete Jean-Baptiste Adamsberg den gewaltigen Heizkessel, der zwei Tage zuvor jede Tätigkeit eingestellt hatte. An einem Samstag, 4. Oktober, während die Außentemperatur auf ungefähr ein Grad gesunken war und ein steifer Wind von der Arktis her wehte. Laienhaft begutachtete der Kommissar den Brenner und die nun stillen Rohrleitungen, in der Hoffnung, sein freundlicher Blick könnte der Anlage neue Kraft einflößen oder aber den Fachmann auftauchen lassen, der kommen sollte und nicht kam.
Dabei war er weder besonders kälteempfindlich, noch war ihm die Situation unangenehm. Im Gegenteil, die Vorstellung, der Nordwind käme ohne Aufenthalt oder Umweg vom Packeis geradewegs in die Straßen des Pariser 13. Arrondissements, gab ihm das Gefühl, er könnte mit einem einzigen Schritt in jene eisigen Weiten gelangen, dort umherstapfen und sich ein Loch für die Robbenjagd aufhacken. Er hatte sich noch eine Strickweste unter seine schwarze Jacke gezogen, und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er hier in aller Ruhe die Ankunft des Monteurs abgewartet und auf das Auftauchen der Robbenschnauze gelauert.
Aber die mächtige Maschine im Kellergeschoss trug nun einmal auf ihre Weise zur Aufklärung der Fälle bei, die zu jeder Tageszeit auf die Brigade criminelle zukamen, indem sie die Körper der vierunddreißig Radiatoren und der achtundzwanzig Bullen im Gebäude wärmte. Kältestarre Körper, die derzeit in Anoraks verschwunden waren, sich um den Kaffeeautomaten drängten und ihre behandschuhten Finger an die weißen Becher drückten. Oder sich gleich davonmachten in die umliegenden Bars. Damit aber erstarrten auch die Akten. Hochwichtige Akten, blutige Verbrechen. Die den gewaltigen Heizkessel indes nicht interessierten. Wie ein fürstlicher Tyrann wartete er darauf, dass ein Mann der Zunft sich aufmachen und sich ihm zu Füßen legen möge. Als Zeichen seines guten Willens war Adamsberg schließlich hinuntergegangen, um ihm seine kurze und überflüssige Aufwartung zu machen, aber vor allem auch, um dem Lamentieren seiner Männer zu entfliehen und ein wenig Dunkel und Stille zu finden.
Dieses Gejammer, während sich in den Räumen doch immerhin noch eine Temperatur von zehn Grad hielt, war ein schlechtes Vorzeichen für den DNA-Lehrgang in Québec, wo sich ein rauer Herbst ankündigte – minus vier Grad gestern in Ottawa und hier und da bereits Schnee. Zwei Wochen, in denen es um genetische Fingerabdrücke gehen würde, um Speichel, Blut, Schweiß, Tränen, Urin und andere Absonderungen, die heutzutage elektronisch erfasst, geordnet und analysiert werden konnten, alle menschlichen Säfte, die zum regelrechten Kriegsgerät der Kriminalwissenschaft geworden waren. Eine Woche vor der Abreise hatten Adamsbergs Gedanken bereits abgehoben in Richtung kanadische Wälder, jene unermesslich Weiten, wie es hieß, die durchlöchert waren von Tausenden von Seen. Sein Stellvertreter Danglard hatte ihn grollend daran erinnert, dass sie wohl eher auf Bildschirme starren würden und in gar keinem Fall auf die Oberfläche von Seen. Seit einem Jahr grollte Capitaine Danglard nun schon. Adamsberg wusste, warum, und wartete geduldig darauf, dass dieses Knurren sich legte.
Danglard dachte nicht über Seen nach, sondern betete jeden Tag, dass ein heißer Fall die gesamte Brigade hier festnageln möge. Seit einem Monat quälte ihn der Gedanke an sein baldiges Ableben bei einer Explosion der Maschine über dem Atlantik. Seitdem allerdings der Fachmann, der kommen sollte, nicht kam, wurde seine Stimmung merklich besser. Er setzte auf diesen unerwarteten Ausfall des Heizkessels und hoffte, der Kälteeinbruch würde die absurden Fantasien entkräften, die die eisigen Weiten Kanadas in den Köpfen seiner Kollegen erzeugten.
Adamsberg legte seine Hand auf die Brennerklappe der Anlage und lächelte. Wäre Danglard imstande, den Heizkessel zu manipulieren, weil er die demobilisierende Wirkung einer solchen Aktion voraussah? Und die Ankunft des Monteurs zu verzögern? Ja, zu so etwas war Danglard imstande. Seine bewegliche Intelligenz glitt in jedes noch so feine Räderwerk des menschlichen Geistes: vorausgesetzt natürlich, dass es auf Vernunft und Logik beruhte. Und genau hier, auf dem schmalen Grat zwischen Vernunft und Instinkt, waren Adamsberg und sein Stellvertreter mit den Jahren zu absoluten Gegensätzen geworden.
Der Kommissar stieg die Wendeltreppe wieder hinauf und durchquerte den großen Saal im Erdgeschoss, wo sich seine Männer schwerfällig, weil angedickt mit der Last ihrer Schals und Pullover, wie in Zeitlupe hin und her bewegten. Ohne jeden erkennbaren Grund nannte man diesen Raum den Konzilsaal, sicherlich, dachte Adamsberg, weil hier die gemeinsamen Versammlungen stattfanden, Schlichtungsgespräche oder auch Verschwörungssitzungen, je nachdem. Ebenso nannte man den angrenzenden Raum den Kapitelsaal, er war viel kleiner, und hier versammelte sich der engere Kreis der Mitarbeiter. Wer sich diese Namen ausgedacht hatte, wusste Adamsberg nicht. Wahrscheinlich Danglard, dessen Bildung ihm mitunter grenzenlos, ja beinahe toxisch erschien. Der Capitaine wurde von heftigen Wissensausbrüchen heimgesucht, die so häufig wie unkontrollierbar über ihn kamen, etwa wie ein Pferd, das sich in schnaubender Erregung schüttelt. Ein schwacher Anreiz genügte – ein selten verwendetes Wort, ein verschwommener Begriff –, und schon setzte sich bei ihm ein gelehrter Mechanismus in Gang, der nicht unbedingt immer sehr angebracht war, sich jedoch mit einer Handbewegung unterbrechen ließ.
Mit einer verneinenden Geste bedeutete Adamsberg den Gesichtern, die sich ihm auf seinem Weg zuwandten, dass der Heizkessel noch immer kein Lebenszeichen von sich gab. Er erreichte das Büro von Danglard, der mit düsterer Miene die dringendsten Berichte zu Ende schrieb, für den verheerenden Fall, dass er mit nach Labrador musste. Allerdings würde er dort ja ohnehin nie ankommen wegen dieser Explosion über dem Atlantik infolge eines Brandes im linken Triebwerk, ausgelöst durch einen Schwarm Stare, der in die Turbine geraten war. Und das war eine Aussicht, die ihn seiner Meinung nach vollauf berechtigte, eine Flasche Weißwein schon vor sechs Uhr abends zu öffnen.
Adamsberg setzte sich auf eine Ecke des Tisches.
»Wie weit, Danglard, sind wir mit dem Fall Hernoncourt?«
»So gut wie abgeschlossen. Der alte Baron hat ein Geständnis abgelegt. Vollständig und klar.«
»Zu klar«, sagte Adamsberg, indem er den Bericht zurückschob und sich die Zeitung griff, die sauber gefaltet auf dem Tisch lag. »Da haben wir ein Abendessen im Kreise der Familie, das in einem Gemetzel endet, und wir haben einen zögerlichen alten Mann, der sich in seinen Worten verstrickt. Plötzlich aber entschließt er sich zur Klarheit, ohne jeden Übergang, ohne Helldunkel. Nein, Danglard, das unterschreiben wir nicht.«
Adamsberg schlug geräuschvoll eine Seite der Zeitung um.
»Und das soll heißen?«, fragte Danglard.
»Dass wir noch mal von vorn beginnen. Der Baron führt uns doch an der Nase herum. Er deckt jemanden, und sehr wahrscheinlich seine Tochter.«
»Und die Tochter würde ihren Vater ans Messer liefern?«
Adamsberg blätterte eine nächste Seite der Zeitung um. Danglard mochte es nicht, wenn der Kommissar seine Zeitung las. Er gab sie ihm stets zerknittert und in Einzelteilen zurück, man brauchte dann gar nicht erst zu versuchen, das Papier wieder in seine gefaltete Form zu bringen.
»Hat man schon erlebt«, antwortete Adamsberg. »Aristokratische Traditionen und vor allem ein mildes Urteil für einen schwachen alten Mann. Ich sage Ihnen nochmals, da gibt’s nichts Zwielichtiges und so was ist nicht vorstellbar. Dieser Sinneswandel kommt viel zu plötzlich, das Leben kennt keine so sauberen Brüche. Also ist irgendetwas faul daran.«
Danglard war müde, er verspürte plötzlich eine heftige Lust, sich den Bericht zu schnappen und alles hinzuschmeißen. Auch die Zeitung an sich zu reißen, die Adamsberg in seinen Händen achtlos auseinandernahm. Ob wahr oder falsch, er würde in jedem Fall gezwungen sein, das verdammte Geständnis des Barons noch einmal zu überprüfen, nur weil der Kommissar irgendeine schwammige Eingebung hatte. In den Augen Danglards glichen diese Eingebungen einer primitiven Rasse wurmartiger Weichtiere ohne Füße noch Flossen, ohne Unter- noch Oberseite, deren durchsichtige Körper unter der Wasseroberfläche trieben, und sie reizten den präzisen, scharfen Verstand des Capitaine, ja sie widerten ihn regelrecht an. Er wäre auch deshalb gezwungen, noch einmal alles zu überprüfen, weil diese weichtierartigen Eingebungen sich nur allzu häufig als richtig erwiesen, dank wer weiß welchem adamsbergschen Vorauswissen, das der raffiniertesten Logik trotzte. Ein Vorauswissen, das den Kommissar von Erfolg zu Erfolg schließlich bis auf diese Tischkante geführt hatte, auf diesen Posten als ungebührlicher, versonnener Chef der Mordbrigade des 13. Arrondissements. Ein Vorauswissen, das Adamsberg selbst indes leugnete und ganz einfach die Leute, das Leben nannte.
»Hätten Sie das nicht früher sagen können?«, meinte Danglard. »Bevor ich den ganzen Bericht hier geschrieben habe?«
»Ich bin erst heute Nacht darauf gekommen«, entgegnete Adamsberg und schlug plötzlich die Zeitung zu. »Beim Gedanken an Rembrandt.«
Er faltete die Zeitung hastig zusammen, aus der Fassung gebracht von einem heftigen Unwohlsein, das ihn mit einer Wucht befiel, als würde ihm eine Katze mit ausgefahrenen Krallen in den Rücken springen. Ein Schlag, ein Gefühl der Beklemmung, Schweiß im Nacken, trotz der Kälte im Büro. Sicher war es gleich vorbei, ganz bestimmt, es ging ja schon wieder.
»In dem Fall«, fuhr Danglard fort und sammelte seinen Bericht ein, »werden wir wohl hierbleiben müssen, um uns damit zu befassen. Oder sehen Sie eine andere Möglichkeit?«
»Mordent wird den Fall übernehmen, wenn wir weg sind, er wird das sehr gut machen. Wie weit sind wir denn mit Québec?«
»Der Präfekt erwartet morgen um vierzehn Uhr unsere Antwort«, entgegnete Danglard und runzelte besorgt die Stirn.
»Sehr gut. Setzen sie eine Versammlung der acht Mitglieder des Lehrgangs an, um halb elf im Kapitelsaal. Danglard«, fuhr er nach einer Pause fort, »Sie müssen nicht unbedingt mitkommen.«
»Ach nein? Der Präfekt höchstpersönlich hat die Teilnehmerliste aufgestellt. Und ich steh ganz obenauf.«
In diesem Augenblick wirkte Danglard nicht gerade wie eines der herausragendsten Mitglieder der Brigade. Angst und Kälte hatten ihm seine gewohnte Würde genommen. Hässlich und von der Natur wenig begünstigt – wie er meinte –, setzte Danglard auf makellose Eleganz, die seine unbestimmten Züge und die hängenden Schultern ausgleichen und seinem langen, weichen Körper ein wenig englischen Charme verleihen sollte. Heute aber, mit seinem verdrossenen Gesicht, der Felljacke, in die er sich gezwängt hatte, und einer Matrosenmütze auf dem Schädel, konnte er jegliches Bemühen um Stil als gescheitert ansehen. Umso mehr, als die Mütze, die wohl einem seiner fünf Kinder gehörte, auch noch von einer Bommel gekrönt war, die Danglard zwar, so gut es ging, abgeschnitten hatte, deren roter Stummel aber lächerlicherweise sichtbar geblieben war.
»Wir könnten immer noch eine Grippe vorschieben, wegen des defekten Heizkessels«, schlug Adamsberg vor.
Danglard hauchte in seine Handschuhe.
»Ich soll in weniger als zwei Monaten zum Commandant aufsteigen«, brummte er, »und ich kann’s mir nicht leisten, diese Beförderung zu verpassen. Ich habe fünf Kinder zu ernähren.«
»Zeigen Sie mir mal die Karte von Québec. Zeigen Sie mir, wohin wir fahren.«
»Habe ich Ihnen doch schon erzählt«, antwortete Danglard und faltete eine Karte auseinander. »Hier«, sagte er, indem er auf einen Fleck zwei Meilen vor Ottawa tippte. »In ein Kaff am Arsch der Welt namens Hull-Gatineau, wo die GRC einen Teil der nationalen Gendatenbank untergebracht hat.«
»Die GRC?«
»Habe ich Ihnen doch schon erzählt«, wiederholte Danglard. »Die Gendarmerie royale du Canada. Polizei in roten Stiefeln und roter Uniform wie zu der guten alten Zeit, als die Irokesen noch die Gesetze machten an den Ufern des Sankt-Lorenz-Stroms.«
»In roter Uniform? Laufen die immer noch so rum?«
»Nur für die Touristen. Wenn Sie’s nicht erwarten können, dahin zu reisen, wäre es vielleicht ganz gut zu wissen, wohin Sie Ihren Fuß setzen.«
Adamsberg lächelte übers ganze Gesicht und Danglard senkte den Kopf. Er mochte es nicht, dass Adamsberg so lächelte, wenn er selbst sich entschieden hatte zu grollen. Weil, so sagte man im Gerüchtezimmer, das heißt in dem Winkel, wo die Imbiss- und Getränkeautomaten standen, Adamsbergs Lächeln Widerstände weich werden und Polareis schmelzen ließ. Und auch Danglard reagierte darauf wie ein junges Mädchen, was ihm mit seinen über fünfzig Jahren ziemlich gegen den Strich ging.
»Immerhin weiß ich, dass diese GRC am Ottawa-Strom liegt«, stellte Adamsberg fest. »Und dass es dort Wildgänse gibt.«
Danglard trank einen Schluck Weißwein und lächelte dünn.
»Ringelgänse«, präzisierte er. »Und der Ottawa River ist kein Strom, sondern ein Fluss. Er ist zwar zwölfmal länger als die Seine, aber trotzdem ein Fluss. Der in den Sankt-Lorenz-Strom mündet.«
»Gut, ein Fluss also, wenn Sie darauf bestehen. Sie wissen zu viel darüber, um noch auszusteigen, Danglard. Sie hängen doch längst mit drin und werden mitfahren. Nur zu meiner Beruhigung: Sagen Sie mir, dass nicht Sie es waren, der in der Nacht den Heizkessel niedergemacht und den Monteur, der kommen sollte und nicht kommt, auf seinem Weg hierher umgebracht hat.«
Danglard sah beleidigt auf.
»Warum sollte ich?«
»Um unsere Kräfte lahmzulegen und unsere Lust auf Abenteuer einzufrieren.«
»Sabotage? Wissen Sie, was Sie da sagen?«
»Eine kleine, harmlose Sabotage. Besser ein defekter Heizkessel als eine explodierende Boeing. Denn das ist doch der wahre Grund Ihrer Verweigerung? Nicht wahr, Capitaine?«
Da schlug Danglard plötzlich mit der Faust auf den Tisch, dass Wein auf die Berichte spritzte. Adamsberg schreckte hoch. Danglard konnte grollen, brummen oder still vor sich hin schmollen, alles maßvolle Formen, um, wenn nötig, sein Missfallen auszudrücken, aber in erster Linie war er ein kultivierter, höflicher Mensch mit einer ebenso unerschöpflichen wie taktvollen Güte. Außer wenn es um ein bestimmtes Thema ging, und Adamsberg machte sich steif.
»Mein ›wahrer Grund‹?«, sagte Danglard kühl, die geballte Faust noch immer auf dem Tisch. »Was schert Sie mein ›wahrer Grund‹? Ich leite doch diese Brigade nicht, und ich schick uns auch nicht los, um die Blödmänner zu spielen im Schnee. Scheiße.«
Adamsberg schüttelte den Kopf. In den vielen Jahren war es das erste Mal, dass Danglard ihm direkt ins Gesicht Scheiße sagte. Na schön. So etwas traf ihn nicht, aufgrund seiner einzigartigen Fähigkeit zur Gelassenheit und Sanftmut, die von einigen Gleichgültigkeit und Desinteresse genannt wurde und all jene zum Wahnsinn trieb, die versuchten, listig in diesen Nebel einzudringen.
»Ich erinnere Sie daran, Danglard, dass es sich um ein ganz seltenes Angebot zur Zusammenarbeit handelt und um eines der leistungsfähigsten Systeme, die es zurzeit gibt. Die Kanadier sind auf diesem Gebiet absolut spitze. Wenn wir absagen würden, stünden wir wie die Blödmänner da.«
»Quatsch! Erzählen Sie mir doch nicht, Ihr Berufsethos würde Ihnen vorschreiben, uns in dieser Arschkälte anöden zu lassen.«
»Doch, ganz genau.«
Danglard leerte sein Glas in einem Zug und sah Adamsberg mit vorgestrecktem Kinn ins Gesicht.
»Was sonst, Danglard?«, fragte Adamsberg ruhig.
»Ihr Grund«, knurrte er. »Ihr wahrer Grund. Wenn Sie mal davon reden würden, anstatt mir Sabotage zu unterstellen. Wenn Sie mal von Ihrer eigenen Sabotage reden würden?«
Na endlich, dachte Adamsberg. Da hätten wir’s.
Danglard stand ruckartig auf, öffnete seine Schublade, holte die Flasche Weißwein heraus und goss sein Glas voll. Dann lief er durchs Zimmer. Adamsberg verschränkte die Arme und wartete, dass das Gewitter losbrach. Wenn er in dieser Wut- und Weinphase war, war es nicht angebracht, irgendetwas zu entgegnen. Eine Wut, die sich mit einem Jahr Verspätung schließlich entlud.
»Nur zu, Danglard, wenn Sie darauf bestehen.«
»Camille. Camille ist in Montreal und Sie wissen es. Darum und aus keinem anderen Grund stecken Sie uns in diese verdammte Höllenboeing.«
»Das also ist es.«
»Ja, genau.«
»Und eben das geht Sie nichts an, Capitaine.«
»Nein?«, schrie Danglard. »Vor einem Jahr hat Camille sich davongemacht, ist aus Ihrem Leben verschwunden durch eins dieser vertrackten Abtauchmanöver, deren Geheimnis nur Sie kennen. Und wer wollte sie unbedingt wiedersehen? Wer? Sie? Oder ich?«
»Ich.«
»Und wer hat ihre Spur verfolgt? Sie wiedergefunden, ausfindig gemacht? Wer hat Ihnen ihre Adresse in Lissabon beschafft? Sie? Oder ich?«
Adamsberg stand auf und schloss die Tür des Büros. Danglard hatte Camille immer verehrt, ihr geholfen und sie behütet wie einen Kunstgegenstand. Daran war nicht zu rütteln. Und dieser Beschützereifer vertrug sich sehr schlecht mit Adamsbergs chaotischem Leben.
»Sie«, antwortete er gelassen.
»Richtig. Also geht es mich etwas an.«
»Leiser, Danglard. Ich höre Sie sehr gut, Sie müssen nicht schreien.«
Diesmal schien der besondere Klang von Adamsbergs Stimme seine Wirkung zu tun. Wie ein Heilmittel wanden sich die Schwingungen der Kommissarsstimme um den Gegner und lösten eine Ruhe oder auch ein Gefühl des inneren Friedens, der Heiterkeit und Freude oder auch völlige Unempfindlichkeit in ihm aus. Lieutenant Voisenet, von Beruf Chemiker, war im Gerüchtezimmer oft auf dieses Rätsel zu sprechen gekommen, aber niemand hatte je herausgefunden, welches lindernde Mittel denn nun wirklich Adamsbergs Stimme beigemischt worden war. Thymian? Gelée royale? Wachs? Eine Mischung von alledem? Danglard senkte den Ton.
»Und wer«, fuhr er leiser fort, »ist nach Lissabon gerannt, sie zu sehen, und hat die ganze Geschichte in weniger als drei Tagen wieder kaputtgekriegt?«
»Ich.«
»Sie. Eine einzige Sinnlosigkeit, nicht mehr und nicht weniger.«
»Die Sie nichts angeht.«
Adamsberg stand auf, spreizte die Finger und ließ den Becher senkrecht in den Papierkorb fallen, genau in die Mitte. So wie einer schießt, wie er zielt. Er verließ das Zimmer mit gleichmäßigen Schritten, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Danglard presste die Lippen aufeinander. Er wusste, dass er die Grenze überschritten und auf verbotenem Terrain angegriffen hatte. Aber unter dem Druck des Unmuts, den er nun seit Monaten mit sich herumtrug, und gereizt durch die Sache mit Québec, hatte er sich nicht mehr beherrschen können. Er rieb sich mit seinen rauen Wollhandschuhen über die Wangen und dachte unschlüssig nach über diese Monate lastenden Schweigens, der Lüge, vielleicht sogar des Verrats. Es war gut so, oder auch schlecht. Durch seine Finger hindurch fiel sein Blick auf die auf dem Tisch ausgebreitete Karte von Québec. Wozu sich überhaupt das Leben schwer machen? In einer Woche wäre er tot, und Adamsberg auch. Stare, von der Turbine geschluckt, linkes Triebwerk in Brand, Explosion überm Atlantik. Er hob die Flasche und trank einen großen Schluck. Dann nahm er den Telefonhörer ab und wählte die Nummer des Monteurs.
2
Beim Kaffeeautomaten traf Adamsberg Violette Retancourt. Er hielt ein wenig Abstand und wartete, dass der kräftigste seiner Lieutenants sein Glas von den Zitzen der Maschine zog – denn in der Vorstellungswelt des Kommissars erinnerte der Getränkeapparat an eine Nährkuh, die sich in den Büros der Mordbrigade niedergelassen hatte, eine stille Mutter, die über sie wachte, und dafür liebte er ihn. Aber Retancourt verschwand, sobald sie ihn sah. Ganz offensichtlich, dachte Adamsberg, während er einen Becher unter das Euter des Automaten stellte, war dies nicht sein Tag.
Ob nun sein Tag oder nicht, Lieutenant Retancourt war ein seltener Fall. Adamsberg hatte dieser beeindruckenden Frau, fünfunddreißig Jahre alt, ein Meter neunundsiebzig groß und hundertzehn Kilo schwer, nichts vorzuwerfen, sie war ebenso intelligent wie stark und besaß die Fähigkeit, wie sie bereits demonstriert hatte, ihre Kraft nach Belieben umzuwandeln. Und in der Tat hatte die Vielfalt der Mittel, die Retancourt mit einer geradezu erstaunlichen Schlagkraft innerhalb eines Jahres unter Beweis gestellt hatte, den Lieutenant zu einem Grundpfeiler des Gebäudes werden lassen, zur vielseitigen Kriegsmaschine der Brigade, einsetzbar auf jedem Gebiet, geistig, taktisch, behördlich, im Kampf wie beim Präzisionsschießen. Aber Violette Retancourt mochte ihn nicht. Ohne alle Feindseligkeit, sie ging ihm einfach aus dem Weg.
Adamsberg nahm seinen Kaffeebecher an sich, tätschelte die Maschine zum Zeichen kindlicher Dankbarkeit und ging in sein Büro zurück, in seinen Gedanken kaum beeindruckt von Danglards Ausbruch. Er hatte nicht vor, in stundenlanger Arbeit die Ängste des Capitaine zu beruhigen, ob es sich nun um die Boeing handelte oder um Camille. Allerdings wäre es ihm lieber gewesen, er hätte ihm nicht erzählt, dass Camille in Montreal war, ein Umstand, von dem er nichts wusste und der seinem Ausflug nach Québec ein wenig in die Quere kam. Es wäre ihm lieber gewesen, dass die Bilder nicht wieder zum Leben erweckt würden, die er an den Randzonen seiner Augen, im süßlichen Schlick des Vergessens, vergraben hatte, eines Vergessens, in dem das kantige Kinn versank, der kindliche Mund unscharf wurde und die weiße Haut dieses Mädchens aus dem Norden sich mit waberndem Grau überzog. Dass diese Liebe nicht aufs Neue belebt würde, die sich doch unmerklich auflöste in den vielfältigen Landschaften, die ihm die anderen Frauen boten. Sein unbestreitbarer Zwang zum Plündern, zum Stehlen junger Früchte, der Camille verständlicherweise verletzte. Wie oft hatte er gesehen, dass sie sich nach einem seiner Streifzüge die Hände auf die Ohren presste, als hätte ihr melodiöser Liebhaber mit seinen Nägeln über eine Tafel gekratzt und eine Dissonanz in ihre zarte Partitur gebracht. Camille war Musikerin, das erklärte vieles.
Er setzte sich schräg in seinen Bürosessel, blies in seinen Kaffee und richtete den Blick auf die Pinnwand, an der Berichte, dringliche Vorhaben und, in der Mitte, eine Notiz mit den Zielen der Québec-Mission angeheftet waren. Drei Blätter, mit drei roten Reißzwecken ordentlich nebeneinander festgesteckt. Genetische Fingerabdrücke, Schweiß, Pisse und Computer, Ahornblätter, Wälder, Seen, Karibus. Morgen würde er den Dienstreiseauftrag unterschreiben und in einer Woche würde er abheben. Er lächelte und nahm einen Schluck Kaffee, in Gedanken ruhig und sogar glücklich.
Plötzlich spürte er, wie ihm erneut kalter Schweiß in den Nacken trat, wie dieselbe Beklemmung ihn wieder umschloss und die Krallenkatze ihm auf die Schultern sprang. Er krümmte sich unter dem Schock und stellte vorsichtig seinen Becher auf den Tisch. Zweites Unwohlsein in nur einer Stunde, unbekannte Störung, wie ein Fremder, der unerwartet eintritt und ein heftiges Erschrecken auslöst, einen Alarm. Er zwang sich aufzustehen, ein paar Schritte zu tun. Abgesehen von diesem Schock, diesem Schweißausbruch, reagierte sein Körper ganz normal. Er legte die Hände aufs Gesicht, dehnte die Haut, massierte sich den Nacken. Ein Unwohlsein, eine Art Abwehrkrise. Ein Anfall von großer Not, die Ahnung von etwas Bedrohlichem, unter dem der Körper sich spannt. Und zurück blieb, nun, da er sich wieder problemlos bewegen konnte, ein unsagbares Gefühl von Trauer, wie ein trüber Bodensatz, den die wegströmende Welle hinterlässt.
Er trank seinen Kaffee aus und stützte das Kinn in die Hand. Es war schon bei manchen Gelegenheiten vorgekommen, dass er sich selbst nicht verstand, aber dies war das erste Mal, dass er sich entglitt. Das erste Mal, dass er ein paar Sekunden lang taumelte, so als habe ein blinder Passagier sich an Bord seines Wesens geschlichen und das Ruder übernommen. Denn dessen war er sich sicher: Es gab einen blinden Passagier an Bord. Ein vernünftiger Mensch hätte ihm die Absurdität einer solchen Vorstellung vor Augen geführt und seine plötzliche Benommenheit mit einem Anflug von Grippe erklärt. Doch Adamsberg erkannte etwas ganz anderes darin, er spürte, dass ein gefährlicher Unbekannter, der es nicht gut mit ihm meinte, für einen Augenblick in ihn eingedrungen war.
Er öffnete seinen Schrank und holte ein altes Paar Turnschuhe heraus. Spazieren gehen oder träumen, das allein würde diesmal nicht reichen. Er würde rennen müssen, stundenlang wenn nötig, zur Seine hinunter und dann immer weiter. Vielleicht würde er bei diesem Lauf seinen Verfolger abhängen, ihn auf dem Fluss aussetzen oder, warum nicht, auch auf jemand anderem.
3
Gelöst, erschöpft und geduscht beschloss Adamsberg, sein Abendessen in den Schwarzen Wassern von Dublin einzunehmen, einer dunklen Bar mit geräuschvoller Atmosphäre und erfüllt von säuerlichem Geruch, wo er schon manchen seiner Spaziergänge beschlossen hatte. Dieser Ort, der ausschließlich von Iren bevölkert war, und er verstand kein Wort Irisch, besaß den einzigartigen Vorteil, menschliche Wärme und Geschwätz in Fülle und doch gleichzeitig absolute Einsamkeit zu bieten. Er fand dort seinen von Bier verklebten Tisch vor, die guinnessgeschwängerte Luft und die Kellnerin Enid, bei der er Schweinebraten mit Kartoffeln bestellte. Enid servierte das Essen mit einer langen alten Zinngabel, die Adamsberg sehr mochte mit ihrem abgeriebenen Holzgriff und den drei unregelmäßigen Zinken. In dem Moment, wo sie das Fleisch auf den Teller legte, tauchte der Eindringling mit der Brutalität eines Vergewaltigers von Neuem auf. Diesmal meinte Adamsberg seinen Überfall den Bruchteil einer Sekunde zuvor erkannt zu haben. Die Fäuste auf dem Tisch verkrampft, versuchte er ihm Widerstand zu leisten, er spannte seinen Körper, rief andere Gedanken in sich wach, stellte sich rote Ahornblätter vor. Doch umsonst, das Unheil fuhr durch ihn hindurch, wie ein Tornado ein Feld verwüstet, schnell, unaufhaltsam und mit großer Gewalt. Um gleich darauf von seiner Beute abzulassen und sein Werk woanders fortzusetzen.
Als er seine Hände wieder strecken konnte, griff er nach dem Besteck, war aber unfähig, sein Essen anzurühren. Die Trauer, die der Tornado zurückgelassen hatte, nahm ihm den Appetit. Er entschuldigte sich bei Enid und ging auf die Straßen hinaus, wo er ziellos und unschlüssig umherlief. Sein Großonkel fiel ihm ein, der sich, wenn er krank war, in einer Felsenkuhle der Pyrenäen zusammenkauerte, bis es vorüber war. Danach streckte der Ahn sich und kehrte ins Leben zurück, sein Fieber war verschwunden, der Fels hatte es geschluckt. Adamsberg lächelte. In dieser großen Stadt würde er keine Höhle finden, um sich darin einzurollen wie ein Bär, keine einzige Felsspalte, die sein Fieber aufnehmen und seinen Eindringling in einem Stück verschlingen könnte. Aber vielleicht war er in diesem Augenblick auch schon auf den Nacken eines irischen Tischnachbarn übergesprungen.
Sein Freund Ferez, der Psychiater, hätte zweifellos versucht herauszufinden, was diese Attacken auslöste. Den verborgenen Konflikt, das uneingestandene Leid zu ergründen, das wie ein Gefangener plötzlich an seinen eisernen Ketten rüttelte. Ein Rasseln, das ebendiese Schweißausbrüche, diese Krämpfe hervorrief, und ein Geheul, unter dem sich ihm der Rücken krümmte. Das hätte Ferez zu ihm gesagt, mit jener gefräßigen Sorge, die er an ihm kannte, wenn es um außergewöhnliche Fälle ging. Er hätte gefragt, wovon er gerade gesprochen habe, als die erste von den Krallenkatzen ihm ins Kreuz gefahren sei. Von Camille vielleicht? Oder von Québec?
Er hielt im Gehen inne und kramte in seinem Gedächtnis, überlegte, was er zu Danglard gesagt haben mochte, als der erste Ausbruch ihm den Hals zugeschnürt hatte. Rembrandt, genau. Er hatte von Rembrandt gesprochen, von dem fehlenden Helldunkel im Fall Hernoncourt. In dem Moment war’s geschehen, also längst vor dem Streit über Camille oder Kanada. Und vor allem hätte er Ferez erklären müssen, dass noch nie zuvor irgendein Problem ihm eine boshafte Katze auf die Schultern gejagt hatte. Dass dies was völlig Unbekanntes war, etwas noch nie Dagewesenes, eine Neuheit. Und dass sich die Attacken in unterschiedlichen Situationen und an verschiedenen Orten ereignet hatten, ohne dass die geringste Verbindung zwischen ihnen bestand. Welchen Zusammenhang gab es zwischen der braven Enid und seinem Stellvertreter Danglard, zwischen dem Tisch in den Schwarzen Wassern und der Pinnwand? Zwischen dem Gedränge in der Bar und der Einsamkeit im Büro? Keinen. Selbst ein so cleverer Typ wie Ferez würde sich die Zähne daran ausbeißen. Und sich weigern zu glauben, dass ein Eindringling an Bord gekommen war. Er fuhr sich durchs Haar, rieb seine Arme und Schenkel, brachte seinen Körper wieder in Gang. Dann lief er weiter und versuchte sich auf seine gewohnten Kraftreserven zu besinnen: spazieren gehen, Passanten aus der Ferne beobachten, die Gedanken beweglich wie Treibholz.
Die vierte Böe erfasste ihn eine Stunde später, als er den Boulevard Saint-Paul hinauflief, nur wenige Schritte von seiner Wohnung entfernt. Er krümmte sich unter dem Anfall und stützte sich an einer Laterne ab, wie gelähmt durch das Fauchen der Gefahr. Er schloss die Augen, wartete. Keine Minute später hob er langsam den Kopf, ließ die Schultern sinken, bewegte die Finger in den Taschen, wieder der gleichen Verwirrung ausgeliefert, die der Sturm bei seinem Durchzug nun zum vierten Mal zurückließ. Eine Not, ein namenloser Schmerz, der ihm die Tränen in die Augen trieb.
Einen Namen aber hätte er gebraucht. Einen Namen für diese Heimsuchung, diesen Schrecken. Denn der vergangene Tag, der mit seinem täglichen Weg in die Büros der Mordbrigade so harmlos begonnen hatte, ließ ihn verändert zurück, er war verwandelt und unfähig, die Routine am nächsten Tag wieder aufzunehmen. Am Morgen noch ein ganz gewöhnlicher Mensch, war er nun, am Abend, in seinem Wesen erschüttert, blockiert, ein Vulkan hatte sich vor seinen Füßen aufgetan, ein Feuerschlund, in dessen Tiefe ein unerklärliches Rätsel lauerte.
Er löste sich von der Laterne und studierte seine Umgebung wie den Schauplatz eines Verbrechens, dessen Opfer er geworden war, er suchte nach einem Zeichen, das ihm den Namen des Mörders offenbaren konnte, der da auf ihn einschlug. Er trat einen Meter zurück und wieder genau an die Stelle, an der er den Hieb empfangen hatte. Sein Blick wanderte über den leeren Bürgersteig, über das dunkle Schaufenster eines Geschäftes zu seiner Rechten, ein Werbeplakat zu seiner Linken. Nichts sonst. Nur dieses beleuchtete Plakat in seinem gläsernen Kasten war klar sichtbar in der Nacht. Das also war das Letzte, was er erblickt hatte, bevor die Böe auf ihn niederfuhr. Er besah es sich genauer. Es war die Reproduktion eines klassischen Gemäldes, darunter die Ankündigung: Die Prunkmalerei des 19. Jahrhunderts. Ausstellung im Grand Palais. 18. Oktober – 17. Dezember.
Das Gemälde stellte einen muskulösen Kerl dar, hellhäutig und mit schwarzem Bart, der, umgeben von Nymphen, in einer breiten Muschel auf dem Ozean thronte. Adamsberg konzentrierte sich einen Augenblick auf dieses Bild, ohne zu begreifen, wodurch es die Attacke ausgelöst haben könnte, wie er ebenso wenig verstand, in welcher Weise sein Gespräch mit Danglard, sein Bürosessel oder der verräucherte Schankraum vom Dublin dies vermocht haben sollten. Dennoch geriet ein Mensch ja nicht durch ein Fingerschnipsen von der Normalität ins Chaos. Dazu brauchte es einen Übergang, eine Verbindung. Hier wie anderswo und auch im Fall Hernoncourt fehlte ihm das Helldunkel, die Brücke vom Ufer des Schattens hinüber zum Licht. Er seufzte vor Ohnmacht, biss sich auf die Lippen und sah forschend in die Nacht hinaus, wo ein paar Taxis leer umherschweiften. Er hob einen Arm, stieg in den Wagen und nannte dem Fahrer die Adresse von Adrien Danglard.
4
Er musste dreimal klingeln, bevor ihm Danglard schlaftrunken die Tür öffnete. Der Capitaine zog sich innerlich zusammen, als er Adamsberg sah, seine Züge schienen noch schärfer geworden, die Nase noch gebogener, und ein düsteres Flackern lag unter den hohen Wangenknochen. Also hatte der Kommissar sich nicht, wie sonst, genauso schnell entspannt, wie er sich erregt hatte. Danglard hatte die Grenze überschritten, das wusste er. Seitdem hatte er sich unaufhörlich mit dem Gedanken an eine mögliche Auseinandersetzung gemartert, eine Verwarnung vielleicht. Oder eine Strafmaßnahme? Oder noch Schlimmeres? Unfähig, die Sturzflut seines Pessimismus aufzuhalten, war er während des ganzen Abendessens die in ihm aufsteigenden Befürchtungen wieder und wieder durchgegangen, gleichzeitig bemüht, die Kinder nichts davon merken zu lassen, wie er natürlich auch das Problem mit dem linken Triebwerk mit keiner Silbe erwähnt hatte. Die beste Ablenkung war da immer noch, ihnen eine neue Story von Lieutenant Retancourt zu erzählen, was sie auf jeden Fall amüsierte, vor allem die Tatsache, dass diese kräftige Frau – von der man meinen konnte, sie sei von Michelangelo gemalt, der, bei all seinem Genie, in der Darstellung der geschmeidigen Ungewissheit des weiblichen Körpers nicht eben der Gewandteste war –, dass also diese Frau den Namen einer zarten Wildblume trug, des Veilchens. An diesem Tag also hatte sich Violette leise mit Hélène Froissy unterhalten, die gerade großen Kummer hatte. Violette hatte einen ihrer Sätze mit einem Schlag der flachen Hand auf den Kopierer bekräftigt, worauf das Gerät, dessen Papiereinzug seit fünf Tagen hoffnungslos blockiert war, augenblicklich wieder funktionierte.
Einer von Danglards Zwillingen hatte gefragt, was wohl passiert wäre, wenn Retancourt auf den Kopf von Hélène Froissy geschlagen hätte statt auf den Kopierer. Wäre es möglich gewesen, auf diese Weise die Gedanken des traurigen Lieutenant wieder in fröhlichere Bahnen zu lenken? Konnte Violette Menschen und Dinge beeinflussen, wenn sie sich darauf abstützte? Jeder von ihnen hatte anschließend gegen den maroden Fernseher geklopft, um seine eigene Macht zu testen – Danglard hatte nur einmal Klopfen pro Kind erlaubt –, aber das Bild war nicht auf den Schirm zurückgekehrt, und der Kleinste hatte sich den Finger dabei verstaucht. Als die Kinder endlich schliefen, holten ihn die düsteren Vorahnungen aufs Neue ein.
Nun stand er vor ihm, sein Vorgesetzter, und Danglard kratzte sich in einer trügerischen Geste der Selbstverteidigung die Brust.
»Machen Sie schnell, Danglard«, keuchte Adamsberg, »ich brauche Sie. Unten wartet das Taxi.«
Ernüchtert durch diese unvermittelte Rückkehr zur Ruhe, zog der Capitaine eilig Jacke und Hose an. Adamsberg nahm ihm seinen Wutausbruch also gar nicht übel, er war bereits vergessen und verschwunden im Dunstkreis seiner Langmut oder seiner gewohnten Unbekümmertheit. Wenn der Kommissar ihn mitten in der Nacht holte, musste ein Mordfall über die Brigade gekommen sein.
»Wo ist es?«, fragte er, als er wieder bei Adamsberg war.
»Saint-Paul.«
Die beiden Männer liefen die Treppe hinunter, wobei Danglard versuchte, sich gleichzeitig seinen Schlips und einen dicken Schal umzubinden.
»Gibt’s Opfer?«
»Beeilen Sie sich, mein Lieber, es ist dringend.«
Das Taxi setzte sie bei dem Werbeplakat ab. Adamsberg bezahlte, während Danglard überrascht auf die verlassene Straße sah. Kein Blaulicht, niemand von der Spurensicherung, ein leerer Bürgersteig und verschlafene Häuser. Adamsberg griff ihn beim Arm und zog ihn hastig zu dem Aufsteller. Ohne ihn loszulassen, wies er auf das Gemälde.
»Was ist das, Danglard?«
»Wie bitte?«, sagte Danglard irritiert.
»Das Gemälde, zum Donnerwetter noch mal. Ich frage Sie, was das ist. Was es darstellt.«
»Und das Opfer?«, sagte Danglard und sah sich um. »Wo ist das Opfer?«
»Hier«, sagte Adamsberg und tippte sich auf die Brust. »Antworten Sie mir. Was ist das?«
Danglard schüttelte halb verwirrt, halb beleidigt den Kopf. Dann aber kam ihm die traumhafte Absurdität dieser Situation mit einem Mal so amüsant vor, dass reine Heiterkeit seine Wut hinwegfegte. Er empfand tiefe Dankbarkeit für Adamsberg, der nicht nur seine Beleidigungen ignoriert hatte, sondern ihm an diesem Abend ganz unfreiwillig auch noch einen Moment außergewöhnlicher Verrücktheit schenkte. Denn allein Adamsberg war imstande, das gewöhnliche Leben so zu verdrehen, dass sich solche Extravaganzen, solche Augenblicke bizarrer Schönheit daraus gewinnen ließen. Was spielte es da für eine Rolle, wenn er ihn aus dem Schlaf riss, um ihn bei eisiger Kälte und weit nach Mitternacht zu Neptun zu schleppen?
»Wer ist dieser Kerl?«, wiederholte Adamsberg, ohne seinen Arm loszulassen.
»Neptun, wie er gerade aus den Fluten steigt«, antwortete Danglard lächelnd.
»Sind Sie sicher?«
»Neptun oder auch Poseidon, wie Sie wollen.«
»Ist das der Gott des Meeres oder der Hölle?«
»Sie sind Brüder«, erklärte Danglard und freute sich, mitten in der Nacht einen Vortrag über Mythologie halten zu können. »Drei Brüder: Hades, Zeus und Poseidon. Poseidon herrscht über das Meer, über seine blauen Weiten und seine Stürme, aber auch über seine abgründigen Tiefen und ihre Gefahren.«
Adamsberg hatte seinen Arm jetzt losgelassen und hörte ihm zu, die Hände im Rücken verschränkt.
»Hier«, fuhr Danglard fort und ließ seinen Finger über das Plakat wandern, »sieht man ihn umgeben von seinem Hofstaat und seinen Dämonen. Hier sind Neptuns Wohltaten dargestellt und hier seine Macht, zu strafen, veranschaulicht durch seinen Dreizack und die Unheil bringende Schlange, die in die Untiefen lockt. Es ist eine sehr akademische Darstellung, der Stil ist unausgereift und sentimental. Den Namen des Malers kann ich nicht erkennen. Vermutlich irgendein Unbekannter, der für die bürgerlichen Salons der Zeit tätig war, und wahrscheinlich …«
»Neptun«, unterbrach ihn Adamsberg nachdenklich. »Gut, Danglard, tausend Dank. Gehen Sie jetzt nach Hause, schlafen Sie. Und verzeihen Sie, dass ich Sie geweckt habe.«
Bevor Danglard noch eine Erklärung verlangen konnte, hatte Adamsberg schon ein Taxi angehalten und seinen Stellvertreter hineingeschoben. Durch die Scheibe sah Danglard, wie der Kommissar langsam davonging, eine schmale schwarze Silhouette, leicht gebeugt und ein wenig schwankend in der Nacht. Er lächelte, strich sich unwillkürlich über den Kopf und traf auf die abgeschnittene Bommel seiner Mütze. Von einer plötzlichen Unruhe erfasst, berührte er diesen Bommelknirps dreimal, auf dass er ihm Glück bringen möge.
5
Als Adamsberg zu Hause war, überflog er seine zusammengewürfelte Bibliothek auf der Suche nach irgendeinem Buch, das ihm über Neptun-Poseidon Auskunft geben konnte. Er fand ein altes Geschichtslehrbuch, in dem ihm auf Seite siebenundsechzig der Gott des Meeres in seiner ganzen Herrlichkeit erschien, in der Hand seine göttliche Waffe. Er betrachtete es einen Moment und las die kurze Erläuterung unter dem Basrelief, dann, das Buch noch in der Hand, warf er sich angezogen aufs Bett, von Müdigkeit und Kummer wie ausgelaugt.
Das Gekreisch einer Katze, die auf den Dächern raufte, weckte ihn gegen vier Uhr früh. Er öffnete die Augen in der Dunkelheit, starrte auf das etwas hellere Viereck des Fensters gegenüber dem Bett. Seine am Fensterknauf aufgehängte Jacke bildete eine große, unbewegliche Gestalt, wie ein ungebetener Gast, der in seinem Zimmer erschienen war und ihm beim Schlafen zusah. Da war er, der Eindringling, der sich in seine Höhle geschlichen hatte und ihn nicht mehr losließ. Adamsberg schloss kurz die Augen und öffnete sie wieder. Neptun mit seinem Dreizack.
Diesmal begannen seine Arme zu zittern, diesmal raste sein Herz. Kein Vergleich mit den vier Stürmen, die über ihn hinweggegangen waren, wohl aber Bestürzung und Entsetzen.
Er trank lange aus dem Wasserhahn in der Küche, spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht und über die Haare. Dann öffnete er alle Schränke auf der Suche nach Alkohol, ob hart, prickelnd, würzig, egal. Es musste doch irgendwo etwas in der Art geben, wenigstens einen Rest, den Danglard eines Abends zurückgelassen hatte. Endlich fand er eine ihm unbekannte Flasche aus gebranntem Ton, die er rasch entkorkte. Er drückte seine Nase an den Flaschenhals, prüfte das Etikett. Vierundvierzigprozentiger Wacholderschnaps. In seinen Händen zitterte die dickbauchige Flasche. Er füllte ein Glas und trank es in einem Zug leer. Zweimal hintereinander. Adamsberg spürte, wie sein Körper in seine Einzelteile zerfiel, und sackte in einen alten Sessel. Nur eine kleine Lampe ließ er brennen.
Nun, da der Alkohol seine Muskeln betäubt hatte, konnte er anfangen nachzudenken, konnte er sich vorwagen. Und versuchen, dem Ungeheuer ins Gesicht zu sehen, das Neptuns Erscheinung endlich aus seinen eigenen Tiefen hatte auftauchen lassen. Den Eindringling, den schrecklichen Gast. Den unbesiegbaren, hochmütigen Mörder, den er den »Dreizack« nannte. Den unbezwingbaren Schlächter, der vor dreißig Jahren sein Leben ins Wanken gebracht hatte. Vierzehn Jahre lang hatte er ihn beharrlich verfolgt, gejagt, jedes Mal in der Hoffnung, ihn zu fassen, und hatte seine bewegliche Beute doch immer wieder verloren. Er war gerannt, gestürzt, weitergerannt.
Und wieder gestürzt. Viele Hoffnungen hatte er dabei aufgegeben, vor allem aber hatte er seinen Bruder verloren. Der Dreizack war ihm immer wieder entwischt. Ein Titan, ein Teufel, ein Poseidon der Hölle. Der seine dreizinkige Waffe hob und mit einem einzigen Stoß in den Bauch tötete. Der seine Opfer aufgespießt zurückließ, gezeichnet mit drei roten Malen auf einer geraden Linie.
Adamsberg richtete sich in seinem Sessel auf. Die drei roten Reißzwecken an der Wand seines Büros – drei blutige Löcher. Enids lange, dreizinkige Gabel – das Abbild des Dreizacks. Und Neptun mit erhobenem Zepter. Das waren sie, die Bilder, die ihm so wehgetan hatten, die den Sturm auslösten, den Schmerz in ihn strömen ließen und seine zurückgekehrten Ängste in einer Flut von Schlamm freisetzten.
Er hätte es wissen müssen, dachte er jetzt. Hätte die Heftigkeit dieser Anfälle mit dem schmerzhaft langen Weg in Verbindung bringen müssen, den er mit dem Dreizack gegangen war. Denn nichts hatte ihm mehr Leid und Grauen, mehr Verzweiflung und Wut bereitet als dieser Mann. Er hatte das klaffende Loch, das der Mörder in sein Leben gerissen hatte, damals, vor sechzehn Jahren, verstopfen müssen, er hatte es zumauern und dann vergessen müssen. Und nun öffnete es sich jäh unter seinen Füßen, an diesem Tag und ohne allen Grund.
Adamsberg stand auf und lief, die Arme über dem Bauch verschränkt, durchs Zimmer. Einerseits fühlte er sich befreit und beinahe entspannt, weil er ins Auge des Zyklons geblickt hatte. Der Tornado würde nicht wiederkommen. Aber das plötzliche Auftauchen des Dreizacks bestürzte ihn. An diesem Montag, dem 6. Oktober, war er wiederauferstanden gleich einem Gespenst, das durch Wände ging. Beunruhigendes Erwachen, unerklärliche Wiederkehr. Er räumte die Flasche Wacholderschnaps weg und spülte sorgfältig sein Glas. Wenn er doch verstehen könnte, warum, wenn er doch gewusst hätte, aus welchem Grund der alte Mann wiederaufgetaucht war. Zwischen seiner friedlichen Ankunft heute Morgen im Büro und dem Erscheinen des Dreizacks fehlte ihm erneut die Verbindung.
Er setzte sich auf den Fußboden, den Rücken am Heizkörper, die Knie mit den Händen umschlossen, und dachte an den Großonkel, der genau so in einer Felsenkuhle gekauert hatte. Er musste sich konzentrieren, einen Punkt fixieren, hinabblicken, so tief es ging und ohne abzulassen. Er musste bis dahin zurück, wo der Dreizack ihm zum ersten Mal erschienen war, wo die erste Böe ihn erfasst hatte. Das war, als er von Rembrandt sprach, als er Danglard die Schwachstelle im Fall Hernoncourt erklärte. Er ging die Szene im Geiste noch einmal durch. Sosehr er sich anstrengen musste, um sich Wörter einzuprägen, so leicht nisteten sich Bilder in ihm ein, wie Kiesel in weicher Erde. Er sah sich wieder auf der Ecke von Danglards Schreibtisch sitzen, sah wieder das mürrische Gesicht seines Stellvertreters unter der Mütze mit der gestutzten Bommel, sah den Becher mit Weißwein, das Licht, das von links hereinfiel. Und sich selbst, wie er vom Helldunkel sprach. In welcher Haltung? Die Arme verschränkt? Oder auf den Knien? Die Hand auf dem Tisch? In der Hosentasche? Was tat er mit seinen Händen?
Er hielt eine Zeitung. Er hatte sie sich vom Tisch gegriffen, aufgefaltet und durchgeblättert, ohne sie bei seinem Gespräch wirklich wahrzunehmen. Ohne sie wahrzunehmen? Oder hatte er, im Gegenteil, doch hineingeschaut? Und zwar so genau, dass eine mächtige Woge aus seiner Erinnerung hervorgebrochen war?
Adamsberg sah auf die Uhr, zwanzig nach fünf. Er erhob sich schnell, strich seine zerdrückte Jacke glatt und ging. Sieben Minuten später entsicherte er den Alarm am Eingangstor und betrat die Räume der Brigade. In der Eingangshalle war es eisig, der Monteur, der um neunzehn Uhr hatte kommen sollen, war nicht gekommen.
Er grüßte den Wachhabenden und schlich leise in das Büro seines Stellvertreters, wobei er vermied, die Leute von der Nachtschicht auf sich aufmerksam zu machen. Er schaltete nur die Schreibtischlampe an und suchte nach der Zeitung. Danglard war nicht der Mensch, der sie auf dem Tisch herumliegen ließ: Adamsberg fand sie im Aktenschrank. Ohne sich zu setzen, blätterte er sie durch auf der Suche nach irgendeinem neptunischen Zeichen. Aber es kam schlimmer. Auf Seite sieben fand sich unter der Titelzeile Junges Mädchen in Schiltigheim mit drei Messerstichen ermordet ein unscharfes Foto, das einen Körper auf einer Tragbahre zeigte. Trotz der Grobkörnigkeit des Bildes konnte man den hellblauen Pullover des Mädchens und in Bauchhöhe drei nebeneinanderliegende rote Löcher erkennen.
Adamsberg lief um den Tisch herum und setzte sich in Danglards Bürosessel. In seinen Händen hielt er das letzte Bruchstück des Helldunkels, die drei flüchtig wahrgenommenen Wunden. Das blutige Zeichen, das er so viele Male gesehen hatte in der Vergangenheit, Handschrift des Mörders, der seit sechzehn Jahren reglos in seiner Erinnerung verharrte. Und den dieses Foto schlagartig wieder zum Leben erweckt hatte.
Nun war er ruhig. Er nahm die Seite aus der Zeitung heraus, faltete sie zusammen und steckte sie in die Innentasche seiner Jacke. Die Elemente waren an ihrem Platz, die Böen würden nicht wiederkommen. Ebenso wenig wie der Dreizack, der durch ein zufälliges Zusammentreffen von Bildern auferstanden war – und nach diesem kurzen Missverständnis in seine Höhle des Vergessens zurückkehren würde.
6
Die Versammlung der acht Mitglieder der Québec-Mission fand bei acht Grad Celsius statt, in trüber, kältegeschwächter Stimmung. Die Partie wäre verloren gewesen ohne die entscheidende Anwesenheit von Lieutenant Violette Retancourt. Ohne Handschuhe noch Mütze, zeigte sie nicht die geringste Spur von Verdrossenheit. Im Gegensatz zu ihren Kollegen, die sich mit verkrampftem Kiefer und angestrengter Stimme äußerten, hatte sie wie immer ihren kräftigen, energischen Ton drauf, der noch verstärkt wurde durch das Interesse, das sie der Québec-Mission entgegenbrachte. Sie saß zwischen Voisenet, der die Nase in seinen Schal drückte, und dem jungen Estalère, der dem vielseitigen Lieutenant einen regelrechten Kult widmete wie einer allmächtigen Göttin, einer korpulenten Juno, gekreuzt mit der Jägerin Diana und einem zwölfarmigen Shiva. Retancourt regte an, legte dar, schlussfolgerte. Ganz offensichtlich hatte sie ihre Energie heute in Überzeugungskraft umgewandelt und Adamsberg überließ ihr lächelnd die Spielführung. Trotz seiner chaotischen Nacht fühlte er sich entspannt und wieder auf seinem normalen Pegelstand. Von dem Wacholderschnaps hatte er nicht mal einen Brummschädel zurückbehalten.
Danglard beobachtete den Kommissar, der lässig auf seinem Stuhl wippte und seinen Unmut vom Vorabend vergessen zu haben schien, ja selbst ihr nächtliches Gespräch über den Gott des Meeres. Retancourt sprach noch immer, entkräftete die Gegenargumente, und Danglard fühlte, wie er zunehmend an Boden verlor und eine unabwendbare Kraft ihn zu dieser Boeing mit den von Staren verstopften Triebwerken hinzog.
Retancourt setzte sich durch. Um zwölf Uhr zehn wurde die Reise zur Königlichen Gendarmerie in Gatineau mit sieben Stimmen und einer Gegenstimme angenommen. Adamsberg hob die Versammlung auf und ging dem Präfekten ihre Entscheidung ankündigen. Auf dem Flur hielt er Danglard zurück.
»Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte er. »Ich werde den Faden schon halten. Ich mache das sehr gut.«
»Welchen Faden?«
»Den Faden, an dem das Flugzeug hängt«, erklärte Adamsberg und drückte Daumen und Zeigefinger zusammen.
Adamsberg nickte, um sein Versprechen zu besiegeln, und entfernte sich. Danglard fragte sich, ob der Kommissar sich über ihn lustig machte. Aber er schien ernst, als dächte er wirklich, dass er die Fäden von Flugzeugen hielte und ihren Absturz so verhinderte. Danglard fasste nach seiner Bommel, die seit dieser Nacht ein tröstlicher Anhaltspunkt geworden war. Und merkwürdigerweise konnte ihn der Gedanke an diesen Faden und an Adamsberg, der ihn hielt, ein wenig beruhigen.
An der Straßenecke gab es ein großes Lokal, in dem die Atmosphäre gut und das Essen schlecht war, während gegenüber ein kleines Café lag, in dem das Ambiente schlecht, aber das Essen gut war. Diese ziemlich gewichtige existenzielle Entscheidung drängte sich beinahe täglich den Mitgliedern der Brigade auf, die zwischen der Befriedigung ihres Gaumens in einem dunklen, schlecht geheizten Raum und der Gemütlichkeit des alten Lokals schwankten, das zwar noch seine Bänke aus den dreißiger Jahren besaß, aber dafür einen miserablen Küchenchef engagiert hatte. Heute siegte die Heizungsfrage über jede andere Erwägung und etwa zwanzig Beamte strebten auf das Restaurant zu. Es trug den Namen BrasseriedesPhilosophes, was etwas unpassend war, wenn man bedachte, dass pro Tag an die sechzig Bullen dort einkehrten, die sich in der Mehrheit für große Ideen wenig interessierten. Adamsberg sah, in welche Richtung der Strom seiner Männer lief, und bog zu dem schlecht geheizten Bistro ab, genannt Das Gebüsch. Er hatte seit vierundzwanzig Stunden kaum etwas gegessen, da er sein irisches Gericht ja dem Fauchen des Sturms hatte überlassen müssen.
Während er das Tagesmenü zu Ende aß, holte er die Zeitungsseite heraus, die knittrig in seiner Innentasche lag, und faltete sie auf der Tischdecke auseinander, angezogen von diesem Mord in Schiltigheim, der den Sturm in ihm ausgelöst hatte. Das Opfer, Elisabeth Wind, zweiundzwanzig Jahre alt, war vermutlich gegen Mitternacht ermordet worden, während sie mit dem Fahrrad von Schiltigheim in ihr drei Kilometer entferntes Dorf fuhr, ein Weg, den sie jeden Samstagabend zurücklegte. Ihre Leiche war im Gestrüpp ungefähr zehn Meter neben der Kantonsstraße gefunden worden. Erste Ermittlungen ergaben eine Schädelprellung und drei Einstiche im Bauch, die zum Tod geführt hatten. Das Mädchen war weder vergewaltigt noch ausgezogen worden. Ein Verdächtiger war gleich darauf in Polizeigewahrsam genommen worden, Bernard Vétilleux, achtunddreißig Jahre alt, alleinstehend und ohne festen Wohnsitz, den man vollkommen betrunken und schlafend am Straßenrand gefunden hatte, fünfhundert Meter vom Tatort entfernt. Die Polizei versicherte, einen belastenden Beweis gegen Vétilleux in Händen zu haben, wohingegen der Mann seinen eigenen Angaben zufolge keinerlei Erinnerung an die Mordnacht hatte.
Adamsberg las sich den Artikel zweimal durch. Er schüttelte langsam den Kopf, während er auf den von drei Löchern durchbohrten hellblauen Pullover starrte. Unmöglich, da gab es keinen Zweifel. Er musste es besser wissen als jeder andere. Er strich das Zeitungspapier glatt, zögerte, dann holte er sein Mobiltelefon heraus.
»Danglard?«
Sein Stellvertreter meldete sich mit vollem Mund aus des Philosophes.
»Den Commandant der Gendarmerie von Schiltigheim, im Département Bas-Rhin, könnten Sie mir den herausfinden?«
Danglard wusste die Namen der Kommissare in sämtlichen Städten Frankreichs aus dem Gedächtnis, aber bei der Provinzgendarmerie kannte er sich weniger gut aus.
»Ist es genauso dringend wie die Identifizierung von Neptun?«
»Nicht ganz, aber sagen wir, es gehört zur selben Kategorie.«
»Ich rufe Sie in einer Viertelstunde zurück.«
»Vergessen Sie in Ihrem Eifer nicht, den Heizungsmonteur anzutreiben.«
Adamsberg trank gerade seinen doppelten Espresso – viel dünner als der aus der Nährkuh in der Brigade –, als sein Stellvertreter zurückrief.
»Commandant Thierry Trabelmann. Haben Sie was, um seine Nummer zu notieren?«
Adamsberg schrieb sie auf die Papiertischdecke. Er wartete, bis die alte Standuhr vom Gebüsch zwei Uhr schlug, dann rief er die Gendarmerie von Schiltigheim an. Commandant Trabelmann zeigte sich verhältnismäßig reserviert. Er hatte schon von Kommissar Adamsberg gehört, Gutes wie Schlechtes, und war unschlüssig, wie er sich verhalten sollte.
»Ich habe nicht vor, Ihnen den Fall wegzunehmen, Commandant Trabelmann«, versicherte ihm Adamsberg gleich zu Beginn.
»Das sagt sich so, dabei weiß man ja, wie das endet. Die Provinzgendarmerie macht die Drecksarbeit, und sobald es interessant wird, reißen sich’s die großen Bullen von der Kripo unter den Nagel.«
»Eine schlichte Bestätigung ist alles, was ich brauche.«
»Ich weiß nicht, was Ihnen im Kopf rumgeht, Kommissar, aber Sie sollten wissen, dass wir unser Bürschchen bereits haben, und zwar gut verwahrt.«
»Bernard Vétilleux?«
»Ja, und das ist absolut sicher. Die Waffe wurde fünf Meter neben dem Opfer gefunden, wahr und wahrhaftig im Gras liegen gelassen. Stimmt genau mit den Wunden überein. Und mit Vétilleux’ Fingerabdrücken auf dem Griff, wahr und wahrhaftig.«
Wahr und wahrhaftig. So einfach war das also. Adamsberg fragte sich einen Moment, ob er weitermachen oder aufgeben sollte.
»Aber Vétilleux leugnet die Fakten?«, fuhr er fort.
»Er war noch voll wie ’ne Haubitze, als meine Leute ihn einkassiert haben. Kaum fähig, sich gerade zu halten. Dass er leugnet, ist keinen Pfifferling wert: Er erinnert sich an nichts, außer daran, wie ein Loch gesoffen zu haben.«
»Ist er vorbestraft? Andere Überfälle?«
»Nein. Aber jeder fängt ja mal an.«
»Im Artikel ist von drei Einstichen die Rede. Handelt es sich um ein Messer?«
»Um ein Stecheisen.«
Adamsberg schwieg einen Moment.
»Eher ungewöhnlich«, bemerkte er.
»Nicht unbedingt. Diese Obdachlosen schleppen einen regelrechten Trödelladen mit sich herum. So ein Stecheisen lässt sich zum Büchsenöffnen wie zum Schlösserknacken verwenden. Machen Sie sich mal keine Gedanken, Kommissar, ich garantiere Ihnen, wir haben unseren Burschen.«
»Eine letzte Sache noch, Commandant«, sagte Adamsberg rasch, der Trabelmanns Ungeduld spürte. »Dieses Stecheisen, ist es neu?«
Es wurde still in der Leitung.
»Woher wissen Sie das?«, fragte Trabelmann misstrauisch.
»Es ist neu, oder?«
»Allerdings. Was ändert das?«
Adamsberg stützte die Stirn in die Hand und starrte auf das Zeitungsfoto.
»Seien Sie nett, Trabelmann. Schicken Sie mir Fotos von der Leiche und Großaufnahmen von den Wunden.«
»Und warum sollte ich das tun?«
»Weil ich Sie liebenswürdig darum bitte.«
»Wahrhaftig?«
»Ich werde Ihnen den Fall nicht wegnehmen«, wiederholte Adamsberg. »Sie haben mein Wort.«
»Was drückt Sie denn?«
»Eine Kindheitserinnerung.«
»Na, wenn das so ist«, sagte Trabelmann plötzlich respektvoll und versöhnlich, als wären Kindheitserinnerungen ein heiliges Motiv und ein Sesam-öffne-dich, das nicht anzuzweifeln war.
7
Der Monteur, der kommen sollte und nicht kam, war endlich an seinem Bestimmungsort eingetroffen, ebenso vier Fotos von Commandant Trabelmann. Eine der Aufnahmen zeigte deutlich die Wunden des jungen Opfers in der Draufsicht, vollkommen plan.
Adamsberg kam mit seiner Mailbox inzwischen gut zurecht, wusste aber ohne Danglards Hilfe nicht, wie man Bilder vergrößerte.
»Was ist das?«, murmelte der Capitaine und setzte sich auf Adamsbergs Platz, um das Kommando zu übernehmen.
»Neptun«, antwortete Adamsberg mit einem halben Lächeln, »wie er sein Zeichen in die blaue See drückt.«
»Aber was ist es?«, wiederholte Danglard.
»Sie stellen mir immer Fragen und dann mögen Sie nie meine Antworten.«
»Ich weiß nur ganz gern, woran ich herumpussle«, sagte Danglard ausweichend.
»Die drei Löcher von Schiltigheim, die drei Einstiche vom Dreizack.«
»Von Neptun? Ist das eine fixe Idee?«
»Es ist ein Mord. Ein junges Mädchen, das durch drei Stiche mit einem Eisen getötet wurde.«
»Hat Trabelmann uns die geschickt? Ist er von dem Fall entbunden?«
»Ganz sicher nicht.«
»Also?«
»Also, ich weiß nicht. Ich weiß nichts, bevor ich nicht diese Vergrößerung habe.«
Danglard verzog das Gesicht und begann mit der Bildübertragung. Er hasste dieses »Ich weiß nicht«, einer von Adamsbergs häufigsten Sätzen, der ihn schon unzählige Male auf unbestimmte Fährten, ja manchmal auf regelrechte Schlammpfade geführt hatte. Für Danglard war er das Vorspiel zu den Gedankensümpfen, und er hatte schon oft befürchtet, dass Adamsberg eines Tages mit Haut und Haaren darin versinken könnte.
»Ich habe gelesen, sie hätten den Typen eingesperrt«, Danglard wurde deutlicher.
»Ja. Mitsamt der Mordwaffe und den Fingerabdrücken.«
»Was macht Ihnen dann noch zu schaffen?«
»Eine Kindheitserinnerung.«
Auf Danglard machte diese Antwort nicht denselben beschwichtigenden Eindruck wie auf Trabelmann. Im Gegenteil, der Capitaine spürte, wie seine Befürchtungen zunahmen. Er ging auf maximale Bildvergrößerung und startete den Druckvorgang. Adamsberg sah zu, wie das Bild rucksend aus dem Gerät kam. Er griff es an einer Ecke, ließ es rasch in der Luft trocknen und schaltete dann die Lampe an, um es genauer zu betrachten. Ohne zu begreifen, sah Danglard, wie er sich ein langes Lineal nahm, eine Spanne maß, dann eine andere, eine Linie zog, mit einem Punkt die Mitte der blutigen Einstiche markierte, eine weitere, parallele Linie zog, noch einmal maß. Schließlich warf Adamsberg das Lineal weg und lief im Zimmer umher, das Foto in der Hand. Als er sich herumdrehte, las Danglard in seinen Zügen eine Art erstaunten Schmerz. Und wenn Danglard diesen Ausdruck auch schon bei Tausenden Gelegenheiten gesehen hatte, so sah er ihn doch zum ersten Mal auf dem leidenschaftslosen Gesicht von Adamsberg.
Der Kommissar nahm einen neuen Ordner aus dem Schrank, legte die schmale Akte hinein und schrieb fein säuberlich einen Titel darauf, Dreizack Nr. 9, mit einem Fragezeichen dahinter. Er würde nach Straßburg fahren und sich die Leiche ansehen müssen. Allerdings kämen damit auch die dringlich zu treffenden Vorbereitungen für die Québec-Mission ins Stocken. Er beschloss, sie Retancourt anzuvertrauen, denn in dieser Angelegenheit war sie ihnen allen ohnehin um Längen voraus.
»Kommen Sie mit zu mir nach Hause, Danglard. Sie müssen das sehen, sonst verstehen Sie nicht.«
Danglard ging in sein Büro zurück und holte seine große schwarze Ledertasche, mit der er wie ein englischer Collegeprofessor oder manchmal auch wie ein Priester in Zivil aussah, und folgte Adamsberg durch den Konzilsaal. Bei Retancourt blieb Adamsberg stehen.
»Ich möchte Sie heute vor Feierabend noch sprechen«, sagte er. »Sie werden mich entlasten müssen.«
»Kein Problem«, antwortete Retancourt und sah kaum von ihrem Aktenordner auf. »Ich bin bis Mitternacht im Dienst.«
»Perfekt. Bis heute Abend also.«
Adamsberg war schon aus dem Raum, als er plötzlich die fette Lache von Brigadier Favre hörte und gleich darauf seine näselnde Stimme.
»Er braucht dich, um ihn zu entlasten«, feixte Favre. »Heute ist der große Abend, Retancourt, Defloration des Veilchens. Der Chef kommt aus den Pyrenäen, so wie der klettert keiner auf Berge. Ein wahrer Profi unbezwingbarer Gipfel.«
»Eine Sekunde, Danglard«, sagte Adamsberg und hielt seinen Stellvertreter zurück.
Gefolgt von Danglard, ging er in den Raum zurück und geradewegs auf Favres Schreibtisch zu. Es war plötzlich sehr still. Adamsberg griff eine Seite des metallenen Tischs und stieß ihn mit Wucht zurück. Er kippte krachend um, riss Papiere, Berichte, Dias mit sich, die wild durcheinander auf dem Boden landeten. Favre, seinen Kaffeebecher in der Hand, saß verdattert da und zeigte keine Reaktion. Adamsberg peilte die Stuhlkante an und ließ das Ganze hintenüberkippen, den Stuhl samt Brigadier und Kaffee, der sich über dessen Hemd ergoss.
»Nehmen Sie das zurück, Favre, eine Entschuldigung und dass es Ihnen leidtut. Ich warte.«
Scheiße, dachte Danglard und griff sich an die Stirn. Er sah, wie Adamsbergs Körper sich spannte. In den letzten zwei Tagen hatte er mehr neue Gefühlsregungen an ihm erlebt als in all den Jahren ihrer Zusammenarbeit.
»Ich warte«, wiederholte Adamsberg.
Favre rappelte sich auf die Ellbogen hoch, um ein wenig Würde vor den Kollegen zurückzuerlangen, die sich jetzt verstohlen dem Epizentrum des Streits näherten. Nur Retancourt, die Zielscheibe von Favres Grausamkeiten, saß regungslos da. Allerdings ordnete sie keine Akten mehr.
»Was denn zurücknehmen?«, kreischte Favre. »Die Wahrheit? Was hab ich denn gesagt? Dass Sie ein Bergsteiger-Ass sind, stimmt das etwa nicht?«
»Ich warte, Favre«, wiederholte Adamsberg.
»Scheiß drauf«, erwiderte Favre, der wieder zu sich kam.
Da riss Adamsberg Danglard die schwarze Ledertasche aus den Händen, holte eine volle Flasche heraus und zerschmetterte sie auf dem metallenen Tischbein. Glassplitter und Wein flogen durch den Raum. Mit der zerschlagenen Flasche in der Hand tat er einen Schritt auf Favre zu. Danglard wollte den Kommissar zurückhalten, aber Favre hatte mit einer raschen Bewegung seine Waffe gezogen und zielte mit dem Revolver auf Adamsberg. Die Mitglieder der Brigade erstarrten vor Schreck und sahen auf den Brigadier, der es wagte, seine Waffe auf den Kommissar zu richten. Auch ihren Kommissar starrten sie an, bei dem sie in einem ganzen Jahr nur zwei spontane Wutausbrüche erlebt hatten, die genauso schnell wieder erloschen, wie sie entflammt waren. Jeder suchte sofort nach einer Möglichkeit, die Auseinandersetzung zu beenden, jeder hoffte, dass Adamsberg zu seinem gewohnten Gleichmut zurückfände, die Flasche fallen ließe und sich schulterzuckend entfernte.
»Nimm deine Scheißwaffe runter, blöder Bulle«, sagte Adamsberg.
Verächtlich schmiss Favre den Revolver weg und Adamsberg senkte die Flasche ein Stück. Er spürte, dass dieser Ausbruch etwas Unangemessenes, ja sicher sogar Groteskes hatte, und wusste nicht einmal, wer von ihnen beiden, Favre oder er, hier den Sieg davontrug. Seine Finger lockerten sich. Der Brigadier richtete sich vollends auf, und in einem plötzlichen Wutanfall schleuderte er den splittrigen Flaschenboden von sich, der sauber wie eine Klinge in Adamsbergs linken Arm schnitt.
Favre wurde auf einen Stuhl gezerrt, wo man ihn festhielt. In Erwartung einer Entscheidung angesichts dieser neuartigen Situation wandten sich alle Gesichter dem Kommissar zu. Mit einer Geste hielt Adamsberg Estalère zurück, der schon den Telefonhörer abnahm.
»Ist nicht tief, Estalère«, sagte er mit wieder ruhiger Stimme, wobei er den angewinkelten Arm an seinen Oberkörper drückte. »Sagen Sie unserem Gerichtsmediziner Bescheid, er wird das schon machen.«
Er gab Mordent ein Zeichen und hielt ihm die halb zerschmetterte Flasche hin.
»In eine Plastiktüte damit, Mordent. Beweisstück meiner Gewalttätigkeit. Einschüchterungsversuch eines meiner Untergebenen. Sammeln Sie seine Magnum und den Flaschenboden ein, Beweis seiner Aggression, wenn auch ohne die Absicht zu …«
Adamsberg fuhr sich durchs Haar und suchte nach dem passenden Wort.
»Doch!«, brüllte Favre.
»Halt’s Maul«, schrie ihn Noël an. »Mach’s nicht noch schlimmer, hast schon genug Schaden angerichtet.«