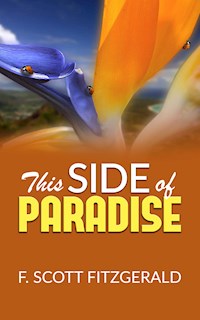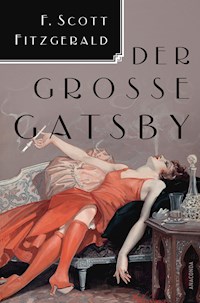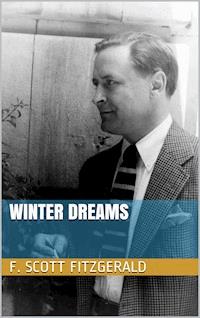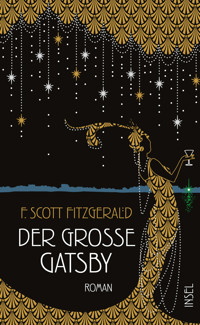8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Meisterhaft neu übersetzt von Lutz-W. Wolff Nach den beiden berühmten Romanen ›Der große Gatsby‹ und ›Zärtlich ist die Nacht‹ erscheinen nun auch die besten Kurzgeschichten F. Scott Fitzgeralds bei dtv. Die Verfilmung von ›Der seltsame Fall des Benjamin Button‹ im Jahr 2008 hat viel Aufmerksamkeit auf die kürzeren Texte des Autors gelenkt, die durch ihre sprachliche wie poetische Kraft bestechen. In der Neuübersetzung von Lutz-W. Wolff erstrahlen diese Meisterwerke in neuem Glanz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
F.Scott Fitzgerald
Bernice schneidet ihr Haar ab
Erzählungen
Neu übersetzt, mit einem Nachwortund Anmerkungen vonLutz-W.Wolff
Deutscher Taschenbuch Verlag
Neuübersetzung 2012
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
© für die deutschsprachigen Ausgabe:
2012Deutscher Taschenbuch Verlag, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital– die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41328-2 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-14120-8
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
Inhalt
Bernice schneidet ihr Haar ab
May Day
Ein kurzer Trip nach Hause
Doppeltes Unrecht
Drei Stunden zwischen zwei Flugzeugen
Das verlorene Jahrzehnt
Der seltsame Fall des Benjamin Button
Nachwort
Anmerkungen zum Text
Zeittafel
Bernice schneidet ihr Haar ab
Wenn man sich an Samstagabenden nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Golfplatz an den ersten Abschlag stellte, lagen die Fenster des Country Clubs wie ein gelber Horizont über einem schwarzen, bewegten Meer. Die Wellen dieses Meeres waren die Köpfe der vielen neugierigen Caddies, der etwas schlaueren Chauffeure und der tauben Schwester des Golflehrers. Normalerweise gab es auch ein paar andere, sanfte Wellen, die genauso gut im Inneren hätten plätschern können, wenn sie gewollt hätten. Das war die Galerie.
Der »Balkon« befand sich im Inneren. Er bestand aus einem Kreis von Korbstühlen an den Wänden des großen Clubraums, der an diesen Abenden zum Ballsaal wurde. Dieser Bereich war erfüllt von einem großen weiblichen Stimmengewirr, hervorgerufen von Damen mittleren Alters mit scharfen Augen und eisigen Herzen hinter Lorgnetten und breiten Busen. Die Hauptfunktion des Balkons war kritischer Natur. Gelegentlich zeigte er widerwillige Bewunderung, aber gebilligt wurde hier gar nichts, denn unter Damen über fünfunddreißig ist wohlbekannt, dass die jungen Leute nur die übelsten Absichten hegen, wenn sie sich im Sommer zum Tanz treffen, dass verirrte, einzelne Pärchen in den Ecken barbarische Dinge tun, wenn sie nicht ständig mit versteinerten Blicken traktiert werden, und dass die beliebtesten und gefährlichsten Mädchen manchmal sogar in den geparkten Limousinen ahnungsloser Matronen geküsst werden.
Aber letztlich ist dieser Kreis von Kritikerinnen nicht nahe genug an der Bühne, um die Gesichter der Schauspieler sehen zu können und die subtilen Nuancen der Handlung genau zu erfassen. Sie können nur die Stirn runzeln und die Köpfe zusammenstecken, Fragen stellen und befriedigte Schlüsse aus ihren Prinzipien ziehen, zu denen unter anderem gehört, dass jeder junge Mann mit einem höheren Einkommen das Leben eines gejagten Rebhuhns führt. Das eigentliche Drama der trügerischen, halbgrausamen Welt der Adoleszenz können sie niemals begreifen. Nein, die Hauptdarsteller, der Chor, die »Logen« und das »Parkett« befinden sich in jenem Wirbel von Gesichtern und Stimmen, der sich zu den klagenden afrikanischen Lauten von Dyer’s Orchester im Tanz wiegt.
Vom sechzehnjährigen Otis Ormonde, der noch zwei Jahre auf der Hill School bleiben muss, bis zu G.Reece Stoddard, der zu Hause über dem Schreibtisch schon ein juristisches Diplom aus Harvard hängen hat, von der kleinen Madeleine Hogue, die sich immer noch seltsam und unbehaglich mit der hochgesteckten Frisur fühlt, bis zu Bessie MacRae, die schon ein bisschen zu lange– mehr als zehn Jahre– der Mittelpunkt jeder Party ist, bildet dieses bunte Durcheinander nicht nur die eigentliche Bühne, sondern umfasst auch die einzigen Leute, die einen ungehinderten Blick darauf haben.
Mit einem Tusch hört die Musik auf. Die Paare tauschen ein müheloses, künstliches Lächeln, wiederholen spöttisch die letzten Takte: la-di-da-da dum-dum, und dann übertönt das Gickern junger weiblicher Stimmen das Beifallklatschen.
Ein paar enttäuschte junge Männer, die gerade abklatschen wollten und mitten auf der Tanzfläche vom Ende der Musik überrascht worden sind, kehren lustlos an die Wände zurück. Hier ging es nicht so wild wie bei den Bällen zur Weihnachtszeit zu. Die sommerlichen Tanzereien wurden als nette, anregende Feste betrachtet, wo auch die Jungverheirateten noch gelegentlich aufstanden und zur gutmütigen Erheiterung ihrer jüngeren Brüder und Schwestern altmodische Walzer und einen ängstlichen Foxtrott vorführten.
Warren McIntyre, der ohne großes Engagement in Yale studierte, war einer dieser Enttäuschten; er tastete in der Jacke seines Abendanzugs nach einer Zigarette und schlenderte auf die große, halb im Dunkeln liegende Veranda hinaus, wo die Paare an Tischen verstreut saßen und die von Lampions beleuchtete Nacht mit unbestimmten Worten und flüchtigem Lachen erfüllten. Er nickte hierhin und dorthin, wo die weniger mit sich selbst Beschäftigten saßen, und jedes Mal, wenn er an einem Paar vorbeikam, lief ein halbvergessenes Bruchstück einer Geschichte vor seinem geistigen Auge ab, denn es war keine große Stadt und jeder war ein Who’s who aller anderen. Da saßen zum Beispiel Jim Strain und Ethel Demorest, die seit drei Jahren heimlich verlobt waren. Jeder wusste, dass sie ihn sofort heiraten würde, wenn es Jim gelingen sollte, sich mal zwei Monate lang an einer Arbeitsstelle zu halten. Trotzdem sahen sie so gelangweilt aus, und Ethel schaute Jim so müde an, als ob sie sich fragte, warum sie die Ranken ihrer Zuneigung gerade an eine so schwankende Pappel geheftet hatte.
Warren war neunzehn und bedauerte alle seine Freunde, die nicht nach Osten aufs College gegangen waren. Aber wie alle Jungen gab er mächtig mit den Mädchen aus seiner Stadt an, wenn er weit genug weg war. Da war Genevieve Ormonde, die bei allen Bällen, Hauspartys und Footballschlachten in Princeton, Yale, Williams und Cornell die Runde machte. Da war die schwarzäugige Roberta Dillon, die in ihrem Jahrgang genauso berühmt war wie Hiram Johnson oder Ty Cobb; und natürlich war da Marjorie Harvey, die abgesehen davon, dass sie ein feenhaftes Gesicht und eine schnelle, verwirrende Zunge hatte, zu Recht auch dafür gefeiert wurde, dass sie beim letzten Pump and Slipper-Ball in Yale fünfmal hintereinander Rad geschlagen hatte.
Warren, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgewachsen war, war schon seit Längerem »verrückt nach ihr«. Manchmal schien sie sein Gefühl mit einer blassen Dankbarkeit zu erwidern, aber sie hatte ihn mit ihrem unfehlbaren Test geprüft und ihm mit ernster Miene mitgeteilt, dass sie ihn nicht liebte. Der Test bestand darin, dass sie ihn immer vergaß, wenn sie nicht in seiner Nähe war, und Geschichten mit anderen Jungs anfing. Warren fand das entmutigend, besonders, weil sie den ganzen Sommer über kleine Reisen gemacht hatte und er jedes Mal, wenn sie wieder zu Hause war, auf dem Tisch in der Garderobe der Harveys mehrere Tage lang haufenweise Briefe gesehen hatte, die in verschiedenen männlichen Handschriften an Marjorie adressiert waren. Und um alles noch schlimmer zu machen, hatte sie auch noch den ganzen August Besuch von ihrer Cousine Bernice aus Eau Claire und es schien unmöglich, sie mal alleine zu treffen. Ständig musste man nach jemandem suchen, der sich um Bernice kümmerte, und je weiter der August voranschritt, desto schwieriger wurde das.
Obwohl er Marjorie anbetete, musste Warren doch zugeben, dass ihre Cousine Bernice irgendwie lahm war. Sie war hübsch, hatte dunkles Haar und einen schönen Teint, aber es machte keinen Spaß mit ihr auf einer Party. Jeden Samstag tanzte er einen langen, mühseligen Pflichttanz mit ihr, um Marjorie zu gefallen, aber er hatte sich immer nur gelangweilt in ihrer Gesellschaft.
»Warren–« Eine leise Stimme und eine Berührung an seinem Ellbogen unterbrachen seine Gedanken. Er wandte sich um und sah Marjorie, erhitzt und strahlend wie immer. Sie legte ihm die Hand auf die Schulter und sofort begann er unmerklich zu glühen.
»Warren«, flüsterte sie. »Tu mir einen Gefallen und tanz mit Bernice. Sie hängt jetzt schon fast eine Stunde bei dem kleinen Otis Ormonde fest.«
Warrens Glühen verblasste.
»Klar, natürlich«, sagte er halbherzig.
»Es macht dir doch nichts aus, oder? Ich achte schon darauf, dass du nicht an ihr kleben bleibst.«
»Schon gut.«
Marjorie lächelte– und dieses Lächeln war Belohnung genug.
»Du bist ein Engel, ich bin dir total dankbar.«
Mit einem Seufzer sah der Engel sich auf der Veranda um, aber Bernice und Otis waren nirgends zu sehen. Er ging wieder hinein, und da fand er Otis vor der Damentoilette inmitten einer Gruppe von jungen Männern, die sich vor Lachen krümmten. Otis schwenkte ein Stück Holz, das er aufgehoben hatte, und führte wilde Reden.
»Sie ist reingegangen, um sich die Haare zu richten«, erklärte er lautstark. »Und ich darf jetzt darauf warten, eine weitere Stunde mit ihr zu tanzen.«
Das Lachen erhob sich von Neuem.
»Warum klatscht sie von euch keiner ab?«, rief Otis empört. »Sie möchte auch etwas Abwechslung.«
»Aber Otis«, sagte einer der Freunde. »Du hast dich doch gerade erst an sie gewöhnt.«
»Was willst du denn mit dem Balken da?«, fragte Warren lächelnd.
»Welcher Balken? Ach, der? Das ist eine Keule, wenn sie wieder rauskommt, hau ich sie ihr über den Schädel und schubse sie wieder rein.«
Warren ließ sich auf ein Sofa fallen und lachte. »Keine Sorge, Otis«, sagte er schließlich. »Diesmal werd ich dich erlösen.«
Otis simulierte einen plötzlichen Ohnmachtsanfall und gab Warren den Stock.
»Falls du ihn brauchst, alter Junge«, sagte er heiser.
Ganz egal, wie schön oder klug ein Mädchen sein mag– wenn sie den Ruf hat, selten abgeklatscht zu werden, ist das eine heikle Lage auf einem Ball. Die jungen Männer finden ihre Gesellschaft vielleicht sogar reizvoller als die der vielen Schmetterlinge, mit denen sie ein Dutzend Mal am Abend tanzen, aber die Jazzgeneration ist nun einmal ruhelos, und die Vorstellung, einen ganzen Foxtrott mit demselben Mädchen zu tanzen, erscheint ihnen unangenehm, ja absolut grässlich. Wenn es gar um mehrere Tänze hintereinander geht, einschließlich der Pausen dazwischen, dann kann sie sicher sein, dass ihr der junge Mann, wenn er endlich abgelöst worden ist, nie wieder auf die eigensinnigen Zehen treten wird.
Warren tanzte den ganzen nächsten Tanz mit Bernice und führte sie schließlich– dankbar für die Unterbrechung– zu einem Tisch auf der Veranda. Es entstand eine Pause, in der sie wenig imponierende Dinge mit ihrem Fächer tat.
»Hier ist es heißer als in Eau Claire«, sagte sie.
Warren unterdrückte ein Stöhnen und nickte. Das war– soweit er wusste– durchaus möglich. Müßig überlegte er, ob sie so wenig Aufmerksamkeit fand, weil sie eine schlechte Gesprächspartnerin war, oder ob sie eine schlechte Gesprächspartnerin war, weil sie so wenig Aufmerksamkeit fand.
»Bleibst du noch lange hier?«, fragte er, und dann wurde er rot. Womöglich erriet sie den Grund seiner Frage.
»Noch eine Woche«, erwiderte sie und starrte ihn an, um sich augenblicklich auf seine nächste Bemerkung zu stürzen, wenn sie seine Lippen verließ.
Warren zappelte herum. Einem plötzlichen barmherzigen Impuls folgend beschloss er, einen seiner Sprüche bei ihr zu probieren. Er wandte sich ihr zu und sah ihr in die Augen.
»Du hast einen richtigen Kussmund«, flüsterte er.
Das war ein Satz, den er gelegentlich bei College-Bällen benutzte, wenn er mit einem Mädchen in ähnlichem Halbdunkel saß. Bernice zuckte sichtlich zusammen. Sie wurde auf unattraktive Weise rot und hantierte ungeschickt mit dem Fächer. So etwas hatte noch nie jemand zu ihr gesagt.
»Frech!«– das Wort entfuhr ihr, ehe sie es richtig merkte, und sie biss sich sofort auf die Lippen. Viel zu spät entschloss sie sich, amüsiert zu sein, und schenkte ihm ein verlegenes Lächeln.
Warren war genervt. Er war es zwar gewöhnt, dass dieser Spruch nicht ernst genommen wurde, aber zumindest rief er doch meist ein Lachen oder ein paar Zeilen sentimentales Geplänkel hervor. Und er hasste es, wenn man ihn frech nannte, außer natürlich im Scherz. Sein barmherziger Impuls erstarb, und er wechselte das Thema.
»Jim Strain und Ethel Demorest sitzen natürlich auch wieder draußen«, sagte er.
Das lag mehr auf ihrer Linie, aber in ihre Erleichterung über den Themenwechsel mischte sich auch ein leichtes Bedauern. Männer redeten nicht mit ihr über Kussmünder, aber sie wusste, dass sie mit anderen Mädchen über so etwas redeten.
»Oh ja«, sagte sie und lachte. »Ich habe gehört, dass sie sich schon seit Jahren anschwärmen– ohne einen roten Heller zu haben. Ist das nicht albern?«
Warrens Abneigung wuchs. Jim Strain war ein enger Freund seines Bruders, und außerdem fand er es ganz schlechten Stil, wenn man sich über Leute lustig machte, weil sie kein Geld hatten. Aber Bernice wollte sich gar nicht lustig machen. Sie war bloß nervös.
2
Als Marjorie und Bernice eine halbe Stunde nach Mitternacht nach Hause kamen, sagten sie sich am oberen Ende der Treppe gute Nacht. Sie waren Cousinen, standen sich aber nicht nahe. Genau betrachtet hatte Marjorie gar keine engen Freundinnen– sie hielt Mädchen für dumm. Bernice dagegen hatte sich sehr danach gesehnt, bei diesem von den Eltern arrangierten Besuch mit Kichern und Tränen gewürzte Geheimnisse auszutauschen. Sie hielt das für einen unverzichtbaren Faktor bei jedem Gespräch unter Frauen. Aber in dieser Hinsicht hatte sie Marjorie eher kalt gefunden; mit ihr zu reden war für Bernice genauso schwierig wie die Gespräche mit Männern. Marjorie kicherte nie und hatte nie Angst, auch verlegen war sie nur selten. Sie hatte überhaupt nur sehr wenige von den Eigenschaften, die Bernice für angemessen und wunderbar weiblich hielt.
Als Bernice an diesem Abend mit ihrer Zahnpasta hantierte, fragte sie sich zum hundertsten Mal, warum ihr nie jemand Aufmerksamkeit schenkte, wenn sie von zu Hause weg war. Dass ihre Familie die reichste in Eau Claire war, dass ihre Mutter ständig Einladungen gab und vor jedem Ball ein kleines Abendessen für ihre Tochter, dass sie ihr sogar ein eigenes Auto gekauft hatte, in dem sie herumfahren konnte, hatte sie nie als wesentliche Faktoren für ihren gesellschaftlichen Erfolg in der Heimatstadt wahrgenommen. Wie die meisten Mädchen war sie mit dem lauwarmen Milchbrei von Annie Fellows Johnston und anderen Romanen gefüttert worden, in denen die Frauen wegen irgendwelcher geheimnisvollen weiblichen Qualitäten geliebt wurden, die ständig erwähnt, aber nie genau dargestellt wurden.
Bernice empfand einen vagen Schmerz darüber, dass sie nicht populär war. Sie wusste nicht, dass sie den ganzen Abend mit demselben jungen Mann getanzt hätte, wenn sich Marjorie nicht für sie eingesetzt hätte; aber sie wusste, dass sogar in Eau Claire viele Mädchen von weitaus bescheidenerer Stellung und geringerer Schönheit sehr viel mehr Aufsehen erregten. Sie führte das auf eine subtile Skrupellosigkeit dieser Mädchen zurück. Es hatte sie nie beunruhigt, und wenn es das getan hätte, dann hätte ihre Mutter sie damit beruhigt, dass die anderen Mädchen sich irgendwie billig machten, und die Männer in Wirklichkeit Mädchen wie sie schätzten.
Sie drehte das Licht im Bad aus, und beschloss aus einer Laune heraus, noch ein bisschen mit ihrer Tante Josephine zu plaudern, bei der noch Licht brannte. Ihre weichen Slipper glitten lautlos über den Teppich im Flur, aber als sie das Zimmer ihrer Tante erreichte, hörte sie Stimmen von drinnen. Sie schnappte ihren eigenen Namen auf, und ohne eigentlich lauschen zu wollen, blieb sie vor der nur angelehnten Tür stehen. Der Gesprächsfaden im Inneren durchschnitt ihr Bewusstsein so scharf, als würde er mit einer Nadel hindurchgezogen.
»Sie ist absolut hoffnungslos!« Das war Marjories Stimme. »Ach, ich weiß genau, was du sagen wirst! So viele Leute haben dir erzählt, wie hübsch und süß sie ist und wie gut sie kocht! Na und? Sie hat eine ganz miese Zeit hier. Die Männer mögen sie nicht.«
»Was ist schon ein bisschen billige Beliebtheit?« Mrs Harvey klang ärgerlich.
»Das ist das einzig Wichtige, wenn man achtzehn ist«, sagte Marjorie mit Nachdruck. »Ich hab doch mein Bestes getan. Ich bin höflich gewesen, ich hab die Männer gezwungen, mit ihr zu tanzen, aber die Männer langweilen sich nun mal nicht gern. Wenn ich diese fabelhafte Haarfarbe sehe, die an so ein Pusselchen verschwendet ist, und daran denke, was Martha Carey daraus machen würde– ach!«
»Es gibt keinen Anstand mehr heute.« Mrs Harveys Stimme implizierte, dass ihr das moderne Leben zu viel war. Als sie noch jung war, hatten alle jungen Mädchen, die zu guten Familien gehörten, immer eine herrliche Zeit.
»Na ja«, sagte Marjorie. »So eine lahme Ente kann man auf Dauer nicht durchschleppen. Heutzutage muss jedes Mädchen für sich selbst sorgen. Ich habe ihr sogar schon Tipps wegen ihrer Kleider und anderer Dinge zu geben versucht, aber da ist sie bloß wütend geworden und hat mich ganz komisch angeschaut. Sie ist sensibel genug, um zu merken, dass sie nicht gut ankommt, aber ich wette, sie tröstet sich damit, dass sie denkt, sie ist tugendhaft und ich würde ein böses Ende nehmen, weil ich so leichtsinnig bin. So denken diese Mauerblümchen doch alle. Saure Trauben! Sarah Hopkins nennt Genevieve, Roberta und mich die ›Gardenien-Mädchen‹. Ich wette, sie würde zehn Jahre ihres Lebens und ihre feine europäische Erziehung geben, wenn sie dafür ein ›Gardenien-Mädchen‹ sein könnte, drei oder vier Männer hätte, die in sie verliebt sind, und beim Tanzen alle paar Schritte abgeklatscht würde.«
»Ich habe den Eindruck«, unterbrach Mrs Harvey etwas ermüdet, »dass du durchaus etwas für Bernice tun könntest. Ich weiß, dass sie nicht sehr temperamentvoll ist.«
Marjorie stöhnte. »Temperamentvoll! Du meine Güte! Ich habe noch nie gehört, dass sie zu einem Jungen etwas anderes gesagt hätte als: Heiß ist es hier, voll ist es hier, nächstes Jahr gehe ich nach New York auf die Uni. Manchmal fragt sie auch, was für Autos sie haben und erzählt ihnen, was sie für eins hat. Aufregend!«
Sie schwiegen kurz, und dann nahm Mrs Harvey ihren Refrain wieder auf: »Ich weiß nur, dass andere Mädchen, die nicht halb so attraktiv und süß sind, jederzeit Tanzpartner finden. Martha Carey zum Beispiel ist stämmig und laut, und ihre Mutter ist höchst gewöhnlich. Roberta Dillon ist dieses Jahr so dünn, dass man denkt, sie müsste nach Arizona. Und sie tanzt sich zu Tode.«
»Aber Mutter«, protestierte Marjorie ungeduldig. »Martha ist fröhlich und schrecklich witzig und clever, und Roberta ist eine fabelhafte Tänzerin. Sie ist schon seit Ewigkeiten so populär!«
Mrs Harvey gähnte.
»Ich glaube, es ist dieses verrückte Indianerblut bei Bernice«, fuhr Marjorie fort. »Vielleicht ist sie ein genetischer Rückfall. Die Indianerfrauen haben ja auch immer bloß rumgesessen und nie was gesagt.«
»Geh jetzt ins Bett, du dummes Kind«, lachte Mrs Harvey. »Ich hätte dir das nie erzählt, wenn ich gewusst hätte, dass du dir das merken würdest. Und die meisten deiner Ideen finde ich völlig idiotisch«, ergänzte sie schläfrig.
Es entstand eine weitere Pause, in der Marjorie überlegte, ob es sich lohnte, ihre Mutter zu überzeugen. Frauen über vierzig können selten von irgendwas überzeugt werden. Mit achtzehn sind unsere Überzeugungen Berge, von denen wir herunterschauen; mit fünfundvierzig sind es Höhlen, in denen wir uns verstecken.
Nachdem sie sich das noch einmal vor Augen gehalten hatte, sagte Marjorie gute Nacht. Als sie auf den Flur trat, war er vollkommen leer.
3
Als Marjorie am nächsten Tag beim späten Frühstück saß, betrat Bernice das Zimmer mit einem sehr förmlichen Guten Morgen, setzte sich ihr gegenüber, sah sie aufmerksam an und befeuchtete leicht ihre Lippen.
»Hast du was auf dem Herzen?«, fragte Marjorie, etwas verwirrt.
Bernice machte eine Pause, ehe sie ihre Handgranate warf. »Ich habe gehört, was du gestern über mich zu deiner Mutter gesagt hast.«
Marjorie war erschrocken, zeigte aber nur eine leichte Röte, und ihre Stimme blieb ruhig. »Wo warst du?«
»Auf dem Flur. Ich wollte zuerst gar nicht zuhören.«
Nach einem unfreiwilligen Blick der Verachtung senkte Marjorie den Blick und begann sich sehr für eine verirrte Frühstücksflocke zu interessieren, die sie auf ihrem Zeigefinger balancierte.
»Ich glaube, ich sollte lieber nach Eau Claire zurückfahren– wenn ich so lästig bin«, sagte Bernice. Ihre Unterlippe zitterte heftig, als sie mit schwankender Stimme fortfuhr. »Ich habe versucht, nett zu sein, aber– erst bin ich ignoriert und dann beleidigt worden. Mich hat noch keiner besucht und ist so behandelt worden.«
Marjorie blieb stumm.
»Aber jetzt weiß ich ja, dass ich im Weg bin. Ich bin für dich eine Last. Deine Freunde mögen mich nicht.« Sie machte eine Pause. Dann erinnerte sie sich an eine weitere Kränkung. »Natürlich war ich wütend, als du letzte Woche anzudeuten versucht hast, mein Kleid wäre unvorteilhaft. Denkst du, ich wüsste nicht, wie man sich kleidet?«
»Nein«, murmelte Marjorie nicht allzu leise.
»Was?«
»Ich habe überhaupt nichts angedeutet«, sagte Marjorie lapidar. »Wenn ich mich recht erinnere, hab ich gesagt, dass es besser sei, ein vorteilhaftes Kleid dreimal hintereinander anzuziehen, als zwischendurch zwei Scheußlichkeiten zu tragen.«
»Findest du, dass das eine nette Bemerkung war?«
»Ich hab gar nicht versucht, nett zu sein.« Dann nach einer Pause. »Wann willst du denn fahren?«
Bernice sog scharf die Luft ein. »Oh!« Es war ein kleiner schmerzlicher Aufschrei.
Marjorie sah überrascht hoch. »Hattest du nicht gesagt, du wolltest nach Hause?«
»Ja, aber–«
»Ach so, du hast bloß geblufft!«
Sie starrten sich einen Augenblick über den Frühstückstisch an. Neblige Wellen senkten sich über den Blick von Bernice, während Marjorie den ziemlich harten Gesichtsausdruck zeigte, den sie aufsetzte, wenn angetrunkene Erstsemester mit ihr zu schmusen versuchten.
»Du hast also geblufft«, wiederholte sie, als wäre von Bernice gar nichts anderes zu erwarten gewesen.
Bernice gab es zu, indem sie in Tränen ausbrach. Marjories Blick zeigte nur Langeweile.
»Du bist doch meine Cousine«, schluchzte Bernice. »Ich b-besuche dich doch. Ich sollte einen Monat lang bleiben– w-wenn ich jetzt nach Hause komme, wird es meine Mutter erfahren und sich f-fragen–«
Marjorie wartete, bis sich der Schwall von kaputten kleinen Wörtern in Schniefen auflöste. »Ich gebe dir mein Taschengeld für diesen Monat«, sagte sie kalt. »Dann kannst du die letzte Woche verbringen, wo du willst. Es gibt ein sehr hübsches kleines Hotel–«
Das Schluchzen wurde zu einem schrillen Flötenton, dann sprang Bernice abrupt auf und lief aus dem Zimmer.
Eine Stunde später, als Marjorie in der Bibliothek saß und intensiv damit beschäftigt war, einen der unverbindlichen, wunderbar ausweichenden Briefe zu verfassen, wie sie nur ein junges Mädchen zustande bringt, erschien Bernice wieder, rotäugig und angestrengt ruhig. Sie gönnte Marjorie keinen Blick, sondern nahm aufs Geratewohl ein Buch aus dem Regal und setzte sich, als wollte sie lesen. Marjorie schien völlig absorbiert von ihrem Brief und schrieb einfach weiter.
Als die Uhr Mittag schlug, klappte Bernice mit einem lauten Schnappen ihr Buch zu. »Ich sollte mir wohl lieber meine Fahrkarte kaufen.«
Das war keineswegs der Anfang der Rede, die sie oben eingeübt hatte, aber nachdem Marjorie ihr keine Stichworte gab und sie nicht bat, doch vernünftig zu sein, es sei alles ein Irrtum, war es die beste Eröffnung, die ihr noch einfiel.
»Warte, bis ich den Brief fertig habe«, sagte Marjorie, ohne sich umzusehen. »Den will ich heute noch auf die Post bringen.«
Nach einer weiteren Minute, in der ihr Federhalter eifrig kratzte, drehte sie sich um und entspannte sich mit einem Gesichtsausdruck, der besagte »ganz zu deiner Verfügung«. Wieder fiel es Bernice zu, etwas zu sagen.
»Willst du, dass ich nach Hause fahre?«
»Na ja«, überlegte Marjorie. »Wenn du hier keinen Spaß hast, fährst du wohl besser. Es hat ja keinen Sinn, unglücklich zu sein.«
»Findest du nicht, dass ein bisschen menschliche Freundlichkeit–«
»Jetzt komm mir bitte nicht mit den ›Little Women‹!«, rief Marjorie ungeduldig. »Das ist nun wirklich passé.«
»Findest du?«
»Um Himmels willen! Natürlich. Welches moderne Mädchen könnte wie diese albernen Frauen leben?«
»Das waren die Vorbilder unserer Mütter.«
Marjorie lachte. »Ach, das waren sie doch nicht wirklich. Außerdem waren unsere Mütter auf ihre Weise völlig in Ordnung, aber von den Problemen ihrer Töchter wissen sie wenig.«
Bernice setzte sich sehr gerade hin. »Bitte rede nicht so über meine Mutter.«
Marjorie lachte. »Ich wüsste nicht, dass ich sie erwähnt hätte.«
Bernice hatte das Gefühl, dass sie von ihrem Thema abgelenkt wurde. »Findest du, dass du mich gut behandelt hast?«
»Ich habe mein Bestes getan. Du bist ziemlich sprödes Material zum Bearbeiten.«
Die Lider ihrer Cousine begannen sich wieder zu röten. »Ich finde, du bist hart und egoistisch und hast keinerlei weibliche Eigenschaften an dir.«
»Ach, du lieber Gott!«, rief Marjorie voller Verzweiflung. »Du kleines Dummchen! Solche Mädchen wie du sind für sämtliche farblosen, müden Ehen verantwortlich, und für die ganzen entsetzlichen Hilflosigkeiten, die als weibliche Eigenschaften bezeichnet werden. Das muss schon ein ziemlicher Schlag sein, wenn so ein Mann mit Fantasie das Bündel aus schönen Kleidern heiratet, um das er seine Visionen gebaut hat, und dann feststellen muss, dass es bloß ein schwacher, wehleidiger Pudding voller Ängste und aufgesetzter Gefühle ist.
Bernice blieb der Mund offen.
»Die weibliche Frau!«, fuhr Marjorie fort. »Die Hälfte ihres Lebens ist sie damit beschäftigt, über Mädchen wie mich zu jammern, die wirklich ein bisschen Spaß haben.«
Bernice sank der Unterkiefer noch ein Stück weiter herunter, während Marjorie immer lauter wurde.
»Es ist ja noch verständlich, wenn ein hässliches Mädchen herumjammert. Wenn ich unrettbar hässlich wäre, hätte ich meinen Eltern nie verziehen, dass sie mich in die Welt gesetzt haben. Aber du beginnst das Leben doch ganz ohne Einschränkungen–« Marjorie ballte die kleine Faust. »Wenn du erwartest, dass ich dich bemitleide, dann muss ich dich leider enttäuschen. Fahr weg oder bleib, ganz wie du willst.« Sie nahm ihre Briefe und ging aus dem Zimmer.
Bernice täuschte Kopfschmerzen vor und erschien nicht zum Mittagessen. Am Nachmittag hatten sie eine Verabredung zu einer Matinee, aber Marjorie musste ihre Cousine »wegen anhaltender Kopfschmerzen« bei einem nicht allzu enttäuschten Jungen entschuldigen. Als sie gegen Abend ins Haus zurückkehrte, fand sie Bernice mit eigenartig entschlossenem Gesicht in ihrem Schlafzimmer vor.
»Ich bin zu dem Ergebnis gekommen«, sagte Bernice ohne irgendeine Vorrede, »dass du vielleicht recht hast– vielleicht aber auch nicht. Aber wenn du mir sagst, warum deine Freunde… nicht an mir interessiert sind, dann werde ich versuchen, das zu tun, was du von mir willst.«
Marjorie saß vor dem Spiegel und löste gerade ihr Haar. »Meinst du das ernst?«
»Ja.«
»Ohne Vorbehalt? Wirst du alles tun, was ich sage?«
»Nun ja, ich–«
»Kein Wenn und Aber! Wirst du genau das tun, was ich sage?«
»Wenn es vernünftige Dinge sind.«
»Das sind sie bestimmt nicht! Du bist kein Fall für vernünftige Dinge.«
»Wirst du mich– wirst du empfehlen–«
»Ja, alles. Wenn ich dir sage, du sollst Boxunterricht nehmen, dann musst du das auch machen. Schreib deiner Mutter, dass du noch zwei Wochen bleibst.«
»Wenn du mir sagen könntest–«
»Na schön, ich geb dir ein paar Beispiele. Vor allem fehlt dir die Leichtigkeit im Umgang mit anderen. Und warum? Weil du dir deiner äußeren Erscheinung nicht sicher bist. Wenn eine Frau das Gefühl hat, perfekt gepflegt und gekleidet zu sein, dann braucht sie über diesen Teil von sich gar nicht mehr nachzudenken. Das nennt man Charme. Je mehr du von dir vergessen kannst, desto mehr Charme hast du.«
»Sehe ich denn nicht in Ordnung aus?«
»Nein. Zum Beispiel kümmerst du dich nie um deine Augenbrauen. Sie sind schwarz und glänzen, aber weil du sie so struppig lässt, sind sie ein Schandfleck. Sie könnten sehr schön sein, wenn du ein Zehntel der Zeit, die du mit Nichtstun verbringst, darauf verwenden würdest, sie ein bisschen zu pflegen. Du brauchst sie bloß zu bürsten, damit sie gerade und glatt liegen.«
Bernice hob die infrage stehenden Brauen. »Willst du damit sagen, Männer achten auf so was?«
»Ja– unbewusst. Und wenn du wieder zu Hause bist, solltest du dir die Zähne richten lassen. Es ist zwar kaum zu merken, aber trotzdem–«
»Aber ich dachte«, unterbrach Bernice sie verwirrt, »dass du die niedlichen kleinen Püppchen verachtest.«
»Ich hasse das niedliche Denken«, erwiderte Marjorie. »Aber in seinem Äußeren muss ein Mädchen durchaus niedlich sein. Wenn du klasse aussiehst, kannst du über Russland, Pingpong oder den Völkerbund reden und niemand nimmt es dir übel.«
»Sonst noch was?«
»Oh, ich habe gerade erst angefangen! Da ist zum Beispiel deine Art zu tanzen.«
»Tanze ich denn nicht richtig?«
»Nein, tust du nicht. Du stützt dich auf die Männer– doch, doch, das tust du, wenn auch nur ganz leicht. Ich habe es gestern gemerkt, als wir zusammen getanzt haben. Außerdem stehst du ganz gerade, statt dich ein bisschen vorzubeugen. Wahrscheinlich hat dir mal eine alte Dame gesagt, dass es würdevoll aussieht, aber für die Männer ist es viel schwerer, außer bei einem sehr kleinen Mädchen. Und auf die Männer kommt es ja an.«
»Mach weiter.« Bernice spürte, wie ihre Gedanken sich überschlugen.
»Nun ja, du musst lernen, auch zu Männern nett zu sein, die eher traurige Vögel sind. Du siehst immer gleich beleidigt aus, wenn du an jemanden gerätst, der nicht zu den allerbeliebtesten Jungen gehört. Schau, Bernice, ich werde alle paar Meter abgeklatscht– und wer sind diese Männer? Nun, es sind gerade die traurigen Vögel. Kein Mädchen kann es sich leisten, sie einfach zu ignorieren. Sie sind fast immer in der Überzahl. Gerade junge Männer, die zu schüchtern sind, um zu reden, sind die besten Übungsobjekte für die Konversation. Auch unbeholfene Tanzpartner sind ideal, um zu üben. Wenn es dir gelingt, dich von so einem Tollpatsch führen zu lassen und dabei anmutig auszusehen, dann kannst du auch einem Panzer durch ein himmelhohes Stacheldrahtverhau folgen.«
Bernice stöhnte aus tiefster Seele, aber Marjorie war noch nicht fertig.
»Wenn du zu einem Ball gehst und, sagen wir mal, drei traurige Vögel findest, die mit dir tanzen und die du so gut unterhältst, dass sie gar nicht mehr wegwollen, dann hast du schon etwas erreicht. Die kommen das nächste Mal wieder, und bald werden so viele traurige Vögel mit dir tanzen, dass die attraktiven Jungs aufmerksam werden. Und wenn sie merken, dass nicht die Gefahr besteht, dass sie an dir kleben bleiben, dann werden sie auch mit dir tanzen wollen.«
»Ja«, sagte Bernice schwach. »Ich glaube, ich verstehe allmählich.«
»Und am Ende«, sagte Marjorie abschließend, »werden Gelassenheit und Charme ganz von selbst kommen. Eines Morgens wachst du auf und weißt, dass du sie hast. Und die Männer werden es auch wissen.«
Bernice stand auf. »Das war sehr nett von dir. Niemand hat je so mit mir geredet, und ich bin ein bisschen verdutzt.«
Marjorie gab keine Antwort, sondern starrte nachdenklich ihr Spiegelbild an.
»Du bist ein Schatz, dass du mir hilfst«, sagte Bernice.
Marjorie sagte immer noch nichts, und Bernice überlegte, ob sie vielleicht zu dankbar geklungen hatte.
»Ich weiß, du magst keine Sentimentalitäten«, sagte sie ängstlich.
Marjorie drehte sich abrupt zu ihr um.
»Ach, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe überlegt, ob wir nicht deine Haare abschneiden müssen.«
Bernice brach rücklings auf dem Bett zusammen.
4
Am darauffolgenden Mittwoch fand ein Dinner Dance im Country Club statt. Als sie mit den anderen Gästen hereinschlenderte und ihre Tischkarte suchte, war Bernice leicht irritiert. Zu ihrer Rechten saß G.Reece Stoddard, ein höchst angesehener und begehrenswerter Junggeselle, aber für die alles entscheidende Linke war nur Charley Paulson vorgesehen. Charley mangelte es an Körpergröße, Schönheit und gesellschaftlichem Geschick, und im Licht ihrer neuen Erkenntnisse kam Bernice zu dem Schluss, dass er wahrscheinlich nur deshalb ihr Partner geworden war, weil er noch nie an ihr kleben geblieben war. Aber ihre Irritationen verschwanden bereits nach der Suppe. Sie erinnerte sich an Marjories ganz spezifische Instruktionen, schluckte ihren Stolz, wandte sich Charley zu und stürzte sich ins Gespräch.
»Finden Sie, ich sollte mir die Haare abschneiden lassen, Mr Paulson?«
Charley hob erschrocken den Kopf. »Warum?«
»Weil ich darüber nachdenke. Es ist so ein einfaches und zugleich unfehlbares Mittel, um Aufmerksamkeit zu erregen.«
Charley lächelte freundlich. Er konnte nicht wissen, wie lange Bernice das geprobt hatte.
Er wisse nicht viel über kurzes Haar, sagte er. Aber Bernice war schon dabei, ihn aufzuklären.
»Wissen Sie, ich möchte ein richtiger Vamp werden«, erklärte sie kühl und teilte ihm mit, dass abgeschnittenes Haar die unumgängliche Voraussetzung dafür sei. Sie frage deshalb gerade ihn, sagte sie, weil sie gehört habe, dass er bei Frauen so wählerisch sei.
Charley, der über weibliche Psychologie so viel wusste wie über buddhistische Meditation, fühlte sich vage geschmeichelt.
»Ich habe mich entschlossen«, sagte sie mit leicht gehobener Stimme, »dass ich nächste Woche zum Friseur im Sevier Hotel gehe, mich auf den ersten Stuhl setze und mir die Haare abschneiden lasse.« Sie geriet ins Stocken, weil sie merkte, dass die Leute in der Umgebung ihre Gespräche unterbrochen hatten und zuhörten; aber nach einer Sekunde der Verwirrung zahlte Marjories Training sich aus und sie beendete ihre Ausführungen so laut, dass alle in der Nähe mithören konnten. »Natürlich werde ich Eintritt verlangen müssen, aber wenn ihr zuschauen wollt und mich unterstützt, kann ich euch Plätze in der ersten Reihe versprechen.«
Es gab eine Welle anerkennenden Lachens, und unter diesem Deckmantel beugte sich G.Reece Stoddard herüber und sagte ihr blitzschnell ins Ohr: »Ich nehme sofort eine Loge.«
Sie sah ihn an und lächelte, als hätte er etwas überragend Brillantes gesagt.
»Glauben Sie an kurze Haare?«, fragte G.Reece mit demselben Unterton.
»Ich glaube, sie sind unmoralisch«, sagte Bernice ernsthaft. »Aber was soll ich machen? Man muss die Leute entweder amüsieren, füttern oder schockieren.« Das hatte Marjorie bei Oscar Wilde geklaut. Es wurde von einer neuen Welle von Gelächter vonseiten der Herren und einigen schnellen, angespannten Blicken vonseiten der Mädchen begrüßt. Dann, als hätte sie gar nichts Witziges oder Bedeutsames gesagt, wandte sich Bernice wieder Charley zu und sagte ihm vertraulich ins Ohr: »Ich wollte Sie nach Ihrer Meinung über verschiedene Leute fragen. Ich vermute, Sie sind ein wunderbarer Menschenkenner.«
Charley war vor Begeisterung ganz durchdrungen und machte ihr ein subtiles Kompliment, indem er ihr Wasserglas umkippte.
Zwei Stunden später, als Warren McIntyre untätig bei den anderen jungen Männern herumstand, die Tanzenden beobachtete und sich fragte, wohin und vor allem mit wem Marjorie wohl verschwunden war, fiel ihm plötzlich etwas auf, was damit gar nichts zu tun hatte: Bernice, die Cousine von Marjorie, war in den letzten fünf Minuten gleich mehrfach abgeklatscht worden. Er schloss die Augen, machte sie wieder auf und schaute noch mal hin. Vor ein paar Minuten hatte sie noch mit einem Jungen getanzt, der zu Besuch in der Stadt war, was sich leicht erklären ließ: Er wusste es eben nicht besser. Aber jetzt tanzte sie schon wieder mit jemand anders, und Charley Paulson steuerte mit begeisterter Entschlossenheit auf sie zu. Komisch– Charley tanzte selten mit mehr als drei Mädchen am Abend.
Noch überraschter war Warren allerdings, als er sah, wer da abgelöst wurde: G.Reece Stoddard persönlich. Und er schien keineswegs glücklich darüber, dass er abgelöst wurde. Als Bernice das nächste Mal in der Nähe vorbeitanzte, warf Warren ihr einen prüfenden Blick zu. Ja, sie war hübsch, ganz eindeutig hübsch; und ihr Gesicht schien heute Abend richtig lebendig. Sie zeigte jenen Gesichtsausdruck, den keine schauspielerisch noch so begabte Frau glaubhaft vortäuschen konnte– sie sah aus, als hätte sie richtig Spaß. Die Art und Weise, wie sie ihr Haar trug, gefiel ihm. Er fragte sich, ob sie Brillantine benutzt hatte, weil es so glänzte. Und ihr Kleid stand ihr sehr gut– ein dunkles Rot, das ihre umschatteten Augen und heißen Wangen zur Geltung brachte. Er erinnerte sich, dass er sie sehr hübsch gefunden hatte, als sie in die Stadt gekommen war und er noch nicht wusste, dass sie langweilig war. Zu schade, dass sie langweilig war– langweilige Mädchen sind unerträglich– aber hübsch genug war sie.
Seine Gedanken kehrten im Zickzack zu Marjorie zurück. Dieses Verschwinden würde genauso sein wie die anderen Abwesenheiten. Wenn sie wieder auftauchte, würde er fragen, wo sie gewesen war– und sie würde ihm nachdrücklich erklären, dass ihn das nichts anginge. Was für eine Schande, dass sie sich seiner so sicher sein konnte! Sie sonnte sich in der Gewissheit, dass ihn kein anderes Mädchen in der Stadt interessierte; sie forderte ihn geradezu heraus, sich in Genevieve oder Roberta zu verlieben.
Warren seufzte. Der Weg zu Marjories Zuneigung war wirklich ein Labyrinth. Er hob den Blick. Bernice tanzte erneut mit dem Jungen von auswärts. Halb unbewusst machte Warren einen Schritt vorwärts in ihre Richtung und zögerte plötzlich. Dann sagte er sich, dass es ein Akt der Nächstenliebe sei. Er ging auf sie zu– und stieß mit G.Reece Stoddard zusammen.
»Entschuldigung«, sagte Warren.
Aber G.Reece blieb keineswegs stehen, um sich zu entschuldigen. Er hatte stattdessen Bernice abgeklatscht.
Um ein Uhr morgens drehte sich Marjorie, den Finger schon am Lichtschalter, noch einmal im Flur um und warf einen letzten Blick auf die strahlenden Augen ihrer Cousine. »Es hat also wirklich geklappt?«
»Oh, ja, Marjorie!«, rief Bernice.
»Ich habe gesehen, dass du viel Spaß hattest.«
»Ja, hatte ich! Das einzige Problem war, dass ich um Mitternacht keinen Gesprächsstoff mehr hatte. Ich musste mich wiederholen– bei verschiedenen Männern natürlich. Ich hoffe, sie tauschen nicht ihre Erfahrungen aus.«
»Das tun Männer nie«, sagte Marjorie gähnend. »Und wenn sie es täten, wäre es auch egal– sie würden dich nur für noch raffinierter halten.«
Sie knipste das Licht aus, und als sie die Treppen hinaufgingen, hielt sich Bernice dankbar am Geländer fest. Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie müde getanzt worden.
»Siehst du?«, sagte Marjorie, als sie das obere Ende der Treppe erreichten. »Ein Mann sieht, wie ein anderer abklatscht, und schon denkt er: Da ist was zu holen. Na, für morgen werden wir uns was Neues ausdenken. Gute Nacht.«
»Gute Nacht.«
Als Bernice ihr Haar löste, ließ sie den Abend noch einmal Revue passieren. Sie hatte die Anweisungen ihrer Cousine genau befolgt. Selbst als Charley Paulson zum achten Mal abgeklatscht hatte, hatte sie Entzücken vorgetäuscht und sich geschmeichelt und interessiert gezeigt. Sie hatte weder über das Wetter noch über Eau Claire, ihre Uni oder Automobile geredet, sondern sich strikt an drei Themen gehalten: ich, du und wir.
Aber ein paar Minuten, bevor sie einschlief, rührte sich noch ein rebellischer Gedanke in ihrem schläfrigen Hirn: Letzten Endes hatte sie selbst es getan. Marjorie hatte ihr gesagt, worüber sie reden solle, das stimmte, aber Marjorie bezog einen großen Teil ihres Gesprächsstoffs aus den Büchern, die sie las. Auch das rote Kleid hatte Bernice selbst gekauft, obwohl sie es nicht wirklich zu schätzen gewusst hatte, ehe Marjorie es aus dem Koffer zog. Ihre eigene Stimme hatte die Worte gesagt, ihre eigenen Lippen hatten gelächelt und ihre eigenen Füße getanzt. Marjorie ist ein nettes Mädchen– sehr eitel– netter Abend– nette Jungs– wie dieser Warren– Warren– Warren– wie hieß er gleich– Warren–
Und damit sank sie in Schlaf.
5
Die folgende Woche war eine Offenbarung für Bernice. Mit dem Gefühl, dass die Leute sie wirklich gern ansahen und ihr gern zuhörten, wurden die Grundlagen ihres Selbstbewusstseins gelegt. Natürlich machte sie am Anfang noch zahlreiche Fehler. Sie wusste zum Beispiel nicht, dass Draycott Deyo Theologie studierte und dass er sie nur deshalb abgeklatscht hatte, weil er sie für ein stilles, zurückhaltendes Mädchen hielt. Sonst hätte sie wahrscheinlich darauf verzichtet, ihn mit einem Spruch zu begrüßen, der mit den Worten »Hallo, Sie Granate!« begann und dann in die Badewannengeschichte überging: »Im Sommer brauche ich immer ewig, um mein Haar hochzustecken. Es ist so viel davon da. Deshalb mach ich das immer zuerst, pudere mein Gesicht und setz mir den Hut auf; danach leg ich mich in die Wanne und dann zieh ich mich an. Ich finde das praktisch, Sie nicht?«
Obwohl sich Draycott gerade intensiv mit der Frage auseinandersetzte, ob der Körper bei der Taufe ganz eingetaucht werden müsste und welche Schwierigkeiten es dabei gab, vermochte er diesen Gesprächsbeitrag nicht zu würdigen. Weibliches Baden hielt er für ein unmoralisches Thema und machte Bernice daher ausführlich mit seinen Gedanken über die Verkommenheit der modernen Gesellschaft vertraut.
Zum Ausgleich für diesen unglücklichen Zwischenfall konnte sie sich aber auch einige markante Erfolge gutschreiben. Der kleine Otis Ormonde verzichtete auf einen Trip an die Ostküste und folgte ihr stattdessen mit der Ergebenheit eines Hündchens, sehr zum Ärger von G.