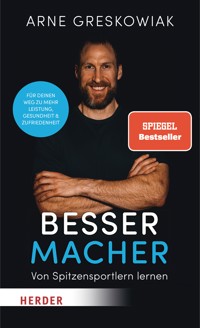
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Athletikcoach Arne Greskowiak weiß, wie man Spitzensportler zum richtigen Zeitpunkt in Topform bringt. In 20 Jahren an der Seite von Athleten wie Dennis Schröder oder Leon Draisaitl und mit Profiteams wie den Kölner Haien hat er einen ganz individuellen und einzigartigen Ansatz entwickelt. Im Mittelpunkt: die vier Säulen Training, Ernährung, Regeneration und Mindset – die Schlüssel zum Erfolg. Mit der deutschen Basketball- und Eishockey-Nationalmannschaft sammelte er zuletzt Bronze, Silber und Gold bei Welt- und Europameisterschaften. In seinem Buch "Bessermacher" nimmt er uns mit in die Kabine, auf die Arbeit mit den Stars und lässt uns teilhaben an den Geheimnissen des Spitzensports. Das Buch zeigt: Auch wenn Erfolg nicht planbar ist, der Weg dorthin ist es durchaus. Und jeder kann ihn beschreiten! Ein absolutes Muss für alle Sportbegeisterten und solche, die ihre Leistung auf das nächste Level bringen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arne Greskowiak
Bessermacher
Von Spitzensportlern lernen Mit Alexander Haubrichs
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: © Christian Hedel
E-Book-Konvertierung: Zero Soft, Timisoara
ISBN Print 978-3-451-60138-5
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83405-9
Inhalt
Vorwort
Teil 1: Ein Profi werden
Kapitel 1: Purpose – Die Suche nach der Bestimmung
Kapitel 2: Der harte Hund
Kapitel 3: Selbst und ständig
Kapitel 4: Ackern – die Basis des Erfolgs
Kapitel 5: Becoming a Pro
Kapitel 6: Der Weg ist das Ziel
Kapitel 7: Profis richtig führen
Kapitel 8: Ein besonderer Anführer
Teil 2: Being a Pro – Ein Profi sein
Kapitel 1: Coaching
Kapitel 2: Mindset
Kapitel 3: Ernährung
Kapitel 4: Training
Kapitel 5: Regeneration
Teil 3: Der Weg zum Champion
Kapitel 1: Starting a Career
Kapitel 2: Lernen von den Champions
Kapitel 3: Alter ist nur eine Zahl
Kapitel 4: Schritte zum besseren Ich
Nachwort
Über die Autoren
Vorwort
Als die Schlusssirene in Manila ertönte, gab es kein Halten mehr. Dennis Schröder, Franz Wagner, Daniel Theis & Co. feierten den Triumph bei der Basketball-Weltmeisterschaft – und ich war mittendrin im Trubel. Doch schon wenige Stunden nach diesem Moment des größten Triumphs, den ich als Athletikcoach erleben durfte, gingen meine Gedanken schon wieder nach vorne. Zur nächsten Aufgabe, zum nächsten Training und irgendwann in dieser Zeit auch dahin, das alles zu Papier zu bringen.
Wenn nicht jetzt, wann dann sollte ich meine Erfahrungen aus mehr als zehn Jahren Coaching teilen? Bronze, Silber oder Gold – eine Medaille für Deutschland zu gewinnen, ist ein absoluter Sportlertraum. Und ich war gleich dreimal binnen kürzester Zeit dabei: Nach Bronze bei der Heim-EM 2022 gelang Dennis Schröder & Co. im Sommer 2024 der große Triumph bei der Basketball-WM. Ungeschlagen wurde das Team Weltmeister, ein sensationeller Erfolg.
Zwischen diesen Turnieren durfte ich an der Bande stehen, als Bundestrainer Harold Kreis die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland bis ins Finale führte, wo sie erst im Endspiel in Tampere ihren Meister in Kanada fand.
Das waren unvergessliche Momente, und ich bin froh und dankbar, dass ich diese fantastischen Mannschaften und außergewöhnlichen Sportler als Athletiktrainer bei diesen Erfolgen unterstützen durfte. Doch was für mich eigentlich zählt, ist der Weg, den ich zum Ziel gemacht habe, der Prozess, nicht das Ergebnis. Das hat mich glücklicher werden lassen, zufriedener. Und warum das so ist, welchen Weg ich gegangen bin und wie auch du es schaffen kannst, das will ich dir in diesem Buch vermitteln.
Mir macht es am meisten Spaß, wenn ich mich jeden Tag ein wenig weiterentwickeln, ein wenig stärker, schlauer, entspannter – einfach besser werden kann. Das mag nicht immer gelingen, aber doch versuche ich es und stecke nie auf. Das ist auch der Antrieb bei der Arbeit mit meinen Sportlern. Irgendwann hat mal einer meiner Profis die Frage, warum er Zusatzschichten bei mir schob, mit fünf einfachen Worten beantwortet: „Weil Arne ein Bessermacher ist.“
Dieses Lob hat mich mit großem Stolz erfüllt, das war für mich wertvoller als eine Medaille. Denn das ist der Kern meiner Leidenschaft, meine Bestimmung: Ich will Menschen besser machen. Wie das geht? Wie man Sportler auf ein neues Level bringt, Mannschaften reif für Titel macht, Menschen zu einem gesünderen, glücklicheren Ich verhilft? Dem will ich hier auf den Grund gehen.
Ich lasse dabei meine Stationen Revue passieren, und dabei kamen mir viele lehrreiche Begegnungen, jede Menge inspirierende Menschen und prägende Ereignisse in den Sinn, die mich geformt haben und die mich zu dem werden ließen, der ich heute bin. Jemand, dem es gelingt, Menschen besser zu machen. Doch bin ich weit entfernt von perfekt. Ich habe noch eine Menge zu lernen, will mich in vielen Bereichen weiterentwickeln. Aber das ist das Leben! Da gibt es viel zu tun, und das ist gut so! Womit wir schon am ersten Punkt der Dinge angelangt wären, die uns zufriedener und ausgeglichener machen: ein gesunder Mix aus Anspannung und Entspannung, aus positivem Stress und Erholung.
Aber wie können wir immer besser werden? „Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen“, lautet eines meiner Credos. Die Wahrheit nämlich ist: Es gibt Gründe, warum die deutschen Basketballer oder die Eishockey-Cracks diese Erfolge erzielen konnten. Neben viel Talent, guter Menschenführung, Wille und dem nötigen Glück war es vor allem viel Arbeit, sich im richtigen Moment in Topform mit den besten Mannschaften der Welt messen zu können.
Dieses Buch ist keine Pille, die schnellen Erfolg bei wenig Aufwand verspricht. Wir finden nicht die Wundermaschine, die aus Menschen Superhelden macht. Oder vielleicht doch. Aber anders, als man denkt. Denn diese Wundermaschine ist das menschliche Gehirn, das in jedem Alter in der Lage ist, sich neue Routinen anzueignen, neue Pfade zu beschreiten.
Ich bin überzeugt: Es gibt einen Weg zu einem besseren, gesünderen, glücklicheren Leben. Zu mehr Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit. Ich habe in den vergangenen Jahren viel Wissen gesammelt, das ich bis heute an meine Sportler und Kunden weitergebe. Und: Ich lerne umgekehrt jeden Tag von ihnen. Von Stars wie Dennis Schröder und Leon Draisaitl, die jeden um sich herum in Training und Spiel besser machen, von Top-Trainern wie Gordon Herbert oder Harold Kreis, die es mit Kommunikation und Arbeit schaffen, ihre Mannschaften zu entwickeln, von führenden Managern, Unternehmern, TV-Stars und Entertainern. Das sind die Menschen, die mich besser machen.
All ihre großen und kleinen Erfolgsgeschichten möchte ich in diesem Buch zusammenzuführen. Ich versuche zu zeigen, wie wichtig es ist, unsere Bestimmung zu finden, ihr zu folgen, wenn wir ein Highperformer sein wollen, ein Leistungsträger, ja vielleicht sogar ein wahrer Champion. Ich versuche herauszufinden, was uns auf dem Weg zu mehr Glück im Weg steht – und wie wir es überwinden können.
Am Anfang steht der Weg, sich ein Leben aufzubauen, zu wachsen und zu lernen. Im zweiten Teil beleuchte ich das Fundament jeder Höchstleistung, die vier Säulen Training, Ernährung, Regeneration und Mindset – aber auch, wie man als Coach oder Führungspersönlichkeit diese Dinge bei anderen steuern kann.
Dann kommen wir zum goldenen Schluss: Was macht die wirklichen Champions aus? Was haben die Stars, das sie vom Rest unterscheidet? Was können wir von ihnen lernen? Wie hält man sich möglichst lange auf einem Topniveau, ob nun im Sport oder im Beruf?
Egal, ob du Athlet bist oder mitten im Berufsleben stehst – nutze die Erfahrungen aus dem absoluten Spitzensport, um dir ein Umfeld zu schaffen, in dem du nachhaltig erfolgreich sein kannst. Mach dich auf den Weg zu einem besseren Ich – dieses Buch nimmt dich gerne mit …
Teil 1 Ein Profi werden
Kapitel 1 Purpose – Die Suche nach der Bestimmung
Schule und der Systemfehler Arne
Die Welt um uns herum dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich, die sozialen Netzwerke stehen nie still. Nicht selten bleibt dabei das Ich auf der Strecke. Wer bin ich? Wo will ich hin? Was ist meine Bestimmung? Die Frage nach dem großen Sinn, sie stellt sich gerade jungen Erwachsenen immer drängender. „Purpose“ heißt das Zauberwort – und früher oder später muss jeder für sich eine Antwort finden.
Dem einen wird vielleicht schon in der Kindheit klar, welchen Weg er einschlagen will. Bei mir hat es eine ganze Weile gedauert. Um ehrlich zu sein: In der Schule hatte ich überhaupt keine Ahnung, wohin mich dieses Leben führen würde. Ich bin in Hannover geboren, aber zusammen mit meiner Schwester in Köln aufgewachsen – und dort bin ich bis heute zu Hause.
Sport hat immer eine große Rolle gespielt, das haben uns unsere Eltern vorgelebt. Ich ließ mich anstecken und war selbst sehr aktiv. Mit 13 bin ich zum Handball gekommen. Ich glaube, ich war ein einigermaßen guter Spieler und habe alle Jugendmannschaften durchlaufen, aber für eine Profikarriere hat es nicht gereicht. Diese Tür öffnete sich mir also nicht.
Und andere erst einmal auch nicht, denn das System Schule und Arne, das hat nie so richtig zusammengepasst. Ich tat das Nötigste, kam stets irgendwie durch, aber der große Ehrgeiz wollte sich nicht entwickeln. Nach mehreren Schulwechseln hielt ich dann am Wirtschaftsgymnasium in Leverkusen meinen Schulabschluss in der Hand und hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Die Berufsorientierungstage und Jobmessen waren alle ergebnislos verlaufen, und so war ich sehr dankbar, dass mir der Pflichtdienst – damals musste man noch zwölf Monate entweder in der Bundeswehr oder im Zivildienst ableisten – noch eine Denkpause verschaffen würde.
Zur Musterung auf dem Kreiswehrersatzamt in Köln ging ich eigentlich mit dem Plan, eine entspannte Zivildienstzeit zu verbringen, in der ich ein wenig mit den Jungs chillen konnte. Als ich den Raum betrat, fragte mich die Verwaltungsangestellte: „Was für eine Einheit könnten Sie sich bei der Bundeswehr vorstellen?“ Ich zuckte mit den Schultern. „Eigentlich sehe ich da keinen Platz für mich.“
Doch noch während ich diese Worte aussprach, fiel mein Blick auf einen Flyer auf dem Schreibtisch. Die Gebirgsjäger suchten Verstärkung. Mein Interesse war geweckt. „Wenn ich dort hingehen könnte, würde ich das machen“, sagte ich. „Können Sie Ski fahren?“, fragte die Beamtin. „Selbstverständlich“, antwortete ich, „ich habe letztes Jahr sogar eine Skilehrerausbildung beim Deutschen Alpenverein gemacht.“
Die Entscheidung war gefallen. Ein paar Monate später machte ich mich auf die über siebenstündige Zugfahrt nach München, stieg dann in den Regionalzug nach Bad Reichenhall um. Es war eine Reise wie ans andere Ende der Welt. Nein, in eine ganz neue Welt. Denn zum ersten Mal in meinem Leben betrat ich eine Kaserne. Ich schaute noch einmal auf den Brief, den ich ein paar Wochen zuvor erhalten hatte, und meldete mich bei der 3. Kompanie des Gebirgsjägerbataillons 231. Da hieß es erst einmal warten. Mit ein paar anderen Rekruten stand ich im Treppenhaus, direkt vor mir lehnte ein Neuling an der Wand, die Hände in den Hosentaschen vergraben, sein Gesichtsausdruck zeugte von Langeweile.
In diesem Moment kam ein Soldat in Uniform vorbei. Seine Schulterklappen machten deutlich, dass er nicht ganz unten in der Befehlskette stand. In einem Tonfall, der Respekt einforderte, raunzte der Offizier den jungen Rekruten an: „Die Mauer steht auch ohne Sie.“ Sichtlich überrascht stellte sich der Kamerad gerade hin. Der Soldat fuhr fort: „Ach, und haben Sie heute Geburtstag?“ „Nein“, stammelte der Neuling verschüchtert. „Dann nehmen Sie die Hände von der Kerze.“ Schnell zog er sie aus der Hosentasche. Ich traute meinen Ohren nicht. Kaum angekommen, hagelte es Sprüche, wie man sie sonst nur aus Filmen kannte.
Die ersten Tage waren karg, hart und von Drill und Übungen geprägt. Alles war neu. Die Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Das Leben in der Stube, zu sechst im ersten Stock der Kaserne, ganz am Ende des Gangs. Das Aufstehen um 4.30 Uhr, das Essen nach Zeitplan. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich eine klare, vorgegebene Struktur, an die ich mich halten musste. Ich merkte schnell, dass ich mit meiner aufmüpfigen Art aus der Schulzeit nicht weit kommen würde. Bei den Gebirgsjägern funktionierte alles nur, wenn ein Rädchen ins andere griff. Hier wurde weniger Spaß verstanden, sondern viel Wert darauf gelegt, dass alles so gemacht wurde, wie es vorgeschrieben war.
Doch ich hatte mich im Handumdrehen an die neuen Routinen gewöhnt. Ich merkte schnell, wenn man morgens um halb fünf aufstehen muss, ist es gut, abends nicht zu spät ins Bett zu gehen. Es ergab plötzlich Sinn, seine sieben Sachen zusammenzuhalten, die Dinge gut und ordentlich zu behandeln und auf seine Habseligkeiten aufzupassen.
Das Lehrjahr bei der Bundeswehr
Hier bei der Bundeswehr galt das Credo: „Lernen durch Schmerz.“ Wenn du bei einer Übung nicht aufpasst, dass dein Schlafsack nicht nass wird, wird die Nacht eiskalt und unangenehm feucht. Es war hart, aber ich mochte dieses Leben. Ich ging darin auf und wurde, ohne es gleich zu merken, zum Anführer der Gruppe. Zuerst in meiner Stube, wenn es darum ging, die allgemeine Ordnung aufrechtzuerhalten, Absprachen zu treffen und sich gemeinsam das Leben zu erleichtern. Später auch bei Übungen.
Die drei Monate Grundwehrdienst waren für mich eine sehr wertvolle Zeit. Für jemanden, der aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommt, dem es an nichts fehlt, der jederzeit auf einen vollen Kühlschrank zurückgreifen kann, der selbst entscheiden kann, wann er abends ins Bett geht oder was er anzieht, war es anfangs ein Kulturschock. Nie zuvor hatte mir jemand gesagt, wie ich mich zu verhalten hatte. So mancher Lehrer kann sicher heute noch ein Lied davon singen, wie ich in der Schule über Dinge wie Befehl und Gehorsam gedacht habe.
Plötzlich wurde mir vorgeschrieben, wie ich meine Haare zu tragen und meinen Bart zu rasieren hatte. Der schulterlange blonde Schopf fiel dem Langhaarschneider zum Opfer, es blieb ein nur drei Millimeter raspelkurzer Schnitt. Auch der Dreitagebart war vorerst Geschichte. Morgens mussten alle Rekruten antreten, und der Gruppenführer kontrollierte aus nächster Nähe den Erfolg der Morgentoilette.
Der neue Lebensstil hatte aber nicht nur Auswirkungen auf meine Selbstorganisation und Ordnung. Schon nach wenigen Wochen merkte ich, dass sich meine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verbessert hatte. Die Schlafroutine, das regelmäßige, aber nicht überkalorische Essen, die klaren Abläufe im Alltag und das tägliche Training taten mir gut. Ich war topfit und fühlte mich auch so.
Dann war die Grundausbildung vorüber. Nach drei Monaten erhält jeder Soldat eine sogenannte „Verwendung“. Für mich und die Rekruten, die mit mir begonnen hatten, war vorgesehen, dass wir nach Wildflecken verlegt werden. Dort bildet die Bundeswehr Soldaten aus, die in den Einsatz gehen. Dazu brauchten sie Statisten, die Demonstranten spielten, als Fahrer bei einer Autodurchsuchung mitmachten und so weiter. Mein absoluter Alptraum, schließlich hatte ich mich für den Wehrdienst entschieden, um bei den Gebirgsjägern zu sein. Natürlich war der Einsatz in Wildflecken wichtig, aber er hatte nichts mit meiner Motivation zu tun, mich zum Wehrdienst zu melden.
Gipfelsturm zu den Gebirgsjägern
Es gab nur einen Ausweg: Das war die Möglichkeit, sich für die Spezialeinheit zu qualifizieren. In dreitägigen Eignungstests wurde ausgesiebt. Nur 15 von 180 Rekruten aus meinem Jahrgang sollten die Chance bekommen, wirklich bei den Hochgebirgsjägern aufgenommen zu werden.
Ein paar Tage vorher hatten mich unsere Vorgesetzten bei einem Lauftest noch in der mittleren Leistungsgruppe eingeteilt. Als ein Favorit auf die vorderen Plätze galt ich bei ihnen also nicht. Das stachelte mich aber nur noch mehr an. Ich wollte es allen zeigen.
Der Aufnahmetest begann mit einem Bergmarsch. Dabei gingen alle Rekruten gleichzeitig den Berg hoch, mit Tourenskiern unter den Füßen, also mit einer Bindung wie beim Langlauf und mit Fellen unter den Skiern, damit man den Berg überhaupt besteigen kann. Das Konzept war einfach: Alle Rekruten starteten gemeinsam und rannten tausend Höhenmeter hoch. Wer bei den Ersten dabei war, hatte nach dem Ski- und Klettereignungstest eine realistische Chance auf einen Platz bei den Hochgebirgsjägern. Es hieß also: Jeder gegen jeden …
Ich achtete von Anfang an darauf, mich in der Spitzengruppe zu platzieren. Ich wollte unbedingt bei den Gebirgsjägern ankommen, die Motivation setzte Kräfte frei. Vor mir gingen zwei Soldaten in Führung. Dann kam ich, hatte aber eine ganze Reihe von Kameraden im Nacken. Direkt hinter mir hatte sich mein Kamerad Moritz Fricke festgebissen. Wir kannten uns damals noch nicht, aber ich erinnere mich genau daran, dass immer, wenn ich mich umdrehte, er direkt hinter mir war. Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die bis heute anhält. Auch wenn man sich nicht ständig schreibt oder telefoniert. Wenn wir uns treffen, ist es genau wie damals am Berg – nur laufen wir jetzt gemeinsam und nicht gegeneinander.
Ich ließ mich nicht beirren, zog weiter und erreichte als Dritter das Ziel. Völlig erschöpft sank ich in den Schnee. Neben mir keuchten die anderen Rekruten. Aber die Gruppe, die hier vorne gelegen hatte, hatte nun die besten Chancen auf einen Platz in der Spezialeinheit. Als Nächstes stand das Skifahren im „schweren Gelände“ auf dem Programm. Dazu mussten wir einen Naturhang hinunterfahren.
Allerdings hatte das mit der Vorstellung, die ich bis dato vom Alpinskifahren hatte, nichts zu tun. Alle Rekruten bekamen die gleichen kantigen Bretter, von modernen Carving-Ski konnten wir nur träumen. Auch war ich gewohnt, in Skischuhen zu fahren, die vorne und hinten Halt gaben. Doch diese Prüfung galt es in einem „Winter-Bergschuh“ zu absolvieren, quasi ein Wanderschuh aus Hartplastik. Ich machte ein paar Trockenübungen und legte mich erst mal der Länge nach auf die Nase.
Unten standen die Ausbilder und bewerteten unsere Abfahrt. Bei den Gebirgsjägern muss man nicht schön, sondern vor allem schnell und sicher Ski fahren können. Ich entschied mich, mit einem schnellen Parallelschwung den Hang hinunterzufahren, und bemerkte, dass die Ausbilder bei meiner Ankunft leicht schmunzelten. Es schien ihnen zu gefallen, dass ich nicht nur auf Sicherheit und Schnelligkeit achtete, sondern auch mit einer vernünftigen Technik den Berg meisterte. Mein Ziel war in greifbarer Nähe.
Am nächsten Tag ging es an die Kletterwand. Ich war vorbereitet, denn in der Grundausbildung wurde viel Wert auf das Klettern gelegt, und ich beherrschte die Grundtechniken. Zusammen mit den Leistungen vom Vortag war schnell klar: Ich gehörte in die Einheit und würde ein richtiger Hochgebirgsjäger werden! Ich hatte mir ein Ziel gesetzt, dafür trainiert, dafür gelebt, mich nicht beirren lassen, war konsequent meinen Weg gegangen. Der Lohn: Als der Ausbilder am Ende des Tages die 15 neuen Hochgebirgsjäger aufzählte, war mein Name darunter. Mein Wunsch war in Erfüllung gegangen!
Der Teamgeist am Berg
Kurz darauf ging es in den Winterurlaub, sodass wir nach unserer Rückkehr in die 1. Kompanie überstellt wurden und nun zum Hochgebirgsjägerzug gehörten. Voller Stolz betrat ich die neuen Kasernengebäude. Aber quasi mit dem Schritt durch die Eingangstür war da noch ein zweites Gefühl: Druck.
Hauptfeldwebel Alex Elste, damals stellvertretender Zugführer, begrüßte uns. Wir wurden in einen Besprechungsraum gebracht. Der Hauptfeldwebel hatte einen Bergrucksack dabei und ein Seil. Er schmetterte seine Ausrüstung auf den Boden und sagte in ruhiger, aber bestimmter Tonlage „Ihr seid die besten Sportler und Soldaten des Bataillons. Aber von jetzt an gehört euer Arsch mir! Ich werde dafür sorgen, dass ihr diese Einheit bei den kommenden Übungen und Wettkämpfen gut repräsentiert!“
Die Hochgebirgsjäger sind eine Spezialeinheit des Bundesheeres. Ihr Job ist es, in schwer zugänglichem Gelände zu agieren. Die Aufgaben sind gefährlich, sie sind komplex. Jeder muss sich blind auf den anderen verlassen können. Deshalb war die Kameradschaft so wichtig – und ich habe nie etwas Vergleichbares erlebt wie in dieser Zeit.
Zu unseren täglichen Aufgaben gehörten die Ausbildung zum Spähtrupp, die Bergrettung, die Vorbereitung auf militärische Wettkämpfe und das Überleben im Wald, am Berg, im Biwak oder im Iglu. Auch wenn es nur Übungen waren: Die Sinne mussten geschärft sein, denn die Gefahr, sich oder andere durch Unachtsamkeit zu verletzen, war immer präsent. Egal, ob wir uns an einer Felswand abseilten oder im selbstgebauten Akia aus Skiern die Rettung eines Kameraden simulierten: Im Hochgebirge kann jeder Fehltritt Folgen haben.
Umso wichtiger war es, dass wir uns aufeinander verlassen konnten. Ich habe gelernt, dass nicht alle meine Kameraden meine besten Freunde sein müssen – aber dass es in einer Gruppe volles Vertrauen braucht. Wir fuhren gemeinsam in Lawinenfelder, wussten, dass eine Lawine abgehen könnte und ein Kamerad gerettet werden musste.
Das erfordert eine besondere Form des Zusammenhalts, und man spürte, wie wir als Einheit auch im Alltag immer mehr zusammenwuchsen. Mein Wertesystem wurde auf den Kopf gestellt. Bis heute stehen für mich Vertrauen, Loyalität und Disziplin an erster Stelle – Werte, die nicht nur im Mannschaftssport, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen ein Grundstein für den Erfolg sein können.
Neue Routinen und der Abschied vom Alkohol
In dieser Zeit haben sich auch meine Routinen und Gewohnheiten gefestigt. Das frühe Aufstehen, der Zyklus von Ruhe, Schlaf und Training wurden immer besser. Aber dann war da noch das Thema Alkohol. Man sagt ja, bei der Bundeswehr wird viel getrunken. In unserer Mannschaftsstube, einem Raum, in den nur die Hochgebirgsjäger der Truppe (keine Dienstgrade und keine Ausbilder) durften, gab es auch Alkohol. Besonders das bayerische Bier schmeckte allen. Auch wenn es nie mehr als ein, zwei Bier am Abend waren – am nächsten Morgen merkte ich, dass es mir nicht guttat. Nicht, dass ich einen Kater gehabt hätte, aber ich fühlte mich wesentlich besser, wenn ich nichts getrunken hatte.
Also beschloss ich, vorerst unter der Woche auf Alkohol zu verzichten. Da mir das Leben in den Bergen und in der Natur so gut gefiel, verbrachte ich meine Wochenenden nun öfter in Süddeutschland. Mein „Verfolger“ Moritz Fricke hatte es auch in den Zug geschafft. Er wohnte am Chiemsee und wir verbrachten die Wochenenden gemeinsam „am Berg“. Da man früh aufstehen muss, wenn man eine Bergtour machen will, fand ich es sinnvoll, auch hier nicht mehr zu trinken. Und das war es dann für mich: Seit über 20 Jahren trinke ich keinen Alkohol mehr, dass ich nicht rauche, versteht sich von selbst.
Was man immer wieder merkt: Die meisten Leute haben ein Problem damit, wenn man keinen Alkohol trinkt. Auch hier in Köln, wo das Kölsch fast selbstverständlich dazugehört. Es gilt als gesellig und völlig normal, gemeinsam zu trinken. Wenn andere mit meinem Nichttrinken konfrontiert werden, fühlen sie sich plötzlich rechtfertigungspflichtig. Dabei habe ich kein Problem damit, wenn jemand abends mal ein Glas Wein trinkt. Aber meistens bleibt es nicht bei einem Glas. Oder sie erwarten eine Erklärung, warum ich das Bier stehen lasse. Immer wieder komme ich da in Situationen, in denen mich Menschen zum Mittrinken animieren wollen. Denen gebe ich gerne den Vergleich mit dem Vegetarier. „Den forderst du ja auch nicht auf, heute mal ein Steak zu essen, oder?“ Das hat noch immer funktioniert.
Die Leere nach der Dienstzeit
Für mich war immer klar, dass die Bundeswehr nicht das Ende meines Weges ist. Als ich vor der Entscheidung stand, mit meiner Einheit nach Afghanistan zu gehen, habe ich mich für den zivilen Weg entschieden. Die Zeit bei den Gebirgsjägern hat mir viel gegeben. Neue Fähigkeiten, neue Stärken, ich wusste, was mir Spaß macht, ich hatte Talente in mir entdeckt – aber wohin mich das im „normalen Leben“ führen würde, davon hatte ich noch keine Vorstellung.
Eine neue Leere machte sich in mir breit. Meine Bestimmung, meinen Purpose, meinte ich gefunden zu haben – aber wo konnte ich Teamgeist spüren, Menschen anleiten, wo würden mir die erlernten Eigenschaften weiterhelfen?
Es waren Extremsituationen im Hochgebirge, die Kameradschaft in der Truppe, die mir geholfen haben, meine Bestimmung zu finden. Jeder muss in sich hineinhorchen, um eine Antwort zu finden. Ich wusste nun, was ich wollte, aber noch nicht, wie und wo ich das würde umsetzen können.
Meine wichtigsten Lehren aus der Bundeswehrzeit
Es ist eine Qualität, auch einmal Dinge als gegeben zu nehmen, ohne zu diskutieren.„Klagt nicht, kämpft“, lautete das Credo. Mitleid bringt einen keinen Schritt weiter.Disziplin ist wichtiger als Motivation.Vorbereitung ist alles.Kapitel 2 Der harte Hund
Auf in die Fitnessbranche
Zurück in Köln, suchte ich erst einmal nach Orientierung. Immerhin wusste ich, was ich nicht wollte. Ich wollte nicht in einem Büro sitzen, wollte keine monotone Arbeit machen. Meine Eltern rieten mir, mich in der damals boomenden Fitnessbranche zu versuchen. Die Idee gefiel mir. Ich bewarb mich für ein einjähriges Praktikum bei der Fitness Company, dem heutigen Fitness First in der Luxemburger Straße. Für eine 40-Stunden-Woche gab es gerade mal 500 Euro, aber das war mir damals egal. Ich suchte eine Aufgabe und hoffte, sie dort zu finden.
Der Vorteil eines langen Praktikums: Man lernt wirklich jede Abteilung kennen, probiert sich aus, sammelt Erfahrungen. Nebenher begann ich, die ersten Leute individuell zu trainieren: ein Programm, bei dem ich mich mit einem Trainierenden zu einer bestimmten Zeit verabredete und ihn eine Stunde lang trainierte. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten „Kunden“.
François, Mitte 40, sprach kein Wort Deutsch, sondern nur Französisch. Meine wenigen Brocken Schulfranzösisch reichten bei weitem nicht aus, um ein längeres Gespräch zu führen. François saß im Rollstuhl und litt an einer Spastik. Er konnte sich zwar mit Gehhilfen fortbewegen, aber nur sehr mühsam. Er war hier in Deutschland, weil seine Mutter (damals über 70) einen Deutschen geheiratet hatte, der aus Köln kam. Zweimal in der Woche traf ich mich mit François zum Training.
Mit Händen und Füßen habe ich ihm die Aufgaben erklärt. Ich half ihm in den Stand, überlegte mir Übungen, wie er seine Muskulatur an den Hilfsmitteln oder im Sitzen trainieren konnte. Es war schwierig, doch es funktionierte. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen und ich merkte, dass ich François wirklich half. Mein Wissen war natürlich begrenzt, aber allein durch das Tun, durch die Bewegung war François ausgelasteter, besser gelaunt und motiviert, nicht aufzugeben.
Von einem wirklichen Personal Training war das noch weit entfernt, da fehlte der ganzheitliche Ansatz. Aber das hat mich angespornt, mein Ziel weiterzuverfolgen. Nach und nach wuchs die Zahl meiner Kunden. Menschen, die merkten, dass ich ihnen helfen wollte und es auch tat. Das gab mir Zufriedenheit. Ich wusste: Das ist mein Ding.
In der Fitness-Industrie
Die Arbeit im Studio war vielfältig, denn ich probierte alle Bereiche einmal aus. Es gab Leute, die sich um die Kunden auf der Trainingsfläche kümmerten. Andere beaufsichtigten die Kraftmaschinen. Es gab Mitarbeiter, die sich im Kundenservice mit den Fragen, Beschwerden und Anregungen der Kunden beschäftigten. Einer der wichtigsten Jobs war der an der Theke, denn dort ist man das Gesicht des Studios. Wenn die Kunden durch die Tür kommen, müssen sie ein freundliches Gesicht sehen, einen einfühlsamen Menschen, dann fühlen sie sich wohl.
Aber es ist auch keine leichte Aufgabe, zumindest war sie das für mich nicht. Auf der einen Seite stehen die Leute mit den unterschiedlichsten Problemen vor dir an der Theke. Der eine hat seine Mitgliedskarte vergessen, der andere hat eine Frage, will noch einen Shake kaufen oder braucht ein Handtuch. Gleichzeitig kommen von hinten schon wieder Kunden, die einen Riegel wollen oder Ausrüstung suchen. Ich habe den Service gerne gemacht, habe aber gemerkt, dass die Hektik an der Theke auf Dauer nicht meine Welt ist.
Etwas Wichtiges habe ich aber aus den Wochen im Eingangsbereich mitgenommen: Ich habe gespürt, wenn man die Leute mit einem Lächeln begrüßt und sie mit Namen anspricht, dann ist sofort eine andere Stimmung da. Nicht ohne Grund werden in den Studios beim Einchecken das Foto und die Daten des Gastes angezeigt, denn diese Begrüßung ist der absolute Eisbrecher, und der Frust, der sich vielleicht bei der Arbeit oder zu Hause angestaut hat, kommt gar nicht erst ins Studio.
Vielleicht haben sich die Studios das von den Tophotels abgeschaut. Ich durfte einmal mit der Basketball-Nationalmannschaft bei der WM im Ritz-Carlton in Schanghai schlafen – da wussten die Pagen nicht nur, wie du heißt, sondern auch, welchen Kaffee du magst und wie du dein Ei gerne isst. Ich habe daraus gelernt, dass eine Wohlfühlatmosphäre und der direkte Draht zum Kunden entscheidend für die Kundenzufriedenheit sind. Meinen Mitarbeitern gebe ich gerne den Rat, die Wünsche der Kunden mehr als zu erfüllen, sie zu überraschen. Denn das bleibt in Erinnerung.
Besonders wichtig ist, nicht vorschnell über potenzielle Kunden zu urteilen – denn das kann im Zweifel durchaus nach hinten losgehen. Dazu gibt es auch eine schöne Geschichte mit meinem Freund Christian Ehrhoff, der 2016 nach 13 Jahren in der nordamerikanischen Profi-Eishockeyliga NHL zu den Kölner Haien zurückkehrte. Wir hatten am Tag vor einem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers ein wenig Leerlauf, gingen in unseren Trainingsanzügen aus dem Hotel und besuchten ein Autohaus für Fahrzeuge aus dem gehobenen Preissegment, da standen schicke Ferraris, Jaguars oder auch ein Bentley. Wir schauten uns interessiert um. Die Verkäufer musterten uns, aber niemand sprach uns an. Irgendwann beschlossen wir zu gehen. Christian schaute einen Verkäufer an und sagte nur: „Schade eigentlich, ich hätte gerne einen Wagen gekauft. Aber hier hat anscheinend niemand Interesse. Wenn Sie Ihre Kunden nicht kennen …“
Der Verkäufer hatte offensichtlich keine Ahnung und fragte nach. Als er dann via Google erkannte, wen er vor sich hatte, entschuldigte er sich vielmals und wollte wissen, welcher Wagen denn Ehrhoffs Interesse geweckt habe. „Jetzt gar keiner mehr“, sagte der Haie-Profi, und wir gingen zurück ins Hotel.
Beim Sport lernt man, Äußerlichkeiten weniger Beachtung zu schenken. Die Skilehrer sagen immer: „Ab 1500 Metern duzen sich alle, da sind alle gleich auf der Skipiste.“ Und so ist es auch bei uns: Spätestens, wenn unsere Kunden und Athleten aus der Umkleide kommen, lässt sich nicht mehr erkennen, welcher Mensch besonders erfolgreich ist. Einige trainieren in 15 Jahre alten Trainingsschuhen oder in einem zu heiß gewaschenen Poloshirt. Aber Vorsicht: Auf den Erfolg im Job oder die Höhe seines Bankkontos kann man da keine Rückschlüsse ziehen.
Daher habe ich mir angewöhnt, nicht das Aussehen als Entscheidungsmerkmal für Erfolg oder „Wichtigkeit“ heranzuziehen. Ich selbst trage zu 99 Prozent meiner Zeit eine Jogginghose. Auch wenn Karl Lagerfeld einst sagte: „Wer die trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, ist bei mir das Gegenteil der Fall. Kontrolle, Disziplin und Ordnung spielen mittlerweile eine große Rolle in meinem Leben. Man sollte also niemals vorschnell urteilen.
Die Trainingsfläche wird zum Zuhause
Zurück zu meiner Zeit im Studio. Mir war klar: Ich wollte auf die Trainingsfläche. Ich machte eine Ausbildung zum Fitnesstrainer, begann mein Studium an der Sporthochschule und arbeitete nebenbei weiter. Ich wusste, was ich wollte. Mit Menschen arbeiten, sie trainieren, Teams auf ein neues Level bringen, Potenziale erkennen, wecken und fördern.
Im Fitnessstudio funktionierte das allerdings nur bedingt. Ich ging motiviert und engagiert an jeden Kunden heran, erarbeitete mit ihm einen Trainingsplan nach seinen Wünschen und Bedürfnissen. Natürlich folgten alle einem gewissen Muster, aber dennoch war jeder Plan einzigartig. Und dann sah ich, wie genau diese Neuankömmlinge kurze Zeit später etwas ganz anderes trainierten und mein Plan Geschichte war. Das war für mich sehr frustrierend.
Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass in den Studios jeder neue Trainierende einen Trainer zugelost bekommt. Es ist also ein Zufallsereignis. Niemand weiß, ob die beiden zusammenpassen. Und das steht dem Trainingserfolg im Weg. Es ist viel besser, wenn sich da eine Beziehung zwischen Coach und Sportler aufbauen könnte, in den meisten der großen Studios ist dieser Gedanke aber ein Wunschtraum, der nicht verwirklicht werden kann.
Ein weiteres Problem in der Fitnessbranche war und ist die unglaublich hohe Aussteigerquote. Viele kommen schon nach wenigen Wochen nicht mehr, weil sie auf sich allein gestellt sind, weil die Motivation nachlässt und/oder weil sich kein Trainingserfolg einstellt. Das liegt daran, dass viele entweder zu wenig oder zu lasch trainieren, manche laufen gleich mehrere Monate mit demselben Trainingsplan herum, andere werfen ihre guten Vorsätze spätestens bei der ersten Karnevalssitzung über Bord. Ich sah die Kunden kommen und gehen und merkte: Was ich tat, war nicht effektiv und damit unbefriedigend.
Was also tun? Mangels Alternativen blieb ich auch nach dem Studium in der Branche und wechselte als Trainingsleiter zu Fitness First in die Schildergasse. Dort tauchten plötzlich die ersten Personal Trainer auf. Ich schaute neidisch auf meine Kolleginnen und Kollegen. Die arbeiteten regelmäßig mit denselben Kunden, die motiviert zum Training kamen, und man konnte fast von weitem zusehen, wie sich der Trainingserfolg einstellte. Das fand ich sensationell und fing Feuer: Das war es, was ich auch machen wollte!
Mein erster richtiger Privatkunde
Doch mein Arbeitsplatz blieb vorerst die Trainingsfläche. Bis eines späten Vormittags ein Mann im Anzug vor mir stand. Etwa 1,90 Meter groß, gut gebaut, aber leicht untersetzt, grau melierte Haare. „Ich möchte trainieren“, sagte er, und ich erklärte ihm unser Angebot. „Nein, so wird das nichts. Ich brauche einen Trainer.“ An dieser Stelle war es an mir, auf die Coaches in unserem Studio hinzuweisen.
Er schüttelte den Kopf. „Das ist ja schön und gut, aber was ist mit dir? Machst du das auch?“ Ich beschloss, meine Chance zu nutzen. „Natürlich kann ich das“, platzte es aus mir heraus. „Gut. Können wir morgen früh anfangen?“ Der Kunde ist König, also nickte ich. „Dann machen wir das so. Mein Name ist Alexander. Bis zu meinem 40. Geburtstag möchte ich fit sein. Wir trainieren immer montags, mittwochs und freitags um 6.45 Uhr.“
Ich musste kurz schlucken, denn die Bundeswehrzeit lag schon ein paar Tage zurück, und ich hatte mich im Studium wieder ans längere Schlafen gewöhnt. Aber diese Gelegenheit wollte ich um nichts in der Welt verpassen, also hieß es: Zurück zum early bird, früh aus den Federn, vor der eigentlichen Arbeit stand das Training mit Alex an. Aber hey, es machte Spaß, nein, mehr noch: Eine neue Welt tat sich auf.
Lernen durch Schmerz
Schon seit einiger Zeit trainierte ich eine Footballmannschaft, die Cologne Falcons. Ich hatte im Fitnessstudio den ehemaligen American-Football-Spieler David Odenthal kennengelernt. David erzählte mir, dass er ein neues Jugendteam gründen wollte, und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, ihr Athletiktrainer zu werden. Ich überlegte nicht lange und sagte zu.
Ich war überzeugt, dass meine Fähigkeiten aus der Bundeswehrzeit eine hervorragende Basis für die Verwirklichung meines Berufswunsches waren – und so habe ich auf das zurückgegriffen, was ich dort gelernt hatte. Jeder, der gedient hat, weiß, dass Disziplin oberstes Gebot war. „Lernen durch Schmerz“ hieß die Devise: Wer sein Bett nicht gemacht hatte, musste zur Strafe die Latrinen putzen oder eine andere stumpfsinnige Arbeit verrichten. Meistens saß die Lektion, und der Rekrut machte den Fehler kein zweites Mal. Dieses Mindset adaptierte ich in meinen Führungsstil.
Das erste Training mit der Jugendmannschaft der Cologne Falcons werde ich nie vergessen. Wir trafen uns in Köln-Michaelshoven hinter dem Berufsförderungswerk. Dort war eine freie Wiese. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir standen mit einem Haufen Jungs im kniehohen Gras. Die meisten hatten noch nie einen Football gesehen und waren körperlich gar nicht in der Lage, gegen eine andere Mannschaft anzutreten. Aber ich spürte: Hier bin ich richtig. Ich konnte ausprobieren, üben, Fehler machen, gewinnen, verlieren und mich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Es war perfekt.





























