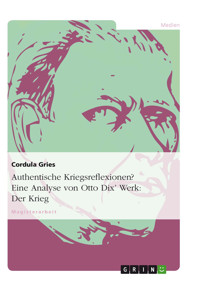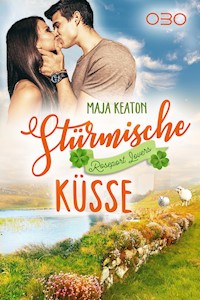0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Akademische Arbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Kunst - Grafik, Druck, Note: 1,0, , Sprache: Deutsch, Abstract: Im ersten Weltkrieg verbrachte der Künstler Otto Dix vier Jahre als Soldat überwiegend an der Westfront und bewährte sich im Kampfeinsatz. Mit nur einer leichten Verletzung, mehreren Beförderungen und Auszeichnungen - darunter das Eiserne Kreuz II. Klasse - überlebte er das Inferno fast unversehrt. Seiner Kreativität tat der militärische Einsatz keinen Abbruch. Im Gegenteil, sozusagen im Schützengraben und unter feindlichem Beschuss fertigte er über 600 Kreidezeichnungen und Gouachen, in denen er seine Erlebnisse reflektierte. Erst ein halbes Jahrzehnt nach Kriegsende kehrte Dix sozusagen auf das Schlachtfeld des Krieges zurück, um sich seinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen zu stellen. Dafür bedurfte er jedoch neuer Ausdrucksformen und die fand er im Erfassen der Realität und nackten Wirklichkeit. Der Schützengraben von 1923 (Abb. 18), in dem er den Betrachter mit dem qualvollen Sterben an der Kriegsfront konfrontierte, wurde aufgrund dieses brutalen „Verismus“, so die Bezeichnung der zeitgenössischen Kritik, von manchen Rezipienten als abstoßend empfunden. In dieser Schaffensphase (in den Jahren 1923 und 1924) entstand auch der Radierzyklus Der Krieg, der in 50 Radierungen ein Panorama der schrecklichen und desolaten Zustände an der Westfront des Ersten Weltkrieges entfaltet und der von den Zeitgenossen, welche der Kriegskatastrophe nunmehr kritisch gegenüberstanden, als ein wahrhaftiges Abbild der Wirklichkeit begriffen wurde. Die Arbeit beschreibt die Radierungen und stellt ihre kunstgeschichtliche Bedeutung dar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Spektrum der Motive
2.1 Soldatentod
2.2 Verwundung und Erschöpfung
2.3 Alltag an der Front
2.4 Landschaft
2.5 Zivilisten
2.6 Vom Zyklus ausgeschlossene Blätter
3. Technik und Verwirklichung
4. Entwürfe, Studien und zeichnerische Vorlagen
5. Literaturverzeichnis
5.1 Primärliteratur
5.2 Monografien
5.3 Werkverzeichnisse
5.4 Kataloge
5.5 Aufsätze und Zeitschriftenartikel
5.6 Nachschlagewerke
6. Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
Im ersten Weltkrieg verbrachte der Künstler Otto Dix vier Jahre als Soldat überwiegend an der Westfront und bewährte sich im Kampfeinsatz. Mit nur einer leichten Verletzung, mehreren Beförderungen und Auszeichnungen - darunter das Eiserne Kreuz II. Klasse - überlebte er das Inferno fast unversehrt.[i] Seiner Kreativität tat der militärische Einsatz keinen Abbruch. Im Gegenteil, sozusagen im Schützengraben und unter feindlichem Beschuss fertigte er über 600 Kreidezeichnungen und Gouachen, in denen er seine Erlebnisse reflektierte. Ganz anders erging es vielen seiner Kollegen, bei denen sich nach anfänglichem Enthusiasmus sehr schnell Ernüchterung einstellte. Vielen Künstlern war bereits die militärische Grundausbildung schwer erträglich, andere vermochten die Erlebnisse an der Front emotional nicht zu verkraften und erlitten Nervenzusammenbrüche. Die meisten zogen sich denn auch, früher oder später und soweit dies möglich war, vom Kriegsdienst zurück und wandten sich auch künstlerisch anderen Themen zu.[ii] Andere verstummten ganz oder starben, wie z.B. Franz Marc, der 1916 bei Verdun fiel.[iii]
Erst ein halbes Jahrzehnt nach Kriegsende kehrte Dix sozusagen auf das Schlachtfeld des Krieges zurück, um sich seinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen zu stellen. Dafür bedurfte er jedoch neuer Ausdrucksformen und die fand er im Erfassen der Realität und nackten Wirklichkeit. Der Schützengraben von 1923 (Abb. 18), in dem er den Betrachter mit dem qualvollen Sterben an der Kriegsfront konfrontierte, wurde aufgrund dieses brutalen „Verismus“, so die Bezeichnung der zeitgenössischen Kritik, von manchen Rezipienten als abstoßend empfunden.[iv] In dieser Schaffensphase (in den Jahren 1923 und 1924) entstand auch der Radierzyklus Der Krieg, der in 50 Radierungen ein Panorama der schrecklichen und desolaten Zustände an der Westfront des Ersten Weltkrieges entfaltet und der von den Zeitgenossen, welche der Kriegskatastrophe nunmehr kritisch gegenüberstanden, als ein wahrhaftiges Abbild der Wirklichkeit begriffen wurde.[v]
Im Folgenden sollen die Radierungen knapp beschrieben und hinsichtlich ihrer kunstgeschichtlichen Bedeutung dargestellt werden.
2. Das Spektrum der Motive
Von den Kriegszeichnungen grenzen sich die Krieg - Radierungen inhaltlich insofern ab, als dass die Perspektive hier hauptsächlich auf den Menschen gerichtet ist, der von dieser riesigen Kriegsmaschinerie zermalmt wird. Nicht mehr die Energie der kriegerischen Auseinandersetzung steht im Mittelpunkt (vgl. Abb. 36) - wie es noch innerhalb der Kriegszeichnungen der Fall war-, sondern das Dasein und Sterben der Soldaten in der von Schützengräben und Granaten zerfurchten Landschaft der Westfront. Kampfgeschehen spielt folglich eine untergeordnete Rolle und taucht nur vereinzelt auf, etwa, wenn ein Sturmtrupp unter Gas vorgeht, (Abb. 9) oder ein Maschinengewehrzug sich mit sämtlichen Waffen durch den Morast aus Schlamm und Leichen quält (Abb. 26). Die Folgen der Kampfhandlungen dagegen beherrschen einen Großteil der Radierungen.
2.1 Soldatentod
Der Tod als Folge des Krieges spielt in fast jeder der fünfzig Radierungen eine mehr oder minder wichtige Rolle. Dementsprechend bildet die Darstellung eines Soldatengrabes das Leitmotiv ganz am Anfang des Zyklus (Abb. 1). Es ist ein „schlechtes Grab“. Otto Dix schilderte einmal in einem Feldpostbrief an eine gute Freundin, den Zustand eines guten und eines schlechten Soldatengrabes. Letzteres beschreibt er anhand einer Zeichnung (Abb. 37) folgendermaßen:
„(…) Der liegt kaum einen Meter tief. Zufällig wurde dort später der Laufgraben vorbeigeführt, und nun streckt der Mensch seine Beine heraus in den Schützengraben. Auch liegt er nicht in gleicher Richtung mit seinem Grabhügel. Das ist weniger schön. (…) Es regnet viel und der Franzose schießt viel. Das ist alles was man sagen kann...“[vi]
Seinen Grabhügel hat das hier in der Radierung gezeigte Soldatengrab zwischen den Linien bereits eingebüßt. Vermutlich haben weitere Granateinschläge diesen zerstört und die Leiche des Soldaten freigelegt. Vom silbrigen Mondlicht beschienen, streckt sie uns ein Bein entgegen. Die Erde ist aufgewühlt und das Kreuz zu ihren Füßen gekippt. Zwischen den Beinen des Toten macht sich bereits eine Ratte zu schaffen und komplettiert den entwürdigenden Anblick dieser letzten ‚Ruhestätte’ für einen Gefallenen.
Die Galerie der Toten setzt sich den ganzen Zyklus hindurch fort. Dix entwickelt ein Panorama des Kriegstodes, welches diesen in allen Facetten schildert. Da sind die gerade im Gas Vergifteten (vgl. Abb. 2), deren aufgedunsene und dunkel verfärbten Leiber aufgereiht liegen. Oder der tote Sappenposten (Abb. 12), der zwar fast schon skelettiert, aber noch wie im Augenblick seines Todes an der Grabenwand lehnt. Ein Schuss mitten ins Herz hat ihn auf der Stelle getötet und sein linkes Bein hochschnellen und in dieser grotesken Haltung erstarren lassen. [vii]
Fast abstrakt wirkt da der Totentanz Anno 17 (Abb. 13), der einen Trupp im Drahtverhau verendeter Soldaten zeigt. Eine Leuchtkugel wirft für einen Moment einen hellen Schein auf die Toten. Sie starben vermutlich im Angriff auf die feindliche Stellung. Die Erregung und Dynamik des vorangegangenen Gefechtes ist in ihrer ‚lebhaften’ Totenstarre noch gegenwärtig. Es scheint tatsächlich als vollführten die Toten einen Tanz. Zwei Totenköpfe in Nahaufnahme beschließen letztlich den Zyklus (Abb. 32). Es wirkt als lache der eine über den anderen, der die Reste seines Gebisses zu einem gequälten Grinsen verzieht. Obwohl die Schädelknochen als Symbol des Todes das Todesthema in eine eher verallgemeinernde Sphäre überführen, verortet Dix es ganz konkret in der Realität des Ersten Weltkrieges, indem er dem Toten an dieser Stelle einen Namen gibt: Unteroffizier Müller aus der II. Kompanie, geb. im Mai 1894 in Köln.
2.2 Verwundung und Erschöpfung
Ist der Soldat nicht tot, so zeigt Dix ihn schwer verwundet und sterbend oder vollkommen erschöpft. Das durch seine klare und ausgewogene Gestaltung bestechende Blatt Ruhende Kompanie (Abb. 10) schildert, wie sich die Überlebenden einer Kompanie im Schutz der Dunkelheit niederlassen, um von den vorangegangen Kämpfen wenigstens einen Augenblick auszuruhen.
Wenn die Zurückgekehrten zum Appell antreten (Abb. 31), erschöpft, zerlumpt, verdreckt und mit hängenden Schultern, bilden sie ein Panorama von sehr individuellen Typen. Trotz aller Tragik, die sich in den Radierungen verdichtet, verzichtet Dix nicht auf seinen makabren Humor und die bittere Ironie, die in der Gegenüberstellung der abgekämpften Truppe mit ihrem steifen Kommandanten in Rückenansicht und seinen blitzblank gewichsten Stiefeln durchscheint. Auch weiß man nicht, wen Dix meint, wenn er das Blatt 7 aus Mappe V Verwundetentransport im Houthulster Wald nennt (Abb. 30). Meint er den Verwundeten, der in dem Tragetuch transportiert wird, oder die Verwundeten, die ihn transportieren. Denn auch die Sanitäter humpeln am Krückstock daher und schleppen den Verletzten ins Lazarett. Der Regen prasselt auf sie nieder und sie nehmen ihn reglos hin als spürten sie ihn nicht. Auch den hilfesuchenden Blick des Verletzten ignorieren sie. Das Elend soll nicht zu nah an ihre Seelen kommen, weshalb sie dumpf, ohne einen Blick zur Seite ihren gefährlichen Dienst verrichtend, weiterstapfen.
Andere schaffen es nicht ihre Seelen zu schützen und erleiden dort durch das Erlebte und Gesehene schwerste Verwundungen wie der wahnsinnig gewordene Soldat, der in der Nacht durch das Labyrinth aus Gräben und Ruinen irrt (Abb. 14). Er trägt seinen Tornister auf dem nackten Oberkörper und weiß nur noch durch krampfartiges Lachen, die permanenten Ängste zu vertreiben. Die qualvoll Sterbenden porträtiert Dix mit bewusster Distanzlosigkeit (vgl. Abb. 4 u.18). Auch die auf dem Schlachtfeld verwesenden Toten (vgl. Abb. 11, 15, 24 u. 27) hält er in unerbittlichen Nahaufnahmen fest. Dem Betrachter wird es dadurch unmöglich die Distanz zum Dargestellten zu wahren. Im Gegenteil, Dix macht ihn zum Augenzeugen, der das Geschehen aus nächster Nähe verfolgt. Diese distanzlose Betrachterperspektive, die bei den meisten der 50 Radierungen beobachtet werden kann, ist meines Erachtens mitverantwortlich für die enorme Suggestivkraft, die der Zyklus besitzt.
2.3 Alltag an der Front
Nur wenige Radierungen thematisieren den Alltag an der Front, vorausgesetzt man begreift den Tod nicht als alltäglich. Da kriechen beispielweise die Essenholer auf allen Vieren durch den eingestürzten Graben, um von der feindlichen Stellung nicht entdeckt zu werden (Abb. 28). Den blechernen Henkeltopf haben sie zwischen die Zähne geklemmt. Er soll die wahrscheinlich schon kalte und magere Ration aus der Gulaschkanone fassen, die die Frontstellungen mit Verpflegung versorgt.
Die beklemmende Enge eines Unterstandes wird dem Betrachter in Abb. 29 gegenwärtig. Während der bullige Soldat mit einem Kameraden Skat kloppt, geht der bebrillte Intellektuelle auf Läusejagt. Sein magerer Körper ist bereits von Läusebissen übersäht. Das blendende Licht und die Erschütterungen durch Granateinschläge, welche die Skatspieler auffahren lassen, stören die erschöpft Schlafenden in ihren engen Kojen nicht. Die beengte Situation des Unterstandes vermittelt Dix dem Betrachter, indem er seinen Protagonisten nur wenig Raum zur Entfaltung gibt. Die Schlafenden stapeln sich im Hintergrund und können kaum ihre Gliedmaßen ausstrecken, während der Läusejäger im Vordergrund nur in geduckter Haltung stehen kann, wenn er nicht mit dem Kopf an die Decke stoßen will. Die sichtbaren Grenzen des gezeichneten Raumes bilden zugleich die Darstellungsgrenzen und verstärken dadurch den Eindruck räumlicher Enge. Die imaginären Grenzen des Raumes verlaufen außerdem hinter dem Rücken des Betrachters und involvieren diesen dadurch im Geschehen. Dix lässt den Betrachter somit nicht als Zuschauer außen vor, sondern macht ihn zu einem Teil seiner Bildkomposition und seiner hier geschilderten Erinnerung.
2.4 Landschaft
Neben dem Mensch ist die Landschaft das zweite beherrschende Thema des Zyklus. Auch sie wird Opfer und gerät in das Mahlwerk des Krieges. Bei Langemarck (Februar 1918) (Abb. 5) ist sie zum Niemandsland geworden. Eine Müllhalde des Krieges türmt sich im Vordergrund auf. Aus aufgewühlten Erdmassen sprießen Eisenträger mit Stacheldraht und abgebrochene Bäume. Alte Fässer, Schädel und Tote modern dort vor sich hin. Die Zerstörung setzt sich in der Ferne endlos fort. Furor muss hier gewütete haben. Lediglich die ruinösen Überreste von Gehöften, erinnern an vergangene friedliche Zeiten, als der Boden noch Früchte trug. Nun ist er zum Massengrab für abertausende Soldaten, Tiere und Kriegsmaschinen geworden.
Als der Abend in der Wijtschaete-Ebene (Abb. 19) im November 1917 einbrach, prägten ihr Profil die unzähligen, gefallenen Kämpfer. Bis an den Horizont erstreckt sich das Leichenfeld, das Dix hier visualisiert. Im Zyklus werden Mensch und Landschaft Eins, sie verschmelzen und bilden eine Schicksalsgemeinschaft auf Gedeih und Verderb. Die Landschaft bietet Schutz, wenn sich die Armeen wie Maulwürfe in ihr vergraben, sie raubt das Leben, wenn sie die Schutzsuchenden verschüttet, die Toten versinken und verwesen in ihr und werden letztendlich eins mit ihr. Gemeinsam werden sie der Zerstörung preisgegeben.
Im Zerfallenen Kampfgraben (Abb. 7) nimmt Dix den Betrachter mit auf den schlammigen Grund des Schützengrabens, so wie er das bereits mit seinem großen und gleichnamigen Gemälde von 1923 getan hatte (Vgl. Abb. 34). Hier wie dort werden Erinnerungen an die monumentalen Hochgebirgslandschaften Caspar David Friedrichs wach (vgl. Abb. 38).[viii] Mag die Silhouette der radierten „Landschaft“ auch von schauriger, romantisierender Schönheit sein, so offenbaren doch die Details am Grabengrund eine desaströse und vollkommen unromantische Hoffnungslosigkeit.
Von bizarrer Schönheit präsentiert sich auch das Trichterfeld bei Dontrien (Abb. 3), das von Leuchtkugeln erhellt, nur die runden Formen der Granattrichter zeigt. Das Elend dazwischen bleibt in der Dunkelheit verborgen. Besonders in den Landschaftsmotiven deutet sich das Spannungsfeld zwischen Werden und Vergehen an, in dem sich der Zyklus bewegt. So zeichnet Dix einerseits eine vom Leben entleerte Mondlandschaft und zeigt andererseits wie sich das Leben nach schwerster Verwüstung erneut Bahn bricht und im hellen Sonnenlicht Blumen auf dem Rand eines Granattrichters ihre Blüten öffnen (Abb. 16). Er lässt beides zu, auch wenn Tod und Zerstörung die beherrschenden Motive bleiben.
2.5 Zivilisten
Zivilbevölkerung spielt innerhalb des Zyklus meist dort eine Rolle, wo sie innerhalb der Etappe[ix] in Kontakt mit den Soldaten kommt oder zwischen die Fronten gerät und Opfer der kriegerischen Auseinandersetzungen wird.
Die gebrochenen Mauern eines Durch Fliegerbomben zerstörten Hauses (Tournai) (Abb. 25) geben eine ganze Familie preis, die während eines Angriffs ausgelöscht wurde. Drei Erwachsene und ein Baby wurden vermutlich aus dem Schlaf in den Tod gerissen. Im Inneren des Hauses und im Gebälk befinden sich weitere Tote und legen Zeugnis über die zerstörerische Macht der neuen Kriegstechnologie ab, welche auch vor der Zivilbevölkerung keinen Halt mehr machte. Das Blatt Lens wird mit Bomben belegt (Abb. 21) macht unmissverständlich die blanke Angst der Menschen vor dieser neuen terrorisierenden Macht deutlich. Mit seiner verzerrten Perspektive ist es wohl die expressionistischste und dynamischste Darstellung im Zyklus. Von dort, wo die Gefahr herkommt, nämlich aus der Höhe, blickt der Betrachter, sich selbst in Sicherheit wiegend, auf den Straßenzug, der für die Fliehenden zur tödlichen Falle wird. Die harte und kontrastreiche Linienführung der Radierung und die verzerrten Dimensionen sind Ausdruck der tief empfundenen Angst der Menschen. Es ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie die inhaltliche Ebene die Wahl der Stilmittel bei Dix beeinflussen kann.
In der Etappe suchten viele Soldaten Ablenkung vom Dienst an der Front und fanden diese häufig in den Armen von Prostituierten. Dix widmete dem, bisher auch in der historischen Forschung kaum beachteten Thema, drei Blätter (Abb. 20, 22 u. 23). Beim Besuch bei Madame Germain in Mérincourt begegnet der Betrachter erneut dem schmalbrüstigen Intellektuellen, der sich im Unterstand entlauste (Abb. 29). Hier räkelt sich die üppige und aufgetakelte Madame auf seinen Knien und er betrachtet sie mit einer Mischung aus wissenschaftlichem Interesse am Exotischen und einem Bedürfnis nach menschlicher Nähe. Ein solches Motiv, wie der „Referendar im Puff“[x] stellte die zeitgenössische bürgerliche Moral durchaus in Frage, da man über ein solches „unmoralisches“ Verhalten, das im Ersten Weltkrieg von den Soldaten massenhaft gelebt wurde, am liebsten Stillschweigen bewahrt hätte.[xi]
2.6 Vom Zyklus ausgeschlossene Blätter
Gesellschaftspolitische Sprengkraft hätte auch das Blatt Soldat und Nonne (Vergewaltigung) (Abb. 33) gehabt, wäre es nicht von Karl Nierendorf vor der Veröffentlichung vom Zyklus ausgeschlossen worden. Am 17.7.1924 schrieb er an Dix:
„Lieber Otto! (…) Gestern wurde ich wieder von verschiedenen Leuten darauf aufmerksam gemacht, dass die Beifügung des Blattes ‚Soldat und Nonne’ die Gefahr der Beschlagnahme für das ganze Werk bedeutet, zumal Deine Darstellung des Krieges an sich ein Schlag ins Gesicht ist für alle, die in der Jubiläumswoche unsere ‚Helden’ feiern und von Kampfgeist und Draufgängertum überströmen. Im Buchhändler-Börsenblatt von heute finde ich schon Ankündigungen über die Heerführer und Kriegsgrößen, die einen solchen Rechtsrummel erwarten lassen. Dein Werk wird in diesen Kreisen einen großen Sturm erregen. Man wird dieses Blatt zum Angelpunkt aller Bekämpfungen machen. Schon das Blatt ‚Soldat und uHHHHHure’ ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die eine bürgerliche Vorstellung vom Frontsoldaten haben (…).“[xii]
Aus welchem Grund Dix auch die Szene eines Luftangriffes (Abb. 34) nicht in die Mappen aufgenommen hat, ist unbekannt. Ich vermute die Radierung genügte seinen qualitativen Ansprüchen im Hinblick auf die Ästhetik des Blattes nicht. Das unübersichtliche Chaos am Himmel gleicht meines Erachtens einem unstrukturierten Gekritzel. Die Bomben wirken fast immateriell und ihre Explosionen scheinen ohne Wirkung über den Köpfen der behelmten Soldaten zu verpuffen.
3. Technik und Verwirklichung
Dix’ verfügte über ein umfassendes drucktechnisches Repertoire. Bei dem Zyklus Der Krieg kamen neben der traditionellen Radierung und der Kaltnadelradierung auch das Aquatintaverfahren, das Aussprengverfahren[xiii] und die Weichgrundätzung[xiv] zum Einsatz. Häufig bearbeitete er ein und dieselbe Druckplatte mit verschiedenen Techniken, so dass im Nachhinein die einzelnen Arbeitsschritte und Verfahren kaum mehr mit absoluter Sicherheit zu bestimmen sind.[xv] Dix zeigte sich regelrecht begeistert von den Radiertechniken, mit denen er erst 1920 begonnen hatte und die er seit 1923 bei seinem Lehrer Wilhelm Herberholz an der Düsseldorfer Akademie vertiefte:
„Säure abwaschen, Aquatinta drauf, kurz, wunderbare Technik, mit der man Stufungen ganz nach Belieben arbeiten kann. Die Mache wird mit einem Male kolossal interessant; wenn man radiert, wird man der reinste Alchimist.“[xvi]
Aufgrund der technisch zum Teil komplizierten Ausführung der Radierungen, bei denen mehrere Arbeitsgänge wie Aufstäuben des Asphaltkornes, Schmelzvorgänge, Säurebäder, Auftragen und Entfernen des Ätzgrundes sowie die Behandlung der Platte mit unterschiedlichsten Werkzeugen wie Stahlnadel, Trommelroulette und evtl. auch Schmirgelpapier nötig war, müsste eigentlich eine große Anzahl von Probeabzügen entstanden sein. Bis heute sind jedoch nur wenige solcher Zustandsdrucke bekannt. Von diesen wurden sogar einige, wie Florian Karsch nachweisen konnte, in normale Auflage-Exemplare hineinverteilt. Er vermutet, dass das entweder aus Unachtsamkeit oder Sparsamkeit geschah.[xvii] Für Dix Arbeitsweise könnte das bedeuten, dass er mit großer Meisterschaft nur wenigen Probeabzügen benötigte, um seine anvisierte Bildidee zu erreichen und einige davon, weil sie seinen Ansprüchen bereits genügten in den Mappen veröffentlichte. Oder aber er vernichtete die vielen Probeabzüge, die eigentlich zu erwarten gewesen wären.
Das Blatt Sterbender Soldat (Abb. 18) steht beispielhaft für eine entsprechend aufwendige Radierung, in der sich die unterschiedlichen Techniken überlagern. Vor einem grau gestuften Grund, der mit dem Aquatintaverfahren flächig gestaltet wurde, hebt sich das schmerzverzerrte Gesicht des sterbenden Mannes ab. Seine Hand krallt sich Halt suchend in den Uniformmantel. Doch Mantel, wie Mensch versinken bereits im Schlamm, nur das auf die Aquatinta gelegte Liniengeflecht unterscheidet noch den Stoff vom erdigen Grund. Mit kräftigen und zügig radierten Strichen gestaltet Dix den von Granatsplittern geschundenen Leib. Die Qualen des Sterbenden werden optisch u. a. durch den harten Kontrast zwischen dem sehr hellen Inkarnat und den tiefschwarzen, fast aggressiv geführten Profillinien vermittelt. Aus den klaffenden Wunden fließt noch weiches und warmes Blut, das Dix hier mit samtig wirkenden Kaltnadellinien vergegenwärtigt. Das wunde Fleisch und hervorquellende Hirn ist aus dem Gemenge der verschiedenen Techniken geformt. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Dix die druckgrafischen Mittel sehr überlegt einsetzte und mit ihnen den Sinngehalt der Darstellung unterstrich. Denn der hier gezeigte gewaltsame Übergang vom Leben zum Tod ist ein vergleichbar überlagernder und zerstörerischer Prozess, wie der Bearbeitungsprozess der Druckplatte. Sie wurde so lange mit Säure und Stahlnadeln ‚verletzt’ bis die fleckigen Grauflächen, zerlaufenden Linien, die harten Striche, Punkte, Haken, Kringel und ausgefransten Ätzungen ineinanderfließen, sich überlagen und das Sterben vergegenwärtigen. Der Einsatz der Aquatinta verleiht den Drucken eine malerische Qualität. Doch nutzte Dix die gesamte Spannbreite der technischen Möglichkeiten und schuf auch technisch sehr reduzierte Blätter, die allein auf die Ausdruckskraft der Linie setzen. Beim Fliehenden Verwundeten (Abb. 8) beispielsweise sind die Striche auf das blanke Papier wie hingestammelt. Der ‚flüchtige’ Charakter der Zeichnung lässt erahnen, dass der Dargestellte sich tatsächlich auf der ‚Flucht’ befindet. Denn erst der enge Bildausschnitt und der Titel des Blattes vervollständigen den Eindruck eines auf den Betrachter zustürzenden Fliehenden. Die hastig gezeichneten Linien, die letztendlich in den psychedelisch kreisenden Pupillen der weit aufgerissenen Augen kulminieren, suggerieren eindringlich den verstörten Zustand des Verletzten. In ähnlicher Weise wie im vorangegangenen Beispiel vermittelt hier die Wahl und die Umsetzung der Drucktechnik den Sinngehalt der Darstellung.
4. Entwürfe, Studien und zeichnerische Vorlagen
Dix fertigte vermutlich keine detaillierten Vorzeichnungen für die Radierungen an. Denn von den ca. 60 erhaltenen Entwürfen[xviii] lassen sich nur wenige einer späteren Radierung zuordnen. Darunter sind einige in der Ausführung sehr reduzierte Bleistiftzeichnungen, die lediglich ein grobes Kompositionsraster vorgeben, während sich von den aufwendigeren Pinselzeichnungen keine einer späteren Radierung zuordnen ließe. Sie haben meines Erachtens eher einen Studiencharakter für den späteren Einsatz der Aquatinta und dienten diesbezüglich vermutlich zur Abstimmung der Hell-Dunkel-Kontraste.
Beispielsweise erprobte Dix in einer mit Tusche lavierten Skizze (Abb. 40) vermutlich die Lichtwirkung der gegnerischen Scheinwerfer über einem nächtlichen Trichterfeld. Soldaten –in Deckweiß- verbergen sich wie Insekten darin und recken ihre Köpfe aus den Löchern. Diesen Entwurf hat Dix nicht übernommen, obwohl er das Motiv des beleuchteten Trichterfeldes sehr wohl im Zyklus berücksichtigte (vgl. Trichterfeld bei Dontrien von Leuchtkugeln erhellt Abb. 3).
Anhand der Pinselvorzeichnungen sind ferner keine zusammenhängenden Entwicklungsprozesse einzelner Motive ablesbar. Eher ließen sie sich als motivische Variationen beschreiben, welche die Lichteffekte mittels tiefschwarzer Tuschelavierungen auf weißem Grund ausloten. Im Hinblick auf die Arbeitsweise des Künstlers bedeutet dies, dass Dix vermutlich das endgültige Motiv erst während der Arbeit an der Druckplatte entwickelte. Dafür sprechen auch andere Beispiele, bei denen er lediglich grobe Skizzierungen vornahm und Arbeitsanweisungen für die spätere Umsetzung formulierte. In der Skizze zu Frontsoldat in Brüssel notierte er z. B. am unteren linken Rand „Weiber größer“ (Abb. 41), unten rechts verwies er auf die Verwendung kräftiger Aquatinta und eines kräftigen Striches. Der Vergleich mit der entsprechenden Radierung zeigt, dass er diese Hinweise umsetzte, darüber hinaus aber auch das Motiv veränderte, indem er auf die Darstellung des Offiziers letztendlich verzichtete und sich auf die vollbusigen „Offiziersdirnen“ konzentrierte, deren Dienste sich das „Frontschwein“ neben dem Trottoir vermutlich niemals würde leisten können.[xix]
Die Betrachtung der Entwürfe und Studien vermittelt den Eindruck, Dix habe relativ ergebnisoffen gearbeitet, das heißt die endgültige Erscheinung der Grafik erst während des Radierens festgelegt. Eine Ausnahme belegt jedoch die strenge Orientierung an einem konkreten Vorbild. Da bisher überwiegend die Unterschiede zwischen den Kriegszeichnungen und den Krieg-Radierungen herausgestellt wurden, erkannte man nicht, dass Dix auf seine Kriegszeichnungen als direkte Vorlage für den Zyklus zurückgriff.
So übertrug Dix die im Krieg entstandene Zeichnung Trümmer von Langemarck[xx] fast eins zu eins auf die Druckplatte. Die Radierung mit demselben Titel (Abb. 17) ist zur Zeichnung zwar seitenverkehrt, doch kommt sie sogar in ihrer Wirkung ihrem mit Kreide gezeichneten Vorbild nahe. Dix konturierte hier die Trümmer mit einer kräftig und breit radierten Linie, während die Binnenzeichnung hauptsächlich durch die körnig erscheinende Aquatinta wirkt. In der Nahsicht erscheint beides zusammen mit dem Vorbild zwar nicht identisch, kommt diesem aber aus der Ferne betrachtet in der Wirkung recht nahe. Auch der Relaisposten (Herbstschlacht in der Champagne) (Abb. 6) findet sein direktes Vorbild in der Frontzeichnungen Relaisposten (Abb. 39) des Künstlers. Zwar variiert er die Ausführung, doch behält die Radierung die Anlage des Motives bei. In beiden Darstellungen verkriecht der Soldat sich schutzsuchend in der engen Höhle, welche ihn wie ein Kokon von der tosenden und kämpfenden Umwelt abschirmt. In der Zeichnung schwebt das Motiv nahezu im Nichts und auch in der Radierung bleibt dieses umgebende ‚Nichts’ spürbar, obwohl die erdige Schützengrabenwand, in die der Kommunikationsposten eingegraben ist, sehr zurückhaltend angedeutet wird.[xxi] Es könnte aber ein Hinweis sein, dass sich noch weitere Parallelen zwischen beiden Werkkomplexen finden lassen, was jedoch gezielter untersucht werden müsste.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Vorzeichnungen -bis auf die letztgenannte Ausnahme -, die ja im eigentlichen Sinne keine Vorzeichnung ist- für die ausgeführten Krieg-Radierungen eine eher marginale Rolle spielten und lediglich ein grobes Schema für die Anlage des Motives sowie die Hell-Dunkel-Kontraste vorgaben. Wie Schubert aber richtig betont, kommt bei den Pinselvorzeichnungen auch die malerische Auffassung des Künstlers zum Tragen, mit der er gleichwohl die Radierungen gestaltete. So realisiere Dix die Form meist nicht aus der isolierten Linie heraus, sondern aus den Massen bzw. den mit Aquatinta gestalteten Flächen und Tiefen heraus.[xxii] Das bedeutet, dass er letztlich die Formen prozesshaft und während der Bearbeitung der Druckplatten entwickelte und nicht bereits in den Vorzeichnungen festlegte.
5. Literaturverzeichnis
5.1 Primärliteratur
Barbusse 1918
Barbusse, Henri: Das Feuer. Tagebuch einer Korporalschaft, Zürich 1918.
Dix 1914
Dix, Otto: Der Krieg. 24 Offsetdrucke nach Originalen aus dem Radierwerk von Otto Dix, Berlin 1924.
Friedrich 1924
Friedrich, Ernst: Krieg dem Kriege, Berlin / Essen / Frankfurt u.a. 151983 (1. Aufl. 1924).
Jünger 1920
Jünger, Ernst: In Stahlgewittern (Erstausgabe 1920), in: Tagebücher I. Der Erste Weltkrieg, Stuttgart 1961.
Jünger 1925
Ders.: Das Wäldchen 125 (Erstausgabe 1925), in: Tagebücher I. Der Erste Weltkrieg, Stuttgart 1961.
Jünger 1930
Jünger, Ernst (Hg.): Das Antlitz des Weltkrieges. Fronterlebnisse deutscher Soldaten, Berlin 1930.
Pechstein 1960
Pechstein, Max: Erinnerungen, hrsg. v. Leopold Reidemeister, Wiesbaden 1960.
5.2 Monografien
Barthes 1986
Barthes, Roland: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie, Frankfurt/Main 21986.
Beck 1993
Beck, Rainer: Otto Dix. Zeit, Leben,Werk, Konstanz 1993.
Burgdorff/Wiegrefe 2004
Burgdorff, Stephan u. Klaus Wiegrefe (Hg.): Der Erste Weltkrieg: Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, München 2004.
Butollo 1999
Butollo, Willi: Kreativität und Destruktion posttraumatischer Bewältigung. Forschungsergebnisse und Thesen zum Leben nach dem Trauma, Stuttgart 1999.
Cohn 1920
Ernst Cohn - Wiener: Willy Jaeckel, Reihe Junge Kunst, Leipzig 1920.
Conzelmann 1959
Conzelmann, Otto: Otto Dix, Hannover 1959.
Conzelmann 1968
Conzelmann, Otto: Otto Dix. Handzeichnungen, Hannover 1968.
Conzelmann 1983
Conzelmann, Otto: Der andere Dix. Sein Erlebnis des Krieges und des Menschen, Stuttgart 1983.
Eberle 1989
Eberle, Matthias: Der Weltkrieg und die Künstler der Weimarer Republik, Stuttgart / Zürich 1989.
Gidal 1972
Gidal, Tim N.: Deutschland – Beginn des modernen Photojournalismus, Luzern / Frankfurt a. M. 1972 (Bibliothek der Photographie, Bd. 1).
Hagestedt 2004
Hagestedt, Lutz (Hg.): Ernst Jünger. Politik-Mythos-Kunst, Berlin 2004.
Hirschfeld 1996
Hirschfeld, Gerhard u.a. (Hg.): >Keiner fühlt sich hier als Mensch…<. Erlebnis und Wirkung des Ersten Weltkriegs, Frankfurt am Main 1996.
Jürgens-Kirchhoff 1993