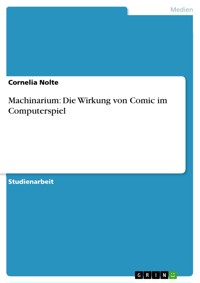Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Bitte nicht noch so einen Überwachungsskandal-Roman", stöhnen Sie? Keine Sorge, ich arbeite mich nicht an NSA, Google & Co. ab. Nein, darüber ist die Wissenschaft längst hinaus. Die nächste Stufe der Überwachung beginnt in Ihrem Kopf. Helfen Sie mir, das zu verhindern! Oder haben Sie diesmal auch nichts zu verbergen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cornelia Nolte
Big Brother 5.0
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Epilog
Impressum neobooks
Prolog
„Jeder Mensch möchte gerne ein Held sein, der für seine Taten gefeiert wird. Aber nicht alle haben die Gelegenheit dazu. Ich schon, und meine Gelegenheit war jetzt. Nur das mit dem Feiern ist so eine Sache...“
Das Leben hätte so schön sein können. Mit 34 Jahren führte ich einen angenehmen Lebensstil und konnte mich in keinster Weise beklagen. Ich zählte mich zur Mittelschicht und mein geregeltes Einkommen als Wissenschaftler an der Universität erlaubte mir ein bisschen Luxus in Form von Reisen, einer für einen Single großzügigen Wohnung in guter Großstadt-Lage und Kontakte rund um den Globus zu pflegen.
Bis ich dann vor zwei Jahren den Unfall hatte. Ein Fahranfänger hatte mich beim Abbiegen übersehen und einfach umgefahren. Wer erwartet auch einen Radfahrer mitten in der Stadt? Mein Helm – und ich war so froh, dass ich immer einen trug, auch wenn das die Frisur ruinierte und nicht gerade sexy war – verhinderte zwar Schlimmeres. Aber trotzdem kam ich so unglücklich auf dem Bordstein auf, dass meine Schädelplatte in Stücke brach und mein Kopf quasi nur noch von den Resten des Helms in Form gehalten wurde. Abgesehen von der gebrochenen Schulter, den Prellungen am Bein und dem verdrehten Knöchel, was allerdings vernachlässigbar war.
Eigentlich war es nicht sein Fehler. Die Kamera seines autonomen Autos hatte meinen Fahrweg wegen meiner Geschwindigkeit und der „nicht gradlinigen“ Fahrweise nicht richtig berechnet. Zwar wurde der Bremsvorgang noch eingeleitet, aber das Auto kam nicht rechtzeitig zum Halten. Vielleicht hätte der Fahrer noch ausweichen können, wenn er sich nicht zu sehr auf die Automatik verlassen hätte. Aber selbst wenn er aufmerksamer am Verkehr teilgenommen hätte, wäre er mit der Situation vermutlich überfordert gewesen. Die jungen Leute heutzutage lernen ja nicht mehr, manuell Auto zu fahren. Ein Jammer.
Jedenfalls stand der Pechvogel offensichtlich mehr unter Schock als ich, wobei ich mich nicht mehr an viel erinnere. Ich sehe die Ereignisse eher in verschwommenen Bildern; die Menschen, die auf mich zustürzten, Dinge sprachen und wahrscheinlich auch versuchten zu helfen. Ich fühle und höre nichts, wenn ich an diesen Moment zurückdenke. In Anbetracht der Schmerzen, die ich gehabt haben musste, war das mit Sicherheit besser so.
Den Krankenwagen hat bestimmt das im Auto eingebaute Unfall-Melde-System gerufen. Mit GPS und Außenkamera-Bildübermittlung durch die permanente Funkverbindung war das ja kein Problem. Von den anwesenden Passanten hätte ich das auch nicht mehr erwartet. Die waren viel zu aufgeregt; der erste schwerere Unfall seit Langem ist nun einmal eine Sensation. Ein Wunder, dass das Auto nicht gleich die Presse mitinformiert. Wobei die Reporter noch nicht vor Ort gewesen wären, als schon die ersten Fotos auf Facebook hochgeladen wurden. Da lohnt sich die Anreise kaum noch.
Später wurde mir dann vor Gericht Schmerzensgeld zugesprochen und die Versicherung des Unfallfahrers übernahm den Schadensfall. Dabei kam mir zugute, dass die Gesetzgebung zu diesen Zeitpunkt noch nicht auf die neue Sachlage eingestellt war. Denn trotz der selbstständig fahrenden Autos lag die Verantwortung für das Auto und die Sicherheit im Straßenverkehr noch beim Fahrer, auch wenn dieser tatsächlich nicht mehr in den Verkehr eingriff. In meinem Fall hätte sich der Fahrer also wie früher vergewissern müssen, dass der Weg frei war, bevor er abbog. Das waren noch Zeiten! Heute hätte ich beweisen müssen, dass ich mit meiner vorausschauenden Fahrweise eine zuverlässige Berechnung des Fahrtweges durch die autonomen Verkehrsmittel gewährleistet hatte und daher keine Verkehrsgefährdung darstellte, um nicht selbst die Schuld zugewiesen zu bekommen. Was ich nicht gekonnt hätte, denn das widerspricht meiner Meinung nach dem Grund, weswegen man das Fahrrad noch dem Auto vorzieht.
Außerdem hatte ich Glück, dass bei meinen Gesundheitswerten nichts gegen eine Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse sprach. Immerhin zahlte sich so die Investition in diverse Fitnessprogramme aus. Die ganze Schinderei mit regelmäßigem Sport verlangte mir ein penibles Zeitmanagement ab, aber dadurch behielt ich trotz Bürojob eine durchschnittlich athletische Figur mit Cholesterin-Werten im grünen Bereich, einem akzeptablen Verhältnis von Muskel- zu Fettmasse und genug Ausdauer im EKG-Belastungstest.
Mit den gesammelten Daten meines Gesundheits-Trackers, den ich u.a. immer für meine Jogging-Runden im Einsatz hatte, konnte ich meinen verantwortungsvollen Umgang mit meiner Gesundheit nachweisen. Ich hielt mich an einen ausgewogenen Spannungsbogen zwischen Aufwärmphase, mäßiger und höchster Belastung im empfohlenen Wechsel und einem Auslaufen vor dem Dehnen, alles perfekt zugeschnitten auf meine Körpergröße und mein Gewicht. Zusätzlich zur gesunden Ernährung, versteht sich. Daneben hatte ich Pluspunkte als Nichtraucher und wegen meines unterdurchschnittlichen Alkoholkonsums. Mein Arzt bescheinigte mir außerdem gute Gene, wodurch die Genesungschancen und vor allem die vollständige Wiederherstellung meiner Arbeitskraft eine günstige Beurteilung erfuhren.
Ich will gar nicht daran denken, wie es ausgegangen wäre, wenn ich mich an den Kosten hätte beteiligen müssen, weil ich mich nicht gut genug um meine Gesundheit bemüht hätte oder die Erfolgsaussichten einer Wiedereingliederung in den Berufsalltag nicht hoch gewesen wären. Und nicht zu vergessen: wie ich die Reha-Maßnahmen hätte überstehen können, wäre ich nicht vorher schon einigermaßen sportlich gewesen.
Als ich nach qualvollen Monaten harten Physiotrainings und speziell zusammengestellter, nicht gerade leckerer Aufbaukost mühsam zu meinem alten Lebensstandard zurückfand, wollte ich natürlich dort weitermachen, wo ich aufgehört hatte. Schließlich war ich physisch geheilt und wieder ausreichend fit. Außer der dünnen Metallplatte, die meine Schädeldecke stabilisierte, war ich ganz der alte, so dass im Grunde nichts dagegen sprach.
Dachte ich.
1
Während ich wieder einmal über jenen schicksalhaften Tag in meiner Vergangenheit sinnierte, wartete ich in der Schlange an der Supermarktkasse. Das war inzwischen äußerst ungewöhnlich, da man üblicherweise per Funk die Waren scannte und bargeldlos bezahlte. Wahrscheinlich hatte irgendwer nicht mehr genügend Guthaben auf seinem Chip oder kein Smartphone dabei, so dass eine echte Kassiererin in Aktion treten musste.
Ich seufzte und sah auf meine Uhr. 19:20 Uhr. Keine neuen Mails. Mittwoch, 17.03., mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 45% bei aktuellen 12 Grad Celsius und bewölktem Himmel. Durch die Warterei wechselte meine Herzfrequenz in den gelben Bereich, weshalb die Wetterinformationen zugunsten einer entsprechenden Warnmeldung ausgeblendet wurden. Da ich mich nicht im Fitness-Modus befand, registrierte das System meine erhöhten Werte als alarmierend. Mich beunruhigte das aber keineswegs, denn ich hasste unnötiges Warten und führte meine gesteigerte Herzfrequenz auf meine Ungeduld zurück.
Ganz so intelligent waren die Geräte doch noch nicht. Sonst hätte mir die Uhr eher ein langsames Lied auf die Ohrstöpsel gelegt. Immerhin gaben sie aber auch kein präventives Beruhigungsmittel ab. Wenigstens das konnte ich gut heißen, damit die Weltbevölkerung nicht den halben Tag wie Zombies durch die Gegend lief. Wobei das sicher nur eine Frage der Zeit war, denn dieses Szenario wäre für die Pharmaindustrie absolut lukrativ. Ich entschied, lieber nicht weiter darüber nachzudenken, und passierte wenige Minuten später die Kasse. Innerhalb von Sekundenbruchteilen wurden meine Einkäufe erfasst und mit einem Piepen die erfolgte Abbuchung quittiert.
Draußen auf der Straße registrierte meine Hausregelung aus der Kombination Uhrzeit und Standort, dass ich auf dem Heimweg war. So konnte sich die Heizung einen Vorsprung verschaffen, damit meine Wohnung mollig warm war, wenn ich zu Hause eintraf. Selbstverständlich wurde der Energiebedarf zum Erreichen der vorgegebenen Temperatur präzise von meinem aktuellen Standort und der daraus errechneten Dauer bis zu meiner Ankunft kalkuliert. Theoretisch hätte ich das auch per Knopfdruck von unterwegs einstellen können, aber die Mühe musste ich mir nicht machen, da mein Tagesablauf gleichförmig genug war, so dass das Smart Home eine riesige Arbeitsersparnis darstellte.
Ein leichtes Vibrieren am Handgelenk bedeutete mir, eine Mail erhalten zu haben. Mein Kühlschrank trug mir auf, Eier einzukaufen. Das hätte er mal früher melden können! Vielleicht sollte ich ihm doch erlauben, direkt einzukaufen. Allerdings brauchte man dazu ein Depot vor der Wohnung, in das der Lieferservice die Lebensmittel ablegen konnte, das hygienisch genug war und gleichzeitig nicht von Dritten geplündert werden konnte. War mir zu kompliziert. Alternativ könnte ich die Bestellung meines Kühlschranks auch in der Filiale meiner Wahl abholen, aber dann wäre ich dem Rhythmus meines Mobiliars unterworfen. Es sei denn, ich würde Regeln für den Onlineeinkauf aufstellen, die mir eine Synchronisierung mit meinem Tagesablauf erlaubten. Auch das war mir zu aufwändig. D.h. also kein Rührei, zumindest nicht heute.
Im Treppenhaus beleuchteten die Lampen nach einem ausgeklügelten System meinen Weg zur Wohnung im zweiten Stock, wobei die Sensoren die Lampen vor mir ein- und hinter mir wieder ausschalteten. Eine Weile hatte ich ein ähnliches System in meiner Wohnung installiert, aber nach einiger Zeit störte mich das ständige Aus und An dermaßen, dass ich lieber wieder zur manuellen Schaltung überging. Auch wenn die Automatik bei vollen Händen ganz praktisch war, wie ich zugeben muss.
Ich machte mir also eigenständig Licht, räumte meine Sachen in den Kühlschrank und setzte mich auf die Couch. Einen kurzen Moment des Innehaltens gönnte ich mir dann immer, um den Stress des Tages von mir abzuschütteln, wenn ich nach Hause kam. Freunde hatten mit dem Licht im Flur sofort Musik dudeln, ich dagegen brauchte meine Ruhe, ein kleines Ritual zum Ankommen. Erst danach griff ich zur Fernbedienung und schaltete die Nachrichten ein.
Dort hörte ich zum ersten Mal von der neuen Erfindung, deren Prototyp nun zum ersten Mal einer ausgesuchten Öffentlichkeit vorgestellt werden sollte.
In dem Beitrag wurde der „große Durchbruch“ des ortsansässigen Technologie-Unternehmens gefeiert. Ein neues Gerät, mit dem es nun auf unkomplizierte Weise möglich sein sollte, die Gefühle von Personen zu analysieren und ihnen entsprechend das zu geben, was eine Person zu einem konkreten Moment wirklich braucht. Selbstverständlich, und wie könnte es anders sein, versprach sich der Hersteller eine Revolution des Marktes, insbesondere im Einzelhandel. Inklusive der Sicherung bzw. Schaffung tausender Arbeitsplätze.
Meine Neugier als Wissenschaftler war geweckt und ich beschloss, mir eine Einladung zu der semi-öffentlichen Demonstration der neuen Erfindung zu verschaffen. Zwar war mein Fachgebiet im Bereich Soziologie der geschichts- und gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät nicht die Auswirkung der Technik auf die Gesellschaft, wohl aber die Modelle gesellschaftlichen Zusammenlebens im Allgemeinen, und das greift in gewisser Weise schließlich ineinander. Wenn dieses Gerät tatsächlich Strukturen revolutionieren sollte, beträfe das auch meine Forschungen. Ich hoffte, das wäre Argument genug.
Gleich am nächsten Morgen wollte ich mich um die Teilnahme kümmern. Dass es schwierig werden würde, hätte mir dabei schon beim Aufstehen klar sein können. Ich erwachte nach einer äußerst unruhigen Nacht. Mein Schlaf-Tracker fasste das Offensichtliche zusammen, indem er mir das Verhältnis von Tiefschlafphase zu Wach- und Leichtschlafphasen mit einem roten Warnsignal markierte. Den Daten entsprechend hatte der Tracker dem Wecker erst zum allerletzten Zeitpunkt das Klingeln erlaubt. Normalerweise hätte ich innerhalb einer definierten Zeitspanne geweckt werden sollen, wenn mein Schlafrhythmus ohnehin auf eine Wachphase zusteuert. Nur war das heute nicht möglich, ohne dass ich verschlafen hätte. Der zweite Punkt, weswegen ich mich wie gerädert fühlte.
Ich schlurfte ins Bad unter die Dusche. Um meine Lebensgeister zu wecken, entschied ich mich für die radikale Lösung – kaltes Wasser. Grundsätzlich eine schöne Idee, wenn nicht die Dusche schon gewohnheitsmäßig das Wasser erhitzt hätte. Schicksalsergeben seufzte ich und ließ das warme Wasser sowie den Schaum an mir herunterrinnen, bevor ich länger als sonst das Wasser strömen ließ. Wenn der Wechsel langsam vonstattengeht, ist es mit der Kneippkur zwar nicht so weit her, aber immerhin gab mir das nun kalte Wasser einen Kick. 20 Liter mehr als üblich verbrauchte ich auf diese Art und Weise. Aus Umweltgesichtspunkten reine Verschwendung, aber andererseits sparte ich sonst mit der genau abgemessenen Menge aufbereiteten Wassers. Insofern konnte man das eine Mal vertreten, fand ich.
In der Küche hatte sich meine Kaffeemaschine ebenfalls schon aufgewärmt und war bereit, mich mit dem köstlichen Duft von frisch gebrühtem Kaffee und dem heißen Koffein zu verwöhnen. Ich ließ mir eine Tasse durchlaufen und scrollte mich nebenbei durch den News-Ticker auf meinem Tablet. Der „große Durchbruch“ schien doch eher lokal begrenzt zu sein, da die überregionalen Medien keine Notiz davon nahmen. Lag vielleicht daran, dass es noch nichts zu sehen gab. Ohne Bilder ist die Aufmerksamkeitsspanne der Leser nicht groß genug. Die meisten Klicks haben nun einmal Artikel mit spektakulären Bildern, also warum kostbaren Platz mit wenig lukrativen Nachrichten verschwenden, die sowieso nur wenige lesen? Soviel zur Informationsrelevanz im ehemaligen Qualitätsjournalismus...
Wie gerne wäre ich jetzt mit dem Rad zur Uni gesprintet! Das macht mir immer den Kopf frei und regt meinen Kreislauf an. Ich will zwar nicht wissen, was ein Arzt zum Adrenalinausstoß sagen würde, könnte er mich durch den Stadtverkehr kurven sehen. Für Menschen, die sich zu sehr auf ihre kleinen Helferlein verlassen, wäre es vermutlich Stress pur. Aber ich bin hier aufgewachsen und brauche weder Navi noch Abstandsmesser, automatische Bremsen oder Informationen zur Straßenlage der Autos zwei Blocks weiter. Ich freue mich immer über die verdutzten Gesichter jüngerer Mitbürger, die solch einen Anblick nicht mehr häufig zu sehen bekommen. Außerdem bin ich wesentlich schneller dort, wo ich hin will, und bin auch nicht aufgeschmissen, wenn die Elektronik eine Macke hat. Was nicht selten vorkommt, da inzwischen alles damit vollgestopft ist.
Heute jedenfalls vermeldete meine Uhr eine Regenwahrscheinlichkeit von 75% bei kühlen acht Grad Außentemperatur. Da ich ungern nass auf der Arbeit ankommen wollte, würde ich das Fahrrad zugunsten der U-Bahn stehen lassen. Ganze Menschenströme schoben sich über die Treppen in den Untergrund, viele vorsorglich mit einem Regenschirm bewaffnet. Unwillkürlich musste ich daran denken, dass das von oben wahrscheinlich so aussah, als würden sich Ameisen über die diversen Zugänge in ihren Heimathaufen drängen. Nur dass die Ameisen nicht maschinell weiter transportiert wurden und sicher auch nicht dafür bezahlen mussten. Ein vertrautes Piepen verkündete mir beim Eintritt in die Fahrkartenzone, dass mein Smartphone ein Ticket gelöst hatte. Beziehungsweise den Startpunkt markiert hatte, denn über den endgültigen Kartenpreis würde das System entscheiden, je nach dem, wo ich ausstieg. Während ich darüber nachdachte, wie ich meinen Plan in die Tat umsetzen könnte, quetschte ich mich neben die anderen Pendler in die Bahn.
Alles in allem ein mauer Start in den Tag.
Endlich im Büro überflog ich meine Post, sowohl die elektronische als auch jene auf Papier. Ja, die gab es immer noch, auch wenn sie immer weniger wurde und ihr Untergang schon oft prognostiziert wurde. Nun ja, die Mühlen einer Behörde mahlen ohnehin langsamer. Aber ein hippes, junges Unternehmen konnte mit Sicherheit bereits ohne Papier auskommen. Ich hatte Studien dazu gelesen, aber das ist ein anderes Thema und ich hatte Wichtigeres zu tun, als mich ablenken zu lassen.
Zunächst suchte ich im Internet nach passenden Artikeln und dem Nachrichtenbeitrag, in der Hoffnung, dort vielleicht weitere Informationen oder Kontaktdaten zu finden. Allerdings beschränkte sich das Suchergebnis auf den Sender, der den Beitrag in dem Abendmagazin verbreitet hatte, und das Video war für Nicht-Abonnenten mit einer Bezahlschranke versehen. Da ich davon ausging, hier keine Zusatzinformationen zu erhalten, sparte ich mir das und verlegte meine Suche auf den Hersteller und das Produkt im Allgemeinen.
Auf seiner Website hielt sich der Hersteller erstaunlich bedeckt. Ich hätte eine offensivere Werbung für das neue Produkt erwartet, aber dazu war nichts weiter zu finden. Lediglich auf der News-Seite war ein Verweis auf den Nachrichtenbeitrag zu finden. So erfuhr ich aber nebenbei, dass es sich um ein etabliertes Hightech-Unternehmen handelte, das für seine Produkte bereits mehrfach Innovationspreise gewonnen hatte und offensichtlich in Geld schwamm. Jedenfalls war es finanzstark genug, um kostspielige Forschung zu betreiben. Andererseits muss der Erfolg irgendwo begründet sein, nicht wahr?
Prinzipiell half mir das aber auch nicht weiter, schließlich gab es keinerlei Hinweise auf die Produktvorstellung, zu der ich unbedingt wollte. Also griff ich zum guten alten Telefon.
Mir blieb nichts anderes übrig, als zuerst den allgemeinen Kontakt anzurufen. Die freundliche Dame am anderen Ende der Leitung hörte sich meine Anfrage an und verband mich in die Pressestelle. Nach wie vor freundlich, aber bestimmt, musste ich ausführlich erklären, wie ich dazu kam, mich für diese Veranstaltung zu interessieren und darüber hinaus die Frechheit zu besitzen, mich selbst einladen zu wollen (auch wenn sie es höflicher ausdrückte, sagte sie mir genau das).
Irgendwie schien Frechheit aber zu siegen, denn sie leitete mich in das Eventmanagement weiter. Während ich in der Warteschleife flotter instrumenteller Musik lauschte, rutschte ich auf meinem Stuhl unbequem hin und her. Ich fühlte mich wie in einem Bewerbungsgespräch, bei dem man merkt, dass die Chemie überhaupt nicht stimmt, man aber mit wachsender Verzweiflung den idealen Kandidaten spielt, weil man den Job unbedingt braucht. Was üblicherweise kein gutes Ende nimmt.
Als das Gespräch angenommen wurde, hatte ich eine Frau dran, die den Namen „Manager“ wirklich verdient. Resolut, aber lösungsorientiert. Und wie alle Manager hellhörig bei Hierarchien. Ich betonte meine Position als Wissenschaftler am Lehrstuhl, überhöhte die Bedeutung unserer Forschung und reizte die Grenzen dessen aus, was mein Chef bestätigen würde, sollte jemand bei ihm nachfragen. Die Managerin notierte sich meinen Namen und meine Kontaktdaten. Sie versprach alles zu prüfen und wieder auf mich zuzukommen.
Es dauerte zwei volle Tage, bis ich die Rückmeldung erhielt, dass man grundsätzlich nicht abgeneigt wäre, mich einzuladen. Allerdings gelten unter dem Siegel des Betriebsgeheimnisses verschärfte Regeln. Innovation sei das kostbarste Unternehmensgut (d.h. teuer) und als solches bedürfe es besonderer Schutzmaßnahmen (d.h. Bedingungen), um bei der Veranstaltung die Wahrung des geistigen Eigentums sicherzustellen (d.h. wir trauen Dir nicht). Ich müsse daher die Erlaubnis zu einem Backgroundcheck meiner Person geben, inklusive eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses, sonst sei man leider schon aus formalen Gründen gezwungen, von einer Einladung abzusehen.
Langsam ungeduldig, war ich zum einen enttäuscht, dass ich noch nicht am Ziel war. Zum anderen war ich fassungslos ob des Umfangs der geforderten Daten. Aber ich hatte ja „nichts zu verbergen“, die Standardausflucht des normalen Bürgers, wenn er sich nicht tiefer mit der Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit und der Implikation für Datenschutz auseinandersetzen will.
Ich ließ mich darauf ein. Im Grunde mein Fehler Nummer eins.
Vierzehn Arbeitstage später sowie nach etlichen Formularen, Stempeln und Prüfungen war es dann soweit: ich hielt meine Einladung in den Händen. Geschafft! Solch harte Arbeit für eine Eintrittskarte zu einer Werbeveranstaltung. Man sollte meinen, der Firma wäre mehr an Publicity für ein neues Produkt gelegen als es mit diesen Hürden den Anschein machte. Trotzdem war ich gespannt und fieberte der Vorführung entgegen, erst recht nach meiner kleinen Odyssee. Irgendwie fühlte es sich auch sehr elitär an, als einer der wenigen Auserwählten dieser exklusiven Show beiwohnen zu können. Nächste Woche sollte es soweit sein. Bis dahin wollte ich mich noch ein wenig vorbereiten.
Wussten Sie, dass die Forschung von „Gehirn-zu-Maschine-Schnittstellen“, wie der Fachausdruck lautet, ihren Ursprung in der klinischen Behandlung von gelähmten Personen hatte, nun aber der Innovationstreiber in der Computerspiele-Industrie war? Nein? Ich auch nicht.
Hier die Zwei-Minuten-Geschichtsstunde: Die Anfänge dieser Forschung datieren auf die 1970er Jahre, als die Computertechnik für solche Zwecke anwendungsreif wurde. Ziel war es, durch Unfall oder Krankheit körperlich behinderten Menschen ihre Ausdrucksfähigkeit zurückzugeben. In erster Linie galt das für die Kommunikation, wenn Sprechen, Schreiben, Zeigen nicht möglich war. Ein berühmtes Beispiel dafür war Stephen Hawking, der sich nur noch über seinen Computer mit seiner Umwelt verständigen konnte. Später erfolgte dann auch die Bedienung von Prothesen durch Gehirnströme.
Seit damals hat die Entwicklung dieser Technik die Schublade der medizinischen Assistenz längst verlassen. Erst recht, nachdem zuverlässigere, nicht-invasive Methoden den operativen Einsatz eines Chips oder der Elektroden überflüssig machten. Dieser Schritt öffnete die Tür für die Verwendung an der normalen Bevölkerung. Mit Gedanken einen Computer steuern – wer hat noch nie von Telepathie geträumt, wenn die verflixte Kiste einfach nicht macht, was man will? Naja, diese Art von Verständigungsproblemen wird es sicher weiterhin geben. Und der Computer wird sich auch nicht selbst aus dem Fenster werfen. Aber immerhin müssten keine Mäuse mehr unter unserer Klickwut leiden. Für Computerspiele ist das bereits Realität; das notwendige Zubehör gibt es für die speziell aufbereiteten Spiele überall zu kaufen.
Viel interessanter als der Hausgebrauch sind da die industriellen Anwendungsbereiche, z.B. die Steuerung von Flugzeugen oder anderer Gerätschaften mithilfe der Gedankenübertragung. Anders als bei Computerspielen sind hier die Konsequenzen einer Fehlinterpretation der Befehle natürlich wesentlich schwerwiegender. Deshalb waren die bürokratischen Hürden in Fragen Sicherheit und Kontrolle entsprechend umfangreich. Aber die Vorteile, zum Beispiel dass neben dem Mensch, der die Steuerung bedient, umgekehrt gleichzeitig die Maschine das Konzentrations- und Aufmerksamkeitslevel des Menschen im Blick hat, dürfte bei der Genehmigung eine entscheidende Rolle gespielt haben.
Und selbstverständlich mischt auch – wie könnte es anders sein – das Militär mit. Wer weiß, vielleicht hat die Technik die praktische Testphase bereits erreicht, ohne dass wir Verbraucher davon in Kenntnis gesetzt wurden? Unnötige Panikmache war noch nie ein Ziel dieser Industrie...
Inzwischen ist die Wissenschaft sogar so weit, die Inputkette umzukehren. Das heißt nicht das Gehirn gibt die Befehle, sondern es empfängt sie. Einfache Bewegungsaufforderungen sind dabei das Eine. Das Andere sind komplexere Manipulationen, zum Beispiel Erinnerungen emotional aufzuladen und somit zu verändern. An einem ganzen „Upload“ neuer Gedächtnismuster, die zum Beispiel Wissen oder Fähigkeiten darstellen, wird intensiv gearbeitet.
Außerdem ist man bereits in der Lage, „Gehirn-zu-Gehirn“- Schnittstellen einzusetzen. Irgendwie gruselig. Der Sinn entzieht sich mir zwar an dieser Stelle, aber Sinnhaftigkeit hält nur selten Leute davon ab, die Grenzen der Machbarkeit auszuloten…
Bisher benötigte man für die Übertragung der Signale aus dem beziehungsweise zum Gehirn allerdings über Elektroden den direkten Kontakt zum Kopf. Offensichtlich hatte die Firma mit dem Prototypen nun jedoch eine Möglichkeit gefunden, diese Hürde zu überwinden. Ich konnte mir schon vorstellen, dass das der entscheidende Meilenstein zur nächsten Generation dieser Forschung war. Die Ausmaße vermochte ich gar nicht zu erfassen. Aber darüber würde mich die Produktvorstellung sicher aufklären.
2
Der große Tag war gekommen. Der Einladung war zu entnehmen, dass es sich bei der Location um eine piekfeine Adresse in einem angesagten Viertel handelte. Es war davon auszugehen, dass sich die Crème de la Crème der Oberschicht einfinden würde. Anders konnte ich mir den mehrstufigen Auswahlprozess nicht erklären. Da war es dann angebracht, sich angemessen herauszuputzen. Extra deshalb hatte ich einen halben Urlaubstag genommen und lief nun, in Unterhose, zwischen Bad und Schlafzimmer hin und her, bis mein Spiegelbild akzeptabel war. Klingt nach einer Frau? Nun, ich war es nicht gewohnt, mich in solchen Kreisen zu bewegen, und wollte auf keinen Fall einen schlechten Eindruck hinterlassen. Und ja: auch Männer können durchaus eitel sein! Als Single in der Großstadt kann gutes Aussehen nicht schaden...
Ich holte also meinen guten Anzug aus dem Schrank, den ich seit der Hochzeit meines Freundes letztes Jahr nicht mehr getragen hatte, und stellte zufrieden fest, dass er noch sehr bequem passte. Ich war sogar beim Frisör gewesen; aber das wäre ohnehin in der nächsten Zeit notwendig geworden. Kurz kämmen, etwas Gel – und die Frage aller Fragen: mit oder ohne Krawatte? Als Gast und mit meiner nicht ganz so hohen Stellung entschied ich mich dagegen. Die Großunternehmer über 50 würden mit Sicherheit eine tragen, da war es vermutlich in Ordnung, wenn ich mich optisch distanzierte.
Um Kleidung und Frisur nicht zu ruinieren, fuhr ich mit Bus und Bahn zur Veranstaltung. Da ich früher dran war als zur Rush Hour, war ich im Verhältnis zu meinen Mitfahrern deutlich zu gut angezogen. In erster Linie waren gerade ältere Schüler und Studenten sowie Rentner und Touristen unterwegs. Mein Empfinden änderte sich allerdings schlagartig, als ich an meiner Station ausstieg und den U-Bahn-Schacht verlassen hatte.
Man könnte meinen, ich sei in einem Bankenviertel gelandet. Wohl aber in einem der betuchteren Bürogebiete, in denen Manager statt Minijobber verkehren. Um mich herum schossen die Glasfassaden in den Himmel. Ihre teils einfallsreiche Architektur zeugte von dem Reichtum und Geschmack der Besitzer und die eingestreuten, aufwändig gepflegten Grünanlagen bedienten eine anspruchsvolle Klientel. Hierhin verirrte sich kein Student. Hier war das Big Business zu Hause.
Das Ziel meiner Reise lag hinter der nächsten Kreuzung. Anscheinend hatte man darauf verzichtet, das zentraler gelegene Messegelände zu buchen, sondern diesem eleganteren Ort den Vorzug gegeben, an dem sich die geladenen Gäste bestimmt heimischer fühlten. Die Location selbst hätte von der Größer her garantiert ebenfalls ein – wenn auch kleineres – Messegelände abgegeben. Aber sie war stilsicher in das Viertel integriert worden und äußerlich nicht sonderlich von den anderen Bürogebäuden zu unterscheiden. Durch die lautlose Drehtür betrat ich den Empfangsbereich.
Der edle Eindruck von außen setzte sich innen nahtlos fort. Von der hohen Decke hing ein beeindruckender Kronleuchter, der so eben nicht überladen wirkte. Boden und Wände zierte glänzender, weiß-grau melierter Marmor. Selbst meine Ledersohlen klackerten hier beim Laufen, so dass sich hundertprozentig niemand hereinschleichen konnte. Es sei denn, man sprang direkt auf den flauschigen Teppich in der Mitte, der die Garderobe rechts von dem linken Service-Tisch trennte. Hinter beiden standen sehr akkurat gekleidete, hübsche Damen und lächelten den Neuankömmlingen zu.
Ich verwarf den Gedanken an das Vorgehen eines Einbrechers und steuerte den Service an, da ich nicht wusste, wie das weitere Prozedere aussah. Mit meiner Eintrittskarte überraschte ich die Dame hinter dem Tresen. Es hätte noch gefehlt, dass sie die Nase rümpfte. Wahrscheinlich sah ich nicht aus wie eine wichtige Persönlichkeit. Aber mein Personalausweis war in ihrer Liste registriert und so wies sie mir den Weg.
Zwar war ich relativ früh angekommen (eine halbe Stunde vorher ist für mich definitiv sehr früh), aber es waren bereits sehr viele Leute im Raum. Aufmerksam betrachtete ich diese illustre Gesellschaft. Wo immer ich hinsah, erblickte ich Prominenz aus den unterschiedlichsten Genres der Stadt. Hier hatte sich tatsächlich das Who-is-who der Highsociety versammelt, und ich war mittendrin. Wahnsinn!
Die meisten anderen Gäste kannten sich untereinander schon und führten angeregte Gespräche. Es wurde viel gelacht, aber in dieser höflichen, nicht ganz so herzlichen Art, von der man nie wusste, ob das Lachen nun wirklich echt und nur gesellschaftstauglich gedämpft war oder man sich selbst gerade disqualifiziert hatte. Hier und da schnappte ich Smalltalk auf, während ich durch das Auditorium schlenderte. Nachher würde ich versuchen, mich irgendwo einzuklinken. Wenn alle über den Vortrag sprachen, war das einfacher. Im Moment suchte ich mir lieber einen guten Platz.
Als das Licht langsam heruntergedreht wurde, legte sich das stete Murmeln im Saal. Gemäß Agenda sprach zuerst der Oberbürgermeister ein paar einleitende Worte und würde anschließend an den Geschäftsführer übergeben. Auf die Bühne trat ein Mann um die 50, das Haar zur Hälfte mit Grau durchzogen, in einem ebenso stahlgrauen wie konservativen Anzug. Lediglich seine Krawatte war ein Farbtupfer, und als solcher auf das Logo des Gastgebers abgestimmt. Wollte er sich etwa anbiedern? Wie peinlich!
Meine Vermutung wurde durch die Rede bestätigt. Der Oberbürgermeister überschlug sich in seiner Laudatio, wie der Name schon sagt, voll des Lobes. Wie immer, wenn Politik die Wirtschaft lobt, geht es in erster Linie um die Schlagworte Arbeitsplätze, Zukunftssicherung (durch Innovation), Standort(vorteile). Die prosperierende Wirtschaft sorgt für zufriedene Bürger, die dann hoffentlich als zufriedene Wähler wissen, wem sie ihr Kreuzchen schulden. Soweit die wirtschaftsliberale Theorie. Dass heute immer noch Mensch dieses Märchen vom ewigen Wachstum glauben, sollte den Philanthropen zu denken geben. Politiker tun es jedenfalls noch; war es doch in den letzten Jahrhunderten ein gut funktionierendes Prinzip. Zumal es die Bevölkerung dermaßen verinnerlicht hat, dass es nach wie vor unhinterfragt hingenommen wird und sich daher als Bezugspunkt deutlich besser eignet als die anderen, erklärungsbedürftigen Modelle einer modernen Volksökonomie, die auch der Globalisierung Rechnung tragen. Aber ich schweife ab.
Mit einem Seufzer versuchte ich mich zu konzentrieren und lenkte meine Gedanken wieder auf die Bühne, die nun der Hauptredner des Abends, der Gastgeber und Initiator, unter überschwänglichem Applaus betrat. Jürgen Morler verkörperte durch und durch den Chef eines Konzerns: kerzengerade und mit selbstbewussten Schritten nahm er die Bühne in Besitz, als wäre sie sein Zuhause. (Wobei sie das in Anbetracht seiner Position mit Sicherheit auch war.) Äußerst gepflegt und in tadellos sitzenden Markenklamotten unterstrich der große Mann mit den angegrauten Haaren seine Macht mit dem Habitus jener Leute, die es gewohnt sind zu führen. Selbst wenn ich nicht gewusst hätte, wer er war, so hätte ich doch intuitiv Respekt vor seiner autoritären Präsenz gehabt.
Ganz und gar unspektakulär holte er sein Publikum mit einer kleinen Vorstellung von sich und seiner Firma ab. 56 Jahre war er alt, und 22 davon waren seinem Baby gewidmet: Network Solutions. Begonnen als Start-up, hatte er das Unternehmen mit dem richtigen Näschen fürs Geschäft an die Spitze der deutschen Wirtschaft gebracht. Der Name Network Solutions stand für beständigen Fortschritt und Innovation im Technologie-Zeitalter. Effektiv träumte er den Traum einer Hightech-Welt, in der er mit seinen Erfindungen das Leben aller Menschen verbessert. Als hätte ich das nicht schon hundertmal gehört… Dennoch, der Werdegang war beeindruckend.
Was folgte war die AIDA-Formel in ihrer schönsten Ausprägung. Unsere Aufmerksamkeit hatte er längst, trotzdem lenkte er den Blick auf die Herausforderungen des modernen und hoch-digitalen Lebens, auf den Einzelhandel, je nach dem bedroht oder unterstützt durch Onlineshops, auf den überforderten und zugespammten Kunden. Das Bedürfnis war klar umrissen: Qualität statt Quantität, auf beiden Seiten. Stärkere Kundenbeziehungen durch Vertrauen, besserer, maßgeschneiderter Service. Auch das war kein neues Rezept.
Die Lösung ließ nicht lange auf sich warten: „imachine“. Die Wortschöpfung war als Verschmelzung von „imagine“ und „machine“ wenig kreativ, dafür aber eingängig und lehnte sich an den Klang alter Apple-Zeiten an, auch wenn man aus Vorsicht auf Markenrechte darauf verzichtet hatte, das M in der Mitte groß zu schreiben.
Mit einer Kombination aus Zoom und ultrasensiblen Mini-Messgeräten war es Network Solutions gelungen, bei der Messung von Hirnströmen auf Kontakt und Elektroden verzichten zu können. Man wolle uns nicht mit technischen Details langweilen, (zumal mehr dann ohnehin unter das Betriebsgeheimnis fiele, aber das sagte er natürlich nicht), daher nur soviel: Die Frequenz der Hirnströme ließe sich mit der technischen Ausstattung von Network Solutions aus den Alltagsgeräuschen gut herausfiltern und in den Testreihen den Probanden auch korrekt zuordnen. Somit sei die Zuverlässigkeit der Methode bewiesen und Marktreife erreicht.
Um eine flächendeckende, vernetzte Nutzung zu ermöglichen, sollte es zu der kontaktfreien Anwendung zusätzlich die Option der Einbindung in Datenbrillen geben. Die aktuellen Nachfolger von Google Glas wären dann in der Lage, die Augmented Reality-Angebote oder auch Beacon-Einspielungen der emotionalen Verfassung der Träger anzupassen.
Win-win, wohin man schaute. Das Auditorium war begeistert und honorierte die Darbietung mit Standing Ovations. Versprach dieses Produkt doch vielen unter ihnen neue Absatzmöglichkeiten und damit steigenden Umsatz. Was mich betraf, so würde ich als Verbraucher nur noch das angeboten bekommen, was ich wirklich brauchte. Und wirklich nur das.
Trotzdem blieb ich skeptisch. Ich würde darüber schlafen und mich später mit den Folgen für das gesellschaftliche Gefüge im Allgemeinen und dem einzelnen Menschen im Speziellen auseinandersetzen. Schließlich war ich auch in meiner Funktion als Wissenschaftler hier und schuldete meinem Chef ein Paper zur Veröffentlichung in den Fachzeitschriften, wenn mein Ausflug hierher als Arbeitszeit durchgehen sollte.
Was ich noch nicht wusste, war, dass ich schon zu diesem Zeitpunkt die Führungsriege des Produktmanagements in helle Aufregung versetzt hatte und mich von nun an in ihrem Fadenkreuz befand. Absolut ahnungslos und unbekümmert setzte ich daher die nächsten Tage mein Leben fort.
3
Der große Tag war gekommen, auch für Dr. Karsten Reinheimer, Leiter der Entwicklungsabteilungen von Network Solutions. Seit sieben Jahren arbeitete er auf diesen Moment hin, und deshalb musste er perfekt sein.
Schon während seines Studiums hatte ihn die Neuroinformatik fasziniert und ihm war klar, dass für ihn kein anderes Forschungsgebiet in Frage kam. Nach seiner Promotion stellte sich allerdings schnell die Ernüchterung über die Mittel und die Prozesse an der Universität ein. Mehrfach hatte er bei den Professoren seines Fachbereichs, in den zuständigen Ausschüssen, ja sogar bei der präsidialen Leitung selbst für seine Vision geworben. Regelrecht gebettelt, um genau zu sein. Welche Erniedrigung. Er ballte die Faust. Er wurde noch immer wütend, wenn er daran dachte.
Unermüdlich hatte er seine Beweggründe skizziert, Paper und sonstige Unterlagen vorgelegt, die man von ihm verlangt hatte, getrieben von der Hoffnung, dass es diesmal endlich angenommen werden würde. Aber sie hatten ihn zum Narren gehalten. Also hatte er sich der Wirtschaft verschrieben, die wesentlich mehr Interesse an seinen Ideen zeigte. Und um es nicht zu verachten: wesentlich mehr zahlte!