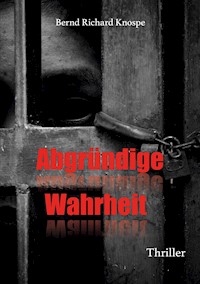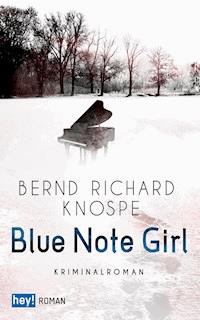Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Emotionale Achterbahnfahrt durch eine Familiengeschichte. Am Anfang geht es nur um den Fortbestand des Familiengrabes. Doch ein spontaner Nachmittag mit alten Fotos lockt die Geschwister Ruth und Richard tief hinein ins Reich der Erinnerungen. Die Reise in die Vergangenheit umfasst mehr als hundert Jahre. Teile aus verschiedenen Lebensabschnitten einzelner Charaktere fügen sich tiefgründig ineinander. Zeitsprünge verbinden Schicksale, offenbaren komplexe familiäre Strukturen und deren Auswirkungen bis in die Gegenwart. Mit ungewöhnlicher Dramaturgie erzählt BILDERGESTÖBER die Geschichte und die Geschichten einer Familie, folgt seinen Protagonisten durch Alltag und Zeitgeschehen, offenbart ihre kleinen und großen Sorgen, den gelegentlich nackten Überlebenskampf und was von jungen Träumen im Alter bleibt. Am Ende steht das Porträt einer Familie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 790
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist von ganzem Herzen meiner Familie gewidmet.
Besonders meinen Schwestern Marion und Andrea.
In Gedenken an meinen Neffen David, der viel zu früh aus unserer Mitte gerissen wurde.
Erinnerung ist eine Form der Begegnung …
Kahlil Gibran
Die Familie
Charlotta Rogalski geb. Schulze (1894 – 1964) Rudolf Rogalski (1878 – 1933)
Magda Meynert geb. Rogalski (1914 – 1995) Erich Meynert (1915 – 1984) Mia Bluhm geb. Meynert (1935 – 1985) Sina Ruge geb. Meynert (1944)
Robert Bluhm (1910 – 1982) Rebekka Bluhm (1911 – 1987) Gert Bluhm (1936 – 1993) Dietmar Bluhm (1938 – 1992) Ella Wagner geb. Bluhm (1940) Ruth Lieven geb. Bluhm (1956) Richard Bluhm (1958) Nicole Bluhm (1966)
Philipp Neubert (1980) Paul Ploog (1986) Patrick Ploog (1988)
Peer Ruge (1945) Torben Ruge (1972) Gitta Bluhm (1939) Emil Wagner (1925) Raimund Ploog (1960) Henry Neubert (1958) Christine Bluhm geb. Thiessen (1957) Hannes Lieven (1954)
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Ende
Kapitel 1: Familiengrab
Kapitel 2: Überraschungen
Kapitel 3: Leben und Tod
Kapitel 4: Die kleine Diebin und die Brillenschlange
Kapitel 5: Licht und Schatten
Kapitel 6: Die Sache mit der Liebe
Kapitel 7: Trennungsschmerz
Kapitel 8: Familienkreise
Kapitel 9: Entscheidungen
Kapitel 10: Umsatteln
Kapitel 11: Raubtiere
Kapitel 12: Hochzeitsglocken
Kapitel 13: Zusammenbrüche
Kapitel 14: Haarige Zeiten
Kapitel 15: Bella Italia
Kapitel 16: Glaubensfragen
Kapitel 17: Ehemänner und Liebhaber
Kapitel 18: Mütter und Töchter
Kapitel 19: Umzüge
Kapitel 20: Wahre Liebe
Kapitel 21: Fußball
Kapitel22: Herzensangelegenheiten
Kapitel 23: Fluchtwege
Kapitel 24: Musik
Kapitel 25: Todesnähe
Epilog: Anfang
Prolog: Ende
Oktober 1934, Holsteinische Schweiz, Magda
Vom Ufer aus ließ der Angler seinen Blick über den See schweifen. Das erste Licht der Herbstsonne überzog den grauen Himmel mit einer zarten Morgenröte, während die Natur noch unter Nebelschwaden ruhte. Kein Mensch zu sehen. Der alte Kahn dümpelte harmlos auf dem Wasser, eine sanft vom Wind geschaukelte Wiege. Vielleicht war er gestern Abend nachlässig befestigt worden und in der Nacht abgetrieben. Das zweite Boot lag sicher vertäut am Holzsteg. Der Angler ließ seine Siebensachen dort zurück, um auf den See hinaus zu rudern.
Während der Befragung durch die ortsansässige Polizei würde er später zu Protokoll geben, sich beim Anblick eines vermeintlich herrenlosen Bootes mitten auf dem See nichts Besonderes gedacht zu haben, sondern einfach nur aus Ordnungssinn hinausgerudert zu sein, um es an Land zu bringen und wieder festzubinden. Es habe ihn zutiefst schockiert, das reglose Paar im Boot liegend vorzufinden, die junge Frau und den älteren uniformierten Mann in enger Umarmung zwar, aber reglos. Wie tot. Er habe schnell gehandelt, das Pärchen an Land gerudert, dort mit ersten Maßnahmen versorgt und sei danach unverzüglich in den nächsten Ort geradelt, um Hilfe zu holen, wodurch beide Leben in letzter Minute noch gerettet werden konnten. Glücklicherweise hatte das Paar die Tabletten erst kurz zuvor eingenommen. Die neunzehnjährige Magda Rogalski und ihr fünfunddreißigjähriger Geliebter, ein verheirateter Offizier, dreifacher Familienvater und glühender Nationalsozialist.
Er war der leibliche Vater von Mia, die sieben Monate nach diesem dramatischen Ereignis zur Welt kommen sollte, als lebender Beweis einer unsterblichen Liebe, natürliches Zeugnis des ungleichen Paares, allen Regeln der Zeit trotzen zu wollen, als Symbol großer Emotionen. Doch zuletzt war sie nur der Anfang vom Ende einer aussichtslosen Affäre. Geeignet als Stoff für einen Roman oder Film. Eine Liebe, die nicht mit dem freiwilligen Tod auf einem See endete, wie unsere Oma Magda später in ihrem Tagebuch vermerkte, sondern durch das schlichte Weiterleben. Die sich abrieb, abnutzte, die ausgehöhlt wurde, an Kraft verlor und – zermürbt von Alltäglichkeit und dem Unvermeidlichen – auf staatliche Anordnung erlosch.
Mia kam am 26. Mai 1935 zur Welt. Das Paar sah in dem unschuldigen Wesen das Wunder ihrer Liebe gespiegelt. Von göttlicher Reinheit war die Rede, ein frisch erblühtes Leben, mit so viel Pathos beladen, dass eine normale Entwicklung schwer vorstellbar war.
Magda und ihr Geliebter versuchten Mia in einer außerehelichen Gemeinschaft während des Aufstiegs der Nationalsozialisten mehrere Jahre gemeinsam aufzuziehen. Doch diese unerlaubte Beziehung löste sich auf, Liebe verwandelte sich in Verachtung. Verachtung in Hass.
Als pragmatisch veranlagte junge Mutter hingen Magda die nebulösen Phrasen des Geliebten bald zum Hals heraus. Davon ließ sich kein Kind ernähren, sie brachten auch keine Wärme in die kleine, feuchte Wohnung, keine Sicherheit in Magdas und Mias Leben. Dieser Mann kam ab und zu vorbei, schlief mit Magda und verewigte anschließend befriedigt in schwungvoller Schrift, die breiten Hosenträger über dem Unterhemd, am Küchentisch seine großartigen Gefühle und Gedanken, aus denen nie nennenswerte Taten entstanden, in einem kleinen Heft.
„Damit Mia eines Tages etwas hat, von ihrem lieben Vati“, erklärte er Magda mit leuchtenden Augen.
Aber mehr als das, dachte Magda bitter, wird er ihr nicht hinterlassen.
Trotz unablässiger Liebesschwüre und Versprechungen brachte er weder die Courage noch den Willen auf, für seine junge Geliebte alles andere hinter sich zu lassen: eine Ehefrau, die er nicht mehr liebte, drei Kinder, in denen er nicht das Glück zu sehen vermochte, das Mia ihm schenkte. Seinen kleinen Sonnenschein nannte er sie gern, sein ein und alles, seine Zukunft, seine Hoffnung. Er wurde nicht müde, das zu sagen oder aufzuschreiben, bei den immer seltener werdenden Gelegenheiten, zu denen er sich bei Magda blicken ließ. In Wahrheit setzte er einfach das staatlich angeordnete Leben des untadeligen Familienvaters fort, der sich lediglich einen kleinen Fehltritt mit einer deutlich jüngeren Frau geleistet hatte. So was kam vor, Schwamm drüber! Er hoffte, in der Doppelrolle als biederer Familienvater auf der einen Seite und als Abenteurer mit einer Geliebten und Kind auf der anderen irgendwie klarzukommen.
Mit seiner Ehefrau sprach er nie mehr von Liebe, mit der Geliebten nicht mehr von der Ehe.
Aber es war nicht das, was Magda sich vorgestellt oder erträumt hatte, die Besuche im Rhythmus seiner Lust, um bei ihr jenen Draufgänger zu spielen, der er nicht war. Mit all seinen verpassten Zielen und ohne den Mut, etwas riskieren zu wollen, während er weiterhin Märchen in einem Heft verfasste, um danach die kleine Mia noch kurz auf dem Arm zu halten, sie zu herzen und zu küssen, bevor er wie ein satter und zufriedener Kater davonschlich, in das andere Leben, das sein echtes war, sein Alltag.
Auch deshalb entschied sich Magda kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges für einen Neuanfang, diesmal in eigener Regie und ohne den rückgratlosen Liebhaber. Von da an sollte es nur noch sie und die kleine Mia geben, in einer Zeit, in der Deutschland nach der Weltherrschaft strebte, das deutsche Volk enthusiastisch dem Führer zujubelte, schon bald selbst vor einem totalen Krieg nicht zurückschrecken würde und die Geschichte eines ihrer blutigsten und grausamsten Kapitel aufschlug.
Nachträglich beschleicht mich an dieser Stelle der Recherche ein Unbehagen, wie immer, wenn von Macht des Schicksals die Rede sein könnte, davon, wie große Ereignisse ihre Schatten auf jede Kleinigkeit werfen und für tiefgreifende familiäre Verflechtungen und Entwicklungen sorgen. Wenn etwas Böses in den Alltag sickert, die Gedanken vieler Menschen vergiftet, bis am Ende aus einem blutgetränkten Boden wieder eine erste zarte Hoffnung keimt, unschuldige Triebe erblühen und neues Leben entsteht.
Hätte sich Magda erst gar nicht auf die ausweglose Affäre mit dem älteren Offizier eines Schreckensregimes eingelassen, würde es den Zweig meiner Familie heute nicht geben, keinen, der über uns schriebe und nichts, was sich zu beschreiben lohnte.
Wäre der gemeinsame Selbstmordversuch zweier unglücklich Liebender 1934 in der Holsteinischen Schweiz gelungen, wären wir alle nicht da und die Geschichte bereits an dieser Stelle vorbei. Ein treibender Kahn auf dem See. Zwei Tote. Ende.
Selbst ohne den Zweiten Weltkrieg und die späteren Ströme der Flüchtenden und Entwurzelten, die er vor sich hertrieb, hätte die Geschichte nicht diesen Verlauf genommen. Falsche Entscheidungen, eine unglückliche Liebe, ein misslungener Selbstmordversuch und eine historische Katastrophe waren letztlich ausschlaggebend für den Beginn unserer Familiengeschichte. In dieser Zeit ist es eine von vielen Geschichten gewesen, bei denen die Umstände alles andere als normal waren.
Da möchte ich fast lieber von der Ohnmacht des Schicksals sprechen. Von seiner Ironie. Einer teuflischen Laune.
Wie dem auch sei, Magda und ihr Geliebter wurden gerettet.
Ein geplantes Ende verwandelte sich in einen Beginn.
Kapitel 1: Familiengrab
Gegenwart, Hamburg Niendorf, Ruth, Richard und Nicole
Wie die letzten Figuren einer noch nicht beendeten Partie stehen wir am Grab unserer Eltern. Meine ältere Schwester Ruth, nach einer nicht optimal verlaufenen Hüft-OP immer noch auf Krücken, aber von trotziger Zuversicht erfüllt, die verhassten Dinger bei nächster Gelegenheit in die Ecke feuern zu können.
Daneben unsere jüngere Schwester Nicole in chronischer Fluchthaltung, jederzeit bereit, sonst wohin zu verschwinden.
Etwas abseits, das bin ich – ein in die Jahre gekommener Geschichtenerzähler, der in Gedanken sowieso immer woanders ist, mit poetischem Blick auf Leben und Tod. Nach meinem Empfinden könnte kaum eine Situation als diese geeigneter sein, den Beginn einer Familiengeschichte einzuleiten: dort wo alles endet, wo Erinnerungen Schatten werfen, größer als so manche Wahrheit.
Ruth hat Nicole und mich hierher bestellt. Nach zwanzig Jahren haben wir darüber zu entscheiden, ob wir die Grabstätte unserer Eltern auf dem beschaulichen Hamburger Friedhof im Stadtteil Niendorf weiter erhalten wollen. Inklusive zweier noch freier Urnenplätze im Familiengrab. Die Frist läuft demnächst ab.
Für sie sei das jedenfalls keine Option, hat Ruth mit einer Entschiedenheit bekräftigt, an der ich lieber nicht rühren möchte. Im Lauf der Zeit begannen die Erinnerungen an unsere Kindheit immer weiter auseinanderzuklaffen. Und so, wie ich Ruths Sichtweise darauf als übertrieben negativ empfinde, hält sie mich für einen verblendeten Träumer, einen Zeitreisenden, für den die Wahrheit nur eine ungefähre Richtung ist.
Dabei möchte ich die Vergangenheit nicht verklären, aber Ruth meint, ich würde immer nach dem reizvollsten Blick in den Abgrund suchen.
Nicole als Nachzüglerin hat ohnehin eine eigene Jugend erlebt, die bringt uns da nicht weiter.
Wann waren wir als Familie ein letztes Mal vereint? Ich meine, mit dem Empfinden, eine Familie zu sein? Ich vermute Silvester 1984, stoße im Kopf auf Bilderfetzen eines harmonischen Jahreswechsels. Damals kamen mit wohldosierter Bitterkeit Ereignisse zur Sprache, die bis dahin tabu gewesen waren. Unsere Sicht auf Kindheit und Jugend, ergänzt durch die Erinnerungen unserer Eltern an dieselbe Zeit. Auch unbequeme Wahrheiten blieben nicht ausgespart. Ungerechte Strafen und unbeherrschte Schläge der manchmal überforderten Eltern, begründet mit den Mühen einer anstrengenden Anfangszeit, zunächst mit zwei, später mit drei Kindern, auf engstem Raum, mit wenig Geld und unter großen Entbehrungen. Das nervenaufreibende Leben auf armselig wenigen Quadratmetern, mit der überlasteten jungen Mutter, dem durch Schichtarbeit zermürbten Vater, und Ruth und ich, in vielen Dingen früh auf uns gestellt – vielleicht zu früh. Nicoles Rolle als Nachzüglerin, das sagte ich schon, war eine andere. Ungeplant. Brachte Veränderung. Weil sich unser Vater aus der Not heraus beruflich neu orientieren musste, während seiner Umschulung vom Maurer zum Zollbeamten monatelang von uns getrennt war, und eine unglückliche, oft weinende Frau mit drei Kindern zurückließ.
Silvester 1984 erinnerten wir uns daran zurück, jeder auf seine Weise. Ich trage das Bild in mir, wie ich in dieser magischen Nacht mit meiner im selben Jahr angetrauten Frau Christine auf dem Heimweg beschwingt durch den frisch einsetzenden Schneefall stapfte, während mich von innen eine tiefe Ruhe wärmte. Ein friedliches Familientreffen war das gewesen. Ich wähnte uns auf gutem Weg, hieß das Jahr 1985 voller Zuversicht willkommen.
Drei Monate später war Mama tot. Kurz vor ihrem fünfzigsten Geburtstag. Ein Tod aus dem Nichts.
Das hat alles verändert.
Ich reiße mich vom Anblick des Grabsteins los und wende mich an Nicole. Das Gespür für Notwendigkeiten, die diskutiert oder entschieden werden müssen, zählt nicht zu ihren Stärken. Bisher hat sie sich noch nicht geäußert.
So ignoriert meine acht Jahre jüngere Schwester auch meinen fragenden Blick, als hätten Ruth und ich uns die ganze Zeit zuvor in einer fremden Sprache unterhalten – eine ihrer bevorzugten Reaktionen auf uns, die mich immer wieder verblüfft. Nicole wirkt konsequent anders, und zwar so anders, dass es sich nicht allein mit der Rolle des verzogenen Nesthäkchens begründen ließe, das wie ein Einzelkind aufwuchs, eingebettet in den pädagogischen Wandel der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts.
Ich meine, Ruth war ja früher auch betont anders, auf ganz klassische Art: die aufbegehrende, uneinsichtige Tochter eben, um jeden Millimeter Abstand kämpfend, um jede Sekunde Freiheit, rebellisch, hitzig, unverstanden. Aber auch trickreich, also so normal anders, dass es die Eltern zwar nervte, aber selten ernsthaft beunruhigte. Welche pubertierende Jugendliche galt damals schon als auffällig, nur wegen des exzessiven und ohrenbetäubenden Abspielens von Lady In Black, oder wegen häufiger Verspätungen auf dem Heimweg von Feten, bloß weil die blöde Fahrradkette wieder rausgesprungen war?
Bei Nights In White Satin stiegen Ruth unaufhaltsam Tränen in die Augen, oder sie steckte in gegenteiliger Stimmung kichernd und flüsternd mit irgendwelchen Freundinnen die Köpfe zusammen. Hörte dem Bruder nur noch mit halbem Ohr zu und den Eltern gar nicht mehr. Niemand wunderte sich über launische Teenager, für die jede Sekunde mit der Clique eine Offenbarung bedeutete, im Vergleich zur sinnlos vergeudeten Zeit mit der Familie, zum Beispiel während der geregelten Mahlzeiten oder langweiligen gemeinsamen sonntäglichen Fernsehnachmittage oder -abende. Außer wenn freitags die Partridge Family lief, weil ein fünfundzwanzig Minütiges Anschmachten von David Cassidy natürlich so notwendig wie das Atmen war.
Im Gegensatz zu Ruth verbrachte Nicole als Heranwachsende viel Zeit zuhause mit üppig belegten Toastbrotscheiben vor dem eigenen Fernsehgerät, fühlte sich vermutlich den Waltons enger verbunden als der eigenen Familie, die zu diesem Zeitpunkt sowieso nur noch aus Mama bestand. Ruth und ich gingen längst eigene Wege, und Papa werkelte und pusselte sich in jeder freien Minute aus dem Kreis der Restfamilie, am Auto, im Garten oder bevorzugt in der Abgeschiedenheit des Kellers. Ich hielte es nicht für abwegig, wenn Nicole damals liebend gern nach Bullerbü, in die Sesamstraße oder nach Saltkrokan ausgewandert wäre, und hätte sie es getan, wäre mir das vermutlich erst nach Monaten aufgefallen.
Wo steckt eigentlich Nicole?
Die lebt jetzt in einer WG mit Ernie und Bert. Oder wurde von den Melkerssons adoptiert.
Oder im Abspann der Waltons:
„Gute Nacht, John Boy!“
„Gute Nacht, Nicole!“
Die kleine Schwester hatte gleich nach Ruths frühem Auszug Ende 1973 in Windeseile letzte Spuren der rebellischen Sechziger von den Wänden entfernt, das Poster Che Guevaras, die Antikriegsposter gegen den Wahnsinn in Vietnam, die Poster von Uriah Heep, CCR, The Move, Novalis, das vom Woodstock Festival und natürlich auch das letzte von David Cassidy, und sie gegen ABBA, SMOKIE und die Bay City Rollers ausgetauscht. Damit hatte sie Ruths psychedelisches Reich in ein braves bonbonfarbenes Wohlfühlzimmer umdekoriert, LEGO- und PLAYMOBIL-Tretminen auf dem Boden verstreut. Ihre Vorliebe galt einer Musik, die Mama gelegentlich sogar mitsummte. Deep Purple, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin und The Doors konnten meinen Eltern ab sofort nicht mehr den letzten Nerv rauben, vorbei waren die vielen Anrufe, es gab kein Klingeln langhaariger Typen an der Haustür mehr, die sich nach Ruths Gesellschaft sehnten.
Die lebte inzwischen in ihrer ersten kleinen und deprimierend hässlichen Wohnung in einer deprimierend hässlichen Gegend direkt am U-Bahnhof Alter Teichweg, und nach meiner ersten Visite bei ihr hatte sich in mir der dringende Wunsch verfestigt, niemals zuhause auszuziehen. Ruths Wohnung war schlimm, das Haus war schlimm und die Gegend war noch schlimmer! Wenn das die ersehnte Freiheit sein sollte, konnte ich gut darauf verzichten. Meine Schwester aber wirkte glücklich und aufgekratzt, voller Energie und Pläne, ich hatte nicht die geringste Ahnung warum.
Unsere kleine Schwester saß zwischen diesen auseinanderdriftenden Lebenswegen und musste bedauernswert konfliktlos aufwachsen.
Ruth hatte im vergleichbaren Alter so ziemlich gegen alles aufbegehrt, was sich ihr irgendwie in den Weg stellte, ich war jedem Hindernis und den meisten Konflikten mit Ignoranz und mundfaul ausgewichen, Nicole aber lebte im Mädchenzimmer wie in einem Elfenbeinturm. Zu ihrem realen Leben zählte eine Handvoll gleichaltriger Nachbarskinder, mit denen sie sich immer dann draußen traf, wenn es im Fernsehen nichts Interessantes gab oder Mama im Putzwahn die gesamte Wohnung auf den Kopf stellte.
Bis heute strahlt Nicole noch immer dieses unbestimmte Unbehagen aus. Da ist etwas geblieben, das sie ein für alle Mal hinter sich lassen möchte. Etwas, das hier am Grab schon wieder übermächtig zu werden droht, man sieht es ihr an. Hat vermutlich mit Nähe zu tun. Oder mit Tiefe. Wahrscheinlich mit beidem.
Also versuche ich es mit einer simplen Frage, damit klar wird, dass jetzt keine gewichtigen Entscheidungen anstehen. Es geht lediglich darum, ob es für sie vorstellbar wäre, sich hier beerdigen zu lassen. Im Erdreich bei unseren Eltern. In einer Urne.
Ihr Nein klingt, als hätte ich vorgeschlagen, sie solle jetzt gleich unter die Erde. Sie ist immer schnell entrüstet, als habe sie die Pubertät selbst mit zweiundfünfzig Jahren noch nicht ganz überwunden. Und beendet viele Antworten fragend, sagt nicht einfach „Nein!“ sondern „Nein?“
Dabei wollte ich wirklich nur wissen, welche Pläne sie für die Zeit nach ihrem Ableben hat. Warum aber nervt mich ihre ablehnende Haltung so viel mehr als Ruths betonhartes Nein? Vielleicht, weil meine zwei Jahre ältere Schwester eingewoben ist in ein Netz engmaschiger familiärer Patchwork-Strukturen, bestehend aus Ex-Männern, dem aktuellen Gatten Hannes nebst seinen beiden erwachsenen Söhnen und deren Frauen und Kindern, dazu Ruths eigenen drei Jungs, zwei Schwiegertöchtern und Enkelkindern – da steckt sie längst in einem maßgeschneiderten Netzwerk. Dagegen eigenbrodelt Nicole von jeher solo vor sich hin, und da wäre es doch interessant zu wissen, was im Falle ihres Ablebens mit ihr geschehen solle. Und was nicht.
Nicole ist das Thema zweifellos mehr als egal.
Was sie denn grundsätzlich über Einäscherung denke, will ich wissen, gestählt durch endlose innereheliche Diskussionen mit Christine in der letzten Zeit, über Testamente, Patientenverfügungen, Versorgungsvollmachten und was in unserem Alter sonst noch alles zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Verbrennen sei okay, lenkt Nicole ein. Dann könne ihre Asche im Winter bei Glätte gestreut werden.
Ich lobe den sozialen Ansatz der Idee. Passt zu ihr. Jedes Theater um die eigene Person ist ihr zuwider. Noch weniger würde es mich wundern, wollte Ruth ihre Asche im Borussia-Park verstreuen lassen, dem Fußballstadion von Borussia Mönchengladbach. Für den Verein hat sie schon seit frühester Jugend geschwärmt, ohne dass ich je dahinterkam, wie und warum. Ruth schläft sogar in Gladbach-Bettwäsche, neben ihrem Mann Hannes, einem ebenso leidenschaftlichen wie gutmütigen HSV-Fan.
Ruth will wissen, was ich mir denn so vorstelle.
Das irritiert mich. Wo meine Asche verstreut werden soll?
Sie verdreht die Augen.
Es gehe doch augenblicklich wohl immer noch um das Familiengrab! Ich?
Na ja, ähm, warte mal, tja, was soll ich sagen ... keine Ahnung.
„Na bitte?“, triumphiert Nicole.
Nachdem das geklärt ist, schweigen wir wieder einträchtig mit Blick auf den Grabstein, der die Namen und Geburts- und Todesdaten unserer Eltern trägt.
Mia und Gert Bluhm.
Beide haben nicht lange gelebt. Mama starb mit neunundvierzig Jahren, Papa wurde siebenundfünfzig.
Selbst den fantasievollsten Romantikern fällt es nicht gerade leicht, sich die Eltern jung, ungestüm und verliebt vorzustellen, leidenschaftlich, schwärmerisch und wild entschlossen für Dummheiten, vor denen sie die eigenen Kinder später auf Biegen und Brechen bewahren wollen.
Komm mir bloß nicht mit einem Kind nach Haus, wird dieselbe Frau als Mutter predigen, die als Tochter viel zu jung mit einem Kind nach Haus kam. Und Mia wird ihre Tochter Ruth mit denselben Worten kränken und zutiefst verletzen, die ihre Mutter ihr an den Kopf warf, ausgerechnet als sie so glücklich gewesen war, so wunderbar schwanger und gleichzeitig so frei!
Geschichten wiederholen sich, gelegentlich derart übereinstimmend, als würde jede Generation die Unterschiede zu den Eltern anfangs nur vortäuschen, um am Ende genau so zu werden. Sobald aus Kindern Leute werden. Eltern. Jene Eltern, die Regeln aufstellen, Moral predigen, Strafen androhen und vollziehen, gefragt und ungefragt Ratschläge erteilen, Freiheiten beschneiden, ungern Zugeständnisse machen. Und die genau das vorleben, von dem man sich befreien und abgrenzen möchte, die sich mit Tagesabläufen zufrieden geben, die man selbst als spießig und unerträglich langweilig empfindet, mit deren kultureller Bescheidenheit man sich schwer tut, die an den Wochenenden Ausflüge ins Nichts unternehmen, die Verwandte und Bekannte besuchen oder zu Kaffee und Kuchen an Sonntagnachmittagen einladen, auf geregelte Mahlzeiten Wert legen, sich gern im eigenen Garten beschäftigen, abends Scrabblen oder Kniffeln oder vor dem Fernseher einnicken, nach immer gleichen Ritualen ihre Geburtstage feiern, immer noch jeden Pfennig umdrehen, viel von früher reden, als das Wenige noch mehr war. Ob man will oder nicht, ungefähr das wartet letztlich auf jede Generation.
Ich muss es mir noch einmal ganz klar vor Augen führen: Auch meine Eltern waren jung, gründeten früh eine Familie. Zogen uns drei Kinder groß, unter Entbehrungen und Mühen von den Neunzehnhundertfünfzigern- bis in die Achtzigerjahre, bis Mama und Papa nacheinander starben, als gäbe es nach der Erfüllung sämtlicher Elternpflichten auf der Welt keinen Grund zum Verweilen mehr.
Kaum etwas hat meine Gier nach Leben mehr entfesselt wie der frühe Verlust unserer Eltern, weil sich so gar nicht erst die Illusion einschleichen konnte, über jede Menge Zeit zu verfügen.
Da zieht mir hier am Grab so Vieles durch den Kopf, vor allen Dingen, dass die beiden ein besseres und längeres Leben verdient gehabt hätten. Gern würde ich ihnen nachträglich mehr Zeit schenken, wenn ich könnte, oder wenigstens dafür sorgen, dass sie unsterblich würden, als junge Liebende, als verantwortungsvolle Eltern, als Menschen, die zur Bewahrung ihres Glücks Anstrengungen unternehmen mussten, Tag für Tag, Jahr für Jahr, bis zuletzt. Voller Einsatz, täglicher Kampf.
Inzwischen ist so viel Zeit vergangen, ohne Mia und Gert Bluhm, es ist Frühling, einer der ersten wärmeren Tage. Wir scheinen heute die einzigen Besucher des Friedhofs zu sein. Irgendwo in der Nähe trällert eine Amsel. Es ist, als berge gerade dieser Moment eine tiefere Bedeutung in sich, jeder Ton genau so, wie ich ihn hören möchte, die wärmende Sonne, dazu eine angenehme Stille, Verkehrsgeräusche nur eine Ahnung am Rand unserer Wahrnehmung – vielleicht kommuniziert Gott nicht durch Wunder mit uns, sondern in der Stille zwischen zwei Gedanken?
Am liebsten würde ich jetzt auf einer Bank in der Sonne sitzen, frei von allen Überlegungen, einfach nur Zuhörer.
Jedenfalls mag ich mich nicht mit der Hoffnung trösten, meine Eltern könnten jetzt irgendwo sein, wo es besser und schöner ist als hier. Wo sollte das sein, ohne dieses Leben, das uns früher alle verbunden hat, an den guten und den weniger guten Tagen?
Ich höre jemanden meinen Namen sagen.
Nicole knufft mich.
„Erde an Richard! Bist du noch da?“
Selbst Nicoles Lachen klingt fragend.
Ruth will endlich unsere Entscheidung wissen. Finanziell sei es ziemlich egal. Die Verlängerung der Grabstätten koste fast ebenso viel wie deren Auflösung. Monetäre Erwägungen sollen unser weiteres Vorgehen nicht beeinflussen. Es gehe hauptsächlich darum, das Familiengrab zwanzig Jahre länger zu behalten oder nicht. Es zu pflegen und die Option auf die beiden noch freien Plätze zu wahren.
Nicole meint, ich müsse das entscheiden, weil weder Ruth noch sie einen Platz im Familiengrab beanspruchen.
„Es geht doch nicht nur darum“, entgegne ich gereizt.
„Also, ich brauch keine Gräber, zu denen ich regelmäßig pilgern möchte“, stellt Nicole klar. „Ich weiß echt nicht, was ich auf einem Friedhof soll. Für mich ist das hier irgendwie so ... abstrakt, versteht ihr? All die Gräber, die Steine und Blumen, da bin ich weiter weg von Mama und Papa als sonst wo.“
Ja, das geht mir fast genauso, sofern ich nicht gerade verträumt einer Amsel lausche. Aber aus Nicoles Mund klingen meine Empfindungen ziemlich unsensibel.
Ruth merkt schmallippig an, sich die letzten Jahre ausschließlich allein um die Grabpflege gekümmert zu haben. Natürlich mit Hannes, der Gräber so gewissenhaft pflegt, als könnten Grabsteine verwelken. Aber ohne uns. Das meine sie gar nicht so vorwurfsvoll, wie es vielleicht klänge, aber es sei ein Punkt, der im Zuge weiterer Überlegungen auch eine Rolle spielen sollte.
Stimmt ja. Nicole und ich sind Friedhofsmuffel, obwohl ich zumindest für mich in Anspruch nehmen kann, die Gräber unserer Eltern in meinem Herzen zu pflegen. Bis heute sind sie in mir präsent. So kann ich noch immer keine Arie aus einer Puccini-Oper ertragen, ohne nicht gleich an die mitsummende Mama denken zu müssen, und sobald sich mal ein Werkzeug in meine ungeschickten Hände verirrt, fühle ich mich an Papas Fähigkeiten erinnert, der alles reparieren konnte, immer eine Lösung fand.
Aber auf dem Friedhof geht es mir wie Nicole. Mich ausgerechnet hier und jetzt an die Eltern zu erinnern? Heute gelingt das ausnahmsweise, meistens aber nicht. Es sind nicht immer Amseln da, wenn man eine braucht.
Damit ist die Sache für Ruth vorerst erledigt. Wehmut benötigt sie nicht, muss sie nicht haben. Da würde sie nur wieder an die fast kriegerischen Auseinandersetzungen mit einer schnell überforderten Mutter erinnert werden, als sich Ruths Hormone hauptsächlich in pure Auflehnung umwandelten, und Mama mit aller Härte dagegenhielt, so wie sie es zuvor von der eigenen Mutter erfahren hatte. Es war die Zeit, in der Mutter und Tochter nicht mehr dieselbe Sprache beherrschten, in der sie aneinander vorbeibrüllten und der Konflikt das gesamte Familienleben beeinflusste. Die Zeit, in der Ruth wie eine Wespe wirkte, über die ein Glas gestülpt worden war, während Mama nur noch predigte, mahnte, drohte und prophezeite, und selbst das Richtige zur falschen Zeit.
Worum ging es? Sollte Ruth das Schicksal erspart bleiben, das Ur-Oma Charlotta, Oma Magda und Mutter Mia vor ihr als Befreiung empfunden hatten? Ein Baby in jungen Jahren? Das Ende von ... ja, von was? Bei Charlotta, Magda und Mia war daraus zweifellos ein Anfang geworden, nicht durchweg ein gelungener, aber wenigstens der Beginn von etwas Neuem.
Noch nicht volljährig hatten alle drei früh für Fakten gesorgt. Und genau hier fängt die eigentliche Familiengeschichte an. Wenn das Alter die Jugend ermahnt, seine „Fehler“ nicht zu wiederholen. Die „Fehler“, die älter werden, eigensinnig, aufsässig, die das Recht auf eigene Entscheidungen einfordern, auf eigene Fehler, und damit nichts anderes verlangen als jede Generation zuvor: Freiheit und Vertrauen.
Die von einem Leben träumen, das anfangs viel zu groß für eine kleine Reihenhauswohnung ist.
Plötzlich ist die Amsel verstummt, als sei das genug Zuversicht für heute.
Der Wind frischt auf.
Noch ist keine Entscheidung gefallen.
Vielleicht haben wir auch nicht ernsthaft damit gerechnet. Wenigstens waren wir mal wieder zu fünft. Für kurze Zeit. In meinem Kopf.
Sie müsse sich hinsetzen, stöhnt Ruth und humpelt, ohne Nicoles und meine Reaktion abzuwarten, zur nächsten Bank. Wir folgen der großen Schwester.
Kapitel 2: Überraschungen
September 1934, Hamburg, Magda und Charlotta
Mittagszeit. Sie hatten in der kleinen Wohnung, in der sie nach dem Chaos der letzten Jahre zur Ruhe gekommen waren, Nudeln mit Gulasch gegessen, und es war ihnen gelungen, an diesem Tag endlich mal wieder etwas behutsamer miteinander umzugehen. Charlotta versuchte all das zu verarbeiten, was die junge Tochter ihr da gerade offenbart hatte.
Besonders in der letzten Zeit war Magda oft angespannt gewesen, sich über jede Kleinigkeit ereifernd, getrieben von aggressiver Ungeduld, in ihrer Lage kein Wunder.
Sie pflegte nicht nur seit einiger Zeit ein Verhältnis mit einem älteren und verheirateten Mann. Jetzt vermutete sie zu allem Überfluss, von ihm schwanger geworden zu sein.
Nach dem Essen war die Wahrheit aus ihr herausgeplatzt, provoziert von irgendeiner nebensächlichen Bemerkung ihrer Mutter, die vielleicht gar nicht so gemeint gewesen war. Aber es reichten ja oft Kleinigkeiten für Missverständnisse und Unfrieden zwischen ihnen.
Mit feurigem Blick verteidigte Magda ihre große Liebe, schwärmte von dem Mann, der ihr Herz im Sturm erobert hatte. Ein reifer Mann, ein sensibler, kluger, kultivierter Kopf, einer, der die Visionen Adolf Hitlers teilte und bereit war, für die großen Ziele zu leben und zu kämpfen, die es in nahe Zukunft geben würde. Ein Mann, den sie bis an ihr Lebensende lieben würde.
„Du siehst am hübschesten aus, wenn du zornig bist“, stellte Charlotta fest, während sie mit gekrümmtem Zeigefinger am Tellerrand entlang letzte Reste der Soße vom Gulasch naschte.
Magda hatte sich bei diesen Worten vom Stuhl erhoben, schon wieder in der Verteidigungsposition, ohne angegriffen worden zu sein, enttäuscht von der Ignoranz und Gleichgültigkeit der Mutter.
„Ist das alles, was du dazu zu sagen hast?“, fragte sie.
Charlotta leckte die Soße vom Finger und starrte eine Weile an Magda vorbei gegen die kahle Wand, als habe sie die Frage nicht gehört.
„Ist das derselbe Mann, von dem du mir schon mal erzählt hast? Der Gedichte schreibt?“
„Ja!“, rief Magda verzweifelt. „Natürlich! Es ist immer dieser Mann! Er und sonst keiner!“
„Und jetzt bist du womöglich schwanger? Von dem?“
„Einiges spricht dafür, Mutti. Und wenn es so ist, dann wollen wir alle Hindernisse überwinden und unser Baby haben. Er wird sich scheiden lassen und mich heiraten. Wir werden eine glückliche Familie werden.“
Auch Charlotta erhob sich und begann, den Tisch abzuräumen.
„Der wird sich nicht scheiden lassen“, sagte sie. „Und selbst wenn. Wie könntest du einem wie ihm je trauen. Er verlässt Frau und Kinder für dich. Eines Tages könnte er dich genauso verlassen.“
Fassungslos starrte Magda die Mutter an, hätte ihr am liebsten die Teller aus den Händen gerissen und auf dem Boden zerschmettert.
„Mutti!“
Charlotta stellte Geschirr und Besteck auf die Ablage neben dem Spülbecken und drehte sich zu Magda um.
„Willst du meinen Segen? Geht es dir darum? Den kriegst du nicht. Ich bin gegen diese Beziehung. Ein verheirateter Mann, der dir das Blaue von Himmel verspricht, nur um sich an deiner Jugend zu berauschen. Du hast keine Ahnung von Männern. Oder von der Liebe!“
„Du hast keine Ahnung von der Liebe!“, entgegnete Magda zornig.
„Nur weil dich jeder Mann verlassen hat, musst du nicht glauben, dass mir das auch passiert. Du hast sogar Vati vertrieben!“
Ärgerlich schüttelte Charlotta den Kopf. Schwieg aber. Wie oft hatte die Tochter ihr das schon vorgeworfen? Es hatte einfach keinen Sinn mehr, mit Magda über Rudolf Rogalski zu sprechen. Wenn eine Tochter vor der Wahrheit über den Vater beharrlich die Augen verschloss, konnte man sich als Mutter den Mund fusselig reden. Sie hatte das Kapitel über diesen Kerl abgeschlossen. Ihr Ex-Mann war seit einem Jahr tot, Ende der Geschichte!
Magda setzte sich wieder an den Küchentisch und atmete tief durch. Für einen Moment sah es so aus, als würde sie weinen müssen. Aber sie biss sich auf die Unterlippe.
„Na, das kann ja noch heiter werden die nächste Zeit“, murmelte Charlotta. „Und in drei Monaten wirst du erst zwanzig. Noch habe ich die Verantwortung für dich. Und da lässt du dir ein Kind andrehen, von einem, der fast dein Vater sein könnte. Dazu noch verheiratet. Was geht bloß in deinem Kopf vor?“
„Ich will ausziehen“, sagte Magda. „So bald wie möglich. Hab schon eine kleine Wohnung gefunden. Und ich habe Arbeit. Ich verdiene Geld. Er wird mir auch helfen.“
Charlotta lachte bitter.
„Und was hab ich zu tun?“
„Du musst mich nur gehen lassen. Ich brauche kein Geld und keinen Segen von dir. Nur meine Freiheit. Wenn du als meine Mutter einverstanden bist, kann ich die Wohnung bekommen.“
Später beim Kaffee hatten sich Mutter und Tochter wieder beruhigt. Charlotta versprach Magda, ihr nicht im Weg zu stehen.
„Und werde ich diesen Mann auch mal kennenlernen?“, wollte sie wissen. „Er dürfte ja eher mein Jahrgang sein.“
Aber das kam für Magda nicht in Frage. Erst wollte sie Klarheit. Das Kind bekommen. Seine Scheidung. Und dann so schnell wie möglich die eigene Hochzeit.
„Kurz vor der Hochzeit werde ich ihn dir vorstellen“, versprach sie der Mutter.
Für einen Moment sah es so aus, als wolle Charlotta das noch kommentieren, dann aber verkniff sie sich jedes weitere Wort.
28. Januar 1956, Erlangen, Mia und Magda
Magda starrte ihre ältere Tochter an und hatte plötzlich das Gefühl, mit der eigenen Vergangenheit, dem eigenen Ich konfrontiert zu werden. Genau so jung wie sie vor zwanzig Jahren, nur zeigte Mia nicht diese Willensstärke und Zielstrebigkeit wie sie damals. Magda konnte aus den braunen Augen der hübschen Tochter Unsicherheit und Verwirrung ablesen, aber auch kämpferischen Trotz. Noch nicht volljährig und schon schwanger? Geschichte wiederholte sich. Geschichten wiederholten sich.
Aber was war Magda von der großen Liebe geblieben? Von der jungen Euphorie damals? Am Ende war nichts so wie erhofft verlaufen. Kein Liebesglück, kein Endsieg. Stattdessen hatte der Krieg in Deutschland gewütet, Magda war in Hamburg ausgebombt worden, sie musste die kleine Tochter fortschicken und sich mit allen Mitteln allein durchschlagen – bis das Schicksal ihr noch eine letzte Hoffnung anbot. Der Himmel schickte ihr Erich Meynert.
Wie sollte Magda ihre Tochter einfach nur ansehen, ohne dieses Gefühl des Scheiterns zu spüren, die Zeit der Dunkelheit, die danach so lange in ihr geherrscht hatte? Dabei sah die Tochter dem leiblichen Vater nicht mal ähnlich, hatte auch nicht sein forsches und sprunghaftes Naturell. Sie hatte fast alles von ihr, und trotzdem hatte der einstige Geliebte in Mia etwas Geheimnisvolles hinterlassen. Es war nicht auf den ersten Blick auszumachen, mehr ein Schatten von ihm: einen Hauch seiner gelegentlichen Neigung zur Melancholie oder die Phasen der Unruhe, wenn ihn Kopfschmerzen plagten, oder rastlose Schlaflosigkeit, seltene Momente nur, in denen sie ihn dann doch in der Tochter erahnte, wenn Mia plötzlich abwesend vor sich hin starrte, jeden Blickkontakt vermeidend, nicht so unbeschwert lächelte wie üblich, nach etwas Fremdem in sich zu lauschen schien oder sich ihre Miene verfinsterte.
Magda fand die Tochter hübscher, als sie selbst es mit zwanzig gewesen war. Mia hatte weichere, ebenmäßige Züge, große braune Augen, die vor Lebensfreude nur so sprühen konnten, dunkle Haare und einen fast südländischen Teint.
„Kleine Zigeunerin“, nannte Magdas Mutter Charlotta die Enkelin immer, was als Kompliment gemeint war, denn Charlotta verherrlichte das Zigeunerleben mit operettenhaften Vorstellungen wie Abenteuerlust, Freiheitsliebe und dem Reisen kreuz und quer durch die Welt. Ein Lebenstraum, den sie sich so gern erfüllt hätte.
Nun war die kleine Zigeunerin schwanger. Einfach so. Magda schäumte vor Wut. Diese unreife dumme Göre! Gerade jetzt, wo sie zehn Jahre nach Kriegsende alles dransetzten, hier endlich wieder wegzukommen, raus aus dem fränkisch provinziellen Erlangen und zurück in das großstädtische, weltoffene Hamburg. Dort hatten sie Anspruch auf eine Sozialwohnung, und die waren die letzten Jahre wie Pilze aus Hamburgs Trümmern geschossen. Magda und ihre Mutter Charlotta standen auf entsprechenden Listen, und in regelmäßigen Abständen reisten Magdas Mutter oder Mann Erich in die sich vom Krieg kontinuierlich erholende Hansestadt, um mit Hilfe der bestehenden Ansprüche ein neues Zuhause zu finden, eine Sozialwohnung in der alten Heimat.
Die SAGA baut und baut, hatte Erich gerade in einem Telegramm aus Hamburg vermeldet, wo er sich nicht nur um eine Wohnung bemühte, sondern auch um einen Job. Alle Weichen wurden in Richtung Rückkehr in die Heimat gestellt. Mias Schwangerschaft war das Letzte, was die Familie jetzt gebrauchen konnte.
Mutter und Tochter befanden sich in dem kleinen Raum, der als Küche und als Wohnraum diente, ihr Bereich in einer größeren Wohnung, die sie sich mit zwei anderen Familien teilten. Jede Familie bewohnte zwei Räume, die Toilette wurde gemeinschaftlich genutzt. Irgendwie kam man klar, aber das konnte ja kein Dauerzustand sein. Sich hier auf engstem Raum auf der Pelle zu sitzen zehrte an den Nerven! Für jemanden wie Magda eine besondere Qual, die als Bankierstochter im Wohlstand groß geworden war, mit Köchin, Kindermädchen und Klavierlehrerin, bis ihr Vater das gesamte Vermögen innerhalb kürzester Zeit am Spieltisch durchgebracht hatte. Doch ihren Standesdünkel und den unbedingten Willen, ein eigenes, notfalls kleines Reich für sich und die Familie haben zu wollen, hatte sich Magda immer bewahrt. Sie würde unbeirrt kämpfen, bis sie dieses Ziel erreicht hatte!
„Mein Gott“, seufzte sie und lief in dem kleinen, fast quadratischen notdürftig eingerichteten Raum nervös auf und ab. Keine Lust zu sitzen. Keine Lust, es sich gemütlich zu machen, wie sonst so oft, wenn sich die Gelegenheit bot, auf eine Tasse Kaffee mit der fast erwachsenen Tochter und ein nettes Gespräch über den letzten gemeinsamen Kinobesuch oder ein Buch.
Mit geröteten Wangen saß Mia am Tisch, offensichtlich so bockig wie nie zuvor, aber der Blick immer ausweichend, als ob sie sich schuldig fühlte, es nur nicht zugeben wollte.
Magda blieb vor der Tochter stehen, stemmte die Fäuste in die Hüften.
„Konntest du nicht aufpassen?“
Mia fielen selten gute Antworten ein. Sie konnte munter plaudern und plappern, aber nicht gut argumentieren oder sich wortgewandt verteidigen. Wo hätte sie das auch lernen sollen? Zuhause, wo die Mutter dominierte? In der Schule früher, von den katholischen Mitschülern und Lehrern als einzige Protestantin während der Jahre in Niederbayern gehänselt und verhöhnt? Dort nannte man sie auch „Zigeunerin“, aber das war nicht so lieb gemeint wie von der Oma Charlotta. In der Schule war sie immer die Fremde geblieben, in den Jahren als Flüchtlingskind in Niederbayern, als die Mutti sie so lange nicht mehr besuchte, bis sie das alte Leben nur noch für einen Traum hielt. Überall hieß es nur, den Mund halten zu müssen, das immerhin hatte sie gelernt. Ruhig sein. Brav sein. Maul halten, Zigeunermädchen! Du redest nur, wenn du gefragt wirst!
Wie also sollte Mia jetzt mit der Mutter über das schönste und aufregendste Erlebnis ihres bisherigen Lebens sprechen, über etwas, für das sie selbst keine passenden Worte kannte? Von dem berauschenden Moment, als sie an Gerts Seite plötzlich genau gewusst hatte, was sie wollte und spürte, dass sie es sofort wollte, und nicht erst, wenn ihre Mutter die Zeit für gekommen hielt.
Inzwischen war Magda in Gedanken jene Burschen durchgegangen, die ihrer attraktiven Tochter in der letzten Zeit den Hof gemacht hatten. Gott sei Dank war der versponnene Künstler Franz nicht mehr dabei, der hatte seine Zelte in Erlangen längst endgültig abgebrochen und war in Richtung seiner Träume verschwunden, um am Stadttheater Aachen als Tänzer zu arbeiten. Der hatte Mia nur Flausen in den Kopf gesetzt, von einer gemeinsamen Karriere als Paar, so wie Fred Astaire und Ginger Rogers. Den hatte Magda eigenhändig abserviert. Alberner Traumtänzer mit seinem übertriebenen Künstlergehabe, die Haare so nachlässig gekämmt und dazu immer dieser Schal, als sei er Gott weiß wer.
Mias großem Talent nicht im Wege zu stehen, hatte Franz Magda beschworen.
Papperlapapp, hatte sie gedacht und auch geantwortet, ihre Tochter solle lieber die Kurse in Stenografie und Schreibmaschine erfolgreich beenden, eine solide kaufmännische Ausbildung im Büro beginnen. Und sich einen guten und verlässlichen Mann suchen. Basta!
Auch ohne den Tänzer blieben noch genügend andere Kindsköpfe übrig, jeder auf seine Weise ungeeignet. Wer aber kam in Frage – als derjenige, der es gewagt hatte, Mia die Unschuld zu rauben?
„Du kennst ihn nicht“, sagte Mia leise. „Aber er ist der Einzige, den ich wirklich liebe.“
„Er ist der, der dir ein Kind gemacht hat“, entgegnete Magda unwirsch. „Das zeichnet ihn nicht gerade als verantwortungsbewussten Menschen aus. Wie alt ist der Kerl?“
Mia schwieg.
Magda blieb wieder vor der Tochter stehen, die am Tisch saß und die Hände gefaltet hielt, als bete sie. Für einen Moment sah es so aus, als wolle Magda Mia eine Ohrfeige verpassen, und die schien selbst darauf gefasst zu sein, hob den Kopf und erwiderte mutig den Blick. Schlag mich doch! Stolz funkelte unverhohlen in Mias Augen, die Bereitschaft, notfalls aufzubegehren, endlich. Das Kinn leicht nach vorn gereckt. Fast schien sie zu hoffen, geschlagen zu werden, vielleicht würde das vieles leichter machen. Aber was?
„Wie alt?“, zischte Magda. „Oder habt ihr noch nicht so viel geredet?“
„Neunzehn“, murmelte Mia und senkte den Blick. Eigentlich hatte sie mutig und selbstbewusst auftreten wollen, im Kampf um ihre Liebe, ihr Baby und ihr Leben. Nun aber kam es doch wieder nur kleinlaut über ihre Lippen.
Magda lachte höhnisch und klatschte in die Hände.
„Na wunderbar! Lässt dich von einem dummen Jungen schwängern, blöde Gans!“
Er ist ein toller Mann! Das sagte Mia nicht, dachte es nur. Ein guter Tänzer. Ein großartiger Fußballspieler, über dessen Tore viele Menschen jubelten, sogar kleine Berichte im Sportteil einiger Erlanger Zeitung erschienen. Gert Bluhm, Mittelstürmer. Ein Charmeur. Einer, der andere zum Lachen brachte, Ziehharmonika spielen und dazu singen konnte. Der schon seit seinem fünfzehnten Lebensjahr hart und zuverlässig auf dem Bau schuftete. Und viel erwachsener wirkte als andere seines Jahrgangs, reifer und zielstrebiger. Ein ehrlicher und offener Charakter, der mühelos auch andere Freundinnen hätte haben können, sich aber für Mia entschieden hatte. Seit einigen Monaten waren sie jetzt ein Paar, aber den Neuen hatte sie ganz bewusst von der kritischen Mutter ferngehalten, denn diese Liebe wollte sie sich nicht wieder kaputtmachen und ausreden lassen. Gert gehörte ihr! Und deshalb war es auch nicht er gewesen, der auf die Idee gekommen war, miteinander zu schlafen. Das hatte Mia ganz allein forciert, auch ohne ausreichende Erfahrung genau gewusst, was zu tun war, hatte ihn nach allen ihr bekannten Regeln verführt, es gewollt, ihn gewollt, mit Leib und Seele. Und es hatte sie zutiefst erregt, unvorsichtig zu sein, bis zum Äußersten zu gehen, mit vollem Risiko. Es hatte sie in eine euphorische Stimmung versetzt, aus Magdas Schatten auszubrechen und den ersten Schritt in ein eigenes Leben zu wagen.
Und wie erst hatte sie es genossen, Gert von ihrer Schwangerschaft zu erzählen, plötzlich so erwachsen, stark und mutig, voller Ideen und Pläne, sich seiner Liebe so sicher. Ja, er würde zu ihr halten, zu seiner Verantwortung stehen, sie heiraten und zusammen mit ihr hier in Erlangen leben wollen.
Seine Familie würde ihnen auf jeden Fall helfen, beide unterstützen, da war sich Gert sicher. Natürlich hatte Mia auch eine ungefähre Ahnung, wie ihre Mutter reagieren mochte, aber das war ihr egal.
Magda hatte den Marsch durch die Küche erneut aufgenommen.
„Was weißt du schon von Liebe!“, sagte sie mit harter Stimme und dachte an ihre eigene Tragödie. Die wilde und hemmungslose Affäre mit Mias leiblichen Vater, der seine Träume wie ein Poet zu formulieren verstand, aber dabei war es dann auch geblieben. Ein Meister der Verführung und Liebesschwüre, der sie schwängerte und davon schwärmte, mit ihr und Mia ein gemeinsames Leben zu beginnen. Bis der Staat ihn dazu zwang, reumütig zu Frau und Kindern zurückzukehren, zu seiner Familie. Denn die Familie war im Nationalsozialismus heilig und stand über allem. Da war es vorbei gewesen mit den großen Träumen, den großen Plänen, den großen Worten!
Die junge Magda hatte von nun an ein wenig geachtetes Leben als ledige Mutter führen müssen, in der Wahrnehmung von Staat und Gesellschaft dem einer Hure nicht unähnlich. Und der Geliebte schien die Beziehung zu ihr auf einer ähnlichen Basis fortsetzen zu wollen. Schlich sich gelegentlich in Magdas bescheidenes Dasein, um nach jeder Liebesnacht etwas Geld dazulassen, für sie und seine Tochter, die schon nicht mehr „Vati“ sagte, wenn sie ihn sah. Da hatte Magda ihn endgültig zum Teufel gejagt, um Mia allein und ohne Hilfe durchzubringen; die Tochter, die am Ende das Einzige war, das ihr von dem erhofften großen Glück geblieben war. So vereinten sich in Mia Vergangenheit und Zukunft, und Magda hatte sie mit viel Liebe, aber auch mit Härte aufgezogen.
„Ich hab dir einfach nicht genug Vernunft beigebracht“, klagte sie jetzt und blieb wieder stehen. „Was hat er für einen Beruf?“
„Weiß nicht“, flüsterte Mia.
Jetzt log sie!
Wuchtig schlug Magda mit der Faust auf den Küchentisch, und die Tochter zuckte zusammen. Richtete sich kerzengerade auf, Erwiderte erregt:
„Maurer ist er. Und verdient gutes Geld. Mehr als viele andere.“
„Wer sagt das?“
„Ich ... weiß es. Er lädt mich immer ein. Zum Tanzen. Ins Kino. Zu Kaffee und Kuchen in die Konditorei.“
„So, so. Und dann hast du gedacht, du müsstest dich dafür mal erkenntlich zeigen?“
„Aber Mutti!“
„Jetzt tu nicht so entrüstet. Hast dich benommen wie eine ... läufige Hündin!“
Mia wurde noch röter. Faltete wieder die Hände. Vielleicht betete sie wirklich, dass dieses Gespräch bald vorüber war.
Magda dachte an Hamburg. An die Pläne der Rückkehr. Als Familie. Mit Mann Erich, mit Tochter Mia und mit der kleinen Tochter Sina, die gerade elf Jahre alt war. So war es geplant, so wollte sie es haben und so sollte es passieren. Für Mia hatte sie sich in Hamburg einen gut situierten Kaufmann erhofft, gern etwas älter und dominant, um der verträumten und unerfahrenen Tochter den richtigen Weg zu weisen. Im Idealfall hätte es auch ein Arzt oder Jurist sein dürfen. Hauptsache ein gebildeter Mann in guter beruflicher und gesellschaftlicher Stellung.
Von diesem Ideal war ein neunzehnjähriger Maurer aus einer fränkischen Stadt so weit entfernt, wie die Menschheit von der ersten Mondlandung. Was um Himmels Willen erwartete Mia an der Seite eines solchen Burschen?
Der tanzende Spinner Franz war für Magda schon ein echter Alptraum gewesen, den hatte sie erst in letzter Sekunde verhindern können, da hatte Mia schon heimlich den Koffer gepackt, um bei Nacht und Nebel durchzubrennen.
Aus der Traum, Ginger Rogers!
Aber der Maurer Gert hatte Fakten geschaffen, die sich nicht so leicht ignorieren ließen. Und Mias große Augen glitzerten so eindeutig, wenn sie von ihm sprach. Sie beherrschte den theatralischen Blick ihrer Kinoidole, hatte aber kaum eine Ahnung vom echten Leben jenseits der Leinwand.
Magda setzte sich zu Mia an den Tisch und lockerte deren ineinander verhakte Finger. Es dauerte eine Weile, bis sie Blickkontakt bekam, die Tränen in den Augen der Tochter sah, die Verzweiflung, das ganze Dilemma.
„Hör mir jetzt gut zu, mein Kind“, flüsterte Magda. „Du und dieser Maurer, das hat doch keine Zukunft. Gut, ihr habt eine Dummheit gemacht, das kann vorkommen. Junge Menschen machen Fehler. Es gibt da eine Frau, die könnte uns in diesem Fall ...“
„Nein!“ Entsetzt zog Mia ihre Hände zurück. Sie mochte jung und unerfahren sein, sicher auch naiv, aber von der Frau, die Babys wegmachen konnte, hatte auch sie schon öfter gehört. Mias Ablehnung war das entschlossenste und erwachsenste „Nein“, das Magda je von der Tochter zu hören bekommen hatte. Sie folgte nicht dem Reflex, erneut nach ihren Händen zu greifen, sondern lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust.
„Und wie habt ihr euch das jetzt weiter vorgestellt, du und dein Maurer? Will er dir hier in Erlangen ein Schloss mauern?“
Mia musterte die Mutter, die immer so klug und wortgewandt auftrat, die ihre Dominanz zu dosieren verstand, ebenso wie den scheinbar mühelosen Wechsel von Härte zu Nachgiebigkeit und wieder zurück. Die Mutter, die sie einige Jahre mit Liebesentzug bestraft und um deren Gunst und Zuneigung sie immer und immer wieder gebuhlt hatte. Verzweifelt schloss Mia die Augen und dachte an Gert. Den Mann, den sie mit jeder Faser ihres unbedarften Herzens wollte. Der so viel mehr war als „nur“ der Maurer, den ihre Mutter in ihm sehen wollte.
„Wir werden heiraten“, sagte Mia. „Ich werde unser Baby bekommen, und wir werden uns eine Wohnung suchen.“
„Hier in Erlangen?“
„Natürlich hier! Gerts Familie wird uns helfen, das ist schon mal sicher. Die mögen mich.“
Magda schwieg lange. Ihre Gedanken bewegten sich weit zurück. Fanden einen alten schaukelnden Kahn auf einem See in der Holsteinischen Schweiz, ein engumschlungenes Paar, er in Uniform und mit Orden an der Brust, sie gerade zwanzig, beide voll mit Schlaftabletten. Was war eine Liebe wert, wenn sie nicht in die Welt passte, wenn keiner etwas damit anfangen konnte, außer den beiden Betroffenen?
Wiederholte sich Geschichte wirklich immer wieder? Und wenn ja, warum? Damit sie daraus lernte, indem ihre blutjunge Tochter ihr den wahren Weg zeigte? Mit einem Maurer, der Mia liebte, und dessen Familie, die dem Paar beistehen wollte.
Das war’s, dachte Magda bitter. Da nimmst du alles auf dich, um ein junges Leben zu formen und zu lenken, und dann stehen sie einfach auf und gehen davon.
„Und dann?“, fragte sie ihre Tochter. „Was kommt, nachdem du mit dem Kopf durch die Wand bist? Hast du davon auch nur die geringste Ahnung?“
Mia sah sie verständnislos an.
„Was meinst du?“
„Wo ist mein Platz in deiner Geschichte? Der von deinem Papi? Deinem Schwesterchen Sina? Deiner lieben Omi? Wir sind deine Familie, und wir werden nach Hamburg ziehen, komme was da wolle. Und du willst allein hierbleiben? In Erlangen! Bei deinem Maurer und seiner Familie. Meinst du, das geht?“
Mia öffnete einige Male den Mund und brachte doch keine passende Erwiderung hervor. Erneut kullerten Tränen über ihre roten Wangen.
Magda beugte sich vor.
„Ich mache dir einen Vorschlag, Mia. Du und dein Maurer ...“
„Er heißt Gert!“, warf Mia ärgerlich ein.
Magda nickte.
„Du und dein Gert, ihr seid beide noch nicht volljährig. Das Ganze ist also eine Sache der Eltern. Beide Familien müssen sich zusammensetzen und es besprechen. Und eine Entscheidung fällen. Gemeinsam.“
„Du meinst, gemeinsam mit Gert und mir“, ergänzte Mia.
„Natürlich!“, stimmte Magda im sanften Tonfall zu.
Die Tochter nickte.
„Aber wenn ich in Erlangen bleibe, wirst du mir nicht böse sein, Mutti“, bat sie, die Augen flehend auf Magda gerichtet.
Die beugte sich jetzt so weit vor, dass ihre Gesichter dicht beieinander waren und fixierte Mia mit klarem Blick. Sie sprach deutlich und sehr bestimmt:
„Ich sag dir das nur einmal, Mia, und werde es nicht mehr wiederholen. Bleibst du hier in diesem Kaff, sind wir geschiedene Leute. Dann hast du keine Familie mehr, keine Mutti, keinen Papi, keine Sina und keine Omi. Niemand von uns wird euch hier besuchen, und in Hamburg seid ihr nicht willkommen. Ich sag das so klar und deutlich, damit du von Anfang an weißt, woran du bist. Ich habe nicht mein halbes Leben lang für eine Tochter Entbehrungen ertragen und Opfer gebracht, damit die ihre Zukunft dann hier in dieser ... Provinz vergeudet, sich einem kleinen Handwerker an den Hals wirft. Und wenn du hier bleiben möchtest, dann trennen uns zukünftig mehr als nur sechshundert Kilometer, verstanden?“
Mia murmelte etwas, das Magda nicht verstand, deshalb fragte sie noch einmal nach, die Hand hinter das Ohr haltend.
„Es sind sechshundertvierundzwanzig Kilometer von hier bis Hamburg“, erwiderte Mia leise. „Sagt Gert.“
Magda erhob sich und verließ ohne ein weiteres Wort den Raum.
Kapitel 3: Leben und Tod
Gegenwart, Hamburg Niendorf, Ruth und Richard
Nach dem Besuch des Familiengrabs wollen wir noch zu Ruth. Sie wohnt nicht weit vom Niendorfer Friedhof entfernt. Mit dem Taxi geht das schnell. Aber Nicole möchte lieber nach Hause. Ihr Bedarf an familiärer Nähe ist vorerst gedeckt. Sie ist mit dem Fahrrad da und verlässt uns Richtung Eppendorf. Ruth und ich schauen ihr hinterher, wie sie entschlossen davonradelt. Ich würde zu diesem Bild gern etwas Tiefgründiges anmerken, aber mir fällt nichts ein. Das ist einfach unsere jüngere Schwester – von hinten, auf dem Weg aus der Geschichte.
Ruth lebt in einem Haus, das ihr gut situierter Mann Hannes gleich nach der Hochzeit um die Jahrtausendwende in Niendorf gekauft hat. Für ihn gehören Familie und ein eigenes Heim untrennbar zusammen. Das eigene Nest als Lebensprinzip. Inzwischen sind die letzten Kinder ausgezogen. Im Anschluss haben die Enkel Zeit und Raum der Großeltern zurückerobert. Aber heute Nachmittag ist niemand da. Die Stille in diesem Haus, das vor lebhaftem Familientreiben zeitweise aus allen Fugen zu platzen drohte, ist fast unwirklich. Hannes ist mit zweien der vier Enkelkinder im Hallenbad, will danach noch einen seiner Söhne besuchen. Familyman on tour – das kann dauern. Er hat immer was auf dem Zettel. Ruth sagt, er brauche es, gebraucht zu werden.
Meine Schwester kocht uns Kaffee. Ich helfe ihr, indem ich ihr nicht helfe. Sie ist trotz der Krücken recht behände und bewegt sich in der offenen Küche zielstrebig und sicher hin und her. Seltsamerweise ist sie mir auf Krücken, mit Gipsbein oder Gipsarm, hinkend, gebeugt laufend oder sonst wie beeinträchtigt, vjeher viel vertrauter als ohne Handicap. Ihr Leben war immer von ungewöhnlichen und seltenen Erkrankungen oder Unfällen geprägt – und von dem Willen, sich von nichts und niemandem unterkriegen zu lassen, in einem Stimmungsbereich zwischen Zuversicht und Galgenhumor.
Kuchen habe sie keinen, ruft sie mir gerade bedauernd aus der Küche zu. Nur Kekse.
Kekse sind doch super!
Früher war das nachmittägliche Käffchen mit einem Stück Kuchen in unserer Familie Tradition, ganz besonders an den Wochenenden. Aber meine Mutter und Oma Magda pflegten auch in der Woche gegenseitige Besuche zum Käffchen, und bei unseren Erlanger Großeltern Robert und Rebekka Bluhm war die tägliche Kaffeezeit mit selbst gebackenen Obstkuchen oder Marmorkuchen ebenfalls ein unverzichtbares Ritual.
Die Kaffeezeit am Nachmittag galt als vierte Mahlzeit des Tages, an den Wochenenden gern auch mal in Verbindung mit einem Sonntagnachmittagsfilm, einer netten, familiengerechten Komödie mit Doris Day oder einem kunterbunten Abenteuerfilm, Robin Hood oder Der Rote Korsar.
Sie zählen in meiner Erinnerung zu den glücklichsten Momenten meiner Kindheit, in Erlangen, mit einem von reichlich Sahne bedecktem Stück Obstkuchen auf dem Teppich vor dem Fernsehgerät meiner Großeltern zu lümmeln, Burt Lancasters Mut und Verwegenheit zu bewundern oder mich über Rock Hudsons Unbeholfenheit beim unfreiwilligen Angeln zu amüsieren, mit der gesamten Familie in meinem Rücken, auf Sofa, Sesseln und Stühlen verteilt, herzlich lachend.
Ich frage meine Schwester, ob sie noch oft an früher denke.
Sie bleibt stehen, verharrt in der Mitte der Küche auf eine Krücke gestützt. Es scheint eher so, als würde sie etwas suchen und nicht über meine Frage nachdenken. Irgendwann klärt sich ihr Blick, sie setzt sich wieder in Bewegung und will über die Schulter hinweg wissen, was ich gerade gefragt habe.
Ich kenne solche Momente auch aus dem Zusammenleben mit Christine. Situationen, in denen ich mir über den Sinn des Lebens den Kopf zerbreche, während meine Frau überlegt, wo sie die besonders hübsche Schale ihrer Großmutter für die Kekse gelassen hat.
„Ob du noch an früher denkst!“, wiederhole ich in einer Vorstufe zur Gebärdensprache.
„An welches Früher?“, will Ruth wissen, mit einer besonders hübschen Schale in der Hand. „Ich habe inzwischen jede Menge davon.“
Als wir noch Kinder waren. Zum Beispiel in Erlangen. Während der Sommerferien. Bei Oma und Opa. Ich als Ameisenforscher und Ruth eingelullt von Oma Rebekkas Liebe.
Meine Schwester tritt an einen Schrank, öffnet die Tür und holt eine Keksdose hervor. Jetzt kann ich mich doch noch nützlich machen. Springe auf, nehme ihr Dose und Schale ab, fülle unter ihrem kritischen Blick einige Kekse um, verstaue die Dose wieder an ihrem gewohnten Platz und trage die Schale zum Wohnzimmertisch. Alles unfallfrei!
„Ach Richard“, sagt Ruth. „Ich hab so viel um die Ohren, meine Zeit reicht kaum für die Gegenwart. Warum beschäftigt dich das plötzlich wieder so? Das kann doch nicht damit zusammenhängen, dass du nach zehn Jahren wieder auf dem Friedhof warst.“
Sie hat es vielleicht vergessen, deshalb erinnere ich sie noch einmal. Damals, als Oma Magda Mitte der Neunzigerjahre starb, sicherte ich mir einen mit alten Familiendokumenten vollgestopften Karton. Darin befanden sich auch Notizbücher, zweiundvierzig Jahre lückenlos geführte Tagebücher von Oma Magda, ein hundert Seiten umfassender Lebensbericht unserer Uroma Charlotta und einige sporadisch geschriebene Tagebücher unserer Mutter Mia. Dazu unangenehm pathetische Texte des ominösen Erzeugers unserer Mutter, für den ich das Wort „Vater“ nach meinem aktuellen Wissenstands nicht mehr in den Mund nehmen mag.
Damals war ich nicht in der Lage, mich mit den gesammelten Erinnerungen intensiver zu beschäftigen, weder zeitlich noch seelisch, und verstaute den Karton im hintersten Winkel meines Daseins, so wie auch die alten Fotoalben und Dias. Eines jener Projekte, die ich auf das Rentnerdasein verschieben wollte.
„Warum nicht früher?“, fragt mich Ruth, da sitzen wir im Wohnbereich mit gefüllten Kaffeetassen vor uns, und sie kann endlich seufzend ihr Bein hochlegen und die Hüfte entlasten.
Ich erwähne das Unbehagen vor zu intimen Informationen, die in den Büchern hätten stehen können. Die mich nichts angehen. Ereignisse, von denen wir nichts wissen, vielleicht nichts wissen wollen, die unsere Familie in einem anderen Licht erscheinen lassen könnten, in keinem guten. Gedanken unserer Vorfahren, von denen die Verfasserinnen möglicherweise nicht wollten, dass andere sie lesen.
„Zum einen das“, sage ich. „Und zum anderen schien mir auch die Zeit noch nicht reif dafür.“
„Wie feinfühlig von dir“, bemerkt Ruth belustigt, aber ihr Lächeln wirkt entwaffnend. „Ich denke allerdings, wer etwas aufschreibt, der will auch, dass es gelesen wird, meinst du nicht?“
„Du hättest den Karton auch haben können“, sage ich.
„Gott bewahre!“, ruft sie aus. „Ich hab echt genug am Hals.“
Also habe ich kürzlich damit begonnen, mich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Einzig sinnvolle Zielsetzung: Wenn nicht jetzt, wann dann?
Vor lauter aufgeschobener Projekte kann ich die Zukunft ja kaum noch sehen.
Ruth beobachtet mich, an einem Keks knabbernd, als erwarte sie jetzt den großen Monolog, als rechne sie mit einer Menge überraschender Details aus dem Leben unserer Familie. Aber damit kann ich noch nicht dienen. Ohnehin ist es oft die Alltäglichkeit mit normalen Sorgen und Nöten, den kleinen Glücksmomenten, der Kampf um das Vorankommen im Leben, was mich in den alten Aufzeichnungen fasziniert. Dass Großeltern und Eltern auch mal jung und unvernünftig waren, ihren Träumen und Plänen nachjagten, Dummheiten machten, älter wurden, um verpasste Chancen trauerten. Niemand von uns hat den Mount Everest bezwungen, ist auf dem Mond gelandet, hat sich durch eine Heldentat hervorgetan. Aber wir alle wollen etwas erreichen, etwas werden, stolz auf etwas zurückblicken, ein wenig Unsterblichkeit hinterlassen.
„Ich bin noch mittendrin“, erkläre ich Ruth. „Oma Magdas Tagebücher sind in Sütterlinschrift verfasst, das liest sich fast wie eine Fremdsprache. Glücklicherweise schreibt sie weitgehend nüchtern und einfach, natürlich nicht ohne Emotionen. Bisher aber noch skandalfrei.“
„Was hast du denn erwartet?“
„Keine Ahnung. Aber vielleicht etwas, das man von seiner Großmutter lieber nicht lesen möchte.“
Ruth lacht.
„Affären? Pikante Geheimnisse aus ihrem Liebesleben mit Opa Erich?“
„Quatsch! Aber es könnte ja auch was zu Privates drinstehen.“
Bisher jedenfalls war das noch nicht der Fall, und so habe ich mich immer tiefer in das Damals hineingelesen, bin in Oma Magdas Gedanken eingetaucht, hab ihren Blickwinkel übernommen, auf das Leben, auf unserer aller Leben, auf die Familie, auf Kinder und Kindeskinder, wie wir in Omas Wahrnehmung erwachsen wurden.
Schließlich vertraue ich Ruth an, ein Buch schreiben zu wollen. Diese vielen Momente und Informationen über die Familie festzuhalten, die dürfen nicht einfach so verloren gehen. Seit ich mit dem Sichten unserer Vergangenheit begonnen habe, fühle ich mich für ihr Überleben verantwortlich. Wir sind das letzte Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft. Nach uns geht der Schatz einer umfangreich dokumentierten Familiengeschichte verloren, das Wissen über drei Generationen. Dieser Zweig bricht ab und gerät für immer in Vergessenheit. Menschen verschwinden. Gräber. Erinnerungen. Wir verschwinden!
„Ja“, sagt Ruth. „So ist das. Gestern war ich das kleine Mädchen mit aufgeschlagenen Knien, heute bin ich die Oma mit den kaputten Hüften. Ich weiß auch nicht, wie es so weit kommen konnte.“
Und das soll alles gewesen sein?
Meine Schwester zuckt mit den Achseln.
„Was erwartest du? Ein großes Feuerwerk zum Abschluss?“
Möglicherweise bereite ich es gerade vor.
Ich denke an das, was ich bisher aus den Unterlagen herausgefunden habe. Es beschäftigt mich mehr als mir lieb ist. Meine Frau Christine meint, seit ich damit begonnen habe, die Aufzeichnungen und Tagebücher zu studieren, hätte ich mich verändert, schliefe unruhiger und rede im Schlaf unverständliches Zeug. Vermutlich in Sütterlin.
Den selbst verfassten Lebensbericht unserer Uroma Charlotta Rogalski habe ich an nur einem Tag verschlungen, ich konnte nicht mehr damit aufhören.
Bei der Erwähnung ihres Namens lächelt Ruth versonnen. An unsere Uroma kann sie sich noch gut erinnern. Mit der sei sie im Zirkus und im Tierpark Hagenbeck gewesen, und auch mal in deren Wohnung, die voller Raubkatzen aus Porzellan, Glas und Stoff gewesen sei, und gerahmte Fotos hätten überall gestanden und gehangen, ebenfalls vorwiegend Aufnahmen von Löwen und Tigern. Das sei keine Wohnung mehr gewesen, sondern ein Museum.
„Uroma hatte freundliche Augen und ein liebes Lächeln“, erinnert sich Ruth. „Silbergraue Haare, hat sich immer auffallend chic gekleidet, und dann sind wir losgezogen.“
Ich weiß das. Die Aufzeichnung unserer Uroma bestätigen Ruths Erinnerungen. Ich kenne Charlotta Rogalski inzwischen so gut, als sei sie meine Erfindung. Eine meiner Romanfiguren. Ich bin ihr gefolgt. War an ihrer Seite. Hab sie begleitet. Sie verloren und wiedergefunden.
„Und darüber willst du schreiben?“, fragt Ruth ein wenig zweifelnd. „Wie wirst du das anstellen?“
Genau das ist der Punkt. Über die Ereignisse zu lesen, ist eine Sache, sich hineinzudenken nur ein Zwischenschritt. Der Kopf speichert Informationen, aber die Fantasie muss Mut und Neugier entwickeln, um weitere Türen aufzustoßen, zugewachsene Pfade erkunden. Im Grunde möchte ich unsere Vorfahren wieder zum Leben erwecken.
Als ich vor einigen Tagen die ersten Sätze meines Projektes aufschrieb, war ich es noch selbst – Richard Bluhm – der vor dem Computer saß, dessen Finger sich über die Tastatur bewegten, als suchten sie von Stein zu Stein über einen Bach den besten Weg zur anderen Seite. Inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, wer diese Geschichte tatsächlich lenkt. Die Stimmen haben sich verstärkt. Bilder fügen sich wie von selbst zusammen. Die Figuren gehen voran, ich brauche ihnen nur noch zu folgen.
Juli 1927, Hamburg, Charlotta