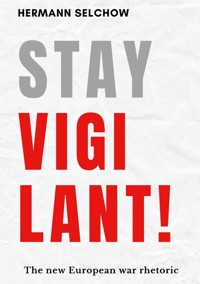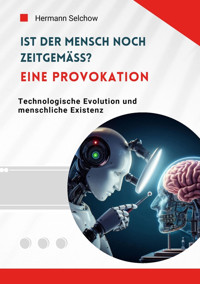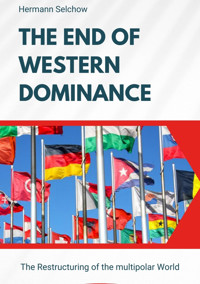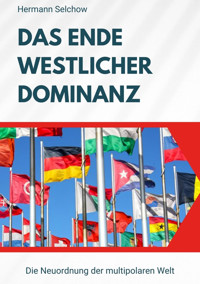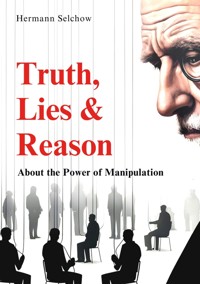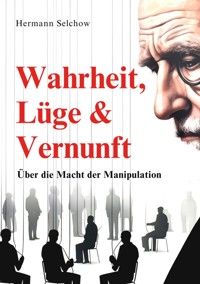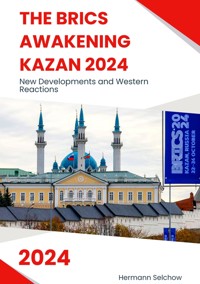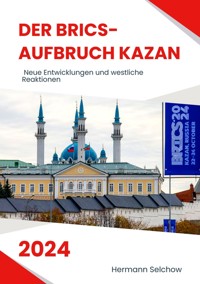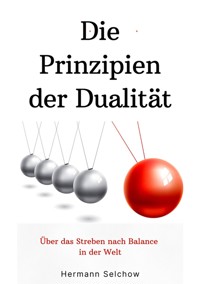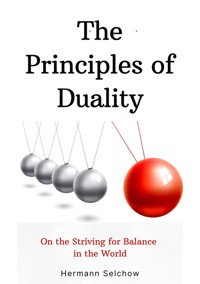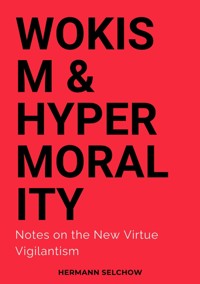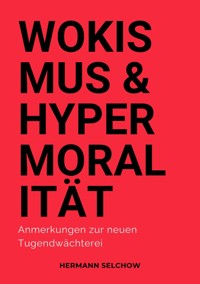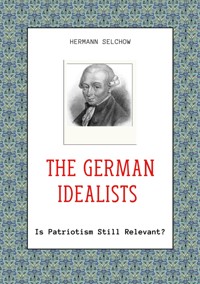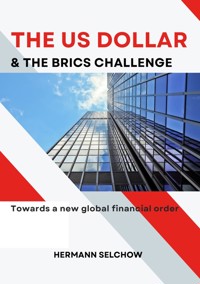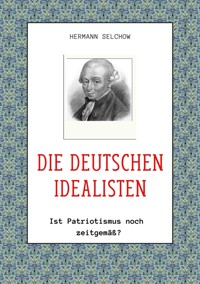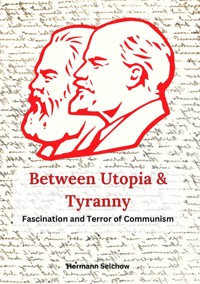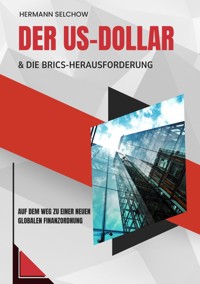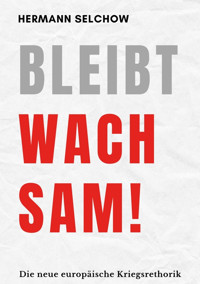
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bleibt wachsam! – Die neue Kriegsrhetorik in Europa Wie Feindbilder entstehen, wer davon profitiert – und wie wir den Weg zum Frieden erhalten können In einer Zeit geopolitischer Spannungen und medialer Dauerkrisen dominiert eine gefährliche Sprache unsere politische Landschaft: Kriegsrhetorik. Doch wie entstehen diese Narrative? Wer konstruiert Feindbilder – und aus welchem Interesse heraus? „Bleibt wachsam!“ nimmt Sie mit auf eine fundierte, schonungslose Analyse der gegenwärtigen politischen Kommunikation in Europa und deckt auf, welche wirtschaftlichen und strategischen Kräfte hinter dem aggressiven Kurs der EU stehen. - Wer sind die eigentlichen Profiteure der Kriegsrhetorik? - Welche Rolle spielen Medien, Wirtschaft und transatlantische Netzwerke? - Wie beeinflussen Angst und Propaganda unsere Wahrnehmung? - Warum sind manche Menschen anfälliger für diese Narrative als andere? - Welche Alternativen gibt es für eine friedlichere, diplomatische Zukunft? Dieses Buch verbindet politikwissenschaftliche Analyse mit spannendem Storytelling und zeigt nicht nur die Mechanismen hinter der aktuellen Eskalationsrhetorik, sondern bietet auch Lösungen an: Wie kann Europa zurück zu einer Politik des Dialogs, der Diplomatie und der Kooperation finden? Und welche Rolle können wir als Bürger dabei spielen? Für alle, die die Welt hinter den Schlagzeilen verstehen und sich nicht von einfachen Feindbildern leiten lassen wollen. Jetzt lesen und mitreden – denn Frieden beginnt mit Wissen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bleibt wachsam!
Die neue europäische Kriegsrhetorik
© 2025 Hermann Selchow
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926
Inhaltsverzeichnis
Einleitung9
Die Sprache des Krieges und die Phase der Annäherung
Die EU als Friedensprojekt? Widersprüche in der Außenpolitik
Die EU und die Konstruktion von Feindbildern – Wer profitiert?
Die USA unter der Trump – Neue Rhetorik gegenüber den Vereinigten Staaten
Die EU und die Konstruktion von Feindbildern – Wer profitiert?
Die Verstrickung deutscher und EU-Politiker in geopolitische Geschäfte
Feindrhetorik und Bevölkerung: Wie Narrative Ängste schüren
Warum manche Menschen anfälliger für Feindrhetorik sind als andere
Ursachen politischer Restriktionen nach Innen
Wir sind nicht wehrlos!
Die Zukunft der Kriegsrhetorik in Europa – Rückkehr zum Miteinander?
Über die Voraussetzungen für einen Wandel
Gegenentwürfe für ein Miteinander statt Gegeneinander
Der Preis der Abschreckung aus politischer und wirtschaftlicher Sicht
Widerstand und Zustimmung – Reaktionen in der Zivilbevölkerung
NATO-Connection: Wo endet EU und wo beginnt Transatlantik
Die globale Wahrnehmung der EU
Zukunftsszenarien zu einer Rückkehr zum Geist der EWG
Die De-Ideologisierung als neue Strategie in Europa: Fakten statt Emotionen?
Ein neuer Pazifismus? Chancen für eine friedlichere Kommunikation
Der Beitrag des Einzelnen und der Gesellschaft
Schlussappell - Bleibt wachsam!
Ebenfalls von mir erschienen:
Bleibt wachsam!
Die neue europäische Kriegsrhetorik
Einleitung
Europa hat sich lange Zeit gerühmt bezüglich seiner friedlichen Integration und der Überwindung historischer Feindseligkeiten. Doch ein genauer Blick auf gegenwärtige politische Debatten, Medienberichterstattung und außenpolitische Strategien offenbart wieder eine tief verwurzelte Kriegsrhetorik, die trotz diplomatischer Fassade wieder entsteht. Dieser Sprachgebrauch dient nicht nur der Rechtfertigung militärischer Interventionen, sondern beeinflusst auch das öffentliche Bewusstsein und prägt das Bild von „Freunden“ und „Feinden“.
Während des Kalten Krieges dominierten Begriffe wie „Eiserner Vorhang“ und „kommunistische Bedrohung“ die westliche Wahrnehmung. Nach dem Fall der Berliner Mauer hätte man erwarten können, dass Europa eine lange Ära friedlicher Rhetorik einläutet. Doch stattdessen wandelten sich die Narrative lediglich – von der Angst vor dem Kommunismus zur Bedrohung durch Terrorismus, Russlands oder anderer geopolitische Rivalen. Die Sprache wurde wieder kriegerisch, wenn auch subtiler und mit modernen Begriffen verschleiert.
Die Medien spielen dabei eine zentrale Rolle. Berichterstattung über Konflikte ist selten neutral – sie folgt oft einer vorgegebenen Agenda, die bestimmte Akteure als Aggressoren oder Verteidiger darstellt. Begriffe wie „humanitäre Intervention“, „präventive Verteidigung“ oder „Stabilisierungseinsätze“ sind Euphemismen, die militärische Aktionen harmloser erscheinen lassen, als sie tatsächlich sind.
Politiker nutzen seit einigen Jahren gezielt Sprache, um Kriegsbereitschaft in der Bevölkerung zu erzeugen. Feindbilder werden konstruiert oder aufgebauscht, indem Staaten oder politische Bewegungen als existenzielle Bedrohung dargestellt werden. So wird die öffentliche Meinung in eine Richtung gelenkt, die militärische Maßnahmen legitimieren sollen.
Die Sprache des Krieges hat sich zunehmend wieder in unseren Alltag eingeschlichen. Formulierungen wie "Verteidigungsbereitschaft stärken", "Kriegsfähigkeit", "strategische Autonomie" und "Abschreckungspotential" sind nicht mehr auf die Fachliteratur der Sicherheitspolitik beschränkt, sondern haben Einzug in die Morgenlektüre von Millionen Europäern gehalten.
"Bleibt wachsam!" ist keine Kampfschrift. Es ist auch kein Plädoyer für naiven Pazifismus. Vielmehr versteht sich dieses Buch als ein Weckruf zur kritischen Reflexion über die Art und Weise, wie wir in Europa über Sicherheit, Konflikte und internationale Beziehungen sprechen. Die Sprache, die wir verwenden, ist nicht mehr von Neutralität geprägt. Sie formt unser Denken, beeinflusst unsere Wahrnehmung und bereitet den Boden für politisches Handeln.
Die Geschichte hat uns gelehrt, dass Worte den Waffen oft vorausgehen. Bevor Grenzen mit Panzern überschritten werden, werden sie in den Köpfen neu gezogen. Bevor Bomben fallen, werden Feindbilder konstruiert. Die Rhetorik der Feindseligkeit, der Abgrenzung und der Unvereinbarkeit bereitet den Weg für die Logik des Krieges. Europa, ein Kontinent, der im 20. Jahrhundert die verheerendsten Konflikte der Menschheitsgeschichte erlebt und verursacht hat, entwickelte nach 1945 eine politische Kultur, die auf Ausgleich, Dialog und Integration setzte. Diese Kultur spiegelte sich in einer Sprache wider, die das Gemeinsame betonte und nach Kompromissen suchte.
In den letzten Jahren jedoch beobachten wir eine zunehmende Militarisierung unserer Sprache und unseres Denkens. Dieser Wandel vollzieht sich nicht im luftleeren Raum. Er ist eingebettet in tiefgreifende geopolitische Verschiebungen, in die Erosion internationaler Ordnungsstrukturen, in ein wachsendes Gefühl der Unsicherheit. Die neue Kriegsrhetorik ist ein Symptom dieser Veränderungen – aber sie verstärkt sie auch und kann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden, wenn wir nicht alle wachsam bleiben.
Besonders faszinierend ist für mich die historische Dimension der gegenwärtigen Entwicklung in der Welt. Auf der einen Seite sind die Parallelen zu früheren Perioden der europäischen Geschichte frappierend – auf der anderen Seite sind die Unterschiede mindestens ebenso aufschlussreich. Gerade in Deutschland, wo die Erinnerung an zwei Weltkriege tief im kollektiven Gedächtnis verankert ist, vollzieht sich der rhetorische Wandel rascher und offensiver als in anderen Teilen Europas.
Mit diesem Buch geht mir nicht darum, eine bestimmte sicherheitspolitische Position zu propagieren. Vielmehr will ich einen Raum öffnen für eine bewusstere Auseinandersetzung mit unserer Sprache und den Weltbildern, die sie transportiert. Die Leserinnen und Leser dieses Buches werden eingeladen, genauer hinzuhören und hinzusehen – auf die Worte, die von Politikern, Experten und Medien gewählt werden, aber auch auf die eigenen sprachlichen Gewohnheiten.
Die folgenden Kapitel bieten einen Blick auf die sich öffnenden Landschaften der europäischen Kriegsrhetorik. Wir werden untersuchen, wie sich die Sprache innerhalb der Europäischen Union verändert hat, welche Rolle die Medien in der Verbreitung und Normalisierung bestimmter Sprachmuster spielen und wie sich die öffentliche Meinung unter dem Einfluss dieser Rhetorik verändert.
Ein besonderes Augenmerk lege ich auf die Narrative und Sprachformen, die es ermöglichen, über Kriegsvorbereitungen zu sprechen, ohne der Logik des Friedenserhalts und Diplomatie zu folgen. Denn es gibt sie: die Sprache der Kooperation, der gemeinsamen Sicherheit, der präventiven Diplomatie. Sie ist keine naive Utopie, sondern hat in der europäischen Geschichte immer wieder praktische Wirksamkeit bewiesen.
Dieses Buch ist entstanden aus einer tiefen Sorge um die Zukunft Europas – aber auch aus der Überzeugung, dass wir als Bürgerinnen und Bürger nicht machtlos sind gegenüber den Strömungen der Zeit. Indem wir uns der Macht der Sprache bewusstwerden, gewinnen wir einen Teil dieser Macht zurück. Kritisches Denken beginnt mit kritischem Hören und Lesen.
"Bleibt wachsam!" ist daher mehr als ein Buchtitel – es ist eine Aufforderung zur intellektuellen Wachsamkeit in Zeiten, in denen das Denken in Schwarz-Weiß-Kategorien wieder an Boden gewinnt. Es ist eine Einladung, der Komplexität der Welt standzuhalten und einfachen Erklärungen zu misstrauen. Und es ist ein Appell, die Sprache als das zu erkennen, was sie ist: nicht nur ein Spiegel der Realität, sondern ein mächtiges aber nicht unüberwindbares Werkzeug zu ihrer Gestaltung.
Ich danke allen, die mich auf dem Weg zu diesem Buch begleitet und unterstützt haben – den Gesprächspartnern, die ihr Wissen mit mir geteilt haben und vor Allem den kritischen Lesern meiner bereits erschienenen Bücher. Ein besonderer Dank gilt jenen Stimmen in Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die unermüdlich für eine differenzierte Sicherheitsdebatte eintreten – neuerdings wieder gegen den Strom der Zeit. Möge dieses Buch einen Beitrag leisten zu einer bewussteren, reflektierteren Kommunikation über diese erneut erwachende Herausforderung in unserer Zeit. Denn die Art, wie wir über die Welt denken und sprechen, entscheidet mit darüber, in welcher Welt wir leben werden.
Hermann Selchow
Die Sprache des Krieges und die Phase der Annäherung
Nach dem Ende des Kalten Krieges schien die Welt an einem historischen Wendepunkt zu stehen. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 und der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 eröffnete sich eine neue Ära der internationalen Beziehungen. Statt Konfrontation zwischen Ost und West wurde plötzlich über Partnerschaft, wirtschaftliche Kooperation und eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur gesprochen. Die Kriegsrhetorik der Jahrzehnte zuvor wich – zumindest vordergründig – einem neuen, hoffnungsvollen Diskurs der Verständigung.
Gerade Europa spielte eine entscheidende Rolle in dieser Entwicklung. Die Europäische Union erweiterte sich nach Osten, ehemalige Ostblockstaaten traten der NATO und später der EU bei, und in Russland selbst versuchten Reformpolitiker, das Land in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft zu führen. Eine Schlüsselphase dieser Annäherung waren die späten 1990er Jahre bis in die frühen 2000er Jahre – eine Zeit, in der auch Wladimir Putin als neuer russischer Präsident in Richtung diplomatische Offensive ging.
Am 25. September 2001 hielt Wladimir Putin eine historische Rede vor dem Deutschen Bundestag – auf Deutsch. Es war das erste und bislang einzige Mal, dass ein russischer Staatschef dieses Privileg erhielt. Der Kontext der Rede war bemerkenswert: Nur wenige Wochen zuvor hatten die Terroranschläge vom 11. September die geopolitische Landschaft erschüttert. Die Welt stand vor neuen Unsicherheiten, und Putin nutzte diesen Moment, um eine enge Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa zu anzuregen.
Seine Rede war geprägt von Versöhnung, Respekt und der Aussicht auf eine gemeinsame Zukunft. Er betonte die historischen Bindungen zwischen Russland und Deutschland und sprach von einer Einigungsbewegung in Europa, die nicht vor Russlands Grenzen haltmachen dürfe. Russland, so Putin, wolle ein verlässlicher Partner des Westens sein und seine Beziehungen zur Europäischen Union vertiefen.
Putins Worte fanden breite Zustimmung. Deutsche Politiker und Medien lobten seine Rede als historisch und wegweisend. Sie schien den Geist einer neuen Zeit zu verkörpern, in der die jahrzehntelangen Blockaden der Vergangenheit überwunden werden konnten. Sogar über eine potenzielle EU-Annäherung Russlands wurde spekuliert.
Die enge Beziehung zwischen Deutschland und Russland hatte historische Wurzeln. Bereits unter Bundeskanzler Helmut Kohl und später unter Gerhard Schröder gab es intensive wirtschaftliche Kooperationen, insbesondere im Energiesektor. Russland wurde zu einem der wichtigsten Gaslieferanten für Deutschland, und Projekte wie Nord Stream waren ein Symbol für die enge Verzahnung beider Länder.
Auch zu Österreich gab es enge Beziehungen. Putin besuchte Wien mehrfach, und die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Russland und Österreich blieben auch nach dem Ende des Kalten Krieges stark. Österreich versuchte traditionell, eine Brückenfunktion zwischen Ost und West einzunehmen – ein Ansatz, der besonders in den 1990er und frühen 2000er Jahren betont wurde.
Doch trotz dieser Annäherungen gab es auch Misstöne. Die NATO-Osterweiterung wurde von Moskau zunehmend kritisch gesehen. Während der Westen argumentierte, dass diese Erweiterung eine natürliche Folge der Demokratisierung Osteuropas sei, empfand Russland sie als strategische Bedrohung. Putin selbst äußerte später, dass Russland sich von den USA und der NATO zunehmend an den Rand gedrängt fühlte.
Die frühen 2000er Jahre waren eine Übergangszeit. Die positiven Signale aus Putins Bundestagsrede verblassten allmählich, und die geopolitischen Realitäten holten die großen Visionen ein. Spätestens mit der NATO-Intervention im Kosovo 1999, der Irak-Invasion 2003 und der Farbrevolution in der Ukraine 2004 begannen sich die Spannungen zwischen Russland und dem Westen wieder zu verschärfen.
Die Sprache der Diplomatie, die noch in den 1990ern von Annäherung geprägt war, wandelte sich. Russland sprach nun von westlicher Einmischung, während der Westen Russland als autoritärer werdenden Staat bezeichnete. Die Rhetorik des Krieges kehrte langsam zurück, wenn auch in neuen Formen – nicht mehr als Kalter Krieg, sondern als geopolitische Konkurrenz, die sich zunehmend in wirtschaftlichen und militärischen Spannungen ausdrückte.
Während des Kalten Krieges war die Rhetorik des Westens von der Gegenüberstellung von Demokratie und Kommunismus geprägt. Der freie Westen stand der sowjetischen Diktatur gegenüber, und dieses ideologische Feindbild war fester Bestandteil der politischen Kommunikation in den USA und Europa. Nach 1991 wurde diese Dichotomie zunächst überflüssig – doch schon bald entwickelte sich eine neue Sprachstrategie, die den Westen als Hüter einer regelbasierten Weltordnung präsentierte.
Die Begriffe veränderten sich: Statt vom „Kampf gegen den Kommunismus“ sprach man nun von der „Verteidigung der Demokratie“ oder der „Förderung von Menschenrechten“. Militärische Interventionen wurden nicht mehr als konfrontative Kriegsakte dargestellt, sondern als „humanitäre Einsätze“ oder „Stabilisierungsmissionen“. Dieser rhetorische Wandel war entscheidend, um militärische Maßnahmen in der post-kalten Kriegswelt zu legitimieren.
Ein markantes Beispiel für diese neue Kriegsrhetorik war der NATO-Einsatz im Kosovo 1999. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte führte die NATO eine militärische Operation ohne UN-Mandat durch – unter dem Argument, dass es darum gehe, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Die Begriffe „Schutzverantwortung“ (Responsibility to Protect, R2P) und „humanitäre Intervention“ wurden in den politischen Diskurs eingeführt und dienten als neue Rechtfertigung für militärisches Eingreifen.
Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 setzte sich diese Entwicklung fort. Der „Kampf gegen den Terror“ ersetzte endgültig die frühere Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Der Krieg in Afghanistan (2001) und die Invasion des Irak (2003) wurden mit der Notwendigkeit begründet, den internationalen Terrorismus zu bekämpfen und autoritäre Regime zu stürzen. Die Sprache dieser Zeit war geprägt von Begriffen wie „Achse des Bösen“, „Schurkenstaaten“ und „Krieg gegen den Terror“ – eine Rhetorik, die erneut eine Dichotomie zwischen „Gut“ und „Böse“ schuf und militärische Maßnahmen als moralisch gerechtfertigt darstellte.
In den 1990er Jahren war Russland noch bemüht, sich in die westlich dominierte Weltordnung zu integrieren. Doch mit der Osterweiterung der NATO, den Konflikten im ehemaligen Jugoslawien und den wachsenden geopolitischen Differenzen wandelte sich auch die Rhetorik in Moskau. Während in den frühen 2000er Jahren noch von „Partnerschaft“ und „gemeinsamer Sicherheit“ gesprochen wurde, setzte ab Mitte des Jahrzehnts eine spürbare Veränderung ein. Russland begann, die westlichen Interventionen als „Destabilisierungsstrategien“ zu kritisieren. Die Farbrevolutionen in Georgien (2003), der Ukraine (2004) und Kirgisistan (2005) wurden in russischen Medien als „vom Westen gesteuerte Umstürze“ dargestellt.
Putins Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 markierte einen Wendepunkt in der russischen Rhetorik. Er warf den USA und der NATO vor, eine „unipolare Welt“ schaffen zu wollen, in der sie sich über internationales Recht hinwegsetzen. Damit führte Russland ein neues Narrativ ein: Das Bild einer aggressiven, expansionistischen NATO, die Russland einkreisen und schwächen wolle. Dieser Wandel wurde besonders deutlich in der Berichterstattung über den Georgien-Krieg 2008 und später über die Ukraine-Krise 2014. Russland begann verstärkt, seine eigenen militärischen Maßnahmen als Schutz russischsprachiger Minderheiten oder als Verteidigung gegen westliche Expansion zu begründen. Die Sprache der russischen Außenpolitik wurde zunehmend konfrontativ – eine Entwicklung, die bis heute anhält.
Ein entscheidender Faktor für den Wandel der Kriegsrhetorik war die Rolle der Medien. Während der Kalte Krieg noch von relativ klaren ideologischen Fronten geprägt war, entstand nach 1991 eine zunehmend fragmentierte Informationslandschaft, in der Narrative gezielt gesteuert wurden.
Im Westen entwickelten sich große Nachrichtensender wie CNN, BBC oder Fox News zu wichtigen Multiplikatoren der neuen Kriegsrhetorik. Während der Irak-Krieg 2003 offiziell als Befreiung des Irak verkauft wurde, übernahmen westliche Medien oft ungeprüft Regierungsdarstellungen. Kritische Stimmen wurden als antiamerikanisch oder naiv dargestellt.
Auf der anderen Seite baute Russland mit RT (Russia Today) und Sputnik eigene Medienkanäle auf, die gezielt Gegen-Narrative verbreiteten. Hier wurde der Westen als Heuchler dargestellt, der Kriege unter dem Vorwand der Demokratieexporte führe, während Russland als Verteidiger einer multipolaren Weltordnung inszeniert wurde.