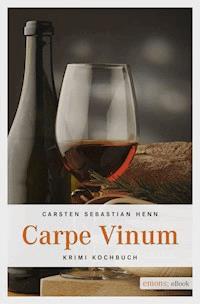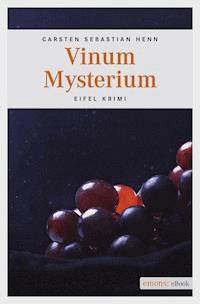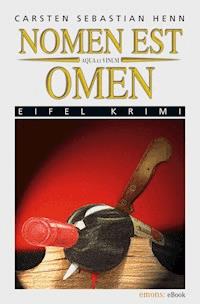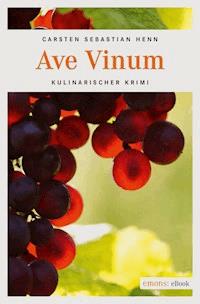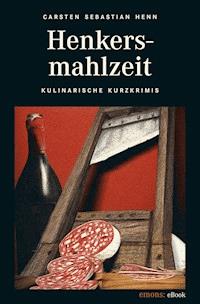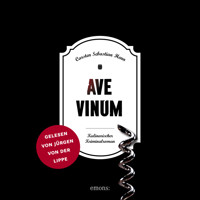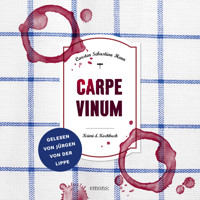2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Wer Hunde, Wein oder Italien liebt, kommt an diesem wunderbar geschriebenen Buch nicht vorbei.« (Sebastian Fitzek) Seit Jahrhunderten schon stehen die Pharaonenhunde vor dem Turiner Grabtuch im Duomo di San Giovanni Wache, eine ehrenvolle Aufgabe. Der unerfahrene Amadeus hat seinen Dienst gerade erst angetreten, da wird das Tuch geraubt. Nun wird er von seiner stolzen Sippe verstoßen. Zum Glück helfen ihm die beiden liebenswerten Schnüffler Niccolò und Giacomo, den Tätern auf die Schliche zu kommen. Giacomo gibt sich auf seine alten Tage zwar gerne einmal dem Barolo hin, aber auf seine hervorragende Nase ist noch immer Verlass: Im Schlosspark von Stupinigi nimmt er die Witterung des legendären Grabtuchs auf. Doch wer steckt hinter dem Raub? Für die cleveren Vierbeiner beginnt eine wilde und gefährliche Jagd…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2019© 2009 Carsten Sebastian Henn© der deutschsprachigen Ausgabe: List im Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinCovergestaltung: Favoritbüro MünchenCovermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
I VOM FALLEN DES SCHNEES
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
II TURINER BLUT
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
III GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
EPILOG
Widmung
Für Frederick & CharlotteAuf dass sie ihr ganzes Leben so zusammenhalten wie Niccolò und Giacomo.
Zitat
»Dann sprach Gott: Siehe, ich richte einen Bund auf mit euch und euren Nachkommen und mit allen lebenden Wesen, die bei euch sind.«
(Gen. 9,9)
I VOM FALLEN DES SCHNEES
Kapitel 1
DER PALAZZO
Wie ein ausgehungertes Tier senkte der Winter seine Krallen ins Piemont, entwurzelte mit Stürmen ganze Waldstriche, ließ Dächer unter der Last von Schneemassen einstürzen und Straßen im Weiß verschwinden. Doch der betagte Trüffelhund Giacomo bekam von alldem gerade überhaupt nichts mit, denn er wurde im Fond eines alten Fiat Ducato mächtig durchgerüttelt. In eine Decke eingehüllt versuchte er, das unablässige Schaukeln zu vergessen und stattdessen an köstlichen Lardo di Arnad zu denken, und an Mocetta-Schinken, natürlich von der Gämse. Seine Nase schnupperte, als wäre sie nur wenige Zentimeter von dem mit Bergkräutern aromatisierten Fleisch entfernt und von dessen köstlicher, nussiger Würze. Er erinnerte sich an warme Sommertage, an denen er vor Marcos kleiner Trattoria stand und den letzten Zipfel einer frisch aufgeschnittenen Wurst abbekam.
Der Transporter hielt mit einem harschen Ruck, die Decke rutschte von Giacomos Körper, und Kälte nahm ihren Platz ein. Müde öffnete Giacomo die Augen. Das grelle Weiß des Schnees drang durch das verschmutzte Heckfenster herein. Dann öffneten sich die Türen, und zwei Hunde huschten an Giacomo vorbei, sprangen in den tiefen Schnee und schnappten nach den durch die Luft wirbelnden Flocken, welche die Größe von Parmesanhobeln hatten. Die überschwängliche Jugend, dachte Giacomo, biss sich einen Zipfel der Decke, zog sie wieder über den Rücken und schloss die Augen.
»Raus mit dir, du verlauster Faulpelz«, rief Isabella und wuschelte ihm über den Kopf. »Ich hab ein wohlig warmes Plätzchen für dich, und zu essen findet sich bestimmt auch noch was.«
Giacomo wäre sicher liegen geblieben, hätte sie nicht angefangen zu pfeifen. Er tat alles, um dieses schrille Geräusch zu vermeiden. Isabella beherrschte die Kunst des klangvollen Pfiffs nicht, bei ihr ähnelte es eher dem Geräusch eines quietschenden Schwerlasters.
Die beiden anderen Vierbeiner liefen bereits weit voraus. Das Italienische Windspiel Niccolò trug einen warmen Hundepullover aus Teddybärenfell, die rothaarige Spanielhündin Canini war lange nicht getrimmt worden und hatte dergleichen nicht nötig. Sie waren schon fast bei diesem weißen mächtigen Ungetüm angelangt, das unbeirrt in der Kälte saß. Es sah aus wie ein Gebirge, dessen höchster Punkt, gekrönt von einem prachtvollen Hirsch, genau in der Mitte lag. Von dort nahm seine Größe harmonisch zu beiden Seiten hin ab. Die Schneemassen wirkten wie Zuckerguss auf diesem ungeheuren Menschenwerk. Etwas Vergleichbares hatte Giacomo niemals zuvor gesehen. Wieso erschufen Menschen solche Gebilde? Alles, was man zum Leben brauchte, passte doch in eine kleine Hütte – allerdings mit einem großen Kühlschrank, Niccolò hatte ihm auf der Hinfahrt erzählt, dass es zum Palazzina di Caccia di Stupinigi gehen würde, einem Schloss, in dem einst bedeutende Menschen gehaust hatten, wenn sie zur Jagd gingen.
Giacomo sprang von der Ladekante in den Schnee. Sogleich spürte er den Temperaturunterschied an den Fußtatzen, doch sein gekräuseltes, leicht öliges Fell wärmte ihn wie stets. Der dürre Niccolò musste in dieser Jahreszeit ein Stück Stoff am Leib tragen, damit er nicht zu einem Eisblock erstarrte. Die Spanielhündin Canini hatte ganz andere Probleme. In ihren langen Ohren fing sich der Schnee und ließ sich nicht abschütteln.
Giacomo sog die eisige Luft ein, suchte in ihr nach Aromen, die ihm etwas über das Land erzählten, über die Menschen, die Tiere, das Leben. Doch es fand sich nichts. Die Luft war wie klares Gebirgswasser. Er tapste einige Schritte weiter, zu einer Stelle, wo der Wind vom Wald her wehte. Aber wieder spürte Giacomo nur diese Kälte, die alles Leben erbarmungslos gefrieren ließ. Keine Duftspuren.
Auch nicht die von Wölfen.
»Kommt schon, ihr verrückten Hunde!«, rief Isabella, strich sich die Schneeflocken aus den kurzen blonden Haaren und schwang sich ihren geliebten Wollschal um den Hals, in den sie alle Farben des Regenbogens gestrickt hatte. Die junge Biologin der Turiner Universität ergriff zwei schwere Koffer und machte sich auf den Weg zum westlichen Schlosstrakt. Seit dem Telefonanruf, der sie hierherbestellt hatte, war sie unheimlich fröhlich. Geradezu überdreht. Während der ganzen Autofahrt hatte sie gesungen.
Plötzlich schritt Niccolò neben Giacomo. »Sie hofft so sehr, dass es nicht ihr Wolfsrudel ist. Sie hat Angst, was dann passieren könnte. Ich kann es spüren, es sticht in ihrer Brust. Aber sie will nicht, dass wir es merken.«
»Und erst recht nicht, dass sie es selbst mitbekommt.«
Canini jagte vorbei, und Niccolò setzte ihr ohne zu zögern nach. Giacomo sah sich unruhig um. Auf diesem Gelände war also ein Wolfsrudel gesichtet worden. Viel zu nah an menschlichen Behausungen. Doch der Winter dauerte bereits lange an, und er war hart wie seit unzähligen Jahren nicht mehr. Die Wölfe würden nirgendwo Beute finden, das ließ sie verzweifelt werden. Aber so sehr, dass sie sich den Menschen näherten? Giacomo trottete hinter Isabella her und hob abermals die Schnauze. Endlich roch er etwas! Ein Pastagericht, das in einer der Schlossküchen zubereitet wurde. Ein Klassiker der Küche Norditaliens, Ragu alla bolognese mit Geflügelleber und einem ordentlichen Schuss Sahne. Köstlich! Aber immer noch keine Spur von Wölfen. Stattdessen fanden sich nun immer mehr Eiskristalle in der Luft, die der Wind ihm ins Gesicht peitschte. In jeden Zwischenraum seines Fells drangen sie ein. Unbarmherzig legten sie sich nicht nur auf die kleine Gruppe, sondern füllten auch die Ritzen im Mauerwerk des Schlosses. Der Piemonteser Winter nahm es immer mehr in seinen Besitz.
Schnell flohen sie ins Schlossinnere und richteten sich in ihren kargen Zimmern ein, die früher dem Gesinde zugewiesen waren. Nur eine Notbesetzung an Personal weilte in Stupinigi, ein einziger Trakt war einigermaßen beheizt. Das Schloss wurde aufwendig umgebaut, überall waren Absperrbänder und Gerüste. Doch nun werkelte niemand. Der Palazzo hielt Winterschlaf, sein Atem kaum vernehmbar. Giacomo rollte sich in einer Ecke zusammen, die zwar von Spinnweben überzogen war, dafür aber nahe der Küche lag. Also strategisch hervorragend. Er würde sicher nur etwas warten müssen, solange konnte er hier schlummern. Und wieder von Mocetta träumen.
»Wer kommt mit auf einen ersten Rundgang?«, hörte er Isabella rufen. Wieder war da diese Angst in ihrer sonst so heiteren Stimme, als habe man in eine köstliche Pannacotta eine Prise zu viel Salz gegeben. Giacomo rollte sich weiter zusammen, wie ein Igel bei Gefahr. Hoffentlich ging dies alles schnell vorbei, und sie konnten in ihr Dorf in der Langhe zurück. Mehr wollte er gar nicht.
»Kommst du?« Es war Niccolò.
»Ich schlafe schon.«
»Wir wollen gehen!«
»Wunderbar. Ich halte hier die Stellung.«
»Steh schon auf! Isabella hätte dich gern dabei.« Er stupste ihn mit der Schnauze an. »Ohne dich geht sie bestimmt nicht raus.«
Giacomo blickte auf. Das kleine Windspiel leckte sich nervös an der Brust. In einiger Entfernung stand Canini, die Rute eingeklemmt. Die beiden hatten Angst und wollten ihn dabeihaben. Sie wussten um die Gefahr, die von Wölfen ausging. Einem ausgehungerten, verzweifelten Rudel.
Isabella hielt bereits ungeduldig die Tür auf.
»Aber nur für Isabella«, sagte Giacomo und stemmte sich in die Höhe. Er spürte jeden seiner Knochen, die schon viel zu lange nicht mehr mit Barolo geölt worden waren, Hinter dem Schloss erstreckte sich ein kleines Wäldchen. Giacomo lief voran. Er wollte nicht, dass Isabella in Gefahr geriet. Und erst recht nicht diese beiden dummen, übermütigen Jungspunde. Im Gegensatz zu ihm hatten sie noch so viel vor sich.
Isabella blieb plötzlich stehen und setzte eine leere abgeschnittene Plastikflasche an den Mund. Dann begann sie zu heulen. Es klang so echt, dass Giacomo selbst in diesem Frost noch ein kalter Schauer durchfuhr. Es war, als hause ein Wolf in ihrem Leib, ein großes, furchteinflößendes Tier.
Doch es kam keine Antwort, und so schritten sie weiter.
Giacomo schärfte seine Sinne wie der Metzger seine Messer, spitzte die Ohren, sog die Düfte tief in seine gewaltige Nase ein, die in ihrer dunklen Verwarztheit an eine reife Albatrüffel erinnerte, und stach seinen Blick in Richtung jedes Schattens, der zwischen den vom Winter abgenagten Baumstämmen erschien. Kein Anzeichen von Wölfen. Doch das bedeutete nichts. Um die Grauröcke zu Enden, mussten sie tiefer in das Waldstück eindringen. Und weniger Lärm verursachen.
Aber die Nacht senkte sich schon über den Schlosspark, und Isabella sammelte ihre Hunde, um sich zurück ins Warme zu begeben.
»Morgen früh, mit neuer Kraft«, sagte sie. »Die Wölfe werden uns schon nicht weglaufen, oder?« Giacomo sah sich unruhig um.
Im Turiner Duomo di San Giovanni geschah in diesem Augenblick etwas, das für alle Anwesenden von größter Bedeutung war – von dem außerhalb der Kirchenmauem jedoch niemand etwas ahnte. Die Sonne war längst untergegangen, nur der matte Widerschein des Schnees fiel durch die großen Fenster. Er tauchte das Kirchenschiff in ein diffuses, lebloses Licht, ließ alles unwirklich erscheinen, was im Inneren vor sich ging. Ein junger Pharaonenhund stand zitternd und völlig allein vor dem Altar mit den hohen, gewundenen Säulen und dem Marienbild samt Kinde in der Mitte des goldenen Tryptichons. Jetzt senkte er den Kopf. Ursprünglich war seine seltene, uralte Rasse als »Kelb tal- Fenek« bekannt. Wenn es in der Welt der Hunde blaues Blut gab, so floss es in seinen Adern. Mit dem schlanken, eleganten Körper und den auffällig großen, spitz nach oben stehenden Ohren ähnelte er dem ägyptischen Totengott Anubis. Sein Fell war rostbraun, kurz und glänzend. Eine weiße Blesse zierte die Mittellinie seines Gesichts, Und wie alle seiner Rasse wies er kein schwarzes Pigment auf. Nase, Augenlider und Ohreninnenseiten, alles von der Farbe des Fleisches. Der Name des Hundes lautete Amadeus – und in dieser Nacht sollte sein wahres Leben beginnen.
Doch niemand hatte ihm verraten, was genau ihn heute erwarten würde. Einer nach dem anderen traten die Mitglieder seiner Sippe in den sakralen Renaissancebau aus dem 14. Jahrhundert. Wie Amadeus mussten sie durch den schmalen Gang gekrochen sein, der von der Piazza Castello direkt ins Innere des Duomo führte und den niemand außer den Pharaonenhunden kennen durfte. Er bestand aus über die Jahrhunderte gegrabenen Gängen.
Das gute Dutzend Hunde bildete einen Kreis um Amadeus. Dessen ganzer Körper war angespannt, die Hinterbeine leicht eingeknickt, der Rücken rund. Der junge Pharaonenhund kroch förmlich in sich hinein.
Heute war sein großer Tag. Er würde zum neuen Wächter ernannt werden. Nur einem jeder zweiten Generation wurde diese Ehre zuteil, alle anderen hatten für ihn zu sorgen. Vorgänger war sein Großvater gewesen, der in der letzten Nacht verstorben war. Amadeus war seit Langem dazu auserkoren, dessen Platz einzunehmen. Von Geburt an hatte man ihn darauf vorbereitet. Seine Meute hatte ihn gelehrt, ausdauernd und wachsam zu sein, selbst im Schlaf auf jedes Geräusch zu achten und im Notfall loszuspurten wie ein Geist, schnell und lautlos.
Seine Mutter trat nun zu Amadeus. Sie war stets streng mit ihm gewesen, hatte ihn wenig Zuneigung spüren lassen, ihn dazu erzogen, allein zu sein. So wollte sie ihm beibringen, den Schmerz der Einsamkeit zu umarmen wie einen alten, weisen Freund.
Es war ihr nicht vollends gelungen.
Sie leckte ihm zärtlich über die Schnauze. Das hatte sie noch nie getan. Dann hob sie ihre Vorderpfote gegen seine Brust. Es war ein Zeichen der Demut. Von seiner eigenen Mutter!
Die anderen folgten ihrem Beispiel. Einer nach dem anderen trat aus dem Kreis, zeigte sich unterwürfig und nahm dann wieder seinen Platz im Zwielicht ein.
Er würde sich ihrer würdig erweisen.
Amadeus’ Vater und sein Onkel lösten sich nun aus der schweigenden Masse gesenkter Häupter und liefen hinaus. Dann geschah lange nichts. Alle verharrten. Amadeus wagte es nicht, eine Frage zu stellen. Er zwang sich, nicht mehr zu zittern und eine stolze Haltung einzunehmen. Er würde bald der Wächter sein! Ihm war die Ehre zuteilgeworden, bis zu seinem Tod dem heiligen Tuch zu dienen, dem Sindone, in dem der Herr gelegen hatte. Amadeus war der Stärkste und Klügste seines Wurfes, er würde es beschützen, mit seiner Kraft, seiner Schnelligkeit, seinem Körper. Die Aufgabe lastete schwer, aber sicher auf seinen Schultern.
Plötzlich erschien Nara im Kirchenschiff, seine Großmutter und die Älteste der Meute. In der Schnauze hielt sie, fast zärtlich, nur mit den vordersten Zähnen ihres Fangs, ein kleines Stück hellen Leinenstoffs. Die anderen Pharaonenhunde unterdrückten ein Aufjaulen, als sie in den Kreis trat, und wandten ihre Häupter ab. Als auch Amadeus dazu ansetzte, hieß ihn seine Mutter aufrecht zu bleiben. Der Blick seiner Großmutter war nervös, so kannte er sie nicht. Sie war doch sonst immer so besonnen und warmherzig.
Sie kam zu ihm und berührte mit dem Leinenstück seine Stirn. Es prickelte. Und das Innere des Duomo schien für einen Moment aufzuflackern, als wären sämtliche Kerzen entzündet worden. Das Rauschen des eisigen Windes brandete auf und hallte im mächtigen Kirchenschiff wie Musik wider.
Amadeus wusste, dass dieses Stück Stoff vom Sindone stammen musste. Niemand hatte ihm erzählt, dass seine Meute im Besitz davon war. Das Tuch selbst befand sich in einer Metallkiste hinter Glas, nur wenige Schritte entfernt.
Nara verschwand wieder, doch noch immer blieben die Häupter gesenkt. Dann erklang die Glocke des mächtigen neben dem Duomo stehenden Turms. Sie ertönte nur für ihn. Sein Vater und sein Onkel mussten all die Stufen hochgelaufen sein, um sie zu läuten. Nun begann die Meute zu heulen, ein Concerto furioso. Sie erhoben sich und traten zu Amadeus in die Mitte. Viele gute Wünsche wurden ausgesprochen, weise Worte gesagt und allerhand Albernheiten von seinen Wurfgeschwistern. Dann begaben sie sich in einer stillen Prozession durch den verschlungenen Gang hinaus vor das Hauptportal des Duomo. Zu dessen Linken war ein Stein im Boden eingelassen, der sich durch nichts von den anderen unterschied – außer durch seinen speckigen Glanz. Unzählige von Amadeus’ Ahnen hatten hier gelegen und ihren Dienst verrichtet. Er ließ sich darauf nieder, der Stein fühlte sich beinahe weich an. Und der eisige Wind schien genau um diese Stelle einen Bogen zu machen.
Ohne einen einzigen Blick zurückzuwerfen, verschwand die Meute im Dunkel Turins. Amadeus hatte seine Aufgabe erhalten.
Und würde sie bis zum Ende seiner Tage erfüllen.
Am nächsten Morgen brachen sie früh auf. Die Schneedecke hatte über Nacht weiter an Volumen gewonnen, als hätte sie jemand wie eine Bettdecke aufgeschüttelt. Zuerst schritten sie ruhig und langsam voran, dicht beieinander, wachsam. Doch schon nach kurzer Zeit schienen Niccolò und Canini das Ganze für einen netten Ausflug zu halten.
»Müsst ihr denn gerade jetzt ausprobieren, wie tief ihr eure Schnauzen in den Schnee stecken könnt?«, herrschte Giacomo sie an. »Meint ihr, die Wölfe finden das lustig?«
Niccolòs Kopf lugte hervor, die Schnauze wie mit Puderzucker bestäubt. Er schüttelte sich aus und sprang in Richtung des alten Freundes und Beschützers – trat dabei jedoch unglücklich auf einen großen Kiesel, der vom tiefen Schnee bedeckt gewesen war. Er jaulte auf, warf sich auf die Flanke und leckte wie wild über seinen rechten Vorderlauf. Schmal und dürr war dieser, wie bei allen Windspielen. Schließlich versuchte er, den Schmerz loszuwerden, indem er mit dem Bein heftig austrat. Doch dadurch wurde er nur noch schlimmer. Isabella rannte gleich zu ihm, Canini lief hilflos im Kreis um beide herum.
Sie mussten ihn zurückbringen, einen Arzt rufen, ihn pflegen.
Giacomo würde alleine weitergehen. Denn ausgerechnet jetzt hatte er einen Schemen im Wald entdeckt. Ein lauerndes Grau, das sich einen großen Stamm zum Verweilen ausgewählt hatte und sogar klug genug war, sich so in den scharfen Wind zu stellen, dass kein Duft zu Giacomo gelangte.
Der alte Trüffelhund entschied sich, einen Bogen zu schlagen, der ihn genau hinter diesen Stamm bringen würde.
Und er beschloss, den aufkommenden Schneesturm einfach zu ignorieren. Leider ignorierte dieser auch Giacomo. Innerhalb kürzester Zeit nahm der Sturm an Stärke zu, und Giacomo musste immer häufiger die Augen zusammenkneifen und den Kopf aus dem Wind drehen. Wenn Wölfe hier lebten, würden sie sich nun zusammenkauern. Und sie würden ihn nicht erwarten. Es war der beste Moment für die Suche. Während der Schnee wütete, erstarrte die Welt – nur Giacomo nicht.
Er schlich auf das lauernde Grau zu.
Es befand sich genau hinter dem Stamm vor ihm. Die Form ähnelte jedoch nicht der eines liegenden Wolfes, zu mächtig war sie dafür, der durch die Luft wirbelnde Schnee stach wie Nadelspitzen in Giacomos Nase. Doch was ihn viel mehr schmerzte, war, dass er in dieser Kälte nichts riechen konnte. Lieber wäre es Giacomo gewesen, man hätte ihm die Augen verbunden. Ohne Düfte war die Welt karg, die Bäume wirkten leer, der Boden ausgehöhlt, alles schien sich vor Giacomo in etwas Fremdes zu verwandeln.
Ein weiterer Schritt. Der Schemen gewann an Kontur, trat förmlich aus dem wirbelnden Weiß heraus.
Und bewegte sich.
Giacomos Pfoten sanken tief in den Schnee, der sich an einer Bodenwelle gesammelt hatte. Er huschte hinter den Stamm, an dem das Weiß bereits klebte wie ein wuchernder Schimmelpilz.
Der Schemen schnaufte. Tief und unwirsch. Doch selbst dieses Geräusch gab Giacomo keinen Aufschluss darüber, um welches Tier es sich handelte. War es ein Wildschwein, dann musste es verletzt sein, sonst würde es sich kaum allein und fern der Rotte aufhalten. Und nichts war gefährlicher als eine verletzte Sau.
Giacomo wollte nicht näher heran, ohne zu wissen, was ihn erwartete. Er schloss die Augen und sog die Luft in tiefen, harten Schüben ein, immer wieder, doch kein einziges Aroma erreichte ihn.
Vorsichtig lugte er deshalb um den Stamm, setzte sogar eine Pfote vor.
Der Schemen drehte sich zu ihm.
Giacomo erkannte Augen, in denen Sorge und Überraschung lagen. Doch er wusste gleich, dass dieses Wesen ihn nicht angreifen würde. Es war nur ein Mensch, einer ohne Dach über dem Kopf, einer von denen, die über die Wärme eines Gullydeckels glücklich waren und sich wie er über ein Tramezzino im Mülleimer freuten, Giacomo gab dem Bruder im Geiste einen freundschaftlichen Stupser mit der Schnauze. Menschen brauchten das ab und zu. Was hatte den armen Kerl nur hierhin verschlagen? Es gab so viele gemütlichere Orte auf der Welt, Brücken, unter denen sich schlafen ließ, geschützte Hauseingänge, Papiercontainer. Der arme Mensch war viel zu dünn angezogen für jemanden ohne Fell. Der lächerliche Schal war bereits an den Stellen gefroren, wo der Atem ihn befeuchtet hatte. Vielleicht käme heute die letzte Nacht für diesen Menschen.
Der alte Trüffelhund legte sich zu ihm, gab ihm ein wenig von seiner Wärme ab. Eine Hand berührte sein Fell, und Giacomo schob sie nicht fort, obwohl ihm sonst jedes Streicheln zuwider war. Er würde dem Mann beistehen, bis sich der Schneesturm legte. Dann wäre die Luft klar, und er könnte wieder schnuppern.
Die Hand des Menschen drückte ihn mit einem Mal fest an sich.
Giacomo blieb fast die Luft weg.
Am sonst so beschaulichen Duomo war mittlerweile der Irrsinn ausgebrochen. Amadeus saß im hintersten Winkel seiner Ecke, um den an ihm vorbeischießenden Schuhen und Schneestiefeln auszuweichen. Niemand beachtete ihn, stattdessen drängten Frauen und Männer, einige auf Armen oder Schultern Kinder tragend, hinein in das Kirchenschiff, obwohl es längst bis zum Bersten gefüllt sein musste. Es fand keine Messe statt, keine Beerdigung, kein Gebet. Amadeus hatte keine Glocke läuten gehört. Warum also wollten die Menschen hinein?
Wenn in diesem Getümmel jemand das Tuch raubte, würde er den Dieb nicht ausmachen können. Nichts würde es nützen, dass sich der Geruch des Tuches dank des kleinen Leinenfetzens bei ihm eingebrannt hatte. Die Kirche war so voller Menschen, dass deren Wärme den Schnee vor den Toren schmelzen ließ. So als wäre der Winter vorbei, als herrsche bereits Frühling.
Amadeus würde seinen Posten nicht verlassen. Auch auf die Gefahr hin, zertrampelt zu werden. Dies war seine erste Bewährungsprobe, und er würde sie mit Bravour bestehen! Ein Wächter verließ niemals seinen Platz. Speisen wurden ihm gebracht, und seine Notdurft verrichtete er über einem rostigen Straßengully wenige Schritte entfernt; nur einmal am Tag, in den frühen Morgenstunden, wenn die Sonne gerade aufging. So war es den Wächtern seit Jahrhunderten vorgeschrieben.
Einen solchen Aufmarsch hatte es am Duomo nie zuvor gegeben, sonst hätte ihm sein Vater davon erzählt. Das Verhalten der Menschen war Amadeus ein Rätsel. Obwohl sie in die Kirche strömten, hatte er das Gefühl, genau dort befände sich der Ursprung ihres Schreckens. Weinen drang von drinnen, Heulen, Schreie des Entsetzens. Er verstand die Worte nicht, denn seine Meute hielt sich stets fern von den Menschen. Doch sie klangen klagend und schmerzensreich.
Amadeus lugte um die schwere Steinmauer. Er wollte nur linsen, einen kurzen Blick riskieren, nicht mehr. Doch sofort riss ihn die Menschenmasse einer Lawine gleich mit. Er jaulte auf, als ein Bein gegen seinen Kopf schlug, er musste nachgeben, geriet in den Strudel der stampfenden Füße, wollte zurück, doch spülte ihn die Welle hinein, wo sie an noch mehr Menschen und Beinen zerschellte. Knie bohrten sich in seinen schlanken Leib, und die Luft blieb ihm weg. Ein Fuß traf seine Blase, und sie entleerte sich.
Plötzlich gab es wieder Raum um ihn. Und Luft. Wenn auch warme, abgestandene. Die Lücke riss auf wie die Masche einer Strumpfhose, und Amadeus folgte ihr, bemerkte nicht, wie sie sich hinter ihm zögernd wieder schloss, sah nur geradeaus. Und näherte sich dem Platz, den er so nie hätte sehen sollen: Der lichtlose, klimatisierte Metallsarg, in dem das Sindone aufbewahrt wurde, stand offen.
Und war völlig leer.
Dahinter fiel ein schwerer Purpurvorhang von der Decke, ein Bild darauf, mit dem Antlitz des Herrn. So traurig hatte Amadeus ihn nie zuvor gesehen.
Das Leben des jungen Pharaonenhundes stürzte wie ein baufälliges Haus in sich zusammen, und er verlor das Bewusstsein.
So wurde seine Welt für kurze Zeit wieder friedlich und ruhig.
Der Sturm legte sich. Immer weniger Schneeflocken fielen, und irgendwann trafen die letzten tänzelnd auf die weiße Decke, in der sie geräuschlos verschwanden. Der Griff des Mannes war schwach geworden, doch das war es nicht, was Giacomo nun aufstehen ließ. Es war ein neuer Duft, der sich in der Kühle wie das warme Rot eines Sonnenaufgangs erhob, immer heller und wärmer werdend. Es war ein Duft, der Giacomos Leben ausmachte, der ihn vom Welpenalter an begleitet hatte, durch alle Leiden hindurch.
Dieser Duft war seine Heimat.
Es war das Aroma der weißen Trüffel des Piemont. Der Duft war gleichzeitig grazil und kraftvoll, fein und wunderbar würzig. Er züngelte lockend in Giacomos Nase und zog ihn Schritt für Schritt näher zu sich. Den Obdachlosen hatte Giacomo bereits vergessen.
Doch etwas anderes schob sich in sein Blickfeld, während er sich unwiderstehlich der Königin aller Pilze näherte. Ein einzelnes erleuchtetes Fenster. Es gehörte zum Westtrakt des Schlosses. Isabella schaute heraus, ihr Blick suchend. Neben ihr flogen große hellbraune Ohren in die Höhe. Immer wieder. Ab und an auch eine Schnauze. Canini. Nur Niccolò war nirgends zu sehen.
Giacomo war Isabella nie wirklich nahegekommen. Oder besser: hatte sie nicht nahekommen lassen. Sie war Niccolòs Mensch und Caninis. Zwei Hunde waren doch mehr als genug. Seit den Geschehnissen um Rimella, dem Geheimnis um das Verschwinden eines ganzen Dorfes, der Schlacht mit dem Wolfsrudel, waren sie unzertrennlich. Er war nur bei Isabella, weil Niccolò mit ihr lebte. Irgendwer musste ja auf den dummen Burschen aufpassen. Er selbst brauchte schließlich keine Zuneigung mehr, keine Streicheleinheiten, kein warmes Wort. Nur ein Dach über dem Kopf und ein Schälchen Barolo. Vielleicht brauchte er einmal in der Woche auch noch ein Tramezzino Doppio. Selbstverständlich auch Salami, Schinken, Pasta und Amaretti ab und an. Sowie andere Leckereien. Mehr brauchte er nicht. Außer natürlich Trüffel.
Wie den, der jetzt seine Nase betörte. Oder die? Es roch zumindest nach mehreren. Der Duft war nicht so präzise und geschliffen wie bei einem einzelnen Exemplar, sondern undeutlicher. Merkwürdig war, dass der Boden nicht passte, zu wenig Kalk, zu viel Gestein für Trüffel Und trotzdem dieser intensive Geruch! Seine Pfoten trugen ihn schnurstracks zu einem alten Baum, der die Allee säumte, welche zum Schloss führte. Brauner Matsch sprenkelte den Schnee um die Kastanie. Ein großer Wagen musste ihn aufgeworfen haben.
Der Duft entstammte nicht dem Boden, Er hatte seinen Ursprung höher, am Stamm. Aber dort wuchsen niemals Trüffel!
Giacomos Nase glitt an der eisigen Borke empor, bis zu einer Öffnung, einem Spalt, an dem der Baum sich weitete.
Hinter dem alten Trüffelhund erhob sich der Vagabund.
Der Wind hatte gedreht, und Giacomo konnte riechen, wie er näherkam. Doch sein ganzes Denken konzentrierte sich auf den Fund der Trüffel, nichts anderes interessierte ihn mehr.
Sehen konnte Giacomo nicht, was sich in der Aushöhlung der Baumes befand. Nur die Spitze eines Pakets erkannte er – auf der sich so gut wie kein Schnee gesammelt hatte. Es konnte noch nicht lange dort liegen. Außen war Plastikfolie, darunter Stoff.
Und darin? Selbst seine gewaltigen Nüstern schafften es nicht durch den dicken, künstlichen Stoff zu riechen. Doch was am merkwürdigsten war: Das Packpapier war es, das nach Trüffeln duftete. Aber es war nur das Aroma, nur der Geist, die köstliche Frucht der Erde hingegen fehlte.
Genau hinter ihm stand nun der Vagabund.
Ein Wagen fuhr im Schritttempo an Giacomo vorbei.
Der alte Hund sprang hoch und zog das Paket aus dem Stamm.
Niccolò rannte in dem kleinen Zimmer mit den hohen Decken so panisch umher, als wären die Bodenfliesen heiße Herdplatten. Das heißt, er lief so schnell, wie es sein verletzter Vorderlauf zuließ, den Isabella notdürftig geschient hatte.
Canini sprang unterdessen wie ein Gummiball vor dem Fenster auf und ab. »Nur Schnee«, sie landete wieder auf dem Boden, um sogleich erneut hochzuschnellen, »und Bäume.« Landung. Start. »Kein Schneesturm mehr.« Sie landete wieder und holte Luft. »Ich habe einen Menschen gesehen – aber Giacomo ist nirgendwo. Ihm wird schon nichts passiert sein, er ist doch ein alter Kämpfer!«
»Ach ja? Reden wir über denselben verfressenen, Wein schlabbernden, ständig schlafenden alten Hund?«
»Du hast ›grummeligen‹ vergessen.«
»Macht es nicht besser!« Niccolò wäre am liebsten durch die Mauer gerannt. Er hatte bereits an der Tür gekratzt, die direkt nach draußen führte, doch Isabella hatte ihm nur beruhigend über den Kopf gestreichelt.
jetzt tat sie nicht einmal mehr das.
Isabella machte überhaupt nichts mehr.
Selbst das Atmen schien sie eingestellt zu haben.
Sie stand auch nicht länger am Fenster, sondern saß wie erstarrt auf dem wackligen Stuhl. Niccolò stupste sie vorsichtig am Bein. Doch sie bewegte sich nicht. Er sprang auf ihren Schoß, leckte ihr über die Wange. Keine Reaktion. Isabella starrte nur. Stur geradeaus. Ihr Gesicht wie Stein. Seit sie einander getroffen und sich gegenseitig das Leben gerettet hatten, teilten sie eine besondere, sehr seltene Verbindung. Das kleine Windspiel wusste immer, was Isabella fühlte, ihre Gedanken und Worte waren für ihn klar wie Wasser. Doch nun spürte er nur Schrecken. Und wandte seinen Kopf, um dasselbe zu sehen wie sie. Es war der quadratische Kasten in der Zimmerecke, über den Bilder ohne Tiefe flimmerten und der Geräusche von sich gab, die niemals so dunkel oder hell waren, wie die der Welt ringsum. Die Menschen nannten ihn ›Fernseher‹. Viele waren nun darin vor einer Kirche zu sehen. Es waren ganze Massen, und sie drängten hinein. Dann wechselte das Bild, und plötzlich sah Niccolò eine große, dreckige Decke. Auf dieser fanden sich Flecken, welche die Silhouette eines Menschen ergaben. Warum versetzte Isabella das in solch einen Schock?
»Bisher konnte die Spurensicherung der Turiner Polizei keinen Hinweis auf ein gewaltsames Eindringen in den Duomo feststellen. Sämtliche Türen sind unversehrt, die Alarmanlage intakt, es gibt keine Fingerabdrücke, keine Fußspuren, niemand will etwas Ungewöhnliches bemerkt haben. Es scheint, so ein Sprecher der Polizei, als habe sich das schwer gesicherte Sacra Sindone einfach in Luft aufgelöst.«
Niccolò verstand kein Wort. Er stellte sich so auf Isabellas Schoß, dass er mit seinen Körper den komischen Kasten verdeckte, legte den Kopf zur Seite und sah sie mit seinem Leckerli-Blick an. Der brachte sie schließlich immer zum Lachen.
Er musste doch etwas tun, damit Isabella endlich wieder normal wurde!
Doch sie schob ihn wütend zur Seite, sodass er das Gleichgewicht verlor und hinunterspringen musste. Er landete ausgerechnet auf seinem verletzten Vorderlauf und heulte auf. Es war, als würde Isabella in diesem Moment erwachen. Bestürzt bückte sie sich zu Niccolò, um ihn zu liebkosen.
Da krachte die Außentür.
Sie brach nicht entzwei, doch der Stoß musste kräftig gewesen sein, denn das Blatt der Bautür hing nicht mehr gerade in den Scharnieren, Schnee wehte durch den Schlitz herein. Wieder prallte etwas mit Getöse gegen das Holz, und die Tür schlug der Lange nach in den Raum. Dann ging alles sehr schnell. Ein schneeübersäter Giacomo stürzte herein, eine Rolle mit sich zerrend, panisch blickte er hinaus, seine Pupillen zuckend wie Fliegen vor einem Insektenlicht. Niccolò humpelte zu ihm und half dem alten Trüffelhund, das Bündel ins Zimmer zu ziehen.
»Wir müssen es Isabella zeigen«, brachte Giacomo nach Luft schnappend hervor. »Sie muss es sehen. Irgendetwas stimmt nicht damit. Und Isabella muss schnell machen, denn die zwei sind hinter mir her.«
»Wer?« Niccolò blickte hinaus, doch in dem weißen Treiben konnte er nichts erkennen. Das ganze Schloss schien in einem blendenden Strudel verschwunden.
»Was ist denn hier …?!« Isabella stand plötzlich neben ihnen. Sie stürzte sich auf Giacomo, tastete sein Fell ab, strich über seinen struppigen Kopf. »Geht es dir gut?« Sie drückte ihn an sich.
Giacomo bellte auf und befreite sich aus der Umarmung. Es gab jetzt Wichtigeres zu tun. Dieses Paket vor ihm duftete nach Trüffel, obwohl es keine enthielt. Und er wollte endlich wissen, warum. Mit seinen Pfoten und Zähnen ließ sich die Rolle vielleicht zerfetzen, doch zum vorsichtigen Öffnen brauchte es weiche Menschenhände. Aber Isabella sah sich sein Fundstück überhaupt nicht an, sie hob das Türblatt auf und lehnte es gegen den offenen Rahmen, denn der Winter versuchte unablässig, ins Haus einzudringen, sandte eisigen Wind und Schneeflocken herein. Giacomo knurrte Isabella an. Warum begriff sie nicht, wie sehr die Zeit drängte? Der Vagabund war ihm gefolgt, und der Fahrer des Wagens hatte ihn merkwürdig fixiert. Er schlug mit der Pfote auf die Rolle.
Doch Isabella sah ihn gar nicht mehr an, sie war in die andere Ecke des Raums geeilt, in der sich Canini verkrochen hatte und winselte. Die Spanielhündin drückte sich immer tiefer in die Ecke, als könne sie im Mauerwerk wie in einer Höhle versinken. Giacomo bellte wieder und brachte immerhin Niccolò dazu, es ihm gleichzutun, beide schlugen nun mit den Pfoten auf die Rolle ein.
»Jetzt hört doch auf damit!«, rief Isabella. »Canini ist schon ganz verstört.«
Am Fenster erschien ein Schemen. Oder war es nur der Schatten eines Baumes? Warum bog er sich dann nicht im Sturm?
Giacomo rannte zu Isabella, biss in ihre Seidenbluse und zog daran. So kräftig, als sei es ein zähes Stück Fleisch.
»Seid ihr denn alle wahnsinnig geworden? Was soll das, du verrückter Hund? Willst du jetzt auch noch meine Sachen zerfetzen, nachdem du schon die Tür zerstört, Müll hereingeschleppt und die arme Canini verängstigt hast?«
Giacomo verstand nicht, was Isabella sagte, doch ihren Ärger spürte er. Sie würde ihm nicht helfen, würde dieses Geheimnis nicht lösen. Und der Schatten vor dem Fenster verfinsterte sich. Viel zu sehr.
In seiner Hilflosigkeit begann Giacomo wie wild seine Flanke zu lecken. Gleißendem Licht gleich entströmte Trüffelduft der verdammten Rolle, und seine Nase ließ sich nicht verschließen!
Dann hörte er über dem Wimmern Caninis und den weichen, schmeichelnden Worten Isabellas ein Knabbern. Wie von einer großen Maus.
»Hab den verdammten Mist gleich durch. Plastik ist ja so eklig.« Niccolò spuckte ein Stück aus. Mit seinen kleinen scharfen Zähnen hatte er die Folie gelöst, nur noch eine gute Pfote breit spannte sie über der Rolle. Dann hatte das Windspiel sie durch, wodurch das Innere sogleich an Volumen gewann, als wollte es sich nach der Zeit in Gefangenschaft endlich ausbreiten. Ein neuer Duft lag jetzt im Raum, leicht flüchtig, wie von etwas Vergangenem und doch vibrierend, als entstamme er einem lebendigen Wesen. Etwas Vergleichbares hatte Giacomo noch nie gerochen. Vorsichtig stieß er seinen Fund mit der Schnauze an, woraufhin sich dieser wie von selbst entrollte.
Es war ein dreckiges Tuch.
Zwei breite schwarze Streifen teilten es in Drittel, große dreieckige Löcher und Wasserflecken ließen es schäbig erscheinen. Ein unregelmäßiger Schleier schien wie ins Fischgrätmuster gewebt. Hinter den Löchern war ein Stützgewebe angebracht, an zwei Ecken fehlte Stoff – und irgendwie machte es Giacomo Angst. Vielleicht lag es an den Blutspuren.
»Das wurde gerade noch im Fernsehen gezeigt. Genau das Gleiche!«, sagte Niccolò fassungslos.
Plötzlich schrie Isabella auf, rannte zu ihnen und fiel vor dem merkwürdigen Fetzen auf die Knie.
»Um Gottes willen«, brachte sie stockend hervor und wiederholte den Satz immer wieder, als könne er die im Chaos versunkene Welt beruhigen. Sie tippte sich mit ihrer Hand auf die Stirn, dann auf die Brust, die rechte und die linke Schulter. Giacomo verstand nicht. Sie tat es gleich noch mal und senkte ihren Kopf dabei.
Der Schatten verschwand, oder war er nie dort gewesen? Hatte Giacomo sich alles nur eingebildet? Das Weiß vor dem Fenster war unberührt, als wäre die Welt gerade erst im Entstehen, als wäre niemals etwas anderes da gewesen als Schnee. Isabella streckte ihre Hand vor, langsam und zitternd wie eine Greisin. Dann berührte sie das Stück Stoff, Tränen in ihren Augen. Wie konnte dieser Lumpen Isabella so aus der Fassung bringen?
Niccolò spürte Isabellas Schmerz, aber er verstand ihn nicht. Warum nur weinte sie? Und wieso streichelte sie das Tuch zärtlich an den Seiten, als wagte sie nicht, weiter mit den Händen über das alte Gewebe zu fahren?
Als er ihre Gänsehaut sah, legte er sich vor den Türschlitz, um den Wind abzuhalten. Doch an Isabellas Frösteln änderte dies nichts.
Als Giacomo seine Pfote auf das Tuch legte, schüttelte sie den Kopf und schob den alten Trüffelhund vorsichtig zurück. Mit nervös zuckenden Händen kramte Isabella dann das Handy aus ihrer Jackentasche und versuchte eine Nummer zu wählen. Doch ihre Finger schienen die richtigen Tasten nicht zu finden, immer wieder musste sie neu ansetzen, Schweiß auf ihrer Stirn, obwohl durch die defekte Tür eisige Luft in den kargen Raum drang und ihn immer weiter auskühlte.
»Hallo? –Ja, ich rufe an, weil, das Tuch, ich … ich habe es … – Welches Tuch wohl? Das Grabtuch! – Ja, das von Jesus – Nein, ich will kein Geld – Ich habe es gefunden! – Herrgott noch mal, mein Hund hat es mir gebracht – Nein, ich nehme Sie nicht auf den Arm, ich bin hier im Westflügel des Schlosses Stupinigi – Ich weiß, dass es gerade renoviert wird, ich bin zur Wolfssichtung hierherbeordert worden – Ich weiß noch nicht, ob es Wölfe gibt, ich bin eben erst eingetroffen. Das ist im Moment auch völlig egal! Mein Hund hat verdammt noch mal das vermisste Grabtuch gefunden, und wenn Sie es nicht abholen wollen, dann drück ich es dem Nächstbesten in die Hand! – Danke, dass Sie kommen wollen – Bitte, beeilen Sie sich. Mir ist ganz unwohl mit dem Grabtuch.«
Obwohl sie aufgelegt hatte, bewegten sich ihre Lippen weiter, auf und zu ging der Mund, doch Worte kamen nicht heraus. Wäre Isabella ein Hund, Niccolò hätte sie für hungrig gehalten. Doch er spürte eine riesige Unruhe in Isabella, ein unerträgliches Warten, Sie kniete sich zu ihm, ihr Gesicht an seinen Hals gedrückt. Er leckte ihr über die Haare, als wäre sie ein Welpe, Canini trat langsam aus ihrer Ecke, und wie von selbst versammelte sich die kleine Runde um das Tuch. Giacomo fasste sich ein Herz und knabberte daran. Es roch nach Trüffeln, vielleicht schmeckte es ja auch danach. Aber es war wie dünnes, trockenes Brot. Keines zweiten Happens würdig. Zudem zog Isabella ihn heftig zurück. Obwohl sie auch kurz gelacht hatte, ohne das Weinen dafür zu unterbrechen. Menschen. Man wusste nie, woran man bei ihnen war. Nur bei seinem alten Herrn, dem Trüffelsucher, war es anders gewesen. Der war wie ein Hund. Wusste immer, was er wollte, und wollte nicht viel. Der Trifolao hatte auch nie seine Meinung geändert, weil es dafür einfach keinen Grund gegeben hatte. Das Leben verlief jeden Tag gleich. Er hatte sich alles längst gut überlegt und wusste immer, wie die Welt beschaffen war. Selbst sein eigener Tod hatte ihn nicht überrascht. Er hatte ihn erwartet, wie den Sonnenuntergang.
Als Isabella das Tuch vorsichtig wieder zusammenrollte, wurde die Welt blau. Zumindest in diesem Flügel des Schlosses Stupinigi. Kurze Befehle hallten durch die Nacht, Fenster wurden mit Gewehrschäften eingeschlagen, die lädierte Eingangstür aufgetreten. Sirenen ertönten. Isabella erstarrte, Canini und Niccolò bellten.
Doch Giacomo wollte nur noch weg. Nicht wie ein Hase in der Falle hocken. Fort von Lärm und Licht.
Aber nicht allein.
Irgendwie hing alles mit diesem dreckigen Tuch zusammen. Er brauchte nur Zeit zum Nachdenken. Es galt, nichts zu überstürzen.
Außer seiner Flucht.
Giacomo biss in ein Ende des aufgerollten Tuches, zog es aus der Tür und jagte hinaus in die tiefdunkle Nacht.
Hinter ihm begann das Geschrei. Ein Schuss wurde abgegeben. Neben ihm stob der Schnee auf.
Eine Männerstimme grölte. »Seid ihr wahnsinnig! Ihr könntet das Tuch treffen!«
Dann kam der Wald und nahm Giacomo auf, umschloss ihn mit seinen Stämmen und Zweigen. Der fallende Schnee verwischte rasch die Spuren des alten Trüffelhundes und spannte ein frisches Laken über das Land. Giacomo rannte weiter und weiter, bis er keine Rufe, keine Menschen mehr hinter sich hörte. Er musste ein Versteck für das Tuch finden – und viele, viele Antworten.
Kapitel 2
TURINO
Als Amadeus erwachte, fühlte sich sein Kopf an, als schliefe noch ein großer Teil davon. Die Welt erschien schummrig, faserte an den Seiten aus, und seine Erinnerungen waren löchrig. Warum lag er hier in einer Ecke des rechten Seitenschiffs vor dem Mausoleum der Giovanna d’Orlier de la Balme? Jemand musste ihn auf eine Ausgabe der La Stampa gelegt haben, ein Teil der Zeitung war wie eine Decke über ihm drapiert. Die Kälte spürte der junge Pharaonenhund trotzdem.
Der Duomo war nun so hell erleuchtet wie nie zuvor. Große Sonnen thronten auf metallenen Stäben, tauchten Wände, Böden und Bänke in ein einziges Gleißen. Viel weniger Menschen als vor seiner Ohnmacht befanden sich in der Kirche. Die meisten von ihnen trugen dieselbe Kleidung. Sie erinnerten Amadeus an die Männer der Stadtreinigung, Doch diese Menschen säuberten nichts, sie suchten. Ihren Blick kannte der Pharaonenhund. Einige schossen Fotos, andere gingen mit ihren Köpfen ganz nah ans Mauerwerk oder an die Türrahmen – und verharrten dann. Geredet wurde wenig, die Stimmung glich eher einer Beerdigung. Nur ein Mann, der den Mittelgang des Hauptschiffes beständig auf und ab schritt, verbreitete Hektik. Und rauchte in der Kirche! Amadeus hätte ihm den schmauchenden Stängel am liebsten aus der Hand geschlagen, doch sein Körper war zu schwach.
Zudem war dies nun nicht mehr sein Reich.
Das heilige Tuch war fort, eine leere Truhe musste niemand bewachen.
Sein Vater würde wissen, was nun zu tun war. Amadeus bewunderte ihn zutiefst, denn seine Augen blickten unfassbar weit. Auch wusste er auf alles eine Antwort. Zwar hatte Amadeus niemals Geschichten über eine solch ungeheure Begebenheit gehört, doch es musste sie geben, denn schon seit Jahrhunderten bewachte seine Meute das Tuch. Von den Tagen an, als der Herr in Israel darin gebettet lag, über die Zeit in der prachtvollen Stadt Edessa in Mesopotamien bis zur Marienkirche im Blachernen-Palast Konstantinopels. Kreuzritter raubten es von dort und brachten es den Templerrittern in Athen. Von dort gelangte es in die Hände des ehrenwerten französischen Ritters Geoffroy de Charny der eine Stiftskirche bei Troyes erbauen ließ, wo das Sindone den Gläubigen gezeigt wurde. Die Pharaonenhunde waren stets an der Seite des Tuches gewesen, hatten es nie aus den Augen gelassen. Selbst als es in eine Festung bei Monfort en Anoix gebracht wurde, fanden sie einen Weg, ihm zu folgen. Von Burg zu Burg wanderte es im Hause Savoyen. Die Meute allein wusste, welches Grabtuch das echte war. Mehrere befanden sich im Umlauf, die Menschen sahen nur mit den Augen, erblickten, was sie sich erhofften, und spürten nicht, was wirklich war. Lange Zeit bewachten die Hunde das Sindone in der Schlosskapelle von Chambéry, wo es in einer Silberkiste hinter dem Altar ruhte. Selbst den damaligen Brand hatte die Meute überstanden, die Menschen herbeirufend, um das Tuch den Flammen zu entreißen. Danach folgten die Jahrhunderte in Turin, der neuen Residenzstadt des Hauses Savoyen.
Nichts hatte die Pharaonenhunde vom Sindone trennen können, Amadeus schlich hinaus, vorbei an weiteren Uniformierten. Das, was ihn mit dem Duomo verband, existierte nicht mehr. Trotzdem fiel es ihm mit jedem Schritt schwerer, jenen Platz zu verlassen, der ihm für den Rest seines Lebens zugewiesen worden war.
Der Weg zur Heimstatt der Meute war kurz. »Die Insel« nannten sie diese, denn im unruhigen Meer Turins, nah den wogenden Massen der Bewunderer des Sindone, lag sie still und sicher. Wieder fiel Schnee und bedeckte alle Spuren rund um den Duomo. Petras schien kein Interesse an der Aufklärung dieses Verbrechens zu haben.
Amadeus’ Schritte beschleunigten sich, er wollte zurück zwischen die Leiber seiner Meute, die in kalten Wintenächten wie Blätter aufeinanderlag, eine wunderbare Wärme ausströmend. Die Insel lag in den Giardini Reali, die direkt an den Duomo grenzten. Zwei seiner Brüder hielten Wache im Park. Von der imaginären Linie auf dem schneebedeckten Rasen wussten nur die Pharaonenhunde. Diese Grenze bestand schon, bevor die Stadtverwaltung beschlossen hatte, hier Gras zu säen. Sie stammte aus einer Zeit, als an dieser Stelle noch Mauern verliefen.
Amadeus verfiel in einen Galopp, denn nur noch wenige Meter trennten ihn von seinen Brüdern, und er wollte sie umrennen, wie er es als Welpe immer getan hatte. Ihm war nach Übermut, nach Raufen und Jagen, um das zu vergessen, was er im Duomo hatte erblicken müssen. Amadeus kläffte spielerisch.
Doch er erntete ein Zähnefletschen.
Tief hingen die Häupter der geliebten Brüder, hoch die Lefzen, die scharfen Fänge bloßlegend, das Knurren drang tief aus ihren Körpern.
Dies war kein Spiel.
Amadeus stoppte abrupt, durch den Schwung seines Laufs stürzte er dabei fast. Und legte den Kopf zur Seite. Dies waren doch seine Brüder, er sah und roch es! Es war sein Blut, und es stand ihm feindlich gegenüber, als sei er ein eindringender Dachs. Der Intimfeind seines Rudels. Einer der gefräßigen Räuber musste hinter ihm stehen.
Amadeus drehte sich langsam um, bereit, sich auf den Grimbart zu stürzen.
Doch hinter ihm lag nur frisches, unschuldiges Weiß. Als Amadeus wieder zurück zur Insel blickte, stand dort nun auch sein jüngster Bruder, dem er alles über das Leben in den Straßen und Gassen Turins beigebracht und die unerschöpflichen Mülltonnen des Porta Palazzo gezeigt hatte. Er war noch nicht einmal ausgewachsen.
Warum nur knurrten sie ihn an?
Waren sie erkrankt? Doch er sah keinen Schaum der Tollwut an ihren Mäulern. Im Gegenteil. Sie wirkten stark wie nie zuvor.
»Was ist mit euch?« Er trat näher. Das Knurren wurde lauter. Doch eine Antwort erhielt er nicht.
»Ich muss mit Vater sprechen. Dringend. Es ist etwas Schreckliches passiert!«
Wieder diese Wand aus Feindschaft.
»Redet endlich mit mir oder lasst mich durch!«
Er ging einen weiteren Schritt vor und sah die Muskeln seiner Geschwister zucken, das Knurren wurde noch tiefer. Würden sie ihn tatsächlich angreifen?
Er musste es darauf ankommen lassen.
Es war ein Bruder aus dem ersten Wurf der Mutter, welcher sich nun aufrichtete, um ihm zu antworten. Bei der Nachfolge als Wächter war er übergangen worden, weil ihm die innere Ruhe fehlte.
»Hau ab! Du gehörst nicht mehr zu uns. Jetzt sehen alle, dass ich recht hatte. Du bist Dreck, eine Schande für alle unsere Ahnen und Urahnen. Du hast das Sacra Sindone verloren. –Jetzt!«
Von rechts schoss seine Schwester auf ihn zu und biss ihn in die ungeschützte Flanke. Die Wunde war nicht tief, doch sie schmerzte ungemein. Immer mehr Pharaonenhunde drangen zur Grenze, senkten die Köpfe und zeigten ihre Fänge.
Sie würden ihn zerfetzen.
Dann begann das Geheul und Gebell. Wie Irre benahmen sie sich plötzlich. Und Amadeus spürte, dass sich ihm jemand näherte, von hinten heranschlich, auf leisen Pfoten und doch von großer Präsenz. Er sprang herum, bereit zum Kampf, die Ohren zurückgelegt.
Doch er blickte nur in das gütige Gesicht seiner Großmutter Nara, deren Schnauze längst grau geworden war, aber die im Schnee fast zu glühen schien.
»Halt dich fern von dieser Schande!«, schrie ihr eine seiner Schwestern zu. »Er hat uns alle entehrt!«
Doch Nara scherte sich nicht darum und leckte Amadeus beruhigend über die Bisswunde. »Komm, mein Guter. Lass uns miteinander reden. Hier ist es mir zu laut.«
Traurig blickte Amadeus auf seine Geschwister und die ganze Meute, welche eine Mauer bildete, ihn von Vater und Mutter trennte.
»Kannst du mich nicht zu Vater bringen? Dich achten sie!«
»Ach, Amadeus«, sie blickte ihn sorgenvoll an. »Folge mir.«
Obwohl sie sich entfernten, ging das Heulen und Bellen weiter. Es kam Amadeus sogar vor, als würde es noch intensiver, als wollten sie jeden Meter, den er sich mit Nara entfernte, überbrücken, indem sie ihren Lungen alle Luft auspressten.
Seine Großmutter führte ihn die leichte Erhöhung hinauf, die der Meute bei Gefahr als Ausguck diente.
»Schau dorthin, und du wirst verstehen. Oder zumindest damit beginnen.«
Amadeus folgte ihrem Blick.
In der Mitte der Insel, unter einer schneebedeckten Hecke, lag leblos sein Vater. Direkt daneben seine Mutter, am ganzen Leib zitternd.
»Ist er … tot?«
Seine Großmutter ließ sich im Schnee nieder, »Nein. Aber leben tut er auch nicht. Er ist zwischen den Welten. Er erträgt die Scham nicht, das Sindone verloren zu haben. Denn er war es, der dich für die Nachfolge ausgewählt hatte – und du hast schrecklich versagt. Deshalb trägt auch er nun große Schuld. Er würde gerne sterben, um dem Schmerz zu entfliehen. Doch dann würde er seinen Ahnen gegenübertreten, bei denen er nun keinen Platz finden wird. Sie werden ihn nicht zu sich lassen, er würde im Jenseits für sich allein bleiben. Deshalb hat er lähmende Angst vor dem Tod. Es gibt keine Heimat mehr für ihn, nirgendwo. Er will weder leben noch sterben.«
Der Körper seines stolzen Vaters wirkte wie verkümmert. In schmerzhaft langen Abständen stieß er spärliche Atemwolken aus. Amadeus sah lange hin, hoffte, er würde mit einem Mal aufspringen, eine Lösung finden.