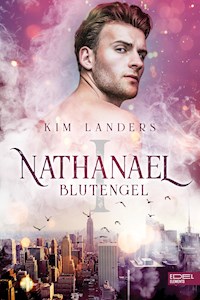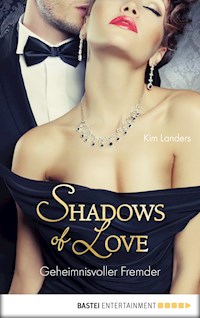3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Blutengel Aaron ist dem Mörder seiner Familie auf der Spur, Seraphiel und seine Verbündeten können sich ihm nicht ewig entziehen. Für Aaron ist es mehr als nur eine Mission, es ist sein Lebensinhalt. Auf seiner Suche trifft er auf die Ärztin Rebecca, die durch ihre Gabe, Krankheiten zu erfühlen, ins Visier dunkler Mächte geraten ist. Vom ersten Moment an fühlen beide sich unwiderstehlich voneinander angezogen. Doch ein Geheimnis aus Rebeccas Vergangenheit bringt beide in höchste Gefahr. Gemeinsam kämpfen sie gegen die höllischen Gegner und begeben sich auf die Suche nach der Wahrheit. Dabei geraten sie immer tiefer in ein Netz aus Verrat, Intrigen und Machtkämpfen ... Aaron und Rebecca müssen einander vertrauen, wenn sie gegen den übermächtigen Gegner bestehen wollen. Doch dann erfährt Rebecca, dass Aaron nach San Francisco gekommen ist, um auch sie zu töten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Der Blutengel Aaron ist dem Mörder seiner Familie auf der Spur, Seraphiel und seine Verbündeten können sich ihm nicht ewig entziehen. Für Aaron ist es mehr als nur eine Mission, es ist sein Lebensinhalt. Auf seiner Suche trifft er auf die Ärztin Rebecca, die durch ihre Gabe, Krankheiten zu erfühlen, ins Visier dunkler Mächte geraten ist. Vom ersten Moment an fühlen beide sich unwiderstehlich voneinander angezogen. Doch ein Geheimnis aus Rebeccas Vergangenheit bringt beide in höchste Gefahr. Gemeinsam kämpfen sie gegen die höllischen Gegner und begeben sich auf die Suche nach der Wahrheit. Dabei geraten sie immer tiefer in ein Netz aus Verrat, Intrigen und Machtkämpfen ... Aaron und Rebecca müssen einander vertrauen, wenn sie gegen den übermächtigen Gegner bestehen wollen. Doch dann erfährt Rebecca, dass Aaron nach San Francisco gekommen ist, um auch sie zu töten …
Kim Landers
Aaron
Blutengel 2
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2019 by Kim Landers
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Kossack
Covergestaltung: Marie Wölk, Wolkenart Design
Lektorat: Franziska Köhler
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-323-6
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Prolog
Es gab für sie kein Entrinnen. In ihrem Hirn spielte sie alle Varianten einer möglichen Flucht durch und kam zu einem niederschmetternden Ergebnis. Wenn sein heißer Atem in sie drang, würde es mit ihr vorbei sein. Sie konnte sich keine schlimmere Art zu sterben vorstellen. In Panik krallten sich ihre Fingernägel in die Tapete.
Der Tag war gemächlich verlaufen, wie immer, bis es vorhin an der Tür geklingelt hatte. In der Annahme, es wäre ihr Mann, der den Schlüssel vergessen hatte, war sie aufgestanden, um zu öffnen. Im nächsten Moment war sie vor Entsetzen zurückgewichen, als sie dem gegenüberstand, den alle nur den «Roten» nannten. Der, der aus dem Feuer geboren worden war.
All die Jahre hatte sie sich in Sicherheit gewähnt, war von Ort zu Ort gezogen und hatte immer wieder ihren Namen gewechselt. Dennoch hatte er sie aufgespürt. Jemand hatte sie verraten.
Sie musste den Kopf weit in den Nacken legen, um zu ihm aufzusehen. Seine Augen schimmerten wie glattpolierter Obsidian und betrachteten sie ohne Mitleid. Grob stieß er sie beiseite und trat ein. Sein schulterlanges Haar glänzte im Lampenlicht wie gesponnenes Gold. Sein schmales Gesicht mit den feinen Zügen und den hohen Wangenknochen, das mit jeder Madonnenstatue konkurrieren konnte, täuschte über seine schwarze Seele hinweg.
Er kannte weder Gnade noch Mitleid.
Langsam wich Carmen zurück. Furcht kroch ihren Nacken hinauf und drückte ihr die Kehle zu. Sein hämisches Grinsen verriet, wie sehr er ihre Angst genoss.
«Hast du wirklich geglaubt, ich würde dich nicht finden?», erklang seine Bassstimme.
Für ihn war sie eine Hure, deren Ende er vor langer Zeit besiegelt hatte. Carmen stieß mit dem Rücken gegen die Wand. Sie hatte gewusst, dass dieser Tag kommen würde, und sich immer davor gefürchtet. Doch viel zu schnell war er eingetroffen.
Eine Tür knarrte im Obergeschoss. Die Kinder! Sie schliefen in ihren Zimmern. Denk nicht an sie, sonst bringst du sie in Gefahr!
Mit keinem Deut verriet seine Miene, ob er ihre Gedanken gelesen hatte. Sie starrte auf den Sekundenzeiger der Uhr an der gegenüberliegenden Wand, der im gleichmäßigen Tempo Strich für Strich um die eigene Achse wanderte. Mit jedem leisen Klacken näherte sie sich dem Tod. Ihr wurde übel. Die Hoffnung, ihm zu entkommen, sank mit jedem Atemzug. Keiner würde ihr helfen. Sie war eine Vergessene.
«Wo ist mein Kind?»
Seine Stimme ließ ihren Brustkorb vibrieren. Er beugte sich weit zu ihr herab und stützte sich mit der Hand neben ihrem Kopf ab. Sein heißer Atem brannte auf ihrer Haut. Ihr Herz hämmerte im Schädel. Wie hatte sie nur hoffen können, er würde sie vergessen! Jetzt verlangte er Antworten, bevor er sie in den Tod schickte. Antworten, die sie ihm nicht geben konnte, weil sie sie nicht kannte.
Ihr Blick fiel auf seine Handgelenke, in die sich die Ketten der Gefangenschaft über die Jahrhunderte hinweg eingegraben hatten. Wulstige Narben zogen sich über seine bloßen Arme. Wie mochte es ihm nur gelungen sein auszubrechen?
«Ich … ich weiß es … doch nicht», stotterte sie und presste ihre feuchten Hände an die Jeans.
Selbst wenn sie es gewusst hätte, wäre sie eher gestorben, als es ihm zu sagen. Sie hatte geschworen für immer zu schweigen. Er schnaubte vor Zorn und bleckte die Zähne. Hinter seinem Rücken breiteten sich seine Schwingen aus, die bis zur Decke reichten. Die Federn seiner Flügel waren schwarz. Nur ein weißer Rand zeichnete sich unten ab, ein Relikt seiner wahren Herkunft, bevor er sich auf die andere Seite geschlagen hatte. Luzifers Seite.
«Du wagst es, mich anzulügen?»
Carmen fröstelte unter seinem Blick. Die Angst um ihre Kinder, die oben in ihren Betten schliefen, schnürte ihr die Kehle zu. Er durfte ihnen nichts tun!
«Zu spät. Du hast gerade deine Bälger verraten.»
Er lächelte triumphierend, und Carmen erstarrte.
«Oh nein, bitte hab Erbarmen», flehte sie, obwohl sie wusste, dass es zwecklos war.
«Erbarmen? Meine Geduld ist am Ende. Entweder du sagst mir, wo mein Kind ist, oder deine werden sterben!» Seine Stimme klang wie ein tiefes Grollen.
«Nein! Bitte, das kannst du nicht tun. Sie sind unschuldig!»
«Mummy? Mummy?», rief eine Kinderstimme durch den Flur. Eine eiskalte Hand griff nach Carmens Herz und drückte es zusammen.
«Ich kenne den Ort nicht. Bitte glaub mir doch.» Sie sank auf die Knie und presste die Hände gegen ihre heißen Wangen. «Töte mich, aber verschone meine Kinder!»
Sein Grinsen wurde breiter. «Wie rührend. Wärest du denn um deinen geflügelten Sprössling auch so besorgt?»
Carmen schluckte, seine Worte rissen alten Wunden auf. Sie vermisste ihren Ältesten, für den das Schicksal einen anderen Weg bestimmt hatte.
«Bei meiner Seele, Madre de dios, ich schwöre, ich nicht weiß nichts!»
Die Miene des Roten verdüsterte sich. «Ich habe jetzt genug von deinen Lügen!»
Carmen überlief es abwechselnd heiß und kalt. Nur zu gut erinnerte sie sich daran, wie sie der blonden Frau damals zur Flucht verholfen und sie in der dunkelsten Ecke eines Eisenbahnwaggons versteckt hatte. Es war die Verzweiflung in ihrem Blick gewesen, die Carmen überzeugt hatte, ihr zu helfen. Nach der gelungenen Flucht war der Rote plötzlich im Viertel aufgetaucht und hatte nach der Geflohenen gefragt, bis er vor ihrer Tür stand. Sie hatte abgestritten, die Frau je gesehen zu haben.
«Stirb», raunte er und öffnete seinen Mund.
Flammen schlugen ihr entgegen und verbrannten ihren Hals. Der Schmerz überwältigte sie, sodass sie wimmernd zu Boden sank. «Ich weiß … es … nicht. Ich … weiß es wirklich … nicht», krächzte sie und krümmte sich vor seinen Füßen.
Verzweifelt sah sie zu ihm auf. Als sie seinem Blick begegnete, spürte sie einen stechenden Schmerz in den Augen, der tief in ihren Kopf drang und sich rasch in ihrem Körper ausbreitete.
Sie hätte ihm niemals in die Augen blicken dürfen. Carmen bereute ihren Fehler bitter, denn schon floss das Blut wie heißes Öl durch ihre Adern. Ihre Haut platzte auf und das Blut schoss heraus. An der Luft entzündete es sich wie Gas. Es fraß ihre Haut und das Fleisch von den Knochen, fraß sich weiter durch ihre Eingeweide. Sie wand sich schmerzverzerrt und brüllte wie ein Tier.
«Keiner bleibt ungestraft, der sich gegen mich stellt», hörte sie ihn sagen.
Doch der Schmerz vernebelte ihr Hirn, jeglicher Widerstand brach zusammen und sie ergab sich der Qual. Sie sah ihr Leben in rasenden Sequenzen vor ihren Augen vorüberziehen, und irgendwann spürte sie den Schmerz nicht mehr. Mit dem letzten verzweifelten Gedanken an ihre Kinder, die sie nicht hatte retten können, verlor sie die Besinnung.
1.
Endlich ein paar freie Tage in New York. Keine Jagd auf Dämonen oder Gefallene, sondern nur relaxen und in der Erinnerung schwelgen, bevor er wieder nach Rom zurückkehrte.
Genau das, was Aaron jetzt brauchte. Nur das schlechte Gewissen Alessandros gegenüber quälte ihn. Über ein halbes Jahr lebte er nun schon in Rom und hatte es nicht geschafft, seinen Freund und Lehrmeister zu besuchen – wegen seines Jobs. Wenn er zurückkehrte, würde er auch dieser Einladung endlich folgen.
Kaum war er durch die Passkontrolle, klingelte sein Handy. Joel. «Hi, Joel. Schon unterwegs?», begrüßte er den Freund am Telefon.
«Ich komme nicht.»
«Was heißt das jetzt?»
«Ich muss was Dringendes erledigen. »
«Was ist denn so wichtig?»
Aaron war enttäuscht. Irgendetwas stimmte nicht.
Joel druckste herum, bis er von Cynthia berichtete.
Was redete er da bloß von geheimen Treffen der Apokalyptiker? Das ließ neue Probleme erahnen. Selbst an seinen freien Tagen blieb ihm nichts erspart.
Cynthia war nicht nur eine wichtige Prophetin, sondern ihr gehörte das Engelsghetto, der geheime Treffpunkt aller Mischwesen in New York, das nicht nur Joels, sondern auch einmal sein Zuhause gewesen war. Er spürte, dass sein Freund auf seine Hilfe hoffte.
«Ich dachte, du unterstützt mich ein wenig gegen die Apokalyptiker.»
Aaron stöhnte auf. Nicht die schon wieder! Hinter den Apokalyptikern verbarg sich eine Satanssekte, die in letzter Zeit für mehr Ärger sorgte, als es den Engeln lieb war. Joel hatte von seinem Vater den Auftrag bekommen, ihren Anführer, der sich selbst «der Verkünder» nannte, zu beobachten.
Einesteils reizte es Aaron, Joel zu unterstützen und diesem Verkünder einen Denkzettel zu verpassen … Nein, nein, nein, nicht nachgeben. Keine Jagd auf Kreaturen, hatte er sich geschworen.
«Sorry, aber ich wollte einfach nur entspannen.»
«Hm. Wo bleibt dein Jagdinstinkt? Ich dachte, du wolltest vielleicht deine neuen Waffen ausprobieren.»
Joels Köder hatte Aaron bereits am Haken. «Nur wenn du meine Hilfe brauchst. Aber nur dann!»
«Ich wusste, dass du nicht Nein sagen kannst», antwortete Joel und lachte.
Der Dreckskerl wusste genau, wie er ihn herumkriegen konnte. Dennoch war Aaron ihm nicht böse.
2.
Geschafft! Die letzten Sachen waren in der Reisetasche verstaut, die Umzugskartons verschickt. Mit einem zufriedenen Seufzen lehnte Rebecca sich an die Wand und ließ den Blick durch die leere Wohnung schweifen. Nun war sie froh, damals eine möblierte Wohnung gemietet zu haben. New York sollte schließlich immer nur eine Zwischenstation in ihrer Karriere sein.
Sie drehte sich zum Fenster und stöhnte. Der blaue Kombi stand noch immer unten auf der Straße vor ihrem Lieblings-Coffeeshop. Der Fahrer sah durchs geöffnete Fenster mit einem Fernglas zu ihr herauf. Was wollte der Kerl von ihr?
Er war ihr zum ersten Mal aufgefallen, als sie neulich aus der Buchhandlung gekommen war. War er ein Stalker oder ließ Martin sie heimlich von einer Detektei überwachen? Es wäre ihrem Ex-Freund durchaus zuzutrauen. Schon zwei Mal hatte sie die Polizei angerufen, aber der fremde Kerl war so gewieft, dass er jedes Mal verschwunden war, bevor die Cops auftauchten. Und es war ihr unmöglich, ihn genauer zu beschreiben, weil er seinen Hut stets weit ins Gesicht gezogen hatte.
Wenn sie in vier Tagen nach San Francisco zog, würde sie ihn nicht mehr sehen, beruhigte sie sich. Könnte sie das nur glauben. Nur zu gut erinnerte sie sich an einen Fernsehbericht, den sie neulich gesehen hatte. Newport war eine Kleinstadt, in der sie eine Zeit lang gelebt hatte.
Deutlich hörte sie die Stimme des Reporters: «Die verbrannten Leichen der beiden verschwundenen Frauen, Laura-Jane McAvoy und Gail Sheridan, konnten nur noch anhand ihrer Zähne identifiziert werden. Die Polizei geht von Ritualmorden aus. Verdächtigt werden zwei Männer, die einer Satanssekte angehören.»
In den Nachrichten wurde ständig über Morde berichtet, woran sie sich gewöhnt hatte. Doch diese beiden Frauen kannte sie. Laura-Jane hatte in der Nachbarschaft gewohnt und die lebenslustige Gail als Krankenschwester am selben Krankenhaus gearbeitet wie sie. Eine Gänsehaut kroch Rebeccas Rücken hinauf. Plötzlich vibrierte ihr Handy in der Hosentasche. Rebecca zog es heraus und sah aufs Display. Martin. Eben noch hatte sie an ihn gedacht. Wenn man vom Teufel sprach …
Jetzt nicht! Sie drückte ihn weg. Es war alles gesagt. Das kurze Piepen verriet den Eingang einer SMS. Gib uns eine Chance.
Rebecca verdrehte die Augen. Sie konnten Freunde sein, mehr nicht. Wann kapierte er das endlich? Wütend steckte sie das Handy in die Hosentasche zurück. Sie musste jetzt los, wenn sie nicht zu spät zum Dienst erscheinen wollte.
Es dämmerte bereits, als Rebecca das Haus verließ. Sie fühlte sich unwohl und ihre Haut an den Unterarmen brannte. Bereits seit heute Morgen stand der blaue Kombi vor dem Coffeeshop. Der Kerl glotzte penetrant. Rebecca vermied es, zu ihm hinüberzusehen, und eilte zu ihrem Wagen.
Als sie die Garage verließ, war der Kombi fort und sie atmete auf. Ihre Erleichterung währte jedoch nicht lange, bereits an der nächsten Ampel erkannte sie im Rückspiegel, dass er ihr folgte. Jetzt konnte sie nur hoffen, ihn irgendwo zwischen Queens und Manhattan abzuhängen.
Doch der Kombi war immer noch hinter ihr, als sie über die Queensboro Bridge fuhr. Rebecca warf einen flüchtigen Blick in den Rückspiegel. Shit! Aber es war einen Versuch wert, einen Umweg in Kauf zu nehmen und ihn an irgendeiner Kreuzung abzuhängen.
An der nächsten Ampel bog sie rechts ab. Der Kombi blinkte ebenfalls und fuhr weiter hinter ihr her. Ein unheimliches Gefühl, verfolgt zu werden. Rebecca überquerte eine Kreuzung und trat das Gaspedal durch. Der Motor jaulte auf und ihr alter Toyota schoss mit einem schnarrenden Geräusch nach vorn. Der Kombi klebte weiter an ihr. Hatte sie vielleicht einen Magneten im Heck? Einen Moment lang überlegte sie, ihren Verfolger anzuhalten und zur Rede zu stellen, verwarf diesen Gedanken aber schnell wieder. Er könnte schließlich bewaffnet sein.
In der Nähe gab es einen Supermarkt mit einem Hinterhof, der von der Straße aus nicht einzusehen war. Dort parkte sie immer, wenn sie nach der Spätschicht noch einkaufen musste. Zwei Wagen drängten sich plötzlich zwischen den Kombi und sie.
Nach der nächsten Kurve war er auf einmal verschwunden, und sie atmete erleichtert auf. Sie warf einen letzten Blick über die Schulter zurück, um sich zu vergewissern, dass er tatsächlich nirgendwo auftauchte, bevor sie den Wagen auf den Hinterhof des Supermarktes steuerte. Rebecca wartete noch Weile, bis sie sich sicher war, dass er ihr nicht gefolgt war, dann stieg sie aus.
Außer ihr parkte im Hof nur noch ein Motorrad dicht an der Mauer. Sie blieb bei der schnittigen schwarz-roten Honda-Fireblade stehen und bewunderte sie im Schein der Neonreklame von allen Seiten, strich über das Lenkrad und warf einen Blick auf den Tacho. Wow! Es musste ein irres Gefühl sein, auf ihr zu fahren.
Sie hatte sich früher nie für Motorräder interessiert, bis sie die Honda in der Werbung gesehen hatte. Natürlich mit einem überaus attraktiven Fahrer. Na klar, träum weiter. Den Doppelpack Motorrad-Traummann gibt es nur in Werbespots.
Ihr Handy vibrierte erneut. Dieses Mal war es ein Alarm, der sie daran erinnern sollte, dass ihr nur noch eine Stunde Zeit blieb, um vor der Schicht noch den Schriftwechsel zu erledigen, den sie seit Tagen aufgeschoben hatte. Mit einem Anflug von Bedauern riss sie sich vom Anblick des Motorrades los und öffnete die Tür zum Supermarkt. Sie lief direkt zur Obsttheke, angelockt von den rotbackigen Äpfeln, die herrlich süß dufteten.
Sie waren in dekorativen Weidenkörben einsortiert, als wären sie frisch in Vermont vom Baum gepflückt worden. Lecker. Das Wasser lief ihr im Mund zusammen. Genau das Richtige für zwischendurch in der Nachtschicht. Sie zog eine von diesen hauchdünnen Plastiktüten vom Stapel neben den Körben und stopfte ein Dutzend Äpfel hinein.
Jetzt noch Truthahn-Sandwiches, und sie war versorgt. Sie drehte sich im Kreis und entdeckte die Sandwiches in einem Regal am Ende des Gangs. Weil sie sich im obersten Fach befanden, musste sie sich auf die Zehenspitzen stellen und den Arm ausstrecken. Dabei blieb die Tüte mit den Äpfeln an einer Regalkante hängen und riss auf.
Ehe sie zugreifen konnte, fiel das Obst heraus und kullerte über den Boden. Leise fluchend hockte sie sich hin und sammelte es wieder auf. Eine Verkäuferin in blauem Kittel reichte ihr lächelnd einen Korb. Es gelang ihr schließlich, alle einzusammeln bis auf einen, der unter eine Ecke des Regals gerollt war. Sie wollte ihn nicht liegen lassen und kniete sich hin, um nach ihm zu hangeln.
Er klemmte zwischen Regal und Fußboden fest. «Widerspenstiges Scheißerchen», murmelte sie und stupste ihn mit den Fingern an.
Leider bekam er zu viel Schwung, prallte von der Rückwand ab und kugelte auf der anderen Seite in den Gang, wo er von einem Paar schwarzer Stiefel gestoppt wurde.
Der Stiefelbesitzer bückte sich und hob ihn auf. «Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mir heute noch eine schöne Frau zu Füßen liegen würde.»
Die dunkelsamtige Stimme ließ sie aufblicken. Ein Bild von einem Mann in schwarzer Motorradkluft stand nur wenige Schritte vor ihr und grinste sie jungenhaft an. Männlich, sexy und mit einem Touch Verwegenheit. Seine muskulösen Schultern und Arme schienen die Lederjacke fast zu sprengen. Sein lackschwarzes Haar war kurz geschnitten und kräuselte sich im Nacken. Auf seinen Wangen zeichnete sich ein Dreitagebart ab. Seine dunklen Augen strahlten nicht nur Selbstsicherheit und Neugier aus, sondern es lag auch ein Hauch Wehmut darin.
Er hielt den Apfel in der Hand und drehte ihn lässig. Wie lächerlich musste sie auf den Knien robbend auf ihn wirken. In seinen dunklen Augen blitzte es amüsiert auf.
Er lächelt charmant, schoss es Rebecca durch den Kopf. Und diese Grübchen …
«Das habe ich nur getan, um Sie mit dem Apfel zu verführen», entfuhr es ihr. Sie war zwar nicht auf den Mund gefallen, aber selten so schlagfertig. Deutlicher konntest du dein Interesse an ihm nicht zeigen, Rebecca, tadelte sie sich. Egal, sie flirtete nun mal gern.
Sein Lächeln wurde breiter. «Gut gekontert, Eva.»
So wie er den Namen aussprach, klang es sündig, wie Adam, der Eva verführen wollte. Dabei sollte es doch umgekehrt sein. Noch dazu war er genau der Typ Mann, der ihren Puls in die Höhe schnellen ließ.
Unter seinem Arm klemmte ein Motorradhelm, und in der Hand hielt er einen Sixpack Budweiser. Beides legte er ins Regal. «Darf ich Ihnen aufhelfen?»
Rebecca schwieg. Sie war vom Klang seiner Stimme gefangen und hätte ihr ewig lauschen können.
«Oh, danke, natürlich.»
Erst jetzt bemerkte Rebecca, dass sie bei den Kunden Aufsehen erregten. Sie lächelte verlegen und fasste seine Hand. Fast hätte sie sie im selben Moment wieder losgelassen, denn bei dieser simplen Berührung durchfuhr es sie wie ein Stromstoß.
Behutsam zog er sie hoch und hielt ihre Hand noch eine Weile länger als erforderlich. Sein Daumen strich über ihren Handrücken und hinterließ ein Prickeln. Schließlich drückte er ihr sanft den Apfel in die Hand.
«Danke für den Ausreißer», sagte Rebecca mit belegter Stimme und lachte.
Himmel, ihr Lachen hörte sich wie Gänsegeschnatter an. Doch das lag nur daran, dass sie sich in der Nähe dieses Mannes seltsam befangen fühlte. Dieses Gefühl war ihr bislang fremd gewesen. Sie arbeitete mit vielen Männern eng zusammen und keiner von ihnen verunsicherte sie so wie er.
«Gern geschehen.»
Seine Stimme weckte in ihr Fantasien, von denen sie nie geglaubt hätte, sie zu besitzen. Ob er einer Frau beim Sex Koseworte ins Ohr flüsterte? Fast glaubte sie, seine Lippen an ihrer Ohrmuschel zu spüren. Eine Gänsehaut breitete sich auf ihrem Rücken aus.
In seinen Augen blitzte es begehrlich auf. Noch nie hatte sie jemand auf Anhieb so in den Bann gezogen. Seine Ausstrahlung war sinnlich, düster und geheimnisvoll. Sein ausgeprägtes Kinn verriet Willensstärke. Bei ihm würde vermutlich jede Frau schwach werden.
Sie wandte sich rasch ab und legte den letzten Apfel in den Korb. «Ich … muss jetzt zur Kasse. Also, darf ich vielleicht …» Sie deutete mit dem Zeigefinger über seine Schulter, damit er sie durchließ.
«Ja, natürlich, ich auch. Bitte nach Ihnen.» Er nickte und trat einen Schritt beiseite, um sie durchzulassen.
Galant war er auch, dachte sie anerkennend. Ihre Finger zitterten leicht, als sie an der Kasse bezahlte und ihre Einkäufe in einer Tüte verstaute. Schuld daran war, dass er dicht hinter ihr stand und sie seinen männlichen Duft riechen konnte. Deutlich spürte sie seinen Blick im Rücken.
Komm, sag was, bevor ich gehe, flehte sie im Stillen, aber zu ihrer Enttäuschung schwieg er. Sie warf einen Blick über die Schulter, bevor sie mit einem knappen «Bye» aus dem Supermarkt eilte.
Er hielt sie nicht zurück, sondern nickte ihr nur zu. Draußen drehte sie sich noch einmal nach ihm um. Ein Mann wie er war bestimmt in festen Händen. Rebecca klemmte sich die Tüte unter den Arm und schloss die Autotür auf, als sich hinter ihr ein Wagen näherte.
Sie wirbelte herum und erkannte den blauen Kombi. Schon wieder dieser Kerl! Sie sprang ins Auto und drehte den Zündschlüssel. Das Stottern verhieß nichts Gutes. Ausgerechnet jetzt streikte der Motor.
«Spring verdammt noch mal an!»
Sie trat Kupplung und Gas und drehte erneut den Schlüssel herum. Ein Klicken folgte, mehr nicht. Dafür leuchteten im Display unzählige rote Lämpchen auf. Klasse! Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Rebecca schlug mit der Faust gegen das Lenkrad und fluchte. Der Kombi hielt direkt neben ihr und das Fenster öffnete sich. Sie schluckte, als sie das hämische Grinsen auf dem hageren Gesicht erkannte.
Sie kurbelte das Fenster herunter. «Wer sind Sie und was wollen Sie von mir?»
«Dich!»
Hatte er das eben gesagt oder hatte sie sich das nur eingebildet? Seine Lippen hatten sich nicht bewegt.
Sein finsterer, gieriger Blick verriet seine Absicht. Im Laden wäre sie vor ihm sicher. Jedenfalls hoffte sie das. Rebecca sprang aus dem Wagen und sprintete zum Supermarkteingang zurück. Doch der Kombi schoss vor und versperrte ihr den Weg.
Bloß keine Angst zeigen, denn genau das will er, redete sie sich zu. Sie rannte nach rechts. Doch wieder war er schneller und vereitelte ihr Entkommen. Jetzt hatte er sie auch noch blöderweise in eine Ecke manövriert. Verdammter Mist! Sie sah durch die Windschutzscheibe in seine vor Zorn verzerrte Miene.
Der Kerl war zu allem bereit, schoss es ihr in den Kopf, auch zu einem Mord! Rebecca schluckte gegen den Kloß in ihrem Hals. Ihr Herz hämmerte so laut, dass sie glaubte, er könne es hören. Der Fremde ergötzte sich offensichtlich an ihrer Furcht. Sie wog die wenigen Alternativen ab, die ihr blieben, und es waren nicht viele.
«Hey, Sie! Ich rufe jetzt die Polizei, wenn Sie nicht sofort verschwinden!» Sie zog ihr Handy aus der Tasche und hielt es demonstrativ hoch, während sie die Notrufnummer wählte. Rebecca fluchte, als der Hinweis «Kein Netz» übers Display flimmerte. Scheiße, das hatte ihr gerade noch gefehlt!
Konnte er das erkennen?
«Du bist erledigt!», brüllte er und trat aufs Gas.
Rebecca zuckte zusammen und warf einen Blick zum Eingang des Supermarktes. Bekam denn keiner da drinnen mit, was hier draußen vor sich ging? Sie wollte auf die Motorhaube klettern, um auf die andere Seite zu gelangen. Da sprang er aus dem Wagen, packte ihren Arm und zerrte sie grob zu sich her. Rebecca trat und schlug nach ihm, aber er ließ sie nicht los, sondern drückte nur noch fester zu.
«Das wird dir nichts nützen, Babe», knurrte er. Er öffnete die Tür zum Fond des Wagens und stieß sie hinein. Rebeccas rechte Hand krallte sich um den Beifahrersitz, während ihre Beine nach ihm traten. Er fluchte, als sie ihn traf, und bekam ein Bein zu fassen. «Du kannst dich wehren, wie du willst. Alles umsonst.»
Sie musste sich mit einem einzigen gezielten Tritt von ihm befreien und losrennen. Mit aller Kraft zog sie ein Bein an.
«Verdammtes Weibsstück! Dir werd ich’s zeigen!», brüllte er und seine Finger gruben sich schmerzhaft in ihre Wade.
Rebecca schrie auf, winkelte das andere Bein so gut es ging an und trat mit voller Wucht zu. Er brüllte, ein dumpfer Aufprall folgte und Rebecca war frei. Blitzschnell krabbelte sie vom Rücksitz und entkam ihm, bevor er erneut nach ihrem Knöchel fassen konnte.
Doch durch das Ausweichmanöver geriet sie ins Stolpern und fiel der Länge nach hin. Sie ignorierte den Schmerz und rappelte sich auf. Voller Entsetzen erkannte sie, dass der Wagen rückwärts auf sie zugerast kam. Sie rannte auf die Tür zu, taumelte und breitete die Arme aus, um einen weiteren Sturz abzufangen. Mit quietschenden Reifen schoss der Kombi erneut auf sie zu. Rebecca stockte der Atem. Sie hatte sich viel zu weit von ihm abdrängen lassen. Ihre Stimme versagte.
Im selben Augenblick flog die Tür zum Supermarkt auf. Es war der Motorradfahrer. Sofort ließ er Bier und Helm fallen und sprintete an ihr vorbei, um mit einem Gewaltsatz auf der Kühlerhaube des Kombis zu landen.
Ihr Schrei blieb ihr in der Kehle stecken. Die Reifen quietschten erneut, als der Fahrer auf die Bremse trat. Der Kombi stoppte nur wenige Schritte vor ihr. Endlose Sekunden verstrichen. Unbeweglich stand der Motorradfahrer auf der Haube und sah auf ihren Angreifer hinab. Die Zeit schien stillzustehen. Rebecca wagte nicht zu atmen. Sie bangte um ihren Retter.
Plötzlich sprang er auf den Boden und ging zur Fahrertür. Im selben Augenblick fuhr der Wagen rückwärts, wendete und preschte davon.
Das eben Erlebte erschien ihr irreal wie eine Filmszene, wenn ihr nicht noch immer die Furcht im Nacken säße. Der Mann musste den Fahrer mit seiner Stunteinlage geschockt haben, anders konnte sie sich das nicht erklären. Langsam gewann Rebecca die Fassung zurück. Der Motorradfahrer drehte sich zu ihr um. Das Glitzern in seinen Augen wirkte bedrohlich und ließ sie erschauern, auch wenn sie ihm unendlich dankbar war.
«Der … der wollte mich entführen», stammelte sie. «Danke, dass du mich vor ihm gerettet hast», sagte sie heiser.
«Schon gut. Alles okay?», fragte er und musterte sie besorgt.
Rebecca nickte und rieb sich die Arme, die unangenehm kribbelten. «Ja, außer einem Schock und ein paar Schürfwunden fehlt mir nichts.»
Erst jetzt bemerkte sie, dass sie die vertraute Anrede benutzte. In ihrem Kopf lief die Szene von eben in Dauerschleife. Sie würde noch eine Weile brauchen, bis sie das verdaut hatte.
«Du solltest von hier verschwinden. Mit diesen Psychopathen ist nicht zu spaßen.»
«Ja, aber erst rufe ich die Polizei.» Dieser Kerl musste geschnappt werden, bevor er noch jemanden gefährdete.
«Hast du dir sein Kennzeichen gemerkt?»
Seine Frage war berechtigt. In der Aufregung hatte sie gar nicht daran gedacht. Rebecca schüttelte den Kopf. «Nein. So ein Mist!»
Alles war so schnell gegangen. Sie überlegte und verwarf ihr Vorhaben, Anzeige zu erstatten. Plötzlich schien den Mann etwas zu beschäftigen. Sein Blick flog unruhig umher und ließ ihre Furcht zurückkehren. «Also dann, pass auf dich auf.»
Sie musste sich ein Taxi rufen und sah aufs Display des Handys, ob sie jetzt Empfang hatte. Natürlich nicht.
«Was ist?», fragte er.
«Mein Wagen springt nicht mehr an. Und dabei muss ich dringend zum Lenox Hill-Krankenhaus.»
«Ich bringe dich hin. Steig auf.»
Um ihren Wagen müsste sie sich wohl morgen kümmern. Sie klappte das Handy zu und steckte es in die Manteltasche. «Oder hast du Angst?», fragte er nach, als sie zögerte.
Sie schüttelte den Kopf. «Natürlich nicht, es sei denn, du bist ein Raser. Eine Sekunde noch bitte, ja?»
Sie holte aus ihrem Wagen zwei Äpfel und stopfte sie in die Manteltaschen, bevor sie hinter ihm auf den Sitz stieg. Gut, dass der Mantel geschlitzt war. «Dein Stunt vorhin war übrigens unglaublich. Machst du so was beruflich?»
«Ich bin kein Stuntman, falls du das glauben solltest.»
«Ach, dann übst du wohl in deiner Freizeit jeden Tag auf die Motorhauben fahrender Autos zu springen?»
«Ja, klar.»
Sie hörte das Lachen in seiner Stimme. «Das kaufe ich dir nicht ab.»
Seine Antwort wurde vom Sound des Motors übertönt, als er die Maschine startete. Wie ein Torpedo schoss die Honda nach vorn.
«Yeah!», rief Rebecca begeistert und schlang die Arme fest um seine Brust. Sie zitterte am ganzen Körper, was nicht nur am Schock lag. Sie genoss das berauschende Gefühl, durch die Straßen Manhattans zu fahren und den Wind mit ihrem Haar spielen zu lassen. Unter der eng sitzenden Lederkluft spürte sie seine Muskeln. Herrlich fest und ausgeprägt. Wie mochte er sich wohl nackt anfühlen?
Rebecca musste sich beherrschen, ihre Hände nicht weiter zu seinen ebenso muskulösen Beinen wandern zu lassen. Ihn so dicht an ihrem Körper zu spüren, erregte sie. Zwischen ihren Schenkeln begann es heiß zu pochen. Ob er auch etwas dabei empfand?
So nah war sie schon lange keinem Mann mehr gewesen. Das waren wohl Entzugserscheinungen, denn seit einem Dreivierteljahr hatte sie keinen Sex mehr gehabt.
Ihre Gedanken wanderten zu Martin, mit dem sie in den vergangenen Monaten eine Fernbeziehung geführt hatte. Wenn sie sich wiedergesehen hatten, hatte es nur im Streit geendet. Im Laufe der Monate hatte sich ihre Kommunikation immer mehr eingeschränkt. Am Telefon hatte er nur über seine Arbeit geredet. Das war nicht mehr der aufmerksame Mann, in den sie sich verliebt hatte, er war ihr fremd geworden. Nie hatte er ein Wort darüber verloren, dass er sie vermisste und liebte, sie als Frau noch immer begehrte.
Mehrmals hatte Rebecca überlegt, ihm ihren Entschluss mitzuteilen, doch immer hatte sie es hinausgeschoben. Ihre Beziehung war so dahingeplätschert. Vor zwei Wochen hatten sie sich dann am Telefon böse gestritten. Schuld daran war seine negative Meinung über karrieregeile Frauen. Natürlich hatte er sie damit gemeint. Das war das Tüpfelchen auf dem I. Ihm lag nichts an ihr und Rebecca hatte den lange überfälligen Schlussstrich gezogen.
Seitdem bombardierte er sie mit Anrufen und bat sie, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben. Alles würde sich bessern, wenn sie erst einmal in San Francisco wäre, erklärte er ihr. Nichts würde sich ändern, dachte sie bitter.
Die Fireblade legte sich in die Kurve und Rebecca umklammerte ihren Retter fester. Seltsam, wie vertraut er sich anfühlte, als würden sie sich schon lange kennen. Sein Herzschlag war kräftig und schnell.
Sie zählte die Schläge und lächelte. Ihre Nähe schien auch ihm nicht gleichgültig zu sein. Nach der nächsten Kurve erreichten sie das Krankenhaus. Ihre Beine zitterten beim Absteigen. Sie fuhr sich mit den Fingern durchs zerzauste Haar und wartete, bis er den Helm abgesetzt hatte, um sich zu verabschieden. Er stieg ab, hängte den Helm an den Lenker und setzte sich seitwärts auf den Sitz. Sein begehrlicher Blick wanderte über ihren Körper und trieb ihren Puls erneut in die Höhe.
«Danke noch mal, für alles. War ein tolles Gefühl auf der Maschine. Das hat mich das von eben vergessen lassen», sagte sie heiser, beugte sich vor und gab ihm, einem spontanen Impuls folgend, einen Kuss auf die Wange.
Mit einem Ruck zog er sie an sich und einen Atemzug später lagen seine Lippen auf ihren. Rebecca verlor sich in der schwindelerregenden Lust dieses zärtlichen Kusses. Mit der Zunge teilte er ihre Lippen und erkundete das Innere ihres Mundes. Jeder einzelne Zungenschlag schickte Flammen in ihren Unterleib. Ihr Körper drängte sich ihm entgegen, während ihr Geist sie fragte, was sie hier eigentlich trieb. Schluss damit.
Sanft stieß sie sich von ihm ab. «Ganz schön frech. Nur weil du mich gerettet hast, bedeutet das noch lange nicht, dass du dir alles herausnehmen kannst.»
Er grinste sie an. «Du hast mich zuerst geküsst.»
«Auf die Wange», stellte sie richtig.
«Aber es hat dir doch gefallen, von mir geküsst zu werden.»
Na, der war ja ganz schön von sich überzeugt. Dennoch konnte sie ihm nicht böse sein. «Bilde dir bloß nichts ein.»
Rebecca verkniff sich ein Grinsen. Ja, er hatte sie überrumpelt, aber irgendwie hatte es ihr auch gefallen. Viel zu gut.
«Gib zu, ich küsse gut», sagte er und lachte.
Er war frech und besaß Humor, das gefiel ihr. Das konnte sie ebenfalls. «Ich habe schon Besseres erlebt.»
Sie würde ihm doch nicht auf die Nase binden, dass sein Kuss wirklich heiß gewesen war.
«Kann ich mir gar nicht vorstellen», flüsterte er und strich mit dem Zeigefinger über ihre Lippen. «Du schmeckst sehr süß, nach mehr.»
Der Klingelton ihres Handys holte sie zum Glück in die Realität zurück. Verwirrt sah sie aufs Display und seufzte. Es war ihre Kollegin Jody, die ihr per SMS mitteilte, dass Dr. Marley bereits auf dem Weg zur Station war.
«Entschuldige, ich muss jetzt.» Sie sah zu ihm auf.
«Ich möchte dich gern wiedersehen», sagte er leise.
«Ich weiß nicht recht. Ich habe eigentlich gar keine Zeit …» Außerdem würde sie sowieso in ein paar Tagen New York verlassen.
«Nur auf einen Kaffee. Mehr nicht. Und ich werde dich nur noch küssen, wenn du es möchtest. Versprochen.»
Rebecca zögerte. Sie war ihm dankbar und wollte ihn nicht einfach abweisen. Ein Kaffee, warum denn nicht? Außerdem musste sie schnell auf die Station, bevor Marleys Donnerwetter über sie hereinbrach. «Okay. Wann?», gab sie nach.
«Wann hast du Dienstschluss?», fragte er.
«Ehrlich gesagt kann ich das nie genau sagen. Manchmal kommt noch ein Notfall rein. Wenn nichts weiter los ist gegen Mitternacht. Vielleicht aber auch nicht.» Sie betrachtete seine Miene, die sich nicht veränderte.
«Keine Chance. So leicht lasse ich mich nicht abschrecken.» Er lächelte.
Ganz schön hartnäckig, dachte sie, und es gefiel ihr. «Tja, dann …»
«Ich bin gegen Mitternacht hier und werde auf dich warten.»
«Ich überziehe manchmal auch mehr als eine Stunde. Kommt immer auf den Patienten an. Manche sind halt … schwierig.» Was würde er jetzt dazu sagen?
Sein Lächeln vertiefte sich und sie fühlte es im Bauch kribbeln. «Ist schon okay, ich warte auch länger.»
Rebecca lächelte, während ihr Herz begann aufgeregt schneller zu schlagen. Wie oft hatte sie früher von Martin auf eine solche Antwort gehofft. «Gut, dann bis nachher.»
«Bis dann, …?»
«Rebecca. Ich heiße Rebecca. Und dein Name?»
«Aaron», antwortete er, setzte sich den Helm auf und stieg auf seine Honda.
3.
Aaron hatte Jacob in dem Kombi vorhin genau erkannt. Wenn er nicht eingeschritten wäre, hätte der verschlagene Kerl Rebecca etwas angetan. Jacob war ein Nephilim, der ab und zu im Engelsghetto in der Hell’s Bar ausgeholfen hatte. Vom ersten Moment an hatte Aaron ihm misstraut. Es lag etwas Geringschätziges in seinem Blick, wenn er mit anderen sprach, auch wenn seine Worte freundlich klangen.
Als Jacob Cynthia in einem Streit geschlagen hatte, war er eingeschritten und hatte ihn kurzerhand aus dem Engelsghetto geworfen. Auch heute hatte er Jacobs Gewaltbereitschaft gespürt. Zum Glück war Rebecca nichts geschehen, und sie hatte sich wacker geschlagen.
Er sah ihr erhitztes Gesicht mit den roten Wangen vor sich. Er leckte sich über die Lippen, die noch immer nach ihr schmeckten. Ihr Kuss war süß und verheißungsvoll gewesen. Doch bald war er wieder in Rom..
Für einen Moment sah er ihre blauen Augen vor sich. Leidenschaft, Feuer und Temperament hatten darin aufgeblitzt. Sie gehörte zu der Sorte Frau, die man nicht so schnell vergaß. War Jacob vielleicht auf sie scharf und von ihr abgewiesen worden?
Die Antworten darauf konnte ihm nur Jacob selbst geben. In letzter Zeit wurden von einigen Informanten der Engel geheime Treffen krimineller Nephilim beobachtet, unter denen sich auch Jacob befand. Bei diesen Treffen wurde vor allem mit Rauschgift gehandelt. Doch Aarons Bauchgefühl sagte ihm, dass noch mehr dahintersteckte, vielleicht sogar ein Pakt mit Luzifer selbst. Seit Jahren war bekannt, dass Jacob mit Rauschgift dealte, aber er war noch nie auf frischer Tat ertappt worden.
Aaron kannte eine Handvoll Orte, an denen er sich verkroch, zwielichtige Bars und Diskotheken, um Kokain zu verkaufen. Eine war die Red Dragon Bar in China Town, in der vor Wochen angeblich sogar ein Gefallener gesichtet worden war.
Aaron steuerte die Honda auf die Parkavenue. Während der Fahrt dachte er wieder an Rebecca, wie sie sich an ihn geschmiegt und die Arme um seinen Körper geschlungen hatte. Es hatte sich gut angefühlt, viel zu gut. Sein Körper hatte unter Strom gestanden. Als ihre Hände an seiner Brust hinauf gewandert waren, hatte er schon befürchtet, sie könnte das Messer und den Shuriken in der Jackeninnentasche ertasten. Zu seiner Erleichterung hatte sie vorher gestoppt. Er wäre in Erklärungsnot geraten. Die meisten Menschen ahnten weder etwas von der Existenz der Engel noch vom Kampf zwischen Himmel und Hölle. Er mochte sich die Panik gar nicht vorstellen, die ausbrechen würde, wenn sie erfuhren, dass um jede ihrer Seelen gerungen wurde.
Vor dem Eingang der Red Dragon Bar parkte Jacobs blauer Kombi. Aaron stellte seine Fireblade am Straßenrand etwas weiter entfernt ab. Über dem Eingang baumelten zwei chinesische Papierlampen, die mit Drachenmotiven und Schriftzeichen verziert waren. Er öffnete die Tür und trat ein. Der süßliche Duft von Räucherkerzen und Pflaumenwein hing im Raum. Eine Frau sang ein Klagelied, begleitet von Zither und Sheng. Die Wände zierten Seidentapeten mit Feuer speienden Drachen. An der Theke standen Asiatinnen in Jeans und tief dekolletierten Seidentops. Sie flirteten mit den Gästen.
Aarons Blick suchte nach Jacob. Als die Hintertür klappte, drängte Aaron sich durch die Gäste zum Ausgang. Kein Geräusch verriet hinter der Tür Jacobs Gegenwart. Aaron streckte den Kopf durch den Spalt und spähte hinaus in den spärlich erleuchteten Hinterhof. Der Geruch von ranzigem Fett und verfaulten Küchenabfällen wehte zu ihm herüber und drehte ihm den Magen um. Gefüllte Mülltüten, zwischen denen sich Ratten tummelten, waren zu seiner Linken sorgfältig aufeinander gestapelt.
Angewidert verzog Aaron das Gesicht. Jacob war nicht zu sehen, obwohl er dessen Gegenwart spürte. Er täuschte vor, in die Bar zurückzukehren, und ließ die Tür zuknallen. Dann drückte er sich in den Schatten der Mauer und verharrte reglos. Wenn Jacob sich sicher fühlte, würde er sich verraten.
Seine Rechnung ging auf, denn es dauerte nicht lange, bis Aaron auf der anderen Seite des Innenhofes eine Bewegung wahrnahm. Jacob huschte an der Mauer entlang. Na, also. Sein Warten hatte sich gelohnt. Da der Nephilim kein überragender Sprinter war, wäre es ein Kinderspiel ihn einzuholen.
Jacob wollte gerade in einem der Hauseingänge verschwinden, als Aaron ihn an der Schulter zurückriss. «Aber, aber, Jacob, du fliehst doch nicht etwa vor mir?»
Aaron drängte den Hageren zurück, bis er mit dem Rücken gegen die Hauswand stieß. Deutlich roch er den Angstschweiß des Nephilims.
«Was willst du von mir, Blutengel?», stieß Jacob keuchend hervor und versuchte, seitlich auszubrechen.
Aaron war schneller, packte ihn an der Schulter und drückte ihn in die Mauer. «Dir eine Frage stellen.»
Die Züge des Nephilims entspannten sich. «Ja, ja, keine Sache. Aber lass mich los.»
«Erst, wenn du mir die gewünschte Antwort gegeben hast, sonst versuchst du wieder abzuhauen.»
«Meinetwegen.» Jacobs Blick war wachsam.
«Was sollte die Aktion vorhin? Rede!»
Jacob hob abwehrend die Hände und lächelte. «Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich bin den ganzen Abend über hier gewesen. Frag die da drinnen.» Er zeigte mit dem Arm auf den Hintereingang des Red Dragon.
«Elender Lügner.» Aaron schnaubte wütend. Der Nephilim besaß tatsächlich die Frechheit, ihm ins Gesicht zu lügen.
Hinter der krausen Stirn seines Gegenübers schien es fieberhaft zu arbeiten, dann lächelte Jacob. «Ey, Mann, okay, ich geb’s ja zu. Ich war da. Ich wollte nur ein wenig Spaß haben und ihr Angst einjagen. Mehr nicht. Und dann ist sie hysterisch geworden.»
Aaron hätte ihm am liebsten die Faust ins Gesicht geschlagen, aber Jacob war es nicht wert. Dennoch glaubte Aaron, dass mehr hinter der Aktion steckte, als der Nephilim zugab. «Spaß? Sie hätte draufgehen können, wenn ich nicht da gewesen wäre!», fuhr er ihn an.
Die Züge des Nephilims verzerrten sich zu einer hämischen Fratze. In seinen Augen glitzerte es mordlüstern. «Ist doch nur ein Mensch. Was kümmert sie dich oder ist sie dein Flittchen?»
Jacob kicherte. Aaron packte ihn am Revers. Unsicherheit flackerte für den Bruchteil eines Moments in den Augen des Nephilims auf, was Aaron bestätigte, dass mehr hinter der Attacke steckte, als Jacob zuzugeben bereit war. Dennoch blieb er ruhig, auch wenn die Wut sich wie Magma in seinem Inneren sammelte und kurz vor der Eruption stand.
«Du verrätst mir jetzt, was wirklich hinter deiner Aktion steckt oder ich …»
Das metallische Klicken ließ Aarons Muskeln anspannen. Gerade noch rechtzeitig konnte er dem gezückten Taschenmesser Jacobs ausweichen.
«Ich sagte doch schon, dass ich nur Spaß haben wollte.» Der Nephilim hielt noch immer das Messer vor sich.
«Lass das Messer fallen, Jacob», forderte Aaron und bemerkte den Schweiß auf der Stirn seines Gegenübers. Als dieser seiner Aufforderung nicht nachkam, zog Aaron seine Waffe. Der Nephilim starrte mit geweiteten Augen auf das Schwert.
«Ich … ich … kann es dir nicht sagen», stammelte er. Seine Augen besaßen plötzlich einen fiebrigen Glanz.
«Ach, ja? Warum denn nicht?»
Jacob zitterte, dann öffneten sich seine Finger und das Messer fiel klirrend auf den Asphalt.
«Also, was ist?»
«Apoka… lyp…tika …», stammelte Jacob, bevor seine Stimme versagte. Seine Augen blickten starr geradeaus, jegliche Farbe war aus seinem Gesicht gewichen. Aaron konnte seine plötzliche Todesangst körperlich spüren, die wie eine Welle zu ihm brandete.
«Nein, nein … nein.»
Er hob abwehrend die Hände, in seinen Augen spiegelte sich Entsetzen, als blicke er in den Höllenschlund. Aaron sah sich um, doch niemand war weit und breit zu sehen. Jacobs Lippen bewegten sich und seine Arme zuckten unkontrolliert. Plötzlich schlugen Flammen aus seiner Leibesmitte. Seine Knie knickten ein, er begann vor Schmerz zu wimmern.
Aaron zog rasch seine Jacke aus, um die Flammen damit zu ersticken, aber sie fraßen sich in rasantem Tempo durch den Körper des Nephilim. Jacobs Schreie erstarben, bevor sie seine Kehle verlassen konnten. Er schlug verzweifelt um sich. «Hilf mir!», flehten seine Augen.
Machtlos musste Aaron mit ansehen, wie der Nephilim vor seinen Füßen bei lebendigem Leibe verbrannte. Er hatte zwar von spontanen Selbstentzündungen gehört, war aber nie Zeuge geworden. Der Nephilim musste einen Pakt mit Luzifer eingegangen sein.
Binnen weniger Sekunden war Jacobs Körper zu Asche verbrannt, die von einem Luftzug emporgewirbelt und davongetragen wurde. Nachdenklich sah Aaron ihr nach, bevor er den Hinterhof verließ. Unzählige Fragen marterten sein Hirn. Er war davon überzeugt, dass der Nephilim ihm die gewünschten Antworten gegeben hätte, wäre ihm mehr Zeit geblieben. Er seufzte. Nicht einmal für ein paar Tage war es ihm möglich, sich von der dunklen Welt zu lösen.
4.
Aaron ging Rebecca nicht aus dem Sinn. Sein Kuss hatte sie völlig aus dem Gleichgewicht gebracht. Das ist doch nur, weil du schon lange nicht mehr von einem Mann geküsst worden bist.
Nein, sie musste sich korrigieren, sie war noch nie so geküsst worden. Verlangend, leidenschaftlich, zärtlich und sanft. Ein perfekter Kuss. Sie ertappte sich dabei, wie sie immer wieder auf die Uhr sah und die Stunden bis zum Dienstschluss zählte. Der Kuss hatte sie den Vorfall mit dem Kombi zum Glück schnell vergessen lassen.
Gegen halb elf spritzte sie dem letzten Patienten ein Antibiotikum. «So, Schwester Carter bringt Sie jetzt auf die Station.»
Rebecca betupfte die Einstichstelle mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Wattebausch, bevor sie ein Pflaster darüberklebte. Als ihre Fingerspitzen seine Haut berührten, kribbelte es unangenehm. Sie spürte seine Traurigkeit.
«Aber ich muss nach Hause. Ich werde gebraucht», protestierte der bullige Bauarbeiter und sah flehend zu ihr auf. «Bitte, Doc.»
Wie gern hätte sie ihm diesen Wunsch erfüllt, aber die Infektion war bereits weit vorangeschritten, was ihr die unregelmäßigen Schwingungen seines Körpers verrieten. «Bitte, Doc, verstehen Sie doch!», bettelte der Patient.
Sie hätte ihm gern nachgegeben. «Tut mir leid, das geht nicht. Ein paar Tage müssen Sie schon bei uns bleiben.» Sie klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter und lächelte ihn an. «Nur eine Woche.»
Seine grauen Augenbrauen schossen nach oben. «Eine ganze Woche? Wie soll das gehen? Meine Frau, sie ist allein …»
Sie spürte seine Sorge, die sich mehr um seine Frau als um seine Gesundheit drehte. Und dann erkannte sie den Grund: Seine Frau war behindert. Diese Selbstlosigkeit rührte sie. Seine Besorgnis schwappte in warmen Wellen zu ihr, bis sie das Gefühl hatte, sie würde die Situation mit seinen Augen betrachten. Sorgen und Traurigkeit waren für seinen Genesungsprozess auf keinen Fall förderlich.
«Geben Sie mir bitte Ihre Telefonnummer, ich rufe Ihre Frau gleich nachher an. Machen Sie sich keine Sorgen.» Noch immer blieb seine Miene skeptisch. «Versprochen», setzte Rebecca nach.
Er entspannte sich und atmete erleichtert aus. «Sie haben ein gutes Herz.» Lächelnd tätschelte er ihre Hand.
«Schon gut.» Rebecca winkte die Schwester herbei. «Den Patienten bitte auf Station 5. Und der Stationsarzt möchte mich morgen früh gleich anrufen. Ach, und wie hieß noch mal dieser Betreuungsservice, der neulich draußen Flugblätter verteilt hat?»
«All-in-one, glaube ich», sagte die zierliche Schwester mit den Rastalocken und schob den Rollstuhl zur Tür.
«Suchen Sie mir doch bitte seine Nummer heraus, ja?», bat Rebecca.
Sie nickte und verließ mit dem Patienten den Untersuchungsraum.
«Geschafft», sagte Rebecca laut und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sie zog die Latexhandschuhe aus und warf sie neben sich in den Mülleimer. Ihre Knöchel und Waden waren geschwollen, und es fiel ihr immer schwerer, sich zu konzentrieren. Das verstörende Erlebnis mit dem Kombi hatte zusätzlich an ihren Nerven gezehrt. Für die nächste Zeit hatte sie die Nase gestrichen voll von irgendwelchen aufregenden Erlebnissen. Ihr Job war hart genug. Dennoch freute sie sich auf die Chance, sich bald als Chirurgin bewähren zu können.
Rebeccas Zunge klebte am Gaumen. Sie lief zum Wasserspender in der Ecke. Noch ein wenig Papierkram und dann ab zur Verabredung, dachte sie und ließ das Wasser in den Pappbecher laufen, bevor sie den Inhalt hinunterstürzte.
Die beiden Schwestern, die ihr assistiert hatten, desinfizierten das Besteck und wuschen eine Nierenschale aus, in die sich ein Patient übergeben hatte.
«Wo bist du?»
Rebecca fuhr herum. Sie mochte es nicht, wenn die anderen während der Arbeit tuschelten. «Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann bitte laut», wandte sie sich an die beiden Krankenschwestern, die mit den Köpfen schüttelten.
«Wir haben nichts gesagt.»
«Okay, war wohl eine Halluzination.» Rebecca hob lachend die Hände. Sollte alles wieder von vorne anfangen? Ach was, wahrscheinlich spielten ihr die Nerven nur einen Streich. Mit einem Achselzucken schaltete sie den Computer ein.
Vor über einem Jahr hatte sie zum ersten Mal dieses Flüstern gehört und einen Kollegen in der Psychiatrie aufgesucht. Es saß wie ein Parasit in ihrem Kopf. Der Psychiater schob alles auf den Stress und ihre sensible Persönlichkeit und verschrieb ihr ein leichtes Entspannungsmittel, wonach der Spuk tatsächlich aufgehört hatte.
«Sag mir, wo du bist!»
Das Flüstern wurde eindringlicher. Rebecca wandte sich erneut zu den Schwestern um, die eifrig, aber schweigend Binden wickelten. Fragend sahen beide auf. Ihre Halluzinationen waren also zurückgekehrt. Sie stöhnte innerlich auf. Es gab genügend Studien über dieses Thema.
Nein, dieses Mal würde sie sie ignorieren. Sie schüttelte den Kopf und setzte sich an den Schreibtisch, um die Krankenberichte in den Computer zu tippen. Im selben Augenblick flog die Tür hinter ihr auf und knallte gegen den Schrank. Rebecca wirbelte empört herum.
Im Türrahmen stand ein stämmiger Mann mit grimmiger Miene, der auf seinen Armen den blutüberströmten Körper eines ohnmächtigen Teenagers trug.
«Schnell, helfen Sie ihm!»
«Legen Sie ihn auf den Tisch.» Rebecca sprang auf und streifte sich neue Handschuhe über. Wo blieb denn nur die Ablösung? Ihr Kollege hätte schon vor einer halben Stunde seinen Dienst antreten müssen. Behutsam legte der Mann den Körper des Jungen ab und redete beruhigend auf ihn ein.
«Was ist passiert?» Rebecca trat an den Untersuchungstisch und schnitt mit einem Skalpell das blutdurchtränkte Sweatshirt des Jungen auf.
«Drei Jugendliche haben auf ihn eingestochen. In der U-Bahn», erklärte er.
«Warum haben Sie nicht sofort den Notarzt angerufen?»
Er sah zu ihr auf, ein wachsamer Ausdruck trat in seinen Blick. «Es war ja die Station um die Ecke.»
«Was Sie getan haben, war fahrlässig. Er könnte innere Blutungen haben», fuhr sie ihr Gegenüber an.
Der Junge stöhnte auf. Der Stämmige beugte sich zu ihm hinab und sprach erneut auf ihn ein, bis er sich wieder beruhigt hatte. Eine tiefe Wunde zog sich quer über seinen Brustkorb, aus der Blut und eine undefinierbare grünliche Substanz quollen.
«Verlassen Sie jetzt bitte den Raum», wies Rebecca den Begleiter des Jungen an und deutete mit dem Kinn zur Tür. Er nickte und machte auf dem Absatz kehrt. Rebecca wandte sich an eine der Schwestern: «Ich mache einen Abstrich. Diese Substanz muss dringend ins Labor. Schwester Thorne, Sie helfen mir bitte beim Ausziehen.»
Rebecca stutzte, als ihr die seltsamen Male an der Innenseite seiner Unterarme auffielen, die wie Brandzeichen aussahen und die abstrakte Form einer Flamme besaßen. Auf welche irrwitzigen Ideen die Jugendlichen heutzutage kamen.
Als sie vorsichtig über die roten Narben fuhr, strömte eine Bilderflut auf sie ein. Plötzlich war es, als tauchte sie in den Körper des Jungen ein und betrachtete das Geschehen mit seinen Augen. Drei Männer mit mordlüsternem Blick umzingelten ihn. Ihre Augen leuchteten rot. Rebecca spürte die Angst des Jungen. Hinter ihm loderte Feuer und verhinderte eine Flucht. Der Junge neigte den Kopf und aus seinem Rücken wuchsen schwarze Flügel. Einer der Kerle, der Krallen statt Fingernägel hatte, stürzte mit einem animalischen Schrei vor und schlitzte den Jungen auf. Rebecca glaubte in diesem Moment, jemand schnitte ihren Brustkorb auf, und zuckte zusammen. Die Todesangst des Jungen legte sich wie ein eisiger Schleier über sie.
«Dr. Clancy?»
Wie durch einen Nebel drang die Stimme der Schwester zu ihr. Sie schüttelte den Kopf und tauchte allmählich aus der Tiefe ihres Bewusstseins auf. Was ging hier vor?
Dass ihr Geist in den Körper des Jungen gefahren war, erschreckte sie zu Tode. Doch es blieb ihr keine Zeit, länger darüber nachzugrübeln, denn die Gliedmaßen des Jungen zuckten unkontrolliert wie unter Stromstößen. Seine Züge verzerrten sich, als wirkten Zentrifugalkräfte auf ihn ein.
«Hey, ganz ruhig.»
Sie hoffte, ihre Stimme würde zu ihm durchdringen und ihm die Angst nehmen. Rebecca drehte ihn vorsichtig auf die Seite und erkannte, dass das Hemd am Rücken zwei handgroße Risse aufwies.
Bevor sie es längs entlang der Wirbelsäule aufschnitt, ahnte sie bereits, was sie erwarten würde. Sie klappte den Stoff um, trennte die Ärmel ab und zog alles herunter.
Gurgelnde Laute entstiegen der Kehle des Jungen, während er am ganzen Leib zitterte, als hätte er Schüttelfrost. Seine Zähne schlugen laut aufeinander. Er krümmte sich vor Schmerzen. Schmerzen, die Rebecca fühlen konnte. Sie erstarrte, als sie seinen Rücken nach weiteren Wunden untersuchte und zwei frische Narben zwischen den Schulterblättern entdeckte. Auf den ersten Blick sahen sie wie Brandwunden aus wegen der Asche, die obenauf lag und bei jedem seiner Atemzüge herabrieselte. Doch es waren keine Brandblasen zu sehen.
Dort hatten seine Flügel gesessen, schoss es ihr durch den Kopf. Das gab es doch nicht! Menschen besaßen keine Flügel! Auch keine roten Augen! Was ging hier vor?
«Was ist das denn?» Schwester Thorne zeigte mit dem Finger auf den schwarzen Staub, der aufwirbelte und sich auf dem weißen Laken absetzte.
«Asche.» Rebecca strich vorsichtig über die Narben und zerrieb anschließend den Staub zwischen den Fingerkuppen.
«Im Feuer geboren, wird er auch dem Feuer geopfert.»
Das Geflüster war wieder zurück, als hätte es der Staub ausgelöst. Der Junge stöhnte lauter und krümmte sich.
«Spürst du seinen Schmerz?»
Rebecca zuckte erneut zusammen. Ihre Haut ringsum die Handgelenke brannte.
«Alles in Ordnung, Dr. Clancy?», fragte die Schwester besorgt.
«Ja, alles bestens», log Rebecca.
Jeder würde das Geflüster auf den Stress schieben und glauben, sie wäre vor lauter Arbeit übergeschnappt. Noch einmal betrachtete sie die Narben des Jungen eingehend. Ihm schienen die Flügel abgebrannt zu sein. Ohne weitere Hautschädigungen. Das war unmöglich, unheimlich und doch die einzige Erklärung.
«Guten Abend, Rebecca. Ich übernehme.»
Es war ihr Chef, Dr. Marley. Erstaunt sah sie auf. Wieso er? Wo steckte James, ihr Nachfolger?
«Ich habe James gefeuert und übernehme für ihn.»
«Aber …», protestierte sie, «aber ich habe bereits mit den Untersuchungen begonnen und würde das gerne abschließen, bevor ich das Krankenhaus verlasse.»
«Haben Sie mich nicht verstanden? Ich werde das übernehmen. Freuen Sie sich doch auf Ihren Feierabend. Bevor Sie gehen, bitte Ihren Bericht. Und fassen Sie sich kurz.» Er zog sich Latexhandschuhe an und trat an den Untersuchungstisch.
James so kurzfristig gefeuert? Rebecca schluckte. Dem cholerischen Marley traute sie alles zu, das machte sie wütend. «Warum haben Sie James gerade jetzt entlassen, wo ich ab morgen nicht mehr da bin?»
«Was interessieren Sie meine Gründe, wenn Sie sowieso morgen gehen?», blaffte er sie an.
Der Junge stöhnte auf, und Rebecca verzichtete auf jegliche Diskussion. Widerwillig befolgte sie Marleys Bitte und beschrieb in wenigen Sätzen die Art der Wunden und den Zustand des Jungen.
Marley nickte: «Schwester MacKenzie, wir brauchen eine Röntgenaufnahme, um zu sehen, wie tief der Schnitt geht. Rufen Sie bitte in der Radiologie an, jemand möchte sofort herunterkommen.»
Im Feuer geboren und auch dem Feuer geopfert! Die Worte hallten in Rebecca nach, obwohl sie deren Sinn nicht verstand. Sie stand neben ihrem Chef, der die Brustwunde eingehend inspizierte. Eine innere Stimme warnte sie plötzlich, dass Röntgenstrahlen den Tod des Jungen bedeuten könnten.
«Wir sind jetzt fertig fürs Röntgen», sagte Schwester MacKenzie, die den Hörer aufgelegt hatte.
«Okay, dann ab mit ihm.» Marley schob den Tisch in Richtung Tür.
Rebeccas ungutes Gefühl verstärkte sich. Der Junge durfte nicht geröntgt werden. «Halt! Bitte warten Sie. Die Wunde geht nicht so tief, dass wir röntgen müssten», wagte sie sich vor.
Marley stoppte und sah sie mit finsterer Miene an. Er hasste es, wenn ihm widersprochen wurde. Aber Rebeccas Überzeugung, das Leben des Jungen wäre gefährdet, wuchs mit jedem Atemzug. Doch wie sollte sie Marley erklären, dass sie nur einer Eingebung folgte?
«Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass Sie hier nichts mehr zu sagen haben, Rebecca?» Er sah sie vernichtend an.
«Bitte verstehen Sie doch …», entgegnete sie.
Marley stöhnte, bevor er ihr ins Wort fiel: «Ich muss Sie doch nicht daran erinnern, dass jede tiefe Wunde zum Röntgen muss. Oder besitzen Sie etwa einen Röntgenblick?»
Sie überhörte die Anspielung und blieb gelassen. «Bitte, Dr. Marley, diese Substanz, die ich bei ihm gefunden habe … wir wissen noch nicht, was es ist. Es könnte …»
«Wir haben jetzt keine Zeit auf die Laborergebnisse zu warten. Sie können selbst beurteilen, wie schlecht es ihm geht», fiel er ihr ins Wort.
«Bitte, ich habe zwar noch keine Beweise, aber ich glaube, dass Röntgenstrahlen für ihn gefährlich sind. Wir sollten die Ergebnisse aus dem Labor abwarten. Es kann sich doch nur um Minuten handeln.»
Marley wollte davon nichts hören. «Jede Minute könnte es mit ihm vorbei sein. Der Junge wird geröntgt und Schluss. Ich möchte keine Klage an den Hals, dass ich meiner ärztlichen Pflicht nicht nachgekommen bin.» Er presste seine schmalen Lippen zusammen und schob den Tisch weiter. Rebecca stellte sich vor die Tür. «Gehen Sie mir aus dem Weg! Zweifeln Sie meine Kompetenz an? Ich trage hier die Verantwortung!», brüllte er.
Was war, wenn sich alle irrten? Oder sie selbst? Jeder Irrtum war tödlich. Die Schwester zerrte Rebecca auf einen Wink Marleys hin beiseite. Marley schob den Jungen an ihr vorbei über den Flur in die Radiologie. Rebecca folgte ihm wie in Trance.
Der Junge bewegte sich unruhig auf dem Untersuchungstisch hin und her. Rebecca rieb sich die schmerzenden Unterarme. Sie spürte, dass der Junge sich selbst in der Ohnmacht wehrte. Marley forderte, ihm ein Beruhigungsmittel zu spritzen, als er vom Tisch zu fallen drohte. Auf sein Geheiß hin wurde der Junge mithilfe von Bändern fixiert, bevor ihm die Schwester das Beruhigungsmittel verabreichte. Die Gegenwehr verschlimmerte sich. Seine Augen rollten in den Höhlen, bis nur noch das Weiße zu sehen war, und er versuchte sich loszureißen.
«Sehen Sie doch, da stimmt was nicht. Bitte stoppen Sie das Ganze», wagte Rebecca einen weiteren verzweifelten Versuch. Marley war ihr Chef und trug die Verantwortung. Aber sie konnte nicht zusehen, wie er einen folgenschweren Fehler beging.
«Wie begründen Sie das? Welche Analysen haben Sie vorgenommen? Welche Fakten sprechen dagegen? Also, ich höre.»
«Es ist ein Gefühl …»
«Ein Gefühl!» Marley lachte lauthals. «Und mein Gefühl sagt mir was anderes. Hier zählen Diagnosen und keine Gefühle! Scheren Sie sich endlich zum Teufel und lassen Sie mich hier in Ruhe meine Arbeit erledigen!»
Rebecca wurde übel. Wenn dem Jungen etwas geschah, würde sie sich schuldig fühlen. Dr. Marley ließ den fixierten Jungen allein und ging zu dem Radiologen in den Nebenraum. In dem Moment, als das Röntgengerät die erste Aufnahme schoss, ging der Körper des Jungen in Flammen auf. Geschockt wichen alle zurück, bevor sie mit Wasser und Decken zu dem Tisch liefen und das Feuer vergeblich zu löschen versuchten.
Die Schreie des Jungen gingen Rebecca durch Mark und Bein. Alle Rettungsversuche scheiterten. Wasser, Handtücher, der Feuerlöscher, alles vergeblich. Hilflos mussten sie mit ansehen, wie der Junge bei lebendigem Leibe verbrannte.
«Du trägst die Schuld an seinem Tod», hörte sie wieder das Geflüster.
Rebecca fühlte sich miserabel. Am Boden zerstört verließ sie wenig später das Krankenhaus. Sie hasste Marley für das, was er dem Jungen angetan hatte, und sich selbst, weil sie sich nicht durchgesetzt hatte.
5.
Drei Jahre hatte Aaron in diesem Viertel gelebt, das die Nephilim als ihr Engelsghetto bezeichneten. Er stoppte seine Fireblade vor dem Eingang der Hell’s Bar, dem einzigen Treffpunkt der Mischwesen weit und breit. Kaum hatte er den Helm abgesetzt, spürte er hinter sich einen Luftzug und wusste, dass sein Vater hinter ihm stand.
«Hallo, Vater», begrüßte er ihn und wandte sich langsam zu ihm um.
Uriel war der einzige Erzengel mit rotem Haar, das sich wie eine Kappe an seinen Kopf schmiegte. Lux vel Ignis Dei, das Feuer Gottes. «Hallo, Aaron.» Hinter Uriels sanfter Stimme verbarg sich Strenge.
«Was möchtest du?»
Aaron befürchtete, dass er ihn an sein Versprechen erinnern wollte, in Rom seinen Lehrmeister Alessandro aufzusuchen. Jeder Blutengel musste mindestens einmal pro Jahr nach Rom fliegen, um von den Ausbildern die Entwicklung seiner Fertigkeiten im Kampf überprüfen zu lassen.
«Es gibt Ärger mit der Sekte und Verräter in unseren Reihen. Eine Verschwörung muss im Keim erstickt werden. Ich will, dass du die Verräter findest und vernichtest. Solange du hier bist, wirst du Joel unterstützen.»
Er konnte seine freien Tage in New York ganz abhaken, wenn er nicht gleich intervenierte. «Es gab immer Verräter, und das Problem mit der Sekte besteht doch auch nicht erst seit heute.»
Die Miene seines Vaters gefror. «Du wirst mir gehorchen, Sohn!»
Aaron verspürte keine Lust, sich mit seinem Vater anzulegen, im Gegenteil. Er wollte, dass er stolz auf ihn war. Dabei hatte er sich so auf seine freien Tage gefreut. «Okay, okay, ich kümmere mich drum», gab Aaron nach.
Der Tod seiner Mutter hatte ihn und seinen Vater entfremdet. Heute erschien ihm Uriel unnahbarer als je zuvor.
«Luzifer hat sich gestern mit ihrem Anführer, dem Verkünder, getroffen und einen Pakt geschlossen. Wir befürchten, dass sie einen vernichtenden Schlag gegen uns planen. Als wäre das nicht genug, ist ein Renegat aufgetaucht und unterstützt die Apokalyptiker. Diese Sekte ist wie ein Virus, der sich durch die Seelen frisst.»
Aaron wusste sofort, wer der Renegat war, vom dem sein Vater sprach, obwohl er ihm noch nicht begegnet war. «Du meinst Ariel?»
Die Brauen seines Vaters zogen sich unheilvoll zusammen. «Sprich seinen Namen niemals in meiner Gegenwart aus!», brüllte er.
Blitze zuckten plötzlich am Himmel als Beweis dafür, dass der Himmel noch immer diesem Engel zürnte. Ariel hatte seinem Vater einst nahe gestanden, bevor Ariel sich von den Engeln abgewandt hatte. Seitdem war er ein Tabu. Berichten zufolge lebte er auf der Erde unerkannt unter den Menschen und scherte sich wenig um andere. Welches Interesse mochte er jetzt an dieser Sekte haben?
«Unruhe ist in unseren Reihen ausgebrochen, nachdem er zu einigen Kontakt gesucht hatte. Einer von uns hat sich Luzifer angeschlossen. Es riecht nach Rebellion. Unser Schicksal und das der Menschheit stehen auf dem Spiel. Begreifst du jetzt, warum es wichtig ist?»
Es war Zeit, dass er seinem Vater von Jacob erzählte. «Jacob ist tot. Sein Körper entzündete sich selbst. Ich hatte keine Möglichkeit, ihn nach der Sekte zu befragen. Doch ich erinnere mich noch gut an sein letztes Wort: Apokalyptika.»
Uriels Miene verfinsterte sich. «Seraphimfeuer. Das bedeutet, ein Feuerengel ist bereits ein Bündnis mit Luzifer eingegangen. Die Apokalyptiker sammeln Seelen, um Luzifers Hilfe zu erbitten …»
«… für die Befreiung Seraphiels», ergänzte Aaron und Hass loderte in ihm auf. Er ballte die Fäuste. Immer hatte er geahnt, dass dieser Tag kommen würde. Und darauf gehofft, endlich Vergeltung üben zu können.
«Je mehr Engel sich Luzifer anschließen und je mehr Seelen er bekommt, desto stärker wächst sein Einfluss. Sollten sich meine Befürchtungen bewahrheiten, ruhen alle Hoffnungen auf deinen Schultern. Außer dir kann kein Blutengel einen Feuerengel im Kampf besiegen.»