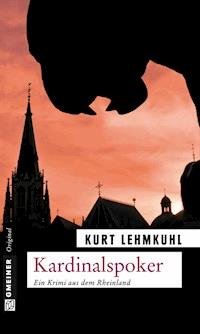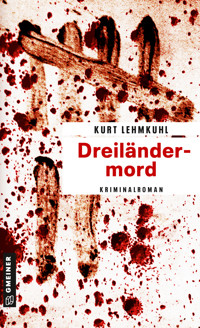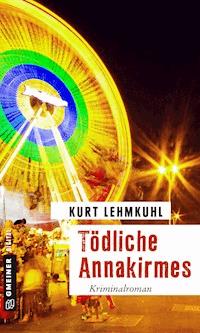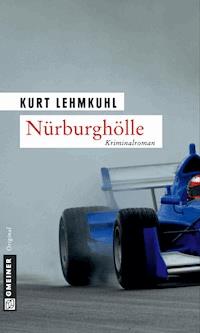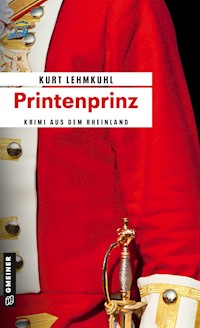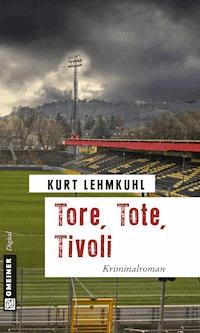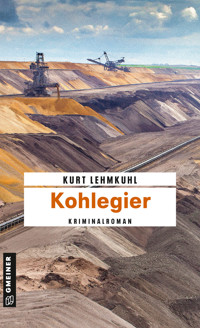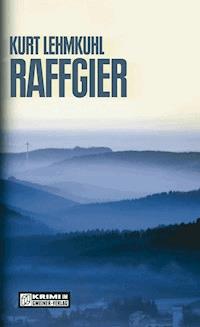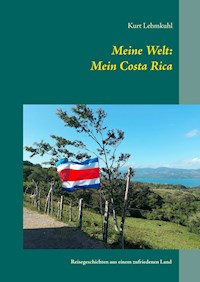Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Diakon wird nach einer Tagung in Aachen Opfer eines Mordes. Deswegen verurteilt wird eine Frau, die die Tat zwar bestreitet, aber aufgrund der erdrückenden Beweislage als überführt gilt. Ein Fall für den ehemaligen Kriminalhauptkommissar Rudolf-Günther Böhnke, der im Auftrag von Rechtsanwalt Tobias Grundler und mit Hilfe des pensionierten Staatsanwaltes Joachim Herbst die Geschichte hinter der Geschichte enthüllt und der zugleich in einem Verfahren gegen Grundler recherchiert, dem eine sexuelle Belästigung einer Referendarin vor mehr als zehn Jahren angelastet wird. Als Böhnke und Grundler endlich glauben, das Geschehen zu durchblicken, taucht Herbst ab und lässt sie bei den Ermittlungen allein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Diakon wird nach einer Tagung in Aachen Opfer eines Mordes. Deswegen verurteilt wird eine Frau, die die Tat zwar bestreitet, aber aufgrund der erdrückenden Beweislage als überführt gilt. Ein Fall für den ehemaligen Kriminalhauptkommissar Rudolf-Günther Böhnke, der im Auftrag von Rechtsanwalt Tobias Grundler und mit Hilfe des pensionierten Staatsanwaltes Joachim Herbst die Geschichte hinter der Geschichte enthüllt und der zugleich in einem Verfahren gegen Grundler recherchiert, dem eine sexuelle Belästigung einer Referendarin vor mehr als zehn Jahren angelastet wird. Als Böhnke und Grundler endlich glauben, das Geschehen zu durchblicken, taucht Herbst ab und lässt sie bei den Ermittlungen allein.
Dies ist ein Roman. Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1.
Im Namen des Volkes.
Schuldig. Mord.
Lebenslänglich.
Es waren nur einzelne Schlagworte, die in ihrem Gedächtnis hängen geblieben waren, nachdem der Richter das Urteil gesprochen hatte. Als der Vorsitzende des Schwurgerichts die Begründung für die härteste aller möglichen Haftstrafen verlas, konnte sie nicht mehr zuhören. Sie war nur noch fassungslos und unendlich müde. Ihr war sämtliche Kraft abhandengekommen, um sich zu wehren, um unentwegt zu beteuern, sie sei unschuldig.
»Ich habe ihn nicht umgebracht!«
Sie hatte geschrien, gefleht, gejammert, geweint, geschluchzt: »Ich habe ihn nicht umgebracht!«
Niemand wollte ihr glauben. Niemand hatte ihr geglaubt, und niemand würde ihr in Zukunft glauben.
Inzwischen zweifelte sie selbst an sich. Die eigene Überzeugung von ihrer Unschuld war im Laufe der letzten Wochen im Gerichtssaal immer mehr geschwunden. Vielleicht hatte sie ja doch den Mann umgebracht, der ihr die Liebe versprochen und dem sie geglaubt hatte. Das Schwein, das elende Schwein. Gut, dass er so elendig verreckt war. Sein Tod und noch mehr sein qualvolles Sterben erfüllten sie mit Genugtuung. Er hatte es nicht anders verdient.
Aber sie hatte ihn nicht umgebracht.
Oder doch?
Sie wollte die Erinnerung an das Verbrechen verdrängen. Sie wollte das Geschehene nicht als Wirklichkeit, sondern als Vorstellung, und ihre Vorstellung als Wirklichkeit erkennen.
Wo waren die Grenzen? Was war tatsächlich geschehen? Was bildete sie sich ein?
Sie hatte sich nicht einmal mehr die Mühe gemacht, das Urteil und die schriftliche Begründung zu lesen. Dazu fehlte ihr die Konzentration.
Ihr junger Pflichtverteidiger hatte die Schreiben des Gerichts in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Auch er glaubte ihr nicht, wenn sie von ihrer Unschuld gesprochen hatte. Eine Revision vor dem Bundesgerichtshof sah der gerade erst zugelassene Rechtsanwalt als nicht erfolgversprechend an.
Sie hatte ihn, wie schon im Gerichtssaal während des Prozesses, reden lassen, ohne sich einzumischen. Sie war mundtot geworden. Und sie hörte ihm längst nicht mehr zu.
Als er in seinem Plädoyer eine angemessene Strafe für die ihr zur Last gelegten Tat angeregt hatte, war ihr schmerzhaft bewusst geworden, dass auch er in ihr eine Mörderin gesehen hatte, die er nur deshalb verteidigte, weil er als ihr Pflichtverteidiger vom Gericht dazu bestellt worden war. Da hatte er das Mandat nicht ablehnen können.
Mittlerweile war ihr egal, was mit ihr passierte und passieren würde. Sie verbüßte eine lebenslange Strafe, die vielleicht doch nicht lebenslang sein würde. Möglicherweise wurde sie nach 25 Jahren aus der Haft entlassen. Und dann? Dann hatte sie die 70 überschritten. Dann war ihr Leben vorbei, ob vor oder hinter den Gitterstäben. Dann war sie längst vergessen.
Sie korrigierte sich. Sie war jetzt schon vergessen, vielleicht von zwei Ausnahmen abgesehen: von Wolfgang und von ihrem Mann.
Für ihren Ehemann war sie ein lästiges Übel geworden. Er wurde notgedrungen an ihr Dasein erinnert, schließlich waren sie verheiratet. Manches behördliche Schreiben war immer noch an die Eheleute Elisabeth und Hermann Zeigler adressiert.
Zwangsläufig musste er ihren Namen gemeinsam mit dem seinen lesen.
Dieses Übel würde jedoch nicht mehr lange währen.
Langsam legte Elisabeth das Schreiben aus der Kanzlei von Rechtsanwaltes Dr. Dieter Schulz aus Aachen zur Seite, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihr Ehemann die Scheidung in die Wege geleitet hätte.
Der Jurist gab ihr den wohlgemeinten Ratschlag, einen eigenen Anwalt zu beauftragen, der unvoreingenommen ihre Interessen in dieser Angelegenheit vertreten würde. Er hatte auch, unverbindlich, wie er betonte, eine Empfehlung beigefügt: Dr. Tobias Grundler.
Einer mehr, der auf ihre Kosten abzocken wollte! Dabei war doch bei ihr nichts zu holen. Sie war arm wie eine Kirchenmaus.
Wenn sie überhaupt noch etwas hatte, dann war es der Gedanke an Wolfgang.
»Ich denke an dich, jeden Abend um 22 Uhr«, hatte er ihr in seinem letzten Brief geschrieben. »Und du denkst zur gleichen Zeit an mich.«
Sie dachte tatsächlich jeden Abend an ihn. Ob er auch an sie dachte?
Wolfgang hatte sich seit diesem Brief nicht mehr gemeldet.
Sie zuckte zusammen. Sie dachte wieder an das Schwein, das ihr Leben ruiniert hatte. Die gedankliche Erwähnung der Kirchenmaus hatte gereicht, ihre Wut, ihre Verzweiflung, ihre Hoffnungslosigkeit kurz aufflackern zu lassen. Er war ein Mann der Kirche gewesen, ein Mann, der Nächstenliebe predigte, aber nur an seine eigene sexuelle Triebhaftigkeit glaubte. Er hatte sich von ihr geholt, was er wollte. Und jetzt? Jetzt war er Gott sei Dank tot.
Unwillkürlich musste sie schmunzeln.
Gott sei Dank war er tot, das hörte sich gut an bei einem Kirchenmann.
Am liebsten würde sie Hermann umbringen. An das Versprechen »In guten wie in schlechten Zeiten« fühlte der sich nicht gebunden. Der Ehemann ließ sie fallen wie eine heiße Kartoffel und zerquetschte sie mit seinem Stiefel, bis dreckiger, ungenießbarer Brei übrig blieb.
Aber konnte sie von diesem Mann etwas anderes erwarten?
Jeder in der bürgerlichen Gesellschaft würde Verständnis für ihn haben, wenn Hermann Zeigler sich von dieser Ehebrecherin und Mörderin Elisabeth Zeigler endlich scheiden ließ.
Sie schüttelte sich, als könne sie dadurch den gedanklichen Ballast abwerfen. Der Blick auf die Uhr verriet ihr, dass es Zeit war für den schönsten Moment des Tages.
Es war 22 Uhr geworden – und sie dachte an Wolfgang.
Was hatte sie denn sonst noch vom Leben?
2.
»Commissario, warum tust du dir das überhaupt an? Kannst du mir das gefälligst verraten?«
Der Gefragte schaute seinen Begleiter an, blieb stehen und zuckte mit den Schultern. »Weil ich nicht anders kann.« Er grinste. »Und weil ich weiß, dass ich nicht allein sein werde. Du machst mit und Tobias ohnehin. Schließlich ist er unser Auftraggeber.«
»Tobias Grundler ist dein Auftraggeber«, korrigierte ihn der andere, »nicht unserer.« Er setzte sich in Bewegung und ließ seinen Begleiter stehen. »Dann erzähl mal, Commissario. Bisher weiß ich nur, dass du für deinen Freund tätig werden sollst«, sagte er beiläufig beim Davonschreiten.
Das Grinsen des pensionierten Kommissars wurde breiter, während er dem hageren Mann nachstiefelte, der ungelenk auf dem Weg zwischen den abgegrasten Weiden auf den herbstlichen Wald zulief.
»Lennet, nicht so schnell«, rief er, »ich bin ein alter Mann.«
»Ich bin auch nicht viel jünger als wie du«, schallte es fröhlich zurück.
»Aber du bist gesünder als ich, mein Freund.«
Das äußere Erscheinungsbild der beiden Männer knapp über 60 stand im krassen Widerspruch zu dieser Bemerkung. Der hagere, schwarz gekleidete Mann mit den schulterlangen, dünnen grauen Haaren, der bei jedem seiner ungelenken Schritte den Eindruck vermittelte, er würde im nächsten Moment umknicken und zu Boden fallen, war kerngesund. Niemand würde in ihm einen ehemaligen Staatsanwalt erkennen, der in seine Heimatstadt Aachen zurückgekehrt war, wo ihm wegen seiner frappierenden Ähnlichkeit zu einem beliebt-berühmten Karnevalsidol der Kaiserstadt zwangsläufig der Spitzname Lennet Kann verpasst worden war und wo er sofort wieder in das für Öcher typische »als wie« verfallen war.
Aus vermeintlich gesundheitlichen Gründen hatte Oberstaatsanwalt Joachim Herbst seinen Dienst in Koblenz quittieren müssen; tatsächlich war er im Zuge seiner letzten Ermittlungen aus politischen Gründen unbequem geworden. Er hatte der vorzeitigen, von seinen Vorgesetzten forcierten Versetzung in den Ruhestand zuerst zaudernd gegenübergestanden, dieses aufgedrängte Angebot dann aber doch gerne angenommen; und kaum war er zurück ins belgisch-niederländisch-deutsche Dreiländereck gezogen, waren sämtliche Magenschmerzen und Krämpfe, die ihn in den vergangenen Monaten zunehmend geplagt hatten, verschwunden.
Herbst wusste, dass er viel besser dran war als sein Freund Rudolf-Günther Böhnke, den er bei seinem letzten Fall als Staatsanwalt, einem gewaltigen Klinikskandal, kennengelernt hatte. Der pensionierte Erste Kriminalhauptkommissar hatte damals schon gemeinsam mit Grundler daran gearbeitet, die dubiose Geschichte um den Arzt Dr. Gottfried Weiß aufzuklären. Böhnke, langjähriger Leiter der Abteilung für Tötungsdelikte im Polizeipräsidium Aachen, sah zwar aus wie das strahlende Leben, groß, schlank, kurzes, graues Haar, aber er war von einer merkwürdigen Erkrankung befallen, die jederzeit seinen Tod bedeuten konnte.
Böhnke sprach nicht darüber, und auch Herbst akzeptierte diese distanzierte Haltung von Böhnke zur Endlichkeit. Er genieße jeden Tag, als sei es sein letzter, hatte Böhnke bei einer ihrer Wanderungen durch den Buchenwald gesagt. Er war mit sich und seinem Leben im Reinen. Der Pensionär hatte sich in der Eifel ein Umfeld geschaffen, in dem sich auch Herbst wohlfühlte, weshalb Herbst lieber nach Huppenbroich kam, als dass Böhnke ihn in Aachen besuchte. Ein nach dem Zweiten Weltkrieg als Hühnerstall genutztes Gebäude hatte Böhnke gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin zu einem Wohnhaus umgebaut. Gedacht war die Bleibe ursprünglich als Ferienwohnung, nach Böhnkes Pensionierung war sie zu seinem dauerhaften Domizil geworden.
Herbst freute sich jedes Mal darauf, seinen neuen Freund in der Abgeschiedenheit des kleinen Orts am Nordrand der Eifel zu besuchen. Nicht einmal 20 Kilometer lagen zwischen der hektischen Großstadt im Norden und der natürlichen Idylle zwischen Monschau und dem Rursee; für Herbst mit seinem Auto ein Katzensprung, für Böhnke als Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs ein ständiges Abenteuer. Herbst ging auf die letzte Bemerkung seines Begleiters nicht ein. »Also, erzähl!« Er hatte gewartet, bis Böhnke wieder an seiner Seite war. »Was will Grundler? Was sollst du? Wie kann ich dir helfen?«
»Drei Fragen zu einem Thema.« Böhnke orientierte sich kurz, als sie am Waldrand angelangt waren. Dann schlug er den Weg ein, der ihn schnell wieder in das 400-Seelen-Dorf Huppenbroich zurückbringen würde. »Im Prinzip geht es um eine banale Scheidungsangelegenheit. Tobias vertritt eine gewisse Elisabeth Zeigler, sein Freund und früherer Partner Dieter den Ehemann Hermann Zeigler. Dr. Schulz hat Tobias das Mandat der Gegenpartei quasi aufs Auge gedrückt.«
»Warum?«
»Kann ich dir sagen. Schulz will einen guten Kontrahenten. Er meint, dass Zeigler seine Frau abzocken will, und das passt ihm nicht. Der ist ihm zu geldgierig. Deshalb hat er Tobias gebeten, die Gegenseite zu vertreten.«
»Ja, und nun? Ein Rosenkrieg ist nicht gerade eine Sache, bei der ein ehemaliger Staatsanwalt und ein ehemaliger Kriminalbeamter mitmischen müssen.«
»Das nicht«, bestätigte Böhnke, »interessant sind die Voraussetzungen des ungleichen Gefechts. Zeigler erfreut sich seines Lebens, seine Frau sitzt als frisch verurteilte Mörderin hinter Gittern.«
»Wir sollen jetzt rauskriegen, dass sie unschuldig ist und in Wirklichkeit Zeigler der Mörder war?«, fragte Herbst erstaunt. »Jetzt, wo alle Messen gesungen sind und das Urteil vollstreckt wird.«
»Zwei Dinge hast du angesprochen«, meinte Böhnke lehrerhaft. »Ob Zeigler ein Mörder ist, brauchen wir nicht zu klären. Nach den Ermittlungen meiner Kollegen und den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hat er nichts mit dem Mord zu tun, der seiner Frau angelastet wird. Der hat ein lupenreines Alibi, wie es lupenreiner nicht sein kann.«
»Gerade das macht ihn doch verdächtig«, warf Herbst ein.
»Nein, in diesem Falle garantiert nicht«, widersprach Böhnke schnell. »Ich beziehungsweise wir sollen herausfinden, ob es irgendwo in der Angelegenheit eine Schwachstelle gibt, welcher Art auch immer, die Grundler dabei helfen könnte, die Position der Frau im Scheidungsverfahren zu stärken.«
»Warum?«, fragte Herbst ein zweites Mal.
»Weil nach dem jetzigen Stand der Dinge Elisabeth Zeigler nichts behält und Hermann Zeigler alles einkassiert. Unter anderem geht es um einige wertvolle Geschenke, die er ihr gemacht hat oder gemacht haben soll. Die will er zurück.«
»Noch ein Grund mehr, sich intensiv mit dem Gatten mit dem lupenreinen Alibi zu beschäftigen.«
Erneut widersprach Böhnke. »War alles einvernehmlich zwischen den Eheleuten geklärt. Der Ehemann braucht keinen Finger krumm zu machen, um irgendwann einmal das alleinige Vermögen zu besitzen.«
»Na ja«, meinte Herbst lakonisch. »Eigentlich braucht die Gute im Knast überhaupt nichts. Bei freier Kost und Logis darf sie Tüten kleben und braucht sich um ihren Job und ihren Lebensunterhalt keine Gedanken zu machen. Die sind krisensicher.« Er musste sich beeilen, um Anschluss an Böhnke zu halten, der unvermittelt in einen versteckten Pfad zwischen den Gärten hinter der Wohnbebauung abgebogen war. »Siehst du denn überhaupt einen Ansatz für eine erfolgreiche Arbeit?« Es sei schon merkwürdig oder gar bizarr, dass sie sich für eine Mörderin ins Zeug legen sollten, bloß weil der Anwalt des scheidungswilligen Gatten seinem Mandanten nicht das ganze Hab und Gut, sondern nur einen Teil davon gönnte.
»Ich weiß nicht, was wir tun können, Lennet. Aber ich habe einen großen Berg von Akten im Hühnerstall, über die wir uns gleich hermachen werden.« Böhnke nestelte umständlich in seiner Jackentasche nach dem Haustürschlüssel.
»Es wird langsam frisch draußen. Rein mit dir in die gute Stube!«
Der Wechsel von der guten Stube im Hühnerstall zur guten Stube von Huppenbroich war nicht nur dem aufkommenden Hungergefühl geschuldet. Böhnke und Herbst hatten in konzentriertem Schweigen die von Grundler zur Verfügung gestellten Unterlagen durchforstet, und hatten sich danach zur Dorfgaststätte »Zur alten Post« aufgemacht, um dort zu Abend zu essen und dabei ihre Erkenntnisse auszutauschen und zu diskutieren.
Passend zu seinen Klamotten müsste Böhnke ein Holzfällersteak bestellen, feixte Herbst in Anbetracht des grob karierten Flanellhemds und der ausgebleichten Jeans, die Böhnke wie immer trug und in der eh mehr einem Landwirt als einem Kriminalbeamten entsprach.
Böhnke nahm die kleine Lästerei kommentarlos hin. Er musste schmunzeln, als die Bedienung Herbst erstaunt ansah und ihn beim Auftischen der Getränke und der Speisen fragte, ob er derjenige Lennet Kann sei, der bei der Karnevalssitzung im Januar im Saal auftreten soll. Herbst und Karneval, das passte zusammen wie Sommer und Schneefall.
Die beiden Pensionäre waren sich einig: Es gab nichts auszusetzen an der Arbeit der Polizei, der Staatsanwaltschaft und des Gerichts, die dazu geführt hatte, dass Elisabeth Zeigler als Mörderin von Walter Gemünder angeklagt und rechtskräftig verurteilt worden war.
Der Sachverhalt war eindeutig gewesen: Gemünder hatte die Frau, die er vor ein paar Wochen während einer gemeinsamen Reha-Maßnahme kennengelernt hatte, am Wochenende besucht und war am Sonntagmorgen bei der Rückfahrt nach Hause mit seinem Wagen verunglückt, weil sie ihm ein Flasche mitgegeben hatte, in der sich mit Schlafmitteln und Blutverdünnern versetztes Mineralwasser befand. Kurz vor seinem Heimatort hatte der Mann das Bewusstsein und damit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der dadurch verursachte Unfall endete mit seinem Tod.
Auf Gemünders Handy befand sich eine von ihm noch nicht gelesene SMS, die ihm Elisabeth Zeigler nach seiner Abfahrt am Vormittag geschrieben hatte. »Hoffentlich verreckst du elendig«, hatte sie darin unmissverständlich geschrieben.
»Der Gemünder wollte das Techtelmechtel mit seinem Kurschatten beenden, und sie war sauer«, meinte Herbst. »Da hat sich die Zeigler für immer ihres Kurschattens entledigt.«
Das Gericht hatte Heimtücke als Tatmotiv angenommen. Nichts ahnend hatte Gemünder während der Fahrt das Wasser getrunken. Damit hatte er seine Schläfrigkeit bewirkt, die ihn fahruntüchtig werden ließ, so dass er nach dem Unfall, bei dem sein Wagen zunächst in einer scharfen Kurve geradeaus einen Abhang hinunterstürzte und nach mehrmaligem Überschlag gegen einen Baum prallte und zerbrach, tot oder zumindest schwer verletzt war. Zugleich hatte das vergiftete Wasser sein Blut verdünnt. Die inneren Blutungen waren so stark gewesen, dass er sie nicht überleben konnte.
»Die ist auf Nummer sicher gegangen«, kommentierte Herbst nüchtern. »Sollte Gemünder den Unfall überstehen, würden ihm innere Blutungen den Garaus machen.« Er ließ sich die Bockwurst mit Kartoffelsalat schmecken. »Lecker hier.«
»Wie immer.« Böhnke hob sein Wasserglas und prostete seinem Freund zu. Er kam zum Thema zurück. »Die Strafsache ist ordentlich aufgearbeitet worden. Es gibt im Prinzip nur eine Person, die eine andere Ansicht als alle anderen äußert.«
»Elisabeth Zeigler.«
»Richtig, du Schnelldenker.«
»Schutzbehauptung«, sagte Herbst. »Hast du je von einem Mörder gehört, dass er freiwillig die Tat zugibt? Die Mörder beteuern alle ihre Unschuld, solange wir sie nicht überführt haben.«
Böhnke hatte kein Gegenargument. Herbst hatte recht. Warum sollte er sich also überhaupt um die Angelegenheit kümmern?
Nur weil Grundler und Schulz in einer Scheidungsangelegenheit herumrührten?
Das aufgeregte Zucken in Herbsts Mundwinkeln machte ihn stutzig. »Was ist, Lennet?« Er ahnte, was kommen würde.
»Lass uns den Fall aufdröseln, nur so. Quasi aus Spaß. Ich hätte Lust, mal wieder aktiv zu werden. Leute befragen und so. Vielleicht ist ja doch nicht alles so glatt gelaufen, wie es scheint. Und wenn es uns nur gelingt, Zweifel zu streuen, dann hat dein Freund Grundler vielleicht einen Ansatz bei einem Scheidungsprozess, um die Position seiner Mandantin zu stärken.« Er leerte sein noch gut gefülltes Bierglas in einem Zug. »Oder hast du etwas Besseres vor in den nächsten Wochen und Monaten, Commissario?«
Wenn er ehrlich war, musste Böhnke die Frage bejahen. Er wollte den großen Garten winterfest machen. Das in einem Unterstand abgelagerte Holz für den Kachelofen musste endlich ins Haus. Die Ruhe in den Buchenwäldern rund um Huppenbroich wartete bei Spaziergängen auf ihn. Und dann war da noch Lieselotte, die er nicht vernachlässigen wollte.
Aber andererseits war der Tatendrang von Herbst ansteckend. Zugleich würde eine Ermittlungsarbeit Abwechslung bringen und viele Treffen mit dem neuen Freund.
»Okay.« Böhnke hatte sich schnell entschieden. »Lass es uns machen. Aber nicht von Freitagabend bis Montagmorgen. Dann gehört meine Zeit ausschließlich Lieselotte.«
Er zauderte und überlegte lange, ob er Herbst bei einer zweiten Sache ins Bild setzen sollte, eine Sache, die ihm Grundler anvertraut hatte und die verdammt heikel werden konnte. Er entschied sich, Herbst zunächst nicht einzuweihen. Er würde noch einmal mit Grundler reden, nahm Böhnke sich vor, und nur mit dessen Einverständnis würde er Herbst informieren – aber auch nur dann, wenn es ihm und Grundler nicht gelingen würde, die leidige Sache allein aus der Welt zu schaffen; eine Sache, die Grundler den Kopf kosten könnte, egal, ob sie der Wahrheit entsprach oder nicht.
3.
Grundler war ein merkwürdiger Typ. Sah gar nicht so aus wie ein Rechtsanwalt. Graues Sweatshirt, blaue Jeans, blonde Haare, groß, bestimmt über 1,80. Auf Mitte 40 schätzte Elisabeth ihn, als er sich zum ersten Mal mit ihr in der Justizvollzugsanstalt in Köln traf. Sympathischer Typ. Einer, auf den die Frauen flogen, und der wusste, dass er gut bei Frauen ankam. Nicht viel jünger als sie. Unter anderen Umständen vielleicht reizvoll. Er wollte unbedingt ihr Mandat übernehmen. Sie willigte ein, als er ihr versprach, dass er auf sein Honorar verzichten würde, wenn sie bei der Scheidung leer ausgehen sollte. Was hatte sie schon zu verlieren?
Er löcherte sie mit Fragen. Was hatte sie an Dingen mit in die Ehe gebracht? Welche Geschenke hatte ihr Hermann gemacht? Konnte sie den Wert seiner Geschenke abschätzen?
Sie fühlte sich überfordert. Ihr fehlte die Konzentration, um sich an die Zeit vor der Gefangenschaft zu erinnern.
Außerdem hatte das doch alles keinen Sinn.
Doch! Grundler war fuchsteufelswild geworden, als sie sich in ihre Resignation zurückziehen wollte. Er wollte alles haarklein wissen. Was waren die Ketten, Armbanduhren und Ringe wert, die Hermann ihr geschenkt hatte? Sie wusste es nicht. Sie wusste nicht einmal genau, wo sie den Schmuck in ihrer Wohnung aufbewahrt hatte. Über Geld hatten sie und Hermann nie gesprochen. Für sie war es selbstverständlich gewesen, dass sie ihr Erspartes und später ihr Erbe in das Doppelhaus steckte, das Hermann für sie beide nach der Hochzeit gekauft hatte. Sie hatte beim Notar unterschrieben und sich danach um nichts mehr gekümmert. Schön blöd, hatte Grundler kommentiert und ihr einen Grundbuchauszug vorgelegt. Darin war Hermann Zeigler als Eigentümer ausgewiesen. Ihr Name tauchte dort ebenso wenig auf wie auf den Konten und den Sparbüchern. Ihr Ehemann war alleiniger Herrscher über das Geld und die Immobilie. Sie hatte nichts, war im Prinzip mittellos. Eben eine arme Kirchenmaus, die immer wieder auf Männer hereinfiel, wie sie ohne Selbstmitleid feststellte.
Blöde Kuh, hatte sich Grundler gedacht und geschwiegen.
Blöde Kuh, dachte er sich ein zweites Mal, als Elisabeth über ihre kurze Bekanntschaft mit Gemünder sprach. In einer Reha hatten sie sich kennengelernt. Er hatte ihr den Hof gemacht. Sie hatte sich auf ihn eingelassen und nach dem Ende des Klinikaufenthalts zu sich eingeladen. Gemünder war gekommen und über Nacht geblieben. Sie hatte seinem liebevollen Drängen nachgegeben und hatte mit ihm geschlafen. Er sollte der neue Mann an ihrer Seite sein. So schilderte sie den Verlauf ihrer Begegnung. Ob es tatsächlich so gewesen war, verriet sie nicht. Sie schämte sich.
Nach dem erneuten Geschlechtsverkehr am Sonntagmorgen hatte Gemünder ihr am Frühstückstisch leidenschaftslos gesagt, er wolle sie nie mehr wiedersehen. Er würde fahren. Es wäre nett mit ihr gewesen, mehr nicht.
Sie fühlte sich verletzt, entehrt, missbraucht. Wütend hatte sie ihn aus der Wohnung gedrängt. Die Mineralwasserflasche, die sie auf die Anrichte gestellt hatte, hatte er ungefragt mitgenommen.
Nein, sie hätte die Tabletten nicht hineingetan, behauptete sie. Sie wisse nichts davon. Ja, sie hätte ihm die SMS geschrieben. Aber die Verwünschung sei doch nur Ausdruck ihrer Wut gewesen.
Ob Grundler ihr glaubte?
Er hatte keine Miene verzogen und keinen Kommentar abgegeben, sondern nur stumm einige Notizen gemacht.
Sonst noch was?, hatte er sie stattdessen gefragt. Gebe es noch etwas, was er wissen müsse? Etwas, was für sie von Bedeutung sei oder das sie entlasten könnte?
Nein. Sie wollte nur ihre Ruhe haben. Die Scheidung war längst überfällig. Ihretwegen sollte Hermann mit Schmuck und Doppelhaus, Lebensversicherung und Rentenansprüchen glücklich werden. Sie brauchte die materiellen Dinge nicht.
Könnte Hermann bei dem Mord eine Rolle spielen? Sie musste spontan über Grundlers Frage lachen. Hermann, diese Schlafmütze? Der sei an dem Wochenende, als sie heimlichen Herrenbesuch hatte, gar nicht zu Hause gewesen. Da hatte er mit seinen Kegelbrüdern einen Jahresausflug zur Mosel gemacht. Die wären zwar wahrscheinlich mit Ausnahme von Hermann mehr besoffen als nüchtern gewesen, aber sie würden seine dauerhafte Anwesenheit in ihrer Mitte in einem Weinlokal bezeugen können. Hermann, die Lusche, ängstigte sich sogar vor Spinnen und Mäusen, da musste sie ran, um sie zu töten und zu entsorgen. Hermann war ein Sesselfurzer, der selbst beim geselligen Ausflug mit seinen Freunden als einziger schüchtern und nüchtern als Mauerblümchen hocken blieb.
Nein, es gebe nichts, was man ihrem Noch-Mann anlasten könnte, sagte Elisabeth.
Sie verabschiedete Grundler und ließ sich in ihre Zelle zurückbringen. Dem Anwalt von Wolfgang zu erzählen, dafür sah sie keine Veranlassung.