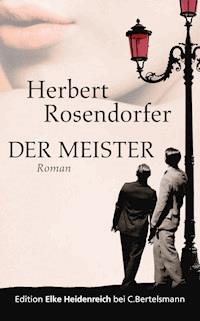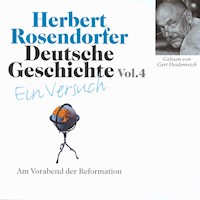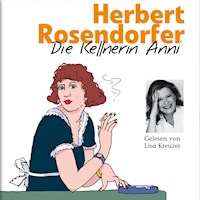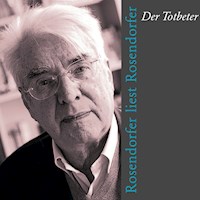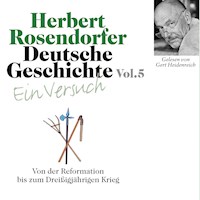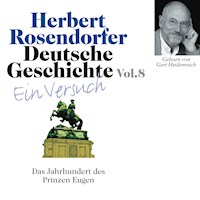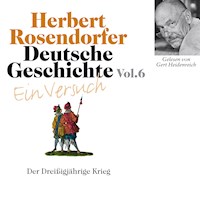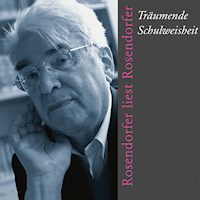Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mandarin aus dem China des 10. Jahrhunderts versetzt sich mit Hilfe eines "Zeit-Reise-Kompasses" in die heutige Zeit. Er landet in einer modernen Großstadt, deren Namen in seinen Ohren wie Min-chen klingt und die in Ba Yan liegt. Verwirrt und wissbegierig stürzt er sich in ein Abenteuer, von dem er nicht weiß, wie es ausgehen wird. In Briefen an seinen Freund im Reich der Mitte erzählt er vom seltsamen Leben der "Großnasen" und versucht Beobachtungen und Vorgänge zu interpretieren, die ihm selbst zunächst unverständlich sind. "Herbert Rosendorfer skizzierte 1983 (...) humorvoll eine düstere Gegenwart von "Min-chen", die derzeit überaus hellsichtig erscheint." (Süddeutsche Zeitung, 20. April 2022)
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Distanzierungserklärung: Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
© 2023 Langen Müller Verlag GmbH
© 1983 F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Satz und E-Book Konvertierung: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
ISBN 978-3-7844-8448-8
www.langenmueller.de
Inhalt
Vorbemerkung
Erster Brief
Zweiter Brief
Dritter Brief
Vierter Brief
Fünfter Brief
Sechster Brief
Siebter Brief
Achter Brief
Neunter Brief
Zehnter Brief
Elfter Brief
Zwölfter Brief
Dreizehnter Brief
Vierzehnter Brief
Fünfzehnter Brief
Sechzehnter Brief
Siebzehnter Brief
Achtzehnter Brief
Neunzehnter Brief
Zwanzigster Brief
Einundzwanzigster Brief
Zweiundzwanzigster Brief
Dreiundzwanzigster Brief
Vierundzwanzigster Brief
Fünfundzwanzigster Brief
Sechsundzwanzigster Brief
Siebenundzwanzigster Brief
Achtundzwanzigster Brief
Neunundzwanzigster Brief
Dreißigster Brief
Einunddreißigster Brief
Zweiunddreißigster Brief
Dreiunddreißigster Brief
Vierunddreißigster Brief
Fünfunddreißigster Brief
Sechsunddreißigster Brief
Siebenunddreißigster und letzter Brief
Dank
Quellen
Vorbemerkung
Die Datierung der Briefe des Mandarins Kao-tai an seinen Freund, den Mandarin Dji-gu, wurde aus dem altchinesischen in den europäischen Kalender umgerechnet.
Die Anrede und die Schluß- und Grußformeln wurden vereinfacht und nur sinngemäß übersetzt. Diese Formeln im altchinesischen Briefstil sind außerordentlich kompliziert und überladen. Dies wurde alles weggelassen. Kao-tai redet seinen Freund im Original mit dessen Männernamen an und unterschreibt selber mit seinem Gelehrtennamen, gelegentlich mit seinem Männernamen. Auch dies wurde auf die Familiennamen der Briefpartner vereinfacht.
Erster Brief
(Mittwoch, 10. Juli)
Treuer Freund Dji-gu.
Die Zukunft ist ein Abgrund. Ich würde die Reise nicht noch einmal machen. Nicht das schwärzeste Chaos ist mit dem zu vergleichen, was unserem bedauernswerten Menschengeschlecht bevorsteht. Wenn ich könnte, würde ich sofort zurückkehren. Ich fühle mich in eine Fremde von unbeschreiblicher Kälte hinausgeworfen. (Obwohl es auch hier Sommer ist.) Für heute nur soviel: ich bin, in Anbetracht der ungewöhnlichen Art meiner Reise, leidlich gut angekommen. Ich kann nur rasch diese Zeilen kritzeln und den Zettel an den Kontaktpunkt legen. Ich hoffe, Du findest ihn. In Liebe grüßt Dich Dein
Kao-tai
Dritter Brief
(Mittwoch, 17. Juli)
Geliebter Freund Dji-gu.
Ja, ich habe einen Menschen in diesem Abgrund, in diesem schwarzen Strudel von Zukunft gefunden. Ich muß gerecht gegen unsere Enkel sein: sogar zwei Menschen, und beim zweiten scheint es mir nicht ausgeschlossen, daß er mein Freund wird, obwohl ich – wie gerade Du weißt – äußerst geizig mit dieser Bezeichnung bin. Zwar brüllt auch Herr Shi-shmi (so heißt der zweite Mensch), aber ich habe das Gefühl, von ihm trennen mich nicht 100 000 Li wie von den anderen, sondern nur 99 999. Alle außer den zweien erscheinen mir nach wie vor wie bleiche Riesenkrebse ohne Ähnlichkeit mit Dir und mir und unseresgleichen. Freilich, auch Herr Shi-shmi ist weit davon entfernt, mich zu verstehen, aber er hilft mir seine ferne Welt zu begreifen.
Kennengelernt habe ich Herrn Shi-shmi auf ziemlich unwegsame und leider auch schmerzliche Weise. Du wirst daran sehen, was ich in den wenigen Tagen, die ich nun »unterwegs« bin, alles erlebt habe. Ich schreibe an Herrn Shi-shmis Tisch, in seinem Haus. Er selber ist nicht da. Der Kontaktpunkt ist zum Glück nicht weit vom Haus entfernt. Ich könnte ihn zur Not allein finden.
Wir haben vor meiner Abreise viel über mein, wie manchem scheinen könnte, nicht ungefährliches Unternehmen gesprochen. Du, geliebter Dji-gu, der Erfinder des mathematischen Zeitsprungs, bist der einzige, der von meiner Reise weiß. Wir haben viel gesprochen, und Du erinnerst Dich, daß ich den weisen Satz des großen Meng-tzu »Wer beobachten will, darf selber nicht beobachtet werden« als einen der wichtigsten Grundsätze für mein Vorhaben betrachtete. Ich habe deshalb, wie Du selber gesehen hast, eine denkbar unauffällige Kleidung für meine Reise gewählt, habe auf alle Rangabzeichen als Kwan der Klasse »A4«[3] verzichtet und sogar meine Amtskette als Präfekt der kaiserlichen Dichtergilde »Neunundzwanzig moosbewachsene Felswände« – die zu tragen ich eigentlich verpflichtet bin – zurückgelassen. Ich wollte nicht auffallen, wollte unbeobachtet beobachten. Aber die ganzen weisen Sprüche nicht nur des Meng-tzu, nein, des ganzen ›Li Chi‹ helfen in dieser verrückten Zukunft nichts. Meine, wie wir meinten, unauffällige Kleidung ist für hiesige Begriffe so außer jeder Gewohnheit, daß ich genausogut in Weiberkleidung oder als bunter Palasthund verkleidet angekommen sein könnte. Das Aufsehen wäre auch dann nicht größer gewesen.
Die Reise selber verlief ganz ohne Schwierigkeiten und war das Werk eines Augenblicks. Unsere vielen Experimente haben sich gelohnt. Nachdem ich Dich auf jener kleinen Brücke über den »Kanal der blauen Glocken« – die wir als den geeignetsten Punkt ausgesucht und errechnet hatten – umarmt, alles in Gang gesetzt hatte, was notwendig war, war es mir, als höbe mich eine unsichtbare Kraft in die Höhe, wobei ich gleichzeitig wie von einem Wirbelwind gedreht wurde. Ich sah noch Dein rotes Gewand leuchten, dann wurde es Nacht. Einen Augenblick danach saß ich, natürlich etwas benommen, auf ebender Brücke über den »Kanal der blauen Glocken«; aber es war alles anders. Kein einziges Gebäude, keine Mauer, kein Stein von dem, was ich eben noch gesehen hatte, war noch vorhanden. Ungeheurer Lärm überfiel mich. Ich saß am Boden neben meiner Reisetasche, die ich krampfhaft festhielt. Ich sah Bäume. Es war – es ist – Sommer wie vor tausend Jahren. Eine fremde Sonne schien über dieser Welt, die so sonderbar, so völlig unbegreiflich ist, daß ich zunächst gar nichts wahrnahm. Ich saß da, hielt meine Reisetasche fest, und wenn ich gekonnt hätte, wäre ich sofort wieder zurückgekehrt. Aber Du weißt, das geht nicht. Mein erster Gedanke war: hat Shiao-shiao Sehnsucht nach mir? Ich werde warten müssen, bis ich sie wieder liebkosen kann. Sie wird warten müssen.
Die Brücke, auf der ich erwachte oder ankam, ist ganz anders als die Brücke, auf der ich Dich verließ. Sie spannt sich zwar immer noch über den »Kanal der blauen Glocken«, ist aber nicht mehr aus Holz, sondern aus Stein, allerdings aus sehr grob gehauenem, und offensichtlich ziemlich lieblos zusammengefügt. Alles »hier« ist lieblos gemacht. Ich dachte: zum Glück haben die nach tausend Jahren immer noch eine Brücke an derselben Stelle. Es hätte ja sein können, daß sie, nachdem die alte Holzbrücke verfault oder sonst zusammengebrochen war, die neue Brücke etwas weiter oben oder unten errichtet hätten. Dann wäre ich ins Wasser gefallen, was natürlich unangenehm, aber nicht gefährlich gewesen wäre, denn der »Kanal der blauen Glocken« ist längst nicht mehr so tief, wie Du ihn kennst, allerdings äußerst schmutzig. So ziemlich alles hier ist äußerst schmutzig. Schmutz und Lärm – das beherrscht das Leben hier. Schmutz und Lärm ist der Abgrund, in den unsere Zukunft mündet.
Auch die Hügel auf der westlichen Seite des Kanals haben sie inzwischen abgetragen, denn alles ist ganz flach, soweit man sehen kann. Aber das habe ich Dir im letzten Brief schon mitgeteilt.
Ich richtete mich auf – ganz benommen, sagte ich schon –, stellte meine Reisetasche ab und schaute mich um. Nach dem Plan für meine ersten Schritte in der Zukunft, den wir so herrlich ausgearbeitet haben (ich kann Dir gleich sagen: er hat sich als völlig undurchführbar erwiesen), sollte ich mich zunächst zu der Stelle begeben, wo Dein Gartenhaus steht, um den erwähnten Stein zu suchen, den wir neben dem Eingang in den Boden haben rammen lassen. Ich kam gar nicht so weit, denn von dort, wo damals – Dein »jetzt« – das Haus der Jagdaufseherswitwe des Mandarins Mawang stand, näherte sich, erschrick nicht, ein Riese. Er war ganz in komische graue Kleider gehüllt, die völlig unnatürlich waren – auch darauf werde ich später noch zurückkommen –, hatte eine enorm ungesunde bräunliche Gesichtsfarbe und, als allerauffallendstes, eine riesige, eine unvorstellbar große Nase; mir schien: seine Nase mache die Hälfte des Körpervolumens aus. Er blickte aber, wie mir schien, nicht unfreundlich. Er wollte über die Brücke gehen, blieb jedoch stehen, als er mich sah. Ich kann das Mienenspiel unserer Nachfahren noch nicht richtig deuten. (Sie sind uns so unähnlich, daß ich mich frage: sind sie es wirklich? Wirklich unsere Nachfahren?) Ich lerne auch erst, ihre Gesichter zu unterscheiden. Das ist sehr schwer, denn sie sehen alle gleich aus und haben alle gleich große Nasen. Daß jener Riese – oder jene Riesin, auch das Geschlecht ist kaum zu unterscheiden –, der erste Mensch, den ich nach meiner Reise von tausend Jahren sah, keine drohende Haltung einnahm, glaubte ich aber erkennen zu können. Vermutlich war er so erstaunt über meinen Anblick wie ich über seinen. Ich nahm meine Reisetasche in die Hand, ging auf ihn zu, verbeugte mich und fragte:
»Hoher Fremdling oder hohe Fremdlingin! Ich, der unwürdige und weniger als nichtsnutzige Kwan der vierthöchsten Rangklasse Kao-tai, Präfekt der kaiserlichen Dichtergilde ›Neunundzwanzig moosbewachsene Felswände‹, entbiete meine Hochachtung vor dir und deinen Ahnen.« Wer weiß, dachte ich, ob ich nicht selber unter diesen Ahnen bin. »Kannst du mir sagen, ob hinter jener Mauer einst das Gartenhaus meines Freundes, des erhabenen Mandarins Dji-gu, stand?«
Der Riese verstand aber offensichtlich nichts von meiner Rede. Er sagte etwas in einer mir völlig unverständlichen Sprache, das heißt: er brüllte mit so tiefer Stimme, daß es mich fast über das Brückengeländer warf, und ich hätte unverzüglich die Flucht ergriffen, wenn sich nicht inzwischen eine größere Anzahl weiterer Riesen angesammelt hätte, die mich alle anstarrten. Ich war ganz verzweifelt. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich mich sofort wieder in die Vergangenheit – in Deine und meine Gegenwart – verflüchtigt. Aber das geht ja nicht. Ich muß ausharren. Es ist auch gut so, denn das ist der Zweck meiner Reise. So umklammerte ich meine Reisetasche und wandte mich fragend an alle, ob nicht einer unter ihnen sei, der die Sprache der Menschen verstünde.
Es war keiner dabei.
Wenn man bedenkt, daß wir ohne Schwierigkeiten Bücher lesen können, die zweitausend Jahre alt sind, sich die Sprache bis auf uns von den ältesten Zeiten an nicht stark verändert hat, muß man sich wundern, daß sich die Sprache der Menschen in den nächsten tausend Jahren, die uns bevorstehen, so wandelt, daß ich mich mit keinem Wort mehr verständigen kann. Sollten das hier, diese Riesen mit ihrer brüllenden Sprache, gar keine Enkel von uns sein? Haben die Barbaren des Nordens es fertiggebracht, die Große Mauer zu überwinden? Haben sie unser Land überschwemmt, uns ausgerottet? Bewohnen sie nun unser Reich? Dagegen spricht, daß die Barbaren des Nordens ein zwar kräftiger und zäher, aber eher kleinerer Menschenschlag als wir sind. Nun – vielleicht gelingt es mir, auch da noch dahinterzukommen.
Inzwischen – aber auch davon später – habe ich ein paar Wörter der Zukunftssprache erlernt. Sie ist sehr schwer.
Die Großnasen und Riesen, die mich umringten – beruhige Dich: es sind keine Riesen; alle Leute »hier« sind größer, als wir es gewohnt sind –, schrien mit furchtbaren lauten und tiefen Stimmen durcheinander. Hättest du die Szene in einem Traum erlebt, hättest Du gemeint, in einen Haufen streitender Dämonen geraten zu sein. Offensichtlich redeten sie über mich. Da sie so brüllten – ich wußte zu dem Zeitpunkt noch nicht, daß die Leute hier immer brüllen –, fürchtete ich, es könnte im nächsten Augenblick eine Prügelei unter ihnen ausbrechen. Ich entwich deshalb in einem günstigen Moment und verließ die Brücke. Eine Straße ganz aus Stein zieht sich dort, wo Du jetzt, wenn Du diesen Brief bekommst, die äußeren Mauern der kaiserlichen Stallungen siehst, am Kanal entlang. Ich wollte die Straße überqueren, da passierte etwas ganz Schreckliches.
Übrigens – verzeih, daß ich von einem Gedanken zum anderen und wieder zurück springe, aber es ist wirklich schwer, meine Eindrücke in eine geordnete Reihe zu fassen, da zu viel auf einmal in diesen wenigen Tagen auf mich eingestürmt ist – gab es unter den Leuten auf der Brücke keine Prügelei. Sie prügeln sich selten, auch nicht solche niederen Standes. Es kann natürlich sein, daß sie sich in der Öffentlichkeit nicht prügeln und solche Tätigkeit in ihren Häusern betreiben. Ich kann mich noch viel zu wenig in der hiesigen Sprache ausdrücken, um Herrn Shi-shmi danach zu fragen. Sie prügeln sich nicht, aber sie brüllen. Sie brüllen immer, alle. Es hat nichts zu bedeuten. Freilich, man muß ihnen zugute halten, daß sie bei dem Lärm, der ständig hier herrscht, gar nicht in normaler Lautstärke reden können. Da würde sie niemand verstehen. Kannst Du Dir ein Leben vorstellen, lieber Freund Dji-gu, das darin besteht, ständig den Tag und Nacht herrschenden Lärm zu überschreien? Du kannst es Dir nicht vorstellen. Die Zukunft, lieber Freund Dji-gu, ist ein Abgrund. Aber ich lebe noch.
Der Zeitpunkt ist gekommen, um diesen Brief an den Kontaktpunkt zu legen. Ich schließe deshalb für heute. Es umarmt seinen geliebten Dji-gu
sein Freund Kao-tai
[3] Altchinesische korrekte Bezeichnung dessen, was wir unter »Mandarin«, verstehen. Es gab in der Sung-Zeit, aus der Kao-tai stammt, zweimal neun Rangklassen; Kao-tai ist also hoher Beamter. »A4« ist cum grano salis vergleichbar mit einem Ministerialdirektor oder Staatssekretär.
Fünfter Brief
(Dienstag, 23. Juli)
Geliebter Freund Dji-gu.
Ich sitze wieder in einem Zimmer von Herrn Shi-shmis Haus, das kein eigentliches Haus ist, davon aber später. Drei Tage sind seit meinem letzten Brief vergangen. Vorerst werde ich bei Herrn Shi-shmi bleiben, den der Himmel segnen möge, er ist – obwohl er nicht so aussieht – ein Mensch. Ich verstehe mich von Tag zu Tag besser mit ihm. Er hat mir eins seiner Zimmer eingeräumt. In ihm fühle ich mich, obwohl es für unsere Begriffe so klein ist wie die Bude eines Bettlers, schon einigermaßen heimisch, vor allem deswegen, weil ich hier meine gewohnten Kleider trage, während ich draußen in einer dieser scheußlichen grauen Schlauch-Häute herumlaufen muß, die sie An-tsu nennen. Diese qualvolle An-tsu-Kleidung besteht aus einer komplizierten Vielfalt von Einzelteilen. Einige weiße Schläuche trägt man darunter, zwei schwarze Schläuche an den Füßen, dann kommt eine graue Hose, dann eine dünne Jacke mit unzähligen Knöpfen. Diese Dünn-Jacke (sie heißt – ich habe das aber möglicherweise nicht richtig verstanden – »Hem-hem«) stopft man in die Hose hinein. Der an sich schon unbequeme Kragen dieser dünnen Hem-hem-Jacke wird noch dadurch eingeengt, daß ein Streifen Stoffes, dessen Funktion nicht ohne weiteres klar ist, darum gebunden wird. Der Stoff-Streifen muß auf bestimmte Länge vorn herunterhängen. Viele Männer tragen solche Stoff-Streifen, ja, ich muß gestehen: nur an so einem Stoff-Streifen erkenne ich – vorerst –, daß es sich um einen Mann handelt, mit dem ich es zu tun habe, denn Weiber tragen solche Stoff-Streifen nicht. Es gibt solche Stoff-Streifen in verschiedenen Farben. Der, den Herr Shi-shmi mir gegeben hat, ist rot. Er selber trägt einen blauen. Das Binden des Stoff-Streifens ist eine ungeheuer komplizierte Sache. Ich beherrsche es noch nicht; Herr Shi-shmi muß mir immer helfen. Da ich keinerlei Funktion der Stoff-Streifen erkennen kann, nehme ich an, daß es sich um Rangabzeichen handelt. Ich hoffe, daß der rote Stoff-Streifen einigermaßen meiner Würde als Mandarin der vierthöchsten Rangklasse und Präfekt der Dichtergilde »Neunundzwanzig moosbewachsene Felswände« entspricht. Bezeichnet etwa der blaue Streifen, den Herr Shi-shmi sich umbindet, einen niedrigen Rang? Es verwirrt mich, daß ich die Rangordnung nicht kenne und somit mein Verhalten nicht richtig bemessen kann. In der Kenntnis der hiesigen Sprache bin ich noch nicht so weit vorgedrungen, daß ich so etwas Kompliziertes fragen könnte. Ich glaube zwar nicht, daß Herr Shi-shmi einen höheren Rang einnimmt als ich, und meine Verbeugungen erwidert er immer exakt in gleicher Weise, ich wüßte es aber doch gern. Ich hoffe, daß er nicht allzu tief unter mir steht.
Aber, so denke ich mir, er hat mir soviel geholfen, ist mir so nützlich: ja, ohne ihn wüßte ich nicht, was anfangen, daß ich ihn, selbst wenn er ein Hofbeamter der 18. Rangklasse wäre und schon das siebte und letzte Mal bei der Dichterprüfung der Akademie durchgefallen, hochachten und lieben würde. In der Situation, in der ich bin, neigt man zu der Meinung, daß Rang und Dichterprüfung nicht das wichtigste Kriterium für die Bewertung des Menschen sind.
Aber ich bin mit der Beschreibung der Kleidung, des An-tsu noch längst nicht am Ende. Über Hose, Dünn-Jacke und Rangstreifen zieht man eine dickere Jacke an. Die Füße steckt man in kleine, verschnürte Kästchen aus entsetzlich hartem Leder, in denen man kaum gehen kann. Über dem Ganzen trägt man hie und da – wenn es am Abend kühler wird, und das ist hier selbst im Sommer der Fall – eine etwas längere, ebenfalls graue Jacke, die wohl einen Mantel vorstellen soll. Hat man das alles an, kommt man sich vor wie ein Wickelkind und kann sich kaum bewegen. Die Hände in unserer gewohnten Weise in die Ärmel zu stecken ist völlig ausgeschlossen. Die Leute stecken hier die Hände in die Taschen, die an der Kleidung an den überraschendsten Stellen in Vielzahl vorhanden sind. In noch größerer Zahl aber, in geradezu lächerlicher Menge finden sich Knöpfe am An-tsu. Eine Reihe kleiner Knöpfe befindet sich direkt am Geschlechtsteil. Ich nehme deshalb an, daß es sich hier um einen Fruchtbarkeitszauber handelt.
So laufe ich also draußen herum. Ich lasse es über mich ergehen, weil ich ja – der ich beobachten will – nicht ständig Gegenstand allseitigen Bestaunens sein mag. Ich falle auch in dem An-tsu noch genügend auf.
Bevor ich aber nun in der Schilderung der Erlebnisse meines ersten Tages hier fortfahre, habe ich Dir für Deinen liebenswürdigen, wenngleich kurzen Brief zu danken. Ich fand ihn wohlbehalten am Kontaktpunkt. Das angekündigte Silberschiffchen war allerdings nicht eingeschlossen. Nur unser spezielles Zeitwander-Papier vermag offenbar die tausend Jahre zu durcheilen. Laß also das mit dem Silberschiffchen in Zukunft … (merkwürdig: wenn ich so weit in die Vergangenheit zurück von »Zukunft« schreibe) … ich brauche es auch gar nicht. Ich habe erst eines der fünfzig, die ich bei mir habe, ausgegeben. Herr Shi-shmi hat es in hier gültige Währung umgetauscht. (Ich vertraue ihm da völlig.) Er hat dafür einen An-tsu und einen Haufen anderer Sachen für mich gekauft und angedeutet – wenn ich seine Gesten richtig verstehe –, daß noch viel Geld übriggeblieben ist. Was ich in absehbarer Zeit brauche, ist Zeitwander-Papier, denn meine Briefe an Dich sind doch ziemlich lang, und mein Vorrat geht zur Neige. Schicke mir also das nächste Mal ein Paket leeres Papier mit.
Im Übrigen freut es mich, daß meine herzige Shiao-shiao wohlauf ist. Daß sie Sehnsucht nach mir hat, schmeichelt mir. Ich habe auch Sehnsucht nach ihr. Ich hätte sie gern auf meine Zeit-Reise mitgenommen; aber es ist besser so. Die Welt »hier« wäre nichts für ihre empfindliche Seele. –
Aber nun fahre ich fort in meinem Bericht: ich wachte in meiner Gefängniszelle davon auf, daß ein mürrischer, aber nicht bösartiger Schließer die Tür öffnete und mir das Frühstück auf einem nahezu schon grotesk kunstlosen Tablett brachte. Nachdem ich ein wenig von einer dunkelbraunen Masse, die offenbar aus schlecht gebackenem und äußerst salzhaltigem Teig bestand, gegessen hatte (die beigegebene Flüssigkeit, die sehr heiß war und mehr als fremdartig roch, rührte ich zur Vorsicht nicht an), kam der Schließer wieder. Er winkte mit dem Schlüsselbund. Ich ordnete meine Kleider und folgte ihm. Er führte mich durch lange, lärmreiche und schmutzige Gänge, in denen der ranzige Geruch unsereinem längeren Aufenthalt unmöglich gemacht hätte. Den Leuten hier macht aber der Gestank nichts aus. Auch das wäre ein Kapitel für einen eigenen Brief. Selbst Herr Shi-shmi hat offenbar von der Erfindung der Räucherstäbchen noch nie etwas gehört.
Man führte mich in ein etwas größeres Zimmer. Dort saß ein Mensch, ja, ein Mensch, obwohl auch er das Antlitz – wenn man so sagen kann – der hiesigen Riesenkrebse trug. Seine Augen waren anders als die der sonstigen Riesen. Ich vermutete sofort – und wohl richtig –, daß es sich bei ihm um einen höheren Mandarin und Richter handelte. Zunächst schien auch er ratlos über meine Erscheinung zu sein. Ich kann mir nicht helfen: wenn zu uns, ich meine in unsere Zeit, in die Regierungszeit unseres Glorwürdigen Und Gnädigen Kaisers Und Sohnes Des Himmels ein Mann aus – sagen wir – der Regierungszeit der Dynastie Shang[6] käme, so erschiene uns dieser Mensch nicht fremder und eigenartiger als ein Gast etwa aus den fernen westlichen Provinzen, wo sie ja auch eine etwas unterschiedliche Sprache und merkwürdige Sitten haben. Hier aber bin ich so fremd wie ein seltenes Tier – nein: wie ein eigenartiger Stein. Wir kennen die Kaiser und die Dichter unserer fernsten Vergangenheit. Die heute hier wissen von uns nichts. Mir scheint, sie kennen sie nicht nur nicht, sie wissen gar nicht, daß sie eine Vergangenheit haben. Ich begreife nicht, wie sich in den tausend Jahren so ein verheerender Spalt zwischen unseren Enkeln und uns, ihren Ahnen, auftun konnte. Aber vielleicht sind die Leute wirklich fremder Rasse – Eindringlinge, Eroberer, die unsere Nachkommen verdrängt haben und vernichtet. Oder sollten wir uns bei unseren Reisevorbereitungen verrechnet haben? Bin ich statt tausend Jahre zehntausend Jahre in die Zukunft gereist? Das würde manches erklären.
Ob die Leute ohne Vergangenheit glücklicher oder unglücklicher sind als wir, muß ich erst herausfinden. Freilich kann das Wissen um die Vergangenheit auch wie eine Last sein. Ich kann nur nicht begreifen, daß es eine Rasse geben soll, die einfach in den Tag hineinlebt, ohne sich der Namen ihrer Ahnen bewußt zu sein.
Der Richter oder Hofbeamte, dem ich also vorgeführt wurde, versuchte auch, sich mit mir zu verständigen, natürlich vergeblich. Ich deutete ein paar Mal auf mich – unter einer Drei-Achtel-Verbeugung, ich schätzte den Hofbeamten auf einen Kwan höchstens vom Rang B3 – und sagte: »Kao-tai.« Ganz langsam und deutlich: »Kao-tai.« Er verstand, lächelte und schrieb meinen Namen auf ein Papier, das vor ihm lag. (Sie schreiben in gänzlich unverständlicher Schrift, lächerlicherweise in waagerechten Zeilen von links nach rechts.) Danach ließ er mich zu meiner grenzenlosen Enttäuschung wieder zurück in die Zelle führen. Bis dahin überwog in meinen Gefühlen trotz allem die Neugier. Als aber der Schließer die Zellentür auf ein neues hinter mir schloß, erfaßte mich die Verzweiflung. Wohl nie war ein Mensch so allein wie ich. Tausend Jahre weit aus meiner Welt hinausgestoßen, hilflos in einem Chaos von Unverstand. Würde ich je den Kontaktpunkt wiederfinden? Nein, sicher nicht ohne fremde Hilfe. Ich wußte nicht einmal, wie weit ich mit dem A-tao-Wagen verbracht wurde … Wer sagte mir, daß es nicht tausend Li waren? Ich war ja bewußtlos auf der Fahrt. Der Kontaktpunkt, der einzige Zusammenhang mit meiner Zeit-Heimat, schien mir damals im Gefängnis für immer verloren. Gut, es sind noch acht Monate Zeit – aber wie soll ich selbst in acht Monaten jemals in diesem Chaos, von aller Hilfe abgeschnitten, in einer Lärmwelt von Riesenkrebsen und Großnasen, in einer Welt, die mich nicht versteht, jene kleine Brücke wiederfinden? Ich war verzweifelt. Ich sah mich schon – selbst wenn ich aus dem Gefängnis entlassen würde – durch diese unordentliche Welt irren und vergeblich die Brücke suchen … und den Zeitpunkt der Rückkehr versäumen … und ich wäre ausgestoßen in diese Nebelwelt, endgültig und unwiederbringlich abgeschnitten von meiner Heimat, und alle, Du, meine Kinder, meine geliebte Shiao-shiao … tot seit tausend Jahren und – entschuldige – verwest und sogar ihr Andenken verweht.
Ich saß völlig verstört und wie auf einer geländerlosen Brücke über einem Abgrund in meiner Zelle und dachte an die Verse unseres großen Lin Tsung-yüan – den sie hier gewiß auch nicht mehr kennen:
»Wenn du nach Norden ziehst,
Frühling, wann kommst du nach Tsin?
Nimm meinen Traum dorthin.
Trag in den alten Garten
Den Traum, daß ich zu Hause bin.«
Aber was hält das Menschenherz nicht alles aus. Ich schlief zwei Stunden oder wohl auch drei, dann öffnete sich die Zellentür, und herein trat zu meiner Überraschung jener Richter und Mandarin, in dem ich halbwegs einen Menschen zu erkennen glaubte. Er hatte meinen Namen behalten und sagte: »Hel Kao-tai!« Die Vorsilbe »Hel« ist hier eine Anrede in höflicher Form. Ich machte deshalb wieder eine Drei-Achtel-Verbeugung und sagte: »O du gütiger, vom Himmel gesandter Hel-Richter und Mandarin, ich unwürdiger Staubwurm danke dir für deine freundliche Anrede. Der Himmel möge deine Ahnen segnen, unter denen möglicherweise ich selber bin.« Er verstand das natürlich nicht, ahnte aber vielleicht den Sinn meiner Rede und klopfte mir mit der Hand dreimal leicht auf die Schulter. Vermutlich war das eine Reinigungszeremonie. Ich verbeugte mich, und er deutete mit der Hand auf die offene Zellentür. Ich verstand, daß ich frei war.
Soweit der Brief für heute. Meine eigentlichen Abenteuer, das spüre ich, beginnen erst. Herr Shi-shmi steht neben mir, seit ich eben das Gedicht geschrieben habe, und wartet. Er weiß, daß ich heute wieder einen Brief zum Kontaktpunkt bringen will. Herr Shi-shmi ist sehr rücksichtsvoll, und ich glaube, er ahnt von der Bewandtnis, die es mit mir hat.
Bis jetzt bin ich noch nie allein ausgegangen. Herr Shi-shmi hat mich stets begleitet, denn ich habe immer noch Angst vor den A-tao-Wagen, und dann sind es doch drei Li von hier zur Brücke. Aber verirren könnte ich mich nicht mehr. Um meine Rückkehr bange ich nicht.
Ich grüße Dich, überaus liebenswerter Dji-gu; und schreib mir bald einen etwas längeren Brief.
Kao-tai
[6] Dynastie Shang, auch Yin genannt: ca. 1700–1066 v. Chr.
Sechster Brief
(Sonntag, 28. Juli)
Liebster Freund.
Ich bedaure überhaupt nicht mehr, daß ich diese Reise unternommen habe, obwohl ich mich nach wie vor nach den Gesprächen mit Dir in abendlicher Dämmerung in Deinem oder in meinem Park und nach den unbeschreiblichen Liebkosungen meiner einzigen Shiao-shiao sehne. Für Deinen sehr bündigen und in seiner Prägnanz äußerst kunstvoll zu nennenden Brief danke ich Dir von Herzen; dennoch hätte ich auch gern gewußt, ob meine schwangere Konkubine Fa-fo ihr Kind inzwischen bekommen hat, ob das schwarze Fohlen wieder gesund ist und ob meine Vierte Schwiegermutter Ta-chiang noch lebt, die am Tag vor meiner Abreise sterbenskrank geworden ist. Hat meine Hauptfrau noch ihr Furunkel? Auch schreibst Du nur sehr wenig von Shiao-shiao … aber immerhin weiß ich aus Deinem Brief, daß es ihr gutgeht.
Ich bedaure meine Zeit-Reise nicht mehr. Ich bin sogar fast geneigt – entgegen meinen trüben Gedanken in den ersten Tagen – zu sagen: es ist herrlich. Ich genieße eine neue Jugend. Was ein junger Mensch im Lauf von zwanzig Jahren erlebt, nämlich das Entfalten der Welt vor ihm, eröffnet sich hier für mich in ungleich kürzerer Frist, und dazu noch bei wachem Verstand, der nichts als eine Selbstverständlichkeit hinnimmt. Ich schaue wie ein Kind und staune, aber ich weiß, daß ich staune. Es ist herrlich … und das, obwohl es schon seit vorgestern regnet. Herr Shi-shmi und ich standen heute früh am Fenster und schauten hinaus. Herr Shi-shmi ist ganz trübsinnig. Er sagte: »Shai-we-ta«, was offenbar soviel wie »langandauernder Regen« bedeutet.
Für unsere dumpfen Enkel – mit Ausnahme von gebildeten und sensiblen Leuten wie Herrn Shi-shmi – ist das »Shai-we-ta« kaum bedrückend. Sie spannen ihre Schirme auf und rennen im Regen herum. Die A-tao-Wagen, in die es natürlich nicht hineinregnet, weil sie ja rundum aus Eisen sind, rasen wie immer und spritzen Wasserfontänen um sich, wenn sie durch eine Pfütze fahren. Niemand tut etwas dagegen – es sind wohl doch die Mächtigen, die sich in solchen A-tao fortbewegen. Der Schirm scheint die einzige unserer Errungenschaften zu sein, die auf unsere Enkel gekommen ist. An den Schirmen erkennt man mühelos Männer und Weiber auseinander, die Weiber tragen nämlich verschiedenfarbige Schirme, die Männer ausschließlich schwarze. Warum das so ist, weiß ich natürlich nicht, ebensowenig ob die Farben der Weiberschirme irgendwelche Rangstufen anzeigen. Trägt eine Frau oder Konkubine den Schirm in der Farbe des Stoff-Streifens (der, das habe ich inzwischen herausgebracht, »Kwei-te« heißt) des Mannes, dem sie gehört? Herr Shi-shmi hat selbstverständlich einen schwarzen Schirm, eine Frau hat er nicht.
Heute vormittags ging ich zum ersten Mal allein aus dem Haus. Herr Shi-shmi meinte (wir können uns jetzt schon recht gut verständigen), daß es an der Zeit sei, damit anzufangen. Er schickte mich in ein anderes Haus, in dem eine Person einen Laden betreibt. (Ich glaube, es handelt sich bei ihr um ein Weib; da ich sie aber nicht mit Schirm gesehen habe, bin ich allerdings nicht sicher.) Wie immer mußte mir Herr Shi-shmi helfen, meinen An-tsu anzuziehen, denn ich verwechsle doch noch die Reihenfolge der einzelnen Bestandteile. Einmal, als ich versuchte, mich allein anzuziehen, zog ich das »Hem-hem« über der Mitteljacke und die schwarzen, dehnbaren Fußschläuche über den verschnürbaren Lederkästchen an. Als Herr Shi-shmi mich so sah, hielt er sich vor Lachen den Bauch. Nun, ich muß eben alles lernen wie ein Kind.
Ich zog also heute vormittags unter Herrn Shi-shmis Aufsicht meinen An-tsu an, nahm meinen Schirm, denn ich habe auch schon einen, schwarz, logischerweise, und verließ das Haus. Den Laden und das Haus, in dem er ist, kannte ich schon, denn wir kommen immer dort vorbei, wenn wir zum Kontaktpunkt gehen. Ich mußte nur eine einzige Stein-Straße überqueren. Ich wartete am Rand der Straße, spähte und lauschte, bis ich sicher war, daß wirklich keins der verfluchten A-tao käme, dann rannte ich los. So kam ich glücklich drüben an, ging in den Laden und sagte mein Sprüchlein, das Herr Shi-shmi mir eingetrichtert hatte. Auf chinesisch bedeutete das Sprüchlein: »Einen halben sheng Öl, bitte.« (»Li-ti« heißt ein halber sheng). Die Formulierung ist doch außerordentlich knapp (fast wie Deine Briefe) und unhöflich. Du und ich hätten natürlich in dem Laden gesagt: »Würdest du, unvergleichliche Ladenbesitzerin, Sonne des Stadtviertels, die Güte haben, einen halben sheng deines honigduftenden Öls mir unwürdigem Zwerg herabzureichen, sofern du nicht eine andere, bessere Verwendung dafür hast, und das Maß deiner Güte vollmachen, indem du diese bescheidene, schmutzige Münze dafür entgegennimmst, die natürlich nicht das entfernteste Äquivalent für deine unbezahlbare Ware ist, zumal ein so gänzlich unbedeutender Mann wie ich es wagt, diese kühne Bitte zu äußern.« Aber so einen Satz in der hiesigen Sprache hätte ich natürlich nicht behalten.
Ich brachte den mir eingetrichterten Satz recht gut heraus, die Person, die den Laden betreibt, gab mir auch tatsächlich einen halben sheng Öl, und ich legte die Münzen, die mir Herr Shi-shmi mitgegeben hatte, auf den Ladentisch. Ich war sehr stolz. Die Person im Laden starrte mich zwar an wie einen fremdartigen Käfer, aber das bin ich ja inzwischen gewohnt. Sie brüllte mir auch irgend etwas zu, was ich nicht verstand: wahrscheinlich einen Gruß. Ich verbeugte mich zu einem Siebtel. Als ich wieder heraustrat, kam die Person mit bis zur Ladentür und brüllte wieder etwas. Ich spannte meinen Schirm auf, deutete mit den Augen nach oben und sagte: »Shai-we-ta!« Es war ein glänzender Erfolg. Sie nickte und lachte. Offenbar hatte sie mich vollkommen verstanden.
Ich machte mich auf den Heimweg. Ich war sehr stolz auf meine Leistung und bewegte mich völlig frei und sicher unter all den Leuten auf der Fußgängerseitenstraße, fast als wäre ich einer von ihnen. Da plötzlich stieß ich einen Schrei aus und ließ fast meine Ölflasche fallen, denn ich sah das wohl absonderlichste Phänomen, das ich hier bisher zu Gesicht bekommen habe. Ich konnte es Herrn Shi-shmi nicht beschreiben – so komplizierte Dinge kann ich noch nicht ausdrücken –, weshalb ich nicht weiß, wie es heißt. Es scheint eine seltene, aber dennoch für die Leute hier nicht furchteinflößende Erscheinung zu sein. Es handelte sich um eine Person auf einem zweirädrigen Wagen. Die Räder waren aber nicht nebeneinander wie an einem Karren, sondern hintereinander angebracht. Auf dem hinteren Rad saß der Lenker, dennoch drehte es sich. Wie das genau war, konnte ich nicht erkennen. Nach menschlichem Ermessen hätte dieser Wagen oder Karren unverzüglich umfallen müssen, allein: er fiel nicht nur nicht um, er fuhr sogar, obwohl die Person auf dem Rad – ich bin geneigt, sie für einen Artisten zu halten – keineswegs stillsaß, sondern gefährlich strampelte. Der zweirädrige Wagen fuhr zwar längst nicht so schnell wie ein A-tao, aber schneller, als ein Mensch laufen kann. Ich schaute dem artistischen Gefährt lange nach. Dann kehrte ich in Herrn Shi-shmis Haus zurück. Er wartete unter der Tür, war also doch etwas besorgt um meine glückliche Rückkehr.
Aber nun fahre ich fort, Dir die weiteren Abenteuer meines zweiten Tages hier in dieser fremden Welt zu schildern.