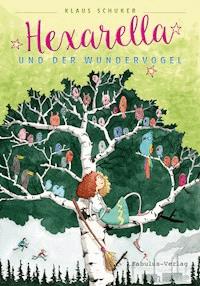Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
In einem Wald am Stadtrand von Ravensburg wird die Leiche des pensionierten Arztes Josef Klimnich entdeckt. Neben ihm liegt sein Pudel mit abgeschnittenen Läufen. Wenig später wird ein weiterer Mann ermordet aufgefunden. Auch seinem Hund wurden sämtliche Läufe abgetrennt. Die Polizei steht vor einem Rätsel und auch der ehemalige Kripobeamte Louis Astrella, der von Klimnichs Frau engagiert worden ist, kann sich keinen Reim auf die seltsamen Morde machen. Aber sein Instinkt sagt ihm, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Opfern geben muss. Astrella beginnt sich durch ein Gestrüpp aus Gewalt, Lügen und dunklen Geheimnissen zu kämpfen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Schuker
Brudernacht
Astrellas zweiter Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2007 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © www.photocase.com
ISBN 978-3-8392-3294-1
Widmung
Für
Ulrike Wörner,
Rosi Köberle
und Franz Gitschier
1
Das Baby schreit, schreit, schreit. Schrille Schreie, ohne Unterbrechung. Es scheint keine Pause zu benötigen, um Luft zu holen. Die Schreie sind ein einziger, durch Mark und Bein dringender Ton.
»Haben wir hier schon jemals so ein Kind gehabt?«, fragt Schwester Heidrun.
»Nein«, erwidert Schwester Kordula und schüttelt ihren Kopf mit den silbergrauen Haaren. »Bei Gott, nein!«
»Ich weiß mir bald nicht mehr zu helfen«, gesteht Schwester Heidrun und wirft einen Blick zum Fenster hinaus, wo die Linde steht, deren Blätter sanft im Wind schaukeln. Das Kind schreit weiter.
»Vielleicht ist es eine Prüfung?«, deutet Schwester Kordula zaghaft an. Jedoch ist ihr anzusehen, dass sie selbst an dieser Möglichkeit zweifelt. Eine Prüfung wofür?, denkt sie, behält es aber für sich.
»Ja, vielleicht ist es so«, murmelt Schwester Heidrun und denkt dabei an die Mutter des Kindes.
Das Baby gibt keine Ruhe. Das süße Köpfchen ist von der Anstrengung des Schreiens angeschwollen. Ein Schweißfilm bedeckt sein Gesicht. Die Äuglein sind nur einen klitzekleinen Spalt geöffnet.
»Wenn es nur nicht so laut wäre«, klagt Schwester Kordula. Trotz ihrer klaren und festen Stimme hört es sich verglichen mit dem Schreien wie ein Flüstern an. Das Kind hat sie völlig in seinen Bann gezogen. Sie alle hier im Heim.
»Hast du es schon gewickelt?«
»Wir müssen uns wieder um die anderen kümmern.«
Sie sagt es, dreht sich um und verlässt das Zimmer. Auch Schwester Heidrun wirft einen letzten Blick auf das Baby und geht dann ebenfalls hinaus. Das Baby schreit weiter. Die Tür dämpft dieses Schreien. Ein wenig.
Josef Klimnich blieb auf dem Gehweg in der Schubertstraße stehen und überlegte, ob er im Hirschgraben noch ein Weilchen den Boulespielern zusehen sollte, bevor er dann über die Weinbergstraße und die Friedrich-Schiller-Straße nach Hause ging. Viel länger als eine Dreiviertelstunde sollte er nicht unterwegs sein, sonst machte Berta sich Sorgen. Besonders seit er vor ein paar Monaten in der Jahnstraße von ein paar Jugendlichen belästigt worden war. Bestimmt würden wieder viele Menschen unterwegs sein. Vor allem junge Leute nutzten diesen malerischen Platz inmitten der alten Reichsstadt Ravensburg, um dort bei einem Bier oder einer Cola über Gott und die Welt zu diskutieren oder einfach den herrlichen Sommerabend zu genießen. Manche wiederum schauten ebenfalls den Boulespielern zu. Selbstverständlich würde er das fröhliche Treiben nur von oben, von der Straße aus beobachten. Sich unter die Leute in dem tiefen Graben mit dem doppelten Mauerring zu begeben, getraute er sich nicht. Zumal es leider auch ein paar unangenehme Zeitgenossen gab, die ihre Hunde mithatten und die Vierbeiner frei umherlaufen ließen.
Klimnich spazierte gern diesen Weg entlang, auch wenn er dafür den Umweg über die Schubertstraße in Kauf nehmen musste. Berta hatte ihm nach dem Vorfall mit ernster Stimme verboten, jemals wieder allein durch die Jahnstraße zu gehen. Dabei hatte sie ihm einen Blick aus ihren wunderschönen grünblauen Augen geschenkt, in dem er nur zu deutlich ihre Angst erkannte, ihm könnte etwas zustoßen. Andererseits bestand sie darauf, dass er diese Spaziergänge unternahm. Als Arzt war das anders gewesen. Da war er abends nur noch froh gewesen, dem alltäglichen Trubel entkommen zu sein. Hätte ihm Berta nicht den Pudel zu seinem 65. Geburtstag geschenkt, würde er sich jetzt wahrscheinlich in seinem Häuschen vergraben.
Fips, wie üblich etwa zwanzig Schritte voraus, beschnupperte soeben einen kleinen Mauervorsprung an einer der zahlreichen Laderampen. Das Gewerbegebiet Schubertstraße lag parallel zu den Bahngleisen der Strecke von Friedrichshafen nach Ulm. Der Pudel kümmerte sich nur insofern um Klimnichs Entscheidungsschwierigkeiten, als er kurz nach hinten blickte, um sich dann weiter seinem Revier zu widmen. Er ließ sich dabei auch von einem vorbeifahrenden Auto nicht stören, dessen Lichtkegel ihn für Sekundenbruchteile der Nacht entriss.
Klimnich erinnerte sich bei diesem Anblick daran, wie er Berta eines unvernünftigen, kindlichen Gemütes bezichtigt hatte, als sie ihm das kleine schwarze Knäuel überreichte. Auf seine Frage, wer denn künftig mit dem Pudel Gassi gehen würde, hatte sie mit einem verschmitzten Lächeln geantwortet: »Du!« Trotz seiner heftigen Proteste hatte er sich nach kurzer Zeit an den neuen Begleiter gewöhnt. Zumal der sich rasch als ein überaus ungeduldiges und nachdrücklich auf seine Gassirunden bestehendes Bürschchen entpuppt hatte. Die zungenfeuchte Dankbarkeit samt seiner verständnisvollen Augen war mehr als nur eine Entschädigung für diese auffallenden Charaktereigenschaften. Klimnich konnte sich seinen Lebensabend ohne den kleinen Vierbeiner inzwischen nicht mehr vorstellen. Das hing freilich auch damit zusammen, dass Berta, früher eine robuste Frau, in den letzten Jahren gesundheitlich stark abgebaut hatte. Insbesondere die Füße machten ihr zu schaffen. Kein Wunder, dass er sie deshalb nur noch selten zu einem Spaziergang überreden konnte. Brach die Dunkelheit herein, war das sowieso kein Thema mehr für sie, nachdem ihr vor acht Jahren ein nie gefasster Jugendlicher in der Herrenstraße, genau gegenüber der Liebfrauenkirche, beim Aussteigen aus dem Auto die Handtasche entrissen hatte. Er selbst, damals immerhin auch schon 64, hatte nur danebengestanden und hilflos mit ansehen müssen, wie der Verbrecher im Feierabendgewimmel verschwunden war.
Wieder erfasste der Lichtkegel eines Autos das Herrchen und den kleinen Hund, der inzwischen doch einige Schritte zurückgetrippelt war. Kaum hatte Klimnich beschlossen, sich zu den Boulespielern zu gesellen, und war zwischen den parkenden Autos auf die Straße getreten, schreckte er wieder zurück. Ein Motorradfahrer drehte kurz vor ihm auf und raste mit heulendem Motor vorbei. Beinahe noch mehr als dieser Rowdy erschreckte den älteren Mann die Tatsache, dass er ihn nicht früher wahrgenommen hatte. War er so in Gedanken versunken gewesen? Oder hatte etwa sein Gehör nachgelassen? Eventuell hatte sich der Motorradfahrer aber auch einfach nur einen Spaß erlaubt und war bewusst leise an ihn herangefahren, um ihm dann im geeigneten Moment auf diese einfältige und zugleich gefährliche Weise Angst einzujagen. Im selben Augenblick fiel ihm ein, dass der Fahrer kein Licht eingeschaltet hatte. Klimnich schaute in seine Richtung, konnte jedoch trotz der mondhellen Nacht nur das einmalige Aufflackern eines Bremslichtes an der Maschine erkennen. Das Motorrad verschwand in Richtung Pfannenstiel.
Mit einem Mal hatte er keine Lust mehr auf den Hirschgraben. Der Weg dorthin führte über den Pfannenstiel. Mit diesem Rowdy wollte er nicht noch einmal zusammentreffen. Er würde wohl besser umkehren und einen anderen Weg nehmen. Eine junge Frau näherte sich und sprach ihn an: »Ist alles in Ordnung?«
»Hm… ja«, zögerte Klimnich mit einer Antwort. Er wusste nicht so recht, was die Frau mit ihrer Frage meinte.
»Ich bin gerade im Auto an Ihnen vorbeigefahren und habe im Rückspiegel alles beobachtet. Ich meine, wie der Idiot Sie beinahe über den Haufen gefahren hätte. Ich habe sofort gedacht, dass ich umdrehen und nach Ihnen sehen muss. – Übrigens: Ich bin die Konstanze. Aber sagen sie einfach Conny zu mir.«
Klimnich folgte mit den Augen ihrer Handbewegung. Sie zeigte auf ein Auto, das zwischen zwei Straßenlaternen am Straßenrand geparkt war; er hatte es bisher nicht bemerkt.
»Ach, das meinen Sie! Jaja, es ist alles in Ordnung. Ich bin nur erschrocken, weil ich den Motorradfahrer vorher gar nicht gesehen hatte. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung, danke.«
»Und ich habe mich noch gewundert, dass er ständig das Licht ein- und ausgeschaltet hat, als er mir entgegenkam. Wahrscheinlich ist er betrunken.«
»Vermutlich haben Sie recht«, stimmte Klimnich ihr zu. Nach dem Schrecken tat es gut, mit jemand ein paar Worte wechseln zu können. Konstanze, er schätzte sie auf 20 bis 25 Jahre, trug Jeans und ein enganliegendes weißes T-Shirt, das deutlich zeigte, dass sie keinen Büstenhalter trug. Mit ihren schulterlangen blonden Haaren und dem kessen Zug um den Mund sah sie ausgesprochen hübsch aus.
»Kann ich Sie irgendwohin bringen?«
»Nein, nein«, wehrte der alte Mann das Angebot ab. »Das ist nicht nötig, Fräulein Konstanze. Außerdem habe ich ja noch meinen Hund dabei.«
»Ach, der ist ja süß!« Sofort ging Conny in die Knie und begann den Pudel zu kraulen, der sich das gerne gefallen ließ. »So einen süßen Kerl habe ich mir immer gewünscht. Kann ich ihn mal auf den Arm nehmen oder beißt er dann?«
»Fips hat noch nie jemanden gebissen!«, erwiderte Klimnich mit einem stolzen Unterton in der Stimme.
»Das passt ja prima«, meinte Conny, Fips weiterhin das Fell kraulend, bevor sie ihn mit einem schnellen Griff hochhob. Das Tier begann in ihren Armen erst zu zappeln, um dann ein etwas hilflos klingendes Knurren von sich zu geben.
»Wie meinen Sie das?«
Die junge Frau setzte gerade zu einer Antwort an, als vom Pfannenstiel her der satte Klang eines Motorrads zu hören war. Lichter waren keine zu sehen. Aufgeregt blickte der alte Mann erst Conny an und dann Fips in ihren Armen; dieser zappelte stärker.
»Es sieht gerade so aus, als käme der Verrückte wieder zurück. Haben Sie ihn vorher beim Vorbeifahren etwa beschimpft?«
»Nein, nein, natürlich nicht!«, haspelte Klimnich.
»Jedenfalls ist es wahrscheinlich besser, wenn Sie doch bei mir einsteigen. Wer weiß, was der von Ihnen will, und ich glaube kaum, dass der sich von Ihrem Pudel abhalten lässt. Ich fahre Sie nach Hause, steigen Sie ein!«
»Nein, ja – ich weiß nicht – meinen Sie wirklich?«
Doch als Conny ihn am Ärmel zupfte und in Richtung Auto eilte, folgte er ihr. Wahrscheinlich hat sie ja recht, dachte er bei sich.
Zeitgleich mit Conny kam er am Auto an. Er hastete auf die Beifahrerseite, stieg ein und nahm den kleinen Vierbeiner entgegen, der indessen zu bellen angefangen hatte. Kaum waren die Türen zugeschlagen, die Sicherungsknöpfe nach unten gedrückt und Conny losgefahren, brauste der Motorradfahrer vorbei. Das Licht an seiner Maschine brannte jetzt.
Die beachtlichen Brüste der aufgetakelten Frau bebten, als der hinter ihr gehende Mann sie heftig gegen die Schulter nach vorne stieß. Sie prallte gegen den Rücken des kräftigen Polizisten, der mit wütendem Gesichtsausdruck vorneweg marschierte. Dieser drehte sich blitzschnell um und versetzte ihr eine schallende Ohrfeige.
»Ihr verfluchten Scheißkerle!«, heulte die Frau auf. Der andere Polizist packte den Mann mit einer Hand von hinten an seinem fettigen Kragen und mit der anderen an seinen strähnigen Haaren und drückte ihn so, mit dem Gesicht voraus, gegen die Wand des schmalen und engen Empfangsraumes.
»Hör endlich mit dem Schwachsinn auf, Hans«, fauchte er. »Sonst bekommst du echt Ärger mit mir!«
»Diese verdammte Hure!«, quetschte Hans unter seiner plattgedrückten Nase hervor. Er sah keinen Deut besser aus als die Wasserstoffblondine. Sein gesamter Hals- und Brustbereich war mit einem satten Rot getränkt, ohne dass eine blutende Wunde zu erkennen gewesen wäre.
»Wenn ich die erwische, mach’ ich sie kalt.«
»Das lässt du hübsch bleiben«, widersprach ihm Heinz Obst, 22-jähriger Streifenpolizist, ohne seinen Griff auch nur im geringsten zu lockern. »Immerhin ist die Schöne Judith deine Frau, also kannst du nicht so mit ihr umspringen.«
Jeder der in dem veralteten und kleinen Empfangsraum Anwesenden konnte den spöttischen Unterton in der Stimme von Obst heraushören. Neben Hans, der Schönen Judith und Obst waren das sein Kollege Manfred Eck, 44 Jahre alt, sowie ein vor sich hindösender Mann und eine alte Frau an seiner Seite. Neben diesem Empfangsraum gab es, durch eine Theke mit aufgesetzter Panzerglasscheibe getrennt, den eigentlichen Wachraum, wo der Wachhabende unter anderem den Funk und das Telefon bediente. An einem anderen Tisch saß ein weiterer Polizist.
Der Wachhabende, ein glatzköpfiger Oberlippenbartträger, erhob sich nun mit gleichgültigem Gesichtsausdruck und stakste die zwei Schritte zum Tresen. Auf diesem stand ein Namensschild: ›Kesselwang‹. Trotz seiner drahtigen Figur war nicht zu übersehen, dass er die fünfzig schon weit hinter sich gelassen hatte.
»Was war los, Manfred?«, fragte er Eck, der bereits zur Tür gegangen war, die zu den eigentlichen Diensträumen und dem Wachraum führte, sich nun aber nochmals umdrehte.
»Das Übliche«, antwortete Eck durch die Scheibe. »Du kennst ja diese zwei Heinis. Heute hat er wieder mal angefangen, weil sie ihm angeblich zu viel Ketchup auf seine Pommes geschüttet hatte. Und als der Zoff dann losging, hat sie ihn auch noch wie einen Pommes behandelt. Na, das Ergebnis siehst du ja selbst. Am besten …«
»Ich bin kein Pommes frites!«, unterbrach Hans ihn protestierend. Eck quittierte es mit einem schnellen Blick zu dem immer noch in derselben Stellung an die Wand gedrückten Mann.
Von dem Lärm aufgeschreckt, richtete sich der Mann auf, der bis dahin vor sich hingedöst hatte. Wobei er die ganze Zeit über in der Gefahr geschwebt hatte, mit seinem Oberkörper gegen die neben ihm sitzende alte Frau zu kippen. Während der Mann zweifellos ein Penner war, schien die Frau sich offenbar rasch zurechtgemacht haben, um hierherzukommen. Als Eck sie genauer anschaute, sah er, dass sie geweint haben musste. Und noch etwas wurde ihm klar: Er kannte diese Frau.
»Grüß Gott, Herr Eck. Kennen Sie mich noch?«
Eck überlegte krampfhaft. »Ja, ich kenne Sie. Nur fällt mir momentan beim besten Willen Ihr Name nicht ein.«
»Ich bin die Frau Berta Klimnich. Sie haben sich damals um mich und Josef gekümmert, als mir die Handtasche gestohlen wurde.«
»Ach ja, richtig. Das war bei der Liebfrauenkirche, wenn ich mich noch recht entsinne.«
»Ja, genau«, bestätigte Frau Klimnich und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Indes hatte sich die ›Schöne Judith‹ eine Zigarette angezündet und zog hastig daran. Doch als Eck sich ihr zuwandte und sie drohend anschaute, hörte sie sofort wieder damit auf. Mit einem gezischten Fluch versuchte sie ihre Selbstachtung zu wahren.
»Entschuldigung, Frau Klimnich, aber Sie sehen, dass hier einiges los ist. Kümmert man sich schon um Sie?«
Als Frau Klimnich daraufhin nickte, wandte Eck sich wieder seinem Kollegen hinter dem Tresen zu.
»Am besten ist es, wenn wir die beiden erst mal in die Ausnüchterung bringen. Den Schreibkram machen wir später, weil wir gleich wieder raus müssen. In der Altstadt schlägt eine Bande Jugendlicher Scheiben ein.«
»Ich weiß. Zwei Besatzungen sind bereits unterwegs.«
Gleich darauf drückte er einen Signalknopf auf dem mit Schaltern, Knöpfen und Telefonen bedeckten Tisch. Es dauerte nicht lange, bis zwei weitere uniformierte Polizisten auf den Plan traten. Ihren Gesichtern war deutlich anzusehen, dass sie der ›Schönen Judith‹ und ihrem Ehemann nicht zum ersten Mal begegneten. Sie nahmen die beiden in Empfang. Hans hatte sich inzwischen soweit beruhigt, dass Obst ihn loslassen konnte. Beleidigt rieb er seine Nase.
Obst und Eck wollten gerade gehen, als Kesselwang sie aufhielt.
»Ach, Manfred, ihr werdet nachher noch eine Personenbeschreibung über Funk durchbekommen. Diese Frau hier vermisst nämlich ihren Mann.«
»Ist in Ordnung. Bis dann!« Bevor er jedoch die Tür endgültig hinter sich zufallen ließ, wandte er sich kurz Frau Klimnich zu und sagte mit beruhigendem Ton in der Stimme: »Wir werden ihn bestimmt finden, Frau Klimnich.«
Einer der Polizisten geleitete Berta Klimnich in sein Büro. Trotz des offenstehenden Fensters stand Rauch in der Luft. Frau Klimnich musste unwillkürlich hüsteln.
»Ich weiß, ich sollte mit dem Rauchen aufhören«, räumte ihr Gegenüber ein, um dessen Lippen ein verständnisvolles Lächeln spielte.
»Ich bitte Sie, das macht doch nichts«, wehrte Frau Klimnich ab. »Ich bin es nur nicht mehr gewöhnt, seit Josef nicht mehr raucht.«
»Josef ist Ihr Mann, nicht wahr?«
»Ja, und seinetwegen bin ich«, Frau Klimnich konnte den Satz nicht mehr vollenden. Die Tränen liefen ihr über die Wangen, begleitet von heftigem Schluchzen. Der Beamte ließ ihr Zeit, griff nach seiner Zigarettenschachtel und nahm eine Zigarette heraus. Er wollte sie gerade anzünden, ließ es dann aber doch bleiben und legte Zigarette samt Schachtel in eine Schublade seines Schreibtisches. Den Aschenbecher stellte er auf die Fensterbank.
Nachdem Frau Klimnich sich wieder einigermaßen gefasst hatte, stellte er sich ihr als Hauptmeister Wügel vor. »Aber ich nehme stark an, dass Sie meinen Namen schon bald wieder vergessen haben. Denn bestimmt kommt Ihr Mann noch in der nächsten Stunde nach Hause und alles ist wieder gut. Glauben Sie mir.«
»Nein, nein«, stammelte Frau Klimnich, »das glaube ich nicht! Josef hat sich noch nie verspätet, wenn er mit Fips unterwegs war.«
»Fips?«
»Das ist unser Pudel. Ich habe ihn Josef zu seinem 65. Geburtstag geschenkt, damit er öfter an die frische Luft kommt.«
»Ah ja. Und warum glauben Sie, Frau Klimnich, dass den beiden etwas passiert ist?«
»Weil sie noch nicht nach Hause gekommen sind. Ich bin den ganzen Weg abgelaufen, den sie normalerweise gehen. Bestimmt …«
Ihre Stimme versagte.
»Na na, Frau Klimnich … – Sie dürfen jetzt nicht gleich an das Schlimmste denken. Damit helfen Sie den beiden überhaupt nicht. Gerade jetzt ist es wichtig, dass Sie ruhig bleiben und mir der Reihe nach alles erzählen, was uns weiterhelfen könnte. – Welchen Weg genau nehmen Ihr Mann und Fips denn gewöhnlich?«
»Josef geht stets von unserem Haus aus in die … in die – ach, wie heißt sie denn bloß, die Straße. Vor lauter Aufregung habe ich jetzt den Namen vergessen. Sie müssen entschuldigen.«
»Lassen Sie sich ruhig Zeit, Frau Klimnich. Sie meinen wahrscheinlich die Wilhelm-Hauff-Straße? Da wohnen Sie doch?«
»Jaja, natürlich, die Wilhelm-Hauff-Straße. Dass ich das vergessen konnte.«
»Macht überhaupt nichts. Erzählen Sie bitte weiter.«
»Von uns aus geht Josef immer über die Schubertstraße in den Hirschgraben und von da aus dann in einem großen Bogen wieder nach Hause zurück.«
»Und von diesem Weg weichen die beiden niemals ab?«
»Doch, schon. Früher ist er über die Jahnstraße in den Hirschgraben gegangen. Aber dort haben ihn vor ein paar Monaten mehrere Jugendliche belästigt, weshalb ich ihn gebeten habe, diese Straße zu meiden. Doch sonst geht Josef nie einen anderen Weg. Im Hirschgraben schaut er oft den Leuten beim Boulespielen zu. Und …«
»Na, sehen Sie, Frau Klimnich, da haben wir ja möglicherweise schon die Lösung. Wahrscheinlich ist er dort aufgehalten worden, hat einen Bekannten getroffen, sich unterhalten und die Zeit vergessen. Am besten wird sein, wenn wir …«
»Nein, nein, da kennen Sie meinen Josef schlecht. Der lässt sich nicht aufhalten. Nicht um diese Zeit, weil er nämlich genau weiß, dass ich sonst Angst habe und mir Sorgen mache.«
»Aber ganz ausschließen können wir das natürlich trotzdem nicht, Frau Klimnich. Immerhin ist gerade jetzt im Sommer im Hirschgraben doch recht viel los. – Eine andere Frage, Frau Klimnich …«
»Ja?«
»Wie lange sind Sie denn jetzt schon hier? Es ist bereits kurz vor zwei.«
»Genau um Mitternacht bin ich hereingekommen. Die Glocken haben geläutet, und außerdem habe ich ja ständig auf meine Uhr geschaut.«
»Das heißt also, dass Sie seit fast zwei Stunden nicht mehr zu Hause gewesen sind, stimmt das?«
»Ja.«
»Dann ist es jetzt wohl am besten, wenn Sie dort erst einmal anrufen. Denn wenn Ihr Mann inzwischen tatsächlich wieder heimgekehrt ist, macht er sich bestimmt Sorgen um Sie, meinen Sie nicht auch?«
»Ich glaube nicht, dass Josef zu Hause ist. Er …«
»Versuchen wir es doch einfach, einverstanden? Hier ist das Telefon.«
Der Beamte nahm den Apparat und stellte ihn vor Frau Klimnich auf den Schreibtisch. Sie brauchte zwei Anläufe, bis sie ihre Nummer gewählt hatte. Während es tutete, starrte sie mit sorgenvollem Blick auf Wügel, der bemüht war, zuversichtlich zu wirken. Die Sekunden dehnten sich. Als Frau Klimnich schon auflegen wollte, verhinderte er das mit einem energischen Handzeichen. »Vielleicht ist er ja eingeschlafen«, flüsterte er zu seiner eigenen Verwunderung.
Wenig später wurde das Tuten durch das Belegtzeichen abgelöst. Er forderte Frau Klimnich auf, nochmals anzurufen. Ihr Gesicht und ihre Augen drückten ihre ganze Hoffnungslosigkeit aus. Trotzdem kam sie seinem Wunsch nach. Das Ergebnis jedoch blieb dasselbe.
»Das macht nichts. Immerhin wissen wir jetzt sicher, dass er noch nicht zu Hause ist. Am besten wird sein, wenn ich jetzt meinen Kollegen die Personenbeschreibung Ihres Mannes durchgebe. Dann können die die ganze Strecke noch einmal abfahren. Ein Mann mit einem Pudel dürfte nicht einfach so vom Erdboden verschwinden. Also müssen Sie mir jetzt genau beschreiben, wie Ihr Mann aussieht und was er anhat. Außerdem brauche ich eine Beschreibung von Fips.«
Nachdem Wügel alles aufgeschrieben und, um Frau Klimnich zu beruhigen, alles die Suche Betreffende in ihrer Anwesenheit unternommen hatte, bat er sie, draußen zu warten. Sofort stand sie auf.
»Oder, Frau Klimnich – was noch besser ist: Ich lasse Sie nach Hause fahren und sobald wir Ihren Mann gefunden haben oder etwas über ihn erfahren, rufe ich Sie an.«
»Nein, nein, ich bleibe lieber hier und warte. Ich kann jetzt sowieso nicht schlafen.«
Er erklärte ihr zwar nochmals nachdrücklich, dies sei nicht notwendig. Doch als klar wurde, dass sie sich von ihrem Entschluss nicht mehr würde abbringen lassen, versprach er, ihr eine Tasse Kaffee zu besorgen.
Es dauerte über eine Stunde, bis er zurückkam. Bis dahin hatte die müde, trauernde Frau alle möglichen polizeilichen Aktivitäten erlebt. Von den jugendlichen Scheibenwerfern waren drei festgenommen worden, die zunächst noch heftig gegen ihre Festnahme protestierten, angesichts der zahlenmäßig überlegenen Polizisten jedoch bald kleinlaut geworden waren; ein Mann mit blutig geschlagener Nase beschuldigte einen Nebenbuhler dieser Tat; einmal stürmten auf einen Schlag vier Polizisten durch den Empfangsraum nach draußen, nachdem kurz vorher schrilles Alarmleuten zu hören gewesen war; eine junge Frau mit Tränen im verschlafenen Gesicht erstattete Anzeige gegen ihren mehrere Jahre älteren Freund, weil der sie während einer seiner häufigen Eifersuchtsszenen geschlagen hatte. All das lief wie ein Film mit schlechtem Bild und Tonstörungen vor ihr ab. Selbst Kesselwang hatte seinen Versuch, sie bei aller Hektik zwischendurch mit einem Gespräch ein wenig abzulenken, schnell wieder aufgegeben. Frau Klimnich schien sich nur auf den Moment vorzubereiten, wenn die Tür zu den Büros aufging und Wügel vor ihr stünde.
»Kommen Sie bitte, Frau Klimnich«, sagte er zu ihr. »Gehen wir noch einmal in mein Büro.«
Seine Stimme klang belegt.
Am nächsten Tag ließ Frau Klimnich enttäuscht und verzweifelt die Tageszeitung auf den Tisch sinken. Die ihren Mann betreffende Vermisstenmeldung war so klein und unauffällig, dass sie sich keinerlei Hilfe davon versprach. In normaler Schriftgröße waren nur die Buchstaben gemischt und anders zusammengesetzt worden, und das Ergebnis eine Information unter vielen, die kein Aufsehen erregen würde.
Am Abend des darauffolgenden Tages nahm Werner Theweleit vorsichtshalber die leichte Jacke vom Kleiderhaken. Man wusste ja nie so recht, ob das Wetter hielt. Brischa dauerte das viel zu lange; er bellte.
»Jaja, du Quälgeist«, sagte er schmunzelnd in Richtung Eingangstür, wo der Mischlingshund schwanzwedelnd wartete. »Ich komme ja schon.«
Er nahm die auf dem Garderobeschränkchen liegende Taschenlampe an sich und war schon fast an der Tür, als Ulrike im Flur auftauchte.
»Weißt du was? Ich gehe doch mit.«
»Echt? Prima«, freute sich Werner. »Ich geh’ zur Sankt Christina hoch.«
Nachdem Ulrike erst kurz nach neun von der Arbeit nach Hause gekommen war, müde und abgespannt, hatte sie nur noch den Wunsch gehabt, ihre Beine hochzulegen und alsbald ins Bett zu gehen.
Er wartete, bis sie sich ihre Schuhe angezogen hatte, dann schloss er die Tür auf. Brischa, der achtjährige Mischling aus dem Tierheim, jagte hinaus und bellte seine Freude auf die nächtliche Straße. Werner und Ulrike sahen sich an und lachten.
Draußen führte ihr Weg sie über die Saarlandstraße und den Langholzweg hoch an der großen Wiese vorbei, auf der früher das Eisstadion gestanden hatte. Diese rechts liegen lassend, wandten sie sich der steil ansteigenden Treppe zur St. Christina zu, von wo aus man einen wunderbaren Weitblick über das nächtliche Ravensburg hat.
»Wie war dein Tag?«, fragte Werner seine Frau. Sie arbeitete als pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Apotheke, während er Marketingleiter einer mittelständischen Firma war, die Sanitäreinrichtungen für Hotels herstellte.
»Ach, es ging«, sagte Ulrike, um dann doch in allen Einzelheiten von ihrem Arbeitstag zu erzählen. Unterdessen hatten sie den links abgehenden Wald- und Lehrpfad erreicht, der zum Flappachweiher führte. Hier war der Hund verschwunden. Sie blieben auf der Treppe und waren auf halber Höhe des Anstiegs, als sie wütendes Bellen aufhorchen ließ.
»Wir hätten ihn vielleicht doch an die Leine nehmen sollen«, meinte Ulrike.
»Ach, wo! Normalerweise geht er doch nie weg von uns, wenn wir den Wald erreicht haben.«
»Normalerweise. Vor lauter reden habe ich überhaupt nicht bemerkt, dass er verschwunden ist.«
»Ich auch nicht«, gestand Werner und rief nach Brischa. Es dauerte einige Zeit, bis der Hund endlich kam. Aber nicht etwa, um nun folgsam bei ihnen zu bleiben. Er bellte in einem fort, schien sich überhaupt nicht beruhigen zu können, machte kehrt und verschwand wieder aus ihrem Blickfeld. Weit weg konnte er jedoch nicht sein.
»Das muss da vorne sein«, sagte Werner, als sie den Lehrpfad erreicht hatten, und deutete auf ein Stück Unterholz, das vom Mondlicht nicht erreicht wurde. »Wahrscheinlich eine Katze oder so.«
»Glaub’ ich nicht. Dann wäre Brischa bestimmt nicht zu uns hergekommen.«
»Na, ich werde mal nachsehen. So, wie der dumme Kerl bellt, bleibt es mir ja sowieso nicht erspart.«
»Ich geh’ mit und warte auf dem Weg.«
Gleich darauf arbeitete sich Werner durch das an dieser Stelle dichte Unterholz. Erst jetzt war Brischa ruhig.
»Was ist los«, wollte seine Frau wissen.
»Mein Gott!« hörte sie Werner statt einer Antwort sagen. Und dann hörte sie abermals das Knacken der Äste, als ihr Mann zurückkam. Selbst im fahlen Mondlicht konnte sie sehen, dass er kreidebleich war.
»Was ist los, Werner? Red doch!«
»Da – da liegt eine Leiche.«
Der Leichenfundort war von den großen Scheinwerfern hell erleuchtet. Blaulicht beherrschte die nächtliche Szenerie. Trotz der vielen Menschen, die sich innerhalb des abgesperrten Bereichs aufhielten, ging alles seltsam ruhig zu. Entsprechend laut klangen hin und wieder erteilte Befehle oder Rufe, mit denen nach einem bestimmten Kollegen gesucht wurde. Jeder wusste, was er zu tun hatte.
Hauptkommissar Zillmann von der Kriminalin-spektion 1 war soeben eingetroffen. 38 Jahre alt, war er ein hagerer Mann mit bereits schütterem Haar. Aufmerksam hörte er zu, was der junge Kriminalobermeister Pedlasch ihm berichtete.
»… und als der Hund abermals in den Büschen verschwand, schaute der Mann nach und stieß auf die Leiche.«
»Wissen Sie schon, um wen es sich dabei handelt?«
»Ja. Es handelt sich um den Vermissten Josef Klimnich und seinen …«
»Ist das sicher?«, unterbrach Zillmann den Kollegen, weil er sofort daran dachte, wie oft die alte Dame bei seinen Kollegen vom Vermisstendezernat angerufen hatte.
»Ja, leider. Denn neben ihm liegt sein Pudel. Wahrscheinlich hat der Hund der Zeugen Theweleit auch seinetwegen so reagiert.«
»Der Pudel ist auch tot?«
»Ja, und nicht nur das …«
Zillmann hatte das Zögern in Pedlaschs Stimme herausgehört. »Sondern?«
»Dem Tier wurden sämtliche Läufe abgeschnitten.«
Zillmann schluckte.
»Also war es kein Unfall.«
»Nein.«
»Kann der Arzt schon etwas zur Todesursache bei Klimnich sagen?«
»Noch nichts Abschließendes«, mischte sich in diesem Moment ein knapp 50-jähriger Mann in ihre Unterhaltung ein. Über seine rechte Wange erstreckte sich eine mehrere Zentimeter lange Narbe. Doktor Will. Er bot Zillmann die Hand zum Gruß, den dieser erwiderte. Er und Doktor Will kannten sich bereits seit zehn Jahren. »Wie es aussieht, ist er erstickt.«
»Würgemale am Hals?«, fragte Zillmann.
»Nein, das nicht. Dafür aber mindestens zwei gebrochene Rippen.«
»Wie das?« Zillmann bemühte sich nicht, seine Überraschung zu verbergen.
»Nun, mir scheint, als hätte irgendjemand ihm den Brustkorb dermaßen zusammengepresst, dass ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Luft weggeblieben ist. Aber wie gesagt: Ich muss ihn mir erst noch genauer ansehen. Sie bekommen übermorgen meinen Bericht.«
»Morgen!«, widersprach Zillmann und lächelte dabei. Doktor Will sah ihn an, lächelte ebenfalls und verließ den Ort, ohne eine Antwort zu geben.
»Na«, wandte Zillmann sich wieder Pedlasch zu, der die ganze Zeit über schweigend danebengestanden hatte. »Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Die Nacht ist kurz und nicht zum Schlafen gedacht.«
Pedlasch hatte die Ironie in der letzten Bemerkung seines Vorgesetzten herausgehört und schmunzelte. Beide begaben sich auf dem markierten Weg zu der Stelle, an der die Leiche lag. Längst waren die ersten nummerierten Spurentafeln in den trockenen Waldboden gesteckt worden.
2
Zwei Tage später hatte sich an der Buchstabengröße nichts geändert, die nach einem neuerlichen Mischvorgang in einer neuen Zusammenstellung bekanntgab, dass der Vermisste samt seinem Hund tot aufgefunden und – den Erkenntnissen der Polizei nach – Opfer einer Gewalttat geworden sei. Die Zeilenzahl für Fips hatte sich dabei von zwei auf acht erhöht, was er dem Umstand zu verdanken hatte, dass ihm alle Läufe oberhalb der Kniegelenke abgeschnitten worden waren.
Obwohl Frau Klimnich zu diesem Zeitpunkt bereits durch die Polizei vom Tod ihres Mannes wusste, erreichte der Artikel für sie dennoch die Größe einer Plakatwand. Ein junges Ehepaar mit Hund hatte den bewegungslosen Körper des Mannes im Wald beim St. Christina-Hang entdeckt. Sie hatte Josef identifiziert, wobei sie sein schmerzverzerrtes Gesicht nicht mehr aus ihrem Kopf verbannen konnte. Das Angebot des sachbearbeitenden Kriminalbeamten, ihr den Anblick zu ersparen, hatte sie entschlossen abgelehnt. Die alte Frau weigerte sich weiterhin, seinen Tod anzunehmen. Sie rief wiederholt seinen Namen und las ein ums andere Mal den Artikel. Gerade so, als könnte sich die Zusammensetzung der Buchstaben verändern und als Ergebnis das Eingeständnis zu lesen sein, dass es sich bei der ganzen Sache um einen Irrtum handelte und Josef samt Fips längst wohlbehalten wieder zurückgekehrt seien. Doch ihre Hoffnung erfüllte sich nicht.
»Die Spurensicherung ist noch mal rausgegangen«, sagte Pedlasch zu Zillmann. »Ich habe gerade mit Wallner telefoniert.«
»Und, hat er was gefunden?«
»Ein paar Fasern im Unterholz. Aber die können natürlich auch von den Theweleits oder von anderen Spaziergängern stammen. Muss noch abgeklärt werden.«
Etwas Derartiges hatte Zillmann befürchtet; jedenfalls bedeutete es entsprechende zeitliche Verzögerungen. Er schob Doktor Wills Obduktionsbericht ein wenig beiseite.
»Braucht Wallner Unterstützung?«, wollte er wissen. Natürlich hätte er Wallner selbst anrufen und danach fragen können, doch er wollte den jungen und immer noch etwas unsicheren Pedlasch nicht unnötig in Verlegenheit bringen. Pedlasch gehörte erst seit einem halben Jahr zu ihnen und Zillmann sah ihn als durchaus fähig an, auch wenn er sicherlich nie die große Karriere machen würde. Doch jedes Dezernat konnte froh sein, solche Leute in den eigenen Reihen zu haben.
»Er meinte, dass ein Zug Bereitschaftspolizei nicht schaden würde. Weil zum einen ständig mehr Schaulustige auftauchen, und zum anderen könnten sie dann den Raum für die Spurensuche weiter ausdehnen.«
»Gut, ich werde mich darum kümmern. – Gibt’s sonst noch etwas?«
»Nein.«
»Dann erinnern Sie die anderen daran, dass wir uns um fünfzehn Uhr zur Lagebesprechung treffen.«
Nachdem Pedlasch gegangen war, lehnte Zillmann sich in seinem Stuhl zurück und überlegte. Doktor Wills Bericht nach war der Leichenfundort nicht der Tatort. Das hatte Zillmann nicht anders vermutet. Ihm war sofort aufgefallen, dass dafür einfach zu wenig Blut am Fundort vorhanden war. Wie auch, wo der Täter die abgeschnittenen Läufe des Pudels in einem einfachen und überall erhältlichen Müllbeutel verstaut hatte. Wäre der Fundort auch der Tatort gewesen, wäre dieses Verhalten ausgesprochen unsinnig, weil überflüssig. Außer der Täter wäre ein naturliebender Sauberkeitsfanatiker. Aber brachte so einer einen ungefährlichen kleinen Hund um? Und dann noch auf diese bestialische Weise?
Doktor Will hatte in seinem Bericht geschrieben, dass Klimnich an einem Ventilpneumothorax gestorben war. Da Zillmann mit der gewohnt nüchtern gehaltenen und mit Fachbegriffen gespickten Sprache nicht viel anfangen konnte, hatte er Will angerufen.
»Kurz gesagt: Das Opfer hat sich selbst erstickt.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, bei einem Ventilpneumothorax, ausgelöst durch einen Rippenbruch, gelangt Luft in den normalerweise kleinen Raum zwischen Rippenfell und Lungenfell. Diese Luft kann nicht mehr ausgeatmet werden, wodurch der Raum sich ständig vergrößert, also sich ausdehnt. Es dauert nicht lange, bis auch der zweite, noch intakte Lungenflügel zusammenfällt, was dann unweigerlich zum Tod führt. Das Unangenehme für das Opfer ist dabei, dass es mit jedem Atemzug mehr Luft in sich hineinpumpt, die nicht mehr entweichen kann. Das meine ich mit: Das Opfer hat sich selbst erstickt.«
Zillmann musste unwillkürlich schlucken.
»Sonst noch Fragen?«, wollte der Doktor ungerührt wissen.
»Aber ist nicht eine ziemlich große Kraftanstrengung nötig, um diesen Druck auszuüben?«
»Ja und nein. Das hängt von der Statur des Täters ab, von der verwendeten Technik und natürlich vom Zustand des Opfers. Die Technik ist den Feststellungen nach einigermaßen klar: Der Täter bindet dem Opfer ein entsprechend stabiles Seil um den Brustkorb, schiebt einen länglichen Gegenstand in die Schlinge und dreht daran wie an einem Lenkrad. Angesichts des hohen Alters des Opfers und seiner entsprechend bruchanfälligeren Knochen dauert es nicht lange und die Rippen brechen wie Strohhalme im Wind.«
»Aber es muss ein Mann gewesen sein? Ich meine, der Täter.«
»Muss nicht, kann. Auch eine einigermaßen kräftige Frau kann so etwas durchführen.«
»Und es gibt keine Kampfspuren? Ich meine, ob jung oder alt: So etwas lässt sich doch kein Mensch gefallen, ohne dass er sich wehrt.«
»Und wenn er sich nicht wehren konnte? Vielleicht, weil er überrascht worden ist und alles so schnell abgelaufen ist, dass es für eine Gegenwehr einfach zu spät war. Wir haben Fesselungsspuren gefunden. Mich würde es nicht wundern, wenn wir an den Hosen ebenfalls Faserspuren eines Seils oder Ähnlichem finden.«
»Ja, aber der Hund.«
»Na, sind Sie mal ehrlich: Würden Sie sich von so einem alten Pudel ins Bockshorn jagen lassen?«
Zillmann musste nicht lange überlegen. »Wahrscheinlich haben Sie recht.«
»Leider!«, erwiderte daraufhin Will. »Finden Sie den Täter. Denn sich selbst zu ersticken ist ein grausamer Tod.«
Danach hatten sie noch ein paar allgemeine Floskeln ausgetauscht.
Zillmann beugte sich nochmals über den Bericht. Was den Pudel betraf, schrieb Will, seien ihm die Läufe ziemlich sicher mit einer Schere abgeschnitten worden. Zumindest ließe sich das aufgrund der Hautverletzungen an den Schnittstellen sagen. Fips war verblutet. Warum in Gottes Namen tötete jemand einen Hund auf solch grausame Art und Weise?
Die hübsche junge Frau mit den schulterlangen blonden Haaren stellte den Motor ab, blieb sitzen und beobachtete das unauffällige mehrstöckige Wohnhaus. Um die Hitze in dem BMW ein wenig erträglicher zu gestalten, ließ sie auch das Bei-
fahrerfenster herunter. Das Surren des Elektroantriebs war nicht zu überhören, so still war es in der Straße. Vermutlich würde sich das ändern, wenn in einer halben Stunde der Feierabendverkehr einsetzte. Nein, hier bestimmt nicht, dachte sie bei dieser Vorstellung. In dieser Straße herrschte absolute ›tote Hose‹ und den Rest besorgte die Hitze. Ihr sollte es recht sein, sahen sie dann schon wenigstens nicht allzu viele Leute. Trotzdem fühlte sie unvermittelt leichte Unruhe in sich aufsteigen. Hastig sah sie sich um. Da war nichts. Als sie sich wieder umdrehte, sah sie, wie aus dem Wohnhaus eine junge Mutter mit einem Kinderwagen auf die Straße trat. Ohne sich umzuschauen, entfernte sie sich in die andere Richtung. Einen Moment lang dachte die Blondine darüber nach, ob sie selbst jemals Mutter sein würde. Doch sie kam nicht dazu, diesen Gedanken weiter zu vertiefen, denn abermals wurde die Haustür des Wohnhauses geöffnet. Ein alter Mann, der gleichwohl einen rüstigen Eindruck machte, trat heraus. Und der soll weit über siebzig sein?, dachte sie verwundert. Na ja, was soll’s? Den Alten sieht man heute nicht mehr an, wie alt sie sind, und den Jungen nicht, wie jung. An seiner Seite befand sich ein Terrier. Dieser schien ebenfalls bereits einige Jahre auf seinem Hundebuckel zu haben. Die Blondine machte sich eine kurze Notiz in ein kleines, schwarzledernes Büchlein. Dann stieg sie aus, schwang die Handtasche mit dem langen Riemen über ihre Schulter und begann dem Alten in gebührendem Abstand zu folgen. Wie sie so ging, wirkte sie wie eine junge Frau, die gedankenverloren auf dem Weg zu ihrer Wohnung war.
Frau Klimnich legte den Hörer auf. Sie war empört. Das würde sie sich nicht gefallen lassen, schließlich war ihr Josef ermordet worden und nicht sonst wer.
»Frau Klimnich, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber wir können momentan nicht mehr für Sie tun«, hatte ihr dieser Herr Zillmann von der Kriminalpolizei mit einem Ton erklärt, als sei sie schwer von Begriff.
»Wir haben auch noch andere Fälle zu bearbeiten, die ebenso wichtig sind. Die Welt ist leider schlecht und jeden Tag passiert etwas Neues, etwas Schreckliches. – Ich verspreche Ihnen, liebe Frau Klimnich, dass ich Sie als Erste verständigen werde, wenn wir etwas herausgefunden haben. Aber so lange möchte ich Sie bitten, uns nicht jeden Tag anzurufen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, nur haben Sie in den vergangenen zehn Tagen beinahe täglich angerufen. Wenn Sie so weitermachen, haben wir bald keine Zeit mehr für unsere Arbeit.«
Nein, so einfach würde sie es ihnen nicht machen. Und wenn die ganze Welt ermordet würde, wäre ihr das vollkommen gleichgültig, solange Josef bei ihr war. Niemand hatte das Recht, ihrem geliebten Mann das anzutun, was ihm angetan worden war. Niemand! Frau Klimnich wäre es lieber gewesen, die ganze Welt zusammen mit ihr wäre ermordet worden, nur nicht ihr Josef. Sie waren die glücklichsten Menschen der Welt gewesen, und nun hatte irgendjemand dieses Glück zerstört. Josef hatte nie einem Menschen wehgetan, im Gegenteil: Er hatte geholfen, wo er nur helfen konnte. Das war manchmal schwer gewesen, denn es gab auch Menschen, die sich nicht helfen lassen wollten. Und dann Fips. Wie konnte ein Mensch nur so gemein sein, einem Hund, einem kleinen, wehrlosen Hund die Beine abzuschneiden?
Frau Klimnich saß vor dem Telefon und weinte leise, wobei sie immer wieder aufschluchzte. Die Bilder der Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit ihrem Mann huschten nur so vor ihrem inneren Auge vorüber. Bis ein einzelnes Bild im Drahtgewirr ihres Schmerzes hängenblieb, fortwährend genauere Formen annahm und neue Kräfte in ihr freisetzte. Ja, das würde sie tun.
Entschlossen nahm sie den Hörer ab und wählte abermals die Nummer der Polizei. Das waren sie ihr schuldig.
3
Es verweigert die Nahrung und hat trotzdem die Kraft zu schreien. Immer noch liegt es allein im Zimmer. Der Tränenschleier vor seinen Augen verhindert, dass es viel sieht. Nur manchmal nimmt es den linken Daumen in den kleinen Mund. Dann dauert es nicht lange und ein riesengroßer dunkler Kreis taucht über ihm auf und gibt ruhige Laute von sich. Das Kind verharrt dann mit dem Nuckeln. Doch spätestens, wenn sich etwas Warmes, das zu diesem riesengroßen dunklen Kreis gehört, auf seine Stirn legt, nimmt es den Daumen wieder heraus. Und schreit. Das Warme zuckt dann zurück und es dauert nicht lange, bis der riesengroße dunkle Kreis verschwindet.
Nachdem es bereits zum dritten Mal an der Haustür geklingelt hatte, stand Louis Astrella endlich auf und öffnete.
»Guten Morgen «, begrüßte ihn der junge Postbote. An seinem verschwitzten Gesicht mit dem freudlosen Lächeln unter dem borstigen Schnauzer erkannte Astrella, dass der Junge es eilig hatte. Er reichte ihm zwei Briefe, einer davon in einem zartblauen Umschlag.
»Das da ist ein Einschreibebrief, für den ich eine Unterschrift brauche.«
Astrella unterschrieb den Beleg, bedankte sich bei dem Postler, der eilig grüßend und ein schönes Wochenende wünschend in die Hitze entschwand, und ging durch das sonnendurchflutete Wohnzimmer zurück in die geräumige Küche mit dem großen Esstisch. Aus einem Kofferradio drang Musik, hin und wieder unterbrochen von Informationen. Neben einer aufgeschlagenen Zeitung auf dem Esstisch stand seine azurblaue Kaffeetasse mit dem Sonnenblumenmuster, daneben ein weißer Teller mit einem angebissenen Wurstbrot.
Mit der rechten Hand fuhr er sich durch das dichte braune Haar. Die grauen Strähnen an den Schläfen waren nicht zu übersehen. Knapp einsneunzig groß, mit leichtem Bauchansatz, verstärkten sie den Eindruck der Seriosität, den er auf andere Menschen gemeinhin machte. Seine kastanienbraunen Augen erfassten den Absender des Einschreibebriefs, den er nun öffnete: Es handelte sich um eine geschäftliche Sache im Zusammenhang mit seiner Arbeit als Sicherheitsberater. Rasch überflog er den Inhalt, bevor er den zartblauen Umschlag des zweiten Briefes in die Hand nahm. Er stammte von seiner Tochter Sandra aus Italien. Astrella entnahm vier engbeschriebene Bögen seidigen Briefpapiers, lehnte sich nach hinten in seinen Stuhl und begann zu lesen.
»Hi Paps!
Gloria hat Dir sicher schon gesagt, dass ich in den Herbstferien nicht kommen kann. Obwohl ich mich natürlich darüber aufgeregt habe, hat sie wie gewohnt ihre eigenen Pläne. Aber Du weißt ja, wie sie ist. Manchmal frage ich mich echt, wie Ihr fünfzehn Jahre miteinander verheiratet sein konntet. Leider redet Gloria nicht viel darüber. Ich würde manchmal gerne mehr über dieses Thema erfahren, doch sie lenkt immer wieder davon ab. Vor allem jetzt, wo ich Valerio kennengelernt habe, vermisse ich jemanden, mit dem ich über solche Dinge sprechen kann. Dich vermisse ich ständig. Aber obwohl Gloria weiterhin nicht vorhat zu heiraten, glaube ich langsam nicht mehr daran, dass wir drei irgendwann wieder richtig zusammenkommen. Zwar wären einige Kandidaten für eine Hochzeit bereit, aber ich glaube, keiner wird so richtig schlau aus ihr. Früher, als Du noch bei der Polizei gearbeitet hast, hast Du oft genug von undurchsichtigen Fällen und Gestalten erzählt. Damals dachte ich, es sei eine Ausrede dafür, dass Du nicht mehr erzählen musst. Aber jetzt begreife ich von Tag zu Tag mehr, was mit ›undurchsichtig‹ gemeint war. Irgendwie ist Gloria nämlich auch undurchsichtig. Das hört sich jetzt zwar irgendwie nach Verbrechen und schlechten Absichten an, aber ich glaube, Du weißt, wie ich das meine. Da wäre zum Beispiel das Theater mit ihrem Vornamen. Wie Dir sicher schon aufgefallen ist, schreibe ich von ihr nur noch als Gloria und nicht mehr als Mutter. Sie möchte von mir nur noch mit Gloria angeredet werden, aber einen richtigen Grund konnte sie mir dafür bisher nicht nennen. Ich versuche jedenfalls, mir das MUTTER einfach abzugewöhnen. Manchmal ist das sehr schwer für mich, weil ich automatisch an Dich denke, wenn ich von Mutter rede oder schreibe.
Vielleicht will sie Dich auch auf diese Art aus ihrem Leben streichen. Natürlich erinnere ich sie ständig an Dich. Vor ein paar Tagen hat sie mich gefragt, warum ich Dich noch Paps nenne, obwohl Du gar nicht mehr bei uns bist. Als ob das etwas ändern könnte! Schließlich bist und bleibst Du mein Paps, egal was passiert.
Auch darüber, warum Du damals ins Gefängnis gehen mußtest, redet Mutter nicht mit mir. Jetzt habe ich wieder MUTTER geschrieben. Aber ich bin mir sicher: Du hast nichts Schlimmes getan. Ich habe Dir das ja schon oft geschrieben. Das mache ich aber nicht, um es mir einzureden, und ich erwarte auch nicht, dass Du es mir erklärst, obwohl ich mit meinen 16 Jahren kein kleines Kind mehr bin. Ich schreibe es nur, damit Du weißt, dass ich immer noch nicht daran zweifle. Möglicherweise erfahre ich mal mehr über die Sache. Aber ich verstehe auch, wenn das Zeit braucht. Die zwei Jahre seit der Entlassung sind schließlich keine lange Zeit. Und wahrscheinlich musst Du erst selbst genügend Abstand dazu gewinnen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob Gloria mit ihrem Vornamen angesprochen werden möchte, um sich selbst jünger zu fühlen. Gloria klingt einfach jünger als Mutter. Das denke ich auch deshalb, weil sie inzwischen ewig vor dem Spiegel steht und ihre Falten bekämpft, die eigentlich gar nicht da sind. Dabei ist sie mit ihren 37 Jahren noch lange nicht alt. Einen Vorteil hat das Ganze jedoch auch für mich: Ich kann von ihr jede Menge übers Schminken lernen. Ich weiß, Du siehst es nicht gerne, wenn ich mich schminke. Aber ich bin jung und warum sollte ich es nicht tun? Außerdem: Die Konkurrenz schläft nicht! Natürlich werde ich mich nicht schminken, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Denn obwohl mir Make-up viel Spaß macht, sind mir Deine Komplimente noch wichtiger. So liebe Komplimente macht mir bis jetzt nur Valerio. Denn Valerio kann das auch ziemlich gut, und ich glaube, er meint es auch ernst. Wir haben uns wirklich sehr lieb, obwohl er schon 24 ist. Doch auch das hat Vorteile; na, Du weißt schon! Außerdem bist Du ja auch 7 Jahre älter als Gloria. Habt ihr eigentlich meinetwegen geheiratet?