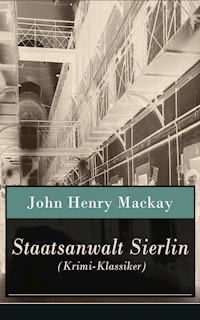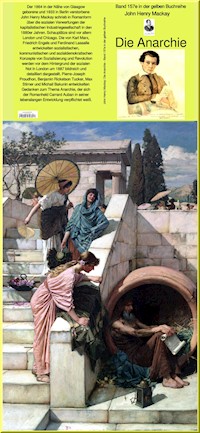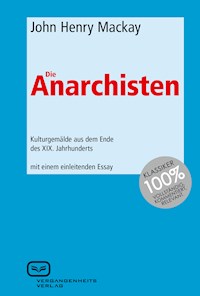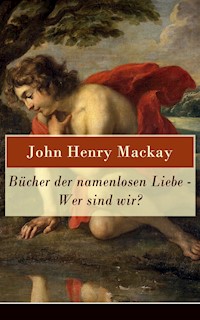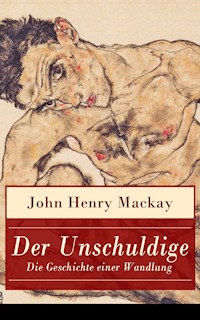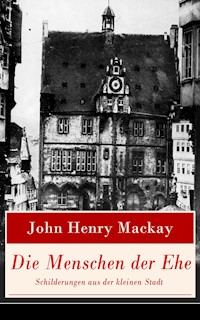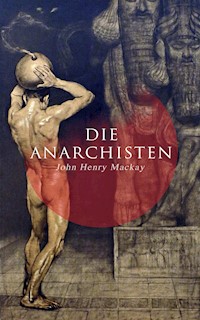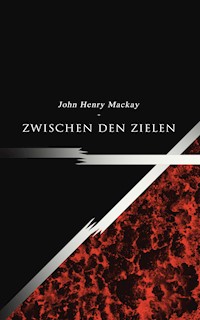Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Dieses eBook: "Büchern der Freiheit: Der Freiheitsucher + Die Anarchisten" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. John Henry Mackay (1864-1933) war ein deutscher Schriftsteller. Mackay präsentierte seine Konzeption des individualistischen Anarchismus in den "Büchern der Freiheit" (Die Anarchisten, Der Freiheitsucher). Inhaltlich stimmt sie weit besser mit dem in Nordamerika - in der Tradition von Thomas Jefferson, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau und anderen - entstandenen radikalen Liberalismus seines Freundes Benjamin R. Tucker überein. Aus dem Buch "Der Freiheitsucher": "Das Kind lernt Lesen und Schreiben: In seine Hand wird die erste Waffe gelegt für den Kampf mit dem Leben. Noch ist sie ungeschliffen, und die Hand des Kindes zu schwach, um sie zu führen. Am Erwachsenen wird es sein, sie brauchbar zu machen für seinen Kampf. Es kann lesen und schreiben: nun müssen sich ihm alle Pforten auftun, und, wenn es groß geworden sein wird, stehen ihm alle Weiten des Geistes offen, und er darf Zwiesprache halten mit den Großen und Erlauchtesten aller Zeiten, und alle müssen sie ihm ihr Bestes geben, wenn er es will ... In seine Hand ist die Waffe gelegt. Ob es sie aufnehmen, sie schärfen und schwingen wird - es liegt an ihm." Aus dem Buch "Die Anarchisten": "...Was ist Anarchie? - fragte er. Und antwortete: "Es ist ein Gesellschaftssystem, in welchem Keiner die Handlungen seines Nachbarn stört; wo Freiheit frei von Gesetz ist; wo Vorrecht nicht existiert; wo Gewalt nicht der Ordner menschlicher Handlungen ist. - Das Ideal ist das zweitausend Jahre früher von dem Nazarener verkündete: die allgemeine Brüderlichkeit der ganzen menschlichen Familie". - Und schmerzlich rief er immer wieder aus: "Rache ist die Lehre, gepredigt von der Kanzel, von der Presse, von allen Klassen der Gesellschaft! - Nein, Liebe! Liebe! Liebe! predigt! ..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 816
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Büchern der Freiheit: Die Anarchisten + Der Freiheitsucher
Eine Konzeption des individualistischen Anarchismus
Inhaltsverzeichnis
Der Freiheitsucher
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
NEBEN MEINE ANARCHISTEN STELLT SICH, ALS das zweite meiner beiden » BÜCHER DER FREIHEIT«, wie ich sie jetzt zusammenfassend nennen will, dieser FREIHEITSUCHER, ihre Ergänzung und ihr Abschluß.
Noch einmal ziehe ich in dieser Arbeit langer Jahre, die ebensowenig ein Werk der Kunst ist und als solches beurteilt sein will und darf, wie jene ein »Roman« waren, diesmal nicht in dem weiten Rahmen eines Kulturgemäldes, sondern in dem engeren eines einzelnen Lebens und seiner Entwickelung zur Freiheit, die letzten Konsequenzen der Forderung nach der Souveränität des Individuums gegenüber allen Versuchen zu seiner Beschränkung und Unterdrückung, und gegenüber seinem größten und gefährlichsten Feinde: dem Staat.
DIESER ARBEIT LANGER JAHRE. Neben das Gemälde einer Kultur am Ende des vorigen Jahrhunderts mit der Fülle seiner Erscheinungen und der Überfülle der Ereignisse, neben das Bild der Massen und ihrer Kämpfe um Gewalt und Freiheit das der psychologischen Entwickelung eines Einzelnen unserer Zeit zur Freiheit zu stellen – den weiten Rahmen zu verengern, um dieses Bild so vertiefen und einer Weltanschauung, der des individualistischen Anarchismus, geschlossene Form geben zu können, erwies sich als notwendig, und so wurde auch hier der »verbleibende Rest von Unzufriedenheit der Keim zu dem neuen Werke«.
Bücher, wie dieses, werden nicht geschrieben, sondern entstehen und brauchen ihre Zeit. Immer wieder unterbrochen, auf Jahre durch einen anderen Kampf, von dem hier zu sprechen verfrüht wäre; immer von neuem wieder aufgenommen; in seiner ursprünglichen Form gänzlich verworfen und nur schwer in die neugefundene hineinwachsend, aber nie aufgegeben, vollendete zögernd der Alternde, was der Junge einst ungestüm begonnen. So kommt es nun, nicht zu früh, nicht zu spät, sondern, wie mir scheint, gerade zur rechten Zeit – zu einer Zeit, in welcher die soziale Frage nicht mehr mit Worten schüchtern oder fordernd an die Türen pocht, sondern alle, die sich ihr nicht öffnen wollen, mit harten Fäusten rücksichtslos einschlägt.
Die Notwendigkeit der Freiheit, die Utopie jedes Gewaltzustandes zu beweisen; zu zeigen, was Freiheit ist und was Gewalt, und wie diese sich nennt; sowie den einzigen Weg, auf dem sie erfolgreich bekämpft und besiegt werden kann war die neue Aufgabe, in deren Dienst ich die bescheidene Unabhängigkeit, der mir früher zu leben vergönnt war, gestellt habe.
Welche Zeit wohl könnte besser und eindringlicher die Berechtigung zu einer solchen Aufgabe erweisen, als die, in der wir leben (oder vielmehr langsam sterben): diese Zeit des Niederganges und des Zusammenbruches ganzer Völker; der Zwangswirtschaft und der ebenso sinn- wie aussichtslosen Sozialisierungsversuche; der Grenzsperrungen und der nicht endenden Kriege; der allgemeinen Ratlosigkeit und Verwirrung; diese Zeit des frechen Taumels über Gräbern hier, und dort der müden Verzweiflung?
Nach den grauenvollen Jahren eines in seiner scheußlichen Art bisher und wahrscheinlich in alle Zukunft beispiellosen Massenmordens; nach der Abwendung der größten Gefahr, die die Freiheit der westlichen Welt bedrohte, durch den Sturz des preußischen Militarismus, löst heute mit atembeklemmender Geschwindigkeit eine Gewalt die andere ab, und während wir uns hier zur Zeit der zweifelhaften Wonnen einer sogenannten demokratischen Republik erfreuen, weiß keiner von uns, welche letzten Schrecken und tiefsten Erniedrigungen nicht schon von Osten her das Machtgelüst einer neuen Diktatur (ein Kommunismus des Proletariats) über uns verhängt haben und wann auch diese letzte und plumpste Form der Gewalt durchlaufen und in sich zusammengebrochen sein wird.
Müssen wir auch dies Letzte und Schrecklichste noch über uns ergehen lassen, um sehend zu werden? – Könnten wir es nicht wenigstens mit der Freiheit einmal versuchen? Anfangen, aus den teils furchtbaren, teils lächerlichen Erfahrungen, die die Gegenwart uns täglich aufzwingt, zu lernen, indem wir aufhören, uns gegenseitig zu bestehlen und zu vergewaltigen; innehalten und umkehren auf dem Wege, auf dem uns fremde Herrschsucht und Habgier sowohl, wie die eigene Torheit und Blindheit vorwärts treibt; und indem wir den einschlagen, der uns allein noch herausführen kann aus dem Wahnwitz dieses Lebens, endlich erkennend: es gibt nur ihn noch und keinen anderen? ...
Wenn wir es auf ihm einmal versuchten? –
Es ist meines Lebens zweite große Schlacht, die ich mit diesem Buche um die Freiheit schlage. Noch einmal, zum letzten Male, wirbt meine einsame Stimme, einsamer heute fast, als damals, wo sie sich zuerst erhob, im Toben der Wut und im Geschwätz der Angst um sie her für das höchste Gut der Menschheit, das die Menschen so wenig zu würdigen wissen, weil sie es nicht erkennen; das sie so schmählich mißbrauchen, weil sie ihm nicht trauen; und das dennoch ihre letzte Hoffnung und ihre einzige Rettung ist und bleibt.
Möge man sie überhören, möge man sie verlachen und niederschreien, fälschen und mißdeuten, wie man es immer getan: diese Stimme – sie läßt sich nicht mehr erdrosseln, und sie wird zu denen dringen, die sie sucht, wie die sie vernehmen werden, die sie hören wollen.
Denn langsam, unendlich langsam, aber mit unbezwinglicher Sicherheit brechen sich die Wahrheiten, die uns die nächsten sein sollten und uns noch immer die fernsten sind, ihre Bahn; Wahrheiten, die man als »gefährlich« abzutun und zu ersticken sucht, weil man sie nicht widerlegen kann; Wahrheiten, in der Tat gefährlich, aber gefährlich allein dem Wahn und dem Aberglauben, allen Vorrechten und jeder angemaßten Autorität.
Vorwort
Ich stelle diesem Buche – und zugleich, was ich damals nicht wagte, nachträglich seinem Vorgänger – den Namen eines Mannes voran, der in einem langen und unvergleichlichen Leben voll Mut, Tatkraft und Ausdauer mehr für die Sache der Freiheit getan hat, als irgendein Lebender; einen Namen, der, statt heute über die Welt hin genannt und gefeiert zu sein, von den verhältnismäßig so wenigen erst gekannt und geliebt ist, deren bester Trost es immer noch sein muß, daß in der unermeßlichen Dummheit und schrankenlosen Brutalität ringsumher es überhaupt noch Menschen gibt, wie den, der ihn trägt.
Nichts hat in diesen dreissig Jahren die ersten Erkenntnisse meiner Jugend auch nur für einen Augenblick zu erschüttern vermocht. Keine Erfahrung, die sie nicht bestätigt, kein Erlebnis, das sie nicht befestigt und vertieft hätte.
Wie sollte es auch anders sein? – »Alles, worauf es ankommt, ist, sich den Mut zur Arbeit, der der Mut zum Leben ist, nicht biegen und brechen zulassen. Solange er, der Haß und Gleichgültigkeit gleichermaßen überwindet, uns bleibt, solange sind wir jung – auch ohne Jugend!« – Irgendwo habe ich es geschrieben. In guter Stunde und Wahreres nie.
Denn Mut zum Leben ist Mut zur Freiheit. Die Liebe aber zur Freiheit ist eine lange Liebe – sie stirbt erst mir dem Leben, weil sie das Leben selbst ist.
Berlin-Charlottenburg, im Frühjahr 1920
Erstes Kapitel
Das Kind
Inhaltsverzeichnis
In seiner weissen Liege lag das Kind.
Es schlief.
Die kleinen Hände ruhten geballt auf der Decke, und sein Atem ging stetig.
Es war um die dritte Stunde des Nachmittags, der müden Stunde des Tages, und die Fenster des Zimmers waren tief verhüllt.
Draußen aber schlich die glühende Sonne an den Wänden der Häuser hin und suchte nach Einlaß.
Sie fand einen winzigen Spalt, klemmte sich durch und lief nun wie eine schmale, durchsichtige Staubwand durch das Zimmer und über die Wiege hin.
Wie sie stieg und stieg, rückte auch der helle Streifen auf der Decke höher und höher. Er glitt über die kleinen Fäuste, über den rosigen Hals, den halboffenen Mund und traf endlich die geschlossenen Lider des Kindes.
Da erwachte es, geblendet von dem plötzlichen Licht. Es erschrak und begann zu weinen – erst leise und kläglich, dann lauter und lauter in seiner Hilflosigkeit.
Aber niemand hörte es, so laut es auch schrie, denn sie wußten es hier gutverwahrt für eine Weile ...
Und der Sonnenstrahl stieg höher und höher, spielte ein wenig mit den seidenen, goldenen Haaren, rann über die Kissen und begann seine Wanderung die Zimmerwand hinauf.
Das Zimmer lag wieder in tiefem Dunkel, wie vorher.
Noch immer schrie das Kind, geängstigt und ungeduldig. Dann – wie beruhigt durch sein eigenes Weinen – schlief es wieder ein. Es war wieder still in dem kühlen Gemach. – Oft noch sollte es so weinen, dieses Kind, in dem Leben, das es kaum begonnen: einsam und ungehört.
Aber immer sollte es ihm auch beschieden sein: in sich selbst seinen Trost und seine letzte Beruhigung zu finden.
Das Kind ungleicher Eltern, in einer Ehe, die auf der einen Seite in später Leidenschaft, auf der anderen ohne Neigung geschlossen war, wurde es in den Jahren geboren, als nach dem blutigen Kriege zweier aufeinandergehetzter Völker in dem Jubelschrei der Sieger die Todesschreie der Hingeopferten verklangen, und erhielt, in den Schoß einer christlichen Gemeinschaft aufgenommen, den Namen Ernst Förster (einen einfachen und guten Namen für den einfachen Menschen, der ihn tragen sollte). –
Sehr ungleicher Eltern: der Vater Gerichtspräsident in einer mittelgroßen Stadt des südlichen Deutschlands, Beamter in guter Bestallung, streberisch im Engen und eng in seinem Streben, äußerlich der korrekte Ehrenmann, innerlich ein beschränkter Aktenmensch, der nie gewagt, oder auch nie daran gedacht hätte, eine andere Anschauung als die von oben her vorgeschriebene und gebilligte zu haben – ein Typus; die Mutter die einzige Tochter eines hervorragenden und durch seine wissenschaftlichen Arbeiten weit über die Kreise seines heimischen Wirkens hinaus bekannten, aber in täglichen Dingen wenig praktischen und unbekümmert dahinlebenden Arztes, von dem sie nach dem frühen Tode ihrer Mutter eine freie und vorurteilslose Erziehung erhalten hatte, die sie zu dem frischen und unbekümmerten Menschen machte, der sie war – eine Persönlichkeit.
Der Präsident, ein hoher Vierziger, Witwer und Vater erwachsener Kinder, lernte das junge Mädchen während eines Sommerurlaubes kennen, verliebte sich, hielt an und wurde schlankweg abgewiesen. Zum erstenmal in seinem Leben vielleicht empfindlich in seiner Eitelkeit verletzt, reizte es ihn, wie alle brutalen Menschen, seinen Willen durchzusetzen. Er kam wieder und wieder: als Patient, der nicht abgewiesen werden durfte; dann als guter Bekannter, der geduldet werden mußte.
Ein Zufall kam seinen Absichten zu Hilfe: der plötzliche und unerwartete Tod des Arztes. Er wiederholte seinen Antrag. Alleinstehend, fast ohne Mittel, jeder Fürsorge und Liebe mit ihrem Vater beraubt, nahm das junge Mädchen ihn diesmal an, fast ohne zu wissen, was sie tat.
Es war auf ihrer Seite eine verhängnisvolle Unüberlegtheit; von seiner Seite aus eine unschöne Überrumpelung.
Sie nannte diese Ehe später das Unglück ihres Lebens; er – wenn auch nur sich gegenüber – nannte sie die einzige, große Dummheit des seinen.
Die Ehe wurde, wie sie in diesen Kreisen, wo nur mit Worten geschlagen wird, werden mußte.
Sie war auf seiten des Mannes ein nie endender Groll: eine ständig in ihrem Machtbewußtsein verletzte Eitelkeit, die jede freie Betätigung des anderen schon als eine Auflehnung betrachtete; eine nicht endende Unzufriedenheit darüber, einen grade gewachsenen Menschen nicht biegen zu können; und ein geheimer, uneingestandener Neid auf Interessen feinerer und höherer Art, die zu teilen ihm versagt und denen mit Spott allein nicht beizukommen war ...
Sie war auf seiten der Frau ein aufreibender und ermüdender Kampf, sich aus dem Zwiespalt mit einer ihr innerlich völlig fremden Umgebung die Heiterkeit des Gemütes, die Freiheit der Seele und die Selbständigkeit ihrer Anschauungen, ihrer Entschlüsse und ihrer Handlungen zu retten – jene Güter, die sie gelehrt worden war, als die wertvollsten, als die einzig wertvollen des Lebens zu betrachten.
Die Geburt des Kindes, statt die Eheleute einander näher zu bringen, trennte sie völlig. Sie fühlte, daß es jetzt nicht mehr den Kampf um sich allein, sondern auch den um ihr Kind galt, und zog hieraus neue Kraft zu diesem Kampfe; er sah, daß ihm ein neuer Feind erwachsen war.
Eines Tages verließ sie mit dem Kinde, das eben seine ersten Worte sprach, schweigend und abschiedlos das Haus.
Er drohte, sie mit Gewalt zurückholen zu lassen. Aber er tat es nicht. Er fürchtete den Skandal: die »öffentliche Meinung«. So blieb sie – der die Meinung einer Welt, in der sie nie begehrt hatte, zu leben, und in der sie sich nur unglücklich gefühlt hatte, gleichgültig war –die Siegerin.
Sie »ging in die Schweiz, um ihre angegriffene Gesundheit zu kräftigen«; ihn »banden leider seine beruflichen Pflichten an die Stätte seines Wirkens«.
Eine Scheidung erfolgte nicht; sie wollte sich nicht der Gefahr aussetzen, ihr Kind zu verlieren.
Aber sie kehrte nie zu diesem Manne zurück.
Ihre Gesundheit war in der Tat erschüttert. Sie gewann sie nie ganz wieder, wenn sie sich auch in den stillen und friedlichen Jahren in dem kleinen Hause an dem lieblichen See, das sie mit ihrem Kinde bezog, in der Ruhe einer großen Natur und in dem langsamen Vergessen des Erduldeten sichtlich erholte und scheinbar die Frische und Heiterkeit ihrer Mädchenjahre wiederfand, ihr Lachen und ihre Unbekümmertheit.
Im Winter lag das Haus unter Schnee und Eis, und außer den Nachbarn nahte sich selten ein Mensch. Aber im Sommer tat es sich auf: dann kamen die Fremden, die das ganze Land überschwemmten, auch hierher, und es wurde vermietet. Denn davon mußten sie leben.
Dort wuchs das Kind auf; wurde das Kind zum Menschen, aus dem Kinde ein Knabe.
Es ist noch ein Kind, ein hilfloses Kind. Alles muß es erst noch lernen. Es ist noch lange kein Mensch.
Es trinkt, schreit und starrt hinaus in das Unfaßbare. Man weiß sehr wenig von ihm, aber es weiß noch weniger von sich. Es wird von allen geliebt, denn es ist gegen alle gleichermaßen gleichgültig.
Eines Tages aber geht ein Lächeln über das kleine runzelige Gesicht, als die Mutter sich über die Wiege beugt. Es erkennt mich! – sagt sie glücklich. Hat es sie wirklich erkannt?
Eines anderen Tages trifft das Kind seine erste Wahl. Es wählt das Wesen, dessen Liebe es am nächsten und wärmsten fühlt. Es will nicht nur Nahrung von ihm, Blut von seinem Blut – es will die Hand, weich und zart wie keine andere Hand. Es will gehen. Allein kann es das noch nicht. So will es sich halten.
Dann steht es zum erstenmal auf seinen eigenen Füßen; sehr ängstlich auf dem ersten Platz, den es sich selbst gewählt hat. Es macht den ersten Schritt – von den Knien der Mutter zu dem Stuhl an der Wand. Es jauchzt, aber die Mutter weint. Sie begreift, daß ihr Kind sich ihr zum erstenmal selbständig entzogen hat. Wie lange wird es noch dauern, und es geht seine eigenen Wege! – Und dann die Wege, auf denen sie ihm nicht mehr folgen kann, Wege, von denen sie nichts mehr weiß! ...
So wird das Kind zum Menschen, der es jetzt noch nicht ist.
Die ersten Eindrücke – keine großen, aber für das Kind ungeheuer und unvergeßlich:
das Haus am See, mit der Veranda, über die der wilde Wein sich rankt;
der kleine Garten, seine Sommerwelt, das Königreich, in dem es herrscht;
Treu, der große Hund, in dessen weichem Fell die kleinen Hände wühlen, in dessen weichem Fell es, müde von seinen kindlichen Spielen, entschläft;
der See selbst, der geheimnisvolle Spiegel, dem es sich nur bis zu einer gewissen Grenze nähern darf, der See mit den fernen, weißen, dämmernden Bergen – –
die Welt des Kindes, eng und klein in Wirklichkeit, aber unermeßlich groß in der Erinnerung, die niedrige Zimmer zu Hallen, Lauben und Büsche zu Waldestiefen, und begrenztes Wasser zu Meeren weitet; noch weitet, als längst der Erwachsene gelernt hat zu sehen, und längst die Dinge sieht »wie sie sind«.
Es wächst und wächst, das Kind, mit jedem Jahre um einen neuen Strich an der Tür, aus seinen ersten Schuhen heraus in die neuen.
Es hat gehen gelernt; nun lernt es sprechen: sich verständlich machen mit anderen.
Alles war erst Sehen und Staunen, Fühlen und Empfinden. Nun kommen langsam die ersten Fragen, und langsam kommt in die Fragen erstes Denken, in das sich umzusetzen beginnt, was es sieht und fühlt.
Die Fragen kamen früh, wie alle meinten, die es sahen; zu früh, wie manche sagten, für ein Kind.
Es wuchs und wuchs ...
Eines Tages tut es seinen ersten Schritt zur Menschwerdung: es spricht sein erstes bewußtes »Nein«! – Es wird gefragt, weshalb es Nein gesagt hat und es hat sein Nein zu begründen. Es wird genötigt, sich klar darüber zu werden, warum und worin es sich von anderen mit diesem Nein unterscheiden will; und die anderen müssen ihm antworten.
Denn es will eine Antwort, eine begründete Antwort. Bisher ist ihm nur gesagt worden: »Tue dies! – Lasse das!« – Jetzt will das Kind zum erstenmal wissen, warum es dies tun und jenes lassen soll.
Wenn man ihm bisher gesagt hat: »Gehe nicht zu nahe ans Wasser!« so muß man jetzt hinzufügen: »denn du kannst hineinfallen und ertrinken«. –
Es beginnt, Gründe als sein Recht zu verlangen; man soll sich mit ihm auseinandersetzen.
– Und das Kind hat so viele, viele Fragen. Mit allen kommt es zur Mutter. Diese hat ihm einmal gesagt: Was ich dir beantworten kann, das sollst du nicht vergebens fragen. Aber bedenke, daß ich nicht alles weiß und daß es daher Fragen gibt, die ich dir nicht beantworten kann ...
So erscheint sie dem Kinde nicht als eine allwissende Macht, die unbedingten Glauben verlangt, sondern als die Helferin seiner ersten Versuche sich zurechtzufinden.
Sie sieht auch in dem ersten »Nein!« keine Auflehnung und keinen Trotz, sondern die erste berechtigte Äußerung eines Willens zu eigenem Dasein.
Sie beginnt, sich mit ihm zu verständigen: sucht seinen Einwänden mit Gründen zu begegnen und macht auf die Folgen aufmerksam. Überlege, was du tust, sagt sie ihm. Und das Kind ist ihr dankbar. Vieles läßt es gleich. Manches versucht es dennoch; sieht, daß die Mutter recht hat und läßt es.
Anderes tut es gegen ihren Rat. Es »setzt seinen Willen durch«. Die Mutter läßt es gewähren, wenn es ihm nicht schadet. Sie weiß: selbst so ein Kind hat schon seine eigenen heimlichen, kleinen Wünsche und ist nur glücklich, wenn es sie befriedigen kann. Unterdrückt man hier die berechtigten, so äußern sich die unberechtigten dort als Trotz und Widerspenstigkeit.
Sie sieht – und sieht es mit Freude –: ihr Kind beginnt zu denken, zu prüfen, und fängt langsam an, zu unterscheiden. Es fängt an, seine eigenen Erfahrungen zu machen; an: ein Mensch zu werden ...
Es hat sprechen gelernt »von selbst«. Es hat begonnen, sich mit den Menschen zu verständigen, die um ihn sind.
Nun lernt es lesen und schreiben, um sich auch verständigen zu können mit denen, die ihm fern und fremd sind.
Lernt es von der Mutter. Sie führt ihn ein in Sinn und Bedeutung der rätselhaften Zeichen. Sie zeigt ihm, wie die anderen sie deuten. Wie es selbst sie sich einmal deuten wird, das wird seine Sache sein.
Noch vieles andere lernt es vor ihr: wie sich die Zahlen reihen, fügen und lösen; wie die Tiere und Pflanzen heißen und wie sie leben und wachsen in Wald, Flur und Luft; wie die Gestirne wandern, Mond und Sonne, und unsere Erde; was es tun muß, um sich zu nützen und was lassen, um sich nicht zu schaden ...
Alles, was es lernt, lernt es zuerst von ihr. Es lernt alles gern und leicht, weil es aus der Hand kommt, an der es sich sicher fühlt. Und früh lernt es, in der Mutter nicht nur die Mutter, sondern auch die Gefährtin seiner ersten kleinen Leiden und Freuden zu sehen, und sie wird und bleibt seine beste Freundin.
Das Haus hatte einen Freund. Er kam jeden Sommer auf lange und schöne Wochen und war sein ersehnter und liebster Gast.
Auch das Kind hing an ihm. Er war vielleicht der einzige, dem sich das sonst so spröde erschloß.
Es wurde von ihm auf Spaziergängen mitgenommen, wo Sagen und Geschichten erzählt wurden, und unerschöpflich schien auch die Zahl der Gedichte, die er ihm sprach, und deren Klang das Kind auch dann oft seltsam berührte, wenn es noch nicht imstande war, ihren Sinn zu erfassen.
Es war auch der Freund der Mutter.
In den letzten Jahren wohnte er nicht mehr im Hause.
»Hat er uns denn nicht mehr lieb,« fragte Ernst, »weil er nicht mehr bei uns wohnt?«
Aber die Mutter lächelte nur:
»Ja er hat uns noch lieb. Du siehst doch, er kommt alle Tage zu uns ...«
Aber noch später, im Winter, nahm sie ihn in die Arme, und er fühlte ihre Tränen auf seinem Haar:
»Unser lieber Freund wird nie mehr kommen, denn – er ist tot.«
Das Kind verstand nur das erste und weinte mit ihr.
– Viele Jahre später begriff der Mann, daß der Freund seiner Kinderjahre auch der Freund der Mutter und vielleicht ihre einzige Liebe gewesen war, und, durch sein eigenes Leben belehrt, die Menschen und ihre Verhältnisse einzig in dem hellen und reinen Licht der Freiheit zu sehen, erschien ihm ihr Bild nicht getrübt, sondern im Gegenteil wie verklärt durch diese nur in den Augen aller dummen und aller niedrigen Menschen verfemten Liebe, und er gedachte mit verdoppelter Dankbarkeit des Mannes, durch den und mit dem sie nach den traurigen Jahren ihrer Ehe die Kraft und den Mut zu einem letzten Glück gefunden.
Das Kind lernt Lesen und Schreiben: In seine Hand wird die erste Waffe gelegt für den Kampf mit dem Leben. Noch ist sie ungeschliffen, und die Hand des Kindes zu schwach, um sie zu führen. Am Erwachsenen wird es sein, sie brauchbar zu machen für seinen Kampf. Es kann lesen und schreiben: nun müssen sich ihm alle Pforten auftun, und, wenn es groß geworden sein wird, stehen ihm alle Weiten des Geistes offen, und er darf Zwiesprache halten mit den Großen und Erlauchtesten aller Zeiten, und alle müssen sie ihm ihr Bestes geben, wenn er es will ... In seine Hand ist die Waffe gelegt. Ob es sie aufnehmen, sie schärfen und schwingen wird – es liegt an ihm.
Es hat sich auf seine eigenen, kleinen Füße gestellt und sein erstes »Nein!« gesprochen.
Es soll nun gehen, weiter und weiter, und ohne die Hand, die es bisher führte, die es stützte, wenn es strauchelte. Es soll ein Mensch werden, einer unter den vielen, vielen anderen Menschen, und es soll sich behaupten lernen unter ihnen.
Denn sich behaupten: so oder so – das ist alles Leben: Streben und Widerstreben.
– Es soll ein Mensch werden.
Noch ist es kein Mensch, wenn sie es auch so nennen. Denn es zählt noch nicht mit.
Ein Mensch wird es erst werden, wenn es sich selbst mitzählt: wenn es anfängt, seinen eigenen Willen zu äußern; wenn es beginnt, zu unterscheiden, zu vergleichen und – zu wählen!
In Liebe und Haß sein Leben behaupten –das heißt ein Mensch sein.
Es ist noch ein Kind.
Als Kind hat es noch keine Erkenntnis des Lebens. Aber es hat das Gefühl des Lebens.
Dieses Lebensgefühl, das aus seinen Augen blitzt, die Bewegungen des jungen Körpers durchzuckt, begehrend und heischend aus Lachen und Weinen klingt – ist Bejahung: Bejahung des Lebens!
Und in dieser Bejahung kündet alles unbewußt mit der Kraft unbeeinflußter Instinkte: daß Freude der Sinn und der Zweck des Lebens ist! ...
Es gibt Menschen, die ihr Leben so weiter leben in dieser Bejahung – als Kinder, unbewußt und selig. Nie erschließt sich ihnen sein Widerspruch; nie öffnen sich ihnen seine Höhen, nie seine Tiefen. Sie bleiben »ewige Kinder«. Es sind ihrer und können ihrer nur wenige sein in unserer Zeit. Die meisten Menschen aber geraten früher oder später in den Zwiespalt des Lebens, und dreierlei nur kann ihr Schicksal sein: sie verzweifeln und gehen unter; sie geben sich zufrieden in dem Bewußtsein, diesen Zwiespalt doch nicht lösen zu können (eine andere und oft schlimmere Form des Untergangs); oder sie lehnen sich auf gegen ihn, suchen ihn zu ergründen, ihn zu lösen – kämpfen und leben: oft Unterlegene, aber endliche Sieger ...
Zu ihnen, diesen letzten, sollte dies Kind gehören, zu diesen Kämpfern mit dem Leben und zu seinen endlichen Besiegern.
– Noch aber ist es ein Kind, ein argloses Kind.
Und Lebens-Bejahung ist sein erster Schrei, wie es einst sein letzter sein würde.
Noch ist der Kleine ganz ein Kind.
Noch ganz vertrauend, gläubig und noch ganz ohne Zweifel.
Die Menschen sind gut. Was sie sagen, ist wahr; was sie tun, ist recht.
Noch ist es ganz ein Kind.
Aber in den grauen Augen steht es doch schon wie Fragen, erste Fragen, noch ungefragte, aber doch schon Fragen: Fragen, tiefer als nach der Wirklichkeit der Dinge. Fragen an das Leben.
Noch sind die Augen hell und klar, von keinem Schatten getrübt – Augen des Kindes.
Die Flamme, die vielleicht hinter ihnen liegt, ist noch nicht entzündet.
Es ist noch ein Kind.
Zweites Kapitel
Der Knabe
Inhaltsverzeichnis
Er war noch ein Kind, der kleine Ernst, und wußte nicht, was Leben und Sterben war.
Er fühlte nur, daß das Leben warm war wie die Sonne dort draußen; der kalte Hauch des Todes hatte ihn auch aus der Ferne noch nicht berührt.
Er sollte seine eisige Nähe früh kennen lernen.
– Er war noch nicht zwölf Jahre alt, als er die verlor, die seine Welt und ihr ganzer Inhalt gewesen war und ohne die er sich diese Welt nicht denken konnte.
Die Gesundheit der Mutter war in der Tat untergraben, und sie starb nach der langen und schweren Krankheit eines Winters. Sie starb schwer und kämpfte um ihr Leben bis zum letzten Atemzuge. Sie wußte, daß ihr Mann das Kind zurückfordern und daß er versuchen würde, zu biegen und zu beugen, was bis jetzt so schön und aufrecht gewachsen war; und sah keine Möglichkeit, es zu hindern.
Als sie begriff, daß der Tod der Stärkere war, nahm sie ihren Jungen an ihre Seite und sprach mit ihm. Sie sagte ihm alles und wollte ihn ermahnen, gut und folgsam zu sein. Aber als sie ihn so vor sich stehen sah, noch so klein, aber doch schon mit einem frühen Ernst in den offenen Zügen, sagte sie nur: »Du wirst dort manches anders finden ... Die Menschen sind nicht immer so, wie wir sie uns vorstellen und uns wünschen. Tue immer das, von dem dein Herz dir sagt, daß es das Rechte ist ...«
– Er war wie betäubt. Er ging umher, als suche er etwas, das er wiederfinden müsse. Die Menschen, die ins Haus kamen, floh er und sprach mit keinem. Er hatte nicht nur seine Mutter, er hatte seinen einzigen Freund verloren, den, mit dem allein er sprechen konnte, wie er wollte.
Dann, als er endlich begriff, was geschehen war, überkam ihn eine große Angst – die erste Angst seines Lebens. Was würden sie jetzt mit ihm tun? ...
»Ich will hierbleiben!« – rief er, als sie kamen, um ihn zu holen.
Er rief es immer wieder. Sie mußten ihn in den Wagen heben.
Zum ersten Male spürte er sie an seinem jungen Leibe – die Gewalt, die er hassen lernen und hassen sollte, sein Leben lang, wie nichts auf der Welt. Mit aufeinandergebissenen Zähnen und tränenlosen Augen ergab er sich, als er sah, daß er der Schwächere war.
Auf der Reise, während die anderen schliefen, die ihn geholt, saß er allein wach und aufrecht, und sah unablässig zum Fenster hinaus. Die Berge versanken, das Land wurde flacher und flacher, und schwer sein kleines Herz und schwerer.
War das die Welt? – Sie war nicht schön.
Auf dieser langen Fahrt, der ersten seines Lebens, nahm er Abschied von dem reinen und unbewußten Glück seiner Kindheit, ohne es zu ahnen, und mit ihr begann er den Kampf mir dem Leben.
Es sollte ein langer Kampf werden.
Fremd war ihm dieses große und laute Haus, das er betrat, und fremd die Menschen, die es bewohnten: seine Stiefgeschwister, die Kinder des Präsidenten aus erster Ehe, die, schon erwachsen, zum Teil im Begriff waren, es zu verlassen; fremd dessen Schwester, eine frühere Hofdame, die den Haushalt leitete; fremd der Mann selbst, den er Vater nennen sollte. Und fremd sollte es ihm bleiben, bis er ihm vier Jahre später, sechzehn und aus dem Kinde zum Knaben geworden, den Rücken kehren durfte.
Denn alles war hier anders. Alles ging hier seinen geregelten und vorbestimmten Gang. Prinzipien lebte man, nicht dem Leben zuliebe. Genau war vorgeschrieben, was man tun durfte und was nicht, und ein Maßstab wurde allein und an alles gelegt – der der »Anständigkeit«. Die gesellschaftliche Sitte gab den Ausschlag in allen Fragen, und gegen sie anzuhandeln wäre Verbrechen, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.
Man lebte von großen Einkünften gut und sicher, und der Junge hatte es in allem Äußerlichen besser, als bisher. Er bekam Sachen zu essen, die er nicht einmal dem Namen nach kannte, und trug Kleider, wie er sie kaum gesehen.
Aber ihm war nichts von dem allem lieb. Er hatte bisher nie darüber nachgedacht, was er aß, wenn er nur satt geworden war, und nie viel darauf geachtet, wie er gekleidet war. Bei der Mutter hatte er mit einem Loch im Ärmel heimkommen dürfen, und außer einem liebevollen Kopfschütteln hatte es nichts abgesetzt, während er jetzt seine Anzüge wie ein anvertrautes Gut behandeln und vor Fleck und Riß sorgfältig schonen mußte. Schmal waren die Bissen und niedrig die Stuben in dem Hause am See gewesen, aber satt war er immer geworden. Frohsinn und Heiterkeit hatten die Mahlzeiten gewürzt, und die engen Wände sich geweitet und bevölkert unter den phantasievollen Erzählungen der lieben Stimme. Hier mußte er steif und stumm am Ende einer langen Tafel sitzen, durfte nur sprechen, wenn er gefragt wurde, und die Speisen blieben ihm im Halse stecken unter dem strengen Blick des Vaters und vor der majestätischen Haltung der Hofdame.
Was er aber am schwersten empfand, war, daß es in dem ganzen, großen Hause keinen Raum gab, in dem er mit sich allein sein konnte. Immer war er bewacht und beaufsichtigt, bei der Arbeit für die Schule und im Schlafe, und nie hätte er gewagt, die lange Flucht der prächtigen Räume, in denen es sich doch herrlich hätte spielen lassen, unerlaubt zu betreten.
Er war und blieb ein Fremder unter Fremden.
Es wurde von vorneherein als feststehend angenommen, daß das Kind in den Händen »der Person, die ihrem Mann davongelaufen war, sittlich verwahrlost, und wenn das nicht, so doch gefährdet sein müsse« und auf alle Fälle einer strengen Zucht dringend bedurfte. Es mit Strenge, aber auch mit Gerechtigkeit zu einem ordentlichen Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu erziehen, war des Präsidenten ernstlicher Vorsatz. Er war erstaunt, es so ruhig, fast still zu finden. Aber als er dann den offenen und freimütigen Blick auf sich ruhen fühlte, der ihn so sehr an einen anderen, seltsam ähnlichen erinnerte, stieg die nie verwundene Bitterkeit tief verletzter Eitelkeit von neuem in ihm auf, und er nahm sich vor, die geheime Auflehnung und den versteckten Trotz, die er aus ihm herauszulesen vermeinte, zu brechen; das sollte seine Rache sein an der, die er haßte noch über das Grab hinaus.
– Er fand nur wenig Gelegenheit dazu.
Denn Ernst fügte sich scheinbar in alles. Er tat, was man ihm sagte, und nur im Anfang noch stellte er hin und wieder seine unbekümmerten Fragen. Als er dann sah, daß man sie als Unbescheidenheit und sein Zuhören als Neugierde auslegte, und ihm bedeutet wurde, daß Kinder nicht zu fragen, sondern zu gehorchen und sich nicht unaufgefordert in das Gespräch von Erwachsenen zu mischen hätten, verstummte er und wurde noch stiller.
Er fragte selten mehr.
Noch glaubte er, daß man ihm nicht antworten wolle. Der Gedanke, daß man ihm auf manche seiner Fragen, von denen einige bereits anfingen, unbequem zu werden, nicht antworten könne, kam ihm noch nicht. Wie hätten auch diese großen, erfahrenen und lebenssicheren Menschen nicht antworten können auf die Fragen eines Kindes!
Aber er wurde mißtrauisch, und bald gab er es ganz auf, zu fragen. Mehr und mehr zog er sich mit allem, was er auf dem Herzen hatte, zurück in sich.
Er hatte bis dahin gelebt, ohne sich Gedanken zu machen über die Menschen und die Dinge um sich her. Nun zwang ihn die große Veränderung der Verhältnisse zum Vergleich. Er verglich – und zugleich begann er zu denken, zu prüfen, zu wählen.
Er trauerte der sorglosen Fröhlichkeit seiner ersten Kinderjahre nach – ein kleiner Vogel, den man in einen Käfig gesetzt, an dessen Stäben er sich die Flügel zerschlägt.
Immer dachte er an seine Mutter.
Er hatte niemand, mit dem er von ihr sprechen konnte, und niemand sprach zu ihm von ihr.
Oft, wenn er allein war, saß er lange und sah hinaus. Dann stieg es in ihm auf, und er glaubte, wieder zurückzumüssen um jeden Preis.
Bitterer Kummer der einsamen Kinder – was wissen die Großen von ihm!
Einsame Tränen der jungen Augen – im Verborgenen geweint und nicht getrocknet von den Küssen der Liebe – wie glühende Tropfen fallen sie nach innen und hinterlassen in den zarten Herzen die Narben ihrer Wunden!
Als er größer wurde, weinte er nicht mehr. Aber ein früher Ernst nahm von ihm Besitz.
Er war mißtrauisch geworden und begann zu beobachten und nachzudenken.
So vieles verstand er nicht!
Diese Menschen hatten es doch so gut und alles, was sie sich wünschten, und doch klagten sie immer.
So klagten sie fortwährend über ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen. Aber warum gab man diese Gesellschaften und ging in sie, wenn man keine Lust dazu hatte? Als er das einmal aussprach, traf ihn ein vernichtender Blick: »Man muß vieles im Leben tun, weil man Pflichten gegen andere hat. Das wirst du auch noch lernen ...«
Man sprach unfreundlich, oft gehässig über andere Menschen, und wenn man sie sah, tat man, als seien es die besten Freunde.
Man sagte ihm, daß Lügen abscheulich und das unverzeihlichste aller Vergehen sei. Aber man log selbst: Wenn Besucher kamen, wurde den Dienstboten oft befohlen, zu sagen, man sei nicht zu Hause, wenn man es war. Weshalb tat man es? Man hätte doch einfach sagen können, man habe keine Zeit oder Lust, andere Menschen zu sehen.
Er verstand es nicht, aber sein wachgewecktes Mißtrauen empfand den Zwiespalt zwischen Wort und Handlung, und immer tiefer senkte sich dieser Zwiespalt in die junge Seele.
Er glaubte nicht mehr alles, was man ihm sagte; und er sagte selbst nicht mehr alles, was er glaubte.
Er war in die Schule gekommen, und eine zweite, neue Welt hatte sich ihm aufgetan.
Bis dahin war er von der Mutter und einem alten Lehrer zusammen mit einigen anderen Kindern unterrichtet worden, die er natürlich alle kannte. Jetzt kam er unter viele und lauter fremde.
Er hatte immer leicht gelernt und gern.
Aber jetzt kamen Dinge, die er nicht begriff und –was schlimmer war – von denen er nicht begriff, warum er sie lernen sollte: Formeln und Regeln, Zahlen und Bezeichnungen, und wieder Zahlen und Zahlen, deren Sinn sich ihm nicht erschließen wollte.
Er pfropfte hinein in sein kleines Gehirn, was nur hinein ging. Aber oft wußte er am nächsten Tage nicht mehr, was er am vorhergehenden noch gewußt, und vieles behielt er und wußte es, aber es war plötzlich nicht mehr da, wenn er es wissen sollte.
Staub, der uralte Staub der Schule, begann sich auf ihn zu senken, und schnell verlor er die Lust am Lernen.
Die Lehrer fragten. Die Schüler hatten nicht zu fragen. Sie hatten zu antworten.
Eine andere Berührung, als die vom Katheder herab zur Schulbank, gab es nicht.
Die Lehrer saßen dort oben, unnahbar, und die Schüler saßen hier unten, und zwischen ihnen herrschte nicht Vertrauen, sondern Kampf. Die Lehrer kämpften darum, ihre Macht zu behaupten; und die Schüler darum, sich dieser ihrer Macht zu entziehen, so weit es ging. Nicht immer blieben die ersteren Sieger. –
Für Ernst waren sie alle gleich. An keinen von ihnen hatte er später auch nur eine Erinnerung mehr.
Außer an einen. Denn ein Lehrer war da, den er nicht vergaß, und der bei allen dafür sorgte, daß sie ihn nicht vergaßen.
Verwachsen und an den Füßen verkrüppelt, mit einem bartumrahmten Christusgesicht, galt er für einen Gelehrten und gab alte Sprachen.
Er schlug. Er schlug in jeder Stunde: auf jeden los, der »nichts wußte«, und solche gab es immer. Er schlug systematisch.
Die Angst der Kinder vor diesem Menschen war unbeschreiblich. Selbst die Stärksten und Gleichgültigsten zitterten vor ihm. Ernst empfand weniger Angst, als eine Art Grauen.
Einmal sollte auch er geschlagen werden. Aber er blieb nicht, wie sie es mußten, mit dem Gesicht gegen die Wand und mit erhobenen Händen stehen, sondern er drehte sich beim ersten Schlage jäh um, so daß dieser sein Gesicht traf. Auch der Lehrer erblaßte, als er ihn sich das Blut abwischen hieß. Er schlug ihn seitdem nie mehr.
Zu Hause sagte der Knabe, er sei gefallen und habe sich verletzt.
Später, viel später, als er erfuhr, daß es Menschen gibt, die aus schwer erklärbaren Ursachen an Mißhandlungen anderer eine Art unnatürlicher Befriedigung empfinden, dachte er, jener Lehrer, der über sie gesetzt war, möge wohl einer von diesen gewesen sein, um so ungestraft an ihren jungen Körpern seiner Lust fröhnen zu dürfen.
Das waren die Lehrer.
Wo aber blieben die Eltern, die ihnen ihre Kinder auslieferten, ohne danach zu fragen, was mit ihnen geschah?
Sie kümmerten sich offenbar nicht darum. Und doch liebten sie ihre Kinder, und hätten sie, wie Ernst von vielen wußte, selbst nie geschlagen.
Das war wieder etwas, was er nicht begriff.
Warum stellen sie sich nicht vor ihre Kinder, um sie zu schützen? Wagten sie es nicht? – Unterließen sie es aus Bequemlichkeit? – Galt diese ihnen mehr, als das Wohl und Wehe ihrer Kinder? – Und war die Macht dieser Lehrer so unermeßlich groß, daß alles vor ihnen sich beugen mußte, auch die Großen?
Er begriff es nicht. Aber von neuem wuchs sein Mißtrauen und stärker wurden seine ersten Zweifel.
Er schloss seine erste Freundschaft, mit dem unter seinen Mitschülern, der ihm am besten gefiel, einem klugen und freundlichen Jungen, dem Sohne einfacher und anständiger Eltern.
Sie sagten sich alles, und es wurde zwischen ihnen die heftige und doch so unendlich keusche Zuneigung dieser Jahre, die nicht ganz ohne Leidenschaft und nicht ohne geheime Eifersucht auf andere ist.
Sie waren zusammen, so oft es ging.
Aber zu Hause wurde diese Freundschaft nicht gerne gesehen. Man bedeutete ihm, sich seinen Umgang lieber unter den Söhnen der Kreise zu suchen, in denen man selbst verkehrte. Aber unter denen war eben keiner, der ihm so gefiel wie sein Freund, und viele erschienen ihm trotz ihrer Herkunft roh und äußerlich in ihrem Wesen, und die meisten eingebildet auf das Geld und die Titel ihrer Väter.
Er ließ nicht von seinem Freund. Zum erstenmal stellte er seinen Wunsch gegen die fremden Wünsche.
Er folgerte für sich so: Dein Vater gibt dir Nahrung und Obdach, und dafür mußt du zu Hause gehorchen; außerhalb des Hauses aber hört seine Macht auf.
Als er daher sah, daß er und sein Freund nicht mehr offen miteinander verkehren konnten, sahen sie sich heimlich. Sie schwuren sich, allen Gefahren zu trotzen, die ihrer Freundschaft drohten, und mit der natürlichen Schlauheit ihrer Jahre fanden sie tausend Wege und Winkel, von denen die anderen nichts ahnten. Sie blieben unzertrennlich, solange sie auf der Schule waren.
– Ernst aber dachte für sich: es gab also Menschen, mit denen man verkehren durfte, und Menschen, mit denen man es nicht durfte. Auch das wollte ihm nicht eingehen.
Eine andere Bekanntschaft, die er machte, eine Bekanntschaft ganz anderer Art, verschwieg er daher von vornherein und sprach selbst zu seinem Freunde nicht von ihr.
Auf einem seiner Streifzüge, die er, so oft es ging, an seinen freien Nachmittagen unternahm und von denen er nie anders als beladen mit Pflanzen und allerlei Kleingetier zurückkam, um mit ihnen den Raum (den kleinsten des Hauses ), den man ihm endlich überlassen, zu füllen – auf einem dieser Streifzüge lernte er einen alten Förster kennen, durfte mitgehen und wurde im Försterhaus von der guten, alten Frau herzlich und gastlich aufgenommen. Er kam wieder und wieder und machte sich nützlich, wie er konnte; ersparte den alten Leuten Gänge nach der Stadt und ging im Hause zur Hand, wofür er dann den Förster auf seinen Dienstwegen durch den Wald begleiten durfte, der ihm mit allem, was in ihm lebte und webte, bald so vertraut wurde, wie das kleine Haus am Waldrand ihm Zuflucht und Heimat.
Das alte Ehepaar aber, das den einzigen Sohn im Kriege verloren, freute sich an dem frischen Leben, das in das stille Haus kam.
Hier durfte Ernst wieder ganz das frohe Kind von früher sein, das mit den Hunden tollte und jagte und mit den Vögeln um die Wette sang, und wer ihn in der Schule und zu Hause und dann hier gesehen hätte, hätte ihn gewiß nicht wiedererkannt.
Wie ein Geiziger seinen Schatz behütet, so hütete er sein Geheimnis, in der Furcht, man könnte es ihm rauben.
So wurde aus dem Kinde ein Knabe, der sich gewöhnte, neben einem Leben, wie es gefordert wurde und das er schweigend ertrug, ein zweites zu führen – ein Leben für sich, an das er nicht rühren ließ.
Er empfand das als sein »Recht« ...
Wer führte es denn nicht?
Wohin er sah, überall sah er diesen stillen, aber hartnäckigen Kampf zwischen den Anforderungen der einen und den Wünschen der anderen: zwischen den Kindern und den Eltern, den Schülern und den Lehrern, den Dienstboten und der Herrschaft, überall, so weit er sehen konnte in dem Kreise, in dem erlebte.
Er sah auch, daß, je enger seine Kameraden zu Hause gehalten wurden, um so größer ihre Listen und Schliche wurden, sich den Fesseln zu entziehen, und umgekehrt; und es schien ihm oft, als sei in den kleinen Bürgerfamilien das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ein herzlicheres und freimütigeres, als in denen dieser Beamten und Großkaufleute, wo wenig Vertrauen und Offenheit herrschte und alles nach festgelegten Erziehungsprinzipien herging.
Langsam lernte der Knabe zu sehen, langsam, zu schweigen zu dem, was er sah; und früh begann er, sich in seine Gedanken zu verschließen, um mit ihnen allein zu sein in einem zweiten, seinem eigenen Leben, das ihm – wie er ahnte – niemand nehmen konnte: kein Verbot und keine Strafe; einem Leben, dessen er, obwohl es ein geheimes war, sich nicht schämte und zu schämen brauchte, und das ihm die ersten Stunden schenkte eines echten Glückes.
Aus dem Kinde war ein Knabe geworden, der die ersten Klassen der Schule hinter sich hatte, in sein sechzehntes Jahr ging und nun eingesegnet werden sollte.
Er sollte sich »Gott geloben«, wie man ihm sagte, und »den Bund mit Ihm erneuern ...«
Gott? – Wer war Gott? –
Von seiner Mutter war ihm wohl der Name genannt worden, aber doch nur selten und mehr gelegentlich, als absichtlich, und wenn sie ihn nannte, verband sie ihn nie mit einem persönlichen Wesen, sondern sprach von ihm, als sei er in den Dingen, in allen, den kleinen wie den großen, ja als sei er diese Dinge selbst. Hier im Hause aber war der liebe Gott ein Prachtstück, das man bei besonderen Gelegenheiten hervorholte um zu beweisen, daß man auch das besaß, aber sonst war nie von Gott die Rede, und man machte kein Hehl daraus, daß man ihm gegenüber auf der Höhe der Zeit stand – man bekannte sich nicht zu ihm, würde ihn aber ebensowenig verleugnet haben.
Gott? – Wer war Gott? – –
In der Schule war allerdings viel von Gott die Rede, dem »allmächtigen Gott«, aber die Stunde, in der es am meisten geschah, die Religionsstunde, wurde nicht ernst genommen und galt als willkommene Erholung zwischen den anderen. Gott? – Wen sollte er nach ihm fragen, daß er ihm sagte, wer das sei? ...
Sein Freund wußte es so wenig wie er selbst, und der alte Förster war auf die »Pfaffen« nicht gut zu sprechen und setzte sich, wie er sagte, mit seinem Herrgott lieber ohne ihre Hilfe auseinander, was übrigens, wie er hinzufügte, ein jeder tun solle, und zwar auf seine eigene Weise ...
Jetzt hörte er, daß Gott ein persönliches Wesen sei, und ein höchstes, das über den Dingen throne; daß er allgegenwärtig und die Liebe sei; und in dieser Liebe gleich gütig und verzeihend, wie drohend, zürnend und strafend; daß er seinen Sohn gesandt habe, um die Welt von ihren Sünden zu erlösen, und daß dieser Sohn als das Kind einer unbefleckten Jungfrau geboren sei; und daß die heilige Dreifaltigkeit: Gottvater, Sohn und der Heilige Geist – hier indessen hörte das Verständnis des Knaben völlig auf, und er begriff nichts mehr ...
Aber sein natürliches Empfinden lehnte sich auf, und dieser Gott, dieser persönliche Gott, war ihm fremd und unheimlich-schreckhaft wie diese ganze Lehre von Sünde und Vergebung, Schuld und Strafe, Himmel und Hölle. Und blieb es.
Ein strafender Gott, der alle Sünden sah? –
Er war sich keiner Schuld bewußt. Oder war es schon eine Schuld, daß er lebte? – Fast schien es ihm so bei den vielen und großen Worten. Aber er konnte diesen Worten nicht glauben.
Was ihn aber an diesen Vorbereitungsstunden anzog und sie für ihn zu besonderen machte, war, daß sie ihn zum erstenmal in seinem Leben mit ganz anderen Kreisen in Berührung brachten. Das war etwas Neues. Alles Neue aber zog ihn an und gab ihm zu denken.
Der Unterricht wurde gemeinsam abgehalten, in einem großen Saale: die Schüler des Gymnasiums saßen auf der einen, die der Volksschulen auf der anderen Seite, ohne daß aber dadurch die Böcke von den Schafen geschieden waren, und zwischen ihnen herrschte Feindschaft von Anbeginn, eine Feindschaft, die sich oft in förmlichen Schlachten austobte, bei denen die ersteren nicht selten vor den kräftigen Fäusten der letzteren den kürzeren zogen. Sie rächten sich dann damit, daß sie mit unsagbarer Verachtung von den »Proleten« sprachen, wofür sie hinwiederum »Protzen« und »Fatzken« betitelt wurden.
Wie diese fremden Kinder dort drüben zusammensaßen, waren sie für Ernst eine fremde und unheimliche Masse, aber mit einzelnen hatte er gern gesprochen, wenn dies bei den streng geschiedenen Grenzen überhaupt möglich gewesen wäre. Er verstand nicht, weshalb seine Kameraden so hochmütig auf die dort drüben herabsahen. Wenn sie plumpe Stiefel und grobe, zerrissene und geflickte Kleider trugen, so kam das doch sicher daher, daß ihnen ihre Eltern keine besseren kaufen konnten, und wenn sie den muffigen Dunst ungelüfteter Stuben und die gemeine Sprache der Gasse mit sich brachten, so war das wohl, weil dort die Häuser eng und niedrig waren und man sich nicht so um seine Kinder kümmern konnte, wie es bei ihnen geschah, weil man den ganzen Tag arbeiten mußte.
Er sah immer hinüber und sah, wie verschieden sie auch dort waren: neben blassen und mageren Gesichtern, die aussahen, als seien sie immer hungrig, saßen Burschen mit Männerfäusten, von denen es hieß, daß sie sich bereits mit den Mädchen herumtrieben und mit der Polizei zu tun gehabt haben sollten, und die ganz so aussahen, als kümmerten sie sich um keinen Gott und keinen Teufel.
Er sah oft hinüber. Zum ersten Male in seinem jungen Leben rührte ihn, ohne daß er es ahnte, leise die Frage an, die ihn in seinem späteren Leben tiefer erregen und stärker beschäftigen sollte, als irgendeine andere Frage.
»Wenn einer unter euch in geistigen Zweifeln und Nöten ist, der möge zu mir kommen und mich befragen. Ich, euer Seelsorger, stehe hier an Gottes Stelle, um euch in ihnen zu helfen ...«
Die anderen schienen nichts von solchen Zweifeln und Nöten zu wissen; Ernst aber glaubte zuweilen, in ihnen zu sein.
Wenn Gott, wie es gelehrt wurde, gütig, allerbarmend und gerecht war, warum ließ er dann zu, daß es den einen so gut und den andern so schlecht ging? – Und wenn die Menschen alle Brüder waren, die sich untereinander lieben sollten wie sich selbst, und alle gleich vor ihm, dem Höchsten, warum litt er dann, daß es Schwache und Starke, Reiche und Arme, Hohe und Niedrige gab? – Sah Gott alles, mußte er auch das sehen.
– Eines Tages faßte er sich ein Herz und ging zu dem Pfarrer.
Er wurde auch angenommen, erstaunt, wie es schien, und sogar etwas verlegen, aber statt der Antwort, die er erwartete, wurde er zunächst selbst gefragt:
Wer ihn auf solche Gedanken gebracht habe ? – Ob er sie irgendwo gehört oder gelesen habe, und wo? – Und als er sagte, daß er sie weder gehört noch gelesen habe, aber doch sähe, daß es so sei, erfolgte eine lange Rede, von der er nur soviel verstand, daß es nach Gottes unerforschlichem Ratschluß immer Arme und Reiche gegeben habe und immer geben werde; daß aber die Armen eigentlich die Reichen seien, denn das Reich Gottes sei ihrer, sofern sie nur den rechten Glauben hätten; daß es aber gerade an diesem rechten Glauben noch recht sehr fehle ... woher denn auch die Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen käme ... und aus dieser Unzufriedenheit dann wieder solche Fragen, die schon anfingen, wie er sähe, die jungen Gemüter zu vergiften ...; daß man aber nicht fragen solle, sondern sich demütig in den höheren Willen schicken, der hier auf Erden Prüfungen auferlege, um dereinst mit himmlischer Seligkeit zu belohnen, und der am Ende alles zum besten lenke ...
Als der Redende aber die Augen des Knaben auf sich gerichtet sah, in denen deutlich stand, daß ihm nicht geglaubt wurde, wurde der Ton plötzlich ein anderer und auf einmal ein merkwürdig scharfer. Jetzt sprach er von dem bösen Geist der Zeit, dem aufrührerischen, der seine Krallen bereits nach so jungen Seelen strecke und die zarten vergifte, und er schloß mit der ernsten Ermahnung, doch abzulassen von solchen Gedanken, für die er noch nicht reif genug sei und die einem Sohn aus gutem Hause und dem Sohn eines solchen Vaters doch eigentlich fremd sein müßten ...
Während dieser ganzen Rede hatte der Knabe nur das eine Gefühl, daß dieser Mann dort vor ihm log. Log, um keine Antwort geben zu müssen. – Wollte er keine geben oder konnte er keine geben? Der Knabe wußte es nicht, aber was er jetzt wußte, das war, daß diese Menschen selbst dann nicht antworteten, wenn sie es ausdrücklich vorher versprochen hatten, und er beschloß, keinen von ihnen mehr zu fragen.
– Dieser Mann war einfach ein Wortbrüchiger und ein Lügner. Kein Wort, das er sprach, würde er ihm mehr glauben. Von einem Gott aber, an den man glauben sollte, ohne ihn zu sehen und zu begreifen, hatte er genug, und wenn es ihn je gelüsten sollte, wieder nach ihm zu fragen, würde er die Antwort sicher nicht bei denen suchen, die »Ihn und Sein Wort« lehrten, wie sie sagten, und die sich »Seine auserwählten Diener« nannten.
Kind, das er war, wußte er noch nicht, daß es nicht leicht etwas auf der Welt gab: unduldsamer, fanatischer und engherziger als ein evangelischer Geistlicher.
Seit diesem Besuch verlor er auch das letzte Interesse an diesem Religionsunterricht. Daß ihnen, die allesamt nichts oder nicht genug gelernt hatten, in einer letzten Stunde, die fast wie eine Generalprobe aussah, gesagt wurde, welche Fragen dem einzelnen vorgelegt werden würden, und die Allerfaulsten und Dümmsten fast flehentlich gebeten wurden, sich doch wenigstens die Antworten auf diese Fragen einzutrichtern – das war auch eine Lüge, die dadurch nicht besser wurde, daß sie sich alle Jahre wiederholte; und als der Tag kam, an dem sie vor dem Altar standen, war das »Ja« des Knaben kaum mehr als ein Lippen-Bewegen, das ebensogut auch »Nein« bedeuten konnte, und für ihn – und wie Ernst Förster an dem Blick des Geistlichen sah, auch noch für einen anderen – auch »Nein« bedeutete.
Wie sie zusammengekommen, gingen sie auseinander, diese Knaben: die einen hinaus in das Leben, das für sie gleichbedeutend mit Arbeit war; die anderen einstweilen noch zurück auf ihre Marterbänke.
Aus dem Kinde war ein Mensch geworden; aus dem Kinde ein Knabe.
Noch kein »voller Mensch«, denn er wurde noch nicht »für ernst« genommen, weil er nicht selbstverantwortlich, noch nicht »mündig« war.
Aber er verlangte doch schon, mitgezählt zu werden – als einer unter vielen.
Er ging in sein sechzehntes Jahr, war eingesegnet, hatte die kurzen Hosen aus- und die langen angezogen und beanspruchte mit »Sie« angeredet zu werden.
Er hatte seine erste eigene Wahl in bezug auf die Menschen getroffen: sich seine ersten Freunde gewählt und erworben und sich seine ersten Feinde gemacht; hatte seine ersten kleinen Kämpfe ausgefochten; und die ersten Blicke hinter den Vorhang getan, der ihn noch von der Bühne schied, auf der das Spiel des Lebens, das große, geheimnisvolle, vor sich ging.
Er stand da und wartete, zugelassen zu werden ... – Es wurde ihm eröffnet, daß er auf die Schule einer anderen Stadt kommen solle, da er hier offenbar nicht gut mitkäme.
In Wirklichkeit wollte man ihn aus dem Hause haben, in das er nicht paßte.
Er war weder ein guter, noch ein schlechter Schüler, und zu Hause fügte er sich längst in alles. Aber man fand, daß ihm das »notwendige Gefühl der Zusammengehörigkeit« fehle. Obwohl er nie mehr fragte und widersprach und eigentlich keinem im Wege war, sahen diese jungen Augen, hörten diese Ohren doch zu viel, und seine bloße Gegenwart wurde schon als unbequem empfunden.
Ernst begrüßte den Entschluß mit innerem Jubel. Denn in einem hatten sie recht: das Gefühl der Zusammengehörigkeit fehlte ihm.
Nun ging es hinaus in die Freiheit!
Freiheit – unter allen Worten der Sprache klang keines so süß an sein Ohr, erschien ihm keines so schön wie dieses! ...
Wir haben frei! – hieß es, wenn ihnen eine dieser drückenden Stunden geschenkt wurde und sie hinaus durften. Ferien ... im Klange so gleiches Wort: Inbegriff aller Freude und Seligkeit – frei sein vom Zwange der Schule, ihren Pflichten und Lasten, auf Tage, auf Wochen!
Frei sein! – Frei war er, wenn er an seinen »freien« Nachmittagen hinaus durfte zu seinem alten Freunde im Walde, um dort ungebunden umherzuschweifen; wenn er allein in seinem kleinen Zimmer saß, befreit von denen dort unten, sicher, daß niemand mehr kam; wenn er seine Arbeiten gemacht, die verhaßten, und sich zu den Büchern wenden durfte, die er in freier Wahl gefunden und die er schon darum liebte ...
Freiheit – es war nur ein Hauch, der ihn erst leise berührte. Aber diese Berührung war lind, wie es die seiner Mutter gewesen, die sie – und mit so seltsam verschiedener Betonung – eine »freie Frau« nannten, und die ihm gerade darum immer so groß erschienen war ...
Freiheit – der Knabe hätte nicht zu sagen gewußt, was sie war, aber er sehnte sich nach ihr, wie er sich nach der Liebkosung seiner toten Mutter sehnte.
Aus dem Kinde war ein Knabe geworden, der am Anfang seines Weges ins Leben stand.
Er betrat den langen Weg, den alle Menschen gehen, die nicht früh sterben oder die ihr Leben nicht gedankenlos herunterleben, sondern die eine innere Notwendigkeit zwingt, ihn bewußt gehen zu wollen: das Leben zu erkennen, das sie leben.
Der erste Zweifel hatte ihn ergriffen und ihm die erste, noch ungeschliffene Waffe in die noch ungeschulte Hand gelegt. Er mußte lernen, sie zu gebrauchen: sie zu schärfen an dem Stahl der Erfahrung.
Er hat den ersten Schritt auf diesem Wege der Erkenntnis getan, indem er die Menschen und Dinge nicht mehr so nimmt, wie sie sich ihm geben und zeigen, sondern indem er begonnen hat, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Er hat sein erstes, eigenes Urteil gefällt.
Seine kleinen, schwachen Fäuste pochen an die eherne, geschlossene Pforte des Lebens und begehren Einlaß.
Wie stark sie sind, diese ehernen Pforten! – und wie fest sie verschlossen scheinen! ...
Er hat den ersten selbständigen Schritt auf dem Wege der Erkenntnis getan.
Der erste Zweifel hat sich in seine junge Seele gesenkt, und als erste Frucht ist ihm eine erste Erkenntnis entsprungen.
Es ist noch keine gefestigte Erkenntnis; es ist nur die Ahnung einer solchen, aber diese Ahnung läßt sich nicht mehr beschwichtigen.
Sie sagt ihm:
daß durch die Worte und die Handlungen der Menschen ein Riß geht, ein Zwiespalt, wie zwischen Wahrheit und Lüge; daß, was die Menschen sagen, nicht immer übereinstimmt mit dem, was sie tun; daß ihre Worte oft nur gesprochen wurden, um ihre Handlungen zu verbergen und zu verhüllen; daß sie nicht so waren, wie sie schienen und scheinen wollten; und daß man ihnen daher nicht in allem unbedingt trauen durfte.
Er sagte es sich nicht mit solchen Worten. Er hatte für sich selbst noch keine Worte für diese seine ersten Erkenntnisse. Aber er fühlte, daß es so war.
Der erste Zweifel hatte sich des Knaben bemächtigt und ließ ihn nicht mehr los.
Wie ein Funke schlug er zuweilen aus diesen Augen, die so grade und offen in andere Augen und in die Welt blickten – wie ein Funke, der die künftige Flamme verhieß.
Drittes Kapitel
Der Jüngling
Inhaltsverzeichnis
Es war eine enge und niedrige Eingangspforte zu der großen und weiten Welt seines späteren Lebens, durch die der Knabe mußte, diese kleine Stadt mit ihren paar tausend Einwohnern, in ihrer trostlosen Öde und stickigen Luft.
Er kam zu einer großen Familie in Pension, erhielt sein eigenes Zimmer und war, außer in seinen Schul- und Arbeitsstunden, sein eigener Herr, der tun und lassen durfte, was er wollte; und hingehen konnte, wohin er wollte. Nur daß jedes Tun und Lassen hier natürlich unter die Augen und damit die Kritik aller anderen gestellt war, und man nirgends vor diesen Augen sicher war.
Das kümmerte den Knaben aber wenig; wenn er allein sein wollte, blieb er auf seinem Zimmer bei seinen Büchern, oder er ging weit hinaus in die Wälder.
Er war zufrieden.
Nur allein sein – Stunden haben, in denen er es mit sich sein konnte!
Und wieder begannen graue und eintönige Jahre, auf die die Schule ihren Staub legte, und schnell vergingen sie in ihren sich ewig gleichenden Tagen.
Selbst die Ferien führten ihn selten mehr in das väterliche Haus zurück. Er verbrachte sie bald so, bald so: einmal auf einer Fußreise, die er mit zusammengespartem Taschengelde unternahm (angeblich allein, in Wirklichkeit mit seinem Freunde, mit dem er sich heimlich traf); ein anderes Mal blieb er hier, in der kleinen Stadt, und die Tage wurden ihm nicht lang über seinen Sammlungen und seinen Liebhabereien; und ein drittes Mal durfte er in dem Hause seines Vaters zurückbleiben, während die ganze Familie verreist war. Da verbrachte er natürlich ganze Tage bei seinen Freunden, den Förstersleuten.
Auch die Ferien vergingen – leider – schnell.
Die neuen Mitschüler Ernst Försters setzten sich aus den verschiedensten Elementen zusammen: neben den Söhnen reichgewordener Bauern aus der Umgegend, die ihren Stolz dann suchten, ihre dickschädeligen Söhne studieren zu lassen, saßen die verzweifelter Eltern, hierher geschickt, weil sie auf der heimischen Schule nicht fortkamen, und es war eine Gesellschaft, so bunt, wie die frühere geschlossen gewesen war, aber darum gerade für den Neuangekommenen von doppeltem Interesse.
Auch die Lehrer kamen von überallher und wenigstens zwei von ihnen waren für ihn ganz neue Erscheinungen.
Der eine, der der neueren Sprachen, war das unerschöpfliche Gesprächsthema der ganzen Stadt. Hager und elegant, mit scharfgeschnittenen und müden Gesichtszügen, mochten ihn gottweißwelche Schicksale hierher verschlagen haben. Er lebte völlig für sich, in einer sagenhaften Wohnung, in der es unter anderen ein mit orientalischen Waffen und Teppichen ausgestattetes Zimmer von unerhörter Pracht geben sollte (das indessen noch nie ein fremder Fuß betreten). Jeden Sonnabend nach Schulschluß reiste er in die nächste größere Stadt, wo er bis zum Montag blieb und wo er, wie man sich schaudernd erzählte, eine Geliebte haben sollte. Eines Tages kam er nicht mehr zurück. Er hatte sich bei eben dieser Geliebten erschossen. Auf Ernst machte dieses unerhörte Ereignis, von dem man sich hier noch nach Jahren nicht erholte, einen um so größeren Eindruck, als er nur wenige Tage vorher von eben diesem Lehrer ganz gegen dessen Gewohnheit bei einer zufälligen Begegnung angeredet und in ein Gespräch gezogen war, an dessen Schluß er zu ihm mit einem Druck der wohlgepflegten Hand und einem seltsamen Lächeln gesagt hatte: »Adieu, Förster, machen Sie es besser als ich!« – eine Begegnung, die dieser nie vergaß und von der er zu keinem sprach.